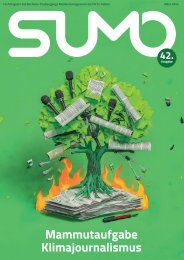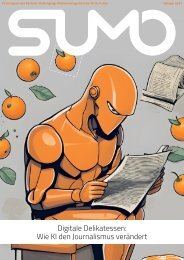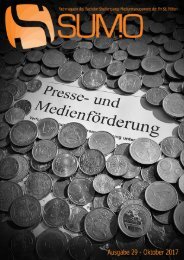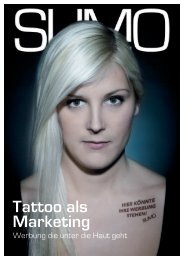SUMO #35
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fachmagazin des Bachelor Studiengangs Medienmanagement der FH St. Pölten<br />
Medien-Politik-Medien<br />
© Copyright: Ida Stabauer<br />
Ausgabe 35<br />
- Oktober 2020 -
Medienmanagement<br />
studieren heißt die<br />
Zukunft der Medien<br />
mitgestalten.<br />
Wissen, was morgen zählt.<br />
Medienmanagement<br />
· Bachelorstudium: 6 Semester<br />
· Vollzeit<br />
Schwerpunkte<br />
· Content Management<br />
· Marketing und Sales<br />
· Strategisches Management<br />
© Martin Lifka Photography<br />
2<br />
Thema<br />
Jetzt informieren:<br />
fhstp.ac.at/bmm
Inhalt<br />
» Editorial von Roland Steiner 4<br />
» Regionaljournalismus und -politik unter der Lupe von Christiane Fürst 5<br />
» Hintergrundgespräche: Verkündung von Staatsgeheimnissen? von David Pokes 9<br />
» Think Austria: des Kanzlers Denkstube von Lukas Pleyer 11<br />
» Open Data - nur die Spitze des Eisbergs? von Karin Pargfrieder 16<br />
» Medienpluralismus: Bedarf es politischer Regulierung? von Christiane Fürst 20<br />
» Pressefreiheitsgrenze - Wahrheit kann bestraft werden! von Ondrej Svatos 23<br />
» Mediales Alternativ-Bingo: Aufmerksamkeit um jeden Preis von Lukas Pleyer 27<br />
» Hate Speech und die Politik von Viktoria Strobl 31<br />
» Emotionalisierung und Dramatisierung um jeden Preis von Therese Sterniczky 33<br />
» Wenn lesen nicht selbstverständlich ist von Julia Allinger 36<br />
» Nicht nur Politiker spielen „Clash of Clans“ von Martin Möser 39<br />
» Pornografie - eine bzw. welche Gefahr für Kinder und Jugendliche? von Alexander Schuster 42<br />
» Zwischen Games und Gefahr von Julia Allinger 45<br />
» Deep Fakes: Fluch oder Fun? von Alexander Schuster 48<br />
» Digital Steuer: Endlich faire Steuern für alle? von David Pokes 51<br />
» „Zugriff verweigert“ - technischer und rechtlicher Schutz von Smart Home von Raphaela Hotarek 53<br />
» Upload-Filter: Eine Herausforderung für Türkis-Grün von Martin Möser 56<br />
» Die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks von Viktoria Strobl 58<br />
» Der milliardenschwere Kampf um Sportübertragungsrechte von Michael Geltner 61<br />
» Sollen Programmkinos gefördert werden? von Ida Stabauer 64<br />
» Die (Ohn-) Macht des Presserates von Karin Pargfrieder 66<br />
» Wenn private Daten in den Medien landen von Christina Glatz 70<br />
» Wenn MANN den Journalistinnen Chancen verwehrt von Sophie Pratschner 73<br />
© Copyright: pexels<br />
Inhalt<br />
3
Editorial<br />
Liebe Leserin, lieber Leser!<br />
„Here we are now, entertain us“, nachfolgend jedoch:<br />
„I feel stupid and contagious“ – so Kurt Cobains Refrain.<br />
Was hat „Nirvana“ mit dem Rahmenthema<br />
dieser halbrunden <strong>SUMO</strong>-Ausgabe zu tun? Mediale<br />
Unterhaltung war und ist ein Bedürfnis (vermehrt) in<br />
Krisenzeiten, der Ansteckungsgrad via Streamingdienste<br />
wird höher und bei manchen die Reflexion<br />
einer Selbstscham betreffs dieses „Binge Viewings“.<br />
Während des Lockdowns manifestierten sich jedoch<br />
auch hohe Informationsbedürfnisse, und in Demokratien<br />
dürften wir uns nicht als „stupid“ – weil genug<br />
an Aufklärungsmaterial vorhanden – oder „contagious“<br />
– weil seriöser Art – befriedigt fühlen. Dagegen<br />
aber standen bisweilen inflationäre Pressekonferenzen<br />
der Regierung, die teils ohne Fragemöglichkeit<br />
uns Direktiven transferiert haben, PR-Kampagnen<br />
derselben als indirekte Medienförderung, die Sonderförderung<br />
für die Reichweitenpotentaten, Verschleierung<br />
und Verweigerung im „Ibiza“-Ausschuss.<br />
Wenn wir den Bereich „Medienpolitik“ vor der Krise<br />
untersuchen, fällt dessen geringe Bedeutsamkeit<br />
auf: oft ging es um Boulevardsubventionen, weit<br />
weniger um Medienfreiheit und -pluralismus. Medien<br />
werden in unserer Wohlstandsdemokratie als<br />
Subsystem in gesellschaftlich „systemrelevanten“<br />
Bereichen als irrelevant eingestuft. Volkswirtschaftlich<br />
hängen weit mehr Arbeitsleistungen daran als<br />
gedacht, jedoch müssen wir uns hierzulande meist<br />
auf Zahlen aus Deutschland beziehen, da zu Österreich<br />
fehlend. Betriebswirtschaftlich hüllen sich österreichische<br />
Medienunternehmen gerne im Nebel,<br />
in Deutschland sind etliche ob ihrer Rechtsform dazu<br />
verpflichtet. Umfragen wie Quoten ergaben eine<br />
hohe Nutzung der ORF-Nachrichten, die Akzeptanz<br />
für eine Co-Finanzierung durch die Rundfunkgebühr<br />
aber stieg nicht. Dasselbe geschah den Websites von<br />
„Die Presse“ und „Der Standard“, wo die Zahlbereitschaft<br />
nicht drastisch gestiegen ist.<br />
Befunde für den Bedarf einer Umgestaltung der Medienpolitik<br />
und -förderung liegen in den jeweiligen<br />
Ministerien in der Schublade – in den jeweiligen, weil<br />
Medienpolitik analog zu „Medienbildung“ in Schulen<br />
stets „Querschnittsmaterie“ ist: also themenbezogen.<br />
Themenbezogen? Man müsse die Digitalisierung<br />
fördern (Kinder lernen mit Handys umzugehen,<br />
LehrerInnen mit Videochats, AltersheimbewohnerInnen<br />
mit sozialen Netzwerken), und überhaupt: Technik,<br />
Digger!<br />
Diese <strong>SUMO</strong>-Ausgabe hatte sich zum Wechselspiel<br />
zwischen den Systemen Medien und Politik Themen<br />
gesetzt, aber freilich hat auch uns COVID Barrieren<br />
auferlegt (u.a. dass alle Interviews telefonisch oder<br />
via Skype geführt wurden). Umso mehr gilt GRAZIE<br />
MILLE den beteiligten Studierenden des Praxislabors<br />
„Journalistisches Arbeiten“ (Print) und des Freifachs<br />
„<strong>SUMO</strong>“, die in allen Bereichen Enormes leisteten:<br />
Sie haben Artikel inklusive Interviews dennoch umgesetzt,<br />
die Selbstfinanzierung der Ausgabe via Anzeigen<br />
– in dieser Zeit! – mehr als geschafft, Distribution,<br />
Produktion (die erste Grafik als Cover in der<br />
<strong>SUMO</strong>-Geschichte!), Kommunikation usf.<br />
Sie halten die 35. Ausgabe des einzigen, durchgängig<br />
von Studierenden erstellten Medienfachmagazins in<br />
Österreich in den Händen. Dies ist in erster Linie ein<br />
Verdienst bedankter Studierenden und der Medieninhaberin<br />
FH St. Pölten. Vor allem jedoch gilt Ewald<br />
Volk Dank, der dieses Magazin rettete, förderte und<br />
vorantrieb, nunmehr bedingt durch Pensionierung<br />
(als Dozent, Betriebsrat der FH und Leiter des „Campus<br />
& City-Radio 94.4“ erhalten bleibend!) seine<br />
Leitung des Bachelor Studiengangs Medienmanagement<br />
abgab an Johanna Grüblbauer: Absolventin<br />
unseres Studiengangs, promovierte Kommunikationswissenschaftlerin,<br />
als Forscherin stv. Leiterin des<br />
Instituts für Medienwirtschaft, digital- wie print-affin.<br />
Herzlichen Dank & herzlich willkommen!<br />
Ihnen wünschen wir den besten Sommer & eine interessante<br />
<strong>SUMO</strong>-Lektüre,<br />
FH-Prof. Dr. Johanna Grüblbauer<br />
Studiengangsleiterin<br />
Bachelor Medienmanagement<br />
FH-Prof. Mag. Roland Steiner<br />
Praxislaborleiter Print<br />
Chefredakteur <strong>SUMO</strong><br />
FH-Prof. Mag. Ewald Volk<br />
Studiengangsleiter<br />
Bachelor Medienmanagement<br />
(bis 30.6.2020)<br />
© Copyright: pexels<br />
Copyright: Privat<br />
Copyright: Ulrike Wieser<br />
Copyright: Privat<br />
4<br />
Editorial
Regionaljournalismus und<br />
-politik unter der Lupe<br />
Hintergrundgespräche am Stammtisch, fehlende Kritik, Freundschaft<br />
zählt mehr als Objektivität. All das wird dem Regionaljournalismus vorgeworfen.<br />
Doch inwieweit stimmen diese Vorwürfe? Auf der Suche nach<br />
Antworten diskutierte <strong>SUMO</strong> mit Christoph Reiterer und Sandra Frank,<br />
JournalistInnen der „Niederösterreichischen Nachrichten“ (NÖN), sowie<br />
PolitikerInnen.<br />
© Copyright: adobe stock / Dragon Images<br />
Eine laue Sommernacht. Da passt ein<br />
Heurigenbesuch unter FreundInnen<br />
ganz gut ins Programm. Natürlich darf<br />
ein guter Wein nicht fehlen. Und wie es<br />
oft so ist, bespricht man beim Heurigen<br />
auch Berufliches. So auch am Tisch neben<br />
dem großen Apfelbaum. Dort sitzen<br />
zwei Männer, der Körpersprache zufolge<br />
kennen sie sich seit Längerem und sind<br />
gut befreundet. Auf den ersten Blick<br />
also nichts Besonderes. Doch während<br />
an den restlichen Tischen FreundInnen<br />
von ihren Marketingtätigkeiten, ihrer<br />
LehrerInnenfortbildung oder dem anstehenden<br />
Personalworkshop erzählen,<br />
bespricht der Tisch beim Apfelbaum politische<br />
Vorhaben und deren publizistische<br />
Veröffentlichung. Denn an diesem Tisch<br />
sitzt der Bürgermeister gemeinsam mit<br />
dem Journalisten der Regionalzeitung.<br />
Szenarios wie diese assoziieren viele<br />
Menschen mit Regionaljournalismus,<br />
ob am Stammtisch, beim Dorffest oder<br />
in den eigenen vier Wänden. RegionaljournalistInnen<br />
und -politikerInnen sind<br />
stets im regen Austausch miteinander<br />
und gut befreundet. Dass man über<br />
eine/n gute/n FreundIn nicht kritisch<br />
berichtet, versteht sich von selbst.<br />
Deswegen ist die allgemeine Berichterstattung<br />
auch eher seicht und ohne<br />
kritische Untertöne. Soweit zumindest<br />
die öffentliche Auffassung.<br />
Studie klärt auf<br />
Dieser Thematik haben sich Arnold und<br />
Wagner in ihrer 2018 erschienenen<br />
empirischen Studie „Leistungen des<br />
Lokaljournalismus“, in der 103 Lokalausgaben<br />
von deutschen Tageszeitungen<br />
und deren Online-Auftritte analysiert<br />
wurden, angenommen. Laut den<br />
Ergebnissen der Studie konnten mit<br />
Verbesserungen bei der Themenvielfalt<br />
und der Unabhängigkeit bisherige Defizite<br />
ausgelotet werden. Im Zuge dieser<br />
Änderungen sind weniger „weiche“<br />
Themen in der Lokalberichterstattung<br />
und mehr unterschiedliche Themen, in<br />
denen AkteurInnen diverser Bevölkerungsgruppen<br />
zu Wort kommen, gefunden<br />
worden. Jedoch gibt es weiterhin<br />
Problembereiche. Nach wie vor sind<br />
die Zeitungen relativ unkritisch und<br />
publizieren nur wenige kontroverse Artikel,<br />
hier fehlen kritische Kommentare<br />
über das politische Geschehen. Ebenso<br />
werden die Hintergründe nicht immer<br />
erläutert. Da meist nur Berichte und<br />
Meldungen veröffentlicht werden und<br />
sich in den Regionalzeitungen nur wenig<br />
unterhaltende Elemente wie Rätsel<br />
befinden, ist der Unterhaltungsfaktor<br />
textlich und grafisch eingeschränkt. So<br />
wird durch den fehlenden gestalterischen<br />
Aufbau die Anschlussfähigkeit –<br />
also das Ausmaß der Verständlichkeit<br />
für LeserInnen – nicht immer erfüllt.<br />
Die Partizipation kann vor allem wegen<br />
fehlenden Leserbriefen und Abstimmungsmöglichkeiten<br />
ebenfalls noch<br />
verbessert werden. Manche Defizite<br />
sind aber nicht nur auf die Professionalität<br />
der Redaktion zurückzuführen.<br />
Denn Metropolenzeitungen stehen in<br />
den Bereichen Relevanz, Themenvielfalt<br />
und Kritik besser da, was mit den<br />
Charakteristika des lokalen Kommunikationsraums<br />
zusammenhängt, weil<br />
die Metropole mehr relevante Themen<br />
als eine kleine ländliche Gemeinde<br />
hergibt.<br />
Vertrauen ist gut, Kontrolle besser<br />
Da die in Studien erforschten Probleme<br />
nicht dieselben wie die in der Praxis er-<br />
Regionaljournalismus und -politik unter der Lupe<br />
5
© Copyright: adobe stock / Aleshchenko<br />
lebten sein müssen, hat <strong>SUMO</strong> das Gespräch<br />
mit RegionaljournalistInnen mit<br />
reichlich Erfahrung gesucht und nachgefragt,<br />
wie man den Balanceakt zwischen<br />
Objektivität und Freundschaft<br />
meistern kann. Fündig geworden ist<br />
man im niederösterreichischen Weinviertel.<br />
Mit dem Chef vom Dienst der<br />
NÖN Weinviertel Christoph Reiterer<br />
und Sandra Frank, stv. Redaktionsleiterin<br />
der Redaktionen Hollabrunn und<br />
Gänserndorf, konnte man auch 21 bzw.<br />
14 Jahre Erfahrung mit vielen persönlichen<br />
Treffen, Einhaltung journalistischer<br />
Regeln und mehr oder weniger<br />
gesprächigen PolitikerInnen für ein<br />
Interview gewinnen.<br />
Laut Frank sei es wichtig, auch bei<br />
freundschaftlichen Beziehungen die<br />
journalistische Pflicht zu erfüllen und<br />
kritische Geschichten über die jeweilige<br />
Person zu schreiben. Für gute Beziehungen<br />
sei es vor allem anfangs<br />
schwierig, wenn ein/e gute/r Bekannte/r<br />
einem/r ins Gesicht lüge. Hier<br />
müsse man die Distanz haben und erkennen,<br />
dass PolitikerInnen auch nur<br />
ihren Job machen und in der Presse gut<br />
rüberkommen möchten. Sie habe auch<br />
schon erlebt, dass manche PolitikerInnen<br />
nach kritischen Berichten beleidigt<br />
waren. Das sei schwierig, weil man sich<br />
am selben oder darauffolgenden Tag<br />
öfter begegne und man dann keine oder<br />
nur wenige Antwort/en auf gestellte<br />
Fragen bekomme. Reiterer sieht es aus<br />
der Perspektive, dass PolitikerInnen<br />
durch die Berichte die Möglichkeit bekämen,<br />
sich auch zu verteidigen und<br />
die eigene Meinung zur Kritik der Opposition<br />
oder anderen abzugeben. Den<br />
LokalpolitikerInnen sei auch bewusst,<br />
dass sie eine große Angriffsfläche bieten<br />
und können deswegen Kritik auch<br />
gut einstecken, solange sie sich fair behandelt<br />
fühlen. Ferner müsse man auch<br />
als JournalistIn nicht nur austeilen, sondern<br />
auch einstecken können<br />
Beide erachten es für wichtig, trotz guter<br />
Beziehungen mit PolitikerInnen nicht<br />
„schleißig“ zu werden und die Aussagen<br />
deswegen weniger zu überprüfen. Hier<br />
könne laut Reiterer auch der Austausch<br />
in der Redaktion hilfreich sein, weil eine<br />
andere Person neue Informationen<br />
oder Erfahrungen teilen kann. Frank<br />
hält es für notwendig, Aussagen immer<br />
zu checken und auch bei freundschaftlichen<br />
Verhältnissen mehrmals nachzufragen,<br />
wenn sie etwas nicht verstehe.<br />
Das habe ihr beispielsweise bereits vor<br />
einer Wahl geholfen, um falsche Informationen<br />
eines Bürgermeisters für die<br />
LeserInnen klarzustellen. Ein einfacher<br />
Check der Landeshomepage habe gereicht,<br />
um die richtige Gesetzeslage<br />
herauszufinden, die sie dann im Bericht<br />
mit einer Infobox beigefügt habe.<br />
Im Fall, dass sich hinter den Aussagen<br />
Falschinformationen verbergen frage<br />
sie auch immer bei der Person nach,<br />
warum es denn zu dieser gekommen<br />
ist. „Es ist dann immer lustig, zu sehen,<br />
wie sie sich rausreden möchten“, lacht<br />
Frank. Ebenfalls könne man Objektivität<br />
gewährleisten, indem man Geschichten<br />
über gute Bekannte oder Verwandte an<br />
eine/n Kollegin/en abgibt, die/der dann<br />
objektiver darüber berichten kann.<br />
Selbstzensur in jeglicher Form wird von<br />
beiden JournalistInnen vehement abgelehnt.<br />
Reiterer habe immer Erfolg damit<br />
gehabt, die Situation möglichst authentisch<br />
wiederzugeben. „Wenn sich<br />
die Person darin wiederfindet, hat man<br />
schon gewonnen“, erläutert er. Frank<br />
erklärt, dass sie bei manchen KollegInnen<br />
erlebt habe, dass sie kritische Artikel<br />
vermeiden oder verharmlosen, um<br />
ja nicht anzuecken – vor allem, wenn<br />
es Personen aus der eigenen Gemeinde<br />
betrifft. Laut Frank habe man sich<br />
dann aber für den falschen Beruf entschieden.<br />
Einig sind sich die KollegInnen<br />
auch dabei, dass man selbst bei unangenehmen<br />
Themen, „etwa bei schwerwiegenden<br />
Vorwürfen“ gegen PolitikerInnen,<br />
die man bereits lange kennt,<br />
alles hinterfragen müsse.<br />
In Bezug auf die inhaltliche Tiefe der<br />
Antworten merken beide JournalistInnen,<br />
dass Nationalratsabgeordnete<br />
Schulungen hinsichtlich politischer<br />
Kommunikation erhalten haben und<br />
deswegen eher in „Politsprech“, den<br />
man auch von Regierungsmitgliedern<br />
kennt, verfallen können. Ebenfalls sei<br />
es hier manchmal schwieriger, die<br />
eigene Meinung und nicht nur die Parteimeinung<br />
zur Thematik zu erfahren.<br />
Bei PolitikerInnen auf Landesebene bemerke<br />
man zwar die Tendenz, dass es<br />
politische Schulungen gegeben habe,<br />
aber falls die Person bereits vor ihrer<br />
Funktion auf Landes- auf Gemeindeebene<br />
aktiv war, ändere sich nicht allzu<br />
viel an der inhaltlichen Tiefe der Antworten.<br />
GemeinderätInnen allerdings<br />
seien entweder sehr gesprächig und<br />
beantworten die Fragen der JournalistInnen<br />
gerne ausführlich, oder haben<br />
Angst etwas Falsches zu sagen und<br />
geben lieber gar kein Interview. Reiterer<br />
verweist in puncto Bürokratie auf ein<br />
Statement des niederösterreichischen<br />
Gemeindebundes aus 2014: „Aufgrund<br />
der immer üppiger werdenden gesetzlichen<br />
Bestimmungen wächst die Gefahr,<br />
dass die Bürgermeister ‚mit einem Bein<br />
im Kriminal stehen‘.“<br />
„Kaum Ausweichmöglichkeiten“<br />
Nachdem die Einschätzungen der JournalistInnen<br />
geklärt sind, stellt sich die<br />
Frage wie ihre GesprächspartnerInnen<br />
die Situation empfinden. Damit diese<br />
6<br />
Regionaljournalismus und -politik unter der Lupe
Frage beantwortet werden kann, hat<br />
<strong>SUMO</strong> zwei PolitikerInnen befragt. Eine<br />
ehemalige Nationalratsabgeordnete<br />
(SPÖ) und ein Altbürgermeister (ÖVP)<br />
haben ihre Eindrücke geschildert.<br />
Nina* (Anm.: Name geändert) konnte<br />
besonders während ihrer Zeit im Nationalrat<br />
viel Erfahrung mit RegionaljournalistInnen<br />
sammeln. Schwierigkeiten<br />
habe sie selbst keine bemerkt, das<br />
könne daran liegen, dass sich andere<br />
Aspekte ihres Lebens wie der Kindergarten<br />
ihrer Kinder nicht mit denen der<br />
JournalistInnen überschnitten haben.<br />
Sie habe auch den Eindruck, dass die<br />
JournalistInnen immer das Handwerk<br />
besäßen, um die notwendige Distanz<br />
zu wahren. Einflüsse wie die Blattlinie<br />
führen laut Nina eher dazu, dass es teilweise<br />
schwieriger sei, ausführlichere<br />
Berichte zu bekommen oder gar auf<br />
der Titelseite zu erscheinen. Persönliche<br />
Beziehungen haben darauf weniger<br />
Einfluss. Ebenfalls findet sie es problematisch,<br />
wenn journalistisches Handwerk<br />
nicht richtig eingesetzt wird und<br />
sie beispielsweise falsch zitiert wird.<br />
Auch die Tatsache, dass auf regionaler<br />
Ebene weniger JournalistInnen tätig<br />
sind, sei teilweise schwierig. „Wenn das<br />
persönliche Verhältnis nicht stimmt,<br />
hat man kaum Ausweichmöglichkeiten,<br />
weil dann gibt es zwei bis drei regionale<br />
Blätter in der Region und wenn<br />
man sich mit einen oder zwei [JournalistInnen]<br />
nicht versteht, dann wird es<br />
schwierig“, führt Nina weiter aus.<br />
Die ehemalige Nationalrätin versuche<br />
auch immer, ausführliche Antworten<br />
zu geben, weil sie sich als Politikerin<br />
den LeserInnen gegenüber verpflichtet<br />
fühlt, die Gründe hinter den Entscheidungen<br />
zu kommunizieren. Allerdings<br />
sei es natürlich schwieriger, sehr ausführliche<br />
Antworten zu geben, wenn<br />
es Belange betrifft, in denen Nuancen<br />
die Entscheidung ausmachen. Dennoch<br />
könne sie von sich selbst behaupten,<br />
dass sie immer die Wahrheit gesagt<br />
habe. Ärger habe sie deswegen von<br />
ihrer Partei noch nie bekommen. Denn<br />
zu entscheiden, womit man wann an<br />
welchen Personenkreis hinausgeht, liege<br />
in der Eigenverantwortung jedes/r<br />
Politikers/in.<br />
Komplett andere Erfahrungen hat der<br />
Altbürgermeister Josef* (Anm.: Name<br />
geändert) gemacht. Ihm zufolge seien<br />
die Gründe hinter Entscheidungen in<br />
Berichten nicht genügend beleuchtet<br />
worden. In der Folge sei in den Medien<br />
die Kritik der Opposition als „Aufhänger“<br />
verwendet worden, ohne die Grundlagen<br />
der Entscheidung zu erwähnen.<br />
Das führte dazu, dass er sich dazu entschloss,<br />
den JournalistInnen keine oder<br />
nur sehr wenig Auskunft zu geben. Er<br />
fordert, dass sich die Medienvertreter-<br />
Innen nicht nur auf die präsentierten<br />
Endergebnisse von Entscheidungen<br />
fokussieren sollten, sondern auch die<br />
Hintergründe der Entscheidung erfragen.<br />
„Vertrauen ist A und O“<br />
In einem Punkt sind sich alle InterviewpartnerInnen<br />
einig: Im Regionaljournalismus<br />
ist Vertrauen das allerwichtigste.<br />
„Das Vertrauensverhältnis ist A und<br />
O, aber das ist auch keine Einbahnstraße,<br />
das muss auf beiden Seiten funktionieren“,<br />
erklärt Nina. Aus diesem Grund<br />
sei die journalistische Beziehung für<br />
Josef auch keine gute gewesen. Zu selten<br />
wären JournalistInnen auch außerhalb<br />
der Gemeinderatssitzungen vor<br />
Ort gewesen und so sei kein Vertrauen<br />
entstanden. Doch wenn eine solide Vertrauensbasis<br />
geschaffen wird, können<br />
sich für beide Seiten einige Vorteile entwickeln.<br />
Deswegen müsse Nina nicht<br />
daran zweifeln, dass Meinungen, die<br />
sie offrecord abgibt, am nächsten Tag<br />
als Schlagzeile zu lesen sind. Bei guter<br />
Vertrauensbasis melde sie sich auch<br />
direkt bei JournalistInnen, wenn es ein<br />
mein allesfürmichplus<br />
mehr fernsehen, internet, telefonie & mobile, mehr ich<br />
Jetzt<br />
noch mehr Speed:<br />
500<br />
Mbit/s<br />
Alles aus<br />
einer Hand<br />
vom Komplettanbieter:<br />
+ unlimitiert surfen, streamen und gamen<br />
+ im Glasfasernetz mit bis zu 500 Mbit/s<br />
+ Festnetz-Telefonie ohne Telekom-Grundgebühr<br />
+ SIM Karten-Tarife fürs Smartphone mit kabelplusMOBILE<br />
+ mehr als 130 digitale Sender inkl. HD-TV ohne Aufpreis<br />
+ jetzt neu: zeitversetztes Fernsehen mit kabelplusMAGIC TV<br />
Gleich informieren und anmelden: 0800 800 514 / kabelplus.at<br />
Regionaljournalismus und -politik<br />
7
neues Thema mit Nachrichtenwert gibt.<br />
Solche Vertrauensdienste bestätigt<br />
Frank, denn vertrauliche Informationen<br />
werden keineswegs vorzeitig in Artikeln<br />
untergebracht. Auch Informationen,<br />
die nach einigen Weingläsern und<br />
zwischen Privatunterhaltungen durchscheinen<br />
nutze sie nicht für ihre journalistische<br />
Arbeit aus. Als Gegenleistung<br />
bekomme man meistens exklusive Informationen<br />
oder weiß als erstes von<br />
konkreten Vorhaben. In der Folge erfahre<br />
man teilweise bereits vor dem Gemeinderat<br />
von bestimmten Vorhaben,<br />
schreibe aber eben erst darüber, wenn<br />
die Freigabe der jeweiligen Person<br />
kommt. Zum Teil könne das gute Verhältnis<br />
auch dazu genutzt werden, dass<br />
sich PolitikerInnen und JournalistInnen<br />
über die Zeit der Pressekonferenz absprechen,<br />
damit sowohl PolitikerInnen<br />
als auch JournalistInnen anwesend sein<br />
können, erzählt Reiterer. Besonders auf<br />
journalistischer Seite sei die Einhaltung<br />
solcher Abmachungen wichtig, weil<br />
man im Regionaljournalismus nur eine<br />
begrenzte Anzahl an Gemeinden hat,<br />
über die man berichten kann und diese<br />
daher möglichst gut abdecken möchte.<br />
Weitere Empfehlungen<br />
Im Rahmen seiner 2017 veröffentlichten<br />
Studie mit dem Namen „Politiker<br />
und Journalisten in Interaktion“ gibt<br />
Philipp Baugut Handlungsempfehlungen<br />
für RegionalpolitikerInnen und<br />
-journalistInnen, von denen einige sich<br />
mit den beschriebenen Maßnahmen<br />
aus der Praxis überschneiden. Zu diesen<br />
zählt die besondere Wichtigkeit<br />
der Diskretion bei Hintergrundgesprächen.<br />
Demnach sollen Medien Hintergrundgespräche<br />
nicht für kurzfristige<br />
Wettbewerbsvorteile nutzen und stets<br />
die Hintergedanken der PolitikerInnen<br />
hinterfragen. Bei einem weiteren bereits<br />
angesprochenen Bereich – den<br />
Ratssitzungen – müssen BürgermeisterInnen<br />
dafür sorgen, dass diese von<br />
politischen AkteurInnen nicht als Bühne<br />
zur Selbstinszenierung verwendet<br />
werden. Damit die PolitikerInnen auch<br />
ohne diese Möglichkeit sich selbst profilieren<br />
können, sollen JournalistInnen<br />
ihnen außerhalb von Ratssitzungen<br />
ausreichend Raum dafür geben. In Hinblick<br />
auf Exklusivinformationen sollten<br />
PolitikerInnen nicht permanent ein Medi-um<br />
bevorzugen und die Relevanz der<br />
Informationen zu überprüfen, indem<br />
man die Perspektive der BürgerInnen<br />
einnimmt. Auf journalistischer Seite<br />
müsse immer hinterfragt werden, ob<br />
es für die LeserInnen besonders wichtig<br />
ist, ein Thema exklusiv zu veröffentlichen.<br />
MedienvertreterInnen sollte auch<br />
bewusst sein, dass die Darstellung von<br />
Politik durch ihre mediale Präsenz beeinflusst<br />
wird. Denn durch ihre Berichterstattung<br />
werden Anreize für politische<br />
Binnenkommunikation gegeben.<br />
Im Falle von bewusst provozierenden<br />
Artikeln sollten PolitikerInnen diese<br />
nicht persönlich nehmen, sondern mit<br />
ihrer politischen Tätigkeit in Verbindung<br />
setzen. Für JournalistInnen gilt: Wenn<br />
die Substanz der Politik beeinflusst<br />
werden soll, muss eine politische Kommunikationskultur,<br />
die besonders von<br />
Nähe, Konflikten und Nicht-Öffentlichkeit<br />
geprägt ist, angestrebt werden.<br />
von Christiane Fürst<br />
© Copyright: adobe stock / Björn<br />
Sandra Frank / Copyright: Franz Enzmann<br />
Christoph Reiterer / Copyright: Erich Marschik<br />
8<br />
Regionaljournalismus und -politik unter der Lupe
Hintergrundgespräche:<br />
Verkündung von Staatsgeheimnissen?<br />
Sebastian Kurz sorgte im Februar dieses Jahres für Aufsehen, als er in<br />
einem Hintergrundgespräch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft<br />
scharf kritisierte und in diesem Zusammenhang von „roten<br />
Netzwerken“ innerhalb dieser Organisation redete. <strong>SUMO</strong> sprach mit<br />
Florian Beißwanger, deutscher Journalist und Autor des Buches „Hintergrundgespräche:<br />
Konsensuales Geheimnis-Management im Mediensystem<br />
des digitalen Zeitalters“, sowie mit Gernot Bauer, Journalist bei der<br />
Wochenzeitung „Profil“, über die Sinnhaftigkeit von Hintergrundgesprächen,<br />
die Einhaltung von Regeln und Vertrauen.<br />
© Copyright adobe stock / Atstock Productions<br />
Hintergrundgespräche gibt es seit vielen<br />
Jahren und sind aus dem heutigen<br />
Zusammenspiel zwischen Politik und<br />
Medien nicht mehr wegzudenken. Dabei<br />
sollen PolitikerInnen in vertrautem<br />
Rahmen bestimmte Einschätzungen und<br />
Standpunkte näher erläutern. KritikerInnen<br />
befürchten jedoch, dass in diesen<br />
Gesprächen vertrauliche Geheimnisse<br />
ausgetauscht werden. Strenge Regeln,<br />
die von allen beteiligten AkteurInnen einzuhalten<br />
sind existieren. Was geschieht<br />
jedoch, wenn aus einem als vertraulich<br />
gekennzeichneten Hintergrundgespräch<br />
trotzdem Informationen an die Öffentlichkeit<br />
gelangen?<br />
Ohne Vertrauen keine Hintergrundgespräche<br />
„Die wichtigste Grundlage in Hintergrundgesprächen<br />
ist das Vertrauen“,<br />
sind sich Florian Beißwanger und Gernot<br />
Bauer einig. Die TeilnehmerInnen sollten<br />
sich stets an die vereinbarten Regeln<br />
halten, denn wird gegen diese Regeln<br />
der Vertraulichkeit verstoßen, würde<br />
das „Instrument“ Hintergrundgespräch<br />
beschädigt werden, so Beißwanger. Es<br />
käme immer wieder vor, dass eigentlich<br />
vertrauliche Informationen aus Hintergrundgesprächen<br />
an die Öffentlichkeit<br />
gelangen, was dazu führe, dass es für<br />
JournalistInnen immer schwieriger würde,<br />
wirklich Interessantes in solchen<br />
vertraulichen Gesprächen zu erfahren,<br />
so Beißwanger weiter. Ähnlich sieht das<br />
Bauer, der die Vorteile von Hintergrundgesprächen<br />
nennt. Seine persönlichen<br />
Erfahrungen seien durchwegs positiv,<br />
da PolitikerInnen dadurch „ungezwungen<br />
und frisch von der Leber weg“ über<br />
bestimmte Themen sprechen könnten.<br />
Sobald Notizen gemacht werden oder<br />
das Gespräch aufgezeichnet wird, würden<br />
sich die meisten PolitikerInnen verschließen.<br />
Keine Staatsgeheimnisse<br />
„Man muss sich davon lösen, dass Hintergrundgespräche<br />
streng geheime<br />
Treffen sind, bei denen über Staatsgeheimnisse<br />
geplaudert wird“, gibt Bauer<br />
zu bedenken. Vielmehr würde es um<br />
Einschätzungen und genauere Erklärungen<br />
zu bestimmten Sachthemen gehen.<br />
„Wirklich spannende Informationen erfährt<br />
man wenn, dann nur unter vier<br />
oder sechs Augen“ und diese Art der Informationsmitteilung<br />
sei meistens nicht<br />
geplant und würde in einem schnellen,<br />
spontanen Telefonat geschehen. Daher<br />
seien die meisten Hintergrundgespräche<br />
konstruktiv und ohne dass tatsächliche<br />
Staatsgeheimnisse ausgeplaudert<br />
werden würden. Bießwanger sagt, dass<br />
Neid und Missgunst unter KollegInnen in<br />
der Politik in der Politik oft stattfänden<br />
und ergänzt: „Gelegentlich lästern PolitikerInnen<br />
in Hintergrundgesprächen,<br />
was sie jedoch nicht tun sollten, da es<br />
ein schlechtes Licht auf sie wirft und es<br />
meist doch herauskommt.“ Laut Bauer<br />
würden Kritikäußerungen gegenüber<br />
anderen PolitikerInnen nicht oft vorkommen.<br />
Dass „ein/e PolitikerIn eine/n<br />
andere/n PolitikerIn so richtig vom Leder<br />
zieht, habe ich noch nie erlebt“, das<br />
sei eine absolute Ausnahme. Früher<br />
konnte es durchaus vorkommen, dass<br />
Gespräche zwischen PolitikerInnen und<br />
JournalistInnen bei Klausuren an der Bar<br />
stattfanden, bei denen es zu Unmutsäußerungen<br />
kam. Wobei dann eher über die<br />
eigenen „ParteifreundInnen“ geschimpft<br />
Hintergrundgespräche: Verkündung von Staatsgeheimnissen?<br />
9
wurde, und selbst das sei schon lange<br />
her. Mittlerweile seien alle PolitikerInnen<br />
professionell und würden wissen,<br />
worüber sie zu sprechen haben und worüber<br />
besser nicht, berichtet Bauer.<br />
Spielregeln festlegen<br />
Um späteren Missverständnissen vorzubeugen,<br />
sei es wichtig, die Spielregeln im<br />
Vorhinein klar festzulegen, erzählt Bauer.<br />
Dabei gelten in Deutschland folgende<br />
drei Regeln, wie Beißwanger erklärt:<br />
„Unter eins“ heißt, dass der/die Journalist/in<br />
über den genannten Inhalt des<br />
Gesprächs berichten und auch die Quelle<br />
nennen dürfe. Bei der Regel „Unter zwei“<br />
darf die Quelle nicht genannt, sondern<br />
lediglich umschrieben werden, wobei<br />
der Inhalt des Gesprächs sehr wohl veröffentlicht<br />
werden dürfe. Ein Beispiel:<br />
Sebastian Kurz äußert sich negativ über<br />
seinen grünen Koalitionspartner, da er<br />
mit der Regierungsarbeit der grünen<br />
MinisterInnen unzufrieden ist. JournalistInnen<br />
dürften dann etwa so darüber<br />
schreiben: „Aus ÖVP-Regierungskreisen<br />
ist zu vernehmen, dass man derzeit nicht<br />
sonderlich zufrieden über die Arbeit der<br />
grünen MinisterInnen im Kabinett ist.“<br />
Damit ist der/die QuellengeberIn geschützt,<br />
der Informationsinhalt erscheint<br />
jedoch in den Medien. Die Regelung<br />
„Unter drei“ besagt, dass über die besprochenen<br />
Inhalte nicht berichtet werden<br />
dürfe. Diese Informationen würden<br />
lediglich dem näheren Verständnis der<br />
JournalistInnen dienen. Laut Bauer sei<br />
im Einzelfall festzulegen, welche Regel<br />
für welches Hintergrundgespräch gilt. So<br />
bald Notizen gemacht werden oder Notizblöcke<br />
vor Ort aufliegen, sei es nicht<br />
mehr wirklich ein Hintergrundgespräch,<br />
sondern „semioffiziell“.<br />
Das Nähe-Distanz-Problem<br />
Dass es bei derart vertraulichen Gesprächen<br />
vor allem in kleinerem Rahmen zu<br />
einer Annäherung zwischen PolitikerIn<br />
und JournalistIn kommt, ist unumgänglich.<br />
Laut Florian Beißwanger sollte<br />
es zumindest in Deutschland so sein,<br />
dass „jede/r PolitikerIn ungefähr sieben<br />
so genannte ‚Vertrauensjournalist-<br />
Innen‘ hat, mit denen er/sie in einem engen<br />
Austausch steckt.“ Dieses Verhältnis<br />
sei wichtig, damit er/sie diese dementsprechend<br />
„bedienen“, also mit Informationen<br />
versorgen kann. Man könne,<br />
wenn man die Medien näher beobachtet,<br />
sehr gut erkennen, welche/r JournalistIn<br />
über welche/n PolitikerIn berichtet. Ganz<br />
anders sieht das Gernot Bauer. „Die Zeit<br />
der großen Nähe ist vorbei und ‚‚Verhaberung‘<br />
im Ausmaß wie früher gibt es<br />
nicht mehr.“ Nicht einmal bei JournalistInnen,<br />
die bereits lange in der Medienbranche<br />
tätig sind. Beide Seiten wären<br />
in den letzten Jahren professioneller<br />
geworden und hielten mehr Distanz, so<br />
Bauer und erläutert weiter: „Vertrauen<br />
ist keine Sache der ‚‚Verhaberung‘.<br />
Vertrauen entsteht durch Erfahrung.“<br />
Amsterdamer Frühstücksaffäre<br />
Das wohl berühmteste Beispiel, bei denen<br />
Informationen eines Hintergrund-<br />
gespräches veröffentlicht wurden, war<br />
die „Amsterdamer Frühstücksaffäre“<br />
mit dem ehemaligen Außenminister<br />
Wolfgang Schüssel. Dabei bezeichnete<br />
Schüssel den damaligen deutschen<br />
Bundesbankpräsidenten Hans Tietmeyer<br />
bei einem Hintergrundgespräch<br />
mit österreichischen JournalistInnen in<br />
Amsterdam als „richtige Sau“. „Was genau<br />
Schüssel mit dieser Aussage meinte,<br />
ist immer noch unklar“, sagt Bauer.<br />
Dabei handelte es sich laut ihm um ein<br />
tatsächliches Hintergrundgespräch, bei<br />
dem Schüssel seine persönliche Sicht<br />
der Dinge offenbarte. Über Umwege seien<br />
diese Informationen schließlich an die<br />
Öffentlichkeit gelangt.<br />
Hintergrundcharakter gehr verloren<br />
Auf die weitere Entwicklung von Hintergrundgesprächen<br />
angesprochen, erzählt<br />
Bauer, dass sie „in der jetzigen institutionalisierten<br />
und formalisierten Form“<br />
weiter bestehen werden. Womöglich<br />
wird der Hintergrundcharakter verlorengehen<br />
und mehr in Richtung einer Pressekonferenz<br />
wandern. Wie sich Hintergrundgespräche<br />
in Zukunft entwickeln,<br />
würde aber auch an den politischen AkteurInnen<br />
selbst liegen. Ob diese Art von<br />
Gesprächen dann überhaupt von MedienvertreterInnen<br />
angenommen wird,<br />
sei eine andere Frage, gibt Bauer an, der<br />
sich ebenso gut vorstellen könnte, dass<br />
in Zukunft auch BloggerInnen zu Hintergrundgesprächen<br />
eingeladen werden.<br />
von David Pokes<br />
Florian Beißwanger / Copyright: Privat<br />
Gernot Bauer / Copyright: Alexander Unger<br />
© Copyright: adobe stick / Art Lucas<br />
10<br />
Hintergrundgespräche: Verkündung von Staatsgeheimnissen?
Think Austria: des Kanzlers<br />
Denkstube<br />
Think Tank: ein Begriff, der in den letzten Jahren durch die mediale Berichterstattung<br />
häufig zu hören war. Neben der „Agenda Austria“ und<br />
Straches gescheiterten Projekt „Denk zukunftsreich“ wurde ebenfalls<br />
über die Stabstelle „Think Austria“ berichtet. Nur, was versteht man unter<br />
einem Think Tank und warum sollte man diese kritisch hinterfragen?<br />
<strong>SUMO</strong> sprach darüber mit Bruno Rossmann, dem ehemaligen Nationalratsabgeordneten<br />
und Klubobmann der Liste Jetzt, und Edward Strasser,<br />
Mitgründer & CEO des Innovation in Politics Institute.<br />
7. April 2020: Lockdown Österreich.<br />
Homeoffice im Pyjama und schnell gekochte<br />
Pasta. Ein Alltag, den meist nur<br />
StudentInnen kennen, gilt nun für sehr<br />
viele in Österreich. Um weiterarbeiten<br />
zu können, wäre ein Kaffee ganz gut.<br />
Gesagt getan, aufgegossen und vorsichtig<br />
daran geschlürft. Just in dem<br />
Moment klingelt das Handy: Bruno<br />
Rossmann – der erhoffte Rückruf.<br />
Warum? Parlamentarische Anfragen:<br />
insgesamt drei wurden zum Kanzler-<br />
Projekt „Think Austria“ eingereicht.<br />
Zwei von Claudia Gamon (NEOS) unter<br />
Türkis-Blau, die dritte und letzte von<br />
Bruno Rossmann (Liste Jetzt) in Zeiten<br />
der Expertenregierung. Der Grund:<br />
Kanzlerin Bierlein machte kurzen Prozess<br />
und löste am 11. Juni 2019 das<br />
Projekt „Think Austria“ auf.<br />
Think Austria II – auf ein Neues<br />
Mit der Verabschiedung durch die Kanzlerin<br />
war es aber nicht vorbei. Im Rahmen<br />
der Evaluierung und Neuorganisation<br />
wurde dem Projekt „Think Austria“<br />
der Stecker gezogen, während andere<br />
Stabstellen des Bundeskanzleramts<br />
überlebten. Am 21. Jänner wurde durch<br />
den „Standard“ bekannt, dass es damit<br />
nicht erledigt war: Bundeskanzler Kurz<br />
schickt „Think Austria“ in die zweite<br />
Runde. Am 7. April, glücklicherweise vor<br />
dem Interview mit Bruno Rossmann,<br />
veröffentlichte „Der Standard“ eine<br />
weitere Meldung, die indirekt mit dem<br />
Projekt zusammenhängt: „Kurz-Beraterin<br />
Antonella Mei-Pochtler wird mit<br />
13. April als Mitglied des Aufsichtsrats<br />
der ProSiebenSat.1 Media SE bestellt.“<br />
Ehrenamtliche Leiterin von „Think Austria“<br />
und nun Aufsichtsrätin eines privaten<br />
deutschen Medienkonzerns, kann<br />
dies zu Interessenskonflikten führen?<br />
„Selbstverständlich!“, so Rossmann im<br />
Gespräch mit <strong>SUMO</strong>. „Das war ja damals<br />
auch so. Frau Mei-Pochtler agiert<br />
nicht wertefrei irgendwo im Raum,<br />
sondern sie geht ebenfalls einer beruflichen<br />
Tätigkeit nach und das hat Ein-<br />
fluss auf ihre Geschäftstätigkeit. Daher<br />
entstehen schon Interessenskonflikte.<br />
Entweder mache ich das eine oder das<br />
andere, aber eine Mischung aus beiden<br />
ist politisch ungesund“, erläutert<br />
der einstige Klubchef weiter. Laut dem<br />
Bundeskanzler und Mei-Pochtler dient<br />
die Stabstelle dem Entwickeln von<br />
mittel- bis langfristigen Analysen und<br />
Konzepten für Österreich. Themenfelder<br />
wie „Neue Wettbewerbsfähigkeit“,<br />
„Neue Leistung und Verantwortung“<br />
und „Neue Identität“ wurden hierfür<br />
gewählt. Auch der Weltraum war beim<br />
ersten Anlauf ein wichtiges Thema.<br />
Laut dem Kanzler ist das Einrichten so<br />
einer Stabstelle mittlerweile üblich. Edward<br />
Strasser, Leiter des Innovations<br />
in Politics Institute, stimmt dem zu.<br />
Sein Institut arbeite häufig mit solchen<br />
Stabstellen zusammen, um gemeinsam<br />
politische, zukunftsorientierte,<br />
prodemokratische und proeuropäische<br />
Lösungen zu erarbeiten. „Die Politik<br />
versinkt in der Tagesarbeit“, fährt der Institutsgründer<br />
fort: „Somit stellt sich die<br />
Frage, wo man die Programme, seien es<br />
Arbeitsmarkt- oder Sozialprogramme,<br />
langfristig so umstellen und verbessern<br />
muss, damit diese wirksamer werden.<br />
Für diese Fragen ist in der Alltagsarbeit<br />
keine Zeit mehr.“ Auch Rossmann sieht<br />
die Grundidee einer solchen Stabstelle,<br />
die direkt im Bundeskanzleramt eingerichtet<br />
ist, grundsätzlich als sinnvoll an.<br />
Damit könne man sehr gute strategisch<br />
politische Entscheidungen vorbereiten,<br />
und dagegen sei nichts einzuwenden.<br />
Think Tank oder nicht?<br />
Nicht nur die Pläne der Regierung konnten<br />
ob der „Ibiza-Affäre“ und deren Folgen<br />
nicht umgesetzt werden, sondern<br />
auch die geplanten Publikationen von<br />
„Think Austria“. Durch die Auflösung fiel<br />
ebenfalls das geplante Zusammentreffen<br />
des Sounding Boards am 18. Juni<br />
2019 flach. Im Zuge dessen hätte ein<br />
erster Zwischenstand der geplanten<br />
Publikationen intern evaluiert werden<br />
© Copyright: adobe stick / REDPIXEL<br />
Think Austria: des Kanzlers Denkstube<br />
11
sollen. Darf man sich durch den erneuten<br />
Anlauf der Stabstelle etwas aus der<br />
Vergangenheit erwarten? Rossmann<br />
trocken dazu: „Nein, da kommt sicher<br />
nichts mehr. Das ist ad acta gelegt.“ Und<br />
von der wieder eingesetzten Stabstelle?<br />
„Von der neuen erwarte ich mir ein<br />
klares Konzept: Was wollen wir machen?<br />
Da erwarte ich mir eine gewisse<br />
Öffentlichkeit und eine Offenlegung der<br />
Ergebnisse. Wenn das wieder nur in der<br />
Reisetätigkeit von Frau Mei-Pochtler<br />
und dem Herrn Bundeskanzler besteht,<br />
dann ist mir das zu wenig. Gerade nach<br />
dem Lockdown als Folge von Covid-19<br />
und den damit verbundenen vielfältigen<br />
Folgen erwarte ich mir systemische<br />
Lösungsansätze. Klare Vorgaben, klare<br />
Aufgabengebiete und dann eine möglichst<br />
transparente Darlegung der Ergebnisse“.<br />
Rossmann unterstreicht im Interview<br />
klar und deutlich seine Skepsis an dem<br />
Kanzler‘schen „Think Tank“-Projekt.<br />
Dieses wurde von Medien wie dem<br />
„Standard“ oder der „Presse“ als Think<br />
Tank bezeichnet. Der Kanzler selbst<br />
allerdings hat „Think Austria“ in seinen<br />
parlamentarischen Antworten, sowie<br />
auf der Website des Projekts, nie als<br />
Think Tank bezeichnet. Auch Rossmann<br />
sieht „Think Austria“ nicht als Think<br />
Tank, sondern – so wie eben der Kanzler<br />
selbst – als Stabstelle für Strategie,<br />
Analyse und Planung. Also kein Think<br />
Tank? Laut Rossmann war es keiner,<br />
allerdings betont er ebenfalls, dass<br />
dies eine Wortsklaverei sei. Auch für<br />
Strasser sei vollkommen unerheblich,<br />
wie es bezeichnet wird. Wichtig sei die<br />
Frage: Was macht es?<br />
Die fehlende Transparenz<br />
Für Bruno Rossmann war dies allerdings<br />
vollkommen unklar, ebenso wie<br />
dessen Aufgaben aussahen und welchen<br />
öffentlichen Mehrwert es bringen<br />
hätte sollen. „Immerhin sind das öffentliche<br />
Gelder, die hier für Studienzwecke<br />
verwendet werden und dazu braucht es<br />
nicht einmal das Auskunftsgesetz. Das<br />
ist offenzulegen. Basta“, so Rossmann.<br />
„Da geht es ja nicht um Geheimnisse<br />
der Republik, sondern um Ergebnisse,<br />
die von einem Minister oder einer Ministerin<br />
in Auftrag gegeben wurden.<br />
An die Oberfläche damit!“ KritikerInnen<br />
würden sagen, dass es an Transparenz<br />
mangelte, doch der ehemalige Klubchef<br />
der Liste Jetzt stellt eines klar: „Es<br />
war überhaupt keine Transparenz vorhanden.<br />
Kein Mensch hat gewusst, was<br />
Frau Mei-Pochtler und diese Stabstelle<br />
machen.“ Neben der als nicht vorhanden<br />
empfundenen Transparenz der<br />
Stabstelle ist Rossmann ebenfalls der<br />
Meinung, dass es für internationale<br />
Benchmark-Vergleiche keine eigene<br />
Stabstelle brauche.<br />
Laut der Antwort des Bundeskanzlers<br />
auf die parlamentarischen Anfrage Nr.<br />
1587/J von Claudia Gamon (NEOS) diene<br />
die Stabstelle dem reinen Wissensmanagement.<br />
Bei „Think Austria“ sollte<br />
keine akademische Forschung durchgeführt,<br />
sondern die Nutzung schon vorhandener<br />
Studien und Arbeiten in den<br />
Vordergrund gestellt werden. Ebenfalls<br />
hieß es, dass der Input der Stabstelle<br />
laufend in interne Hintergrundinformationen<br />
und Vorbereitungen mit eingeflossen<br />
sei. In der Antwort auf die Anfrage<br />
Nr. 2388/J, ebenfalls von Gamon<br />
eingebracht, hieß es allerdings, dass<br />
bei der Bündelung des Wissens, sowie<br />
die Vernetzung mit Stakeholdern, die<br />
Arbeit des Kanzlers sowie dessen Ressorts<br />
an erster Stelle stehen. Je nach<br />
Bedarf gäbe es dann ebenfalls Veröffentlichungen.<br />
Sein Ressort und seine Stabstelle: zum<br />
Teil besetzt ohne Ausschreibung nach<br />
§20 Abs. 1 des Ausschreibungsgesetzes<br />
mit Personen aus der Jungen ÖVP<br />
Think Tanks sind Organisationen für öffentlich-politische Forschungsanalyse und<br />
Engagement, die im Bereich nationaler und internationaler Fragen politikorientierte<br />
Forschungen, Analysen und Ratschläge erarbeiten. Sie ermöglichen sowohl<br />
politischen EntscheidungsträgerInnen als auch den BürgerInnen informierte Entscheidungen<br />
über die öffentliche Politik zu treffen. Think Tanks können einerseits<br />
politisch integrierte, andererseits unabhängige Institutionen sein. Dabei sollten<br />
diese Institutionen als permanente Instanz vorhanden sein und nicht in Form einer<br />
Ad-Hoc Kommission agieren und gegründet werden. Sie fungieren als Brücke<br />
zwischen den akademisch wissenschaftlichen und den politischen Gruppen sowie<br />
zwischen dem Staat und dessen BürgerInnen. Think Tanks dienen dem öffentlichen<br />
Interesse als unabhängige Stimme, die Angewandte- sowie Grundlagenforschung<br />
in eine Sprache übersetzten, die verständlich, zuverlässig und für politische EntscheidungsträgerInnen<br />
und die Öffentlichkeit zugänglich ist. (Vom Autor übersetzt<br />
aus: „2019 Global Go To Think Tank Index Report”)<br />
12<br />
Think Austria: des Kanzlers Denkstube
© Copyright: adobe stick / motortion<br />
(JVP). Diese Tatsache hat dem einstigen<br />
Nationalratsabgeordneten übel aufgestoßen:<br />
„Das hat mich extrem gestört.<br />
Die Vermischung einerseits von Parteipolitik<br />
und andererseits einem der<br />
Verwaltungsapparat. Wenn das parteipolitische<br />
Agenden sind, die hier abgearbeitet<br />
werden, dann soll das bitte<br />
in der Partei stattfinden, aber nicht im<br />
Kanzleramt. Parteipolitik hat in einer<br />
Verwaltung nichts verloren und dazu<br />
zählt ebenfalls das Bundeskanzleramt.“<br />
Entscheidende Faktoren<br />
Im Punkt Transparenz sind sich der CEO<br />
des Innovations in Politics Institutes sowie<br />
der einstige Abgeordnete der Liste<br />
Jetzt einig: sie sei essentiell. Der Grund<br />
dafür sei simpel: Ideologiefreies Arbeiten<br />
gebe es nicht. „Es steht immer ein<br />
gewisses Interesse dahinter, wichtig ist<br />
die Transparenz!“, so Strasser. Laut ihm<br />
seien mehrere Fragen entscheidend:<br />
Woher kommt das Geld? Welches Interesse<br />
ist damit verbunden? Wie wird es<br />
offengelegt? „Dies gilt auch für die Parteienfinanzierung.<br />
Wenn politische Parteien<br />
Geld annehmen, dann ist es wichtig,<br />
dass offengelegt wird, woher dieses<br />
Geld kommt. Wenn man weiß, woher<br />
es kommt, dann weiß man auch, was<br />
es bewirken soll“, fährt Strasser fort.<br />
Dies gelte auch für die Beurteilung der<br />
jeweiligen veröffentlichten Arbeiten.<br />
„Think Tanks, die eigentlich Pressure<br />
Groups (Anm.: Lobbyverbände) sind,<br />
führen zu einer verzerrten Wahrnehmung<br />
des Begriffs und außerdem dazu,<br />
dass man die Objektivität der Informationen,<br />
die von dort kommen, in Zweifel<br />
ziehen muss“, erklärt der Institutsleiter.<br />
Für Rossmann sei ein weiterer Aspekt<br />
bei der Gestaltung einer Stabstelle bzw.<br />
eines Think Tanks wesentlich, nämlich<br />
die breite Diskussion grundsätzlicher<br />
und wichtiger Themenstellungen, bei<br />
denen möglichst viele unabhängige<br />
ExpertInnen mit unterschiedlichen Meinungen<br />
involviert werden – im nationalen<br />
sowie internationalen Kontext. „Das<br />
erachte ich für sinnvoll, aber es kann ja<br />
nicht sein, dass dann wieder frisch weg<br />
irgendwelche ‚Lieblinge‘ des Herrn Kurz<br />
oder nur einseitige Wissenschaftler-<br />
Innen, die dem Bundeskanzler angenehm<br />
sind, involviert werden“, so<br />
der ehemalige Klubchef. Die daraus<br />
entstandenen Arbeiten sollten<br />
als Entscheidungsgrundlage für die<br />
Politik zur Verfügung stehen. Laut<br />
Rossmann sei dies bei „Think Austria“<br />
allerdings nicht der Fall gewesen.<br />
Auf die Frage, ob externe Unabhängige<br />
zu bevorzugen sind, stellt Strasser eines<br />
klar: „So etwas gibt es nicht, es gibt keine<br />
unabhängige Instanz. Zeigen Sie mir<br />
in Österreich eine unabhängige externe<br />
Instanz und ich schenke ihnen eine<br />
Flasche Wein. Es steht immer ein Interesse<br />
dahinter und das ist auch gut so!“<br />
Diese immer vorhandene Wertehaltung<br />
sieht der Institutsleiter bei der Gründung<br />
einer solchen Gruppe als entscheidende<br />
Basis. „Man sucht sich, wenn man eine<br />
Gruppe bildet, mit der man gemeinsam<br />
etwas erreichen will, immer Leute, die<br />
der eigenen Werthaltung nahestehen,<br />
dann muss man nämlich nicht ständig<br />
über Werthaltungsfragen diskutieren.<br />
Aus meiner Sicht ist das ein durchaus<br />
menschlicher und nachvollziehbarer Vorgang“.<br />
Steigende mediale Präsenz<br />
Für Edward Strasser und dessen Institut,<br />
das sich nicht als Think Tank sieht –<br />
allerdings laut dem „Global Go To Think<br />
Tank Index Report 2019“ der University<br />
of Pennsylvania zu den „Top Think<br />
Tanks in Western Europe“ gehört –<br />
nahm die mediale Präsenz vieler kleiner<br />
Think Tanks in den letzten Jahren deutlich<br />
zu. Abgesehen von den Gewerkschaften<br />
und der Arbeiterkammer, die<br />
Interessensvertretung und Think Tank<br />
in einem und immer sehr präsent sind,<br />
war dies in der Vergangenheit nicht der<br />
Fall. Welcher sich am häufigsten medial<br />
zu Wort melde, könne der Institutsleiter<br />
nicht sagen. Bruno Rossmann hat hier<br />
einen klareren Eindruck: Die „Agenda<br />
Austria“ zeige sich am meisten, im Gegensatz<br />
zum „Momentum Institut“, das<br />
allerdings erst 2019 gegründet wurde<br />
und einen guten Start hingelegt hat.<br />
„Agenda Austria“ wurde 2013 gegründet<br />
und deren Leiter scheint bei dem<br />
ehemaligen Nationalratsabgeordneten<br />
Eindruck hinterlassen zu haben: Die<br />
‚‚Agenda Austria‘ hat schon eine große<br />
Bedeutung, das ist allerdings ein Lobbyist.<br />
Die aber ich würde ich sie nicht<br />
als Think Tank bezeichnen, sondern als<br />
Lobbyistenverein. Im Gegensatz zum<br />
‚Momentum Institut‘, bei dem ich schon<br />
den Eindruck habe, dass hier – wenn<br />
auch unter bestimmter ideologischer<br />
Sichtweise – bestimmte wirtschaftlich,<br />
sozial und ökologisch relevante Arbeiten<br />
Inhalte aufbereitet gemacht werden.<br />
Die ‚‚Agenda Austria‘ im Gegensatz<br />
dazu lobbyiert im Wesentlichen für die<br />
Wirtschaft und Industrie. Der Leiter ist<br />
ja eigentlich ein Journalist (Anm.: Franz<br />
Schellhorn, vormals ‚‚Die Presse‘), der<br />
nun seine erarbeiteten Netzwerke dafür<br />
nutzt, um seine Ideen und seine<br />
Ideologien an den Mann und an die Frau<br />
zu bringen.“<br />
Auch „Think Austria“ war häufig in den<br />
Medien. Zu Beginn des ersten Anlaufs<br />
wurde über Berater wie Ban Ki-moon<br />
Think Austria: des Kanzlers Denkstube Thema<br />
13
erichtet, allerdings sieht hier Rossmann<br />
den Austausch von Ideen und<br />
Ratschlägen und weniger eine ersthafte<br />
beratende Tätigkeit. Internationale Expertise<br />
für nationale Themen sei durchaus<br />
sinnvoll, als Beispiel nannte er den<br />
Expertisen-Austausch der Arbeiterkammer<br />
mit dem französischen Ökonomen<br />
Thomas Piketty. „Die Ideen solcher<br />
Leute sind da eben gefragt, die die<br />
Verteilungspolitik im Fokus haben“, so<br />
Rossmann. Edward Strasser ist diesbezüglich<br />
derselben Auffassung. Anhand<br />
des Beispiels Künstliche Intelligenz (KI)<br />
erklärte er seinen Standpunkt: „Wir<br />
wissen mittlerweile, dass KI weite Teile,<br />
nicht nur der Arbeitswelt, sondern auch<br />
der Verwaltungs- und Regierungsarbeit<br />
verändern wird. Aber das ist in Österreich<br />
genauso wie in Deutschland und<br />
der Schweiz sowie auch in Bulgarien<br />
und Finnland. Es ist daher notwendig,<br />
sinnvoll und steuergeldersparend, auf<br />
ExpertInnen in anderen Ländern zuzugreifen.<br />
Weil in anderen Ländern<br />
bereits Erfahrungen gemacht und gesammelt<br />
wurden, die wir noch nicht<br />
haben und umgekehrt.“ Laut Strasser<br />
sei der Know-how-Transfer von hoher<br />
Bedeutung, da das Ausprobieren von<br />
neuen Techniken oder Prozessen Zeit<br />
und Geld fresse. Daher sei damit immer<br />
ein großes Risiko verbunden, weil<br />
Steuergelder möglicherweise in erfolglose<br />
Projekte fließen. Demnach sei es<br />
wichtig, auf erfolgreiche Projekte aus<br />
dem Ausland zurückzugreifen.<br />
Demokratische Entwicklungen<br />
Im Zuge des Interviews mit Edward<br />
Strasser konnte es sich <strong>SUMO</strong> nicht<br />
nehmen lassen, etwas zu den aktuellen<br />
und zukünftigen Entwicklungen zu erfragen.<br />
„Dort, wo sich die Demokratie<br />
positiv entwickelt, dort wird sie partizipativer.<br />
Dort, wo man Vorwürfe macht<br />
und populistische antidemokratische<br />
Parteien gewählt werden, dort geht es<br />
nicht in die richtige Richtung. Dort, wo<br />
die Politik versucht, Bürgerinnen und<br />
Bürger stärker einzubeziehen – nicht<br />
nur bei Entscheidung, sondern auch<br />
in der Festlegung der Schwerpunkte<br />
–, dort steigt das Vertrauen und die<br />
Glaubwürdigkeit der Politik und das ist<br />
eindeutig sichtbar. Es wird immer mehr<br />
auf Partizipation gesetzt!“<br />
von Lukas Pleyer<br />
Edward Strasser / Copyright: Sebastian Philipp<br />
Bruno Rossmann / Copyright: Parlamentensdirektion<br />
und Photo Simonis<br />
© Copyright: adobe stick / Robert Kneschke<br />
14<br />
Thema Think Austria: des Kanzlers Denkstube
VORTEILSCARD<br />
Herr<br />
Maximilian<br />
Mustermann<br />
geboren am<br />
03.09.2001<br />
Gültig:<br />
Jugend<br />
01.01.2020 – 31.12.2020<br />
Gratis zum neuen<br />
Konto: Die ÖBB<br />
VORTEILSCARD Jugend*<br />
* Angebot gültig für alle < 26 Jahre bei Eröffnung eines Studentenkontos. Nach Kontoeröffnung wird einmalig ein Gutschein für eine<br />
ÖBB VORTEILSCARD Jugend (gültig für 1 Jahr) per Post zugesendet. Dieser ist nicht in bar ablösbar bzw. umtauschbar und kann nur<br />
an den Ticketschaltern der ÖBB-Personenverkehr AG eingelöst werden. Alle Infos auf www.oebb.at<br />
Thema 15
Open Data – nur die Spitze des Eisbergs?<br />
In den Weiten des österreichischen Verwaltungsmeeres liegen riesige Datenreserven unter Verschluss, die<br />
enormes Potential für Wirtschaft, Wissenschaft und auch die BürgerInnen enthalten. <strong>SUMO</strong> sprach mit<br />
Brigitte Lutz, Data Governance-Koordinatorin der Stadt Wien, und mit Mathias Huter, Generalsekretär des<br />
Forum Informationsfreiheit, über Open Data und Ihren Einfluss auf die politische Transparenz in Österreich.<br />
Die Stadt Wien hat im Jahr 2011 die erste<br />
Open-Data-Plattform im deutschsprachigen<br />
Raum gestartet und somit<br />
den ersten Teil dieser ursprünglich<br />
verschlossenen Datenreserven für die<br />
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.<br />
Die ersten 30 Datensätze waren veröffentlicht.<br />
Vor allem von der Wirtschaft<br />
werden die offenen Verwaltungsdaten<br />
aktiv genutzt, um Apps und Online<br />
Services zu entwickeln. Diese Serviceleistungen<br />
schaffen wiederum einen<br />
Mehrwert für die BürgerInnen. Open<br />
Data kann auch wichtige politische Informationen<br />
enthalten, die zur Mündigkeit<br />
der BürgerInnen beitragen und das<br />
Vertrauen in den Staat stärken. Doch<br />
einen Großteil dieser Informationen<br />
hält Österreich doch lieber verschlossen.<br />
„Überall dort, wo es um politisch<br />
relevante und mitunter brisante Daten<br />
geht, hat Österreich in Sachen Open<br />
Data noch großen Aufholbedarf“, konstatiert<br />
Mathias Huter.<br />
Was sind Open Data?<br />
Es sind Daten, die in maschinenlesbarer<br />
Form von öffentlichen Stellen auf<br />
Websites wie data.gv.at zur weiteren<br />
Verwendung veröffentlicht werden. Die<br />
Daten der öffentlichen Hand werden<br />
auch Open Government Data genannt,<br />
um sie beispielsweise von Open Business<br />
Data – offene Daten von Unternehmen<br />
– zu unterscheiden.<br />
Öffentlich klassifizierte Daten sind nicht<br />
personenbezogen oder sicherheitsgefährdend.<br />
Maschinenlesbar bedeutet,<br />
dass die Daten in Datensätzen von Maschinen,<br />
also Apps oder Computeranwendungen,<br />
gelesen werden können,<br />
ohne dass sie zuvor in eine bestimmte<br />
Form gebracht werden müssen. Daten<br />
aus einer PDF-Datei sind für Maschinen<br />
schwerer zu lesen als strukturierte<br />
Daten in einer CSV-Datei. Brigitte Lutz<br />
unterstreicht, dass durch die Maschinenlesbarkeit<br />
„Anwendungen und Apps<br />
schneller mit Daten gefüttert werden<br />
können“.<br />
Publizierende Stellen sind in Österreich<br />
unter anderem die Stadt Wien, die Gemeinde<br />
Engerwitzdorf oder das Bundesamt<br />
für Eich- und Vermessungswesen.<br />
So veröffentlicht die Stadt Wien<br />
Datensätze wie Echtzeitdaten der Wiener<br />
Linien, die Gemeinde Engerwitzdorf<br />
Fördergelder der Gemeinde und das<br />
Eich- und Vermessungswesen digitale<br />
Landschaftsmodelle. Diese Daten<br />
auf data.gv.at bergen ein immenses<br />
Potential für Start-Ups, Unternehmen<br />
oder die Wissenschaft. Es entstehen<br />
Anwendungen wie Verkehrsinfo-Apps<br />
oder digitale Tourismuskarten mit gekennzeichneten<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
und den Standorten freier Citybikes.<br />
Huter ist sich sicher, dass es den NutzerInnen<br />
oft gar nicht bewusst sei, dass<br />
diese Apps auf Open Data aufgebaut<br />
sind.<br />
Open Data der Stadt Wien<br />
„Wenn man Interesse hat, wenn man<br />
Daten liebt und auch das Verständnis<br />
hat, welchen Mehrwert man erzeugen<br />
kann, dann funktioniert Open Data“,<br />
schwärmt Lutz. So habe sich auch in<br />
Wien sehr früh ein kleines Grüppchen<br />
gebildet, das nach wie vor als Open<br />
Data Kompetenzzentrum das Thema<br />
vorantreibt. In der Stadt Wien arbeite<br />
niemand hauptberuflich für Open Data,<br />
jede/r trage einen Anteil bei. Neben<br />
Lutz als Data Governance-Koordinatorin<br />
gibt es einen Chief Open Data Officer,<br />
der die Abteilungen an die viermal<br />
im Jahr stattfindenden Datenphasen<br />
erinnert. Diese Phasen wurden von Anfang<br />
an fixiert, um eine Kontinuität zu<br />
schaffen und um die Daten für die Veröffentlichung<br />
vorbereiten zu können.<br />
Darüber hinaus wird die Öffentlichkeit<br />
auch offline und persönlich über Initiativen<br />
und Entwicklungen informiert.<br />
Ein wichtiger Meilenstein war die Umsetzung<br />
der Data Excellence-Strategie<br />
anno 2019, die unter anderem den<br />
Umgang mit Open Data beinhaltet.<br />
Eine Innovation darin sei das „Open by<br />
default“-Prinzip. Dadurch würden alle<br />
Daten, die als öffentlich klassifiziert<br />
sind, automatisch offen zur Verfügung<br />
gestellt. „Das heißt, dass beispielsweise<br />
nicht nur der Energiebericht der<br />
Stadt Wien als PDF-Datei publiziert<br />
wird, sondern auch die zugrundeliegenden<br />
Datensätze“, erläutert Lutz.<br />
Es sei wichtig, dass man das „Open by<br />
default“-Prinzip gleich mitbedenkt, um<br />
langfristig Qualität und Quantität der<br />
Daten zu erhöhen.<br />
Jene der Stadt Wien kommen aus verschiedenen<br />
Bereichen. Besonders groß<br />
sei das Interesse an den Echtzeitdaten<br />
der Wiener Linien. Auch Geodaten für<br />
Stadtpläne und Touristenattraktionen<br />
finden sich auf zahlreichen Apps, während<br />
Statistikdaten großes Interesse<br />
bei DatenjournalistInnen hervorrufen,<br />
stellt Lutz fest.<br />
Ein Grund zum Feiern<br />
Die auf data.gv.at veröffentlichten<br />
Datensätze werden bereits von über<br />
525 Anwendungen weiterverwendet.<br />
Brigitte Lutz ist sich jedoch sicher, dass<br />
es eine große Dunkelziffer an Anwendungen<br />
gäbe, die nie erfasst wurden.<br />
Es liege im Ermessen der VerwenderInnen,<br />
ihre Anwendungen auf der Website<br />
zu registrieren. So habe sie zufällig<br />
von Entwicklern aus Russland erfahren,<br />
dass es eine russische Tourismus-App<br />
gebe, die Daten der Website verwende.<br />
Vor kurzem wurde jedoch die 500. Anwendung<br />
registriert – www.offenevergaben.at<br />
von Mathias Huter vom Forum<br />
16<br />
Thema Open Data - nur die Spitze des Eisbergs?
© Copyright: adobe stick / RWrightStudio<br />
Informationsfreiheit. Huter erläutert<br />
im <strong>SUMO</strong>-Interview, was das Besondere<br />
an den Daten ist, die für www.<br />
offenevergaben.at verwendet werden.<br />
Grundsätzlich stellen öffentliche Stellen<br />
Open Data auf freiwilliger Basis zur<br />
Verfügung. Es liege im Ermessen der<br />
Verwaltung, welche Daten in welcher<br />
Form veröffentlicht werden. „Als einzige<br />
Demokratie Europas hat Österreich<br />
kein Informationsfreiheitsgesetz – kein<br />
Gesetz also, das der Öffentlichkeit ein<br />
Recht auf Zugang zu Dokumenten und<br />
Datensätzen der öffentlichen Hand einräumt.<br />
Solche Gesetze schreiben in vielen<br />
Ländern der öffentlichen Hand auch<br />
vor, bestimmte Daten und Dokumente<br />
automatisch online zu veröffentlichen.“<br />
Eine der wenigen Ausnahmen stellt das<br />
seit März 2019 geltende Bundesvergabegesetz<br />
(§ 4 BVergG 2018) dar, das öffentliche<br />
Auftraggeber dazu verpflichtet,<br />
die Werte über Auftragsvergaben<br />
von über 50.000 Euro als Open Data zu<br />
veröffentlichen. „Insgesamt geht es bei<br />
Aufträgen der öffentlichen Hand wohl<br />
um 20 Prozent der österreichischen<br />
Volkswirtschaft, also um 70 bis 80<br />
Milliarden Euro im Jahr“, schätzt Huter.<br />
Durch das Gesetz wurde für die BürgerInnen<br />
also eine erste Transparenz in<br />
der Verwendung ihrer Steuergelder geschaffen.<br />
„Wir erfüllen durch www.offenevergaben.at<br />
die Rolle des Daten- und Informationsübersetzers.“<br />
Die nach §4<br />
BVergG 2018 auf data.gv.at veröffentlichten<br />
Daten werden automatisiert<br />
aufbereitet und für BürgerInnen analysierbar<br />
und verständlich dargestellt.<br />
„Durch die aufbereiteten Daten sieht<br />
man, welche Behörde welche Aufträge<br />
vergibt und welches Unternehmen<br />
diese Aufträge bekommt. Jetzt gibt es<br />
erstmals ein bisschen Nachvollziehbarkeit.<br />
Leider gibt es nach wie vor keine<br />
Möglichkeit, die Verträge und Dokumente<br />
zu bekommen, also die Vereinbarungen<br />
zwischen einem Unternehmen<br />
und einer staatlichen Stelle. […]<br />
Spannende Details, zum Beispiel was<br />
im Detail gekauft wird, ob der Auftrag<br />
nach dem Zuschlag noch geändert wird<br />
und wie teuer am Schluss wirklich ist,<br />
sind leider nach wie vor nicht transparent.“<br />
Das Gesetz ist also ein Schritt in<br />
die richtige Richtung, doch der Schritt<br />
ist noch ein kleiner auf einem langen<br />
Weg, um den Eisberg weiter Richtung<br />
Wasseroberfläche zu bringen.<br />
Die verschlossenen Ministerien<br />
Engerwitzdorf, eine rund 8.700 EinwohnerInnen<br />
starke Gemeinde in Oberösterreich,<br />
hat bisher 503 Datensätze<br />
veröffentlicht. Das am stärksten vertretene<br />
Bundesministerium auf der<br />
Open-Data-Website ist das Sozialministerium<br />
mit 15 Datensätzen. In den<br />
Bundesministerien scheint die sichtbare<br />
Spitze des Eisbergs also besonders<br />
klein zu sein. Doch woran liegt das?<br />
Die niedrige Zahl der Datensätze würde<br />
sich laut Brigitte Lutz auch am Interesse<br />
vonseiten der Bundesministerien<br />
widerspiegeln. Besonders Schulungen<br />
seien wichtig, um ein Verständnis<br />
für Themen im Bereich der Daten zu<br />
schaffen. Während von der Stadt Wien<br />
über hundert Leute „mit dem Open<br />
Data-Virus infiziert“ wären und Schulungen<br />
absolviert haben, seien es von<br />
allen Bundesministerien zusammen<br />
viel weniger. Darüber hinaus spiele die<br />
hohe Fluktuation durch Regierungsumbildungen<br />
der letzten Jahre eine<br />
große Rolle. Der stetige Wechsel habe<br />
zu einem KnowHow-Verlust geführt. So<br />
mangle es an Personen, die sich in das<br />
Thema eingearbeitet haben und Open<br />
Data verstehen. Lutz beobachtete: „Es<br />
war zum Beispiel eine schwere Geburt,<br />
dass das Gesundheits- und Sozialministerium<br />
die Zahlen des Covid-Dashboards<br />
auch als Open Data veröffentlicht<br />
hat. Das hat sehr lange gedauert<br />
und meiner Meinung nach sind sie immer<br />
noch nicht in einer optimalen Form<br />
publiziert“. (Anm.: Interview fand am<br />
20. April 2020 statt). Die Gemeinde Engerwitzdorf<br />
sei überdies eine Vorzeigegemeinde,<br />
da es dort sehr Open-Dataaffine<br />
Personen gebe, die sich sowohl<br />
fachlich, als auch persönlich stark mit<br />
dem Thema beschäftigen würden.<br />
Mathias Huter meint, dass Gemeinden<br />
und Städte näher bei den Bürger-<br />
Innen seien. Sie hätten, im Gegensatz<br />
zu Bundesministerien, weniger Berührungsängste<br />
und in vielen Bereichen<br />
mehr Daten, die relevanter seien für die<br />
DurchschnittsbürgerInnen. Außerdem<br />
habe das auch mit politischen Machtinteressen<br />
zu tun. Es gebe durchaus<br />
AkteurInnen, die vielleicht kein großes<br />
Interesse hätten, der Öffentlichkeit Rechenschaft<br />
abzulegen. Überall dort, wo<br />
es um politisch relevante und mitunter<br />
brisante Informationen gehe, würden<br />
Daten nicht freiwillig veröffentlicht. Es<br />
liege aber nicht an den BeamtInnen<br />
selbst, sondern vor allem an gesetzlichen<br />
Restriktionen wie dem, in der<br />
EU einzigartigen, Amtsgeheimnis. „Im<br />
Zweifelsfall entscheidet man sich für<br />
die Verschwiegenheit. Denn wenn man<br />
zu viel herausgibt, dann steht man sozusagen<br />
im Extremfall mit einem Fuß<br />
im Gefängnis.“<br />
Der träge Weg zur Transparenz<br />
Der Umstand einer fehlenden Gesetzesgrundlage<br />
ziehe sich durch alle<br />
öffentlichen Stellen Österreichs. Lutz<br />
Open Data - nur die Spitze des Eisbergs? Thema<br />
17
sieht den Grund der Verschwiegenheit<br />
nicht hauptsächlich beim Fehlen der<br />
Gesetze, sondern bei der Einstellung<br />
der betroffenen Personen. „Ich mache<br />
eher die Erfahrung mit Gesetzen,<br />
dass Druck Gegendruck erzeugt. Man<br />
bekommt fast eine gewisse Abwehrhaltung,<br />
denn jeder versucht natürlich,<br />
seine eigene Organisation zu schützen.“<br />
Man müsse den Menschen das Thema<br />
Open Data schmackhaft machen und<br />
die Einstellung in eine positive Richtung<br />
lenken.<br />
Für Huter sei die Freiwilligkeit von Open<br />
Data in Österreich ein wichtiger Aspekt,<br />
der unterstreiche, dass Open Data nicht<br />
automatisch Transparenz schaffe. Um<br />
eine solche zu bewirken, brauche es<br />
klare Gesetze. Druck zur Neuauslegung<br />
der geltenden Gesetze verspüre Österreich<br />
bereits durch Höchstgerichtsurteile<br />
oder den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof.<br />
Dabei müsste<br />
Österreich nur etwas über den Tellerrand<br />
auf junge Demokratien in östlicher<br />
Richtung blicken. „In der Slowakei ist es<br />
seit vielen Jahren so, dass ein Vertrag<br />
der öffentlichen Hand gar nicht in Kraft<br />
treten kann, wenn er nicht im Volltext<br />
im Internet für alle einsehbar ist. Das<br />
heißt, da darf ohne diese Transparenz<br />
gar kein Geld fließen. Da geht es nicht<br />
nur um Auftragsvergaben, da geht es<br />
auch um Subventionen, Förderungen,<br />
Genehmigungen und um Privatisierungen.<br />
[…] Es gibt auch Untersuchungen,<br />
die zeigen, dass dadurch nicht nur die<br />
öffentliche Hand Mittel einsparen kann,<br />
sondern dass auch der Wettbewerb gestärkt<br />
wird. So versuchen mehr Unternehmen,<br />
sich um Aufträge zu bewerben,<br />
was sich eben positiv auf den Preis<br />
auswirken kann.“ Junge Demokratien<br />
seien uns durch junge Verfassungen<br />
und Gesetze, sowie strengeren EU-Zutrittsauflagen<br />
einige Schritte voraus<br />
in puncto Transparenz. In Österreich<br />
bräuchte es ein Informationsfreiheitsgesetz,<br />
das über die Ankündigungen im<br />
Regierungsprogramm hinausgehend<br />
auch tatsächlich umgesetzt wird. Das<br />
würde den BürgerInnen einen effektiven<br />
Zugang zu Informationen schaffen<br />
und öffentliche Stellen zur automatischen<br />
Veröffentlichung politisch wichtiger<br />
Dokumente verpflichten. Darüber<br />
hinaus wäre eine politisch unabhängige<br />
Transparenz-Kontrollstelle wichtig, die<br />
beobachtet, ob Transparenzbestimmungen<br />
umgesetzt werden und die<br />
Behörden bei der Umsetzung beraten<br />
würde. „Ohne ein Informationsfreiheitsgesetz<br />
und einer unabhängigen<br />
Kontrollstelle wird es einfach sehr<br />
schwer, wirklich einen Kulturwandel<br />
hin zu mehr Transparenz innerhalb der<br />
Verwaltung auszulösen und sicherzustellen“,<br />
ist sich Huter sicher.<br />
Noch nie wurden die Pläne für ein modernes<br />
Informationsfreiheitsgesetz so<br />
konkret gesetzt wie im aktuellen Regierungsprogramm.<br />
Vielleicht schafft<br />
es die Türkis-Grün-Regierung, dieses<br />
Informationsfreiheitsgesetz – mehr als<br />
250 Jahre nach Schweden – tatsächlich<br />
umzusetzen.<br />
Aufbruchsstimmung: Welche Datensilos<br />
gehören geöffnet?<br />
Auf die Frage, welche Datensilos sie<br />
aufbrechen würde, meint Lutz, dass<br />
beispielsweise österreichweite Verkehrsdaten<br />
sehr sinnvoll wären. Sobald<br />
es um Routen über die Stadtgrenze<br />
hinausgehe, werde es schwierig, da<br />
die Daten der Verkehrsauskunft Österreich<br />
fehlen würden. Überhaupt wären<br />
österreichweite Open Data sinnvoll,<br />
damit sich EntwicklerInnen die Daten<br />
nicht dezentralisiert von verschiedenen<br />
Stellen in unterschiedlichen Datenformaten<br />
zusammenstückeln müssten.<br />
„Allgemein sollte gesamtheitlicher gedacht<br />
werden“. Huter fordert, sämtliche<br />
Gutachten und Studien der öffentlichen<br />
Hand zu publizieren, „weil dort sehr<br />
viel Wissen drinnen steckt, das sonst<br />
in irgendeiner Schublade verstaubt.“<br />
Darüber hinaus wäre die Veröffentlichung<br />
der Daten und Dokumente, die<br />
den Werten der Aufträge nach dem<br />
Bundesvergabegesetz zugrunde liegen,<br />
wichtig, um eine Nachvollziehbarkeit<br />
der Geldflüsse sicher zu stellen.<br />
„Denn das ist das effektivste Mittel,<br />
um Mauscheleien und Korruptionen im<br />
schlimmsten Fall vorzubeugen.“<br />
Je mehr Menschen von Open Data<br />
überzeugt sind und je konkreter die gesetzliche<br />
Grundlage ist, desto sinnvoller<br />
kann man also Open Data veröffentlichen.<br />
Um für BürgerInnen das Potential<br />
der riesigen Datenreserven ausschöpfen<br />
zu können, müssen auch politisch<br />
brisante Details als Open Data transparent<br />
und nachvollziehbar veröffentlicht<br />
werden. Lutz und Huter sind sich einig,<br />
dass es in vielen Bereichen noch nicht<br />
die finanziellen Ressourcen gebe, die<br />
notwendig wären, um dem Thema die<br />
angemessene Priorität einzuräumen.<br />
Solange es für Österreich kein Informationsfreiheitsgesetz<br />
gibt, bleibt Open<br />
Data eine meist freiwillige Leistung<br />
engagierter und datenaffiner MitarbeiterInnen<br />
in öffentlichen Ämtern. Die<br />
Open Data-Erfolgsgeschichten sollten<br />
nicht nur von kreativen Start-Ups und<br />
engagierten Städten und Gemeinden<br />
geschrieben werden, sondern darüber<br />
hinaus von einem offenen, transparenten<br />
Staat, der pro-aktiv Informationen<br />
für BürgerInnen veröffentlicht.<br />
Bis dahin bleibt Open Data nur die Spitze<br />
des Eisbergs.<br />
von Karin Pargfrieder<br />
Brigitte Lutz / Copyright: Lukas Lorenz<br />
Matthias Huter / Copyright: Christian Müller<br />
© Copyright: adobe stick / BillionPhotos.com<br />
18<br />
Thema Open Data - nur die Spitze des Eisbergs?
Wir sind 40.000<br />
Möglichmacher.<br />
Und wer noch fehlt bist Du!<br />
HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.<br />
Über 40.000 Kollegen und Kolleginnen bei den ÖBB arbeiten schon heute mit Leidenschaft an einer positiven und sinnvollen<br />
Zukunft für Land, Wirtschaft, Umwelt und unsere Gesellschaft. Für alle, die einen Job mit Sinn und ein starkes, lokales Team<br />
suchen, sind die ÖBB die richtige Adresse für die Karriere mit Zukunft.<br />
unsereoebb.at
Medienpluralismus: Bedarf es politischer<br />
Regulierung?<br />
Österreich liegt in puncto Medienpluralismus durchaus auf Augenhöhe mit stärker thematisierten Problemländern<br />
wie der Türkei und Ungarn. <strong>SUMO</strong> sprach mit den MedienwissenschafterInnen Josef Seethaler und<br />
Krisztina Rozgonyi über die Gründe, die Wichtigkeit der Pluralität, geltende Regelungen und die Situationen in<br />
Österreich und Ungarn.<br />
Immer wieder liest man von Forderungen<br />
nach mehr Medienpluralismus, so<br />
auch bereits 2007 vonseiten der Europäischen<br />
Kommission. Meist sind die<br />
Forderungen gut gemeint, aber nicht<br />
von konkreten Maßnahmen begleitet.<br />
Sucht man beispielsweise nach europäischen<br />
Richtlinien zu diesem Thema,<br />
stellt sich schnell heraus, dass dies vergebens<br />
ist. Doch worum genau geht es<br />
beim viel erwünschten Medienpluralismus?<br />
Plural ist nicht egal<br />
Die international tätige Nichtregierungsorganisation<br />
„Reporter ohne<br />
Grenzen“ schreibt Medienpluralismus<br />
zwei Definitionen zu. Dazu gehören<br />
zum einen der interne oder auch inhaltliche<br />
Pluralismus, der eine Pluralität<br />
an Stimmen, Analysen, geäußerten<br />
Meinungen und Problemen umfasst.<br />
Zum anderen der externe oder auch<br />
strukturelle Pluralismus, welcher die<br />
Pluralität der Medienkanäle, der Mediengattungen<br />
wie Print, Radio, Fernsehen<br />
und Online und die Koexistenz<br />
von privat-kommerziellen und öffentlich-rechtlichen<br />
Medien beinhaltet. In<br />
Fragen des externen Pluralismus wird<br />
oft die Eigentümerstruktur der Medien<br />
herangezogen, weil mehrere „gleiche“<br />
Medien von ein und demselben Eigentümer<br />
für weniger Vielfalt sorgen als<br />
Medienunternehmen, die in der Hand<br />
von vielen verschiedenen Eigentümern<br />
sind.<br />
Enorme Wichtigkeit wird dem Medienpluralismus<br />
zugeschrieben, weil fehlender<br />
Pluralismus einen Gefahrenherd<br />
für allzu selektive Medienrezeption<br />
darstellt. Liest jemand beispielsweise<br />
die Tageszeitung „Österreich“, sucht<br />
online gezielt nach Nachrichten auf der<br />
Website „oe24.at“ und hört im Laufe<br />
des Tages „Radio Austria“ kommen alle<br />
Nachrichten mehr oder weniger aus<br />
derselben Quelle, denn all diese Medienkanäle<br />
sind im Besitz der Familie<br />
Fellner. Zwar ist dasselbe Phänomen<br />
auch beim ORF zu beobachten, der sowohl<br />
im Radio- als auch im Fernsehmarkt<br />
der größte Player ist, doch muss<br />
sich dieser laut öffentlich-rechtlichem<br />
Auftrag an Binnenpluralismus – also<br />
Vielfalt innerhalb der verschiedenen<br />
ORF-Programme und Sender wie Ö3,<br />
FM4 oder ORF2 etc. – halten. Ohne öffentlich-rechtlichem<br />
Auftrag kann über<br />
mehrere Medienkanäle ein und dieselbe<br />
Meinung an die Öffentlichkeit weitergegeben<br />
werden und so Filterblasen<br />
und Echokammern fördern. Bei stark<br />
ausgeprägtem fehlenden Medienpluralismus<br />
kann dies auch zum kommunikationswissenschaftlichen<br />
Phänomen<br />
der „Schweigespirale“ führen. Denn<br />
wenn die gesellschaftlich anerkannte<br />
Meinung vom dominierenden Medienunternehmen<br />
am Markt kommuniziert<br />
wird und man zu den wenigen Menschen<br />
gehört, die eine andere Meinung<br />
haben, wird die Bereitschaft, die eigene<br />
Meinung öffentlich zu äußern immer<br />
geringer.<br />
Die ungarische Medienforscherin Krisztina<br />
Rozgonyi von der Universität<br />
Wien skizziert Hauptbereiche, die fehlenden<br />
Medienpluralismus begünstigen.<br />
Man könne sehen, dass in sozialen<br />
Netzwerken Effekte wirken, die den<br />
Kontakt mit Nachrichten- und Informationspluralität<br />
drastisch verändern. Vor<br />
allem in diesem Bereich seien öffentlich-rechtliche<br />
Medien gefordert, sich<br />
der dramatischen Veränderung von sozialen<br />
Netzwerken zu stellen und sich<br />
den Bedingungen des 21. Jahrhunderts<br />
anzupassen. Aus Effekten veränderter<br />
Mediennutzung resultieren eine Vielzahl<br />
an Ungleichheiten wie anhand des<br />
Geschlechts oder der Ethnie und somit<br />
weniger Pluralität. Bei diesem Punkt sei<br />
vor allem die Rolle von künstlicher Intelligenz<br />
in der Medienproduktion und<br />
Mediennutzung und die Verbreitung der<br />
Inhalte via sozialer Netzwerke ein wichtiger<br />
Ansatzpunkt.<br />
Status quo der Regulierungen<br />
Die öffentlichen Forderungen nach Medienpluralismus<br />
zeigen, dass der Politik<br />
die Risiken fehlender Vielfalt bewusst<br />
sind. Dem entgegengesetzt hat die<br />
Europäische Kommission trotz ihrer<br />
Forderungen bislang keine passenden<br />
Richtlinien zur Sicherung des Medien-<br />
pluralismus beschlossen. Laut Josef<br />
Seethaler, stellvertretender Leiter des<br />
Instituts für vergleichende Medien- und<br />
Kommunikationsforschung an der Österreichischen<br />
Akademie der Wissenschaften,<br />
beschränke sich die europäische<br />
Medienpolitik zurzeit vor allem<br />
auf Fernsehfilme und ähnliches oder<br />
Zusammenschlussrecht. Jedoch seien<br />
die ersten Anmerkungen der neuen<br />
Kommissionspräsidentin Van der Leyen<br />
und die Aufnahme von Medienpluralismus<br />
in den „Rule of Law“-Report ermutigend.<br />
Auf österreichischer Ebene<br />
sei die Medienpolitik laut Seethaler<br />
„irreparabel“. Denn seit den 1980er<br />
Jahren nehmen sowohl horizontale,<br />
als auch in den letzten Jahren zunehmend<br />
cross-mediale Konzentration zu.<br />
Das gelte auf jeden Fall für den Print-<br />
Sektor, im Radio- und Fernsehmarkt<br />
hatte der ORF bis zur Dualisierung des<br />
Marktes eine Monopolstellung. Nach<br />
der ersten Lockerung aufgrund neuer<br />
privater MarktteilnehmerInnen setzten<br />
auch hier Konzentrationstendenzen<br />
ein. Im Fernsehmarkt erhöhte der<br />
von der Wettbewerbsbehörde genehmigte<br />
Zusammenschluss von ATV und<br />
der „ProSiebenSat.1Puls4“-Gruppe die<br />
Konzentration deutlich. Das hatte zur<br />
Folge, dass es auf diesem Markt nun<br />
einen großen öffentlich-rechtlichen<br />
Rundfunk und einen großen privaten<br />
Medienkonzern, der in deutscher Hand<br />
ist, gibt. Komplettiert wird der Markt<br />
mit vergleichsweise marginalen Teilnehmern<br />
wie „ServusTV“.<br />
Nach der Novelle des Privatradiogesetzes<br />
im Jahr 2004 haben vor allem<br />
Zeitungsverlage die Möglichkeit bekommen,<br />
Radiolizenzen zu erwerben.<br />
Neben einigen nicht weitreichenden<br />
Beschränkungen gebe es laut Seethaler<br />
keine richtige konzentrationsverhindernde<br />
Rechtsgrundlage. Diese Freiheit<br />
führe im Radiobereich dazu, dass<br />
Lizenzen zusammengelegt werden<br />
und dadurch die Voraussetzungen geschafft<br />
würden, um eine bundesweite<br />
Radiolizenz zu bekommen. Rückblickend<br />
betrachtet, sei es ein Konzentrationsschritt,<br />
den man so nicht haben<br />
20<br />
Medienpluralismus: Bedarf es politischer Regulierung?
wollte, aber übersehen habe, dagegen<br />
entsprechend vorzubeugen.<br />
Politik am Zug<br />
Angesichts dieser Umstände stellt sich<br />
die Frage, wie die Politik einschreiten<br />
und die Situation verbessern könnte.<br />
Antworten darauf sind schnell gefunden.<br />
Etwa mit Regelungen bezüglich<br />
cross-medialer Konzentration im Online-Sektor.<br />
„In diesem Bereich könnte<br />
man noch rechtliche Regelungen<br />
schaffen, weil kaum welche existieren“,<br />
erklärt Seethaler. Passiere so etwas<br />
nicht, können die großen regionalen<br />
Zeitungsverlage, die bereits das weitest<br />
verbreitete Regionalradio erworben<br />
haben, ebenfalls zum am weitest<br />
verbreiteten regionalen Online-Anbieter<br />
werden. Dabei müsse aber beachtet<br />
werden, dass im Online-Sektor<br />
vor allem globale Unternehmen tätig<br />
sind und sich deswegen überhaupt die<br />
Frage positiver Auswirkungen einer<br />
nationalen rechtlichen Regelung stelle.<br />
Eine zweite Maßnahme könnte eine<br />
komplette Änderung des Förderwesens<br />
sein. Denn würde es eine reine<br />
Qualitätsförderung geben, profitierten<br />
jene Medien davon, die qualitätsvollen<br />
Journalismus erschaffen. Damit könnte<br />
über den „Umweg“ der Qualitätsförderung<br />
Vielfalt gefördert werden, weil<br />
so Qualitätsmedien ihre Marktposition<br />
verbessern vermögen. „Zukünftig sollen<br />
Förderungen unabhängig von der<br />
Verbreitungsform Qualität fördern, das<br />
wäre eine sinnvolle Möglichkeit über<br />
diesen Umweg auch eine qualitätsvolle<br />
Vielfalt des Angebots zu fördern“, fordert<br />
Seethaler. Dafür müsste viel Geld<br />
in die Hand genommen werden, denn<br />
die jetzigen Fördersummen seien – gemessen<br />
am Bruttosozialprodukt – tendenziell<br />
rückläufig.<br />
Rozgonyi spricht sich ebenso für eine<br />
Qualitätsförderung aus. Laut ihr müsse<br />
die starke Tradition des investigativen<br />
Journalismus in Österreich gefördert<br />
werden, in verschiedenen Formen und<br />
Arten des Journalismus, einschließlich<br />
unabhängiger Gruppen von EnthüllungsjournalistInnen,<br />
die sich besser<br />
an die digitale Medienwelt anpassen<br />
und flexibler für Kooperationsprojekte<br />
sind. Ebenfalls sollten staatliche Förderungen<br />
eher an neue Medienkanäle,<br />
Start-ups und kleinere Medienhäuser<br />
gehen, anstatt an die ohnehin schon<br />
sehr mächtigen Familien wie den Fellners<br />
(„Österreich“-Gruppe) oder den Dichands<br />
(„Kronen Zeitung“ und „Heute“).<br />
Als einen regulierungsbedürftigen Bereich<br />
schätzt die Medienwissenschafterin<br />
auch die Rolle der algorithmischen<br />
Kontrolle in Bezug auf Transparenz der<br />
Funktionsweisen von Plattformen, deren<br />
Algorithmen und deren Nachrichtenauswahl<br />
ein.<br />
Ferner könne das Bildungswesen Teil<br />
einer besseren Medienpolitik sein. Vor<br />
allem Media Literacy und kritische Medienrezeption<br />
sollte an Schulen gelehrt<br />
werden, beispielsweise wie einfach es<br />
ist, Daten und Grafiken zu manipulieren.<br />
Denn wenn solche Dinge gelernt<br />
würden, könne man sich bewusster darüber<br />
sein, wie man den eigenen Nachrichtenkonsum<br />
kontrolliert und wie<br />
man zwischen Qualität und fehlender<br />
Qualität unterscheiden kann. Gerade<br />
im Online-Bereich, in dem immer häufiger<br />
Fake News kursieren, könne dieses<br />
Wissen sehr viel wert sein. Als Best-<br />
Case-Szenario dient Rozgonyi hierbei<br />
Finnland, wo zehnjährige Kinder all<br />
diese Dinge lernen und somit eine gute<br />
Grundlage zur Einordnung qualitätsvoller<br />
Medien hätten. Infolgedessen<br />
würden Qualitätsmedien gestärkt und<br />
helfen so dem Medienpluralismus.<br />
Wie man es (nicht) macht<br />
Einen Überblick über die Situation des<br />
Medienpluralismus in europäischen<br />
Ländern kann die von der EU initiierte<br />
Studie „Media Pluralism Monitor“<br />
(MPM) geben. Ziel dieser ist es, die Risiken<br />
für den Medienpluralismus anhand<br />
von zwanzig Indikatoren in vier verschiedenen<br />
Bereichen einzuschätzen.<br />
Die vier Bereiche sind: grundlegender<br />
Schutz, Marktpluralität, politische Unabhängigkeit<br />
und soziale Miteinbeziehung.<br />
Die Indikatoren beziehen sich auf<br />
rechtliche, ökonomische und soziopolitische<br />
Fragen. Zieht man die Ergebnisse<br />
des MPM von 2017 heran, lassen sich<br />
einige Vorzeigeländer wie Frankreich<br />
und Deutschland ausmachen, die in<br />
allen Bereichen geringe Risiken aufweisen.<br />
Belgien, die Niederlande und Dänemark<br />
können ebenso ein allgemein<br />
niedriges Risiko vorweisen und zeigen<br />
nur im Bereich der Marktpluralität ein<br />
etwas höheres Risiko. Am anderen<br />
Ende des Spektrums befinden sich neben<br />
den osteuropäischen Ländern Bulgarien,<br />
Rumänien und Polen auch die<br />
medial oft thematisierten Problemländer<br />
Türkei und Ungarn. Besonders die<br />
Ergebnisse der Türkei deuten in allen<br />
Bereichen auf maßgebliche Probleme<br />
und Risiken hin.<br />
Die Situation in ihrer Heimat fasst Rozgonyi<br />
kurz so zusammen: „Medienpluralismus<br />
gibt es in Ungarn nicht mehr.”<br />
Gründe dafür sieht sie in politischer Unterdrückung,<br />
Selbstzensur, OligarchInnen<br />
in den Medien, Eigentumskontrolle<br />
sowie verschwommene Eigentumsverhältnisse<br />
und ökonomische Probleme<br />
von Qualitätsmedien. Denn seit 2010<br />
gebe es in Ungarn keinen öffentlich-<br />
Konzentrationsformen:<br />
• Horizontale Konzentration: Medienunternehmen des gleichen relevanten Marktes schließen sich zusammen.<br />
z.B. Zusammenschluss von „ATV“und „ProSiebenSat1.Puls4“<br />
• Vertikale Konzentration: Medienunternehmen, die in vor- und nachgelagerten Märkten agieren und in Abnehmer-Lieferanten-Beziehung<br />
stehen schließen sich zusammen. z.B. Zeitung kauft Druckerei<br />
• Diagonale (konglomerate) Konzentration: Medienunternehmen, die auf unterschiedlichen relevanten Märkten<br />
tätig sind und nicht in einer Abnehmer-Lieferanten-Beziehung stehen, schließen sich zusammen. (Cross-Media-Ownership).<br />
z.B. „Österreich“-Gruppe besitzt Zeitungen, Fernsehsender „oe24.tv“, Radiosender „Radio Austria“<br />
und die Nachrichtenwebsite „oe24.at“<br />
© Copyright: adobe stock/ photokozyr<br />
Medienpluralismus: Bedarf es politischer Regulierung?<br />
21
© Copyright: adobe stick / Bphotokozyr<br />
rechtlichen Rundfunk im klassischen<br />
Sinne, er habe sich zu einer staatlichen<br />
Propagandamaschine gewandelt. Die<br />
Medienmärkte werden zu 80% bis 90%<br />
von politischen OligarchInnen und politischen<br />
AkteurInnen kontrolliert. Geschehen<br />
konnte all das durch die seit<br />
2010 illiberal praktizierte Demokratie,<br />
Machtmissbrauch, Missbrauch öffentlicher<br />
Mittel, einer Menge Korruption und<br />
politischer Kontrolle über die Medien.<br />
Als großes Problem erachtet sie auch<br />
die „Normalisierung“ der Medienlandschaft<br />
und Umstände in Ungarn. Denn<br />
worauf viele ÖsterreicherInnen vermutlich<br />
erst nach der Thematisierung<br />
von Peter Klien in seiner Sendung „Gute<br />
Nacht Österreich“ im Jänner 2020 aufmerksam<br />
wurden, ist im Nachbarland<br />
bereits seit zehn Jahren der Normalfall<br />
und aus diesem Grund tief in den Gedanken<br />
der Bevölkerung verwurzelt.<br />
„Eine ganze Generation ist in dieser Zeit<br />
aufgewachsen, sie ist in den Köpfen der<br />
Menschen ‚eingebrannt‘ “, zeigt die Medienwissenschafterin<br />
auf. Deshalb solle<br />
Ungarn immer im Hinterkopf behalten<br />
bleiben, weil unter bestimmten Umständen<br />
solche Bedingungen ziemlich<br />
schnell entstehen können und dabei<br />
niemand außerhalb des Landes – auch<br />
nicht die EU – die Situation verändern<br />
kann.<br />
Österreich auf dem Prüfstand<br />
Aufgrund der wenigen rechtlichen Regelungen<br />
im Bereich des Medienpluralismus<br />
in Österreich lässt sich hier<br />
sehen, wie sich der Markt von selbst reguliert.<br />
Die Auswirkungen davon hat Josef<br />
Seethaler im österreichspezifischen<br />
Bericht des MPM festgehalten. Er sieht<br />
große Probleme in der Medienkonzentration<br />
in Österreich, weil man sich in<br />
„unrühmlicher Gesellschaft“ befinde.<br />
Diese „unrühmliche Gesellschaft“ setzt<br />
sich unter anderen aus allen vorhin genannten<br />
Negativbeispielländern – also<br />
auch der Türkei und Ungarn – zusammen.<br />
In Fragen der Medienkonzentration<br />
stünden die meisten europäischen<br />
Staaten besser da.<br />
Auch die Ergebnisse des MPM 2020<br />
sehen für Österreich in puncto Medienkonzentration<br />
nicht viel besser aus:<br />
Die vier größten Medienunternehmen<br />
kommen auf Basis des Umsatzes auf<br />
65% Marktanteil und auf Basis der Publikumsreichweiten<br />
im Print-, Radiound<br />
Fernsehsektor auf Werte zwischen<br />
72% und 89%. „Das sind gigantisch<br />
hohe Werte und eigentlich unter dem<br />
demokratischen Mediensystem nicht<br />
vertretbar“, kommentiert Seethaler die<br />
Ergebnisse. Ansonsten hätten sich,<br />
bis auf eine höhere Konzentration im<br />
Fernsehbereich aufgrund des Zusammenschlusses<br />
von ATV und der „Pro-<br />
SiebenSat.1Puls4“-Mediengruppe, die<br />
Werte gegenüber den Vorjahren nicht<br />
gravierend geändert und Österreich<br />
gelte nach wie vor als Hochrisikoland<br />
im Bereich der Medienkonzentration.<br />
Das Aufkommen des zweiten bundesweiten<br />
Privatradiosenders „Radio<br />
Austria“ habe hingegen nur zu einer<br />
leichten Reduktion der bundesweiten<br />
Konzentration im Radiosektor, aber<br />
aufgrund des Zusammenschluss vieler<br />
regionaler Lizenzen zu einer Erhöhung<br />
der Konzentration im regionalen Bereich<br />
geführt. Dieser Schritt habe nicht<br />
zu inhaltlicher Vielfalt geführt, weil das<br />
Programm selbst nach der Zusammenlegung<br />
der Lizenzen das gleiche bleibe.<br />
Chancen für Besserung sehe er im Online-Bereich,<br />
in dem 2018 die Konzentrationswerte<br />
55% betrugen - allerdings<br />
ist die Datenbasis hier lückenhaft. Hier<br />
sehe man noch die Möglichkeit, in die<br />
Verstärkung der Konzentration einzugreifen,<br />
um wenigstens den Zusammenschluss<br />
von traditionellen und<br />
Online-Verbreitungsformen in eine<br />
bessere Balance zu bekommen, etwa<br />
durch Förderung qualitätsvoller Digital<br />
Native Media.<br />
Krisztina Rozgonyi / Copyright: Monika Saulich<br />
Josef Seethaler / Copyright: Fotostudio R. Michael<br />
Schuster, Wien<br />
Ausblick<br />
Genauso vielfältig wie der Medienpluralismus<br />
sein sollte, sind die möglichen<br />
Auswirkungen und Trends. Rozgonyi<br />
sieht in den nächsten Jahren in<br />
Europa viele politische Gefahren für<br />
den Medienpluralismus durch illiberale<br />
politische Amtszeiten, wobei Ungarn<br />
nur ein Beispiel dafür war. Als zweiten<br />
Punkt erkennt sie ökonomische Risiken<br />
wie unternehmerische und finanzielle<br />
Schwierigkeiten oder die Corona-Pandemie.<br />
Denn nach der Finanzkrise 2008<br />
konnte man sehen, dass Qualitätsmedien<br />
und -journalismus sich nie wirklich<br />
davon erholen konnten. Als letzten<br />
Punkt betont sie viele Aspekte algorithmischer<br />
Kontrolle und Probleme in Verbindung<br />
mit künstlicher Intelligenz und<br />
dessen unkontrollierbaren Teil. Ohne<br />
genügende Investitionen in potenzielle<br />
Regulierungen könnte dieses Phänomen<br />
ein großes Risiko für den Pluralismus<br />
darstellen.<br />
Seethaler hingegen sieht Chancen<br />
durch die veränderte Mediennutzung.<br />
Denn Studien zufolge steigt die Möglichkeit,<br />
durch die Nutzung sozialer<br />
Medien in Kontakt mit mehreren unterschiedlichen<br />
Medien zu kommen. So<br />
könnte beispielsweise ein/e Leser/in<br />
der „Kronen Zeitung“, der/die sich auch<br />
ORF-Nachrichten ansieht, auf „Facebook“<br />
durch den Beitrag eines Freundes<br />
bzw. einer Freundin Nachrichten lesen,<br />
von denen weder die „Kronen Zeitung“<br />
noch der ORF berichtet hat. Hier könne<br />
er sich ebenfalls eine gute Möglichkeit<br />
zur Qualitätsförderung für Social Media<br />
Sites, die versuchen einen qualitätsvollen<br />
Diskurs zu initiieren, vorstellen.<br />
Dadurch könne man im regionalen und<br />
nationalen Maßstab ein vielfältigeres<br />
Angebot für eine immer größere Zahl an<br />
NutzerInnen schaffen.<br />
22<br />
Medienpluralismus: Bedarf es politischer Regulierung?<br />
von Christiane Fürst
Pressefreiheitsgrenze - Wahrheit kann bestraft<br />
werden!<br />
So ein Text an Grenzschildern wäre Satire. Dennoch: Übergriffe auf Medien und Medienschaffende sind in<br />
Tschechien und der Slowakei sehr präsent. In diesem Artikel thematisiert <strong>SUMO</strong>, wie die legislative Gewalt versucht,<br />
die vierte Gewalt – also die Medien – zu übernehmen und sprach darüber mit Univ.-Prof. Anna Sámelová<br />
von der Comenius-Universität Bratislava und Studierenden in Prag.<br />
Samelová gibt, um die slowakischen<br />
Medienspezifika nachvollziehen zu<br />
können, einen kurzen Abriss moderner<br />
Mediengeschichte. Diese hat mit<br />
dem Zerfall der damaligen CSSR in die<br />
tschechische und die slowakische Republik<br />
1993 begonnen. Nach diesem<br />
Zeitpunkt hat sich die slowakische Gesellschaft<br />
in zwei Gruppen entzweit, in<br />
die AnhängerInnen des damaligen Premierministers<br />
Vladimír Mečiar und in<br />
seine GegnerInnen. So wie die Bevölkerung<br />
haben sich auch die Medienhäuser<br />
in diese beiden Richtungen orientiert.<br />
Medien, die den Regierungschef befürworteten,<br />
hatten vorwiegend das Ziel,<br />
die Regierungstätigkeiten zu unterstützen<br />
bzw. rechtswidrige Aktivitäten<br />
der Regierung zu verteidigen. Unter den<br />
RegierungsanhängerInnen befand sich<br />
auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk<br />
(RTVS). Investigativjournalismus wurde<br />
kategorisch den Regierungsgegner-<br />
Innen überlassen. Dies hatte zur Auswirkung,<br />
dass Investigativjournalismus<br />
eher als Mittel zum Diffamieren der<br />
Regierung verstanden wurde. Mit dem<br />
Regierungswechsel kamen zwar auch<br />
Verbesserungen, jedoch im Jahr 2006<br />
unterbrochen, als Robert Fico das Amt<br />
des Ministerpräsidenten erhielt. Die<br />
Ausübung journalistischer Tätigkeiten<br />
wurde wieder erschwert und es kam zu<br />
zahlreichen Übergriffen auf die Medien<br />
seitens der amtierenden Partei SMER.<br />
Fico selbst stempelte JournalistInnen<br />
laut Samelová als „Prostituierte“ oder<br />
„Vipern“ ab. Dies hätte auch die RezipientInnen<br />
beeinflusst, die die Aufgabe<br />
der Medien nur als ein forcierendes Mittel<br />
zur Abwertung der Regierung wahrnahmen.<br />
Infolgedessen waren sie auch<br />
nicht bereit, den von Medien gestellten<br />
kostenpflichtigen Content zu bezahlen<br />
oder missbilligten die Rundfunkabgabe.<br />
Wendepunkt im Februar 2018<br />
Im <strong>SUMO</strong>-Gespräch weist Sámelová<br />
mehrfach auf den Unterschied vor und<br />
nach dem Februar 2018 hin, als der<br />
27-jährige Investigativjournalist Ján Kuciak<br />
ermordet wurde. Im Fokus seiner<br />
aufklärenden Tätigkeiten standen Korruption<br />
oder Steuerhinterziehung. Einen<br />
Artikel über die mutmaßlichen Tätigkeiten<br />
der italienischen Mafia in der Slowakei<br />
konnte er nicht mehr selbst veröffentlichen,<br />
denn er wurde kurz davor in<br />
seinem Haus in Veľká Mača (ca. 50 km<br />
von Österreich entfernt) mit seiner Ver-<br />
Performative Change<br />
Welche Kompetenzen sind in der digitalisierten<br />
Arbeitswelt der Zukunft gefragt?<br />
Antworten darauf gibt das Buch „Performative Change“ von<br />
Thomas Duschlbauer, Kommunikations-und Kulturwissenschafter<br />
sowie Lektor an der FH St. Pölten. Es geht dabei<br />
um einen Paradigmenwechsel und die Frage, wie neue Formen<br />
der Organisation und Kommunikation, die zunehmend<br />
automatisiert und von Algorithmen gesteuert werden, auf<br />
das Zusammenleben der Menschen und auf deren Kommunikation<br />
wirken. Eine Schlüsselrolle nimmt dabei der Begriff<br />
der „Performativität“ ein, zumal angesichts wachsender<br />
Komplexität experimentelles und exploratives Handeln<br />
sowie die dazu notwendigen Frei- und Handlungsspielräume<br />
innerhalb einer Organisation von entscheidender Bedeutung<br />
sein werden. Das Buch erscheint im August im<br />
NOMOS Verlag in der Reihe Organisationskommunikation<br />
(140 Seiten, englisch).<br />
23
lobten Martina Kušnírová erschossen.<br />
Der Investigativjournalist berichtete<br />
auch über dubiose Geschäftsmänner<br />
wie etwa Marian Kočner, dessen Name<br />
laut Adéla Očenášková („ČTK“) in mehreren<br />
slowakischen Affären präsent<br />
war, wie in der Causa „Gorilla“, in der<br />
laut der Tageszeitung „Die Presse“ auch<br />
österreichische Unternehmen wie der<br />
Flughafen Wien oder die Raiffeisen Zentralbank<br />
verwickelt wären, wie Geheimdienstprotokolle<br />
aufzeigten.<br />
Marian Kočner wurde auch tatsächlich<br />
von der slowakischen Staatsanwaltschaft<br />
angeklagt und stand mit vier<br />
anderen Personen im Frühjahr 2020<br />
vor dem Spezialisierten Strafgericht in<br />
Pezinok. Ihm wurde vorgeworfen, den<br />
Mord in Auftrag gegeben zu haben.<br />
Diese veröffentlichte Tonaufnahme des<br />
Telefonats zwischen Kuciak und Kočner<br />
dürfte die Klage bekräftigt haben.<br />
Kočner: „Herr Kuciak, Sie können sichergehen,<br />
dass ich mich persönlich mit Ihnen<br />
beschäftigen werde.“<br />
Kuciak: „Sollte das eine Drohung sein?“<br />
Kočner: „Nein, warum?“<br />
Kuciak: „Dann verstehe ich nicht, warum<br />
Sie mir sowas sagen.“<br />
Kočner: „ Denn ich sage es Ihnen friedlich,<br />
ich werde mich mit Ihnen, Ihrer<br />
Mutter, Ihrem Vater und Ihren Geschwistern<br />
beschäftigen.“<br />
Kuciak: „Wissen Sie, wer auch die Familie<br />
in solchen Streit hineinzieht?“<br />
Kočner: „Gehen Sie sche*ßen mit Ihren<br />
Meinungen…“<br />
Laut „aktuality.sk“ habe Kuciak wegen<br />
dieses Anrufes Anzeige erstattet. Die<br />
Staatsanwaltschaft habe jedoch keine<br />
konkreten Schritte unternommen und<br />
erst nach dem Mord das Anzeigeverfahren<br />
bzgl. des Telefonats eingestellt.<br />
Sámelová aber auch „Deutsche Welle“<br />
schilderten, dass der mutmaßliche Auftraggeber<br />
Marian Kočner über Verbindungen<br />
zu RichterInnen, PolitikerInnen<br />
und StaatsanwältInnen verfüge, die ihm<br />
auch bei der Verhinderung dieses Anzeigeverfahrens<br />
geholfen hätten und<br />
weiterhin helfen können.<br />
Der Schicksalstag und seine Auswirkungen<br />
Während der Verhandlungen gestand<br />
der ehemalige Soldat Miroslav Marček,<br />
den Mord begangen zu haben und beschrieb,<br />
wie er tatsächlich leichten<br />
Zugang zu Kuciak hatte. Er habe abgewartet,<br />
bis der Journalist zuhause<br />
angekommen war. Kuciak habe ihm die<br />
Tür geöffnet und darauf habe Marček<br />
geschossen. Vor Gericht erzählte er<br />
noch weiter: „Unglücklicherweise hatte<br />
ich beobachtet, dass im Haus noch eine<br />
andere Person (Anm.: Kušnírová) war.<br />
Sie rannte in die Küche und ich bin ihr<br />
nachgegangen. Da habe ich auch sie erschossen.“<br />
„ČT24“ schrieb, dass bei diesen Verhandlungen<br />
auch der Ex-Chef der Spionageabwehr<br />
Peter Tóth ausgesagt und<br />
die Verfolgung von Ján Kuciak organisiert<br />
habe. Laut Tóth habe Kočner noch<br />
die Verfolgung von 28 anderen JournalistInnen<br />
angeordnet. Dabei hatte<br />
Kočner bereits ihre persönlichen Daten<br />
im Besitz. Es habe sich dabei um Daten<br />
aus dem Polizeiregister gehandelt,<br />
schrieb „ČT24“ weiter.<br />
Der Mord war ein Triebwerk für die politische<br />
Krise des Landes. Im Laufe der<br />
Ermittlung traten hochrangigste politische<br />
Funktionäre zurück. Die Konsequenzen<br />
waren noch zwei Jahre nach<br />
dem Mord deutlich spürbar. Die führende<br />
politische Partei SMER um den Parteivorsizenden<br />
Robert Fico stürzte bei<br />
den Wahlen im Frühjahr 2020 deutlich<br />
ab.<br />
Die Richtung stimmt, aber…<br />
Der ORF berichtete damals, dass Igor<br />
Matovič (derzeitiger Regierungschef)<br />
meinte: „Es war der Tod von Ján Kuciak<br />
und Martina Kušnírová, der die Slowakei<br />
aufgeweckt hat“. Seine Aussage<br />
bekräftigt auch Sámelová, die dazu<br />
ein Beispiel aus ihrem akademischen<br />
Alltag zeigt: „Seit der Ermordung verzeichnen<br />
wir einen Anstieg des Interesses<br />
an Lehrveranstaltungen wie<br />
etwa zu Datenjournalismus sowie investigativem<br />
Journalismus“. Samelová<br />
ist auch der Ansicht, dass die Zukunft<br />
der slowakischen Medienlandschaft<br />
positiver werde: „Die derzeitige Tendenz<br />
ist hoffnungsvoll, hängt aber von<br />
dem wirtschaftlichen Niveau des Landes<br />
ab, das in diesen Zeiten, aufgrund<br />
der weltweiten Corona-Krise schwer<br />
abzuschätzen ist. Die Slowakei hat jedoch<br />
großes Potenzial, über eine starke<br />
und unabhängige Medienlandschaft zu<br />
verfügen“. Dabei wies aber „ARTE“ auf<br />
die verbleibenden Medienfreiheitsprobleme<br />
gerade im slowakischen Rundfunk<br />
hin. Sámelová gibt zu, dass der<br />
RTVS-Generaldirektor Jaroslav Rezník<br />
Kontakte mit der damals amtierenden<br />
Partei gepflegt habe, ersucht jedoch,<br />
mit seiner eventuellen Abberufung bedächtig<br />
umzugehen, denn die politische<br />
Entmachtung des Generaldirektors/der<br />
Generaldirektorin des öffentlich-rechtlichen<br />
Rundfunks sei ein starker Eingriff<br />
in die Mediendemokratie. Es sei zu be-<br />
24<br />
Pressefreiheit Thema - Wahrheit kann bestraft werden
denken, dass er seine Stelle in einem<br />
ordentlichen Auswahlverfahren erlangt<br />
habe. Sámelová äußert sich noch dazu,<br />
dass der slowakische Rundfunk seine<br />
Funktionen nicht optimal erfülle, jedoch<br />
sei die Berichterstattungsaufgabe für<br />
eine öffentlich-rechtliche Anstalt ausreichend<br />
gewährleistet. „Bedenklich erachte<br />
ich aber die Vorgehensweise von<br />
Rezník bei der Berufung neuer Berichterstattungsverantwortlicher,<br />
denn diese<br />
Funktionen haben ehemalige PressesprecherInnen<br />
der Staatsverwaltung<br />
inne, die früher diese verteidigt haben<br />
und nun über sie kritisch informieren<br />
sollen“, so die Universitätsprofessorin.<br />
In Tschechien…<br />
…berichtete zwar das Komitee zum<br />
Schutz von JournalistInnen, dass sich<br />
seit dem Jahr 1992 in Tschechien kein<br />
Mord an ReporterInnen aufgrund ihrer<br />
Arbeitstätigkeiten ereignet habe. „Česká<br />
televize“ („ČT“ - öffentlich-rechtliche<br />
Fernsehanstalt Tschechiens) berichtete<br />
jedoch, dass in dieser Statistik der Mord<br />
an dem Redakteur Václav Dvořák nicht<br />
berücksichtigt sei. Ein weiterer Fall ist<br />
der Mordversuch an der Journalistin Sabina<br />
Slonková im Jahr 2002. Den nicht<br />
verwirklichten Mord habe der damalige<br />
Sekretär des tschechischen Außenministers<br />
Karel Srba in Auftrag gegeben.<br />
„Český rozhlas“ (Tschechischer Rundfunk)<br />
beschrieb, dass die Gründe für<br />
den Mord vorwiegend korrupte Machenschaften<br />
mit staatlichen Grundstücken<br />
gewesen wären. Darüber habe<br />
Slonková Bescheid gewusst und soll<br />
vor dem Mordsauftrag darauf aufmerksam<br />
gemacht haben. Obwohl auch der<br />
ehemalige tschechische Außenminister<br />
Jan Kavan über den Plan gewusst hätte,<br />
habe er laut dem Tschechischen Rundfunk<br />
nichts unternommen. Srbas Absicht<br />
wurde durch den Auftragsmörder<br />
Karel Rziepel selbst angezeigt. Er habe<br />
für die Durchführung der Tat 200.000<br />
CZK (ca. 7.300 EUR) bekommen. Sabina<br />
Slonková ist bis heute im Journalismus<br />
tätig und hat im Laufe ihrer Karriere<br />
eine Reihe von Auszeichnungen für ihre<br />
Arbeit erhalten.<br />
Diese Auszeichnungen sind ein wichtiger<br />
Akt, denn die Medienlandschaft ist eher<br />
verbalen statt physischen Übergriffen<br />
ausgesetzt. Als plakatives Beispiel dient<br />
hierzu die von Präsidenten Miloš Zeman<br />
getätigte Aussage beim Staatsbesuch<br />
in Russland mit Präsident Vladimir Putin,<br />
während dem er sagte: „…und da<br />
sind weitere Journalisten? Journalisten<br />
gibt es viele, sie sollten vernichtet werden“.<br />
Dazu äußerte sich Putin, dass es<br />
nicht notwendig sei, sie zu vernichten,<br />
sondern es reiche, sie zu reduzieren.<br />
Aber diese verbalen oder physischen<br />
Übergriffe gegenüber JournalistInnen<br />
sind nicht allein die Gründe dafür, dass<br />
Tschechien seit dem Jahr 2015 in der<br />
Rangliste der Pressefreiheit kontinuierlich<br />
abgerutscht ist. Diese Liste wird<br />
jedes Jahr von „Reporter ohne Grenzen“<br />
veröffentlicht und hat das Ziel, die verschiedenen<br />
Pressefreiheitsraten aller<br />
Länder auf der Welt zu vergleichen. Im<br />
Jahr 2019 befand sich Tschechien auf<br />
dem 40. Platz, obwohl das Land im Jahr<br />
2015 noch den 13. Platz belegt hatte.<br />
Eigentumsverhältnisse bestimmen<br />
Medieninhalte<br />
„ČT“, die sich weiter auf die wissenschaftliche<br />
Gemeinschaft beruft,<br />
schreibt diesen Rückgang vorwiegend<br />
dem Phänomen zu, dass tschechische<br />
Medienverlage immer deutlicher ihre<br />
Objektivität nicht gewährleisten können.<br />
Immer häufiger werden sie von<br />
einflussreichen Personen übernommen,<br />
die enge Kontakte in der Politik<br />
haben oder selber in der Politik tätig<br />
sind. Früher wurden laut Václav Štětka<br />
(Loughborough University, GB) tschechische<br />
Medienhäuser von ausländischen<br />
EigentümerInnen besessen, die<br />
laut Petr Schönfeld (ehemaliger „Blesk“<br />
Chefredakteur) keinerlei Tendenzen<br />
zeigten, die Inhalte zu manipulieren.<br />
Dies sei bei den inländischen EigentümerInnen<br />
nicht der Fall, denn die Medien<br />
reflektieren immer die Sichtweisen<br />
und Interessen derer, die sie besitzen,<br />
absichtlich, aber auch unabsichtlich wie<br />
etwa mittels Autozensur.<br />
Dieses Phänomen, dass die einheimischen<br />
EigentümerInnen den ausländischen<br />
ihre Anteile an Medienunternehmen<br />
abkaufen, untermauert ein<br />
Beispiel von heuer. Noch im Laufe des<br />
Jahres 2020 sollte der reichste Geschäftsmann<br />
Tschechiens, Peter Kellner,<br />
den kommerziell erfolgreichsten<br />
Sender „TV Nova“ übernehmen. Kellner<br />
pflegt Kontakte zu Präsident Miloš Zeman.<br />
Zu den Auswirkungen meinte der<br />
Soziologe Jaromír Volek gegenüber „ČT“:<br />
„Das wird nicht ein beachtliches unternehmerisches,<br />
sondern ein politisches<br />
Ereignis, das die Politik sehr beeinflussen<br />
könnte.“<br />
Kellner ist in Tschechien kein Einzelfall,<br />
denn Andrej Babiš, der zweitreichste<br />
Bürger und seit 2017 Ministerpräsident,<br />
ist selbst im Besitz eines der wichtigsten<br />
Medienhäuser („MAFRA“). Bei der<br />
Übernahme im Jahr 2013 versprach er<br />
zwar die Unabhängigkeit des Hauses,<br />
© Copyright: adobe stock/ eyetronic<br />
© Copyright: adobe stock/ Pawel Michalowski<br />
Pressefreiheit - Wahrheit kann bestraft werden<br />
25
© Copyright: adobe stock/ yetronic<br />
später jedoch tauchte eine Tonaufnahme<br />
in der Öffentlichkeit auf, in der Babiš<br />
laut der Sendung „Reportéři ČT“ dieses<br />
Gespräch mit einem Redakteur der in<br />
seinem Besitz befindlichen Zeitung „Lidové<br />
noviny“ geführt habe:<br />
Andrej Babiš: „…in ,Právo‘ habe ich die<br />
Titelseite, in ,HN‘ einen großen Artikel<br />
und in ,Lidové noviny‘ habe ich nichts<br />
gefunden…“<br />
Redakteur: „Leider bin ich nur ein einfacher<br />
Redakteur, der nicht bestimmt,<br />
wann etwas wird.“<br />
Andrej Babiš: „Ok, in Ordnung, ich hoffe,<br />
dass die Burschen wissen, was sie machen.<br />
Wahrscheinlich wissen sie nicht,<br />
mit wem sie es zu tun haben, aber das<br />
ist egal.“<br />
Kritik an Praktiken von Regierungschef<br />
Andrej Babiš übte auch der Politologe<br />
Miloš Gregor. Er zeigte in der Sendung<br />
von „Reportéři ČT“ einige Beispiele, wie<br />
Tageszeitungen, die sich im Besitz von<br />
Babiš befinden, zu seinen Gunsten berichteten.<br />
Im Jahr 2019 sollten während<br />
einer Demonstration gegen ihn alle<br />
Tageszeitungen in seinem Besitz über<br />
andere Themen schreiben, während<br />
alle restlichen über diesen Vorfall berichteten<br />
(Anm. <strong>SUMO</strong>: auch der ORF<br />
informierte darüber). Redakteur Jidřich<br />
Šídlo meinte gegenüber „ČT“ dazu, dass<br />
Andrej Babiš im Jahr 2013 die Medien<br />
erworben habe, um Regierungschef zu<br />
werden, was ihm tatsächlich auch gelungen<br />
ist. Die Frage, inwieweit ihm diese<br />
Medienübernahme dabei geholfen<br />
habe, werde bereits an Universitäten<br />
untersucht.<br />
Laut der Website „Hlídací Pes“ hat auch<br />
der zweitmeistrezipierte Sender Tschechiens<br />
„FTV Prima“ Probleme mit seiner<br />
Objektivität. „FTV Prima“ habe absichtlich<br />
manipulierte Berichterstattung<br />
über Flüchtlinge in der EU gesendet.<br />
„FTV Prima“ habe am 7.9. 2015 eine<br />
Redaktionskonferenz abgehalten, in<br />
der die Senderführung mit Chefredakteurin<br />
Jitka Obzinová eine einheitliche<br />
und negative Berichterstattung über<br />
die Flüchtlingskrise bzw. die Darstellung<br />
der Flüchtlinge angeordnet haben<br />
soll. „Hlídací pes“ schrieb weiter, dass<br />
laut seinen Recherchen dies deutlich<br />
erkennbar war und diese Tatsache bestätigte<br />
auch die tschechische Medienregulierungsbehörde<br />
in ihrem Bericht.<br />
Mogens Blicher Bjerregård von „Freelance<br />
International“ meinte zu der Situation<br />
in Tschechien: „Wir haben JournalistInnen<br />
getroffen, die Angst hatten,<br />
über die derzeitige Lage zu reden. Sie<br />
hatten Angst, darüber zu sprechen, dass<br />
sie als JournalistInnen nicht frei arbeiten<br />
können. Das hat seine Einflüsse auf die<br />
ganze Gesellschaft.“<br />
<strong>SUMO</strong>-Recherchen in Prag<br />
<strong>SUMO</strong> traf sich in Prag mit Studierenden<br />
an diversen Hochschulen, um einen<br />
Einblick in ihr Medienverhalten zu bekommen<br />
und um ihre Ansichten zur<br />
Mediensituation in Tschechien zu hören.<br />
Die Befragten haben den Eindruck, dass<br />
die tschechische Medienlandschaft<br />
trotz politischer Einflüsse relativ objektiv<br />
sei, da sie manche von ihnen als<br />
„propagandistische Contentanbieter“<br />
bezeichnete Medien, wie etwa „sputnik.<br />
cz“ oder „parlametnilisty.cz“ nicht als<br />
Nachrichtenanbieter betrachten. Medienhäuser<br />
der sogenannten Oligarchen<br />
werden jedoch schon und sogar häufig<br />
als Sekundärquellen rezipiert. Jedoch<br />
sei man vorsichtig und wolle eventuelle<br />
kontroverse Nachrichten überprüfen,<br />
wie z.B im Fall von Kristýna N.: „Ich<br />
überprüfe die tatsächliche Information<br />
lieber bei der Herkunftsquelle oder bei<br />
einer mir vertrauten Quelle. Damit kann<br />
man mögliche absichtliche, aber auch<br />
unabsichtliche Differenzen erblicken.“<br />
Ob die Studierenden oft so vorgingen?<br />
„Naja, oft eher nicht“, so Jakub Š. Dies<br />
ergänzte noch Márton L. damit, dass<br />
alle Menschen ihrer gesellschaftlichen<br />
„Blase“ ausgesetzt seien, welche vorherbestimme<br />
und steuere, ob die jeweilige<br />
Botschaft als objektiv oder subjektiv<br />
evaluiert werde. „Ich erachte die von mir<br />
konsumierten Nachrichten als objektiv.<br />
Schaue ich jedoch über meine soziale<br />
Blase hinaus, kann ich feststellen,<br />
wie häufig nicht objektive Nachrichten<br />
als objektiv wahrgenommen wurden“.<br />
Manche zeigten sich zur kontroversen<br />
Berichterstattungen renitent, wie etwa<br />
Vojěch B. über Babiš: „Gerade über Babiš<br />
lese ich nichts mehr“.<br />
Alle <strong>SUMO</strong>-DiskussionspartnerInnen<br />
antworteten äußerst kritisch auf die<br />
Frage, ob sie es als zulässig betrachten,<br />
dass der Regierungschef Andrej<br />
Babiš mehrere Medienhäuser in seinem<br />
Besitz habe. Dazu meinte Anna B.: „Es<br />
wäre in Ordnung, wenn die Pressefreiheit<br />
beibehalten würde. Das ist aber<br />
nicht der Fall, gerade während der großen<br />
Demonstrationen in Prag wurde in<br />
seinen Tageszeitungen nicht darüber<br />
berichtet – und das waren echt riesige<br />
Demonstrationen“. Adam H. ergänzt<br />
„Wir als Gesellschaft müssen uns Normen<br />
innerhalb einer Marktwirtschaft<br />
setzen, um die Grenze zwischen dem<br />
Erlaubten bzw. dem nicht Erlaubten zu<br />
bestimmen“.<br />
von Ondrej Svatos<br />
Anna Sámelová / Copyright: Privat<br />
26<br />
Pressefreiheit - Wahrheit kann bestraft werden
Mediales Alternativ-Bingo: Aufmerksamkeit<br />
um jeden Preis<br />
Ob soziale oder klassische Medien: PopulistInnen benötigen das Rampenlicht, ganz gleich wie. Hierfür wird gerne<br />
auch auf Falschinformationen und Übertreibungen zurückgegriffen – umso fragwürdiger oder extremer die<br />
Aussagen, desto besser. Mit <strong>SUMO</strong> konferierten darüber Stephan Russ-Mohl, Gründer des European Journalism<br />
Observatory und emeritierter Professor für Journalismus und Medienmanagement an der Università della Svizzera<br />
Italiana in Lugano, sowie Felix Simon, Leverhulme Doktorand am Oxford Internet Institute und Forschungsassistent<br />
am Reuters Institute for the Study of Journalism der Universität Oxford.<br />
Entweder lassen PopulistInnen und<br />
deren Spin Doctors ihrer eigenen Kreativität<br />
freien Lauf oder sie verwerten<br />
„eingestaubte“ bzw. unbelegte Theorien.<br />
Das Ziel ist simpel: mediale Präsenz.<br />
Donald Trump hat bewiesen,<br />
welche Macht seine Tweets haben<br />
können. Selbst Börsenkurse sind dessen<br />
direktem Sprachrohr gegenüber<br />
nicht gewappnet, er muss dafür nicht<br />
einmal die zur Verfügung stehenden<br />
288 Schriftzeichen verwenden. Direkte<br />
Kommunikation statt direkter Demokratie,<br />
Message out of Control oder<br />
gezielte Message Control: Mainstreammedien<br />
geben diese Botschaften, oft<br />
durch Screenshots verdoppelt, häufig<br />
unkommentiert wieder. Die Befürwortung<br />
erfolgt meist über befreundete<br />
gleichgesinnte Mediennetzwerke.<br />
Covid-19 und Populisten: unterschiedliche<br />
Länder, unterschiedliche<br />
Strategien<br />
Die Kommunikationsstrategien der<br />
Populisten und Autokraten dieser Welt<br />
– <strong>SUMO</strong> missachtet ob männlicher Dominanz<br />
hier bewusst auf geschlechtssensible<br />
Sprache – unterschieden sich<br />
in dieser pandemischen Zeit teils deutlich<br />
voneinander. Der Rechtpopulist<br />
und per Dekret zum Autokraten aufgestiegene<br />
Viktor Orbán griff laut „Der<br />
Standard“ zu gewohnten Maßnahmen<br />
und beschuldigte die „üblichen Verdächtigen“:<br />
George Soros und AusländerInnen.<br />
Letztere waren es laut dem<br />
Staatschef, die Covid-19 nach Ungarn<br />
brachten. Allerdings kamen vergleichsweise<br />
wenig TouristInnen auf Besuch,<br />
sondern mehr jene heimischen „GastarbeiterInnen“<br />
aus Oberitalien und Tirol<br />
wieder nach Hause, die vermutlich das<br />
Virus mit sich brachten. Getestet wurden<br />
sie zum Großteil nicht. Orbán nutze<br />
die virale Notsituation Ungarns aus und<br />
zog der Demokratie vorerst den Stecker.<br />
Nachdem die EU und deren Kommissionspräsidentin<br />
Ursula Von der Leyen<br />
Kritik ausübte und sogar mit „Maßnahmen“<br />
gedroht wurden, erwähnte der<br />
ungarische Staatschef im Zuge einer<br />
gemeinsamen Pressekonferenz mit<br />
Serbiens Oberhaupt Aleksandar Vučić<br />
das voraussichtliche Auslaufen seiner<br />
Vollmacht mit Ende Mai 2020. Dies<br />
hinderte Viktor Orbán allerdings nicht<br />
daran, noch im Mai 2020 die Grundrechte<br />
von trans- und intersexuellen<br />
Menschen massiv einzuschränken.<br />
Der belarussische Präsident Alexander<br />
Lukaschenko hingegen leugnete<br />
jegliche Fakten zu Covid-19, wie „ZEIT<br />
Online“ berichtete. Offizielle Zahlen<br />
scheinen den Autokraten wenig zu<br />
interessieren. Wiederholend sprach<br />
er von der „Corona-Psychose“ und<br />
demonstrierte mit einer 3.000 SoldatInnen<br />
starken Militärparade im Zuge<br />
des heimischen „Tag des Sieges“ am 9.<br />
Mai seine Entschlossenheit. Selbst dem<br />
russischen Oberhaupt Vladimir Putin<br />
war die virale Lage zu heikel: Feierlichkeiten<br />
wurden abgesagt. Die Ignoranz<br />
von Lukaschenko in Kombination der<br />
Bilder und Berichte aus der EU und China<br />
führte dazu, dass die BürgerInnen<br />
der Republik Belarus sich freiwillig in<br />
Selbstisolation begaben, Homeoffice<br />
einführten und soziale Kontakte minimierten.<br />
Nachdem Chinas staatliche „Volkszeitung“<br />
Ende Dezember 2019 die Krankheit<br />
vermeldete, verging fast ein Monat,<br />
in dem das Virus in Wuhan wütete. Dr.<br />
Li Wenliang, der die Entdeckung machte<br />
und davor warnte, wurde Anfang Jänner<br />
© Copyright: adobe stock / Jürgen Fälchle<br />
Mediales Alternativ-Bingo<br />
27
von staatlichen Behörden gezwungen,<br />
eine Verschwiegenheitserklärung zu<br />
unterzeichnen. Ein fragwürdiger „Lösungsansatz“,<br />
denn der Arzt verstarb<br />
Anfang Februar an dem sich rasant<br />
ausbreitenden Virus.<br />
Auf der anderen Seite des Globus wurden<br />
ebenfalls fragwürdige Lösungsansätze<br />
thematisiert, um vor dem Virus<br />
geschützt zu sein. Der brasilianische<br />
rechtspopulistische Präsident Jair Bolsonaro<br />
empfahl über Social Media das<br />
Malaria-Mittel Hydroxychloroquin einzunehmen.<br />
Wissenschaftlich belegt?<br />
Nein. Weiters verharmloste das brasilianische<br />
Oberhaupt über „Twitter“ das<br />
Virus, indem er sich über den „kleinen<br />
Schnupfen“ sowie die „Medienhysterie“<br />
verlachend äußerte. Der Venezolaner<br />
Nicolás Maduro tat es dem Brasilianer<br />
gleich. Resultat: „Facebook“ und „Twitter“<br />
griffen durch und löschten Tweets<br />
und Posts mit Falschinformationen.<br />
Richtet man den Blick weg vom südlichen<br />
Amerika in Richtung Norden<br />
wird klar, weshalb die Debatte mancher<br />
amerikanischen Medien über die<br />
mentale Gesundheit der US-amerikanischen<br />
Präsidenten eine durchaus relevante<br />
ist.<br />
Laut Donald Trump sei das Virus ein<br />
Genie, das undurchschaubar ist und<br />
aus dem Forschungslabor aus Wuhan<br />
stamme, welches mithilfe von Frankreich<br />
gebaut wurde. Unzählige Berichte<br />
widerlegen die Laborherkunft des Virus,<br />
laut Felix Simon wurden die „Wuhan-Labor-Story<br />
und die angeblichen<br />
Geheimdienstberichte von der US-Botschaft<br />
in Canberra an eine australische<br />
Zeitung gefüttert. Trumps Pandemie-<br />
Slogan lautete: „Wir haben alles richtig<br />
gemacht, und China versucht die Wahlen<br />
in den USA zu sabotieren“. Die Wahlsabotage<br />
war im österreichischen Tirol<br />
zwar kein Thema, allerdings war man<br />
auch hier der Meinung, man habe alles<br />
richtiggemacht. Ein Blick auf die Zahlen<br />
in den USA zeigte jedoch andere Tatsachen,<br />
da half auch nicht der Rat des<br />
Präsidenten, sich Desinfektionsmittel<br />
zu injizieren oder Bleichmitteln zu gurgeln.<br />
Nicht nur Bolsonaro schenkte dem<br />
Malaria-Medikament seine Aufmerksamkeit,<br />
auch Donald Trump sprach<br />
über dieses in Pressekonferenzen. Die<br />
präsidiale Zuwendung ging so weit,<br />
dass der amerikanische Staatschef seine<br />
Präventionstherapie beschrieb, um<br />
vor Covid-19 geschützt zu sein, bei der<br />
er angeblich jeden Tag eine Tablette Hydroxychloroquin<br />
einnahm.<br />
© Copyright: adobe stock / J ürgen Fälchle<br />
Entwaffnende Zeiten<br />
Stephan Russ-Mohl sowie Felix Simon<br />
sind sich bei der Frage, ob Covid-19<br />
die Populisten dieser Welt entwaffnen<br />
wird, einig: Jein. Beide verweisen auf<br />
die länderspezifischen Merkmale, die<br />
Populisten zum Erfolg verhelfen. In den<br />
USA gewann der demokratische Präsidentschaftskandidat<br />
Joe Biden an Zuspruch,<br />
da Trumps Lügen mittlerweile<br />
mehr als offensichtlich seien, so Russ-<br />
Mohl. Simon, Forscher am Reuters Institute<br />
for the Study of Journalism der<br />
Universität Oxford, weist darauf hin,<br />
dass in Ländern wie Großbritannien<br />
und den USA die aktuellen Regierungen<br />
anfangs noch einen erhöhten Zuspruch<br />
erhielten. „Man nennt diesen Effekt im<br />
englischen ‚,Rally around the Flag‘“, so<br />
Simon. Dieser sei in beiden Ländern<br />
mittlerweile jedoch weitestgehend verschwunden.<br />
In Deutschland profitierten<br />
die CDU sowie Angela Merkel enorm<br />
von diesem Effekt, der für Krisenzeiten<br />
typisch sei. Weiters ist der Forscher der<br />
Meinung, dass Populisten, die nicht die<br />
Regierung bilden, sondern in der Opposition<br />
sind, eher verlieren als gewinnen.<br />
Die Regierungspartei ÖVP erlebte<br />
diesen Auftrieb bereits, denn laut Umfragen<br />
im April 2020 lag sie bei einem<br />
Zuspruch von 48%. Der Rückhalt für<br />
den italienischen Premierminister Giuseppe<br />
Conte und dessen Maßnahmen,<br />
die laut Simon recht früh relativ hart<br />
waren, stellten einen spannenden Fall<br />
dar. „Gleichzeitig wissen wir nicht, wie<br />
Salvini (Anm.: stv. Ministerpräsident<br />
bis August 2019) mit seiner sehr stark<br />
nationalistischen und faschistischen<br />
euroskeptischen Ideologie punkten<br />
wird, wenn die Krise überstanden ist“,<br />
fährt Felix Simon fort. Die ersten Aktionen<br />
wurden schon während der Krise<br />
gestartet. So entschieden sich Matteo<br />
Salvini sowie 70 seiner Abgeordneten<br />
dazu, am 29. April das Parlament zu<br />
besetzen, um dort zu übernachten. Mit<br />
diesem Protestakt forderte die rechte<br />
Lega-Partei konkrete Informationen<br />
zur Maskenpflicht und den sanitären<br />
Sicherheitsmaßnahmen. Auch in Österreich<br />
war Protest aus den Reihen<br />
der Opposition zu spüren. „Wo ist der<br />
Corona-Virus App?“ rief Herbert Kickl<br />
(FPÖ) am 27. Februar im Zuge der 12.<br />
Nationalratssitzung der aktuellen Legislaturperiode.<br />
Kickl forderte die aktuelle<br />
Regierung auf, digitale Maßnahmen<br />
zu setzen. Am 16. April kündigte der<br />
Klubobmann an, nachdem er im Nationalrat<br />
selbst eine App gefordert hatte,<br />
Anzeige gegen die „Stopp Corona“-App<br />
des Roten Kreuzes zu erstatten. Grund<br />
seien „massive datenschutzrechtliche<br />
Bedenken“ gewesen.<br />
Laut Simon haben es oppositionelle<br />
Populisten in solchen Zeiten nicht<br />
leicht. Die Medien waren und sind voll<br />
mit Berichterstattungen über die Pandemie.<br />
Zu erkennen sei dies daran, so<br />
Simon, dass sich rechtpopulistische<br />
Oppositionsparteien, wie die AFD oder<br />
die FPÖ, aktuell schwerer täten, mit<br />
ihren Themen durchzudringen. Auch<br />
die linkspopulistische italienische „Movimento<br />
5 Stelle“-Bewegung habe es<br />
aktuell schwer, mit ihren Themen Aufmerksamkeit<br />
zu erhalten und sich in die<br />
öffentliche Diskussion einzubringen.<br />
Viraler Rückkopplungseffekt<br />
Stephan Russ-Mohl, Gründer des European<br />
Journalism Observatory, rückt im<br />
Zuge pandemischer Zeit einen weiteren<br />
Aspekt in den Vordergrund: Selbstkritik.<br />
Er persönlich streicht vorab hervor,<br />
dass viele KollegInnen im Journalismus<br />
einen bemerkenswerten Job leisten,<br />
gerade in so schwierigen Zeiten. Allerdings<br />
wünscht er sich von JournalistInnen<br />
mehr Selbstkritik. „Man sollte sich<br />
selbst fragen, was man da eigentlich tut<br />
und was man anderen möglicherweise<br />
antut“, so Russ-Mohl. Dies äußert er in<br />
Hinblick auf die, durch Zeitdruck und<br />
Ressourcenmangel entstandene Verwendung<br />
und Verbreitung perfekt inszenierter<br />
Propaganda und Zahlen aus<br />
China, einem Land, in dem jede Information<br />
nach außen entweder zensiert<br />
28<br />
Mediales Thema Alternativ-Bingo
oder verschönert bzw. abgeändert wird.<br />
„Selbst wenn es vertrauenswürdige<br />
Quellen sind wie zum Beispiel die WHO,<br />
haben auch diese über die landesinterne<br />
Lage Chinas keinen tatsächlichen<br />
Überblick. Woher wissen wir wirklich,<br />
dass es in China keine neuen Fälle<br />
gibt? Meiner Meinung nach wurde viel<br />
zu gläubig die chinesische Propaganda<br />
nachgebetet“, so Russ-Mohl. Dies gelte<br />
auch für viele weitere Meldungen, wie<br />
beispielsweise den Krankenhausbau in<br />
Wuhan, die man aus den klassischen<br />
Medien entnehmen kann. Laut Felix Simon<br />
sei Aufmerksamkeit jene Währung,<br />
die Autokraten und Populisten anstrebten,<br />
ganz gleich ob am linken oder rechten<br />
Rand des politischen Spektrums. Da<br />
sie meist extreme Positionen vertreten,<br />
fällt es ihnen schwer, eine größere Bevölkerungsschicht<br />
damit zu erreichen.<br />
Daher bedient man sich sozialen sowie<br />
alternativen Medienplattformen. „Zum<br />
einen, weil‚,Facebook‘ & Co. so gesehen<br />
keine richtige Gatekeeper-Funktion innehalten<br />
und daher jede/r diese Dienste<br />
nutzen kann“. Die extremen Inhalte,<br />
ob in Trumps Kurzform oder in Straches<br />
ausführlichen „Facebook“-Postings,<br />
seien oftmals dermaßen provozierend,<br />
dass viele JournalistInnen sich,<br />
laut Simon, dazu gezwungen fühlen<br />
„in irgendeiner Form darauf zu reagieren<br />
und zu berichten.“ Dies führe allerdings<br />
zu einem Rückkopplungseffekt:<br />
„Dadurch, dass darüber berichtet wird,<br />
dass XY etwas Fragwürdiges gesagt<br />
hat, verhilft man XY dazu, noch weitere<br />
Kreise der Gesellschaft zu erreichen. Es<br />
ist effektiv wie ein Virus“, pointiert Simon<br />
im Interview mit <strong>SUMO</strong>.<br />
Medialer Einfluss<br />
Der Wahlkampf Trumps hat gezeigt,<br />
welche Fäden im Hintergrund gezogen<br />
werden, um eine Wahl zu gewinnen.<br />
Laut Simon geschehen diese Hintergrundaktivitäten<br />
wie bei Trumps Wahlkampf<br />
2016 „die ganze Zeit“: „Alle<br />
halbwegs vernünftigen Studien, die<br />
wir zu dem Thema haben zeigen, dass<br />
es davor schon ausgeklügelte digitale<br />
Wahlkampf-Strategien gab. Digitale<br />
Kampagnen mit gezieltem Bespielen<br />
von Inhalten an gewisse Gruppen hat<br />
man auch schon im Zuge der Obama-<br />
Kampagne 2008 gemacht. Damals<br />
waren es halt die Guten.“ Auch die<br />
Propaganda-Netzwerke, die im Zuge<br />
der Trump-Kampagne vom Moskauer<br />
Kreml bespielt wurden, wären zum Teil<br />
schon vorher vorhanden gewesen und<br />
existierten immer noch. „Aktuell, Covid-19<br />
ist hier ein gutes Bespiel, gibt es<br />
von Staaten organisierte Kampagnen,<br />
die darauf abzielen oder zumindest<br />
versuchen, Meinung zu beeinflussen<br />
bzw. Verwirrung zu stiften“, konstatiert<br />
Simon. Nur welcher Einfluss ist denn<br />
nun größer: jener der klassischen Medien<br />
oder doch das WWW? Russ-Mohl<br />
stellt klar: „Diese Frage ist nicht wirklich<br />
beantwortbar.“ Die Begründung<br />
hierfür liegt einerseits in der selektiven<br />
Nutzung des World Wide Web bzw. der<br />
Sozialen Medien und andererseits der<br />
Mainstreammedien. „Die klassischen<br />
Gatekeeper haben immer noch einen<br />
relativ großen Einfluss, wenn es darum<br />
geht, was zur Nachricht wird und hinterher<br />
zirkuliert, auch im WWW. Allerdings<br />
haben sie ihre Gatekeeper-Funktion<br />
verloren. Dass einige wenige große<br />
Anbieter im WWW, aber auch in klassischer<br />
Form dementsprechend einflussreich<br />
sind ist trivial. Da zählt auch<br />
Rupert Murdochs Medienimperium<br />
dazu, welches aufgrund der Spannweite<br />
(‚Fox News‘, ‚Wall Street Journal‘, etc.)<br />
durchaus bedrohlich „wirkt“, so Russ-<br />
Mohl. Felix Simon tendiert in seiner<br />
Antwort auf obige Frage eher zu den<br />
klassischen Medien. Im Zuge der Debatte<br />
um Trumps Wahlkampf wurden<br />
diese direkten Medieneffekte erwähnt.<br />
„Trump mit ‚Fox News‘ erzeugt keine<br />
direkten „Sofort-Effekte“, behauptet<br />
Simon. „Das klassische Hypodermic<br />
Needle Model, laut dem man Personen<br />
mit Informationen füttern kann und<br />
die dann daraufhin machen, was man<br />
will, ist seit den 60er Jahren widerlegt.<br />
Diese direkten Effekte gibt es in der<br />
Breite nicht“, fährt Simon fort. Er sehe<br />
eher in den langfristigen Effekten und<br />
Feedbackmechanismen zwischen RezipientInnen<br />
und Mediennetzwerken eine<br />
subtile Form des Einflusses. „In dieser<br />
Hinsicht sind die traditionellen Medien<br />
immer noch bedeutsamer. In den USA<br />
ist es immer noch das Fernsehen, das<br />
unter den Medienformen den größten<br />
Einfluss auf die Wahlentscheidung<br />
hat, aber eben auch nicht der einzige,<br />
weil etwa das soziale Umfeld, das Einkommen<br />
oder die Bildung oft viel mehr<br />
zählt.“ Digitale Medien seien zwar in den<br />
letzten Jahren deutlich – daher auch in<br />
ihrem Einfluss – gewachsen, „jedoch<br />
liegt die meiste Aufmerksamkeit immer<br />
noch bei den großen Playern wie<br />
etwa BBC, ZDF oder CNN. Der Reuters<br />
Digital Newsreport 2019 zeigt, dass für<br />
die meisten Länder Fernsehkanäle die<br />
höchste Reichweite und dadurch den<br />
größten Einfluss haben. Das überträgt<br />
sich durch deren eigene Websites zum<br />
Teil dann in das WWW.“<br />
Russ-Mohl würde sich bei der Schulaufsatzfrage:<br />
Internet – Segen oder<br />
Fluch?, immer noch für die erstere Antwort<br />
entscheiden – auch in Kenntnis<br />
von Darknet, Bot-Netzwerken und Desinformationsschleudern.<br />
Der Grund: die<br />
Möglichkeit des selbständigen Faktenchecks<br />
und der Ermittlung von Zusatzinformationen.<br />
Medienkompetenz als Antidot zu Populismus<br />
Das aktuelle Regierungsprogramm von<br />
Türkis-Grün sieht im Bereich der Bildung<br />
eine Stärkung der Medienkompetenz<br />
vor, sowie der politischen Bildung.<br />
Gleichzeitig erlaube man aber JournalistInnen<br />
teils nicht mehr, bei Pressekonferenzen<br />
der Regierung Fragen zu<br />
stellen. Ebenfalls zeige man bislang ein<br />
© Copyright hier<br />
© Copyright: adobe stock / Chris<br />
Mediales Alternativ-Bingo<br />
29
nicht zu verzeichnendes Interesse an<br />
einer Änderung des 2017 in Kraft getretenen<br />
Medienförderungsgesetztes,<br />
das schon damals sowie auch im März<br />
2020 für heftige Diskussionen sorgte.<br />
Russ-Mohl meint, dass es PolitikerInnen<br />
sehr wohl bewusst sei, wie wichtig<br />
Medienkompetenz ist, allerdings<br />
verweist er auf den legendären Satz<br />
des einstigen deutschen Bundeskanzlers<br />
Gerhard Schröder: „Zum Regieren<br />
brauch‘ ich nur ‚BILD‘, ‚Bams‘ (‚Bild am<br />
Sonntag‘) und Glotze.“ Felix Simon betont<br />
neben der Bedeutung schulischer<br />
Medienbildung noch eine weitere: „Es<br />
sind die Eltern und Großeltern, die hier<br />
mehr Erfahrung brauchen.“ Laut Statistik<br />
Austria belief sich 2019 der Bevölkerungsanteil<br />
Österreichs im Alter<br />
zwischen 45-64 auf 29%. „Es gibt Studien<br />
über die USA, die zeigen, dass vor<br />
allem die Gruppe 50-65+ diejenige ist,<br />
die am anfälligsten für Falschinformationen<br />
im Internet ist. Allerdings, wenn<br />
ich die Dinge glauben will, dann glaube<br />
ich was ich lese oder sehe. Da hilft oft<br />
auch keine Medienkompetenz.“ Stichwort:<br />
Motivated Reasoning und Confirmation<br />
Bias. Ersteres beschreibt das<br />
unbemerkte Lenken eines Denkprozesses<br />
in jene Richtung, die ein bestimmtes<br />
Ergebnis präferiert. Dies geschieht<br />
durch einen systematischen Fehler<br />
bei der Abrufung oder Bewertung von<br />
Information. Unter dem Confirmation<br />
Bias (zu Deutsch auch Bestätigungsfehler)<br />
versteht man die Bestätigung<br />
eigener Hypothesen durch das Bevorzugen<br />
passender Informationen oder<br />
Quellen, unabhängig von deren Wahrheitsgehalt.<br />
Allerdings wären die Kosten für eine<br />
Generation, die sich entweder schon<br />
in der Pension befindet (oder auf diese<br />
zugeht) für eine Regierung in aktuellen<br />
Zeiten schwer zu rechtfertigen. Obendrein<br />
würde laut Medienwissenschaftler<br />
Russ-Mohl „das Leben der PolitikerInnen<br />
nicht leichter werden, wenn sie<br />
Felix Simon / Copyright: Magdalena Góralska<br />
auf sehr viele sehr medienkompetente<br />
BürgerInnen stoßen würden. Wenn<br />
man sich die Bildungspolitik der letzten<br />
20 Jahre ansieht, dann darf man davon<br />
ausgehen, dass hier kein großes Interesse<br />
besteht, dies zu ändern, auch um<br />
etwas Langfristiges für die Demokratie<br />
zu tun.“ Er sehe meist nur ein zentrales<br />
primäres Interesse bei den meisten<br />
PolitikerInnen: die Wiederwahl. „Dementsprechend<br />
werden die Prioritäten<br />
gelegt. Da zählt die Medienkompetenz<br />
nicht dazu. Rente ist für ein altes Wählervolk<br />
wichtiger als die Medienpolitik.“<br />
von Lukas Pleyer<br />
Stephan Russ-Mohl / Copyright: Muphovi<br />
30
Hate Speech und die Politik<br />
Hate Speeches können jede/n treffen – unter anderem auch PolitikerInnen. <strong>SUMO</strong><br />
hat versucht mit Betroffenen zu sprechen, leider ergebnislos. Der Artikel befasst sich<br />
daher damit, wie die Politik mit Hate Speeches umgeht und welche Maßnahmen und<br />
Initiativen es gegen dieses problematische Phänomen gibt.<br />
© Copyright: adobe stock / picsfive<br />
Jörg Meinbauer definiert in seinem<br />
2013 im Sammelband „Hassrede/Hate<br />
Speech – Interdisziplinäre Beiträge zu<br />
einer aktuellen Diskussion“ erschienenen<br />
Artikel den Begriff wie folgt: „Unter<br />
Hate Speech – hier übersetzt mit<br />
‚Hassrede‘– wird im Allgemeinen der<br />
sprachliche Ausdruck von Hass gegen<br />
Personen oder Gruppen verstanden,<br />
insbesondere durch die Verwendung<br />
von Ausdrücken, die der Herabsetzung<br />
und Verunglimpfung von Bevölkerungsgruppen<br />
dienen“. Speziell PolitikerInnen<br />
werden immer wieder Zielscheibe<br />
verschiedener Hassausprägungen.<br />
Dies zeigt der Artikel „43 Gewaltdelikte<br />
in einem Jahr“ des „ARD-Faktenfinders“<br />
(20.06.2019). Im Jahr 2018 gab es so<br />
laut Bundeskriminalamt 1.256 Straftaten<br />
gegen PolitikerInnen in Deutschland,<br />
in 43 Fällen wurden diese als<br />
Gewaltdelikte eingestuft. Insgesamt<br />
wurden von den 1.256 Straftaten 517<br />
von rechts- und 209 von links-motivierten<br />
TäterInnen begangen. Als nicht<br />
zuordnende, ausländisch-ideologische<br />
oder religiös motivierte Taten zählte<br />
man 664. Im Jahr 2017 wurden laut<br />
Bundeskriminalamt 1.512 und im Jahr<br />
2016 1.840 Straftaten gegenüber PolitikerInnen<br />
in Deutschland begangen.<br />
„Hate Speech“ kann bis zum Tod führen<br />
Im Extremfall kann Hass gegenüber<br />
PolitikerInnen mit dem Tod dieser enden.<br />
Ein Opfer unkontrollierten Hasses<br />
wurde die britische Labour-Abgeordnete<br />
Helen Joanne „Jo“ Cox. Die „Frankfurter<br />
Allgemeine Zeitung“ berichtete am<br />
23.11.2016 über diesen Fall. Cox setzte<br />
sich im Zuge des Austrittsreferendums<br />
(„Brexit“) für einen Verbleib Großbritanniens<br />
in der EU ein. Eine Woche bevor<br />
dieses Referendum stattgefunden hatte,<br />
wurde die Politikerin aufgrund ihrer<br />
politischen Einstellung von einem Mann<br />
auf offener Straße angeschossen und<br />
anschließend erstochen. Er soll bevor<br />
er auf sie geschossen hat „Britain first“<br />
gerufen haben. Der Täter wurde zu lebenslanger<br />
Haft verurteilt. Ein weiterer<br />
Fall, in dem ein Politiker aufgrund seiner<br />
Einstellung getötet wurde ist jener von<br />
Walter Lübcke. „ZDF-Heute“ berichtete<br />
am 29.04.2020 über diesen Mord. Lübcke<br />
war Regierungspräsident von Kassel<br />
und wurde im Juni 2019 in seinem<br />
Haus erschossen. In Deutschland war<br />
dies der erste Mord an einer/m PolitikerIn<br />
seit 1984. Aus dem Beitrag geht<br />
ebenfalls hervor, dass ein Verdächtiger<br />
im April 2020 angeklagt wurde. Lübcke<br />
setzte sich für Flüchtlinge ein, der Angeklagte<br />
soll ihn aus rechtsextremen<br />
Motiven getötet haben. Der Prozess<br />
steht noch aus (Stand Mai 2020).<br />
Hate Speech kann jede/n treffen<br />
Dass nicht nur PolitkerInnen zur Zielscheibe<br />
von Hate-Speeches werden,<br />
zeigt eine von FORSA im Auftrag der<br />
Landesanstalt für Medien Nordrhein-<br />
Westfalen durchgeführten Studie. Dafür<br />
wurden im Dezember 2018 1.005<br />
Personen ab 14 Jahren in Deutschland<br />
mittels eines Online-Fragebogens zu<br />
diesem Thema befragt. 47% der Befragten<br />
gaben an, dass sie in Sozialen<br />
Medien schon einmal mit Hass konfrontiert<br />
waren, auf Nachrichtenwebsites<br />
waren dies 35%. 2% erhielten<br />
schon einmal persönlich adressierte<br />
Hassnachrichten per Mail. In der Studie<br />
wurde ebenfalls erhoben, ob die befragten<br />
Personen sich an Diskussionen<br />
im Internet beteiligen. Bei dieser Frage<br />
konnten geschlechterspezifische<br />
Unterschiede festgestellt werden. 58%<br />
der Männer gaben an, sich an Diskussionen<br />
zu beteiligen, bei den Frauen war<br />
der Anteil mit 40% deutlich geringer.<br />
Rechtliche Schritte in Österreich<br />
Nicht alle Äußerungen und Taten, die<br />
unter den Begriff „Hate Speech“ fallen<br />
sind auch tatsächlich Straftaten.<br />
In Artikel 10 der europäischen Menschenrechtskonvention<br />
wird die Meinungsfreiheit<br />
jeder einzelnen Person<br />
festgelegt, so hat jede/r BürgerIn das<br />
Recht, ihre/seine Meinung frei zum<br />
Ausdruck zu bringen. Dieses Recht<br />
kann jedoch unter gewissen Voraussetzungen<br />
eingeschränkt werden. Das<br />
kann beispielsweise der Fall sein, wenn<br />
© Copyright: adobe stock / pustleflower9024<br />
Hate Speech und die Politik<br />
31
Gesundheit oder Moral geschützt werden<br />
müssen. Des Weiteren ist eine<br />
Einschränkung möglich, wenn diese<br />
zur Verbrechensverhütung oder zum<br />
Schutz des guten Rufs dient. Aufgrund<br />
der unterschiedlichen Formen von<br />
„Hate-Speeches“ gibt es kein einheitliches<br />
Gesetz, nach dem über Fälle von<br />
Hassreden geurteilt werden könnte. Es<br />
gibt jedoch unterschiedliche Gesetze<br />
in Österreich, die einzelne Ausprägungen<br />
abdecken. Personen, die öffentlich<br />
Verhetzung betreiben, können nach<br />
§283 des Strafgesetzbuchs verurteilt<br />
werden. Dort ist festgelegt, dass Personen,<br />
die verhetzende Botschaften in<br />
Bezug auf Religion, Staatsangehörigkeit,<br />
Weltanschauung, Hautfarbe und<br />
anderem verbreiten, mit Freiheitsstrafen<br />
von bis zu zwei Jahren bestraft<br />
werden können. Die Leugnung des Holocausts<br />
oder die Verherrlichung der<br />
Taten der NationalsozialistInnen kann<br />
nach §3 des Verbotsgesetzes ebenfalls<br />
zu Verurteilungen führen. Verschiedene<br />
Formen der Hassreden können<br />
nicht nur strafrechtlich, sondern auch<br />
zivilrechtlich verfolgt werden. Entsteht<br />
etwa durch eine Hassrede ein Schaden,<br />
der beispielsweise zu Gewinnverlusten<br />
führt, kann nach §1330 des Allgemein<br />
Bürgerlichen Gesetzbuchs aufgrund<br />
der Ehrenbeleidigung geurteilt werden.<br />
Laut der Website des österreichischen<br />
Klagsverbands gibt es bei Klagen, die<br />
“Hate Speeches“ betreffen, nur sehr<br />
wenige Verurteilungen.<br />
Maßnahmen<br />
Jede/r kann von Hate-Speeches betroffen<br />
sein, daher wurde im Jahr 2013 die<br />
Initiative „No Hate Speech Movement“<br />
vom Europarat gegründet. Auf der<br />
Homepage der österreichischen Variante<br />
der Initiative „National No Hate<br />
Speech Komitee“ wird erklärt, welchen<br />
Zweck diese Initiative hat. Es soll unter<br />
anderem Menschen anregen, gegen<br />
Hass vorzugehen und Aktionen zu unterstützen,<br />
die sich mit dieser Thematik<br />
befassen. Die vom Bundesministerium<br />
für Arbeit, Familie und Jugend und vom<br />
bundesweiten Netzwerk für offene Jugendarbeit<br />
unterstützte Initiative bietet<br />
außerdem Ratschläge zum Umgang mit<br />
Hass. Eine weitere Maßnahme gegen<br />
Hass im Netz wurde 2017 vom Land<br />
Steiermark, der Stadt Graz und der Antidiskriminierungsstelle<br />
Steiermark ins<br />
Leben gerufen. Laut Presseaussendung<br />
der Antidiskriminierungsstelle vom<br />
18.04.2018 ist die „Ban-Hate-App“<br />
international die erste App, die es ermöglicht,<br />
Hasspostings zu melden. Die<br />
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle,<br />
Daniela Grabovic, äußerte sich in der<br />
Aussendung wie folgt: „Leider nimmt<br />
die Anzahl der Hasspostings weiter rapide<br />
zu. Um ein Gegengewicht dazu zu<br />
schaffen und nicht tatenlos zuzuschauen,<br />
haben wir diese App entwickelt.<br />
Wir hoffen auf eine starke Beteiligung<br />
der Menschen und auf Zivilcourage.<br />
Gemeinsam können wir zeigen, dass<br />
Hass im Netz keine Chance hat.“ Auf<br />
der Homepage der „Ban-Hate-App“<br />
wird beschrieben, wie die UserInnen,<br />
die ein Hassposting gegen sich oder<br />
andere entdecken, vorgehen sollen. Zuerst<br />
muss bekanntgegeben werden, auf<br />
welchem Social-Media-Kanal das Posting<br />
zu finden ist. Im Anschluss können<br />
die UserInnen den Hass einer Kategorie<br />
zuordnen, unterteilt in Diskriminierung<br />
wegen: Alter, Behinderung, ethnischer<br />
Herkunft, Geschlecht, politischer Anschauung,<br />
Religion, sexueller Ausrichtung<br />
und sozialer Herkunft. Anschließend<br />
soll noch ein Screenshot und der<br />
Link zum Hassposting in die App geladen<br />
werden. Die gemeldeten Postings<br />
werden von der Antidiskriminierungsstelle<br />
geprüft. Diese fordert die BetreiberInnen<br />
der Social-Media-Sites zur Löschung<br />
der Postings auf. Sollten Inhalte<br />
auch von strafrechtlicher Relevanz sein,<br />
kann dies auch angezeigt werden.<br />
Rolle der Medien<br />
Aber auch die Medien sind in ihrer prinzipiellen<br />
Vermittlungs- und Thematisierungsrolle<br />
gefragt. Liriam Sponholz<br />
forscht an der Österreichischen Akademie<br />
der Wissenschaften unter anderem<br />
zu diesem Thema und habilitierte 2018<br />
an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt<br />
zu „Hate Speech in den Massenmedien“.<br />
Sie konstatiert darin: „Was das<br />
Verhältnis von Medien und Hate Speech<br />
betrifft, können Medien diese Inhalte:<br />
nicht thematisieren, als Nonsens thematisieren,<br />
als Skandal thematisieren,<br />
als Kontroverse thematisieren, mit<br />
anderen gesellschaftlichen Akteuren<br />
eine öffentliche Streitfrage generieren.“<br />
(Sponholz 2018, S. 137) Und Ronald<br />
Pohl, Kulturjournalist beim „STAN-<br />
DARD“, rief im selbigen (16.02.2020)<br />
dazu auf: „Alle durch Hate-Speech Diffamierten<br />
gehören aus der Erstarrung<br />
der Opferrolle erlöst. Das wirkungsvollste<br />
Druckmittel gegenüber Ressentiment<br />
ist die Widerrede: Aufmüpfigkeit,<br />
die sich ihre gedankliche Eigenständigkeit<br />
bewahrt.“<br />
von Viktoria Strobl<br />
© Copyright: adobe stock / pusteflower9024<br />
32<br />
Hate Speech und die Politik
Emotionalisierung und Dramatisierung<br />
um jeden Preis<br />
Die Krise der Europäischen Union ist heute fünf Jahre her, trotzdem versuchen täglich Menschen nach Europa<br />
zu gelangen. Jeden Tag wird über sie berichtet, aber wie? Was bewirken die bewusst gewählten Begriffe<br />
in unserer Mediengesellschaft? <strong>SUMO</strong> hat dazu mit einem Geflüchteten, sowie mit Univ.-Prof. Fritz Hausjell<br />
(Univ. Wien) und Marie-Claire Sowinetz, Mitarbeiterin der UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR gesprochen.<br />
© Copyright: adobe stock / Lydia Greissler<br />
„Illegale“, „EinwanderInnen“ oder „AsylantInnen“<br />
werden sie in den Medien<br />
genannt. Sie selbst werden kaum zu<br />
Wort gebeten. Als Präsident Erdogan<br />
am 1. März 2020 verkündete, dass die<br />
Türkei syrische Kriegsflüchtlinge nicht<br />
mehr an der Weiterreise nach Europa<br />
hindern werde, entfachte die Migrationsdebatte<br />
erneut.<br />
Der Krieg dauert noch immer an<br />
Seit neun Jahren herrscht in Syrien ein<br />
erbarmungsloser Bürgerkrieg. Ausgelöst<br />
wurden die Spannungen durch<br />
friedliche Proteste gegen die autoritäre<br />
Herrschaft des Präsidenten Baschar al-<br />
Assad während des Arabischen Frühlings<br />
2011. Im Laufe des Konfliktes geriet<br />
der Gedanke der Demokratisierung<br />
zunehmend in den Hintergrund, stattdessen<br />
kam es zu einem Krieg unterschiedlicher<br />
Religionen und Ethnien.<br />
Gegenwärtig kämpfen die Türkei und<br />
islamistische Rebellen, sowie Terroristen<br />
in der Stadt Idlib gegen die syrische<br />
Armee des Präsidenten al-Assad, Russland<br />
und Iran. Die Türkei griff in die Auseinandersetzungen<br />
ein, um sich kurdische<br />
RebellInnen, die das Grenzgebiet<br />
beherrschen, vom nationalen Leibe zu<br />
halten. Erdogan möchte so progressive<br />
und emanzipatorische Bestrebungen<br />
der türkischen KurdInnen unterbinden.<br />
Zusätzlich werden die RebellInnen von<br />
Saudi-Arabien und den USA unterstützt,<br />
den Erzfeinden des Irans.<br />
Flucht vor Diversität in österreichischen<br />
Medien und der Politik<br />
Die Wörter „Flüchtlingswelle“ und „illegaler<br />
Migrantenstrom“ sind aus der Berichterstattung<br />
des Jahres 2015 nicht<br />
mehr wegzudenken. Fünf Jahre später<br />
ist die Sprache der Politik und der Medien<br />
vielfach weiterhin aggressiv, bei<br />
RezipientInnen schürt diese Wortwahl<br />
Angst. Sie löst mitunter gar Panik aus,<br />
vor dem Ungewissen und dem Fremden.<br />
Laut der Bilanz 2019 des Bundesamts<br />
für Fremdwesen und Aysl (Stand:<br />
10.01.2020) wurden seit 1. Jänner 2015<br />
in Österreich mehr als 180.000 Asylanträge<br />
gestellt, trotzdem muss man<br />
nach den persönlichen Erfahrungen der<br />
Betroffenen in nationalen Medien mit<br />
der Lupe suchen. Nahezu ein Viertel<br />
der Bevölkerung Österreichs hat einen<br />
Migrationshintergrund. Für eine repräsentative<br />
Darstellung dieser müssten<br />
45 der 183 Nationalratsabgeordneten<br />
einen Migrationshintergrund haben –<br />
tatsächlich sind es neun. Ebenso erheblich<br />
unterrepräsentiert sind diese Personen<br />
in österreichischen Medien, auch<br />
in Qualitätsmedien. Anstatt für mehr<br />
Diversität unter den eigenen MitarbeiterInnen<br />
zu sorgen, lassen sich maximal<br />
Gastkommentare zu besonderen<br />
Medienereignissen von ausländischen<br />
JournalistInnen finden.<br />
Marie-Claire Sowinetz von UNHCR betont,<br />
dass die Perspektive der Flücht-<br />
linge in der Berichterstattung oft zu<br />
kurz kommt. „Vor allem in der Zeit von<br />
2015 bis 2016 wurde festgestellt, dass<br />
es häufig nur zwei Arten der Berichterstattung<br />
über Flüchtlinge gab: entweder<br />
Flüchtlinge als Opfer darzustellen, oder<br />
als potenzielle Bedrohung für die Aufnahmeländer“,<br />
erinnert sie sich.<br />
Während sich die negative Berichterstattung<br />
über Flucht in den letzten<br />
Jahren bei 4% der Artikel hielt, zeigt eine<br />
Studie des Wiener Publizistikinstituts,<br />
dass es im Jahr 2019 schon 7% waren,<br />
berichtete Hausjell bei einer Veranstaltung<br />
im April 2019 im Rahmen des Projekts<br />
„Core – Integration im Zentrum“.<br />
Der Anteil positiver Berichterstattung<br />
über AsylwerberInnen lag 2019 bei<br />
21,8%, im Vorjahr um 1,7% höher. Das<br />
Projekt der Stadt Wien wurde durch den<br />
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung<br />
im Rahmen der „Urban Innovative<br />
Actions Initiative“ kofinanziert.<br />
Die 2019 publizierte Studie „Stumme<br />
Migranten, laute Politik, gespaltene<br />
Medien“ der Otto Brenner-Stiftung<br />
untersuchte die Berichterstattung über<br />
die Themen Flucht und Migration in 17<br />
Ländern. Verglichen wurden 2.400 Artikel<br />
aus sechs Wochen zwischen August<br />
2015 und März 2018. In Deutschland<br />
wurden die „Süddeutsche Zeitung“ und<br />
die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“<br />
Untersuchungsobjekte. Die Studie ergab,<br />
dass lediglich in einem Viertel der<br />
Berichte die Geflüchteten im Mittel-<br />
© Copyright hier<br />
Emotionalisierung und Dramatisierung um jeden Preis<br />
33
punkt standen, zumeist als namenlose<br />
Gruppe. Bloß in 8% der Fälle wurde<br />
über die persönlichen Geschichten und<br />
Schicksale der MigrantInnen geschrieben.<br />
Erfahrungen eines Geflüchteten aus<br />
Syrien<br />
X. möchte lieber anonym bleiben, er<br />
hat in der Vergangenheit nicht so gute<br />
Erfahrungen mit Interviews gemacht.<br />
Er lebt jetzt schon seit sechs Jahren in<br />
Österreich. In Syrien studierte er Rechtwissenschaften,<br />
doch zu seiner Enttäuschung<br />
wurde sein Studienfortschritt<br />
hier nicht anerkannt. Heute arbeitet er<br />
im Bereich Organisationsmanagement.<br />
Zur ständigen Berichterstattung über<br />
Flüchtlinge sagt er zu <strong>SUMO</strong>, dass diese<br />
nur dazu führt, dass das Thema gehasst<br />
wird, unabhängig davon, ob positiv oder<br />
negativ berichtet wird. „Es scheint aber<br />
so, als würde sowieso nur Negatives<br />
geschrieben werden. Ja, natürlich gibt<br />
es Kriminelle unter den Flüchtlingen, die<br />
Leute sind sicher nicht alle vom Himmel<br />
gefallen, aber die gibt es überall, auch in<br />
Österreich, sonst bräuchte man hier ja<br />
keine Polizei oder Gerichte. Keiner sagt<br />
etwas Positives über Flüchtlinge. Es gibt<br />
nur Bilder von geflohenen Menschen,<br />
die mit einer negativen Schlagzeile verbunden<br />
werden. Das ist verletzend. Die<br />
abgebildete Person hat keine Ahnung<br />
davon und hat das auch sicherlich nicht<br />
bewilligt. Warum gibt es keinen Respekt<br />
vor der Privatsphäre? Ich zum Beispiel<br />
will in Österreich eine Karriere haben<br />
und da möchte ich keine Bilder von mir<br />
auf der Flucht in den Medien finden. Das<br />
ist meine Entscheidung. Das ist mein<br />
Leben“, sagt er. <strong>SUMO</strong>: „Findest du,<br />
dass in den Medien zu wenige Flüchtlinge<br />
ihre Geschichte selbst erzählen?“<br />
X.: „In den Medien gibt‘s gar nichts. Da<br />
sind Plattformen wie ‚‚Facebook‘ dafür<br />
zuständig“, sagt er enttäuscht. „Manche<br />
Leute interessieren sich für unsere<br />
Geschichte und möchten sie von uns<br />
hören, nicht von Unbetroffenen“. Außerdem<br />
kritisiert X., dass obwohl er in Österreich<br />
GIS-Gebühren bezahle, er sich<br />
im österreichischen Fernsehen nicht repräsentiert<br />
fühle. „Ich fände es besser,<br />
wenn es bunter und vielfältiger wäre.<br />
Die Aufregung um den ZIB-Moderator<br />
[Anm.: Stefan Lenglinger] habe ich nicht<br />
verstanden: er ist doch Österreicher und<br />
hier geboren“, stellt X. fest. „Ich spreche<br />
aber nicht nur von Nachrichten, auch<br />
in Serien oder Filmen sieht man kaum<br />
AusländerInnen. Das ist nicht die Realität.<br />
Geht mal auf die Straße in Wien und<br />
seht, wie viele Leute da sind. Warum<br />
wird das nicht dargestellt? Auch andere<br />
soziale Gruppen, wie Homosexuelle<br />
oder Menschen mit Behinderungen<br />
werden einfach ausgelassen.“<br />
Über die PolitikerInnen, die von Begriffen<br />
wie „Islamisierung“ sprechen, sagt<br />
er, dass sie nur die Bevölkerung spalten<br />
und die EinwandererInnen weiter ausschließen<br />
wollen. Es gebe einige Menschen,<br />
die ihren religiösen Glauben hinter<br />
sich lassen. Auch in Syrien lebe ein<br />
signifikanter Teil der Bevölkerung ohne<br />
Bekenntnis. Er bedauert, dass darüber<br />
niemand spreche. „Es wird immer nur<br />
über die paar EuropäerInnen gesprochen,<br />
die zum Islam konvertieren. Ich<br />
persönlich bete nicht fünfmal täglich<br />
und während dem Ramadan faste ich<br />
auch nicht. Ich esse sogar Schweinefleisch.<br />
Meiner Meinung bin ich gar kein<br />
richtiger Muslim, aber für die PolitikerInnen<br />
hier werde ich immer einer sein.“<br />
<strong>SUMO</strong>: „Was würdest du PolitikerInnen<br />
gerne sagen?“ X.: „Bitte, macht den Leuten<br />
keine Angst. Sucht euch gefälligst<br />
einen anderen Plan, eure Wahl zu gewinnen!“<br />
Warum kommt es zu Framing?<br />
Hausjell, Professor am Institut für Publizistik-<br />
und Kommunikationswissenschaft,<br />
beschäftigt sich seit 30 Jahren<br />
mit dem medialen Diskurs über Geflüchtete<br />
und den dazugehörigen Frames,<br />
<strong>SUMO</strong> hat nachgefragt, wie diese historisch<br />
entstanden sind. „Frames gab<br />
es schon während der NS-Zeit. Schon<br />
damals wurden Flüchtende mit Kriminellen<br />
gleichgestellt. Allerdings wurden<br />
da sogenannte VaterlandsverräterInnen,<br />
die aus dem NS-Regime flüchteten,<br />
gemeint. Zusätzlichen ist mit der<br />
Vertreibung der jüdischen JournalistInnen<br />
eine gewisse Art der Recherche in<br />
Österreich verloren gegangen. Anders<br />
als im Christentum, ist es im Judentum<br />
üblich, Wissen durch ein ständiges Hinterfragen<br />
und Diskutieren mit dem Rabbiner<br />
zu erlangen. Das hat sich auch in<br />
der Berichterstattung jüdischer JournalistInnen<br />
widergespiegelt, denn das ist<br />
eigentlich das journalistische Prinzip.“<br />
Zur Problematik der Frames in der aktuellen<br />
Berichterstattung erklärt Sowinetz,<br />
dass Flucht und Migration sehr<br />
komplexe Themen seien, die sich nicht<br />
in einem kurzen Artikel erklären lassen.<br />
Marie-Claire Sowinetz / Copyright: Stefanie J. Steindl<br />
Viele Redaktionen hätten mit schrumpfenden<br />
Ressourcen zu kämpfen und<br />
somit fehlten oft Zeit, Geld und Möglichkeiten,<br />
ein Thema ausreichend zu<br />
beleuchten fehlen. „Daher versucht<br />
man, komplexe Inhalte einfach und<br />
schnell runter zu brechen und das führt<br />
dann zu den gängigen Erzählmustern.<br />
Auch Soziale Medien, in denen sehr<br />
emotional diskutiert wird, spielen hier<br />
eine zentrale Rolle“, sagt Sowinetz.<br />
Eine Zukunft ohne Frames<br />
Um Perspektivenverlust zu verhindern<br />
und mehr Realität in die Medien und<br />
die Politik zu bringen, müssen JournalistInnen<br />
ihre Vorurteile hinterfragen<br />
und ihr eigenes Tun kritisch reflektieren.<br />
Sowinetz verweist zum Beispiel auf<br />
die „Checkliste Verantwortungsvoller<br />
Journalismus in der Flüchtlingsberichterstattung“<br />
von „The Ethical Journalism<br />
Network“. Auch UNHCR selbst unterstützt<br />
und schult JournalistInnen mittels<br />
der Carta di Roma und „Guidance by and<br />
for Journalists“. Die Fundamental Rights<br />
Agency der EU hat ein Tool für ethisch<br />
korrekten Journalismus entwickelt, erzählt<br />
sie. „Das Magazin ‚‚Biber‘ bietet<br />
Schulung bzw. Trainings für JournalistInnen<br />
und Menschen mit Fluchthintergrund<br />
an, die in den Medien arbeiten<br />
wollen. Es gibt einige Tools, man muss<br />
sie nur nutzen.“<br />
Hausjell sieht die Herausforderung in<br />
der Personalpolitik. „Es lohnt sich, Talente<br />
im Minoritätenbereich zu fördern.<br />
Das beste Beispiel dafür ist die‚‚‚New<br />
York Times‘. 2018 gehörten 30% ihrer<br />
MitarbeiterInnen zu Minoritäten. Weiters<br />
verweist er auf den ökonomischen<br />
Aspekt einer weiteren Zielgruppe. Er<br />
schlägt vor, einzelne Seiten zweisprachig<br />
zu gestalten oder vergünstigte<br />
und zeitlich begrenzte Abonnements,<br />
ähnlich wie bereits für Studierende vorhanden,<br />
für Geflüchtete und MigrantInnen<br />
zu diskutieren. „Ethno-Marketing<br />
ist heute vielen noch ein Fremdwort.<br />
Es geht den Medien schlichtweg zu gut,<br />
aber das wird nicht immer so bleiben“,<br />
so Hausjell.<br />
von Therese Sterniczky<br />
Fritz Hausjell / Copyright: Miel Satrapa<br />
© Copyright: adobe stock / schankz<br />
34<br />
Emotionalisierung und Dramatisierung um jeden Preis
TURN THE PAGE 180 DEGREES!<br />
WHAT DO YOU SEE?*<br />
*Is it an ice cream cone and a chicken or a pelican?<br />
Nope, it‘s our logo but upside down. Still, for us, it‘s important to<br />
see things from different perspectives to keep things moving.<br />
LUX FUX is an up-and-coming digital marketing agency with<br />
offices in Salzburg and Vienna.<br />
Feel free to check out our website: luxfux.at<br />
Instagram: @luxfux.agency
Wenn Lesen nicht selbstverständlich<br />
ist<br />
Für bildungsbenachteiligte Menschen ist das gesellschaftliche Verständnis<br />
oft gering. <strong>SUMO</strong> geht im Gespräch mit Astrid Klopf-Kellerer, Programmmanagerin<br />
der Basisbildung für Jugendliche und Erwachsene an<br />
den Wiener Volkshochschulen, und Kathrin Schindele, Abgeordnete des<br />
NÖ Landtags und Obfrau des Bildungsausschusses, den Fragen zu den<br />
Herausforderungen von funktionalem Analphabetismus für Betroffene,<br />
Medien und Politik auf den Grund.<br />
© Copyright: adobe stock / Fiedels<br />
Lesen bildet die Basis in vielerlei Lebensbereichen<br />
– sei es, um sich im Alltag<br />
und Beruf selbstständig zurechtzufinden,<br />
Formulare auszufüllen oder um<br />
einfache Schlüsse zu ziehen, ohne diese<br />
Fähigkeit können die gesellschaftlichen<br />
Erfordernisse nur schwer erfüllt werden.<br />
Im Gegensatz zum bekannteren<br />
primären Analphabetismus, welcher<br />
den allgemein fehlenden Erwerb der<br />
Kenntnisse beschreibt, um zu schreiben,<br />
zu lesen oder zu rechnen, bezeichnet<br />
der Begriff „Funktionaler Analphabetismus“<br />
den partiellen Verlust bereits<br />
erworbener Grundkompetenzen im<br />
Lesen und/oder Schreiben. Das österreichische<br />
Bildungsministerium, aber<br />
auch Kursanbieter verwenden anstelle<br />
letzteren Begriffs den Ausdruck „bildungsbenachteiligte<br />
Menschen“. Damit<br />
einher geht eine erschwerte Teilhabe<br />
am gesellschaftlichen Leben. Dies trifft<br />
laut der PIAAC-Studie 2013 (Programme<br />
for the International Assessment of<br />
Adult Competencies) auf fast eine Million<br />
Menschen in Österreich zu. Folgende<br />
Fragen gilt es daher zu beantworten:<br />
Wie reagiert die Bildungspolitik auf den<br />
Handlungsbedarf? Wie handeln Medien<br />
in Bezug auf die Bildungsfrage und welche<br />
Rolle kommt ihnen in der Bildungsdiskussion<br />
zu?<br />
Von den Anfängen bis Heute<br />
Anfang der 1990er Jahre wurde das<br />
Thema in Österreich erstmals in einem<br />
„bottom-up-Prozess“ öffentlich diskutiert.<br />
Damals seien die ersten Basisbildungskurse<br />
für Erwachsene, die in<br />
der Schule nicht ausreichend Lese- und<br />
Schreibkompetenzen aufbauen konnten<br />
und Schwierigkeiten in Alltag und<br />
Berufsleben feststellten, entstanden,<br />
beschreibt Astrid Klopf-Kellerer. Das<br />
Verständnis für die Angebote für bildungsbenachteilige<br />
Erwachsene sei<br />
aber noch gering gewesen. „Über all<br />
diese Jahre hinweg ist ganz viel Aufbauarbeit<br />
passiert“, erzählt Astrid Klopf-<br />
Kellerer.<br />
Dazu trage das seit 2012 bestehende<br />
nationale Förderprogramm der „Initiative<br />
Erwachsenbildung“, das unter anderem<br />
das kostenfreie Besuchen von<br />
Kursen ermöglicht, maßgeblich bei.<br />
Bezogen auf die mediale Berichterstattung<br />
würde das Thema jedoch zu wenig<br />
konkretisiert werden: Anstelle von vereinzelten<br />
Beiträgen sei die Thematisierung<br />
mithilfe von Kampagnen oder Monatsschwerpunkten<br />
erforderlich, um es<br />
von unterschiedlichen Perspektiven zu<br />
beleuchten und das Bewusstsein der<br />
Allgemeinheit zu schärfen.<br />
Kathrin Schindele / Copyright: Herbert Käfer<br />
Astrid Klopf-Kellerer / Copyright: Gerhard Klopf<br />
36<br />
Wenn Thema Lesen nicht selbstverständlich ist
Gerade der Gesichtspunkt der Stigmatisierung<br />
müsse in den Mittelpunkt der<br />
Diskussion gestellt werden, da vielen<br />
bildungsbenachteiligten Personen die<br />
Inanspruchnahme der Kursangebote<br />
durch Scham und Angst vor Diskriminierung<br />
schwerfalle.<br />
Daher sieht Klopf-Kellerer die Aufgabe<br />
der Medien bezogen auf bildungsbenachteiligte<br />
Menschen in der Aufklärung<br />
und Sensibilisierung der Bevölkerung.<br />
Auch Kathrin Schindele fordert gezielte<br />
Lobbyarbeit, um das negativ behaftete<br />
Bild, das in der Gesellschaft häufig<br />
vorherrschend ist, zu beseitigen. Dabei<br />
müsse außerdem das direkte Gespräch<br />
mit den Betroffenen gesucht werden.<br />
Sie betont ebenfalls, dass die verschiedenen<br />
Ursachen und Hintergründe, die<br />
das Entstehen eines Bildungsdefizits<br />
begünstigen, in der Bildungsdiskussion<br />
nicht vorweggelassen werden dürfen.<br />
Wie Schindele erläutert, tragen die Medien<br />
auch aus demokratiepolitischer<br />
Sicht eine große Verantwortung.<br />
Daher müssen ausreichend Vergleichsmöglichkeiten<br />
„für eine Meinungsbildung,<br />
die verschiedene Sichtweisen<br />
zulässt“, vorhanden sein. Klopf-Kellerer<br />
hebt hervor, dass gerade die Personengruppe,<br />
die Schwierigkeiten beim<br />
Erfassen von besonders langen oder<br />
komplizierten Texten hat, eine Chance<br />
zur Erprobung und Verbesserung ihrer<br />
Kenntnisse benötigt.<br />
Dazu seien nicht nur die offensichtlich<br />
geeigneten Mediengattungen Fernsehen<br />
und Radio, sondern auch Print und<br />
Online angebracht. Ein besonderes Augenmerk<br />
müsse hierbei aber daraufgelegt<br />
werden, die Inhalte entsprechend<br />
aufzubereiten. Mithilfe von Abstracts<br />
oder Infokästen, die die wichtigsten<br />
Inhalte kurz und knapp wiedergeben,<br />
könne man zusätzliche Leseanreize<br />
schaffen. Eine Herausforderung in Bezug<br />
auf die Stigmatisierung liege auch<br />
in der korrekten Verwendung von Begrifflichkeiten,<br />
merkt Schindele an. Für<br />
die Anbieterorganisationen, bekräftigt<br />
Klopf-Kellerer, stelle daher das kompetenzorientierte<br />
Wording einen wesentlichen<br />
Aspekt dar. Anstelle des<br />
diskriminierenden Begriffes „funktionaler<br />
AnalphabetInnen“ eigne sich der<br />
Ausdruck „bildungsbenachteiligte Menschen“<br />
besser, um auf die Bildungsbenachteiligungen<br />
in ihrem Lebensumfeld<br />
und Basisbildungsbedarfe im Erwachsenenalter<br />
aufmerksam zu machen.<br />
„Das, denke ich, ist einer der wichtigsten<br />
Punkte, wenn man das vermitteln<br />
kann auf gesellschaftspolitischen Ebene,<br />
dass es nicht das Eigenverschulden<br />
ist, sondern dass es Benachteiligungen<br />
sind, und dass es ein Aspekt der Persönlichkeit<br />
ist“, erklärt Klopf-Kellerer.<br />
Sie verweist auch darauf, dass mehr als<br />
60% der betroffenen Menschen berufstätig<br />
sind und fest im Leben stehen,<br />
entgegen der Diskriminierung, mit der<br />
bildungsbenachteiligte Menschen häufig<br />
konfrontiert sind.<br />
Leben mit geringer Literalität<br />
Die deutsche Studie „LEO 2018 – Leben<br />
mit geringer Literalität“ befasst sich<br />
mit der Lese- und Schreibkompetenz<br />
speziell bezogen auf den Alltag und die<br />
soziale Teilhabe von deutschsprachigen<br />
18- bis 64-Jährigen. Gemessen an den<br />
sogenannten Alpha-Levels sind ca. 6,2<br />
Mio. Erwachsene bzw. 12,1% der erwachsenen<br />
Bevölkerung (Alpha 1 bis 3)<br />
gering literalisiert. Das Ergebnis zeigt<br />
gemessen am Anteil der erwachsenen<br />
Bevölkerung eine Verminderung um 2,4<br />
Prozentpunkte im Vergleich zur LEO-<br />
Studie 2010 (7,5 Mio. Erwachsene).<br />
Eine Auswirkung lässt sich beispielsweise<br />
bezogen auf die Arbeitssuche<br />
erkennen: Rund 13% der gering literalisierten<br />
Erwachsenen sind arbeitslos,<br />
und von den erwerbstätigen Personen<br />
(62,3%) sorgt sich knapp ein Viertel um<br />
die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes. Daher<br />
stellt sich auch die Frage, wie lange<br />
dieser Zustand noch wirtschaftlich<br />
tragbar ist. „Ich sage ganz ehrlich, wir<br />
können uns das jetzt schon nicht mehr<br />
leisten“, merkt Schindele an. Vor allem in<br />
Hinblick auf die Ungewissheit über das<br />
Entstehen neuer Arbeitsfelder seien<br />
rasche und nachhaltige Gesellschaftsinvestitionen<br />
nötig.<br />
Einen weiteren Aspekt hebt die Studie<br />
beim Thema digitaler Kommunikation<br />
hervor: Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung<br />
nutzen bildungsbenachteiligte<br />
Erwachsene häufiger Sprachnachrichten<br />
oder Videotelefonie anstelle von<br />
Kurznachrichten. Auch die Kommunikation<br />
via E-Mail wird von nur etwas mehr<br />
als einem Drittel präferiert. In Bezug<br />
auf politische Praktiken lässt sich erkennen,<br />
dass die fehlende schriftliche<br />
Kompetenz Folgen hat: So informieren<br />
sich nur 23,6% über das Nachrichtengeschehen<br />
per Zeitung oder Internet,<br />
Nachrichtensendungen werden deutlich<br />
häufiger konsumiert (61,7%). Gering<br />
literalisierte Menschen zeigen laut der<br />
Studie zudem weniger ehrenamtliches<br />
Engagement (7,1%) im Vergleich zu literalisierten<br />
Personen (23,1%). Bezogen<br />
auf die Wahlbeteiligung lässt sich<br />
erkennen, dass nur 62,2% der Betroffenen<br />
vom Wahlrecht Gebrauch nehmen<br />
(Gesamtbevölkerung: 87,3%). Eine<br />
weitere Herausforderung lässt sich bei<br />
der Gesundheitskompetenz erkennen:<br />
Beipackzettel von Medikamenten werden<br />
nur von 55,8% der Erwachsenen<br />
mit Basisbildungsbedarf gelesen, und<br />
Wenn Lesen nicht selbstverständlich Thema ist<br />
37
damit gehen wichtige Informationen<br />
zur Dosierung oder Risiken verloren.<br />
Zusammenfassend lässt sich also im<br />
Vergleich zur LEO-Studie aus 2010 eine<br />
leichte Verbesserung erkennen. Dennoch<br />
besteht noch großes Verbesserungspotential,<br />
vor allem in Bezug auf<br />
die Gesamtbevölkerung.<br />
Bildung als Basis<br />
Erwachsenenbildung bildet einen<br />
Grundpfeiler der Fördermaßnahmen<br />
von bildungsbenachteiligten Menschen.<br />
Das Konzept der Basisbildung<br />
hebt sich laut dem Bundesministerium<br />
für Bildung durch eine Erweiterung um<br />
demokratische, teilhabende, selbstkritische<br />
und kritisch handlungsorientierte<br />
Lerndimensionen vom Verständnis<br />
der Alphabetisierung im Sinne des Erwerbes<br />
der Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeit<br />
ab. Laut Klopf-Kellerer<br />
stehe insbesondere die direkte Einbindung<br />
der KursteilnehmerInnen bei der<br />
Erreichung ihrer individuellen Ziele und<br />
Bedürfnisse im Vordergrund. Kathrin<br />
Schindele betont zudem die Wichtigkeit<br />
der verschiedenen Institute wie<br />
beispielsweise Volkshochschulen (VHS)<br />
oder Wirtschaftsförderinstitut (WIFI),<br />
die verschiedenste Erwachsenenbildungsmöglichkeiten<br />
anbieten. Bildung<br />
sollte für jeden zugänglich sein, so das<br />
Credo. Dazu zählt nicht nur der kostenlose<br />
Zugang zu Kursen, sondern auch<br />
die adäquate Aufteilung der Fördermittel.<br />
Schindele hebt außerdem hervor,<br />
dass in der Qualität nicht zwischen<br />
öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen<br />
differenziert werden darf.<br />
Astrid Klopf-Kellerer kennt durch ihre<br />
Arbeit im Programmmanagement der<br />
Basisbildung für Jugendliche und Erwachsene<br />
und als Fachkoordinatorin<br />
der VHS Wien die Herausforderungen,<br />
die in der Praxis auftreten. Besonders<br />
schwierig sei es, Menschen, die<br />
Deutsch als Erstsprache sprechen, mit<br />
den Bildungsangeboten zu erreichen.<br />
Dazu sollen verstärkte Werbemaßnahmen<br />
und Informationsmanagement,<br />
aber auch die forcierte Einbindung der<br />
betroffenen Personen einen maßgeblichen<br />
Beitrag leisten können. Ein großflächiger<br />
Ausbau der Kursangebote ist<br />
für Schindele unerlässlich, um die breit<br />
gefächerte Zielgruppe erreichen zu<br />
können. In Bezug auf die in Österreich<br />
zugänglichen Angebote merkt Klopf-<br />
Kellerer Folgendes an: „Meines Erachtens<br />
sollte das Angebot gerade speziell<br />
in der Basisbildung erweitert werden.<br />
Wir erreichen ja nur einen kleinen Teil<br />
der Menschen mit unseren Angeboten,<br />
und es ist natürlich eine Frage des Budgets.“<br />
Dennoch sei die Wertschätzung<br />
und Dankbarkeit der Menschen, die die<br />
Basisbildungsangebote beanspruchen,<br />
sehr hoch. Kompetenzorientiertes (anstelle<br />
von fehlerorientiertem) Arbeiten<br />
in Kleingruppen trage dazu maßgeblich<br />
bei. Klopf-Kellerer berichtet auch von<br />
Gesprächen mit KursbesucherInnen,<br />
die im Gegensatz zu den oft negativen<br />
Lernerfahrungen in der Schule als Erwachsene<br />
erstmals über positive Lernerfahrungen<br />
und -erfolge sprechen.<br />
Astrid Klopf-Kellerer und Kathrin Schindele<br />
sind sich darüber einig, dass es<br />
insbesondere lokale Initiativen brauche,<br />
die bildungsbenachteiligte Menschen<br />
zusammenbringt und gesellschaftlich<br />
integriert.<br />
Einen relevanten Knotenpunkt stellt<br />
auch die Schul- und Bildungspolitik dar.<br />
Wie Schindele unterstreicht, liege ein<br />
erster Schritt darin, sich einzugestehen,<br />
dass das Thema Analphabetismus einen<br />
hohen Stellenwert im Bildungsdiskurs<br />
einnimmt. Dazu brauche es ausreichend<br />
Gesprächsmöglichkeiten und<br />
Unterstützungssysteme – vor allem für<br />
die Lehrkräfte, merkt Klopf-Kellerer an.<br />
Als Lehrerin sind auch Schindele die Herausforderungen<br />
der Praxis nicht unbekannt.<br />
Einen relevanten Gesichtspunkt<br />
bilden hierbei die Klassengröße und das<br />
Lehrpersonal. Sie fordert speziell in der<br />
Schuleingangsstufe mindestens zwei<br />
PädagogInnen pro Klasse einzusetzen,<br />
um eventuelle Defizite schnellstmöglich<br />
aufzudecken und bestmöglich zu<br />
behandeln. Schindele unterstreicht<br />
zudem die individuellen Bedürfnisse<br />
der SchülerInnen, auf die mithilfe von<br />
Schulsozialarbeit eingegangen werden<br />
muss. Es soll außerdem ausreichend<br />
Personal zur Verfügung gestellt werden,<br />
um den expliziten Ursachen von<br />
Bildungsbenachteiligung auf den Grund<br />
zu gehen und Zielbezug zu erarbeiten.<br />
„Das erfordert zeitliche Ressourcen, das<br />
erfordert natürlich ein Budget und das<br />
erfordert die Expertisen von entsprechend<br />
gebildeten Menschen“, untermauert<br />
Klopf-Kellerer. Österreichweite<br />
Kritik gäbe es dahingehend allerdings<br />
an dem aktuellen „Curriculum Basisbildung<br />
in der Initiative Erwachsenenbildung“<br />
(2019), das die Expertise der<br />
Praxis vorweglässt.<br />
Ein Stichwort, das häufig in Verbindung<br />
mit dem Thema Erwachsenenbildung<br />
genannt wird, ist das lebenslange Lernen.<br />
Klopf-Kellerer schätzt hierbei die<br />
beiden Bereiche Beruf und Medien als<br />
wegweisend ein, um die im Interesse<br />
liegenden Themen anzusprechen und<br />
zur näheren Befassung mit diesen anzustiften.<br />
Wie Schindele anmerkt, seien<br />
Bemühungen in diese Richtung aus<br />
Sicht der ArbeitgeberInnen gerade deshalb<br />
erforderlich, um konkurrenzfähig<br />
zu bleiben und die MitarbeiterInnen<br />
entsprechend aus- und weiterzubilden.<br />
„Bildung muss auch den Firmen, muss<br />
der Wirtschaft etwas wert sein“, betont<br />
Schindele. Das sei wiederum ein Ansporn<br />
für ArbeitnehmerInnen, sich stetig<br />
zu verbessern. Von politischer Seite<br />
seien daher Fördermaßnahmen für diese<br />
Ausbildungsformate unerlässlich.<br />
Jede/r soll die gleiche Chance bekommen<br />
Sowohl von politischer, als auch medialer<br />
Seite besteht noch Handlungsbedarf<br />
im Erwachsenenbildungsdiskurs. Einen<br />
Hauptaspekt bilden die Sensibilisierung<br />
und Lobbyarbeit – bezogen auf die Begrifflichkeiten,<br />
die soziale Schere und<br />
das Verständnis für bildungsbenachteiligte<br />
Personen. Das in Österreich bereits<br />
weitflächig vorhandene Angebot<br />
an Kursen und Initiativen muss allerdings<br />
stetig erweitert und verbessert<br />
werden. Dazu gilt es, die Betroffenen<br />
selbst und die Expertise der Praxis in<br />
die Prozesse miteinzubeziehen. „Es<br />
geht darum, dass jeder die gleiche<br />
Chance hat“, unterstreicht Schindele.<br />
von Julia Allinger<br />
© Copyright: adobe stock / snowing12<br />
38<br />
Thema Wenn Lesen nicht selbstverständlich ist
Nicht nur Politiker spielen<br />
„Clash of Clans“<br />
Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass auch Politiker in die Kostenfalle<br />
vermeintlicher Gratisspiele tappen. Das passiert aber nicht nur Prominenten,<br />
sondern vor allem Kindern und Jugendlichen, die die entstehenden<br />
Kosten bei einem simplen Klick unterschätzen. Medienberichte zu<br />
solchen Fällen gibt es einige – doch wie vermeidet man diese Kostenfalle<br />
effektiv?<br />
Gratisspiele wie auch Anwendungen<br />
sind heute aus den App-Stores nicht<br />
mehr wegzudenken – aber wie „kostenlos“<br />
sind die Applikationen am<br />
Smartphone in der Anwendung tatsächlich?<br />
Fragt man Kinder nach ihren<br />
Lieblingsspielen, gehören die vorerst<br />
kostenfreien „Fortnite: Battle Royal“,<br />
„Minecraft“ und „Clash of Clans“ zu den<br />
Standardantworten. Dass diese nicht<br />
immer kindgerecht sind, zeigt eine Studie<br />
der deutschen Stiftung Warentest<br />
vom September 2019. Gerade die Problematik<br />
rund um das Corona-Virus hat<br />
die Thematik der Apps am Handy abermals<br />
entfacht. Hier war aber nicht die<br />
Frage der Kosten oder des kindgerechten<br />
Inhalts im Fokus, sondern die des<br />
Datenschutzes. Doch die vermeintlich<br />
kostenlosen Spiele bringen einige Probleme<br />
mit sich. Gerade Kinder und Jugendliche<br />
erkennen oftmals eine Werbung<br />
nicht als solche, da diese bewusst<br />
getarnt ist, heißt es aus der Studie der<br />
Arbeiterkammer „Kinder & Online-Werbung“<br />
aus dem Jahr 2019.<br />
Vor allem während der Corona-Pandemie<br />
verhalfen Apps den Eltern, ihre<br />
Kinder zu beschäftigen: sei es mit Hilfe<br />
von Lern-Apps, die in Hülle und Fülle<br />
während der Pandemie erschienen<br />
sind oder mit kostenlos angebotenen<br />
Spielen. Der Clou dahinter: kostenlos<br />
ist nicht gleich kostenlos. Das Spiel<br />
oder die Anwendung lässt sich zwar<br />
gratis auf dem Smartphone installieren,<br />
dahinter verbirgt sich aber oftmals<br />
eine Kostenfalle. So sind manche Spiele<br />
nach kurzer Spieldauer ohne einen<br />
In-App-Kauf nur mehr eingeschränkt<br />
nutzbar. Den Erwerb von „Spielegeld“<br />
(In-Game-Währung) nehmen Kinder oft<br />
nur als Teil des Spieles wahr und nicht<br />
als reales Geschäft. In ihrer Spiellaune<br />
ist ihnen nicht bewusst, dass sie auf<br />
einen kostenpflichtigen In-App-Kauf<br />
klicken. In-App-Käufe bezeichnen alle<br />
Kaufvorgänge, die während eines Spiels<br />
in einer App an einem Mobilgerät getätigt<br />
werden. Ziel der EntwicklerInnen ist<br />
es, ihr „Gratis“-Spiel mit Hilfe von jenen<br />
Käufen zu monetarisieren. Des Öfteren<br />
werden dabei die Regeln nicht beachtet<br />
oder Grauzonen von Werberichtlinien<br />
ausgelotet, heißt es vonseiten der<br />
Arbeiterkammer (AK). Die klassische<br />
Wertschöpfungskette der Gaming-Industrie<br />
wurde so zu einem Modell<br />
adaptiert, das sich ausschließlich aus<br />
diesen In-App-Käufen finanziert. „Einige<br />
Spieleportale arbeiten auch mit Belohnungssystemen:<br />
Wer aktiv Werbung<br />
konsumiert oder sich etwa auf dritten<br />
Webseiten registriert, erwirbt ‚‚Spielgeld‘.<br />
Die Werbung im Internet kann außerdem<br />
ein gutes Geschäft für Datensammler<br />
und Abzocker sein“, resümiert<br />
die AK.<br />
Mehr Kontrollen der Apps<br />
Elfriede K. ist Mutter des achtjährigen<br />
Elias (Anm.: Namen geändert).<br />
Sie erzählt im <strong>SUMO</strong>-Interview, dass<br />
ihr Sohn zu seinem achten Geburtstag<br />
ein Smartphone bekommen hat.<br />
Konkret wurde ihm der Wunsch nach<br />
einem Handy aber nur erfüllt, weil „ich<br />
nicht möchte, dass er in der Klasse ausgegrenzt<br />
wird, da er einer der wenigen<br />
war, der bis dato noch kein Handy<br />
hatte“. Ihr war klar, dass er sein Handy<br />
weniger zum Telefonieren nutzen<br />
würde, sondern vielmehr zum Surfen<br />
im Internet. Tatsächlich schildert die<br />
alleinerziehende Mutter aber eine andere<br />
Problematik. „Elias hat sich heimlich‚‚Fortnite‘<br />
heruntergeladen und mit<br />
dem Taschengeld der Oma Guthaben<br />
in der Trafik gekauft und sich darum<br />
irgendwelche Extras für das Spiel gekauft.<br />
Danach war er vom Handy nicht<br />
mehr wegzubekommen und starrt seither<br />
Tag ein Tag aus in sein Kasterl und<br />
kämpft mit seinen Schulkollegen. Meiner<br />
Meinung nach grenzt das schon an<br />
ein Suchtverhalten. Es ist mittlerweile<br />
schon so weit, dass ich das Handy vor<br />
ihm verstecken muss und er nur eine<br />
© Copyright: adobe stock / charnsitr<br />
Nicht nur Politiker spielen „Clash of Clans“<br />
39
Stunde am Tag spielen darf – das führt<br />
oftmals zu langen Heulkrämpfen und<br />
Diskussionen. Ich würde mir eine staatliche<br />
Regelung wünschen. Gäbe es hier<br />
einheitliche Vorgaben und genauere<br />
Kontrollen, wäre es definitiv einfacher<br />
für mich“.<br />
Nutzungsverhalten der Allerjüngsten<br />
Mit diesem Problem ist Elfriede K. in<br />
Österreich nicht alleine. 35% der Eltern<br />
von 0-6-jährigen wünschen sich, dass<br />
ihre Kinder weniger Zeit mit digitalen<br />
bzw. internetfähigen Geräten verbringen,<br />
ergab eine Studie der IFES, ÖIAT<br />
und der ISPA im Auftrag von saferinternet.at<br />
aus dem Jahr 2020. Demnach<br />
nutzen 51% der Kinder Smartphones<br />
oder Tablets zum Spielen. Schwierigkeiten<br />
bereitet das vor allem Eltern,<br />
die jeden Klick der Kinder beobachten,<br />
PEGI-Einstufung:<br />
Ist ein europäisches Alterseinstufungssystem,<br />
das Eltern helfen soll,<br />
eine Entscheidung beim<br />
Kauf von Videospielen<br />
zu treffen.<br />
ob der Inhalt tatsächlich kindgerecht<br />
ist. So empfinden 28% der Befragten<br />
es als schwierig oder sogar als sehr<br />
schwierig, geeignete Inhalte ausfindig<br />
zu machen. Die Problematik hat auch<br />
vor den österreichischen Schulen nicht<br />
Halt gemacht. Katharina (Anm.: Name<br />
geändert) unterrichtet an einer Wiener<br />
Ganztagsvolksschule, auch sie berichtet<br />
im Gespräch mit <strong>SUMO</strong> am 27.<br />
März von dieser Problematik. „Derzeit<br />
unterrichte ich zwar aufgrund der Corona-Maßnahmen<br />
nicht im klassischen<br />
Sinne, aber ich weiß noch, wie es noch<br />
vor einigen Wochen in den Klassen ausgesehen<br />
hat. Die Kinder sprachen häufig<br />
über‚‚Fortnite‘. Auch musste ich in<br />
den vergangenen Wochen oftmals ein<br />
Handy abnehmen, welches während<br />
des Unterrichts verwendet wurde. Der<br />
positive Effekt dieses Spiels ist aber,<br />
dass die Kinder ihre Hemmungen in<br />
Hinblick auf ihre motorischen Bewegungsabläufe<br />
verlieren. Ich habe immer<br />
wieder gesehen, dass Kinder gemeinsam‚‚Fortnite-Tänze‘<br />
aufführen. Das<br />
hat auch Freundschaften gebildet. Es<br />
ist also nicht alles schlecht an dem Spiel<br />
per se, aber es gehört dennoch etwas<br />
geändert. Außerdem sollten die Eltern<br />
etwas besser darauf achten, was ihre<br />
Kinder so am Handy machen“, erzählt<br />
sie.<br />
© Copyright: adobe stock / Saravoot<br />
40<br />
Nicht nur Politiker spielen „Clash of Clans“
Altersfreigaben in den App Stores<br />
Die Altersfreigaben auf DVD- oder<br />
BlueRay-Covers sind bekannt. Auch<br />
bei klassischen Videospielen findet sich<br />
so eine Altersbeschränkung auf den<br />
Hüllen. Diese Filme oder Spiele sollten<br />
für Kinder ohne altersentsprechenden<br />
Ausweis nicht zum Erwerb möglich<br />
sein. Wie sieht die Altersfreigabe aber<br />
bei den Spielen am Smartphone oder<br />
Tablet aus? Bei Android Smartphones<br />
kommt die PEGI-Einstufung zum Einsatz.<br />
Diese soll Eltern helfen, eine Entscheidung<br />
beim Kauf von Videospielen<br />
zu treffen. Bei iOS hingegen steht eine<br />
eigene Bewertungsskala im Fokus. Alternativ<br />
lassen sich aber auch die PE-<br />
GI-Hinweise einblenden. Das Problem:<br />
meist läuft das Smartphone der Kinder<br />
auf den Namen der Eltern sowie das<br />
dementsprechende Geburtsdatum und<br />
somit sind Schutzmechanismen hinfällig.<br />
Vorzubeugen ist das mit Hilfe der<br />
Einstellungen der jeweiligen Stores;<br />
saferinternet.at empfiehlt beispielsweise<br />
die Bildschirmzeit, wie auch die<br />
Jugendschutzeinstellungen zu prüfen<br />
und anzupassen. Eine weitere Möglichkeit<br />
wäre die Installation von Kinderschutz-Apps<br />
von Drittanbietern. Mit<br />
Hilfe solcher Apps ist es Eltern möglich,<br />
das Nutzungsverhalten des Kindes im<br />
Auge zu behalten, App-Downloads zu<br />
blockieren, Tageslimits festzulegen, das<br />
Gerät für einen bestimmten Zeitraum<br />
zu sperren oder sogar den Standort des<br />
Geräts zu orten. Eine der effektivsten<br />
Methoden ist es laut saferinternet.at,<br />
Dienste wie Mehrwertnummern oder<br />
den „Kauf auf Handyrechnung“ direkt<br />
beim jeweiligen Mobilfunkanbieter zu<br />
deaktivieren.<br />
Das Problem ist allgegenwärtig, und<br />
neben einer Digitalisierung im Bildungsbereich<br />
sollte diese auch in den<br />
einzelnen Haushalten strukturiert<br />
umgesetzt werden. Möglich gemacht<br />
werden könnte dies, wenn der sichere<br />
Umgang mit dem Smartphone im Zuge<br />
des Schulunterrichts besprochen wird.<br />
Außerdem muss es genau festgelegte<br />
Richtlinien für den digitalen Einkauf in<br />
den jeweiligen App-Stores geben. Auch<br />
die Arbeiterkammer fordert „Standards<br />
für die Umsetzung traditioneller Werbegrundsätze<br />
in der Online-Welt und<br />
eine bessere grenzüberschreitende<br />
Rechtsdurchsetzung inklusive klarer<br />
Regeln für Werbungen in Apps.“<br />
von Martin Möser<br />
Nicht nur Politiker spielen „Clash of Clans“<br />
41
Pornografie – eine bzw.<br />
welche Gefahr für Kinder und<br />
Jugendliche?<br />
Während man früher vielleicht in der Trafik heimlich durch den „Playboy“<br />
blätterte, geht es heutzutage um einiges leichter. Mit dem Aufkommen<br />
des Internet steht fast nichts mehr zwischen allem, was es zu Sex ausspuckt<br />
– allem. <strong>SUMO</strong> sprach mit Sexualpsychologin Dr. Christina Raviola,<br />
Leiterin der Familienberatungsstelle für funktionelle Sexualstörungen und<br />
Partnerschaftskonflikte in Wien, und Sexualpädagogin Adriane Krem über<br />
Pornografie-Rezeption und dessen Folgen für Kinder und Jugendliche.<br />
© Copyright: adobe stock / vulkanov<br />
In der jüngeren Gesellschaft kann man<br />
schnell den Eindruck erlangen, Pornografie<br />
sei ein Phänomen des digitalen<br />
Zeitalters und erreichte erst große Beliebtheit<br />
durch das Internet. In Wahrheit<br />
ist Pornografie wahrscheinlich so<br />
alt wie die Menschheit selbst. Neben<br />
der 30.000 Jahre alten Venus von Willendorf,<br />
die eine nackte vollbusige Frau<br />
darstellt, gab es bereits im antiken Rom<br />
obszöne Motive bei Wandmalereien und<br />
auch die antiken Griechen malten Sexszenen<br />
auf Amphoren und Vasen. Der<br />
Unterschied zu heute ist, dass lediglich<br />
ein paar Klicks im World Wide Web von<br />
dem schier unendlichen Angebot an pornografischem<br />
Inhalt trennen. Diese Tatsache<br />
blieb auch nicht den Kindern und<br />
Jugendlichen verborgen. Laut der Wiener<br />
Sexualpsychotherapeutin Christina<br />
Raviola, deren Familienberatungsstelle<br />
vom Bundesministerium für Arbeit, Familie<br />
und Jugend gefördert wird, finden<br />
die ersten Kontakte mittlerweile bereits<br />
im Kindesalter, noch vor dem 9. Lebensjahr,<br />
statt. Zu den Gründen warum Kinder/Jugendliche<br />
Pornos ansehen, gehören<br />
unter anderem Stimulationszwecke,<br />
Gruppenzugehörigkeit oder einfach Langeweile.<br />
Die Frage, die sich daraus ergibt<br />
und auch vielen Eltern Sorgen bereitet,<br />
ist, ob diese Pornorezeption negative<br />
Folgen auf Kinder und Jugendliche hat.<br />
Die Antwort ist ein unbefriedigendes<br />
„Jein“. Laut Raviola könne man annehmen,<br />
dass je früher der Kontakt zu den<br />
diversen Porno-Sites beginne, desto höher<br />
die Wahrscheinlichkeit sei, dass negative<br />
Entwicklungen stattfinden. Dabei<br />
hänge die individuelle Rezeption und wie<br />
das Kind beziehungsweise der/die Jugendliche<br />
damit umgehe von unzähligen<br />
Faktoren ab, wie beispielsweise dem Alter,<br />
den Vorerfahrungen, der Aufklärung<br />
und der geistigen und emotionalen Stabilität.<br />
Adriane Krem, Sexualpädagogin<br />
am Österreichischen Institut für Sexualpädagogik<br />
und Sexualtherapien, meint,<br />
dass die Medienwirkungsforschung bei<br />
der Pornorezeption auf Grenzen stoße.<br />
Die Art und Weise wie das Gesehene im<br />
Porno innerlich vom Kind/Jugendlichen<br />
verarbeitet wird und sich in Folge auf<br />
Beziehungen und das Sozialverhalten<br />
auswirkt, könne nicht direkt getestet<br />
werden, da es privat, schwer zu reflektieren<br />
und höchst subjektiv sei.<br />
Die Schattenseiten der Pornografie<br />
Im Detail manifestieren sich negative<br />
Auswirkungen auf mehrere Weisen.<br />
Eine davon ist die Verstärkung von<br />
Rollenstereotypen und die Verbreitung<br />
eines negativen Frauenbildes. Bereits<br />
1987, lange vor dem Internet-Boom,<br />
startete die deutsche Feministin und<br />
Publizistin Alice Schwarzer die „Por-<br />
NO-Kampagne“ und sprach sich in dem<br />
von ihr herausgegebenen Werk „Por-<br />
NO. Opfer & Täter. Gegenwehr & Backlash.<br />
Verantwortung & Gesetz“ gegen<br />
den „zentralen Sinn der Pornografie,<br />
die Propagierung und Realisierung von<br />
Frauenerniedrigung und Frauenverachtung“<br />
aus. Christina Raviola erklärt<br />
im <strong>SUMO</strong>-Interview, dass sich Rollenstereotype<br />
wie „der starke Mann“ und<br />
„die devote Frau“ möglicherweise durch<br />
Pornografie bei emotional sensiblen<br />
Jugendlichen verstärkten. Auch werden<br />
Vergewaltigungsszenen in weiterer<br />
Form in manchen Pornos dargestellt.<br />
„Diese Videos vermitteln, dass Frauen<br />
also doch gerne vergewaltigt werden<br />
und dabei auch Genuss erfahren. Das<br />
gilt es sehr kritisch zu hinterfragen“, so<br />
Raviola. Pornosucht sei ein weiteres,<br />
nicht zu missachtendes Problem. Diese<br />
Gefahr der Sucht bestehe besonders<br />
für Jugendliche, die bei der Pornorezeption<br />
besonders viel positives Feedback<br />
und Entspannung erhalten oder beispielsweise<br />
ohnehin Probleme mit der<br />
eigenen Sexualität haben. In diesem<br />
Fall könne sich ein Suchtverhältnis zu<br />
Pornografie, laut Raviola, bereits im<br />
Jugendalter sukzessiv aufbauen. Bei<br />
häufiger Nutzung entstünden im Ge-<br />
42<br />
Pornografie - Gefahr für Kinder und Jugendliche?
hirn Gedächtnisspuren, die man sich<br />
wie Gleise eines großen Bahnhofes<br />
vorstellen könne, die sich immer tiefer<br />
und tiefer hineingraben, bis der Körper<br />
schließlich nach der Befriedigung durch<br />
Pornografie verlange. Diese Pornosucht<br />
gehe in manchen Fällen soweit, dass<br />
der Leidensdruck so stark sei, dass beispielsweise<br />
der eigene Beruf nicht mehr<br />
erfüllt werden könne. Laut Sexualpädagogin<br />
Krem gebe es noch einen weiteren<br />
negativen Aspekt: „Wenn ich mich<br />
auf die Bilder im Porno verlasse und<br />
das als Handlungsvorgabe betrachte,<br />
kann das eine Menge Druck machen.<br />
Sind zwar unrealistisch, aber ich nehme<br />
sie trotzdem ernst. Je weniger Wissen<br />
über Sexualität man im Allgemeinen<br />
hat und desto weniger ich gelernt habe,<br />
mich auf meine eigene Wahrnehmung<br />
zu verlassen, desto mehr verlasse ich<br />
mich auf die äußeren Vorgaben, wie<br />
Pornografie.“ Diese Vorgaben führen<br />
neben Druck auch zu Verwirrung. Man<br />
könne ihnen nicht standhalten, weil<br />
sie nicht realistisch seien. Laut Raviola<br />
bestätige sich jedoch die Angst der<br />
Eltern, dass dieser negative Konsum<br />
im Jugendalter massive Auswirkungen<br />
mit sich brächte, in der Regel nicht. Im<br />
Gegenteil, Jugendliche könn-ten sogar<br />
sehr gut differenzieren und bei Pornos<br />
zwischen Realität und einer gespielten<br />
Szene unterscheiden. Medienkompetenz<br />
spielt dabei für Krem eine große<br />
Rolle: „Je mehr ich hinter die Kulissen<br />
von Medien, auch Pornos, schauen<br />
kann, desto weniger muss ich sie als<br />
Informationsquellen für mein eigenes<br />
Leben und Sexualität ernst nehmen“.<br />
Die potenziellen Probleme durch Pornonutzung<br />
sind jedoch kein Grund, als<br />
Elternteil in Panik zu verfallen und dem<br />
Kind das Pornoschauen strikt zu verbieten.<br />
Im Gegenteil, sowohl die Klinische<br />
Sexualpsychologin Raviola als auch die<br />
Sexualpädagogin Krem raten den Eltern,<br />
einen kühlen Kopf zu bewahren und an<br />
ihre eigene Jugend zu denken. „Statt die<br />
Kinder und Jugendlichen hermetisch<br />
davon abzuriegeln, sollte es eher darum<br />
gehen, wie wir sie unterstützen, selbstwertschätzend<br />
zu werden, einen positiven<br />
Umgang mit der eigenen individuellen<br />
Sexualität und einen reflektierten<br />
Umgang mit Medien zu entwickeln“,<br />
erklärt Krem. Es sei ebenfalls wichtig,<br />
ein/e Ansprechpartner/in für die Kinder<br />
zu sein, jemand vor dem man sich nicht<br />
schämen müsse, über Sexualität zu<br />
sprechen. Laut Raviola solle man den<br />
Kindern erklären, dass manche Fantasien<br />
vollkommen in Ordnung seien, es<br />
jedoch manche sexuellen Neigungen<br />
gebe, wie beispielsweise Sodomie oder<br />
gar Gewalt, die es nicht seien. Dabei<br />
sei insbesondere ein offener Umgang<br />
statt angedrohter Sanktionen von hoher<br />
Bedeutung. Die Gespräche sollten<br />
amikal geführt werden, da die Kinder<br />
sonst einem in Zukunft gar nichts mehr<br />
erzählen würden. Weiters rät Raviola<br />
dazu, den Kindern zu vermitteln, wie<br />
bedeutsam die Beziehung zueinander<br />
beim Sex sei und dass man die beiden<br />
Dinge nicht getrennt betrachten könne.<br />
Es gehe dabei auch um Emotionalität<br />
und dass Sex etwas sei, das zwei Menschen<br />
miteinander machen, die sich<br />
gernhaben. Diesbezüglich liefert Krem<br />
Entwarnung: „Der Stellenwert, dass<br />
man sich eine Beziehung wünscht, man<br />
liebenswert und attraktiv sein möchte<br />
und dass es oft einen Wunsch nach<br />
Langfristigkeit und Treue gibt, hat sich<br />
unserer Beobachtung nach nicht geändert.“<br />
Im Gegenteil, es gebe manchmal<br />
sogar den Schwerpunkt, dass Jugendliche<br />
sagen, es gehe bei Sexualität nicht<br />
um oberflächlichen und unmittelbaren<br />
Kontakt. Die Wertigkeit sei dabei unterschiedlich<br />
je nach Community oder der<br />
© Copyright: adobe stock / amixstudio<br />
Pornografie - Gefahr für Kinder und Jugendliche?<br />
43
Wertehaltung innerhalb der Familie.<br />
All das könnte den Eindruck erwecken,<br />
dass Kindersicherungsprogramme und<br />
Computerfilter möglicherweise nicht<br />
benötigt werden, jedoch empfiehlt<br />
Raviola den Einsatz solcher Programme<br />
dennoch. Besonders im Zusammenhang<br />
mit SexualstraftäterInnen<br />
und Kindesmissbrauch können diese<br />
Programme das Schlimmste von den<br />
Kindern abblocken. Diverse Antiviren-<br />
Programme bieten zusätzlich auch<br />
eingebaute Kindersicherungen für das<br />
Internet, aber es gibt auch eigens dafür<br />
entwickelte Programme wie „Google<br />
Family Link“ oder das Erstellen von Familiengruppen<br />
bei den Microsoft-Konten.<br />
Letztere erlauben es den Eltern, die<br />
Aktivitäten ihres Kindes im Netz nachzuvollziehen<br />
und gezielt Inhalte einzuschränken.<br />
Es sei jedoch nicht möglich,<br />
Kindern komplett den Zugang zu Pornos<br />
zu verschließen, denn sie würden<br />
früher oder später durch die Peer Group<br />
oder das sonstige Umfeld in Kontakt<br />
mit Pornografie kommen.<br />
Obwohl Pornografie einige Risiken mit<br />
sich bringt, muss sie nichts intrinsisch<br />
Böses sein, von dem man alle abschotten<br />
muss. Sie ist ein Teil unserer Kultur,<br />
ob wir es zugeben wollen oder nicht. Besonders<br />
für Jugendliche kann sie auch<br />
eine Bereicherung und ein Werkzeug<br />
sein, um etwa die eigene Sexualität und<br />
den Körper zu entdecken. All das setzt<br />
natürlich voraus, dass man mit nötigem<br />
Wissen und Medienkompetenz ausgestattet<br />
wurde, um Realität von Fiktion<br />
in einem Porno zu unterscheiden. Hier<br />
kommen die Eltern ins Spiel, die Aufklärung<br />
betreiben müssen und sich selbst<br />
nicht vor Sexualität sträuben dürfen.<br />
Manchmal gilt es eben, in den eigenen<br />
Augen unangenehme Gespräche mit<br />
den eigenen Kindern zu führen und zu<br />
erklären, was es mit Sex und all dem<br />
was dazugehört auf sich hat. Sie werden<br />
es einem danken.<br />
von Alexander Schuster<br />
Adriane Krem / Copyright: Privat<br />
Christina Raviola / Copyright: Privat<br />
© Copyright: adobe stock / motortion<br />
CHECK DIR<br />
DIE INFOS !<br />
DIENSTVERTRAG GERECHTE ENTLOHNUNG ÜBERSTUNDEN<br />
FÖRDERUNGEN & STIPENDIEN<br />
JOB & STUDIUM<br />
PFLICHTPRAKTIKUM<br />
KONSUMENTINNENSCHUTZ<br />
EVENTS<br />
akyoung@aknoe.at<br />
05 7171-24 000<br />
akyoung.at<br />
44<br />
KY_Claim_geschmeidig_Arbeit_2020.indd 1 04.06.2020 11:43:31<br />
Thema Pornografie - Gefahr für Kinder und Jugendliche?
Zwischen Games und Gefahr<br />
Gewalthaltige Online-Spiele sind im Alltag vieler Kinder und Jugendlicher verankert. <strong>SUMO</strong> sprach mit Natalie<br />
Denk, Leiterin des Zentrums für Angewandte Spieleforschung der Donau-Universität Krems, und Eveline Hipeli,<br />
Kommunikationswissenschaftlerin und Medienpädagogin sowie Dozentin für Medienbildung an der Pädagogischen<br />
Hochschule Zürich, über Jugendschutz, Medienkompetenz und sozialen Druck im Bereich Violent Online<br />
Gaming.<br />
Die Augen auf den Bildschirm geheftet<br />
und über ein Headset kommunizierend<br />
wird der Plan für die nächste Schlacht<br />
besprochen. Es regnet Schüsse auf das<br />
gegnerische Team, Blutflecken erscheinen<br />
am eigenen Bildschirm. Wird man<br />
selbst getroffen, geht es nach wenigen<br />
Sekunden in die nächste Runde. „Fortnite“,<br />
„Counter-Strike“, „Call of Duty“ und<br />
sonstige Online-Shooter-Spiele sind für<br />
viele Kinder und Jugendliche fester Bestandteil<br />
der Freizeitgestaltung. Doch<br />
mit gewalthaltigen Spielen geht auch<br />
eine gewisse Verantwortung von Seiten<br />
der Eltern und Schulen einher. Es stellt<br />
sich die Frage, wie sich der Schutz der<br />
Kinder in Bezug auf Medienkompetenz<br />
mit sozialem Druck – vor allem von der<br />
Peergroup – vereinen lässt.<br />
Aggressionspotenzial?<br />
Laut der Jugend-Information-Medien-<br />
Studie (JIM-Studie) 2018 zeigten sich<br />
unter den befragten 12- bis 19-Jährigen<br />
Deutschen sowohl Burschen als auch<br />
Mädchen interessiert an digitalen Spielen<br />
und nutzten diese mehrmals wöchentlich.<br />
Erstmals fand sich das Koop-<br />
Survival-Spiel „Fortnite“ mit einem<br />
Fünftel der Stimmen an der Spitze der<br />
beliebtesten Spiele. Unter den Nutzer-<br />
Innen von Online-Spielen ist die Sprachkonferenz-Software<br />
„Team-Speak“ eine<br />
populäre Kommunikationsplattform,<br />
bei der neben Spielinformationen auch<br />
persönliche Themen ausgetauscht werden.<br />
Besonders im Kontext der sozialen<br />
Interaktion zwischen SpielerInnen stellt<br />
sich die Frage nach dem Aggressionsund<br />
damit Gewaltpotential von gewalthaltigen<br />
Spielen. Dieser Problematik<br />
haben sich schon etliche Studien gewidmet.<br />
Der These, dass gewalthaltige<br />
Spiele zu einer erhöhten Aggressivität<br />
führen, widerspricht eine 2019 im<br />
Journal der Royal Society Open Science<br />
erschienene Studie. Auch eine 2016 publizierte<br />
Untersuchung im Journal „Plos<br />
One“ konnte nur einen schwachen Zusammenhang<br />
zwischen Gewaltspielen<br />
und Verhaltensstörungen feststellen.<br />
Das Thema ist dennoch immer wieder<br />
Gegenstand medialer und öffentlicher<br />
Debatten. Für die Kommunikationswissenschaftlerin<br />
Eveline Hipeli steht zuallererst<br />
fest, dass sich das Messen von<br />
Mediengewalt als äußerst schwierig herausstellt.<br />
Gerade bei Personen, die von<br />
aggressiver Disposition betroffen sind,<br />
und in ihrem familiären, sozialen Umfeld<br />
Gewalt erleben, wirke mediale Gewalt<br />
anders. Der Bezug zur Realität sei daher<br />
ausschlaggebend. „Bei den meisten<br />
Kindern und Jugendlichen die, sagen wir<br />
einmal, mit altersgerechten Gewaltinhalten<br />
in Kontakt kommen, sind die Wirkungen<br />
relativ klein“, merkt Hipeli an und<br />
weist aber darauf hin, dass das jedoch<br />
nicht auf Kinder zutreffe, die diese Inhalte<br />
noch nicht richtig einordnen können.<br />
„Die Erfahrungen hängen sehr stark<br />
einerseits auch vom Erfahrungshintergrund<br />
ab, vom Alter des Kindes und der<br />
Prädisposition und dem sozialen Umfeld“,<br />
fasst Eveline Hipeli zusammen.<br />
Natalie Denk sieht auch darin eine<br />
Problematik, dass oft eine unmittelbare<br />
Korrelation zwischen gewalthaltigen<br />
Computerspielen und Amokläufen<br />
gezogen wird. „Das ist auch aus<br />
wissenschaftlicher Sicht höchst problematisch,<br />
wenn man unreflektiert behauptet,<br />
dass das eine zum anderen<br />
führt. Das ist etwas, was Menschen<br />
allerdings sehr gerne tun, einfach deshalb,<br />
weil sich Dinge mit genau solchen<br />
Schlussfolgerungen scheinbar einfach<br />
erklären lassen“, erläutert Denk. Daher<br />
gehe es darum, sich explizit mit dem jeweiligen<br />
Fall auseinanderzusetzen und<br />
den Ursachen für exzessives Computerspielen<br />
auf den Grund zu gehen. Es<br />
müsse auch der Frage nachgegangen<br />
werden, inwiefern die Spieleinhalte in<br />
die Realität übersetzt werden. „Wenn<br />
ich jetzt in einem Spiel gewaltlastige<br />
Handlungen durchführe, heißt das nicht<br />
automatisch, dass ich hier wirklich zum<br />
Beispiel lerne, eine Waffe einzusetzen<br />
und überhaupt irgendwelche Barrieren<br />
überwinde, die ich im Realfall habe, also<br />
da geht es oft um ganz andere Sachen“,<br />
untermauert Denk. Man müsse sich<br />
auch die Frage stellen, welche Kompetenzen<br />
in diesen Spielen tatsächlich<br />
gefördert werden. Dabei rücke das Bedienen<br />
einer Waffe oder Ausüben von<br />
Gewalthandlungen in den Hintergrund,<br />
eher stünden taktisches Vermögen,<br />
vorausschauendes Denken und teamübergreifende<br />
Kommunikation im Vordergrund.<br />
Insbesondere bei jüngeren<br />
Kindern gilt es jedoch auch nach altersadäquaten<br />
Alternativen zu suchen, die<br />
dennoch umfangreichen Spielspaß bieten.<br />
Laut Denk gehe es hierbei sowohl<br />
für die Eltern, als auch die Spiele-EntwicklerInnen<br />
darum, über den Tellerrand<br />
hinaus zu schauen und kreative<br />
Lösungen abseits der beliebten kriege-<br />
© Copyright: adobe stock / grandfailure<br />
Zwischen Games und Thema Gefahr<br />
45
© Copyright: adobe stock / Rangizzz<br />
rischen Settings zu finden, die sich der<br />
Spielebranche anbieten.<br />
Doch was verbirgt sich überhaupt hinter<br />
der Faszination von digitalen Spielen?<br />
Im Vergleich zu Zeiten, als Online-Welten<br />
noch kein Thema waren und Kinder<br />
ihre Freizeit hauptsächlich in der freien<br />
Natur verbracht haben, beschreibt Hipeli,<br />
dass Eltern heute viel vorsichtiger<br />
geworden sind. Die Ursache dafür<br />
sei eine Verlagerung von Abenteuern<br />
in virtuelle Welten, die wiederum auch<br />
das Thema Gewalt inkludieren können.<br />
Eine Definition von Gewalt stelle<br />
sich als äußerst schwierig dar, da die<br />
Bandbreite des Begriffs von körperlicher,<br />
verbaler bis zu psychischer Gewalt<br />
reicht und die unterschiedlichsten<br />
Formen annehmen kann. In Bezug auf<br />
Computerspiele merkt die Kommunikationswissenschaftlerin<br />
an: „Das wird ja<br />
oft auch im Rahmen solcher Abenteuer<br />
und Quests etc. eingesetzt und da steht<br />
die Gewalt meistens gar nicht im Vordergrund.<br />
Auch da gibt es ein großes<br />
Spektrum.“ Zur Faszination von Gewalt<br />
in virtuellen Spielen nennt Hipeli einige<br />
mögliche Ursachen. Zuallererst sei es<br />
faszinierend, an diesen digitalen Abenteuern,<br />
die in der Realität nicht erlebt<br />
werden können, teilzuhaben. Außerdem<br />
seien Computerspiele generell<br />
(und auch solche, in denen Mediengewalt<br />
vorherrscht) gerade für Kinder, die<br />
vielleicht in der schulischen Umgebung<br />
oder im Freundeskreis weniger im Mittelpunkt<br />
stehen, eine Möglichkeit, ihr<br />
Können unter Beweis zu stellen. „Da<br />
geht es auch nicht um die Gewalt, sondern<br />
um die Geschicklichkeit, die man<br />
in diesem Spiel erlebt “, erläutert Hipeli.<br />
Besonders im Jugendalter sei das Thema<br />
Grenzüberschreitungen ein Aspekt,<br />
der zum „Entwicklungsprozess der<br />
Loslösung“ dazugehöre und auch die<br />
Faszination hinter gewalthaltigen Spielen<br />
erklären könne. Vor allem in Bezug<br />
auf Horrorspiele nennt Hipeli das Motiv<br />
der Angstlust, das zur Begeisterung der<br />
Jugendlichen beiträgt.<br />
Frage nach (mehr) Verantwortung<br />
Beim Thema Jugendschutz erfordere es<br />
laut Hipeli und Denk der Verantwortung<br />
verschiedener Bereiche. Für Hipeli liege<br />
die Aufgabe der Eltern vor allem in der<br />
Kontrolle der Inhalte und der Förderung<br />
der Medienkompetenz ihrer Kinder.<br />
Dazu zählt es, sich mit den Interessen<br />
der Kinder auseinanderzusetzen und<br />
zu versuchen, ihre Spielewelten zu verstehen.<br />
Die Bezugspersonen müssten<br />
sich selbst informieren und mit dem<br />
Thema auseinandersetzen, um den<br />
Kindern einen kompetenten Umgang<br />
mit Computerspielen zu vermitteln und<br />
über die Gefahren aufklären zu können.<br />
„Ein wesentlicher Faktor ist sicher diese<br />
Förderung der Kritikfähigkeit, und<br />
die läuft über das Gespräch“, erklärt<br />
die Medienpädagogin. Die Verantwortung<br />
liege andererseits aber auch bei<br />
den Geschäften, die diese Spiele anbieten<br />
und sich an die Altersfreigaben<br />
und Weisungen halten sollten. Denk<br />
betont die Rolle der Spielehersteller/<br />
innen, die entsprechende Funktionen<br />
wie die Möglichkeit ungeeignete Chat-<br />
Inhalte zu melden zur Verfügung stellen<br />
müssen. Die Verantwortung liege<br />
auch im Bereich des Bildungssystems<br />
und der Schulen. Anstatt das Thema<br />
der Gewaltspiele zu „verteufeln“, sollte<br />
den Kindern und Jugendlichen ein<br />
Gesprächsraum geboten werden. „Ich<br />
glaube, man kann verlangen, dass es<br />
in jeder Schule Ansprechpersonen gibt,<br />
genauso wie es in jeder Schule SchulpsychologInnen<br />
gibt“, betont Denk und<br />
fordert, dass der Themenbereich Gewalt,<br />
Computerspiele und Cybercrime<br />
mehr in die Ausbildung des Lehrpersonals<br />
miteinfließen müsse. Dazu eigne<br />
sich auch das Anbieten von (Online-)<br />
Workshops, um das Thema nicht nur<br />
für Lehrkräfte, sondern auch Eltern verständlicher<br />
zu machen.<br />
Einen Auslöser für intensives Spielen<br />
sieht Hipeli im sozialen Druck. Vor allem<br />
für Kinder sei es schwierig, sich in der<br />
„Phase der Freundschaftssuche“ gegen<br />
die Peers durchzusetzen. Die Machart<br />
vieler Computerspiele sei oft gerade<br />
darauf ausgerichtet, dass man sich viel<br />
mit ihnen beschäftigt, um beispielsweise<br />
neue Waffen freizuschalten oder<br />
den eigenen Avatar verändern zu können.<br />
Mit steigendem Alter der KonsumentInnen<br />
falle es aber auch leichter,<br />
nein zu sagen. „Und auch da kommt es<br />
sehr auf die Entwicklung an und vor allem<br />
eben auf die Erwachsenen, die mit<br />
den Kindern über Konsumsozialisation<br />
sprechen“, betont Hipeli. Weiterführend<br />
müsse das Thema Taschengeld und<br />
die Frage, wofür es eingesetzt wird,<br />
gemeinsam mit den Kindern geklärt<br />
werden. Beim Thema Computerspielsucht<br />
merkt sie an, dass es weniger im<br />
Aufgabenbereich des Jugendschutzes<br />
durch Altersfreigaben oder ähnliches<br />
gehe, sondern um die Schulung der<br />
Bezugspersonen und dem Bewusstmachen<br />
der Kinder selbst. Dazu gehöre<br />
auch das Setzen von Grenzen.<br />
46<br />
Zwischen Thema Games und Gefahr
Herausforderungen der Virtualität<br />
Für einen kompetenten Umgang mit<br />
Computer- und Online-Spielen ermöglichen<br />
Alters- und Jugendschutzkennzeichnungen<br />
einen ersten Anhaltspunkt.<br />
Dazu zählt beispielsweise das<br />
PEGI-System (Pan-European Game<br />
Information), welches europaweit gilt<br />
und Computerspiele nach Altersempfehlungen<br />
klassifiziert. Für digital vertriebene<br />
Spiele und auch Apps gibt<br />
es das IARC-System (International<br />
Age Rating Coalition). Durch das USK-<br />
Kennzeichen (Unterhaltungssoftware<br />
Selbst-Kontrolle) soll gewährleistet<br />
werden, dass die Entwicklung ab dem<br />
jeweiligen Alter nicht beeinträchtigt<br />
wird. In Österreich liegt das Thema Jugendschutz<br />
gemäß der Bundesverfassung<br />
im Aufgabenbereich der einzelnen<br />
Bundesländer. So ist zum Beispiel in<br />
Wien die Kennzeichnung von Computer-<br />
und Konsolenspielen mit dem PE-<br />
GI-System gesetzlich verpflichtet, in<br />
Salzburg ist das USK-Kennzeichen vorgesehen.<br />
Zu den Altersfreigaben merkt<br />
Denk an, dass durch diese zwar versichert<br />
wird, dass die Spiele keine problematischen<br />
Inhalte für die genannte<br />
Altersklasse beinhalten, jedoch können<br />
keine Rückschlüsse auf die Qualität und<br />
Unbedenklichkeit der Spiele geschlossen<br />
werden. Es sei auch nicht zielführend,<br />
als Elternteil den Kindern und<br />
Jugendlichen bestimmte Spiele zu verbieten,<br />
da es dadurch, und vor allem in<br />
Verbindung mit sozialem Druck von der<br />
Peergroup, kaum zu Gesprächen über<br />
die Spielerlebnisse kommen werde.<br />
Denk empfiehlt – besonders als Informationsquelle<br />
für die Eltern – die Bundesstelle<br />
für die Positivprädikatisierung<br />
von digitalen Spielen (BuPP), die nach<br />
aufwändigen Reviewprozessen Altersempfehlungen<br />
für digitale Spiele abgibt.<br />
Somit können den Kindern direkte<br />
Alternativen, die auch dem jeweiligen<br />
Alter entsprechen, geboten werden. Es<br />
biete sich für die Eltern an, diese im Idealfall<br />
gemeinsam mit den Kindern bzw.<br />
Jugendlichen zu spielen. Auch Hipeli beschreibt,<br />
dass die Erwachsenen durch<br />
Co-playing und -viewing ein besseres<br />
Verständnis für die Kinder und Jugendlichen<br />
entwickeln können, selbst wenn<br />
die Faszination für die Spiele nicht geteilt<br />
werden sollte.<br />
Wie Denk schildert, sind Computerspiele<br />
eines der beliebtesten Unterhaltungsmedien<br />
für Kinder und Jugendliche.<br />
Beim Thema Jugendschutz dürfe<br />
jedoch die Vielschichtigkeit des Mediums<br />
nicht außer Acht gelassen werden.<br />
Einen Kritikpunkt bringt sie dahingehend<br />
auf die häufig fehlende Tiefe und<br />
Verallgemeinerung in der medialen Berichterstattung<br />
an, wenn es um Computerspiele<br />
geht. Diese ermöglichen<br />
„die unterschiedlichsten Spielerfahrungen,<br />
die unterschiedlichsten Erlebnisse“<br />
– und es bedürfe deshalb einer<br />
Auseinandersetzung mit den konkreten<br />
Inhalten des jeweiligen Spieles. Abseits<br />
der Spielinhalte stellt allerdings die in<br />
vielen Online-Spiele integrierte Chatfunktion<br />
eine Problematik dar. Einen<br />
großen Hype gab es beispielsweise um<br />
„Fortnite“, das laut USK ab einem Alter<br />
von zwölf Jahren freigegeben wird. Laut<br />
Denk werde aber zu wenig berücksichtigt,<br />
was sich in den Chats abspielt. Ein<br />
„gesundes Maß“ an Aufstachelungen<br />
sei aber ganz normal – im Gegensatz<br />
zu Erniedrigungen oder Sexismus, welche<br />
keinen Raum einnehmen dürfen.<br />
Die Rolle der Eltern liege daher ganz<br />
klar darin, die Kinder dazu animieren,<br />
sich über ihre Erfahrungen zu äußern.<br />
Die Kommunikation sei aber ein Thema,<br />
das nicht nur auf Computerspiele<br />
zutrifft. „Kinder und Jugendliche von<br />
heute sind einfach in Online-Medien-<br />
Welten unterwegs und haben einfach<br />
auch sehr viel mit pseudoanonymer<br />
Online-Kommunikation zu tun“, betont<br />
Denk und fordert, dass eine häufigere<br />
Thematisierung in Schulen stattfinden<br />
muss.<br />
„Empfehlen statt Verbieten“<br />
Wie Denk anmerkt, sei es wichtig, auch<br />
das viel diskutierte Thema der Online-<br />
Spiele aus einer neuen Perspektive zu<br />
betrachten und die eigene „Bubble“ zu<br />
verlassen. Gerade Qualitätsmedien tragen<br />
maßgeblich zur Aufarbeitung bei.<br />
Von Seiten der Politik solle weniger auf<br />
Verbote und Bestrafungen, sondern<br />
Aufklärung, Empfehlungen und Förderungen<br />
abgezielt werden. Dazu bedarf<br />
es auch des Einsatzes von ExpertInnen<br />
in der Regierung. Auch die Forschung sei<br />
ein Thema, das laut Hipeli gerade durch<br />
neu auftretende Spielformate wie Virtual<br />
Reality in den Fokus rücken müsse.<br />
In der Berichterstattung solle Mediengewalt<br />
differenzierterer betrachtet und<br />
nicht immer nur die negativen Aspekte<br />
hervorgehoben werden. „Mediengewalt<br />
macht nicht einfach irgendwelche<br />
AmokläuferInnen aus den Menschen“,<br />
betont Hipeli. Es bedarf einer neutraleren<br />
Diskussion, wobei die Risiken nicht<br />
vorweg gelassen werden dürfen. Beim<br />
Thema Medienkompetenzförderung<br />
solle nicht immer mit dem erhobenen<br />
„pädagogischen Zeigefinger“ getadelt<br />
werden, sondern spielerisch vorgegangen<br />
werden. Game based learning for<br />
better gaming.<br />
von Julia Allinger<br />
Natalie Denk / Copyright: Alexander Pfeiffer<br />
Eveline Hipeli / Copyright: Luisa Kehl<br />
Zwischen Games und Thema Gefahr<br />
47
Deep Fakes: Fluch oder Fun?<br />
Künstliche Intelligenz (KI) öffnet völlig neue Türen. Ein durch sie entstandenes<br />
Phänomen sind Deep Fakes, digital bearbeitete Videos von Personen,<br />
denen man mit Hilfe von KI Gesichter von Prominenten aufpflanzt. <strong>SUMO</strong><br />
sprach mit Martin Steinebach, Abteilungsleiter für Media Security und IT<br />
Forensics am Fraunhofer-Institut in Darmstadt, und Klaus Gebeshuber,<br />
Professor für IT-Security an der FH Joanneum in Kapfenberg, über Probleme<br />
und Chancen von Deep Fakes.<br />
© Copyright: adobe stock / meyerandmeyer<br />
Man stelle sich folgende Situationen<br />
vor: Ein Politiker wird der Wiederbetätigung<br />
beschuldigt, da er in einem<br />
Video, das im Internet aufgetaucht ist,<br />
antisemitische Aussagen tätigt. Oder<br />
man stößt auf einer Porno-Site plötzlich<br />
auf ein Video von einem selbst,<br />
ohne jemals ein solches gedreht zu<br />
haben. Beide Videos sind fake, doch<br />
der dadurch angerichtete Schaden ist<br />
schwer behebbar und kann weitreichende<br />
Folgen mit sich tragen. Genau<br />
solche Problematiken wirft der ein<br />
paar Jahre alte, stets ausgefeiltere Internet-Trend<br />
„Deep Fakes“ auf. Deep<br />
Fakes bezeichnen gefälschte Videos, in<br />
dem die Gesichter von beispielsweise<br />
PolitikerInnen und SchauspielerInnen<br />
auf die Körper anderer Personen gepflanzt<br />
wurden und man sie danach<br />
Dinge sagen und tun lässt, die nie passiert<br />
sind. Der Wissenschaftsjournalist<br />
Norbert Nosslau schrieb in seiner Arbeit<br />
„Deep Fake: Gefahren, Herausforderungen<br />
und Lösungswege“, dass der<br />
Name ein Kunstwort sei und sich sich<br />
aus den Begriffen „Deep Learning“,<br />
einer speziellen KI-Technik, und „Fake“,<br />
also der Fälschung, zusammensetze.<br />
Diese Technologie basiert auf neuralen<br />
Netzwerken, die durch das Analysieren<br />
möglichst großer Datenproben lernen,<br />
Gesichtsausdrücke und -form einer<br />
Person zu imitieren. Mika Westerlund,<br />
Professor an der Carleton University<br />
in Kanada, legte in seinem Text „The<br />
Emergence of Deepfake Technology: A<br />
Review“ dar, wie Deep-Fake-Technologie<br />
funktioniert: Ein Deep-Learning-<br />
Algorithmus werde mit Aufnahmen<br />
zweier Personen gefüttert, um ihn<br />
darauf zu trainieren, das Gesicht einer<br />
Person in einem Video mit dem Gesicht<br />
einer anderen Person zu vertauschen.<br />
Die zuvor genannten neuronalen Netzwerke<br />
seien lernfähig und in der Lage,<br />
aus vielen Fotos einer Person zu erlernen<br />
oder vorherzusagen, wie sie aus<br />
einem anderen Winkel oder mit einem<br />
anderen Gesichtsausdruck aussehe.<br />
Verwendungsarten von Deep Fakes<br />
Laut Westerlund hätten Deep Fakes<br />
erstmals 2017 an Bekanntheit gewonnen,<br />
als ein Nutzer der Online-Plattform<br />
„Reddit“ die ersten Videos teilte,<br />
die Prominente in sexuellen Szenen<br />
darstellten, und die dafür verwendete<br />
Software als Open-Source-Programm<br />
im Internet für andere zur Verfügung<br />
stellte. Im Allgemeinen ist die pornografische<br />
Verwendung von Deep Fakes<br />
vorherrschend. 2018 startete die KI-<br />
Firma „Deeptrace“ eine Messung der<br />
Deep-Fake-Aktivitäten im Internet und<br />
untersuchte dabei 15.000 Deep-Fake-<br />
Videos. Im darauffolgenden Bericht<br />
„The State of Deep Fakes – Landscape,<br />
Threats and Impact“ wurde schließlich<br />
dargelegt, dass 96% der Deep Fakes<br />
pornografischer Natur waren. 99% der<br />
vertauschten Gesichter betrafen dabei<br />
Frauen. Unter den vielen Opfern von<br />
Deep Fakes zählt auch die bekannte<br />
Schauspielerin Scarlett Johansson.<br />
Laut einem Artikel des „Standard“ erzielte<br />
ein pornografisches Video mit<br />
ihrem Gesicht 1,5 Millionen Aufrufe,<br />
bevor es von „Pornhub“ gelöscht<br />
wurde. In einem Interview mit der<br />
„Washington Post“ erzählte sie, dass<br />
sie den Kampf gegen Deep Fakes als<br />
„sinnlos“ betrachte und dass sie sich<br />
nicht mehr aus dem Netz vertreiben<br />
ließen, wenn sie einmal veröffentlicht<br />
wurden.<br />
Neben der großen Problematik des<br />
Missbrauchs in Sachen Pornografie,<br />
wirft es auch Probleme für PolitikerInnen<br />
und Rufschädigung auf. „Pornografie<br />
war die erste Welle von Deep Fakes,<br />
die ins Netz gekommen sind, danach<br />
hatten wir eine Welle, bei der sehr viele<br />
Entertainment-Videos auftauchten,<br />
in denen Comedians PolitikerInnen<br />
lustige Sachen machen ließen. Jetzt ist<br />
48<br />
Deep Fakes: Fluch oder Fun?
das Ganze wie zu erwarten auch in der<br />
Welt der Desinformation angekommen<br />
und wird da missbräuchlich eingesetzt.<br />
Da ist es natürlich kritisch und als eine<br />
echte kurzfristige Gefährdung für den<br />
Ruf von PolitikerInnen zu sehen“, betont<br />
Media-Security-Experte Martin<br />
Steinebach im <strong>SUMO</strong>-Interview fest.<br />
Es stelle sich meistens raus, dass es<br />
sich um eine Fälschung handle, jedoch<br />
könne der kurzfristige Impact langfristige<br />
Folgen mit sich bringen: etwa<br />
kurz vor einer Wahl, falls Deep Fakes<br />
verbreitet würden, um eine/n Kandidatin/en<br />
zu denunzieren, und viele<br />
Leute ihre Meinung darauf hin ändern<br />
und die/den Kandidatin/en doch nicht<br />
wählen. Auch wenn nach der Wahl das<br />
Video aufgedeckt würde, wäre es dann<br />
schon zu spät. Damit wäre die Aufdeckung<br />
des Videos kurzfristig bereinigt<br />
worden, aber die Nachwirkungen der<br />
Manipulation hielten dann Jahre an.<br />
Die Frage, ob die Verantwortung für<br />
den Missbrauch dieser Technologe bei<br />
NutzerInnen oder dem/r Entwickler/in,<br />
der bzw. die Ersteren schließlich das<br />
Werkzeug in die Hand lege, ist für IT-<br />
Security-Experten Klaus Gebeshuber<br />
klar zu beantworten: „Der/Die Nutzer/<br />
in trägt definitiv die Verantwortung für<br />
den Missbrauch der Technologie. Ein<br />
Schraubenzieher kann auch dafür verwendet<br />
werden, jemanden zu töten,<br />
in diesem Fall trägt aber auch nicht<br />
das Werkzeug die Schuld an der Tat,<br />
sondern der oder die Täter/in“. Neben<br />
diesen problematischen Anwendungsmöglichkeiten<br />
findet die Deep-Fake-<br />
Technologie jedoch auch harmlosere<br />
Verwendung im Bereich Parodien,<br />
Satire und sonstiger Unterhaltung.<br />
„YouTube“-Kanäle wie „Ctrl Shift Face“<br />
nutzen Deep Fakes, um unterhaltsame<br />
Videos zu produzieren, in denen die<br />
Gesichter von SchauspielerInnen mit<br />
anderen ausgetauscht werden: Robert<br />
Downey Junior und Tom Holland<br />
als moderne Neubesetzungen für „Doc<br />
Brown“ und „Marty McFly“ aus dem<br />
Kult-Zeitreise-Film „Zurück in die Zukunft“,<br />
und vieles mehr. Demokratisch<br />
wie auch problematisch kommt hinzu,<br />
dass so ziemlich jede/r heutzutage<br />
in der Lage ist, zumindest einfachste<br />
Deep Fakes zu generieren. Eine immer<br />
länge werdende Liste an Programmen<br />
und zahlreiche Tutorial-Videos auf<br />
Videoplattformen wie „YouTube“ ermöglichen<br />
es auch Laien, sich an der<br />
Erstellung von solchen zu versuchen.<br />
Widerstand und Zukunft<br />
Die Tür, die ein Weiterspinnen solcher<br />
Technologie in der Zukunft öffnet kann<br />
beängstigend wirken. Sowohl Gebeshuber<br />
als auch Steinebach sind sich<br />
einig, dass Deep Fakes bei dem derzeitigen<br />
technologischen Fortschritt<br />
in wahrscheinlich weniger als zehn<br />
Jahren nicht mehr von der Realität<br />
unterscheidbar wären. Es gibt aber<br />
Personen, die Deep Fakes den Kampf<br />
angesagt haben: „Assembler“ – eine<br />
Software von Jigsaw, einer Firma des<br />
Alphabet-Konzerns – soll laut „Der<br />
Standard“ (28.02.2020) beispielsweise<br />
Medienhäusern und Fakten-Checkern<br />
dabei helfen, manipulierte Videos in<br />
geringerer Zeit und mit höherer Trefferquote<br />
zu identifizieren. Ian Sample<br />
vom „The Guardian“ berichtete in<br />
seinem Artikel „What are deepfakes<br />
and how can you spot them“, dass<br />
die Qualität der Deep Fakes zunehme<br />
und sie mit freiem Auge zu erkennen,<br />
immer schwieriger werde. Weiters<br />
finanzieren Regierungen, Universitäten<br />
und Tech-Unternehmen bereits<br />
Forschungsbemühen, um zukünftig<br />
Deep Fakes aufdecken zu können.<br />
Programme wie das zuvor erwähnte<br />
„Assembler“ könnten zukünftig dabei<br />
helfen, Fakes von Realität zu unterscheiden.<br />
Im zuvor genannten Artikel<br />
des „Standard“ wurde ebenfalls berichtet,<br />
dass Pornosites wie „Pornhub“<br />
sich dazu entschieden hätten, Deep-<br />
Fake-Content zu verbannen und dem<br />
Missbrauch keine Plattform zu bieten.<br />
Auch Soziale Medien wie beispielsweise<br />
„Facebook“ und „Reddit“ änderten<br />
ihre Nutzerrichtlinien dahingehend,<br />
dass sie Deep Fake-Inhalte zukünftig<br />
sofort entfernen werden. Einen<br />
Schritt weiter ging die Regierung des<br />
US-Bundesstaats Kalifornien, die zwei<br />
neue Gesetze im Zusammenhang mit<br />
Deep Fakes beschloss, wie „Deutschlandfunk<br />
Nova“ in einem Online-Artikel<br />
berichtete. Während mit dem ersten<br />
Gesetz von Deep-Fake-Videos Betroffene<br />
mehr Möglichkeiten erhalten, sich<br />
gegen die Verwendung ihrer Gesichter<br />
zu wehren, verbietet das zweite Gesetz<br />
die Verbreitung von politischen<br />
Deep Fakes. Gebeshuber sieht solche<br />
Verbote als wenig effektiv: „Technologie<br />
kann nicht verboten werden. Durch<br />
das Internet gibt es immer andere<br />
und neue Wege, sie zu verbreiten.“<br />
Auch Steinebach zeigt sich Verboten<br />
gegenüber skeptisch: „Die Deep Fakes<br />
sind im Internet. Man kann höchstens<br />
seitens der EU solche Projekte nicht<br />
mehr unterstützen oder darüber nachdenken,<br />
eine Kennzeichnungspflicht<br />
für Deep-Fake-Technologie einzuführen.<br />
So wäre wenigstens in den Meta-Daten<br />
erkenntlich, dass das Video<br />
durch einen Algorithmus manipuliert<br />
wurde.“ Für andere würde der zukünftige<br />
Fortschritt der Deep-Fake-Technologie<br />
neue Möglichkeiten mit sich<br />
© Copyright hier<br />
Deep Fakes: Fluch oder Fun? 49
ingen. Mika Westerlund, Professor<br />
an der Carleton University in Kanada,<br />
schrieb im oben erwähnten Artikel,<br />
dass beispielsweise die Filmindustrie<br />
stark von Deep Fake und Face-Mapping-Technologie<br />
profitieren könne. Es<br />
würde FilmemacherInnen beispielsweise<br />
erlauben, klassische Szenen aus<br />
Filmen nachzuschaffen oder verstorbene<br />
SchauspielerInnen wieder auf die<br />
Leinwand zu holen. „Möglicherweise<br />
ist man in der Zukunft im Entertainmentbereich<br />
gar nicht mehr auf die<br />
Präsenz von SchauspielerInnen angewiesen“,<br />
äußerte sich Steinebach dazu.<br />
Auch in der Post Production könne sich<br />
die Technologie in Form von Spezialeffekten<br />
und komplexer Gesichtsbearbeitung<br />
auszahlen. Weiters habe auch<br />
die Mode- und Werbeindustrie Interesse<br />
an dieser Technologie. Mit Ihrer<br />
Hilfe könnten sich beispielsweise die<br />
KonsumentInnen selbst in Models verwandeln<br />
und ihre Gesichter auf andere<br />
Körper pflanzen. Dies ermögliche eine<br />
bis dato unerreichte Vorschau darauf,<br />
wie ein Outfit an einem/einer selbst<br />
aussehen würde, bevor man es überhaupt<br />
kauft. Damit könnte man eine<br />
große Zahl an Kleidungstücken in kürzester<br />
Zeit anprobieren.<br />
Schlussendlich sind Deep Fakes eine<br />
Technologie, die ebenso viele Chancen<br />
eröffnet, wie sie auch soziale Probleme<br />
bereitet. Egal, ob sie Besorgnis<br />
erregt oder man deren Zukunft aufgeregt<br />
entgegenfiebert, eines steht<br />
fest: Deep Fakes sind gekommen, um<br />
zu bleiben. Sie wird sich weiterverbreiten<br />
und perfektioniert werden. Es<br />
gilt, diese Entwicklung in kontrollierten<br />
Bahnen stattfinden zu lassen und<br />
sicherzustellen, dass menschliche<br />
Grundrechte wie Privatsphäre und Gerechtigkeit<br />
für jene Personen, die von<br />
ihnen oft unfreiwillig betroffen sind,<br />
nicht auf der Strecke des Fortschrittes<br />
liegen bleiben.<br />
von Alexander Schuster<br />
48˚10'44.6"N15˚34'02.3"E<br />
Klaus Gebeshuber / Copyright: FH Joanneum<br />
© Copyright: adobe stock / Katerin<br />
Martin Steinbach / Copyright: Fraunhofer SIT<br />
50<br />
Deep Fakes: Fluch oder Fun?
Digitalsteuer: Endlich<br />
faire Steuern für alle?<br />
Was haben „Facebook“, „Google“ und „Amazon“ gemeinsam? Sie sind<br />
Experten, wenn es darum geht, Steuerzahlungen zu vermeiden. Seit<br />
dem 1.1.2020 ist das Digitalsteuergesetz in Österreich in Kraft, um diese<br />
Ungerechtigkeit gegenüber anderen Unternehmen abzuschaffen. <strong>SUMO</strong><br />
sprach mit Dominik Bernhofer, Ökonom und Leiter der Abteilung Steuerrecht<br />
in der Arbeiterkammer Wien, sowie mit Eva-Maria Himmelbauer,<br />
Abgeordnete zum Nationalrat und Bereichssprecherin für Telekommunikation<br />
und Netzpolitik der ÖVP, über den nationalen Alleingang Österreichs<br />
bei der Digitalsteuer, europäische Lösungen und erhoffte Einnahmen.<br />
Die Debatte um gerechte Besteuerung<br />
für die weltweit größten Unternehmen<br />
der Technologiebranche (vor allem<br />
„Google“, „Amazon“, „Facebook“) wird<br />
seit vielen Jahren geführt. Anfang 2018<br />
hat die EU-Kommission einen Vorschlag<br />
für eine EU-weite Digitalsteuer<br />
auf Online-Werbung, Plattformumsätze<br />
und Einnahmen aus Datenverkauf<br />
vorgeschlagen. Auf internationaler<br />
Ebene verhandeln die Länder um einen<br />
Mindeststeuersatz. Eine Einigung? Bisher<br />
Fehlanzeige. „Amazon“ beispielsweise<br />
bezahlte in Europa im Jahr 2016<br />
16,5 Millionen Euro Steuern, bei einem<br />
Umsatz von mehr als 21 Milliarden<br />
Euro, was einem Prozentsatz von 0,07<br />
entspricht.<br />
Werbeabgaben bisher nur für traditionelle<br />
Medien<br />
Mit der neu geschaffenen Digitalsteuer<br />
unterliegen Werbeleistungen im Internet<br />
seit Beginn des Jahres einer 5%<br />
Steuer. Dadurch sollen sämtliche Werbungen,<br />
unabhängig ob online oder<br />
offline, auf dasselbe Steuerniveau gebracht<br />
werden. Werbungen in Zeitungen<br />
oder im Radio werden bereits seit<br />
dem Jahr 2000 mittels der Werbeabgabe<br />
– einer so nur in Österreich existierenden<br />
Abgabe – mit 5% besteuert.<br />
Dabei sind zwei Begriffe von besonderer<br />
Bedeutung: die Onlinewerbeleister<br />
und die Onlinewerbeleistungen. Onlinewerbeleister<br />
wie beispielsweise „Google“<br />
sollen dann zahlen, wenn sie aus<br />
Onlinewerbeleistungen weltweit einen<br />
Umsatz von mindestens 750 Mio. Euro<br />
und in Österreich von mindestens 25<br />
Mio. Euro erwirtschaften. Das betrifft<br />
vor allem die bereits genannten „Internet-Giganten“.<br />
Onlinewerbeleistungen<br />
dagegen sind Werbeeinschaltungen<br />
wie beispielsweise Suchmaschinenwerbung.<br />
Fairness schaffen<br />
Dominik Bernhofer ist der Meinung,<br />
dass in Ermangelung einer internationalen<br />
Lösung die nationale Digitalsteuer<br />
eine notwendige Maßnahme war.<br />
Anzustreben sei dennoch eine internationale<br />
Lösung. Ähnlich sieht es Eva-<br />
Maria Himmelbauer, die angibt, dass<br />
die Einführung dieser Steuer ein wichtiger<br />
Schritt in die richtige Richtung sei.<br />
„Es geht darum, Fairness zu schaffen“,<br />
so Himmelbauer. Laut Bernhofer verlief<br />
jedoch die Umsetzung alles andere als<br />
optimal, denn „sie maximiert<br />
Dominik Bernhofer / Copyright: AK<br />
die rechtlichen Risiken, bei gleichzeitiger<br />
Minimierung der Einnahmen“. Zu<br />
dieser Auffassung kommt er, weil der<br />
Anwendungsbereich deutlich kleiner<br />
ist als beim EU-Vorschlag, die Steuereinnahmen<br />
daher sehr niedrig sind. Die<br />
rechtlichen Risiken würden von den<br />
hohen Schwellwerten kommen. Sie<br />
führen laut Bernhofer dazu, dass nur<br />
„Facebook“ & Co. davon betroffen sind,<br />
© Copyright: adobe stock / Maksim Kabakou<br />
Digitalsteuer: Endlich faire Steuern für Thema alle?<br />
51
was Klagen der US-Unternehmen sehr<br />
wahrscheinlich und auch erfolgsversprechend,<br />
zum Beispiel auf Basis des<br />
Gleichbehandlungsgebots oder des EU-<br />
Beihilfenrechts, mache.<br />
Betreffend der zu erwartenden Einnahmen<br />
scheiden sich die Meinungen verschiedener<br />
ExpertInnen noch deutlich.<br />
Beim Gesetzesentwurf sprach die Regierung<br />
von Einnahmen in Höhe von 25<br />
Mio. Euro. ExpertInnen der Universität<br />
Wien und der Arbeiterkammer hingegen<br />
rechnen eher mit 10 bis 15 Mio. Euro,<br />
so Bernhofer. „Um das jetzt schon abschätzen<br />
zu können, ist es noch zu früh“,<br />
meint Himmelbauer. Kritik üben müsse<br />
man auch daran, dass beim Alleingang<br />
Österreichs zwar die Schwellenwerte<br />
des EU-Vorschlags übernommen wurden,<br />
der exakte Anwendungsbereich<br />
sich jedoch unterscheide. Laut Bernhofer<br />
hätte man Online-Vermittlungsprovisionen<br />
auch noch in das Gesetz integrieren<br />
können. „Dann wäre man näher<br />
am EU-Vorschlag dran gewesen und<br />
hätte einen Beitrag von Online-Konzernen<br />
wie AirBnB und Uber sicherstellen<br />
können.“ Ziel der Regierung war es, Aufzeichnungs-<br />
und Übermittlungspflichten<br />
sowie eine entsprechende Haftung<br />
bei Pflichtverletzung des Plattformbetreibers<br />
einzuführen, um abgabenrelevante<br />
Dienstleistungen, wie es<br />
beispielsweise bei der Vermietung von<br />
Wohnraum über AirBnB der Fall ist, erheben<br />
zu können. So muss auch bei der<br />
touristischen Vermietung von privaten<br />
Wohnungen die Ortstaxe erhoben und<br />
abgeführt werden, wie es für Hotels<br />
und Pensionen bereits seit Jahrzehnten<br />
der Fall ist, sagt Himmelbauer.<br />
Insellösungen<br />
An einem „Flickenteppich“, in dem jedes<br />
europäische Land eine eigene Lösung<br />
zur Digitalsteuer einführt, seien auch<br />
„Google“ und Co. nicht interessiert, denn<br />
dadurch benötigen die Konzerne viele<br />
unterschiedliche Reporting-Systeme,<br />
so Bernhofer. Diese werden von SteuerberaterInnen<br />
erstellt, was selbst für<br />
diese global agierenden Giganten viel<br />
Geld und Aufwand bedeuten würden.<br />
Wesentlich einfacher wäre es, wenn<br />
man statt vieler Insellösungen ein einziges<br />
System zur Berichtsmeldung hätte,<br />
mit dem die gesamte EU abgedeckt<br />
wäre. Das spricht laut Bernhofer dafür,<br />
dass auch die Internetkonzerne und die<br />
sie unterstützenden Länder an einer<br />
einheitlichen Steuer interessiert sein<br />
sollten.<br />
Eva-Maria Himmelbauer / Copyright: ÖVP Klub<br />
Sabine Klimpt<br />
Standort bestimmt Standpunkt<br />
Internationale Lösungen seien bisher<br />
an unterschiedlichen Schwerpunkten<br />
gescheitert, so Himmelbauer, die darauf<br />
anspricht, dass Konzerne wie beispielsweise<br />
„Facebook“ in Irland eine<br />
europäische Niederlassung haben und<br />
dadurch einer europäischen Digitalsteuer<br />
nichts abgewinnen können. Insbesondere<br />
Länder wie Irland würden ja<br />
schließlich durch die Steuereinnahmen<br />
von „Facebook“ profitieren. „Standort<br />
bestimmt Standpunkt“, gibt Himmelbauer<br />
zu bedenken. Bernhofer erklärt,<br />
dass die EU-Steuerpolitik die Zustimmung<br />
aller Mitgliedsländer benötige<br />
– ohne diese Einstimmigkeit könne es<br />
keine gesamteuropäische Lösung geben.<br />
„Sollte es zu keiner einheitlichen Steuer<br />
kommen, dann zumindest zu einer EUweiten<br />
Rahmenrichtlinie, die eine gewisse<br />
Vereinheitlichung der nationalen<br />
Regelungen bringt“, meint Bernhofer.<br />
So könnte auch bei unterschiedlichen<br />
Standpunkten ein „totaler Flickenteppich“<br />
vermieden werden. „Österreich<br />
beteiligt sich aktiv am Dialog und steht<br />
einer europäischen Lösung positiv gegenüber“,<br />
so Himmelbauer. Zumindest<br />
bezüglich der Grenzwerte werde sich<br />
Österreich an die EU-Bestimmungen<br />
anpassen.<br />
von David Pokes<br />
© Copyright: adobe stock / Andrey Popov<br />
52<br />
Thema Digitalsteuer: Endlich faire Steuern für alle?
„Zugriff verweigert“ – technischer<br />
und rechtlicher<br />
Schutz von Smart Home<br />
Smart Home-Geräte erleichtern den Alltag, aber bergen auch Gefahren.<br />
<strong>SUMO</strong> diskutierte mit Armin Anders, Mitgründer und Vice President Business<br />
Development von EnOcean, und Daniel Stanonik, Rechtsanwalt von<br />
„Stanonik Rechtsanwälte“, über Sicherheit, Datenschutz und behördlichen<br />
Zugriff.<br />
Eine Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit<br />
aus dem Jahre 2018<br />
ergab, dass 45% aller ÖsterreicherInnen<br />
smarte Geräte nutzen. Aber sind diese<br />
auch gut geschützt? Um zu verstehen,<br />
wie Smart Home-Geräte vor externen<br />
Zugriffen gesichert sind, muss man<br />
zunächst die Technik dahinter näher<br />
betrachten. Der Mitgründer von EnOcean<br />
klärt auf. EnOcean ist ein Technologielieferant<br />
von energieautarker<br />
Funksensorik. „Wir liefern eine Technologie,<br />
um Funksensoren, Taster und<br />
Schalter drahtlos ohne Batterien zu<br />
realisieren. Wir sehen uns als Technologie<br />
und Komponentenprovider“, so<br />
Anders. Um Smart Home 1 zu verstehen,<br />
ist auch die Abgrenzung zu Internet of<br />
Things 2 relevant. Internet of Things und<br />
Smart Home bauen aufeinander auf.<br />
Bei Smart Home-Geräten würden verschiedene<br />
Sensoren mit einer Heimzentrale<br />
verbunden werden. Die Heimzentrale<br />
steuere technische Einheiten,<br />
sogenannte Aktoren wie Heizung, Klimaanlage,<br />
Lüftung oder Licht. Die Steuerung<br />
könne lokal stattfinden, also im<br />
Haus, aber auch über die Sensoren und<br />
Aktoren, die über Gateways mit dem<br />
Internet verbunden sind. Eine lokale<br />
Steuerung von Smart Home-Geräten,<br />
welche abrufbar über das Smartphone<br />
ist und sich visualisieren lasse, nennt<br />
sich Smart Home. Internet of Things<br />
hingegen beschreibt Armin Anders so,<br />
als dass jeder Sensor, jeder Aktor einen<br />
Einzelknotenpunkt im Internet darstelle.<br />
Eine lokale Steuerung, bei dem die<br />
Daten über einen Browser visualisiert<br />
werden, biete nicht so viel Angriffsfläche<br />
über das Internet, behauptet der<br />
EnOcean-Vizepräsident.<br />
Smart Home vor Gericht<br />
Wie Berichte zeigen, soll „Alexa“ in einem<br />
Mordfall in den USA im Gerichtsprozess<br />
„als Zeuge aussagen“, also die<br />
gespeicherten Daten sollen vor Gericht<br />
verwendet werden dürfen. Daniel Stanonik<br />
hat Erfahrung mit Fällen betreffend<br />
Smart Home. Er sieht Potential,<br />
dass Smart Home-Geräte bei der Ermittlung<br />
und im Gerichtsprozess hilfreich<br />
sein könnten. „Es ist im Endeffekt<br />
ein Computer“. Hilfreich seien die Geräte<br />
insofern, dass die Systeme Informationen<br />
protokollieren, die bislang nicht<br />
bekannt sind, z.B. Log-Daten. Beispielsweise<br />
könne das Gerät helfen, wenn es<br />
um Gewährleistungsfragen geht, also<br />
wann das Gerät aus welchem Grund<br />
nicht mehr funktioniert hätte. Diese<br />
Technologie habe den Vorteil, dass man<br />
unter Umständen erkenne, ab wann<br />
das Gerät defekt war und anhand der<br />
Fehlermeldung (Bedienungs-, System-,<br />
oder Gerätefehler), was die Ursache gewesen<br />
sei. Anhand der oben genannten<br />
Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit<br />
hatten 10% der Smart Home-<br />
NutzerInnen bereits einen Schadensfall,<br />
davon sind 3% Verbindungsfehler.<br />
Sicher ist sicher<br />
Aber wie sicher sind unsere Geräte<br />
vor externen Zugriffen? Der EnOcean-<br />
Gründer erklärt, dass die Sicherheit der<br />
Geräte in zwei Strecken unterteilt werden<br />
könne. Einmal die Kommunikation<br />
zwischen Sensoren und der Zentrale,<br />
die heutzutage häufig über Funk funktioniere.<br />
Der Vorteil von funkbasierten<br />
Lösungen sei, dass kein Verkabelungsaufwand<br />
der Sensoren notwendig sei.<br />
Die zweite Strecke bilde die von der<br />
Smart Home Box ins Internet. Die Sicherheit<br />
eines Gerätes sei abhängig von<br />
der Nutzung. Grundsätzlich würden immer<br />
so viele Sicherheitsmechanismen<br />
eingebaut wie nötig, je mehr Sicherheit,<br />
desto höher werde auch der Arbeitsaufwand<br />
und folglich auch die Kosten.<br />
„Bei der Übertragung einer Zimmertemperatur<br />
braucht man nicht so viel<br />
Sicherheit in die Systeme einbauen. Da<br />
gibt es einen Unterschied, ob man Geld<br />
oder Leben schützen möchte“, so Armin<br />
Anders. Zutrittskontrollen beispiels-<br />
© Copyright: adobe stock / metamorworks<br />
„Zugriff verweigert“ - Smart Thema Home<br />
53
weise benötigen folglich einen höheren<br />
Sicherheitsmechanismus 3 als eine<br />
Temperaturkontrolle. Man differenziert<br />
unterschiedliche Sicherheitslevels, die<br />
in die Geräte implementiert werden.<br />
„Die Sicherheit ist immer an den Energiebedarf<br />
gebunden und je höher die<br />
Sicherheit, umso mehr Energie braucht<br />
man für die Funkübertragungsstrecke.<br />
Deshalb gibt es bei uns unterschiedliche<br />
Sicherheitslevels“, erläutert Anders.<br />
„Die Daten werden in der Zentrale gesammelt.<br />
Um hier die Sicherheit zu gewährleisten,<br />
müssen die Mechanismen<br />
richtig und ordnungsgemäß implementiert<br />
werden“, erklärt der EnOcean-<br />
Gründer.<br />
Zusammenarbeit zwischen NutzerInnen<br />
und HerstellerInnen<br />
Stanonik sieht Smart Home auch als<br />
Gefahr, vor der man sich absichern<br />
müsse. „Über ein ungesichertes Netz<br />
können Dritte auf das Gerät zugreifen.“<br />
Die Informationen, die von dem/r Benutzer/in<br />
und Geräteherstellern übermittelt<br />
werden, müssten vor Dritten<br />
geschützt werden, denn sonst könnte<br />
das Passwort oder die Verbindung gehackt<br />
werden. „Es kann soweit kommen,<br />
dass ein/e Dritte/r ihr Gerät bedient<br />
und somit über ihr Kühlsystem,<br />
ihre Kamera, etc. Informationen entsprechend<br />
ausforschen bzw. stehlen<br />
kann.“ Der Rechtsanwalt fügt hinzu,<br />
dass die Steuerung von Kühlschrank,<br />
Jalousien oder Heizung von außen einen<br />
Bequemlichkeitsvorteil darstelle,<br />
aber gleichzeitig dadurch das Sicherheitsrisiko<br />
beträchtlich erhöht werde.<br />
„Man muss das System entsprechend<br />
konfigurieren und da sehe ich die Problematik,<br />
dass das viele Smarte Home-NutzerInnen<br />
nicht können und die<br />
Standardeinstellungen nicht die sichersten<br />
bzw. allgemein bekannt sind.“<br />
Die Problematik sieht Stanonik insbesondere<br />
beim Passwort. Es sei oft<br />
zu schwach und es werde keine Zwei-<br />
Faktor-Authentifizierung (Kombination<br />
zweier unabhängiger Komponenten,<br />
wie im Bankwesen Passwort und TAN)<br />
verwendet, weshalb der Zugriff in das<br />
Private Dritten erleichtert werde.<br />
Auch Anders sieht Sicherheit als ein<br />
sehr ernstes, aber auch emotionales<br />
Thema. „Es können Implementierungsfehler<br />
entstehen, aber wenn man die<br />
Sicherheitssysteme entsprechend implementiert,<br />
dann sind die Systeme<br />
geschützt“, so der Vizepräsident von<br />
EnOcean. Als Beispiel nennt er hier Online<br />
Banking. Das Vertrauen, unser Geld<br />
über Online Banking zu verwalten, bestehe,<br />
da die Sicherheitssysteme gut<br />
implementiert wurden. Er empfiehlt<br />
professionelle Systeme von professionellen<br />
Anbietern und keine billige Ware<br />
zu kaufen, da mit Sicherheit auch immer<br />
Aufwand betrieben werden müsse,<br />
der sich in Form von Kosten auch im<br />
Preis zeige.<br />
Sicherheit ist wohl der wesentlichste<br />
Parameter in der Nutzung solcher<br />
Geräte, welcher NutzerInnen beim<br />
Komfort programmierter Jalousien<br />
und Staubsaugern, Pflanzengieß- und<br />
Haustierfütterungsgeräten etc. wichtig<br />
sein sollte.<br />
von Raphaela Hotarek<br />
Daniel Stanonik / Copyright: Nenad Ivic<br />
Armin Anders / Copyright: EnOCean<br />
• 1 Smart Home: Der Begriff „beschreibt die Nutzung von intelligenter Informationstechnik im eigenen<br />
Wohnumfeld. Solche intelligente Informationstechnik kann in aller Regel Daten verarbeiten, ist mit dem<br />
Internet und/oder anderen Geräten vernetzt und fernsteuerbar.“ (Geminn, Christian L. (2016): Das Smart<br />
Home als Herausforderung für das Datenschutzrecht, in: Datenschutz und Datensicherheit - DuD, 40, S.<br />
575)<br />
• 2 Internet of Things (dt. Internet der Dinge): Es „bezieht sich generell auf technische Möglichkeiten vielfältige<br />
physische Objekte (‚‚Dinge‘) an das Internet anzubinden und digitale Dienste für diese Dinge und/<br />
oder deren Anwender bereitzustellen.“ (Strohmeier, Stefan/Majstorovic, Dragana/Piazza, Franca/Theres,<br />
Christian (2016): Smart HRM – das „Internet der Dinge” im Personalmanagement, in: HMD Praxis der<br />
Wirtschaftsinformatik, 53, S. 839)<br />
• 3 Die drei Sicherheitsmechanismen: 1) Authentifizierung über IDs: Der Sender muss sich in ein vom Unternehmen<br />
vorprogrammiertes System identifizieren. 2) AES 128 bit: AES steht für Advanced Encryption<br />
Standard. Über Verschlüsselungsmethoden wird für den Empfänger unkenntlich gemacht, welche Information<br />
mit dem Funksignal verbunden ist. 3) Rolling Code: Der Code verändert sich nach jeder Funksendung.<br />
© Copyright: adobe stock / sh240<br />
54<br />
Thema „Zugriff verweigert“ - Smart Home
Meine Raiffeisen Fondspension<br />
Jetzt mit<br />
Nachhaltigkeitsfonds<br />
Der Schutz einer Lebensversicherung<br />
und die Dynamik eines Fonds.<br />
Genießen Sie Ihre Pension ein Leben lang und nutzen Sie die Ertragschancen<br />
eines Investmentfonds. Mehr auf raiffeisen-versicherung.at<br />
Raiffeisen Versicherung ist eine Marke von UNIQA Österreich Versicherungen AG.<br />
Thema<br />
Versicherer: UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, A-1029 Wien, Telefon: +43 1 211 19-0, Telefax: +43 1 211 19-1419, Service Center: 0800 22 55 88,<br />
service@raiffeisen-versicherung.at, raiffeisen-versicherung.at, Sitz: Wien, FN 63197m, Handelsgericht Wien, UID-Nr.: ATU 15362907<br />
55
Upload-Filter: Eine Herausforderung<br />
für Türkis-Grün<br />
Am 26. März 2019 wurde im EU-Parlament die Reform des Urheberrechts<br />
beschlossen, vor allem mit den Stimmen konservativer Seite.<br />
GegnerInnen sahen darin eine Zensur des Internet, BefürworterInnen<br />
argumentierten mit der besseren rechtlichen Absicherung, u.a. von<br />
Musik- oder (Bewegt-)Bildschaffenden, so etwa Kenny Lang im <strong>SUMO</strong>-<br />
Interview. Besonders die geplanten „Uploadfilter“ sorgten europaweit für<br />
breite Proteste in der Internetcommunity. Die Mitgliedsländer haben nun<br />
bis 2021 Zeit, diese EU-Richtlinie in nationales Recht um-zusetzen. Also<br />
auch in Österreich, wo Befürworter (ÖVP) und Gegner (Grüne) gemeinsam<br />
ein Gesetz zu beschließen haben, von dem niemand weiß, wie es umgesetzt<br />
werden soll.<br />
Das Internet ist zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses<br />
nicht ausgestorben.<br />
Ein Jahr nachdem die EU-Staaten die<br />
umstrittene Urheberrechtsreform beschlossen<br />
haben, werden im Netz nach<br />
wie vor Memes gebastelt und Katzenvideos<br />
geteilt. Eine Mehrheit von 348 zu<br />
274 EU-Abgeordneten stimmte für die<br />
EU-Urheberrechtsreform als Gesamtpaket.<br />
Auch wenn die Mehrheit relativ<br />
klar aussieht, war es am Ende dennoch<br />
knapp: Nur fünf Stimmen haben gefehlt,<br />
um über die einzelnen Artikel 15 und<br />
Artikel 17 mittels Änderungsanträgen<br />
einzeln abzustimmen. Dadurch hätten<br />
die umstrittenen Uploadfilter und die<br />
Reform des Leistungsschutzrechtes<br />
noch verhindert werden können. Die Abgeordneten<br />
der ÖVP haben der Reform<br />
geschlossen zugestimmt, SPÖ, Grüne<br />
und NEOS stimmten dagegen, die FPÖ-<br />
Abgeordneten enthielten sich.<br />
Worum geht es konkret<br />
Die Reform selbst soll das veraltete<br />
und nicht auf Online-Aktivitäten ausgelegte<br />
Urheberrecht an das digitale<br />
Zeitalter anpassen und unter anderem<br />
dafür sorgen, dass UrheberInnen für ihre<br />
Inhalte im Netz eine gerechte und angemessene<br />
Vergütung erhalten. Dass<br />
eine Reform notwendig war, darüber<br />
herrschte Einigkeit und auch darüber,<br />
dass KünstlerInnen und andere Content-<br />
Schaffende fair vergütet werden sollen.<br />
„Wir haben derzeit die Situation, dass<br />
große internationale Plattformen sehr<br />
gute Profite mit den Inhalten anderer<br />
machen. Das ist natürlich eine Situation,<br />
die man als Medien- und Kunstschaffender<br />
so nicht hinnehmen kann“, sagt<br />
Kenny Lang, Journalist und Kunstschaffender,<br />
im Interview mit <strong>SUMO</strong>. Konkret<br />
bedeutet das aber, dass Internetplattformen,<br />
bei denen nutzergenerierte Inhalte<br />
hochgeladen werden können, zu<br />
Vorabkontrollen aller Inhalte verpflichtet<br />
werden. Im Artikel 17 ist festgelegt, dass<br />
Online-Plattformen künftig auch dafür<br />
haften, wenn unerlaubt urheberrechtlich<br />
geschütztes Material hochgeladen<br />
wird. Bisher hafteten NutzerInnen der<br />
Plattform selbst – das soll sich nun ändern.<br />
Damit Plattformen, wie beispielsweise<br />
„YouTube“, sicherstellen können,<br />
dass kein urheberrechtlich geschütztes<br />
Material hochgeladen wird, sind technisch<br />
gesehen Uploadfilter erforderlich,<br />
wenngleich diese nicht explizit durch<br />
die Reform gefordert werden. Mit Hilfe<br />
dieser soll der Content bereits während<br />
des Hochladeprozesses geprüft<br />
und aussortiert werden. Die Uploadfilter<br />
können allerdings nicht zwischen<br />
Recht und Unrecht unterscheiden. So<br />
können rechtsverletzende Inhalte und<br />
Inhalte zur legalen Werknutzung nicht<br />
klar unterschieden werden. Zur legalen<br />
Werknutzung zählt etwa das Hochladen<br />
von Inhalten, die von Content-schaffenden<br />
für bestimmte Zwecke frei zur<br />
Verfügung gestellt wurden. Dabei könnten<br />
auch versehentlich Inhalte blockiert<br />
werden, die vom Zitatrecht Gebrauch<br />
56<br />
Thema Upload-Filter: Eine Herausforderung für Türkis-Grün
© Copyright: adobe stock / Chris<br />
machen oder gar Satire sind. Auch Bilder<br />
und Videos, die etwa von Memes oder<br />
Parodien verwendet werden, könnten<br />
automatisch als Urheberrechtsverstoß<br />
ausgefiltert werden, obwohl diese in der<br />
Reform explizit ausgenommen worden<br />
sind. Der zweite umstrittene Teil der Urheberrechtsreform<br />
ist der Artikel 15, bei<br />
diesem geht es um ein Leistungsschutzrecht<br />
für Presseverleger. Demnach müssen<br />
Unternehmen wie beispielsweise<br />
„Google“ Verlage dafür bezahlen, wenn<br />
kleine Textpassagen – sogenannte<br />
Snippets – aus Artikeln in den Suchmaschinenergebnissen<br />
angezeigt werden.<br />
Kenny Lang / Copyright: Christian Lietzmann<br />
Die zwei Seiten<br />
KritikerInnen sprechen bei dieser Reform<br />
gar von Zensur und der Gefahr,<br />
dass mehr gefiltert würde, als unbedingt<br />
notwendig. Bernhard Hayden,<br />
Urheberrechtsexperte der digitalen<br />
Grund-rechtsorganisation „epicenter.<br />
works“, sprach in einem Interview mit<br />
„futurezone.at“ (26.3.2019) gar von<br />
einem „schwarzen Tag für das Internet“.<br />
Konkret sagte er, dass „das Europäische<br />
Parlament sich nicht nur der eindringlichen<br />
Warnungen der führenden<br />
europäischen Urheberrechtsexperten<br />
sowie des UN Sonderberichterstatters<br />
für den Schutz der Meinungsfreiheit<br />
[widersetzt], sondern schlägt mit der<br />
Zustimmung zu dieser Reform einer<br />
ganzen Generation vor den Kopf.“ Untermauert<br />
wurde dies mit einer Unterschriftensammlung<br />
mit mehr als fünf<br />
Millionen Unterschriften, um den Artikel<br />
17 zu stoppen. Franz Medwenitsch, Geschäftsführer<br />
des Verbands der österreichischen<br />
Musikwirtschaft (IFPI), sprach<br />
in einer Aussendung am 26.3. hingegen<br />
von „einem guten Tag für die europäischen<br />
Kreativen.“ In dieser Aussendung<br />
betonte er: „Die Copyright-Richtlinie ist<br />
ausgewogen und fair, neben den Kreativen<br />
stärkt sie auch die Rechte der User.“<br />
Trotzdem muss man sich auch der Frage<br />
widmen, wer darüber entscheidet, ob es<br />
sich um eine Urheberrechtsverletzung<br />
handelt oder nicht. Kenny Lang sagt<br />
in einem Interview gegenüber <strong>SUMO</strong>,<br />
„dass man der Frage nachgehen muss,<br />
wer diese Datenbanken mit den digitalen<br />
Fingerabdrücken kontrolliert. Damit<br />
Uploadfilter effizient arbeiten und feststellen<br />
können, ob es sich um eine Urheberrechtsverletzung<br />
handelt oder<br />
nicht, muss es Datenbanken geben, die<br />
einer Kontrolle unterliegen. Und wer das<br />
kontrolliert, kontrolliert de facto, was<br />
ins Internet hochgeladen werden darf.<br />
Dementsprechend muss man da ganz<br />
genau hinschauen, damit hier keine unfairen<br />
Geschäfte betrieben und die Parameter<br />
genauestens festgelegt werden.“<br />
Betroffen von dieser Reform sind tatsächlich<br />
aber nur die großen Konzerne<br />
und Medienhäuser. Was das für die<br />
Medienhäuser bedeutet, „lässt sich zu<br />
diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, bei<br />
Diskussionen in der Vergangenheit haben<br />
diese aber nicht immer von solchen<br />
Gesetzen profitiert. Wenn man nur daran<br />
denkt, wie viel Verlage davon haben,<br />
bei den großen Suchmaschinen ver-linkt<br />
zu sein. Da man die Artikel dort findet,<br />
ist es natürlich ein beträchtlicher Teil des<br />
Traffic auf der Verlagsseite. Wenn man<br />
diese Verlinkungsmöglichkeiten nun<br />
einschränkt, könnte dadurch der Traffic<br />
leiden“, so Lang.<br />
Wie geht es weiter?<br />
2020 hat die Covid-19-Krise alles überschattet.<br />
Dennoch bleibt die Notwenigkeit,<br />
dass die EU-Mitgliedsstaaten<br />
nur noch bis Juni 2021 Zeit haben, die<br />
Richtlinien in nationales Recht umzusetzen.<br />
Ob sich das tatsächlich ausgehen<br />
wird, bleibt unklar. „Ich glaube, dass die<br />
einzelnen Staaten teilweise selbst noch<br />
nicht wissen, ob sich das ausgeht, eines<br />
ist aber auch klar – die ersten Versuche<br />
werden Fehler haben und dementsprechend<br />
muss dann nachgeschärft werden.<br />
Wichtig ist, dass die großen US-<br />
Unternehmen nicht mehr so stark davon<br />
profitieren, Urheberrechte zu verletzen.<br />
Auch wenn es immer heißt, dass vor allem<br />
die großen Verlage von solch einer<br />
Reform profitieren würden, dann kann<br />
ich nur sagen: große Verlage sind voller<br />
kleiner AutorInnen“, betont Kenny Lang.<br />
Noch ist die umstrittene Reform nicht<br />
in Kraft und kann dem freien Netz bislang<br />
auch (noch) nicht schaden oder<br />
den Medienschaffenden helfen. Aber es<br />
dürfte höchst spannend werden, wie die<br />
Regierungskoalition trotz völlig unterschiedlicher<br />
Meinung der Parteien die<br />
Gesetzwerdung löst.<br />
von Martin Möser<br />
Upload-Filter: Eine Herausforderung für Türkis-Grün Thema<br />
57
Die Finanzierung des öffentlichrechtlichen<br />
Rundfunks<br />
Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wurden diverse Programmaufträge<br />
eingeschrieben, die eine besondere Finanzierung ermöglichen. Die europäischen<br />
Staaten entwickelten hierfür unterschiedlichste Formen. <strong>SUMO</strong><br />
hat im Zuge dieses Artikels mit Leonhard Dobusch, Professor an der Universität<br />
Innsbruck und Mitglied des ZDF-Fernsehrats, gesprochen.<br />
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben<br />
jeweils einen Publikumsauftrag zu<br />
erfüllen. Der ORF muss sich beispielsweise<br />
an den im ORF-Gesetz definierten<br />
Auftrag halten: „Der Österreichische<br />
Rundfunk hat durch die [...] verbreiteten<br />
Programme und Angebote zu sorgen für:<br />
die umfassende Information der Allgemeinheit<br />
über alle wichtigen politische,<br />
sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen<br />
und sportlichen Fragen“. Dafür erfolgt<br />
die ORF-Finanzierung zu einem Großteil<br />
durch Gebühren.<br />
Zusammensetzung der Gebühren in<br />
Österreich<br />
Der Programmauftrag des ORF kann<br />
nur erfüllt werden, wenn ausreichend<br />
finanzielle Mittel vorhanden sind. Die<br />
„GIS Gebühren Info Service GmbH“ gehört<br />
laut der Website der GIS seit 2001<br />
zu 100% dem ORF und ist dafür zuständig,<br />
die Gebühren einzuheben. Laut der<br />
von der GIS im April 2018 veröffentlichten<br />
Zahlen sind in Österreich 3,6<br />
Millionen Haushalte gemeldet, 300.000<br />
Haushalte sind von den Gebühren befreit.<br />
Jährlich werden rund 992 Mio.<br />
Euro an Gebühren eingenommen. Der<br />
ORF kann jedoch nicht frei über diese<br />
Gesamtsumme verfügen. Laut ORF<br />
Ertragsstruktur 2018 waren das 637<br />
Mio. Euro, rund zwei Drittel der GIS-Gesamtbeträge.<br />
Das übrige Drittel setzt<br />
sich laut Aufschlüsselung der GIS aus<br />
Abgaben zusammen. Der Bund hebt<br />
56,2 Millionen Euro an Rundfunkgebühren<br />
ein. Zusätzlich werden die GIS-<br />
Gebühren besteuert, dies bringt dem<br />
Bund weitere 63,7 Millionen Euro ein.<br />
Eine weitere Abgabe ist der Kunstförderungsbeitrag.<br />
Dieser Beitrag macht<br />
jährlich 18,6 Millionen Euro aus. Die<br />
Bundesländer können individuell entschieden,<br />
ob sie zusätzlich eine Landesabgabe<br />
einfordern. Dies erklärt, dass<br />
die GIS-Gebühren unterschiedlich hoch<br />
sind. Vorarlberg und Oberösterreich<br />
sind die einzigen zwei Bundesländer,<br />
die keine Landesabgabe einfordern. Aus<br />
diesem Grund sind die Gebühren mit<br />
20,9 Euro pro Monat am niedrigsten.<br />
Die höchste monatliche Abgabe hebt<br />
das Land Steiermark ein. Dort müssen<br />
die gebührenpflichtigen Haushalte 26,7<br />
Euro pro Monat bezahlen. Sowohl in<br />
Mitglieds- als auch in Nicht-Mitgliedsstaaten<br />
der EU, die den öffentlichrechtlichen<br />
Rundfunk ebenfalls durch<br />
Gebühren finanzieren, sind die Abgaben<br />
an den Bund meist geringer. So werden<br />
laut des im September 2016 von der<br />
European Broadcast Union (EBU) veröffentlichten<br />
„Annual Report“ in Europa<br />
durchschnittlich 90% der eingehobenen<br />
Gebühren direkt den jeweiligen öffentlich-rechtlichen<br />
Anstalten zugeführt.<br />
Rundfunkfinanzierung in Deutschland<br />
Im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag ist<br />
die Haushaltsabgabe verankert. Dort<br />
werden die genauen Bedingungen zu<br />
den Rundfunkgebühren in Deutschland<br />
festgelegt. Laut dem „ARD-ZDF-<br />
Deutschlandradio-Beitragsservice“<br />
wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk<br />
seit sieben Jahren durch eine Haushaltsabgabe<br />
finanziert. Zuvor mussten<br />
lediglich Haushalte, in denen Fernseh-,<br />
Radio- oder andere Geräte, die zum<br />
Empfang der öffentlich-rechtlichen<br />
Programme fähig waren, bezahlen.<br />
Von 1976 bis 2012 wurden diese Gebühren<br />
von der Gebühreneinzugszentrale<br />
(GEZ) eingehoben. Mit Einführung<br />
der Haushaltsabgabe wurde diese ab<br />
2013 in „ARD-ZDF-Deutschlandradio-<br />
Beitragsservice“ umbenannt. Die Um-<br />
58<br />
Thema Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
© Copyright: adobe stock / beeboys.<br />
stellung auf die Haushaltsabgabe stieß<br />
jedoch auch auf Widerstand. Es wurden<br />
Klagen eingereicht, über die das Bundesverfassungsgericht<br />
in Karlsruhe am<br />
18. Juli 2018 entscheiden musste. Aus<br />
dem Urteil ging hervor, dass die Haushaltsabgabe<br />
generell als gesetzeskonform<br />
gilt. Da in Deutschland theoretisch<br />
jeder Haushalt die öffentlich-rechtlichen<br />
Programme empfangen könne,<br />
sei es gerechtfertigt, dass alle Haushalte,<br />
unabhängig von ihrer Nutzung,<br />
einen Beitrag bezahlen müssen. Eine<br />
Regelung wurde jedoch als verfassungswidrig<br />
erklärt: Personen, die eine<br />
Zweitwohnung besitzen, mussten doppelt<br />
bezahlen. Dies ist laut Bundesverfassungsgericht<br />
nicht erlaubt und wurde<br />
somit abgeschafft. Derzeit beträgt<br />
die Abgabe 17,5 Euro pro Wohnungsinhaber/in.<br />
Rundfunkfinanzierung in der Schweiz<br />
In der Schweiz wurde am 4. März 2018<br />
per Volksentscheid über die Abschaffung<br />
der Rundfunkgebühren entschieden.<br />
Laut des vom SRF am 04.03.2018<br />
veröffentlichten Endergebnisses sprachen<br />
sich rund 72% der TeilnehmerInnen<br />
gegen die Abschaffung und somit<br />
für einen Weiterbestand der Rundfunkgebühren<br />
aus. Die Wahlbeteiligung<br />
lag bei circa 54%. Die damalige<br />
Medienministerin Doris Leuthard erklärte<br />
nach der Verkündung der Ergebnisse<br />
in einem Interview mit dem SRF,<br />
dass sie eine Verbundenheit zwischen<br />
der Schweizer Bevölkerung und dem<br />
öffentlich-rechtlichen Rundfunk erkennen<br />
könne. Die Gebühren wurden<br />
mit Anfang des Jahres 2019 laut Informationen<br />
der Serafe AG gesenkt: Nun<br />
müssen pro Haushalt jährlich rund 345<br />
Euro bezahlt werden. Somit wurde die<br />
Abgabe um circa 81 Euro pro Haushalt<br />
gesenkt. Bezahlen müssen grundsätzlich<br />
alle Haushalte, jedoch gibt es auch<br />
Ausnahmen. Dies wird ebenfalls auf der<br />
Website der Serafe AG näher erläutert.<br />
Haushalte, die nachweisen können,<br />
dass sie keine Geräte zum Empfang<br />
des Rundfunks besitzen, können einen<br />
Antrag auf Gebührenbefreiung stellen.<br />
Dies wird als „Opting-out“ bezeichnet.<br />
Der Antrag kann maximal für fünf Jahre<br />
genehmigt werden, danach müssen die<br />
betroffenen Haushalte die Rundfunkgebühren<br />
wieder entrichten.<br />
Akzeptanz in der Bevölkerung<br />
Leonhard Dobusch, Betriebswirtschaftslehre-Professor<br />
an der Universität<br />
Innsbruck und Mitglied des<br />
ZDF-Fernsehrats, erklärt im <strong>SUMO</strong>-<br />
Interview, dass die Zustimmung in der<br />
Bevölkerung für den öffentlich-rechtlichen<br />
Rundfunk groß sei, dennoch dürfe<br />
man sich nicht darauf ausruhen. Diese<br />
Zustimmung spiegelt sich auch in der<br />
2018 veröffentlichten „Akzeptanz-Studie“<br />
der ARD wider. Anfang 2018 wurden<br />
1.502 Personen ab 14 Jahren in<br />
Deutschland telefonisch befragt. 84%<br />
gaben an, dass ihnen der ARD-Medienverbund<br />
sehr gut oder gut gefällt. 78%<br />
sahen die ARD als sehr wichtig für die<br />
Allgemeinheit an und für 66% ist die<br />
ARD persönlich wichtig. Aus der Studie<br />
geht hervor, dass ein großer Teil der<br />
Befragten mit dem Angebot des ARD<br />
zufrieden ist. Es können jedoch keine<br />
Aussagen darüber getroffen werden,<br />
welche Angebote zu dieser Zufriedenheit<br />
führen, so gibt es beispielsweise<br />
einen Trend, der zeigt, dass junge Menschen<br />
die linearen Angebote nicht mehr<br />
so stark nutzen. Univ.-Prof. Dobusch<br />
erläutert: „Wenn man sich anschaut,<br />
wie der Altersschnitt bei den ZuschauerInnen<br />
der linearen Programme ist,<br />
dann sieht man, dass die Reichweite,<br />
wenn man das als eine Rückmeldung<br />
über Akzeptanz ansieht, bei den Jüngeren<br />
im linearen Bereich stark zurückgeht.“<br />
Das ZDF hat ein neues Konzept<br />
erarbeitet, das den Online-Auftritt des<br />
Senders verbessern soll. Auf lange<br />
Sicht könne ein solches Konzept die Akzeptanz<br />
der Bevölkerung in Bezug auf<br />
die Rundfunkgebühren noch steigern.<br />
Dobusch unterstreicht im Interview die<br />
Wichtigkeit des öffentlich-rechtlichen<br />
Rundfunks: „Wir alle profitieren davon,<br />
dass ein öffentliches Medienangebot<br />
für eine vielfältigere und demokratischere<br />
Öffentlichkeit sorgt.“<br />
Positionen der Politik<br />
Die österreichischen Parteien unterscheiden<br />
sich in ihren Meinungen zu<br />
den Rundfunkgebühren teilweise stark.<br />
Im Regierungsprogramm der ÖVP und<br />
der Grünen wird der ORF als wichtiger<br />
Teil der österreichischen Medienlandschaft<br />
bezeichnet. Die beiden Parteien<br />
wollen sich für einen unabhängigen öffentlich-rechtlichen<br />
Rundfunk einsetzen.<br />
Mit welcher Art der Finanzierung<br />
dies verbunden sei, wird aber nicht näher<br />
erläutert. Eva Blimlinger, Nationalratsabgeordnete<br />
der „Grünen“, erachtet<br />
eine Haushaltsabgabe anstelle der GIS-<br />
Gebühren als sinnvoller. Dies erläuterte<br />
sie in einem am 10.01.2020 veröffentlichten<br />
Interview mit dem „Standard“.<br />
Wie sich der Koalitionspartner ÖVP die<br />
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen<br />
Rundfunks vorstellt, geht aus ihrem<br />
2015 veröffentlichten Grundsatzprogramm<br />
nicht klar hervor – sich zur „Idee<br />
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks“<br />
bekennend. Eine klare Position zu diesem<br />
Thema nimmt die FPÖ ein. Diese<br />
wurde in einer am 24.02.2020 statt-<br />
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks Thema<br />
59
findenden Pressekonferenz der FPÖ<br />
näher erklärt. Laut Norbert Hofer sei<br />
das Ende der GIS-Finanzierung mit dem<br />
ehemaligen Koalitionspartner ÖVP vereinbart<br />
gewesen. Durch die Ibiza-Affäre<br />
und der darauffolgenden Auflösung der<br />
Regierung sei keine Zeit geblieben, dieses<br />
umzusetzen. Im Parteiprogramm<br />
äußert sich die FPÖ nicht über den<br />
ORF oder seine Finanzierung, dennoch<br />
hat sie im Februar 2020 bei der oben<br />
genannten Pressekonferenz eine Petition<br />
für die Abschaffung der GIS-Gebühren<br />
vorgestellt. Dort wurde auch<br />
erklärt, dass der öffentlich-rechtliche<br />
Rundfunk in dieser Form nicht mehr<br />
zeitgemäß sei, und ein Abo-Modell die<br />
bessere Lösung für den ORF darstelle.<br />
Leonhard Dobusch erläutert, weshalb<br />
die rechten Parteien gegen die jetzige<br />
Finanzierung der öffentlich-rechtlichen<br />
Medien seien: Sowohl die AFD als auch<br />
die FPÖ nehme die Berichterstattung in<br />
den öffentlich-rechtlichen Medien als<br />
ungerecht war. Sie hätten das Gefühl,<br />
gar nicht oder negativ dargestellt zu<br />
werden. Insbesondere rechtspopulistische<br />
und -radikale Parteien befänden<br />
sich außerhalb eines gesellschaftlichen<br />
medialen Konsenses, sodass sie von<br />
der Schwächung der öffentlich-rechtlichen<br />
Anstalten etwas zu gewinnen<br />
hätten. Ohne die öffentlich-rechtlichen<br />
Angebote wären die Menschen auf andere<br />
Informationsquellen angewiesen.<br />
Dies würde solchen Parteien einen größeren<br />
Einfluss bringen.<br />
Ausblick<br />
Es sei wichtig, so Univ.-Prof. Dobusch,<br />
dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten<br />
in Zukunft die Möglichkeit hätten,<br />
vermehrt auf den digitalen Plattformen<br />
zu agieren. Der neue Telemedienauftrag<br />
in Deutschland erlaube es bereits,<br />
neue „Online-Only-Angebote“ anzubieten.<br />
Um diese Angebote auch weiter<br />
vorantreiben zu können brauche<br />
es jedoch eine Investitionsmilliarde. In<br />
Österreich habe der ORF rechtlich noch<br />
keine Möglichkeit, neue digitale Angebote<br />
zu entwickeln. In Zukunft könne<br />
es in Deutschland unter gewissen Voraussetzungen<br />
zu Problemen mit der<br />
Finanzierung des öffentlich-rechtlichen<br />
Rundfunks kommen. Im Falle, dass die<br />
AFD in einem Bundesland in die Regierung<br />
käme, reiche dieses eine Land, um<br />
jede Beitragserhöhung zu blockieren.<br />
Dies zeige die Schwäche einen solchen<br />
Systems auf, da radikale RundfunkgegnerInnen<br />
dieses schwächen könnten.<br />
von Viktoria Strobl<br />
Leonhard Dobusch / Copyright: Ingo Pertramer<br />
© Copyright: adobe stock / bbatuhan_toker<br />
60<br />
Thema Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Der milliardenschwere<br />
Kampf um Sportübertragungsrechte<br />
Fußball, Skifahren, Tennis, US-Sport. Abseits vom Besuch im Stadion oder<br />
an der Rennstrecke bieten TV und Streaming-Dienste ein immer breiteres<br />
Angebot, rund um die Uhr mitzufiebern. Dahinter aber verbirgt sich ein<br />
knallharter Kampf um Aufmerksamkeit. Im Interview mit <strong>SUMO</strong> diskutieren<br />
ORF-Sportjournalistin Alina Zellhofer sowie „DAZN“- und „Servus<br />
TV“-Producer Martin Pfanner über das Milliardengeschäft der Sportrechte-Vermarktung.<br />
Die Einzigartigkeit von Live-Sport begeistert<br />
Menschen so sehr, wie kaum<br />
eine andere Freizeitbeschäftigung. Auf<br />
den ersten Blick schaffen zahlreiche<br />
Player wie „DAZN“, „SKY“ oder bald auch<br />
„Amazon Prime“ einen umfangreichen<br />
Zugang zu Sportereignissen auf der<br />
ganzen Welt, abseits von linearen Fernsehangeboten.<br />
Auf den zweiten Blick<br />
entstehen durch diese neugewonnene<br />
Vielfalt im Wettbewerb aber auch Grenzen,<br />
da sich immer mehr Sportevents<br />
mittels Sublizenzierung aufteilen und<br />
hinter einer Vielzahl von Bezahlschranken<br />
verschwinden. Für Sportfans wird<br />
der Markt immer unübersichtlicher<br />
und auch Medienunternehmen verlieren<br />
durch kurze Rechteperioden immer<br />
mehr an Planungssicherheit.<br />
Besonders der öffentlich-rechtliche<br />
Rundfunk hat nach seiner jahrzehntelangen<br />
Monopolstellung mit der jetzigen<br />
Selbstgestaltung der Sportrechte-<br />
Vermarktung zu kämpfen. In Österreich<br />
muss der ORF dabei zusehen, wie<br />
Live-Sportereignisse im Programm zunehmend<br />
schwinden und zu anderen<br />
Anbietern wechseln. Eine Verschiebung<br />
des Angebots, die aber nicht bei den<br />
Grenzen der bekannten Sendergruppen<br />
aufhört, wie ORF-Sportjournalistin Alina<br />
Zellhofer feststellt: „Die steigende<br />
Anzahl der Anbieter ist vor allem deshalb<br />
so interessant, weil nicht mehr nur<br />
reine Medienunternehmen mitmischen.<br />
Auch Telekommunikationsunternehmen<br />
wie A1 oder Magenta haben plötzlich<br />
Pläne.“ Immer öfter habe der ORF<br />
das Nachsehen, weil er gesetzlich nur<br />
bis zu einem bestimmten Grad mitbieten<br />
dürfe. Trotz vieler Bestrebungen aktiv<br />
der Konkurrenz entgegenzutreten,<br />
würden Versuche zur Verbesserung der<br />
Inhalte schnell auf rechtliche Rahmenbedingungen<br />
stoßen.<br />
Doch auch auf Seiten der Streamingund<br />
Pay-TV-Unternehmen selbst steigt<br />
der Druck, KundInnen ein attraktives<br />
Programm anbieten zu können, wie<br />
„DAZN“- und „Servus TV“-Producer<br />
Martin Pfanner erklärt: „Live-Sport ist<br />
das letzte relevante Ereignis, das zum<br />
selben spezifischen Zeitpunkt Menschen<br />
vor den Fernseher fesselt. Dieses<br />
Gut ist heiß begehrt, denn man braucht<br />
Live-Sport, um auch auf andere Programminhalte<br />
aufmerksam zu machen.“<br />
Weil immer mehr Anbieter einsteigen<br />
und „am Kuchen mitnaschen wollen“,<br />
würde es für einzelne Unternehmen<br />
unmöglich werden, Exklusivrechte zu<br />
bezahlen. Der unerschwingliche Preis<br />
unterteilt ganze Sportligen und Turniere<br />
in immer kleinere Rechtepakete,<br />
sogenannte Sublizenzen, die nur zu<br />
einer bestimmten Anzahl an Übertragungen<br />
berechtigen. So passiert es im<br />
Fußball beispielsweise, dass sich „SKY“<br />
und „DAZN“ seit der Saison 2018/19<br />
die UEFA-Champions League teilen<br />
müssen. RezipientInnen müssen beide<br />
Anbieter kostenpflichtig abonnieren,<br />
wenn sie eine bestimmte Mannschaft<br />
über den gesamten Bewerb hin verfolgen<br />
wollen, denn eine frei empfangbare<br />
Alternative gibt es nicht. Das entstandene<br />
Wettbieten bestimme aktuell aber<br />
nicht nur Fußball und all seine europäischen<br />
Profi-Ligen, sondern würde sich<br />
auf immer mehr Sportarten ausdehnen.<br />
So bekommen beispielsweise auch die<br />
sportlichen Erfolge von Tennis-Ass Dominic<br />
Thiem in den meisten Fällen nur<br />
© Copyright: adobe stock / sportpoint<br />
Faszination Live-Sport Thema<br />
61
diejenigen in voller Länge zu sehen, die<br />
bereit sind dafür zu bezahlen.<br />
Teamplayer statt Einzelkämpfer<br />
Durch die wachsende Anzahl an Paywalls<br />
stelle sich immer öfter auch die<br />
Frage nach gesellschaftlichen Auswirkungen,<br />
die durch einen eingeschränkten<br />
Zugang entstehen würden. Menschen,<br />
die nicht die Möglichkeit haben<br />
sich kostenpflichtige Inhalte zu leisten<br />
würden durch exklusive Inhalte ausgegrenzt<br />
werden. „Es ist wichtig, sicherzustellen,<br />
dass manche Dinge nicht<br />
komplett aus dem freien Fernsehen<br />
verschwinden“, fordert Zellhofer und<br />
ergänzt: „SportlerInnen haben auch<br />
eine gewisse Vorbildwirkung, weshalb<br />
es wichtig ist, den Bezug nicht zu verlieren.“<br />
Mit dem Fernseh-Exklusivrechtegesetz<br />
aus dem Jahr 2001 gibt es hierzulande<br />
eine gesetzliche Liste von Veranstaltungen,<br />
die durch die „erhebliche<br />
gesellschaftliche Bedeutung“ öffentlichen<br />
Medienanstalten vorbehalten<br />
sind. Diese beinhaltet allerdings fast<br />
ausschließlich internationale Großbewerbe<br />
wie die Olympischen Winterund<br />
Sommerspiele, Alpine Skiweltmeisterschaften,<br />
sowie Europa- und<br />
Weltmeisterschaften im Fußball mit<br />
österreichischer Beteiligung. Etwaige<br />
Versuche, die Verordnung auch auf<br />
Vereinsebene auszuweiten blieben<br />
bislang unvollendet. Denn abzuwägen,<br />
welche Sportereignisse tatsächlich von<br />
nationaler Relevanz sind, würde sich<br />
schwierig gestalten und könne kaum an<br />
gesetzliche Bestimmungen geknüpft<br />
werden. Sportlicher Erfolg sei viel zu<br />
unberechenbar und ließe deshalb keine<br />
Planbarkeit zu, wie Zellhofer anmerkt:<br />
„Man kann nie davon ausgehen, dass<br />
wenn man Rechte für eine Periode innehat,<br />
dass dann auch wirklich ein österreichischer<br />
Vertreter mit dabei ist. Es<br />
kann passieren, dass man teuer die Europa<br />
League einkauft und dann ein Verein<br />
wie Salzburg sensationell den Einzug<br />
in die Champions League schafft,<br />
was ihnen davor zehn Jahre lang nicht<br />
gelungen ist.“<br />
Auch ein öffentlich-rechtlicher Programmauftrag<br />
dürfe deshalb kein Anrecht<br />
auf Übertragungen von bestimmten<br />
Sportveranstaltungen bedeuten.<br />
Der freie Wettbewerb sei wichtig,<br />
bräuchte aber auch neue Wege, wie<br />
beide InterviewpartnerInnen betonen.<br />
Laut Zellhofer wären dies gemeinsame<br />
Modelle zwischen allen Wettbewerbern,<br />
um ZuseherInnen Alternativen<br />
zu bieten. Für Martin Pfanner stellt ein<br />
erfolgreiches Beispiel für ein solches<br />
Konzept US-Sports und insbesondere<br />
die amerikanische Football Liga NFL<br />
dar. Die 32 Teams vermarkten sich auf<br />
mehreren Wegen selbst, um so den<br />
Sport möglichst vielen Menschen zugänglich<br />
zu machen. Eingefleischte<br />
Fans bekommen gegen eine jährliche<br />
Gebühr Zugang zu allen Spielen auf<br />
einem eigenen Network, während sporadische<br />
AnhängerInnen ausgewählte<br />
Spiele frei zugänglich im nationalen<br />
Fernsehen empfangen können. Auch<br />
in Österreich bietet „PULS 4“ eine Free-<br />
TV-Möglichkeit für EinsteigerInnen,<br />
während KennerInnen des Sports auf<br />
„DAZN“ dieselben Spiele mit mehr Expertise<br />
und Taktik oder dem englischen<br />
Originalkommentar verfolgen können.<br />
„Es entstehen dadurch ganz unterschiedliche<br />
Herangehensweisen zu einem<br />
Format. Sind die Einen attraktiver<br />
für die Werbewirtschaft, weil sie länger<br />
Werbung spielen, gehen andere mehr<br />
in die Tiefe ihrer Berichterstattung. Beides<br />
hat seine Daseinsberechtigung“, so<br />
Pfanner.<br />
Schon jetzt gebe es erkennbare Unterschiede<br />
bei der Formatgestaltung<br />
zwischen freien und kostenpflichtigen<br />
Sendeangeboten. So würden sich frei<br />
empfangbare Sportformate vorrangig<br />
nach der breiten Masse richten. Die<br />
Berichterstattung versuche deswegen<br />
das Wichtigste oberflächlich abzudecken,<br />
damit GelegenheitszuseherInnen<br />
genauso folgen können wie KennerInnen<br />
des Sports. Pay-TV-Sender könnten<br />
bei ihrer Zielgruppe hingegen davon<br />
ausgehen, dass sie sich mit dem Sport<br />
identifizieren und ihr Vorwissen über<br />
Grundkenntnisse hinausgeht. Inhalte<br />
sollen ZuseherInnen deswegen mehr<br />
fordern und möglichst nahe am Sport<br />
dran sein.<br />
Generell drehe sich heutzutage aber<br />
alles um das Live-Ereignis. Aufwendig<br />
gestaltete Hintergrundreportagen<br />
würden nicht mehr in dem Ausmaß angenommen<br />
werden wie früher. Für Zellhofer<br />
ist dies eine weitere Änderung im<br />
Nutzungsverhalten, die durch den viel<br />
umkämpften Markt entstanden ist: „Es<br />
geht heutzutage um Schnelligkeit, denn<br />
über das Internet oder auch durch das<br />
Radio brauchst du nicht direkt Sportrechte,<br />
um darüber berichten zu kön-<br />
62<br />
Faszination Thema Live-Sport
© Copyright: adobe stock / andreysh<br />
nen. Im Fernsehen hingegen brauchst<br />
du das Live-Ereignis, um interessant zu<br />
sein.“<br />
Verlängerung oder Neustart?<br />
Die Aufwärtsspirale im Kampf um<br />
Übertragungsrechte werde sich deswegen<br />
auch in Zukunft weiter nach<br />
oben schrauben. Schon jetzt werden die<br />
Perioden für ausgeschriebene Rechtepakete<br />
immer kürzer, das Bieterfeld<br />
und somit auch der Preis hingegen stetig<br />
größer. Auch bislang unangetastete<br />
internationale Großveranstaltungen<br />
werden von mehreren Lizenznehmern<br />
umworben. Die Telekom sicherte sich<br />
als erstes Pay-TV-Unternehmen im<br />
deutschsprachigen Raum die Rechte an<br />
einem internationalen Wettbewerb, der<br />
Fußball-Europameisterschaft 2024.<br />
Dem ORF stehe dadurch auch in Zukunft<br />
ein harter Kampf um Live-Sport<br />
bevor. Würde dieser auf der einen Seite<br />
vor allem Ungewissheit und Planungsunsicherheit<br />
bedeuten, entstünden dadurch<br />
auf der anderen Seite aber auch<br />
Chancen, um sich neuen Programminhalten<br />
zu widmen. So bekamen durch<br />
die freigewordenen Programmflächen<br />
zuletzt auch Nischensportarten wie<br />
Handball oder Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit.<br />
Neben der Suche nach<br />
Alternativen konzentriere man sich<br />
beim ORF aber vor allem auch darauf,<br />
jetzige Programminhalte zu behaupten<br />
und Abhandengekommenes wieder<br />
zurückzuerobern. Möglichkeiten dafür<br />
sieht Zellhofer einerseits in der Flexibilität,<br />
auf den ständigen Wandel im<br />
Markt reagieren zu können. Auf der der<br />
anderen Seite stehe der ORF mit seinen<br />
Sendeflächen aber auch für Verlässlichkeit,<br />
ein breites Spektrum abdecken zu<br />
können: „Viele Anbieter sind oft nur daran<br />
interessiert, einzelne Höhepunkte<br />
eines Sports zu übertragen. Klassische<br />
Beispiele sind im Skifahren die Rennen<br />
in Kitzbühel und Schladming, die jeder<br />
haben will. Da ist die Chance für den<br />
ORF zu sagen, dass er das ganze Paket<br />
nimmt und nicht nur die Zuckerl.“ Dass<br />
es trotzdem gerade für lineare Marktteilnehmer<br />
nicht einfacher werden<br />
wird, bestätigen sowohl Alina Zellhofer<br />
wie auch Martin Pfanner. Für beide<br />
gehe das Duell Free-TV gegen Pay-TV,<br />
lineares Fernsehen gegen Streaming<br />
auch in Zukunft weiter: „Ich glaube,<br />
dass lineares Fernsehen nicht völlig<br />
aus dem Sportbereich verschwinden<br />
wird, aber doch ein Ablaufdatum hat“,<br />
wagt Pfanner eine Prognose. Für Alina<br />
Zellhofer wiederum, kann es trotz des<br />
aktuellen Vorteils auf Seiten von Streaming<br />
keinen endgültigen Sieger geben:<br />
„Das Geschäft mischt sich immer wieder<br />
neu durch. Es wird nie so sein, dass<br />
einer alles haben wird und alle anderen<br />
leer ausgehen. Mit dem Wettbieten<br />
kann es aber trotzdem nicht ewig so<br />
weitergehen. Irgendwann ist die Grenze<br />
erreicht.“<br />
Einen ersten „Gamechanger“ im Kampf<br />
um Übertragungsrechte könnte dabei<br />
die Corona-Krise ausgelöst haben.<br />
Nachdem durch die weltweite Pandemie<br />
die Sportwelt und auch das Wirtschaftsleben<br />
im Frühjahr für längere<br />
Zeit stillstand, zeigte sich bei vielen<br />
Sportverbänden und Medienhäusern<br />
ein Umdenken. Gemeinsam wurden<br />
Lizenzen spontan untereinander zur<br />
Verfügung gestellt, um allen Menschen<br />
einen Zugang zu den verbliebenen<br />
Sportaktivitäten zu ermöglichen. Auch<br />
die immensen Summen, die für Sport-<br />
Übertragungsrechte bislang ausgegeben<br />
wurden, werden nun von beiden<br />
Seiten hinterfragt. Abseits des ständigen<br />
Wettbietens soll der Sport so auch<br />
nach der Krise wieder in das Scheinwerferlicht<br />
rücken.<br />
von Michael Geltner<br />
Alina Zellhofer / Copyright: Roman Zach-Kiesling/ORF<br />
Martin Pfanner / Copyright: Privat<br />
Faszination Live-Sport Thema<br />
63
Sollen Programmkinos<br />
gefördert werden?<br />
Im Gegensatz zu kommerziell ausgerichteten Kinos werden Programmkinos<br />
in einigen Fällen finanziell gefördert, um eine Programmvielfalt zu<br />
fördern. Aus Wettbewerbsperspektive gefragt: Wozu, wenn die Nachfrage<br />
in punkto Film abseits der Blockbuster anscheinend nicht groß genug<br />
ist? Aus Rezipientenperspektive: Welche Rolle spielt die Politik dabei?<br />
<strong>SUMO</strong> sprach mit Johannes Wegenstein, Geschäftsführer der Wiener<br />
Kinos „Schikander“ und „Top Kino“, über Förderungen, Überleben und<br />
politische Unterstützung in der (Programm-)Kinobranche.<br />
Laut der Wirtschaftskammer Österreich<br />
(WKO), die jährlich unter anderem<br />
die österreichischen Kinobesucherzahlen<br />
veröffentlicht, stiegen die Zahlen<br />
der Kinobesuche im Jahr 2019, im<br />
Vergleich zum Vorjahr, um 5,8%, mit<br />
insgesamt ca. 14 Mio. Besuchen. Doch<br />
bei näherer Betrachtung wird klar, dass<br />
es vor allem Hollywood-Blockbuster<br />
sind, die sich an den Besucherzahlen<br />
erfreuen. In den Top 10 der meistbesuchten<br />
Kinofilme 2019 befindet sich<br />
laut WKO keine einzige österreichische<br />
und nur eine deutsche Produktion. Der<br />
erfolgreichste österreichische Film mit<br />
139.177 BesucherInnen war „Love Machine“<br />
mit Thomas Stipsits, die Nummer<br />
1 aus den USA „The Lion King“ hatte<br />
ca. sechsmal so viele BesucherInnen.<br />
Es zeigt sich also eine klare Dominanz<br />
der Hollywood-Blockbuster, die in den<br />
großen Kinoketten gezeigt werden.<br />
Doch wie steht es um die unabhängigen<br />
Programmkinos des Landes?<br />
Leinwand für Neues<br />
2017 ergab eine Studie im Auftrag der<br />
WKO über die ökonomische Bedeutung<br />
der Kinobranche in Österreich, dass es<br />
sich bei etwa 46% aller Kinos in Österreich<br />
um 1- oder 2-Saal-Kinos handelt,<br />
welche den Programmkinos, auch Arthouse-Kinos<br />
genannt, zuzuordnen sind.<br />
Gezeigt werden internationale Filme<br />
und besonders österreichische Filme,<br />
die Themen behandeln, welche abseits<br />
des Mainstreams liegen, bzw. Filme,<br />
die nicht zur reinen Unterhaltung der<br />
breiten Masse dienen, sondern an spezielle<br />
Interessen gerichtet sind und zum<br />
Nachdenken anregen sollen, z.B. gesellschaftskritische.<br />
Doch das Kino ist nicht<br />
nur Spielstätte für Filme, ebenso wichtig<br />
sind Veranstaltungen, Kulturevents<br />
oder ein dazugehöriges Lokal, das als<br />
Treffpunkt dient, auch ohne einen Film<br />
sehen zu wollen. Kulturelle Vielfalt und<br />
Unterstützung junger, unbekannter<br />
FilmemacherInnen sind hier die Devisen.<br />
Ihnen bieten Programmkinos eine<br />
Leinwand, die sie sonst nicht so einfach<br />
bekommen würden. Johannes Wegenstein,<br />
Geschäftsführer des „Schikaneder“<br />
und Top Kino“ in Wien, betont gegenüber<br />
<strong>SUMO</strong>, dass die beiden Kinos für<br />
junge KünstlerInnen stets offen seien.<br />
Deren Filme würden zwar im Vorhinein<br />
abgesegnet werden müssen, denn „gemäß<br />
unseren Grundsätzen haben fundamentalistische,<br />
rassistische, extremistische<br />
Positionen keinen Platz“, eine<br />
Geschmackspolizei gebe es dabei aber<br />
nicht. „Wir zeigen unter anderem sehr<br />
viele Filme junger Filmemacher*innen,<br />
die zwar Low- oder Nobudget, aber mit<br />
viel Leidenschaft in Eigenregie produziert<br />
sind (also eigenständig und aus<br />
eigener Hand), und das sind mitunter<br />
sehr gute Filme.“<br />
Wegenstein war schon 1996, als er das<br />
„Schikaneder“ übernahm, klar, dass<br />
Kino innert einem Gesamtkonzept auf<br />
Basis zumindest zweier Standbeine zu<br />
stellen sei. Das „Schikaneder“ und das<br />
„Top Kino“, die sich selbst als „Vielzwecklocations“<br />
bezeichnen, seien nicht nur<br />
Kinos, sondern auch Bar oder Restaurant<br />
und bieten Alternativprogramme<br />
im Bereich bildende Kunst oder Literatur.<br />
Zum Beispiel mit der Aktion „Wand<br />
sucht Kunst“ ist das „Schikaneder“ laufend<br />
auf der Suche nach KünstlerInnen,<br />
die die Räumlichkeiten und Wände der<br />
Location nutzen wollen, um ihre Werke<br />
64<br />
Sollen ThemaProgrammkinos gefördert werden?
© Copyright: adobe stock / Mr. Music<br />
einem Publikum zu präsentieren. Ebenso<br />
werden regelmäßig Buchpräsentationen<br />
oder Lesungen veranstaltet,<br />
wie etwa „Fellner LIVE – eine szenische<br />
Lesung“, bei der transkribierte Interviews<br />
des „oe24“-Herausgebers mit<br />
österreichischen PolitikerInnen durchleuchtet<br />
und Fellners Medienarbeit sowie<br />
die des Boulevards unter die Lupe<br />
genommen werden. Die verschiedenen<br />
Angebote und das Kino befruchten sich<br />
im Idealfall gegenseitig, so Wegenstein.<br />
Bewusstsein steigt<br />
Kinos dieser Art kämpfen seit Jahren<br />
ums Überleben, zuletzt hatte eines der<br />
ältesten Kinos der Stadt Wien diesen<br />
Kampf verloren. Das „Bellaria Kino“<br />
musste nach 107-jährigem Bestehen<br />
aus finanziellen Gründen seine Tore<br />
schließen. Die sinkenden Einnahmen<br />
waren jedoch auch darauf zurückzuführen,<br />
dass das „Bellaria Kino“ und<br />
seine Programmgestaltung stets auf<br />
ein älteres Publikum ausgerichtet war.<br />
Junges Publikum konnte nicht für die<br />
Filme begeistert werden, und somit<br />
nahmen die Besucherzahlen langsam<br />
ab. Gegenüber dem „KURIER“<br />
(5.12.2019) erklärte der damalige Inhaber<br />
der Kinos, Erich Hemmelmayer,<br />
dass er ohnehin nie etwas mit dem Kino<br />
verdient habe, sondern es als Hobby<br />
betrieb. Doch nun ginge es sich wirtschaftlich<br />
einfach nicht mehr aus, da<br />
die jungen Leute nicht nachkommen.<br />
Staatliche sowie kommunale Förderungen<br />
sollen Schicksalen wie solchen<br />
entgegenwirken. Seit 1999 werden<br />
Programmkinos von der Stadt Wien mit<br />
dem Ziel unterstützt, eine niveau- und<br />
gehaltvolle Programmgestaltung zu erreichen<br />
und filmische Vielfalt zu fördern<br />
und somit sicherzustellen, dass ein<br />
breites Spektrum an Themen und Genres<br />
vertreten sind. Auch von staatlicher<br />
Seite wird Unterstützung angeboten.<br />
Auf der Website des Bundesministeriums<br />
für Kunst, Kultur, öffentlicher<br />
Dienst und Sport sind verschiedenste<br />
Kriterien angegeben, die erfüllt werden<br />
müssen, um als Programmkino Förderungen<br />
erhalten zu können. Eine davon<br />
setzt voraus, dass 40% der vorgeführten<br />
Filme des letzten Jahresprogramms<br />
europäische Produktionen waren. Johannes<br />
Wegenstein sei „überhaupt<br />
nicht unzufrieden“ mit den staatlichen<br />
Förderungen für die Branche. Natürlich<br />
könnte es immer mehr sein, aber<br />
er sei sehr froh über die Unterstützung<br />
der Stadt Wien, die den Förderbeitrag<br />
gerade erhöht habe. Auch der Bund sei<br />
diesbezüglich nicht so schlecht aufgestellt.<br />
Das Bewusstsein der Politik über<br />
die kulturelle Wichtigkeit für Orte wie<br />
das „Schikaneder“ und „Top Kino“ sei<br />
sicher vorhanden, in den letzten paar<br />
Jahren habe sich in diesem Bereich viel<br />
getan, so Wegenstein. Er fühle sich von<br />
der österreichischen Politik verstanden,<br />
ernstgenommen und unterstützt, doch<br />
man werde sehen, was nach der Corona-Krise<br />
an Unterstützung komme.<br />
Kino, Corona, Politik<br />
Eben diese Krise führte zu Spannungen<br />
zwischen der Kunst- und Kulturszene<br />
und der österreichischen<br />
Regierung. Am 17.April machte die damalige<br />
Staatssekretärin Ulrike Lunacek<br />
mit Aussagen, wonach österreichische<br />
Kinos an sie herangetreten seien und<br />
den Wunsch äußerten erst nach dem<br />
Sommer wieder zu öffnen, auf sich<br />
aufmerksam und war rasch mit einer<br />
negativen Reaktion konfrontiert. Die<br />
Empörung der KinobetreiberInnen war<br />
groß. Der Präsident des österreichischen<br />
Kinoverbandes, Christian Dörfler,<br />
bezeichnete Lunaceks Aussage als<br />
falsch. (APA-OTS, 17.4.2020) Auch das<br />
„Schikaneder“ und „Top Kino“ zeigten<br />
ihre Verwunderung durch einen „Facebook“-Post:<br />
„Die Situation vieler Kinos<br />
war schon ohne Corona nicht einfach<br />
und es ist auf viel Idealismus aufgebaut,<br />
dass diese Kinos erhalten wurden<br />
und nun ein prägender Kulturbestandteil<br />
der Stadt Wien sind.“ Weiters wird<br />
in dem Posting erläutert, dass die von<br />
der Politik als schnell und unbürokratisch<br />
dargestellten Hilfsleistungen<br />
sich großteils als enorme und täglich<br />
wachsende hyperbürokratische Hürden<br />
darstellen. „Wieder mal bewahrheitet<br />
sich, dass übersteigerte Formen von<br />
Bürokratie die tyrannischste aller Herrschaftsformen<br />
werden kann und Not zu<br />
Tode verwaltet wird, weil sich niemand<br />
verantwortlich fühlt. Auch das ist Politik.“<br />
Am 29. Mai sperrten die Kinos dennoch<br />
wieder auf.<br />
von Ida Stabauer<br />
Johannes Wegenstein / Copyright: Privat<br />
Sollen Programmkinos gefördert werden? Thema<br />
65
Die (Ohn-)Macht des<br />
Presserates<br />
Die einen bezeichnen ihn als zahnlosen Tiger und die anderen vergleichen<br />
ihn mit dem „Politbüro der Kommunistischen Partei in China“. <strong>SUMO</strong> hat<br />
dem Presserat auf den Zahn gefühlt und dazu mit Alexander Warzilek,<br />
Geschäftsführer des Presserates, und Alexandra Halouska, Stv. Chefin<br />
vom Dienst bei der „Kronen Zeitung“ und neues Senatsmitglied des Presserates,<br />
gesprochen.<br />
„Journalismus bedingt Freiheit und Verantwortung.“<br />
So tiefgründig und doch<br />
bestimmend lauten die ersten Worte<br />
des Ehrenkodex‘ für die österreichische<br />
Presse. Doch hinter dem Satz birgt sich<br />
der Grund, warum der Presserat in einer<br />
Demokratie, in der die öffentlichen<br />
Medien die vierte Gewalt des Staates<br />
darstellen, so essentiell ist. Die Selbstkontrolle<br />
durch den Presserat garantiert,<br />
dass Eingriffe durch den Staat<br />
verringert werden und Medien frei und<br />
unabhängig berichten können. Mit dieser<br />
gewonnenen Freiheit geht auch die<br />
Verantwortung einher, medienethische<br />
Maßstäbe bei der Berichterstattung zu<br />
gewährleisten. Damit diese Maßstäbe<br />
tatsächlich eingehalten werden, wurde<br />
der Presserat als freiwilliges Selbstkontrollorgan<br />
der österreichischen Presse<br />
von den wichtigsten Journalisten- und<br />
Verlegerverbänden gegründet. Der<br />
Presserat verfügt über drei unabhängige<br />
und weisungsfreie Senate. Die<br />
jeweils elf Mitglieder der Senate sind<br />
rechtskundige Personen oder JournalistInnen,<br />
die über Beschwerden und Mitteilungen<br />
der LeserInnen entscheiden.<br />
Verstöße und Konsequenzen – „in the<br />
eye of the tiger“<br />
Laut der letzten Fallstatistik 2019<br />
wurden dem Presserat im vergangenen<br />
Jahr 297 Beiträge österreichischer<br />
Printmedien gemeldet. Davon haben,<br />
nach Prüfung der Senate, 37 Fälle<br />
auch tatsächlich gegen den Ehrenkodex<br />
der Branche verstoßen. Warzilek<br />
nennt den Persönlichkeitsschutz, das<br />
Gebot gewissenhaft zu recherchieren<br />
und Informationen richtig darzustellen,<br />
die Diskriminierung gesellschaftlicher<br />
Gruppen und die Unterscheidung zwischen<br />
redaktionellem Inhalt und Werbung<br />
als die wichtigsten Punkte, die<br />
sich in den Verstößen am häufigsten<br />
wiederfinden würden.<br />
Gegen den Persönlichkeitsschutz verstoßen<br />
haben „kleinezeitung.at“, „vol.<br />
at“, „heute.at“, „krone.at“ und „oe24.at“,<br />
als sie ein Video veröffentlichten, das<br />
einen Sportler – unverpixelt und nicht<br />
unkenntlich gemacht – bei der Nordi-<br />
schen Ski-WM in Seefeld beim Eigenblut-Doping<br />
im Hotelzimmer zeigten.<br />
Bei einem „Heute“-Reporter, der sich<br />
als Polizeibeamter ausgab und so über<br />
„WhatsApp“ an detaillierte Informationen<br />
und Bilder eines Tatverdächtigen<br />
in einem Mordfall gelangte, wurde<br />
ein schwerwiegender Verstoß wegen<br />
unlauterer Materialbeschaffung festgestellt.<br />
Die Veröffentlichung der Entscheidung<br />
im eigenen Medium werde nur gefordert,<br />
wenn jemand persönlich von<br />
einer Berichterstattung betroffen sei,<br />
ansonsten beschreibt Warzilek das sogenannte<br />
„Naming & Blaming“ als die<br />
schärfste Konsequenz für Medien, die<br />
gegen den Ehrenkodex verstoßen haben.<br />
„Wir stellen quasi ein Medium an<br />
den Pranger. Durch unsere Presseaussendungen<br />
über die Entscheidungen<br />
und die APA-Meldungen erfährt die<br />
Branche darüber. Es wird darüber diskutiert<br />
und berichtet.“ Dabei solle man<br />
die Wirkung nicht unterschätzen. „Ich<br />
kann es allein daran messen, dass immer<br />
wieder Chefredakteure anrufen<br />
und sehr erbost sind, wenn eine Entscheidung<br />
gegen sie getroffen wird.“<br />
Eine Herausgeberin habe den Presserat<br />
sogar mit dem Politbüro der Kommunistischen<br />
Partei in China verglichen. „In<br />
der Branche wird das sehr genau wahrgenommen,<br />
was wir sagen und wie wir<br />
entscheiden. Auch bei den Medien, die<br />
bisher noch nicht bei uns mitmachen.“<br />
Dabei spricht Warzilek von der Gratis-<br />
Tageszeitung „Heute“, der „Kronen Zeitung“<br />
und dem Webportal „oe24.at“, die<br />
die Schiedsgerichtbarkeit des Presserates<br />
bisher noch nicht anerkannt haben.<br />
Medienethik im Boulevardjournalismus<br />
Nicht überraschend ist, dass sich genau<br />
diese Boulevardmedien die ersten<br />
Plätze in der Fallstatistik teilen. Die beiden<br />
Spitzenreiter im vergangenen Jahr<br />
waren die Printausgaben und Online-<br />
Plattformen von „oe24“ mit 14 und der<br />
„Kronen Zeitung“ mit neun Verstößen.<br />
Liegt es in der Natur des Boulevardjournalismus,<br />
sich von der Medien-<br />
© Copyright: adobe stock / Mr. Music<br />
66<br />
Thema Die (Ohn-)Macht des Presserats
ethik weitestmöglich zu distanzieren?<br />
Immerhin ist die Printausgabe von<br />
„oe24“ seit 2017 sogar Mitglied des<br />
Presserates. Trotz dieser halben Sache<br />
– die Onlineausgabe „oe24.at“ ist noch<br />
nicht dabei – scheint sich die Mitgliedschaft,<br />
der Fallzahl nach, nicht auf die<br />
redaktionelle Ethik auszuwirken. „Ich<br />
gehe schon davon aus, dass es seitens<br />
der Redaktion von ‚oe24‘ ein Bemühen<br />
gibt, unsere Grundsätze möglichst zu<br />
beachten. Nur dass Zeitungen aus dem<br />
Boulevardbereich da vielleicht eher<br />
einmal eine Grenze überschreiten, ist<br />
nicht ungewöhnlich. Dennoch hat sich<br />
auch die ‚BILD‘-Zeitung dem Deutschen<br />
Presserat verpflichtet“, stellt Warzilek<br />
fest.<br />
Auf die Frage nach einer medienethischen<br />
Prüfung in der „Kronen Zeitung“<br />
erwidert Halouska, dass es kein einheitliches<br />
Protokoll für alle Redaktionen<br />
gäbe. Es läge am Bauchgefühl und<br />
dem journalistischen Knowhow der<br />
„SchleusenwärterIn“, wie Chefredaktion<br />
oder ChefIn vom Dienst, die die Ethik<br />
prüfen und in bestimmten Fällen natürlich<br />
schon eingreifen würden. Dass die<br />
Zeitung kein Mitglied des Presserates<br />
ist, liege – unter anderem – am Erbe<br />
der „Krone“, immer von allen Stellen,<br />
wie auch der APA, unabhängig sein zu<br />
wollen.<br />
Doch, zack, zack, zack, eine kleine spanische<br />
Partyinsel sorgte dafür, das Unmögliche<br />
möglich, beziehungsweise<br />
greifbarer zu machen.<br />
Eine medienethische Revolution in der<br />
„Kronen Zeitung“<br />
„Kronen Zeitung“-Chefredakteur Herrmann<br />
überraschte seine BranchenkollegInnen<br />
im Juli 2019, als er sagte, das<br />
veröffentlichte „Ibiza-Video“, in dem<br />
von einer Übernahme der „Krone“ gesprochen<br />
wurde, habe in der „Kronen<br />
Zeitung“ eine Nachdenkphase ausgelöst.<br />
Man werde verantwortungsvoller<br />
mit ihrer Macht umgehen und „redaktionelle<br />
Unabhängigkeit gegen Außenund<br />
Innenangriffe vehement verteidigen“.<br />
Dabei sei auch die Teilnahme am<br />
Österreichischen Presserat absehbar<br />
(„Horizont“, 26.07.2019). Auf die Frage,<br />
ob es tatsächlich Anbahnungsversuche<br />
seitens der „Kronen Zeitung“ gegeben<br />
hätte, meint Warzilek: „Ja, Gespräche<br />
hat es gegeben. Wir haben jetzt auch<br />
mit Alexandra Halouska ein neues Senatsmitglied<br />
von der ‚Krone‘ im Senat<br />
II. Ich freue mich, dass sie da auch ein<br />
bisschen die Initiative ergriffen hat und<br />
vorhat, unsere Arbeit in die Redaktion<br />
zu tragen.“<br />
Halouska wurde von der Österreichischen<br />
Journalistengewerkschaft als<br />
Senatsmitglied nominiert und hat diese<br />
Die (Ohn-)Macht des Presserats Thema<br />
67
Nominierung auch angenommen. Bisher<br />
hat sie einer Sitzung beigewohnt,<br />
in der über vielseitige Fälle, wie einem<br />
Bericht auf „oe24.at“, einer „Standard“-<br />
Kolumne oder einem Leitartikel der<br />
„Presse“ diskutiert wurde. „Es war unfassbar<br />
spannend, zu sehen, dass ohne<br />
Vorbehalte auf einem sehr hohen Level<br />
gute Argumente gebracht wurden<br />
– pro und contra – und, nach meiner<br />
Beurteilung, auch absolut unabhängig<br />
davon, um welches Medium es gerade<br />
ging.“ Für Halouska sei es auch wichtig,<br />
ihre Arbeit beim Presserat transparent<br />
zu gestalten und die Themen<br />
und Verstöße auch in der Redaktion der<br />
„Kronen Zeitung“ zu besprechen, um<br />
eigene Verstöße in Zukunft vermeiden<br />
zu können. „In der Nachbetrachtung<br />
hätten Verurteilung der ‚Krone‘ durch<br />
den Presserat mit einer anderen Art<br />
der Kommunikation geregelt werden<br />
können.“ Und: „Ich glaube, dass der<br />
Presserat für die ‚Krone‘ immer eine<br />
Unbekannte war und was man besser<br />
kennen lernt, weiß man vielleicht mehr<br />
wertzuschätzen oder anders einzuordnen“,<br />
so Halouska.<br />
Kontraproduktive Presseförderung<br />
Was für die „Kronen Zeitung“ keine<br />
Unbekannte darstellt, ist die indirekte<br />
Presseförderung durch Anzeigenschaltung<br />
aus öffentlicher Hand. Die reguläre<br />
Presseförderung für österreichische<br />
Tages- und Wochenzeitungen (exklusive<br />
Presserat) belief sich im Jahr 2019<br />
laut RTR auf knapp 8,7 Mio. Euro. Neben<br />
dieser gesetzlich geregelten Presseförderung<br />
gibt es noch eine informelle<br />
Förderung durch Werbeschaltungen<br />
von Regierung, Gebietskörperschaften<br />
und staatsnahen Unternehmen in österreichischen<br />
Medien. Im Jahr 2018<br />
wurden auf diese Weise 178 Mio. Euro<br />
vergeben. Die reichweitenstarke „Kronen<br />
Zeitung“, inklusive „krone.at“ und<br />
„Kronehit“, erhielt davon 20,4 Mio. Euro<br />
(rtr.at).<br />
Das Verlangen nach Reichweite seitens<br />
des Staates stellt die gesetzliche Förderung<br />
des Vertriebs, der regionalen<br />
Vielfalt, Qualität und Zukunftssicherung<br />
also bei weitem in den Schatten.<br />
Dabei stellt sich die Frage, ob diese indirekte<br />
Presseförderung die eingangs<br />
erwähnte Freiheit und Selbstbestimmung<br />
der Printmedien in gewisser Weise<br />
wieder beschränkt. Warzilek ist der<br />
Meinung, dass man die direkte Presseförderung<br />
aufstocken sollte und Inserate-Schaltungen<br />
massiv zurückfahren<br />
müsse. „Ich glaube, dass viele Anzeigen<br />
nicht notwendig sind. Wenn die Stadt<br />
Wien sagt, dass ihre Schwimmbäder so<br />
sauber sind und sie mehr oder weniger<br />
eine Art Monopolstellung haben, dann<br />
halte ich es nicht für sinnvoll, dass so<br />
eine Anzeige geschaltet wird. Offizielle<br />
Annoncen in Corona-Zeiten kann ich<br />
nachvollziehen. Aber viele Anzeigen geben<br />
inhaltlich nicht viel her. Außerdem<br />
ist die Vergabe dieser Anzeigen sehr<br />
intransparent, was in einer Demokratie<br />
auch nicht gut ist. Man sollte das<br />
zurückfahren und das dadurch ersparte<br />
Geld in die direkte Presseförderung<br />
geben.“ Darüber hinaus fände er es sehr<br />
sinnvoll, die Presseförderung von Qualitätskriterien,<br />
wie der Mitgliedschaft<br />
am Presserat, abhängig zu machen.<br />
Halouska weist auf das Prinzip der Meinungsvielfalt<br />
als wichtigste Aufgabe<br />
der Presseförderung hin. Bezüglich der<br />
Anzeigen meint sie: „Wenn ein Kunde<br />
bei uns inseriert, egal ob ein Möbelhaus<br />
oder die Stadt Wien, dann hat er das<br />
Ziel, Menschen zu erreichen. Das muss<br />
jedem freigestellt sein.“ Sie weist auch<br />
darauf hin, dass es besonders in Corona-Zeiten<br />
Sinn mache, in großen Medien<br />
zu veröffentlichen, um möglichst<br />
viele Menschen erreichen zu können.<br />
Konvergenz der Medien – der Presserat<br />
der Zukunft<br />
Das Verschwimmen der intermedialen<br />
Grenzen spiegelt sich in den Zuständigkeiten<br />
des Presserates wider. Der<br />
Presserat ist nicht mehr nur für die gedruckte<br />
Presse zuständig, sondern bewertet<br />
auch Beschwerden zu Videos,<br />
„Twitter“-Meldungen und „Facebook“-<br />
Postings der Zeitungsverlage. Gerade<br />
in Sozialen Medien stünden die Redaktionen<br />
unter Druck, möglichst zeitnah<br />
Schlagzeilen und exklusive Inhalte bereitzustellen.<br />
„Ich glaube, gerade wenn<br />
es um Fake News geht, ist eine unabhängige<br />
Einrichtung, die ethische Maßstäbe<br />
anwendet und aufzeigt, wenn etwas<br />
schiefläuft, von großer Bedeutung.<br />
Auch für Medien ist es wichtig, diese<br />
Maßstäbe zu beherzigen, damit sie<br />
langfristig ihre Glaubwürdigkeit bewahren“,<br />
so Warzilek. Auch Halouska misst<br />
dem Presserat in der heutigen Zeit eine<br />
große Bedeutung bei: „Ich glaube, dass<br />
die Digitalisierung den Presserat möglicherweise<br />
stärkt. Das Aufkommen<br />
von Fake News ist immens. Es ist also<br />
wichtig, eine Stelle zu haben, an die<br />
sich die Leute wenden können. Je höher<br />
die Verbreitung von Falschnachrichten,<br />
umso wichtiger ist ein solches Instrument<br />
am Ende des Tages.“<br />
Da Mediengattungen nur mehr schwer<br />
voneinander zu trennen sind, würde<br />
sich Warzilek wünschen, dem Presserat<br />
auch eine Zuständigkeit für Radio<br />
und Fernsehen einzuräumen. „Das ist<br />
in anderen Ländern bereits gang und<br />
gäbe. In der Schweiz zum Beispiel ist<br />
der Presserat auch für Radio und Fern-<br />
68<br />
Thema Die (Ohn-)Macht des Presserates
sehen zuständig, da gibt es eine umfassende<br />
Medienselbstkontrolle.“ Halouska<br />
stimmt dieser Idee zu, sie fände<br />
es sinnvoll, für jeden Kanal ein Instrument<br />
zu haben, das Verstöße aufzeigt<br />
und das für die RezipientInnen da ist.<br />
„Warum sollte man einen Unterschied<br />
machen zwischen Print-Nachrichten,<br />
Nachrichten im Radio und Nachrichten<br />
im Fernsehen?“<br />
Ein krönender Abschluss?<br />
Neben einem medienübergreifenden<br />
Presserat wünscht sich Warzilek eine<br />
Steigerung des Bekanntheitsgrades,<br />
damit LeserInnen sowie UserInnen<br />
wissen, dass es eine Stelle gibt, an die<br />
sie sich wenden können. Darüber hinaus<br />
wäre es für die Printbranche insgesamt<br />
förderlich, wenn auch die „Kronen<br />
Zeitung“, „Heute“ und die digitale Hälfte<br />
von „oe24“ die Schiedsgerichtbarkeit<br />
des Presserates anerkennen würden.<br />
„Eine Mitgliedschaft der ‚Kronen Zeitung‘<br />
ist von Seiten des Presserates<br />
jederzeit möglich. Die Entscheidung<br />
hängt jedoch von der Geschäftsführung<br />
der ‚‚Kronen Zeitung‘ ab.“ Halouska<br />
steuert durch ihre Senatsmitgliedschaft<br />
neue Perspektiven im Bereich<br />
Medienethik in den Redaktionsalltag<br />
der „Kronen Zeitung“ bei. „Ich glaube,<br />
man versucht da schon ein bisschen<br />
alte Strukturen aufzubrechen und<br />
durch dieses Kennenlernen der Arbeit<br />
vom Presserat wird man auch erkennen,<br />
dass man seine Unabhängigkeit ja<br />
nicht unbedingt verliert dabei. Wie jedes<br />
Medium muss sich auch die ‚Krone‘<br />
verändern, ohne sich selbst zu verlieren<br />
und fremd zu werden für die LeserInnen.<br />
[…] Für uns als altgewachsenes<br />
und sehr traditionelles Unternehmen<br />
ist das schon eine große Öffnung, auf<br />
diese Weise über den eigenen Tellerrand<br />
zu blicken. Ich werde meine Arbeit<br />
im Senat auch in den redaktionellen Alltag<br />
der ‚Krone‘ einfließen lassen.“<br />
Der krönende Abschluss lässt also noch<br />
auf sich warten.<br />
von Karin Pargfrieder<br />
Alexander Warzilek / Copyright: Presserat<br />
Alexandra Halouska / Copyright: Reinhard Holl<br />
© Copyright: adobe stock / travelview<br />
Die (Ohn-)Macht des Presserates Thema<br />
69
Wenn private Daten in den<br />
Medien landen<br />
Nicht nur im privaten Bereich gehören soziale Netzwerke zum Alltag,<br />
auch im Berufsleben finden sie immer öfter Anwendung. So nutzt auch<br />
der Journalismus diese Netzwerke zu seinem Vorteil – oft jedoch auf<br />
Kosten anderer. Über dieses Thema sprach <strong>SUMO</strong> mit Peter Grotter, Ressortleiter<br />
für Gericht und Recht bei der „Kronen Zeitung“, und Matthias<br />
Schmidl, Stellvertretender Leiter der Datenschutzbehörde Österreich.<br />
Im November 2016 führte der Trendradar<br />
der APA-OTS gemeinsam mit dem<br />
Marktforschungsinstitut „meinungsraum.at“<br />
eine Umfrage unter österreichischen<br />
JournalistInnen zu ihrer heutigen<br />
Arbeitsweise durch. Dabei wurde<br />
unter anderem erfasst, wie die tägliche<br />
Recherchearbeit aussieht und mit welchen<br />
Quellen JournalistInnen bevorzugt<br />
arbeiten. Es ist nicht verwunderlich,<br />
dass bereits im Jahr 2016 fast 30% der<br />
Befragten häufig in sozialen Netzwerken<br />
recherchierten. Dabei lag „Facebook“<br />
ganz klar an erster Stelle, gefolgt von<br />
„Twitter“ und „YouTube“. Auch berufliche<br />
Plattformen wie Xing oder LinkedIn<br />
wurden teilweise für Recherchezwecke<br />
genutzt. Knapp die Hälfte der befragten<br />
JournalistInnen gab an, die so gewonnenen<br />
Informationen schließlich auch häufig<br />
(10%) oder gelegentlich (38%) in Ihre<br />
journalistischen Beiträge einzubinden.<br />
Es ist zu vermuten, dass diese Zahlen in<br />
den letzten Jahren noch zugenommen<br />
haben. Daraus resultiert die Frage, ob<br />
Recherche in sozialen Netzwerken und<br />
die Veröffentlichung der daraus gewonnenen<br />
personenbezogenen Daten überhaupt<br />
zulässig ist.<br />
Opferschutz<br />
Peter Grotter, Ressortleiter für Gericht<br />
und Recht bei der „Kronen Zeitung“, ist<br />
nun seit 44 Jahren als Journalist tätig.<br />
Seine Erfahrungen bezüglich der Verwendung<br />
von sozialen Medien als Rechercheplattformen?<br />
Besonders im<br />
Gerichtsressort sei das keine gängige<br />
Vorgehensweise von JournalistInnen,<br />
so Grotter. Er berichte über Straftaten<br />
mit TäterInnen und Opfern, dabei seien<br />
ihm soziale Netzwerke keine große<br />
Hilfe. Wenn Grotter Genaueres über<br />
die Betroffenen in Erfahrung bringen<br />
möchte, befrage er sie oder deren Anwalt/Anwältin<br />
höchstpersönlich. Das<br />
ginge dann sogar so weit, dass er sie<br />
in Haftanstalten besuche. In Bezug auf<br />
Opfer-Berichterstattungen habe sich in<br />
seiner langjährigen Laufbahn als Journalist<br />
viel geändert. Früher sei es nichts<br />
„Unehrenhaftes“ gewesen, ein Opfer<br />
zu sein, Berichterstattungen in diesem<br />
Bereich waren also durchaus legitim.<br />
Mittlerweile seien Opfer speziell geschützt,<br />
wodurch sich auch Berichte<br />
über solche Ereignisse schwieriger gestalten.<br />
Grundsätzlich sei es aber erlaubt,<br />
den Namen und das Bild eines<br />
Opfers zu veröffentlichen, solange<br />
nichts über den höchstpersönlichen Lebensbereich<br />
der Person preisgegeben<br />
werde. Auch bei Mordprozessen bringe<br />
die „Kronen Zeitung“ immer wieder<br />
Bilder der Angeklagten. Je massiver der<br />
Vorwurf sei, desto eher dürften auch<br />
Name und Foto der TäterInnen veröffentlicht<br />
werden. Solange im Bericht die<br />
Unschuldsvermutung der TäterInnen<br />
eingehalten werde, sei das laut Grotter<br />
70<br />
Thema Wenn private Daten in den Medien landen
© Copyright: adobe stock / REDPIXEL<br />
kein Problem. Generell halte sich die<br />
„Kronen Zeitung“ sehr genau an das<br />
Medienrecht, wodurch es auch nur wenige<br />
Medienverfahren im Haus gäbe.<br />
Ehrenkodex als Richtlinie<br />
Der Österreichische Presserat sieht seine<br />
Zuständigkeit in der Qualitätssicherung<br />
und Wahrung der Pressefreiheit<br />
in unserem Land. Der Ehrenkodex des<br />
Presserates stellt dabei eine Richtlinie<br />
für die journalistische Arbeit dar und<br />
legt Grenzen und Regeln in diversen<br />
Bereichen fest. Neben gewissenhafter<br />
Recherchearbeit und korrekter Veröffentlichung<br />
beinhaltet der Ehrenkodex<br />
auch Regeln zu Persönlichkeitsschutz<br />
und Intimsphäre. Grundsätzlich gilt es,<br />
die Würde von Personen zu wahren und<br />
deren Intimsphäre zu schützen. Vor allem<br />
Opfer von Unfällen und Verbrechen<br />
muss Anonymität gewährt werden, sofern<br />
diese nicht allgemein bekannt sind<br />
oder selbst in die Veröffentlichung einwilligen.<br />
Auch Kindern und Jugendlichen<br />
fällt ein besonderer Schutz zu, wenn<br />
über sie berichtet werden soll. Der<br />
Presserat appelliert hier an die Medien,<br />
das öffentliche Interesse an diesen<br />
Berichten besonders kritisch zu prüfen.<br />
Dieses ist laut Presserat gewährt,<br />
wenn es um die Aufklärung schwerer<br />
Verbrechen geht, die unmittelbare Sicherheit<br />
der Bevölkerung bedroht ist<br />
oder eine Irreführung der Öffentlichkeit<br />
verhindert werden kann. Nun ist dieser<br />
Ehrenkodex lediglich eine Richtlinie zur<br />
Wahrung der Berufsethik, das bedeutet,<br />
bei einem Verstoß gegen den Kodex<br />
drohen keine rechtlichen Folgen. Der<br />
Presserat kann das betroffene Medium<br />
zwar auffordern, die Entscheidung des<br />
Rates freiwillig zu veröffentlichen, jedoch<br />
auch nicht mehr.<br />
Zwiespalt im Datenschutzgesetz<br />
Im Mai 2018 wurde die neue Datenschutzgrundverordnung<br />
(DSGVO) erlassen,<br />
welche das Datenschutzrecht<br />
in ganz Europa vereinheitlichen sollte.<br />
<strong>SUMO</strong> fragte Matthias Schmidl, den<br />
stellvertretenden Leiter der Datenschutzbehörde<br />
Österreich, inwiefern<br />
die DSGVO Medien und vor allem den<br />
Journalismus betrifft. „Das grundsätzliche<br />
Problem ist, dass Medien weitgehend<br />
von den Bestimmungen des<br />
Datenschutzgesetzes und der DSGVO<br />
ausgenommen sind, weil sonst eine<br />
journalistische Berichterstattung nicht<br />
sinnvoll möglich wäre.“ Der Journalismus<br />
stütze sich auf das Recht der<br />
freien Meinungsäußerung, dieses stehe<br />
allerdings teilweise in Widerspruch<br />
zum Recht auf Datenschutz. Sowohl<br />
die DSGVO als auch ihr Vorgänger, die<br />
Datenschutzrichtlinie, fordern die EU-<br />
Mitgliedstaaten dazu auf, diese beiden<br />
Rechte miteinander in Einklang zu bringen.<br />
Wenn sich in Österreich jemand<br />
durch journalistische Berichterstattung<br />
in seinem Recht auf Datenschutz<br />
verletzt sehe, habe, laut Schmidl, die<br />
Datenschutzbehörde keine Zuständigkeit<br />
dafür. In solchen Fällen müssten<br />
Gerichte diese beiden Grundrechte auf<br />
Basis des Mediengesetzes gegeneinander<br />
abwägen und entscheiden, welchem<br />
Recht der Vorrang einzuräumen<br />
sei. Grundsätzlich käme es bei der Datenschutzbehörde<br />
jedoch eher selten<br />
vor, dass jemand Beschwerde gegen<br />
ein Medium erhebt.<br />
Eingriff in den höchstpersönlichen Lebensbereich<br />
Nun bleibt also als rechtliche Grundlage<br />
für solche Fälle noch das Mediengesetz.<br />
Dieses beinhaltet im dritten Abschnitt<br />
diverse Richtlinien zum Schutz<br />
der Persönlichkeit. Erfährt eine Person<br />
durch ein Medium zum Beispiel zu Unrecht<br />
üble Nachrede, Beschimpfung<br />
oder gar Verspottung, kann die betroffene<br />
Person eine Entschädigung<br />
vom Medieninhaber verlangen. Vor allem<br />
bei der Bekanntgabe der Identität<br />
eines Opfers bzw. eines/r Täters/in ist<br />
Vorsicht geboten. Sollten durch die Veröffentlichung<br />
eines Fotos oder Namens<br />
schutzwürdige Interessen einer Person<br />
verletzt werden, drohen MedieninhaberInnen<br />
hohe Entschädigungszahlungen.<br />
Schutzwürdige Interessen beinhalten<br />
zum Beispiel einen Eingriff in<br />
den höchstpersönlichen Lebensbereich<br />
oder eine herbeigeführte Bloßstellung<br />
des Opfers. Ob so ein Eingriff in den<br />
persönlichen Lebensbereich auch die<br />
Recherche in sozialen Netzwerken und<br />
Verwendung der dort gesammelten<br />
Informationen beinhaltet, ist fraglich.<br />
Sicher ist jedoch, dass Betroffene ein<br />
Recht auf Persönlichkeitsschutz haben<br />
und dieses auch einklagen können.<br />
„Viele Selfies. Im Internet auf mehreren<br />
Profilen“<br />
Beispiele für die Veröffentlichung von<br />
privaten Fotos aus sozialen Netzwerken<br />
lieferte unter anderem die Tageszeitung<br />
„Österreich“. So erschien am 22.<br />
Oktober 2018 ein Artikel, der von einem<br />
Frauenmord in Zell am See berichtet. In<br />
dem Artikel finden sich mehrere unverpixelte<br />
Fotos der ermordeten Frau.<br />
Der Bericht und die Fotos wurden unter<br />
anderem auch auf „oe24.at“ veröffentlicht.<br />
Die Bildbeschreibung „Viele Selfies.<br />
Im Internet auf mehreren Profilen“,<br />
lässt darauf schließen, dass diese Fotos<br />
aus einem oder mehreren persönlichen<br />
Accounts in sozialen Netzwerken stammen.<br />
Zusätzlich zu den Fotos der Frau<br />
Wenn private Daten in den Medien Thema landen<br />
71
wurden auch ihre Vorliebe für Gangsta-Rap,<br />
ihre „Nicknames“ im Internet<br />
und die Anzahl ihrer „Instagram“- Follower<br />
veröffentlicht. Der Presserat griff<br />
den Vorfall auf und stellte fest, dass<br />
die Veröffentlichung der unverpixelten<br />
Fotos in die Persönlichkeitssphäre des<br />
Mordopfers eingriff. Zur Herkunft der<br />
Fotos und der erwähnten persönlichen<br />
Daten wurden keine Anmerkungen gemacht.<br />
Die Tageszeitung wurde vom<br />
Presserat dazu aufgefordert, die Entscheidung<br />
freiwillig zu veröffentlichen,<br />
rechtliche Konsequenzen gab es keine.<br />
Politische Stellungnahme<br />
Die letzten großen Änderungen des<br />
Mediengesetzes liegen nun schon<br />
eine Weile zurück. Die Einführung der<br />
DSGVO hat das Thema Datenschutz<br />
zwar grundsätzlich wieder neu aufgerollt,<br />
doch in Bezug auf Veröffentlichung<br />
privater Daten hat sich für Medienunternehmen<br />
in Österreich wenig<br />
geändert. Die derzeitige Medienpolitik<br />
der Regierung sieht vor, auf die Veränderungen<br />
der Rahmenbedingungen<br />
durch die fortschreitende Digitalisierung<br />
angemessen zu reagieren. Eine<br />
Passage des aktuellen Regierungsprogrammes<br />
lautet: „In der digitalen Welt<br />
müssen die gleichen Prinzipien gelten<br />
wie in der realen Welt!“ Hierbei bezieht<br />
sich die Regierung vor allem auf das<br />
Thema Hass und Gewalt im Netz, ob<br />
jedoch auch Bereiche wie Privatsphäre<br />
und Persönlichkeitsrecht bedacht werden,<br />
ist unklar. Wie es scheint, stellt die<br />
journalistische Veröffentlichung von<br />
privaten Daten aus sozialen Netzwerken<br />
für die Politik zurzeit jedoch kein<br />
großes Problem dar.<br />
von Christina Glatz<br />
Peter Grotter / Copyright: Peter Grotter<br />
Matthias Schmidl / Copyright: Pollmann<br />
© Copyright: adobe stock / calypso77<br />
NeuerJob?<br />
medienjobs.at<br />
die Jobbörse für Medienschaffende<br />
72<br />
Thema Wenn private Daten in den Medien landen
Wenn MANN den Journalistinnen<br />
Chancen verwehrt<br />
Die Verhaltensgrundsätze für JournalistInnen sind eindeutig: Es darf<br />
niemand aufgrund seiner religiösen und ethnischen Werte, sowie seiner<br />
Angehörigkeit zu einer Rasse oder Minderheit diskriminiert werden. Dennoch<br />
ist Diskriminierung kein Fremdwort in der Medienbranche: Journalistinnen<br />
im Print- und Online-Sektor verdienen noch immer weniger als<br />
ihre männlichen Kollegen. <strong>SUMO</strong> sprach darüber mit einer Printjournalistin.<br />
„Journalistinnen sind jünger, besser<br />
ausgebildet, verdienen weniger und<br />
sind seltener in Leitungspositionen<br />
zu finden.“ Das ist ein Statement von<br />
Matthias Karmasin, Direktor des Instituts<br />
für vergleichende Medien- und<br />
Kommunikationsforschung an der Österreichischen<br />
Akademie der Wissenschaft<br />
(ÖAW) auf der ÖAW-Website<br />
(31.1.2020) zum jüngsten „Journalismus-Report“.<br />
Es deutet genau auf etwas<br />
hin, was in der Medienbranche<br />
Realität ist: die Unterscheide zwischen<br />
Männern und Frauen bezüglich des finanziellen<br />
Verdienstes.<br />
Der Gender-Pay-Gap ist ein Indikator<br />
für diese Ungleichheit. Hierbei wird<br />
der prozentuelle Unterschied zwischen<br />
dem Stundenverdienst zwischen Männern<br />
und Frauen errechnet. Insgesamt<br />
lag dieser Wert in Österreich 2018<br />
bei 19,8%, was im Vergleich zum EU-<br />
Schnitt von 14,8% kein gutes Ergebnis<br />
ist. Auch das Bundeskanzleramt ist sich<br />
der Bedeutung dieser Zahl bewusst<br />
und schreibt auf ihrer Homepage, dass<br />
zwar eine sichtliche Verbesserung der<br />
Gender-Pay-Gap stattgefunden hat,<br />
Österreich dennoch zu den negativen<br />
Spitzenreitern in Sachen ungleiche Bezahlung<br />
in der EU zählen.<br />
JournalistInnen verdienen unterschiedlich<br />
Der österreichische „Journalismusreport<br />
2019“ hat den Gender-Pay-Gap in<br />
der Medienbranche errechnet. Ein Journalist<br />
verdient durchschnittlich 4.177<br />
Euro im Monat, wohingegen eine Journalistin<br />
im Schnitt 3.447 Euro verdient.<br />
Das sind ganze 730 Euro weniger und<br />
ein Unterschied von 17,5%. „Zwar ist<br />
der Gender-Pay-Gap im Journalismus<br />
viel geringer als in anderen Branchen,<br />
aber es gibt ihn“, so der Direktor des<br />
ÖAW-Instituts zum aktuellen Report.<br />
Die Größe dieses Prozentsatzes ist<br />
teilweise auf den Fakt zurückzuführen,<br />
dass Journalistinnen öfter in Teilzeitpositionen<br />
angestellt sind. Vollzeitjournalistinnen<br />
verdienen zwar nur 457 Euro<br />
weniger im Monat (10,6%), aber der<br />
Unterschied bleibt.<br />
Obwohl der Faktor der geringeren Be-<br />
© Copyright: adobe stock / photokozyr<br />
Wenn MANN den Journalistinnen Chancen verwehrt Thema<br />
73
zahlung als die größte Ungerechtigkeit<br />
erscheint, ist noch ein anderer Blickwinkel<br />
bezüglich der Behandlung von<br />
Männern und Frauen sehr wichtig, der<br />
vor allem im Bereich der Medien eine<br />
erhebliche Rolle spielt: die Beeinflussung<br />
der Aufstiegschancen auf der<br />
Karriereleiter aufgrund des Geschlechtes.<br />
Marie K. (Anm.: Name geändert)<br />
arbeitet schon seit Jahren bei einer österreichischen<br />
Boulevard-Zeitung als<br />
Printjournalistin und hat im Interview<br />
gegenüber <strong>SUMO</strong> die Fakten auf den<br />
Tisch gelegt. „Frauen werden wohl die<br />
Ungerechtigkeit, betreffend der Aufstiegschancen,<br />
in Zeiten ihres Berufslebens<br />
kaum aufholen können. Außerdem<br />
sind bei uns Redaktionsleitungen<br />
bzw. Chefredakteure ausschließlich<br />
männlich“, betont die Journalistin. Von<br />
den 14 Tageszeitungen in Österreich,<br />
die sowohl Print- als auch Online-Journalismus<br />
betreiben, hat nur der „Kurier“<br />
eine weibliche Chefredakteurin. „Und<br />
findet sich zufällig eine Frau in einer<br />
höheren Position, sind dies eher sogenannte<br />
,Quotenfrauen‘, was ihre Leistungen<br />
und Qualifikationen aber auf<br />
keinen Fall schmälert“, stellt K. fest.<br />
Die einzige Art und Weise, wie sich Frau<br />
gegen diese Ungerechtigkeit wehren<br />
kann, ist die Gleichbehandlungsanwaltschaft<br />
(GAW). Diese ist eine öffentliche<br />
Einrichtung, die auf Basis des Gleichbehandlungsgesetzes<br />
alle vertritt, die<br />
sich in irgendeiner Form benachteiligt<br />
fühlen. Das Gesetz existiert seit 2004<br />
und enthält unter anderem die Gleichstellung<br />
von Frauen und Männern in<br />
der Arbeitswelt, wozu gleiche Bezahlung,<br />
gleiche Chancen und gleiche Verträge<br />
gehören. Nichtsdestotrotz ist das<br />
alles in der Praxis nicht gegeben. Marie<br />
K. bestätigt, sie habe noch immer<br />
weibliche Kolleginnen, die in derselben<br />
Position weniger verdienen als Männer<br />
und das sei scheinbar noch immer<br />
„branchenüblich“. Doch wieso klagen<br />
Journalistinnen mithilfe der Gleichbehandlungsanwaltschaft<br />
nicht ein, was<br />
ihnen zusteht? „Wenn du die anrufst,<br />
hast du wahrscheinlich einen Job gehabt…“,<br />
so Marie K.<br />
Das tut der Staat gegen den Gender-<br />
Pay-Gap<br />
Wie auf der Website des Bundeskanzleramtes<br />
zu lesen ist, ist sich auch die<br />
Regierung bewusst, dass gegen diese<br />
Ungerechtigkeit etwas unternommen<br />
werden muss. Bekämpft werden soll<br />
der Gender-Pay-Gap nicht etwa mit<br />
neuen Gesetzen für den Arbeitgeber,<br />
sondern mit Information. Initiativen,<br />
die Mädchen an technischen und wissenschaftlichen<br />
Berufen begeistern<br />
sollen, Möglichkeiten zur Erhöhung der<br />
Väterbeteiligung in der Familie und die<br />
Förderung von Frauen in wirtschaftlichen<br />
Führungs- und Entscheidungspositionen.<br />
Ein entscheidender Schritt,<br />
der gesetzt wurde, ist die Erhöhung der<br />
Einkommenstransparenz in Österreich.<br />
Dazu gehören die Angabe des Mindestentgeltes<br />
in Stelleninseraten und<br />
ein Einkommensbericht, der durch das<br />
Unternehmen erstellt wird. Diese Ansprüche<br />
gelten selbstverständlich auch<br />
für Medienunternehmen.<br />
Die Ausnahme: Der Öffentlich-Rechtliche<br />
Rundfunk<br />
Obwohl sich der ORF nicht auf Print<br />
und Online beschränkt, spielt er auch<br />
hier eine große Rolle. Zwar sind alle<br />
neun Landesstudio-Chefredakteure<br />
Männer und an der Frauenquote in den<br />
Führungspositionen könnten sie auch<br />
noch arbeiten, trotzdem liegt der Gender-Pay-Gap<br />
beim ORF nur bei 12,1%.<br />
Auch hier ist der Weg zur kompletten<br />
Gleichstellung noch lang. Seit 2010 ist<br />
im ORF-Gesetz eine Frauenquote von<br />
45% in Führungspositionen verankert.<br />
Eine derzeitige Zahl von 26% Frauen in<br />
hohen Führungspositionen lässt noch<br />
Luft nach oben.<br />
Die jährliche Hommage an den Gender-Pay-Gap<br />
25. Februar 2020: Hätten Frauen den<br />
gleichen Stundenlohn wie Männer, aber<br />
ihren aktuellen Verdienst, hätten sie bis<br />
zu diesem Tag des Jahres 2020 gratis<br />
gearbeitet. Der Equal-Pay-Day findet<br />
jedes Jahr statt und soll veranschaulichen<br />
und greifbar machen, wie benachteiligt<br />
Frauen gegenüber Männern<br />
werden. Und sich vorzustellen, dass<br />
eine Journalistin an ihrem Schreibtisch<br />
sitzt am Equal-Pay-Day, einen Artikel<br />
darüber verfasst und genau weiß, erst<br />
ab diesem Zeitpunkt verdient sie Geld.<br />
Frauen verdienen weniger als Männer<br />
in der gleichen Position. Das ist ein Fakt.<br />
Doch dass manche Frauen nicht einmal<br />
die Chance haben, in einer Führungsposition<br />
schlechter zu verdienen, weil sie<br />
diese nie erreichen, ist umso trauriger.<br />
Dies ist auch der Fall in einer Branche,<br />
die die Gleichbehandlung in ihren Kodex<br />
aufgenommen hat. Die Zahlen zeigen,<br />
dass die Medienbranche den Gender-<br />
Pay-Gap nicht annähernd geschlossen<br />
hat, obwohl es genau die Medienhäuser<br />
sind, die über diese Ungerechtigkeit berichten<br />
und diese verpönen.<br />
von Sophie Pratschner<br />
© Copyright: adobe stock / Jink drop<br />
74<br />
Thema Wenn MANN den Journalistinnen Chancen verwehrt
Impressum<br />
Medieninhaberin:<br />
Fachhochschule St. Pölten GmbH<br />
c/o <strong>SUMO</strong><br />
Matthias Corvinus-Straße 15<br />
A-3100 St. Pölten<br />
Telefon: +43(2742) 313 228 - 200<br />
www.fhstp.ac.at<br />
Fachliche Leitung:<br />
FH-Prof. Mag. Roland Steiner<br />
E-Mail: roland.steiner@fhstp.ac.at<br />
Telefon: +43(2742) 313 228 -425<br />
www.sumomag.at<br />
facebook.com/sumomag<br />
Copyright: jeweils Privat<br />
Das Team der Ausgabe 35 und des Online-Magazins www.sumomag.at<br />
Julia Allinger, Christiane Fürst, Michael Geltner, Christina Glatz, Raphaela Hotarek, Martin Möser, Karin Pargfrieder,<br />
Roland Steiner, Lukas Pleyer, David Pokes, Sophie Pratschner, Alexander Schuster, Ida Stabauer, Therese Sterniczky,<br />
Anja Stojanovic, Viktoria Strobl, Sebastian Suttner, Ondrej Svatos<br />
BILDREDAKTION: Christina Glatz, Karin Pargfrieder, David Pokes, Alexander Schuster, Ida Stabauer, Sebastian Suttner<br />
DISTRIBUTION: Christiane Fürst, Lukas Pleyer, Ondrej Svatos<br />
PRINTPRODUKTION: Martin Möser, Ida Stabauer, Therese Sterniczky<br />
ONLINEPRODUKTION: Julia Allinger, Sophie Pratschner<br />
SALES: alle<br />
TEXTREDAKTION: alle<br />
UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION: Michael Geltner, Raphaela Hotarek, Anja Stojanovic, Viktoria Strobl<br />
Impressum<br />
75
Eine gute<br />
Ausbildung<br />
ist eine, die<br />
mir zeigt,<br />
was noch getan<br />
werden muss.<br />
Wissen, was<br />
morgen zählt.<br />
Eva Milgotin<br />
Studentin Wirtschafts- und<br />
Finanzkommunikation<br />
Christoph Rumpel<br />
Web-Entwickler & Autor (Selbstständig)<br />
Absolvent Medientechnik<br />
Sechs Studienbereiche:<br />
medien & wirtschaft<br />
medien & digitale technologien<br />
informatik & security<br />
bahntechnologie & mobilität<br />
gesundheit<br />
soziales<br />
Jetzt informieren: fhstp.ac.at