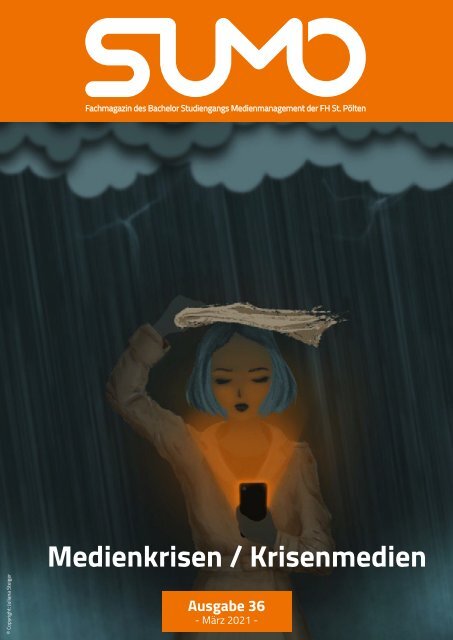SUMO #36
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Fachmagazin des Bachelor Studiengangs Medienmanagement der FH St. Pölten<br />
© Copyright: Juliana Steiger<br />
Medienkrisen / Krisenmedien<br />
Ausgabe 36<br />
- März 2021 -
Medienmanagement<br />
studieren heißt die<br />
Zukunft der Medien<br />
mitgestalten.<br />
Wissen, was morgen zählt.<br />
Medienmanagement<br />
· Bachelorstudium: 6 Semester<br />
· Vollzeit<br />
Schwerpunkte<br />
· Content Management<br />
· Marketing und Sales<br />
· Strategisches Management<br />
© Martin Lifka Photography<br />
2<br />
Thema<br />
Jetzt informieren:<br />
fhstp.ac.at/bmm
Inhalt<br />
» Editorial von Roland Steiner 4<br />
» Wenn es wirklich wichtig ist: lieber digital? von Lukas Pleyer 5<br />
» Umweltkrisenberichterstattung - überbewertet oder Zukunft? von Julia Allinger 8<br />
» Das wirtschaftliche Standing professioneller Fotografie von Ida Stabauer 12<br />
» Krisen im Schattendasein der Medien von Karin Pargfrieder 15<br />
» „Reporter ohne Grenzen“ - oder doch mit? von Kristina Petryshche 18<br />
» Jobunsicherheit: „Goldene Ära des Journalismus ist vorbei“ von Christiane Fürst 20<br />
» Satire als Gegenmittel in Krisen von Christian Krückel 24<br />
» Auf der Suche nach Schnäppchen über Vergleichsportale von Laura Sophie Maihoffer 27<br />
» Keine Zukunft für Musikmedien? von David Pokes 29<br />
» „Propaganda liegt in der Natur des Missionierens“ von Alexander Schuster 32<br />
» Auf der Flucht vor der Krise von Christian Krückel 35<br />
» Modern Loneliness: Zwischen Likes und Einsamkeit von Lisa Schinagl 38<br />
» Filmregulierung: Zum Wohle der Kinder? von Simone Poik 40<br />
» Journalismus heute: Alles geklaut und gelogen? von Matthias Schnabel 43<br />
» Zwischen Liebe und Hass - Das Geschäft mit der Privatsphäre der Stars von Michael Geltner 46<br />
» Close up (or down), Cinema?! von Julia Gstettner 50<br />
» Wird nur noch bildlich gesprochen oder ist da doch zu viel Druck? von Annika Schnuntermann 52<br />
» Der Traum der europäischen Datensouveränität von Matthias Schnabel 55<br />
» Steckt der österreichische Film in der Krise? von Raphaela Hotarek 58<br />
» Die Facetten der Angstlust von Viktoria Strobl 62<br />
» Man nehme einen Goldesel... oder etwa nicht? Europäische Filmfinanzierung von Simone Poik 66<br />
» Kaufen oder nicht kaufen? - Testmagazine verraten es uns von Manuela Schiller 70<br />
» GIS Pfui, Pay TV/Streaming Hui?! von Julia Gstettner 72<br />
© Copyright: pexels<br />
Inhalt<br />
3
Editorial<br />
Liebe Leserin, lieber Leser!<br />
Es begann mit „Asterix“ und Kinderbüchern des<br />
Rowohlt Verlags, ehe den Zwölfjährigen die „Kleine<br />
Zeitung“ und dank einer Mutter als Ordinationsgehilfin<br />
die Wartezimmer-Zeitschriften interessierten<br />
(Adels-Klatsch & Promi-Tratsch, auch der damals<br />
noch nicht ramponierte „Stern“). Schon selbstbestimmter<br />
gesellte sich das Abo der Musikzeitschrift<br />
„Rennbahn-Express“ hinzu, um sich danach zu distinguieren<br />
mittels „SPEX“ und „New Musical Express“.<br />
Vom Bildschirm schimmerten „Die Sendung<br />
mit der Maus“ und echte Tier-Dokus (oder der „Tatort“<br />
dank Opa), später „Zeit im Bild“ und „Ohne Maulkorb“.<br />
Aus dem Radio erklangen die „Ö3-Hitparade“<br />
und Cortis „Schalldämpfer“. Welch Offenbarung an<br />
Welt für ein Kleinstadtkind in den 1980ern, ein Horizont<br />
an Sekundärerfahrungen tat sich auf und der<br />
„Möglichkeitssinn“! 1990 dann, Einführungsvorlesung<br />
am Wiener Publizistik-Institut: Prof. Langenbucher<br />
referiert im mit 1.000 auf den Journalismus-Beruf<br />
erpichten Erstsemestern gefüllten Audimax eine<br />
Statistik u.a. über Sucht- und Scheidungsraten von<br />
JournalistInnen, ökonomische Krisen im Mediensystem.<br />
Und daraus sollten wir Sinn stiften?<br />
Bitte verzeihen Sie mir das persönliche Pathos, aber<br />
Medienkrisen gibt es nicht erst seit dem C-Jahr. Nach<br />
der Revolution 1848 wurden in Österreich-Ungarn<br />
hunderte Zeitungen gegründet – und bald wieder<br />
vom Markt genommen. Zensur und Überwachung<br />
der Medien gibt es heute noch – auch in Demokratien.<br />
Wir Studierenden saßen stundenlang in einem<br />
Kaffeehaus – um für die Nutzung von Zeitungen und<br />
Zeitschriften nichts zu bezahlen. Die Minderbezahlung<br />
von Medienschaffenden erhielt bloß einen neuen<br />
Namen: Prekariat. „Video killed the Radio Star“ –<br />
und Streaming „erledigt“ das Kino?<br />
Die Medienbranche befand sich seit ihrem Entstehen<br />
in einem Wandel. Warum gerade der Journalismus –<br />
insbesondere im Print-Bereich – so krisenanfällig ist,<br />
lässt sich unter anderem so erklären: Informationsmedien<br />
sollen ihre demokratiepolitischen Aufgaben<br />
der Kontrolle und Kritik, Aufklärung und Bildung erfüllen,<br />
was vieler Ressourcen bedarf – die Medienunternehmen<br />
müssen jedoch diese Ressourcen jedoch<br />
erst auftun. Dieser Spagat wird schwieriger<br />
aufgrund veränderter Rezeptionsweisen, aufgrund<br />
hinzugekommener „sozialer Medien“ ohne journalistische<br />
Professionalität und Entlohnung, etc. Obwohl<br />
sich das zeitliche und bisweilen auch finanzielle Budget<br />
gerade im Unterhaltungssegment (z.B. Streaming,<br />
Gaming), welches NutzerInnen für Medien<br />
buchstäblich in Kauf nehmen, erhöht hat, verbleibt<br />
die Gewohnheit an der Gratisnutzung via Internet.<br />
Die <strong>SUMO</strong>-Redaktion hat sich mit dieser Ausgabe<br />
das Ziel gesetzt, Krisen in der Branche multiperspektivisch<br />
zu betrachten und positive Auswege wie<br />
Gegenbeispiele auszuloten. Multiperspektivisch bei<br />
<strong>SUMO</strong> heißt stets: mehrere Mediengattungen abdeckend<br />
und basierend auf Interviews mit ExpertInnen<br />
und Studien. Alle Teams, in denen die Studierenden<br />
der Praxislabore „Journalistische Arbeitsweisen“<br />
bzw. „Medienmanagement“ und jene des Freifachs<br />
„Medien-Fachmagazin <strong>SUMO</strong> (Print und Online)“<br />
tätig waren haben Bravouröses geleistet: Sales, Distribution,<br />
Bildredaktion, Printproduktion, Onlineproduktion,<br />
Unternehmenskommunikation – GRAZIE<br />
MILLE! Und als RedakteurInnen haben sie Ihnen,<br />
werte Leserin und werter Leser, spannende Themen<br />
aufbereitet: Digitale Briefkästen, Religionspropaganda,<br />
Vergleichsportale, Eskapismus und Angstlust,<br />
Krisen im Schattendasein der Medien, Satire als<br />
Antidot zu Krisen, Umweltberichterstattung, Jobunsicherheit<br />
in der Branche, Paparazzi, soziale Medien<br />
zur Einsamkeitsprävention, die Zukunft von Musikmedien,<br />
Film und dessen Selbstregulierung, Kinos<br />
und Fotografie, u.v.m.<br />
Das <strong>SUMO</strong>-Team wünscht Ihnen eine interessante<br />
Lektüre in besser werdenden Zeiten,<br />
FH-Prof. Dr. Johanna Grüblbauer<br />
Studiengangsleiterin<br />
Bachelor Medienmanagement<br />
FH-Prof. Mag. Roland Steiner<br />
Praxislaborleiter Print<br />
Chefredakteur <strong>SUMO</strong><br />
© Copyright: pexels<br />
Copyright: Privat<br />
Copyright: Ulrike Wieser<br />
4<br />
Editorial
Wenn es wirklich wichtig ist:<br />
lieber digital?<br />
Ob als Brief, als E-Mail oder Nachricht in einem Messenger-Dienst.<br />
Brisante Informationen mit den richtigen Personen zu teilen kann wahrlich<br />
Berge versetzen, gewissen CEOs den Tag verderben oder gar Regierungen<br />
in Bedrängnis bringen. Nur wie, ohne dass man selbst dafür zu<br />
Rechenschaft gezogen wird? Zeit für <strong>SUMO</strong>, sich Leaking-Plattformen<br />
bzw. digitalen Briefkästen und deren Bedeutung zu widmen.<br />
© Copyright: adobe stock / Dmitriy<br />
Sonntagmorgen. Heute werden sicherlich<br />
wenig Menschen auf den Straßen<br />
Wiens unterwegs sein, immerhin ist<br />
Lockdown. Gute Bedingungen, nicht gesehen<br />
zu werden. Die Tasche ist gepackt,<br />
die Kaffeetasse leer und die Lichter in der<br />
Wohnung sind abgedreht. Auf zu einem<br />
Postkasten, aber wo findet man einen?<br />
In der Postfiliale in der Weintraubengasse<br />
ist bestimmt einer, allerdings würde<br />
man da auf den Überwachungsaufnahmen<br />
zu sehen sein. Als schon mit Winterjacke<br />
in der Tür Stehender nochmal<br />
das Handy rausgeholt und nachgesehen,<br />
naja, sofern es funktionieren würde.<br />
Der Standortfinder der Post ist nicht auf<br />
Handys abgestimmt – also Laptop nochmal<br />
hochfahren und nachsehen. Aja,<br />
gleich um die Ecke, sehr gut! Dann kann<br />
ja nichts mehr schief gehen. Kurz vor<br />
Verlassen des Hauses läuft einem der<br />
Nachbar über den Weg: man kommt ins<br />
Gespräch und verlässt gemeinsam das<br />
Haus. Man unterhält sich über aktuelle<br />
Themen wie Corona oder die Baustelle<br />
im Haus, die allen auf die Nerven geht.<br />
„Das war ja früher mal ein Puff, bis die<br />
Hausverwaltung sie hat rauswerfen lassen<br />
– kommt davon, wenn man die Miete<br />
nicht bezahlt“, sagt er mit erheitertem<br />
Gemüt. „Ich habe mir einen Coronabart<br />
wachsen lassen“, erklärt der pensionierte<br />
Ur-Wiener und streift sich dabei über<br />
diesen. „Wofür rasieren, man darf ja eh<br />
nichts machen darf. Was für Zeiten! Bin<br />
ich gespannt, wann dieses Lokal endlich<br />
aufsperrt und ob überhaupt. Der Besitzer<br />
meinte, er lädt uns ein, sobald es fertig<br />
ist. Hoffentlich auf mehr als nur ein Achterl“,<br />
fährt er scherzend fort. Das Wetter<br />
ist typisch für Wien: Grau in Grau. Es hat<br />
10 Grad und es riecht nach Herbst, obwohl<br />
es Winter ist. Man geht gemeinsam<br />
Richtung Heinestraße Ecke Mühlfeldgasse,<br />
wo sich der nächstgelegene Briefkasten<br />
befindet. Er ist weniger daran interessiert,<br />
etwas abzusenden, eher etwas<br />
abzustauben; die Sonntagsausgaben<br />
von „Kurier“, „Krone“ und „Österreich“ –<br />
aber ohne Geld einzuwerfen, versteht<br />
sich ja. Der Postkasten ist mit Graffiti beschmiert<br />
und sieht eher danach aus, als<br />
ob er die besten Stunden seines Daseins<br />
schon erlebt hätte. „Entleerung Montag-<br />
Freitag, 16:00“ steht auf einem Zettel<br />
hinter einer kleinen zerbrochenen Scheibe.<br />
Ist der Nachbar schon weg? Sehr gut,<br />
dafür warten einige andere auf die Buslinie<br />
5B. Das Bauchgefühl drängt zum<br />
nächsten Briefkasten. Bei einem deutlich<br />
„gesünder“ aussehenden Postkasten<br />
angekommen, sind Sticker zu erkennen.<br />
„Team Christkind“ steht darauf – hoffentlich<br />
wird Weihnachten noch etwas.<br />
Der Blick auf das Infokärtchen hinter der<br />
intakten Glasscheibe ist zwar möglich,<br />
allerdings etwas verärgernd. Neben der<br />
Tatsache, dass auch dieser Postkasten<br />
erst am Montag um 16:00 entleert wird<br />
steht auch noch daneben mit Edding<br />
draufgeschmiert: „Fuck you“. Ob dies ein<br />
Zeichen ist? Ist der Postkasten direkt<br />
in der Filiale vielleicht doch die bessere<br />
Option oder soll ich es über digitalem<br />
Wege versuchen? Immerhin sollten die<br />
Dokumente so schnell wie möglich die<br />
richtigen Menschen erreichen und das so<br />
anonym wie es nur geht!<br />
Um sich ein Bild über digitale und anonyme<br />
Kontaktaufnahmemöglichkeiten zu<br />
verschaffen, sprach <strong>SUMO</strong> mit Hannes<br />
Munzinger, Digitalinvestigativ- und Datenjournalist<br />
bei der „Süddeutschen Zeitung“,<br />
und Markus Sulzbacher, Projektleiter<br />
des anonymen Briefkastens sowie<br />
Web-Ressortleiter bei „DER STANDARD“.<br />
EU-Angriff auf verschlüsselte<br />
Kommunikation<br />
Kurz nach dem Terroranschlag auf das<br />
Herz Wiens äußerte sich Gilles de Kerchove,<br />
Leiter der Anti-Terror-Koordination<br />
der EU, in der „ZiB“ gegenüber den<br />
Datenschutzbestimmungen der EU. Seiner<br />
Meinung nach erschweren diese es<br />
deutlich, in Ermittlungen auf Handydaten<br />
und E-Mails Verdächtiger zuzugreifen.<br />
Dem wolle die EU nun entgegentreten:<br />
Schwache Verschlüsselung, ein Generalschlüssel<br />
oder eine Hintertür soll es den<br />
Sicherheitsbehörden ermöglichen, leichter<br />
auf Handydaten zugreifen zu können.<br />
Martin Blatter, Chef des Schweizer Messenger-Dienstes<br />
„Threema“, steht dem<br />
sehr kritisch gegenüber – er ist nicht der<br />
Wenn es wirklich wichtig ist: lieber digital?<br />
5
© Copyright: adobe stock / Andrey Popov<br />
einzige. In der am 29.11.2020 erschienenen<br />
„Welt am Sonntag“ äußerte er<br />
sich wie folgt: „Diese Forderungen nach<br />
einem Generalschlüssel zeugen von der<br />
Unbedarftheit der Behörden. Wir haben<br />
gar keinen Generalschlüssel, den wir hinterlegen<br />
könnten. Die Verschlüsselung<br />
wird von den Nutzern vorgenommen<br />
und nicht von uns.“ Der Eingriff in die Verschlüsselung<br />
soll sich dabei nicht nur auf<br />
Messenger-Dienste beschränken, sondern<br />
auch auf E-Mails und Play-Chats<br />
von Videokonsolen abzielen, vermutet<br />
„STANDARD“-Webressortleiter Sulzbacher.<br />
Ein Zugriff auf das Smartphone geht allerdings<br />
auch anders, nämlich mit einem<br />
sogenannten Bundestrojaner. Der Verfassungsgerichtshof<br />
hat 2019 die Vorlage<br />
von Türkis-Blau abgelehnt, dennoch<br />
möchte man laut Regierungsprogramm<br />
diesen „verfassungskonform“ umsetzen.<br />
„Wie der nun, obwohl der erste Entwurf<br />
schon einmal abgeschmettert wurde,<br />
verfassungskonform sein soll, ist eine<br />
gute Frage. Mein Eindruck ist bei so etwas<br />
immer, dass hier viel von Menschen<br />
geredet wird, die keine Ahnung von der<br />
Technik haben und sich das alles immer<br />
sehr einfach vorstellen, um es nett zu<br />
formulieren“, ärgert sich Sulzbacher. Laut<br />
dem Projekt- und Ressortleiter wurden<br />
während dem Tierschützer-Prozess<br />
und jenem gegen den Islamisten Mohamed<br />
Mahmoud ein Bundestrojaner verwendet.<br />
„Die Strafverfolger haben sich<br />
damals so geholfen, indem sie gesagt<br />
haben, dass es kein Bundestrojaner sei,<br />
sondern irgendwie eine Software, die<br />
alle zwei Sekunden Screenshots macht<br />
und wohin schickt“, fährt er fort. Also ein<br />
Bundestrojaner? „Genau.“<br />
Der Weg zum sicheren Hafen<br />
Im Falle der Panama-Papers, bei denen<br />
ca. 11,5 Millionen Dokumente geleakt<br />
wurden, wäre der klassische postalische<br />
Weg undenkbar gewesen. Gab es damals<br />
den digitalen Briefkasten der „Süddeutschen<br />
Zeitung“ schon und wurde der<br />
hierfür genutzt? Laut Munzinger wurde<br />
der Briefkasten erst 2018 mit den „Implant<br />
Files“ ins Leben gerufen, demnach<br />
nein. Wie die Dokumente ihren Weg zum<br />
Investigativ-Team gefunden haben, darf<br />
der Journalist nicht verraten, auch wenn<br />
die Story über verschlüsseltem Weg begann.<br />
„Wenn wir über die Vermögensverhältnisse<br />
von Vladimir Putin schreiben,<br />
dann müssen wir damit rechnen, dass<br />
ein russischer Geheimdienst versucht,<br />
Kommunikationswege nachzuverfolgen,<br />
eben um zu der Quelle zu kommen“, fährt<br />
Munzinger fort. Bei Geschichten, die über<br />
den Briefkasten kommen und der Pfad<br />
demnach nicht nachvollzogen werden<br />
kann ist man etwas offener. Nicht um die<br />
Quelle offenzulegen, sondern weil man<br />
als „Süddeutsche Zeitung“ möchte, dass<br />
der digitale Briefkasten genutzt wird.<br />
Auch beim „STANDARD“ möchte man die<br />
Nutzung des Briefkastens anregen, über<br />
den, laut Sulzbacher, mehr eintrudle als<br />
mit der Post. „Man sollte nicht unterschätzen,<br />
was alles über den Briefkasten<br />
kommt.“ Der anonyme Briefkasten hält<br />
dennoch Überraschungen bereit. „Da gab<br />
es diesen Hackerangriff auf die ÖVP und<br />
da wurde bei uns quasi die ÖVP-Buchhaltung<br />
in den Briefkasten eingeworfen.<br />
Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch<br />
nicht, dass diese Infos über einen Hack<br />
beschafft wurden“, erinnert sich der Projektleiter<br />
im Gespräch mit <strong>SUMO</strong>.<br />
Digital vs. Analog<br />
Im Falle der ÖVP-Spenderlisten, die<br />
durch einen Hack beschafft wurden, ist<br />
es für die jeweiligen Personen von oberster<br />
Priorität anonym zu bleiben. Welche<br />
Variante ist nun zu empfehlen, die Post<br />
oder doch lieber digital? „Ich finde beides<br />
gut. Aber für die LeserInnen ist die digitale<br />
Version um etliches einfacher“, meint<br />
der Projektleiter des digitalen „STAN-<br />
DARD“-Briefkastens. Munzinger sieht<br />
dies ähnlich. Laut dem Investigativjournalisten<br />
sollte man sich aber dennoch<br />
fragen, ob der digitale Weg, den man<br />
geht, Metadaten produziere oder nicht.<br />
In autokratischen Staaten beispielsweise<br />
sei das einfache Absenden eines Briefes<br />
ohne Absender/in meist nicht möglich.<br />
„Wenn man wirklich Grund zur Annahme<br />
hat, dass man mit sehr aufwendigen<br />
Mitteln verfolgt wird, zum Beispiel als<br />
Whistleblower in autokratischen Staaten<br />
oder als Whistleblower aus der Geheimdienstwelt,<br />
dann würde man natürlich<br />
empfehlen, dass man den möglichst<br />
sichersten Weg geht“, so Munzinger im<br />
<strong>SUMO</strong>-Interview. Er sei der Meinung,<br />
dass die Kontaktaufnahme über das<br />
Smartphone (außer bei zentralverwalteten<br />
Diensthandys) und einem verschlüsselten<br />
Messenger-Dienst in vielen Fällen<br />
ausreiche. Wenn es um Webbrowser am<br />
Computer geht, meint Sulzbacher: „Der<br />
Tor Browser ist bei unserem Briefkasten<br />
nicht zwingend notwendig, um anonym<br />
zu bleiben. Es ist möglich, den Briefkasten<br />
mit einem normalen Browser zu<br />
verwenden, wir raten dennoch zum Tor<br />
Browser.“<br />
Varianten digitaler Briefkästen<br />
Die vollanonyme digitale Kontaktaufnahme<br />
verkompliziere für die weitere Recherche<br />
einiges, beispielsweise falls man<br />
Rückfragen hat. „Eigentlich ist der Briefkasten<br />
für die meisten NutzerInnen eine<br />
Einbahnstraße, die werfen etwas ein und<br />
das war es dann“, konstatiert Sulzbacher.<br />
Man sorge für Anonymität, indem man<br />
unter anderem nicht mitlogge; es gebe<br />
keine Logdateien. Logdateien sind Auf-<br />
6<br />
Wenn es wirklich wichtig ist: lieber digital?
zeichnungen von Aktionsmeldungen,<br />
wie z.B. dem Hochladen von Dateien.<br />
Demnach sei es für das Team von „DER<br />
STANDARD“ nicht möglich, nachträglich<br />
mit den WhistleblowerInnen in Kontakt<br />
zu treten, außer sie würden eine Nachricht<br />
dazulegen. Die Technik hinter dem<br />
digitalen Briefkasten wurde mit Hilfe von<br />
Open-Source-Komponenten im Hause<br />
selbst aufgebaut. Ein Hausgeheimnis, so<br />
der Projektleiter. „Wir hatten es am Anfang<br />
auch mit ‚Signal‘ und ‚WhatsApp“<br />
versucht, aber das hat leider nicht so<br />
funktioniert, wie wir uns das vorgestellt<br />
haben. Es ist scheinbar für unsere LeserInnen<br />
einfacher, und es geht viel um<br />
Einfachheit, das ganz normal über einen<br />
Webbrowser hochladen zu können“, erläutert<br />
Sulzbacher weiter.<br />
Bei der „Süddeutschen Zeitung“ hingegen<br />
setzte man auf die Vielfalt an Möglichkeiten,<br />
denn jede Quelle habe unterschiedliche<br />
Fähigkeiten in der Nutzung.<br />
Eine All-in-One-Lösung gäbe es laut<br />
Munzinger nicht. Auf Sicherheit setzte<br />
man mit „Secure Drop“, einer Plattform<br />
zum anonymen und verschlüsselten<br />
Austausch von Dokumenten, Videos<br />
oder Bildern. „Natürlich ist ‚Secure Drop‘<br />
eine besonders sichere und viele sagen<br />
die beste Lösung. Allerdings muss man<br />
dafür natürlich erstmal den Tor Browser<br />
haben und unsere Adresse dazu finden“,<br />
fährt der Investigativjournalist fort. Laut<br />
ihm sei das schon eine Hürde, die manche<br />
gar nicht überspringen können oder<br />
wollen, und deswegen biete die „Süddeutsche<br />
Zeitung“ auch sehr einfache<br />
Möglichkeiten an, wie auch zum Beispiel<br />
„ProtonMail“, ein verschlüsselter<br />
E-Mail-Dienst. Ebenfalls findet man auf<br />
der Kontaktseite des Investigativ-Teams<br />
der „Süddeutschen Zeitung“ die IDs der<br />
Redakteure für den verschlüsselten<br />
Messenger-Dienst „Threema“. „Wir bieten<br />
eigentlich alles an, damit jede Quelle<br />
die uns erreichen will einen Weg nutzen<br />
kann, der ihr gerecht wird und sich mit<br />
dem dann auch wohlfühlt“, so Munzinger<br />
zur Vielfalt bei der deutschen Tageszeitung.<br />
Viel hilft viel<br />
Ob jedes Medienunternehmen einen digitalen<br />
Briefkasten anbieten sollte, das<br />
liege laut Munzinger im Ermessen der<br />
jeweiligen Handelnden. In Deutschland<br />
bieten neben der „Süddeutschen Zeitung“<br />
auch noch der „SPIEGEL“ und „ZEIT<br />
Online“ eine Leaking-Plattform an. Laut<br />
dem Journalisten sei nicht der Briefkasten<br />
entscheidend, sondern vor allem die<br />
handelnden AkteurInnen dahinter, die<br />
JournalistInnen, denn die sorgen dafür,<br />
ob eine Quelle Vertrauen in ein Medium<br />
habe oder nicht. „Warum kommt Material<br />
bei uns an? Weil man uns vertraut,<br />
weil wir Historie haben, weil wir die‚‚Panama<br />
Papers‘ bekommen haben und die<br />
Quelle bis heute nicht offengelegt wurde<br />
und nicht in Gefahr ist, wie das in anderen<br />
Fällen geschehen ist. Ich glaube, es<br />
ist wichtiger, dass man vertrauenswürdige<br />
JournalistInnen präsentieren kann,<br />
als dass man jetzt eine digitale Plattform<br />
hat“, konstatiert Munzinger.<br />
Markus Sulzbacher sieht dies anders.<br />
Seiner Meinung nach sei es wirklich<br />
wichtig, dass jedes Medienhaus in Österreich<br />
einen digitalen Briefkasten zu<br />
Verfügung stelle, sofern man es schaffe,<br />
diesen halbwegs sicher (Betonung<br />
auf halbwegs) hinzubekommen, sodass<br />
die InformantInnen dementsprechend<br />
geschützt sind. Dies sei unabhängig davon<br />
ob im Print-Bereich oder Fernsehen,<br />
denn auch die „ZiB 2“ oder „PULS4“<br />
könnten aus den eingeworfenen Informationen<br />
gute Storys machen. Die Kosten<br />
seien im Vergleich zu anderen Dingen<br />
minimal, man benötige lediglich die technische<br />
Infrastruktur und laut Sulzbacher<br />
am wichtigsten: eigene Rechner, die<br />
durch Verschlüsselung gut abgesichert<br />
sind.<br />
von Lukas Pleyer<br />
Wenn es wirklich wichtig ist: lieber digital?<br />
7
Umweltkrisenberichterstattung<br />
– überbewertet<br />
oder Zukunft?<br />
Die einen finden es durchaus berechtigt, die anderen können es kaum<br />
noch hören: Klimawandel, Umweltkrisen, „Fridays for Future“ und Co.<br />
<strong>SUMO</strong> diskutiert mit Journalist, Autor und Referent Prof. Claus Reitan,<br />
und Viktoria Auer, Pressesprecherin von GLOBAL 2000, über die Relevanz<br />
und Herausforderungen von Umweltkrisenberichterstattung für Medien<br />
und Gesellschaft.<br />
© Copyright: adobe stock / piyaset<br />
Fast bedächtig fließt das Gewässer<br />
der Donau, sanfte Wellen schlagen ans<br />
seichte Ufer. Der Wasserstand ist relativ<br />
niedrig und lässt auf wenig regnerische<br />
Tage in den letzten Wochen schließen.<br />
In den ersten Augustwochen des Jahres<br />
2002 hätte sich wohl niemand nach<br />
Krems Stein getraut, geschweige denn<br />
am Rathausplatz flaniert. Dauerregen<br />
und starke Niederschlagsmengen ließen<br />
zuerst das Wasser von Kamp und<br />
Kremsfluss überschwappen, ehe auch<br />
die Wassermassen der Donau über die<br />
Ufer traten. Was blieb, war eine Spur<br />
der Verwüstung. Von der schönen blauen<br />
Donau zur Jahrhundertflut – ganz zu<br />
schweigen vom entstandenen Schaden,<br />
der auf knapp eine halbe Mio. Euro geschätzt<br />
wurde. Etwa zwei Meter über<br />
dem Boden erinnert eine steinerne Tafel<br />
an der Ecke zum Rathaus mit den Worten<br />
„Hochwasser 14. August 2002“ an<br />
das Ausmaß der Katastrophe. Das Hochwasser<br />
blieb unzweifelhaft in den Köpfen<br />
vieler Menschen hängen und hatte<br />
neben einer gestärkten Gemeinschaft<br />
auch zahlreiche Hochwasserschutzmaßnahmen<br />
und große -investitionen zur<br />
Folge. So wurde entlang der Donau ein<br />
auf einer Höhe von elf Metern errichteter<br />
mobiler Hochwasserschutzwall geschaffen.<br />
Doch das nächste „Jahrhunderthochwasser“<br />
trat bereits im Jahr 2013<br />
ein. Noch heute (Stand November 2020)<br />
lässt sich an dem abgebröckelten Putz<br />
der Wände eines Gebäudes entlang der<br />
Steiner Donaulände auf die Folgen, die<br />
das verheerende Hochwasser hinterlassen<br />
hat, schließen.<br />
Dass für die effiziente Vermittlung von<br />
Umweltkrisen die persönliche Betroffenheit<br />
besonders wichtig ist, um Umweltthemen<br />
effektiv zu kommunizieren,<br />
unterstreicht auch Viktoria Auer. Für viele<br />
ÖsterreicherInnen sei beispielsweise<br />
das große Thema Klimakrise zu fern von<br />
der eigenen Lebenswelt. Daher sei die<br />
Schaffung eines persönlichen Bezugs<br />
wichtig, um die Folgen auch im direkten<br />
Umfeld aufzuzeigen. Das Bild der Meeresschildkröte,<br />
die im Plastikmeer ums<br />
Leben kommt, ist zwar den meisten<br />
Menschen bekannt, aber erst die unmittelbare<br />
Nähe, zum Beispiel das Aufzeigen<br />
der Konsequenzen der Vermüllung<br />
auf den Feldern der Bauern und Bäuerinnen,<br />
mache die Dynamik greifbar. Diese<br />
Thematik wurde auch 2018 im Rahmen<br />
des „Kongresses zu Klimawandel,<br />
Kommunikation und Gesellschaft“ von<br />
Isabella Uhl-Hädicke näher behandelt.<br />
Dabei wurden unerwünschte Nebenwirkungen<br />
der Klimawandelkommunikation<br />
ins Auge gefasst. Aufgrund von Erkenntnissen<br />
der sozialwissenschaftlichen Bedrohungsforschung<br />
konnten zwei Reaktionen<br />
auf existentielle Bedrohungen<br />
wie den Klimawandel erkannt werden:<br />
direktes Lösungsverhalten oder symbolisches<br />
Verteidigungsverhalten. Ersteres<br />
bezieht sich auf die Bedrohungsquelle<br />
(zum Beispiel Klimawandelinformation)<br />
und trägt zur Reduktion des Problems<br />
bei (zum Beispiel durch klimafreundliches<br />
Verhalten). Im Gegensatz dazu<br />
fehlt bei symbolischem Verteidigungsverhalten<br />
der Bezug zur Bedrohungsquelle<br />
und ist somit kontraproduktiv für<br />
das Finden von Lösungen. Symbolische<br />
Verteidigungsreaktionen dienen der<br />
Aufrechterhaltung eigener gesellschaftlicher<br />
Werte und Weltanschauungen sowie<br />
der Angstreduktion. Wird beispielsweise<br />
über die negativen Folgen des<br />
Klimawandels berichtet, kommt es zum<br />
Gefühl der Machtlosigkeit und damit zu<br />
keiner erhöhten bzw. gar verringerter<br />
Bereitschaft, klimafreundlich zu agieren<br />
und kann etwa zu Ethnozentrismus<br />
führen. Der Klimawandelreduktion kann<br />
laut der Studie daher nur durch direktes<br />
Lösungsverhalten beigetragen werden.<br />
Für die Medien selbst lasse sich bezüglich<br />
der Verantwortung, wie Reitan beschreibt,<br />
zwar eine gewisse Bringschuld<br />
unterzeichnen, die Holschuld, die publizierten<br />
Inhalte aufzunehmen, liege aber<br />
bei den StaatsbürgerInnen. „Diejenigen<br />
KollegInnen, die die Massenmedien inhaltlich<br />
gestalten, haben sicherlich eine<br />
8<br />
Umweltkrisenberichterstattung - überbewertet oder Zukunft?
Verantwortung, allerdings eine beschränkte<br />
– lediglich eine Mitverantwortung<br />
– und keine vollständige“, erläutert<br />
Reitan, der sich stark mit Nachhaltigkeitskommunikation<br />
beschäftigt.<br />
Lösungsorientiert statt<br />
angstschürend<br />
Bei GLOBAL 2000 sei das richtige Framing<br />
ein häufig diskutierter Aspekt, damit<br />
die Themen auch wirklich bei den<br />
Menschen ankommen. Die ökosoziale<br />
Steuerreform, welche klimaschädliches<br />
Verhalten besteuert, lasse sich durch<br />
das negativ behaftete Wort „Steuern“<br />
nur schwierig kommunizieren. Daher<br />
sei es essentiell, in diesem Zusammenhang<br />
den Ökobonus als Bonus für klimafreundliches<br />
Handeln zu nennen. Es gehe<br />
nicht darum, Themen herunterzuspielen,<br />
sondern diese beim Namen zu nennen.<br />
„Wir verwenden das Wort ‚‚Klimawandel‘<br />
nicht mehr, sondern‚‚Klimakrise‘, weil es<br />
ist eine Krise und so muss sie behandelt<br />
und kommuniziert werden“, veranschaulicht<br />
Viktoria Auer. Ebenso wichtig sei<br />
das lösungsorientierte Kommunizieren<br />
in Richtung einer positiven Zukunft,<br />
merkt sie an: „Ich finde, es könnte da<br />
mehr positiv kommuniziert werden, dass<br />
klimafreundliche Maßnahmen nicht immer<br />
gleich Verzicht sind und nicht immer<br />
gleich negativ.“ Bezugnehmend auf die<br />
Mediatisierung von Umweltkrisen schildert<br />
Auer, dass punktuelle Umweltkrisen<br />
wie Fukushima oder die Deepwater Horizon-Ölkatastrophe<br />
in den Medien stark<br />
kommuniziert werden und das Bewusstsein<br />
für das Krisenausmaß hier auch bei<br />
der Bevölkerung bestehe. Schwierig zu<br />
kommunizieren, aber umso wichtiger,<br />
seien die langfristigen Umweltkrisen<br />
wie die Klima- oder Biodiversitätskrise.<br />
„Langfristig gesehen sind das die zwei<br />
großen Krisen, die uns als Menschheit<br />
beschäftigen müssen, weil sie uns mehr<br />
bedrohen als die kurzfristigen“, erklärt<br />
Auer. Besonders in diesem Bereich sei<br />
die Mediatisierung und umfassende Berichterstattung<br />
ausschlaggebend, um die<br />
langfristigen, existenzbedrohenden Auswirkungen<br />
zu vermitteln. Gerade in Krisenzeiten,<br />
wie während der Coronakrise,<br />
lasse sich jedoch die ernüchternde Bilanz<br />
ziehen, dass Umweltthemen kurzfristig<br />
untergehen.<br />
Claus Reitan betrachtet die „massenmedial<br />
vermittelte Auswahl und Verbreitung<br />
umweltbezogener Themen“ als<br />
durchaus berechtigte und wesentliche<br />
Aufgabe der klassischen Massenmedien.<br />
„Das kann man aus der Sicht des Themas,<br />
des Problems heraus, egal welcher<br />
Weltanschauung man ist, für angemessen<br />
und sachlich richtig erachten“, betont<br />
Reitan. Insbesondere seit den 1980er<br />
Jahren gebe es eine intensive Ausein-<br />
andersetzung mit Umweltthemen in<br />
Öffentlichkeit, Gesellschaft und Politik.<br />
Von einer intensiven und umfangreichen<br />
Gesetzgebung, konkreten Initiativen aus<br />
Unternehmenskreisen und der Industrie,<br />
Initiativen direkt aus der Zivilgesellschaft<br />
über verschiedenste Auszeichnungen,<br />
Zertifikate oder einschlägige Literatur<br />
wie den CSR-Report mangele es nicht<br />
an Bemühungen in Richtung mehr Nachhaltigkeit.<br />
Entscheidend sei aber, diese<br />
Maßnahmen anhand von Maßstäben<br />
zu betrachten, um die unterschiedlichen<br />
Themen konkret beurteilen zu können<br />
und gegebenenfalls weitere Schritte zu<br />
setzen. Im Zusammenhang mit der Mediatisierung<br />
von Umweltkrisen sind auch<br />
ethische Fragestellungen und die Emotionalisierung<br />
der RezipientInnen ein nicht<br />
zu übersehender Aspekt. Das Paradebeispiel<br />
schlechthin sei Greta Thunberg mit<br />
ihrer „Fridays for future“-Bewegung, die<br />
das große Thema Klimakrise mit einer<br />
enormen Wirksamkeit in Medien und Gesellschaft<br />
einbringen konnte. Zuvor seien<br />
lange Zeit keine Gegenmaßnahmen gesetzt<br />
und die Klimakrise eher zugespitzt<br />
worden, obwohl es in keinster Weise an<br />
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu<br />
den negativen Folgen mangelte. Erst als<br />
das Thema mehr Anklang in den Medien<br />
fand, sei es zu einer stärkeren Lösungsorientierung<br />
gekommen. „Wie wir<br />
wissen, sind Menschen keine rational<br />
denkenden und handelnden Lebewesen“,<br />
untermauert Auer die Bedeutsamkeit<br />
der Emotionalisierung. Kontraproduktiv<br />
sei es aber, in Richtung Angst zu kommunizieren,<br />
da das nur zum Abblocken<br />
der Menschen führt. Der Aufmerksamkeitswettbewerb<br />
stehe bezüglich der<br />
Ausrichtung der verschiedenen Medienangebote<br />
und -produkte an erster Stelle<br />
und führe teilweise dazu, dass zu drastischen<br />
und nach ethischen Grundsätzen<br />
unzulässigen Mitteln gegriffen werde,<br />
erklärt Reitan. Die Aufgabe der Medien<br />
bestehe aber darin, die Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge<br />
der Umweltkrisen<br />
zu recherchieren, dabei aber nicht<br />
über das Ziel hinauszuschießen und zu<br />
überzogenen Darstellungen zu greifen.<br />
„Hochwasserschutz“ im Journalismus<br />
Mit der journalistischen Funktion, Wirklichkeit<br />
zu erkennen und zu vermitteln,<br />
seien auch in Österreich viele JournalistInnen<br />
intensiv betraut, weiß Reitan:<br />
„Hier wird sehr viel an Initiativen, an Berichterstattung<br />
gesetzt. Druck zu machen<br />
ist nicht vorrangige Aufgabe des<br />
unabhängigen Journalismus, sondern die<br />
Erste ist, eine tatsächliche Wirklichkeit<br />
objektivierbar zu erkennen und getreulich<br />
zu vermitteln, sprich eine Berichterstattung<br />
zu betreiben.“ Von der rein<br />
sachlichen Berichterstattung zu unterscheiden<br />
seien Kommentare, wobei Rei-<br />
Umweltkrisenberichterstattung - überbewertet oder Zukunft?<br />
9
tan hierbei „zu wenig an Einordnung, an<br />
Erläuterung, an Kommentierung, an Ausleuchten,<br />
Beleuchten von Hintergründen<br />
und von Zusammenhängen, insbesondere<br />
an den Wirtschafts- und Politikseiten<br />
und -ressorts“ erkennt. Je nach<br />
Medium seien einerseits gattungsspezifische<br />
Unterschiede und andererseits<br />
Differenzen bezüglich der inhaltlichen<br />
Fokussierung und Themenschwerpunkte<br />
bei Umwelt- und Nachhaltigkeitsthematiken<br />
zu erkennen. Hierbei lasse sich<br />
das Symbolbild des Dreiecks, in welchem<br />
sich alle Medien bewegen, anwenden,<br />
welches sich aus den Eckpunkten der<br />
grundlegenden Richtung, dem Nachrichtenaufkommen<br />
sowie der Zielgruppe<br />
des Mediums zusammensetzt. So werde<br />
in Boulevardtiteln wie „Österreich“ die<br />
Themenauswahl eher ereignisbezogen<br />
und in Richtung der klassischen Katastrophenberichterstattung<br />
getroffen,<br />
während sich in der „Furche“ vergleichsweise<br />
hintergründigere, tiefergehende<br />
Texte fänden. Mit dem Gebot der Objektivität<br />
werde es begründet, wenn etwa<br />
in Studiodiskussionen zum Klimawandel<br />
zwei Stimmen vertreten sind: die des/<br />
der Klimawandelbefürworters/in und die<br />
des/der Klimawandelleugners/in. Das<br />
Problem hierbei sei aber, dass das objektive<br />
Verhältnis von BefürworterInnen<br />
und LeugnerInnen nicht 1:1 sei, sondern<br />
Claus Reitan / Copyright: Formanek, Wien<br />
unter WissenschaftlerInnen eher 97:3,<br />
da es mehr Klimawandelbefürworter-<br />
Innen als -gegnerInnen gäbe. Dieses<br />
Phänomen lasse sich auch als „Balance<br />
as Bias“ bezeichnen, wie das Problem<br />
in der Darstellung und Vermittlung von<br />
Umwelthemen, und insbesondere des<br />
Klimawandels, subsummiert werde.<br />
Gerade deshalb ist für Reitan eine differenzierte<br />
Betrachtungsweise ausschlaggebend.<br />
„Die Thematik der Nachhaltigkeit JournalistInnen<br />
nahe zu bringen, stößt auf ein<br />
generelles Thema, nämlich die Aus- und<br />
Fortbildung im Journalismus in Österreich“,<br />
erläutert Reitan und betont, dass<br />
ein inhaltlicher Bedarf an Aus- und Fortbildungsangeboten<br />
bestehe. „Das ist insofern<br />
schwierig, als zum Teil zu wenig<br />
Geld zur Verfügung steht, die öffentliche<br />
Hand ist hier nachlässig, die Budgets<br />
sind unzureichend. Zum Teil steht zu<br />
wenig Zeit zur Verfügung für die KollegInnen<br />
in den Medienunternehmen, und<br />
freiberufliche JournalistInnen haben aus<br />
eigenem weder die Zeit noch das Geld.“<br />
Konkret seien sowohl der Bundeshaushalt<br />
und die Bundesregierung als auch<br />
die Medienunternehmen gefordert,<br />
JournalistInnen mehr Möglichkeiten der<br />
Fortbildung in jeweils neuen Themenfeldern<br />
zu bieten. „In Österreich geht<br />
Viktoria Auer / Copyright: Stefan Wyckoff<br />
gerade viel mehr voran als in den letzten<br />
paar Jahren, gar Jahrzehnten, zum Glück,<br />
und das ist natürlich auch teilweise auf<br />
den medialen Druck hinzuführen“, erklärt<br />
sich Auer die Fortschritte in der Nachhaltigkeitsthematisierung.<br />
Wenig Verbesserungsbedarf<br />
erkenne Reitan allerdings<br />
betreffend das breit gefächerte Angebot<br />
an Wissen, Informationen sowie einschlägigen<br />
Instituten und Studiengängen.<br />
Eine grüne Zukunft?<br />
Zukünftig sieht Viktoria Auer den Umwelt(krisen)journalismus<br />
vor allem in<br />
der Herausforderung, alle Bevölkerungsschichten<br />
zu erreichen und diverse Medien<br />
mit seinen Inhalten zu bespielen. Für<br />
Umweltschutzorganisationen wie GLO-<br />
BAL 2000 stelle die Zusammenarbeit mit<br />
verschiedenen Medien wie Bezirks- oder<br />
Bauernzeitungen eine Möglichkeit dar,<br />
„auch in anderen Medien die Bevölkerung<br />
zu erreichen, die nicht spezifisch<br />
immer Umweltkrisenberichterstattung<br />
bringen“, merkt Auer an. Besonders in<br />
Bezirkszeitungen sei die Kommunikation<br />
eines positiven Bildes in Bezug auf<br />
Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen,<br />
vor allem in der eigenen Region, beliebt,<br />
und werde von diesen dementsprechend<br />
angenommen. Aufgrund eigener Beobachtungen<br />
kann Reitan sagen, dass die<br />
Umweltthematiken „zunehmend stärker<br />
ins Blickfeld geraten“ und auch in die<br />
Unternehmen bis zur Geschäftsführung<br />
voranschreiten. Als erschöpft sieht der<br />
Journalist die Zukunft für diverse Umweltsonderseiten<br />
bzw. -sendungen an.<br />
Ein Umdenken sei allerdings bei vielen<br />
JournalistInnen in den Redaktionen zu<br />
erkennen, Umwelt- und Ökologiethemen<br />
auch stärker in Politik- und Wirtschaftsberichterstattung<br />
miteinzubeziehen.<br />
Reitan hält fest: „Journalismus zum Thema<br />
Umwelt, zu Themen der Nachhaltigkeit<br />
hat nicht nur objektivierbar seine Berechtigung,<br />
sondern auch eine Zukunft<br />
und findet zunehmend ein breiteres Betätigungsfeld<br />
vor.“<br />
von Julia Allinger<br />
© Copyright: adobe stock / DisobeyArt<br />
10<br />
Umweltkrisenberichterstattung - überbewertet oder Zukunft?
MEHR ALS<br />
IRGENDWAS<br />
MIT MEDIEN.<br />
Langjährige Erfahrung in der vielfältigen Multi-Screen-Vernetzung und die<br />
stetige Erweiterung um neue innovative Produkte machen uns zu einem<br />
Kompetenzzentrum bei der Vermarktung elektronischer und digitaler Medien.<br />
Goldbach setzt den Fokus auf:<br />
TV. Online. Mobile. Advanced TV. Digital Out of Home.<br />
www.goldbach.com<br />
11
Das wirtschaftliche<br />
Standing professioneller<br />
Fotografie<br />
Die professionelle Fotografie steht unter Druck. Technologische Neuheiten,<br />
die Allgegenwärtigkeit der Smartphones und die dazugehörigen Fotofilter<br />
ermöglichen es auf simple Weise professionell aussehende Fotos zu<br />
schießen. Doch wie rechtfertigt die Berufsfotografie ihr Dasein und wie<br />
kann man mit den heutigen Herausforderungen umgehen? <strong>SUMO</strong> sprach<br />
mit Univ.-Prof.in Maria Ziegelböck, Leiterin der Abteilung „Angewandte<br />
Fotografie und zeitbasierte Medien“ an der Universität für angewandte<br />
Kunst Wien, und mit Anna Obermeier, selbstständige Meisterfotografin<br />
aus Wien, über Chancen, Gefahren und mögliche Todesstöße.<br />
Das Fenster zur Welt<br />
November in Wien. Einer der ersten Sonnentage<br />
seit langem. Der Park ist gut<br />
besucht, vor allem Pärchen flanieren gemächlich<br />
die Wege entlang. Immer wieder<br />
bleiben sie stehen, einer zückt das<br />
Smartphone, der oder die Andere wirft<br />
sich in Pose. Das Licht ist gut, das Outfit<br />
durchdacht und das Lächeln geübt.<br />
Mit Blick auf den Bildschirm nimmt der<br />
oder die Andere verschiedene Winkel ein,<br />
einmal seitlich, einmal von unten, einmal<br />
Nahaufnahme. Die Models scheinen zufrieden,<br />
doch nur bis zum nächsten Objekt,<br />
das etwas herzugeben verspricht.<br />
Szenen wie diese erinnern an die klassischen<br />
Fotoshootings, für die früher viel<br />
Aufwand betrieben wurde. Doch statt<br />
FotografInnen sind es PartnerInnen –<br />
und statt Kameras sind es Smartphones.<br />
Der Wunsch nach dem eigenen Abbild<br />
ist seit Menschengedenken vorhanden.<br />
Bereits vor dem Aufkommen der Fotografie<br />
war es der Job von MalerInnen<br />
Personen zu verewigen. Doch erst dank<br />
der Fotografie war es zum ersten Mal<br />
möglich, Menschen so abzubilden, wie<br />
sie tatsächlich aussahen. Diese Entwicklung<br />
hat die Welt nachhaltig verändert.<br />
1888 kam die Kodak Nr. 1 auf den Markt,<br />
sie galt als handlich, bedienerfreundlich<br />
und leistbar. Bis heute wird diesem<br />
Modell nachgesagt, sie habe den Beginn<br />
der Amateurfotografie eingeleitet. Sie<br />
ermöglichte den Menschen einen Blick<br />
in weit entfernte Gegenden und Gesellschaften<br />
und ließ räumliche und zeitliche<br />
Grenzen verschwinden. Seitdem hat<br />
sich die Fotografie in viele verschiedene<br />
Richtungen entwickelt. Dank der technologischen<br />
Fortschritte der letzten Jahre<br />
ist es beinahe jedem Menschen möglich,<br />
beliebig viele Fotos zu schießen, deren<br />
Qualität einst undenkbar gewesen wäre.<br />
Auch für Univ.-Prof.in Maria Ziegelböck<br />
ist klar, dass mit der digitalen Wende das<br />
Medium Fotografie völlig demokratisiert<br />
worden sei. Fotografie sei für viele zugänglich<br />
und die technische Hürde gebe<br />
es nicht mehr, welche bis in die 1990er<br />
Jahre jedoch als eine Kernkompetenz der<br />
FotografInnen gegolten hatte. Laut Ziegelböck<br />
habe man in den 1980ern schon<br />
von einer Bilderflut geredet, doch mittlerweile<br />
sei daraus eine eigene Sprache<br />
geworden. Man könne nichts mehr ohne<br />
Bild kommunizieren, daher sei die Fotografie<br />
eine eigene Art der Kommunikation<br />
geworden, erklärt sie.<br />
Herausforderungen an die Professionalität<br />
– oder Todesstoß?<br />
Doch genau diese neuen Entwicklungen<br />
könnten sich als Gefahr für professionelle<br />
BerufsfotografInnen herausstellen, denn<br />
© Copyright: adobe stock / lassedesignen<br />
12<br />
Das wirtschaftliche Standing professioneller Fotografie
die Tatsache, dass Smartphones bereits<br />
Kameras mit beachtlicher Qualität standardmäßig<br />
eingebaut haben führt zu<br />
einer überwältigenden Anzahl an „schönen“<br />
Bildern und lässt die Frage aufkommen,<br />
ob der Beruf des/der Fotografen/<br />
in noch zeitgemäß ist. Das Smartphone<br />
sei laut Ziegelböck nicht mehr nur eine<br />
zusätzliche Kamera, sondern ein ganzes<br />
Editing-Programm. Dadurch sei es leichter<br />
geworden, ein – zumindest an der<br />
Oberfläche – gut funktionierendes Foto<br />
herzustellen. Zusätzlich könne jedes Bild<br />
entweder dem Mainstream oder dem<br />
eigenen persönlichen Geschmack angepasst<br />
werden. Die Nachbearbeitung sei<br />
jetzt schon von großer Bedeutung und<br />
werde in Zukunft noch steigen.<br />
Die Bearbeitung von Fotos ist keineswegs<br />
ein neues Phänomen, man könnte<br />
sagen die Fotobearbeitung ist genauso<br />
alt wie die Fotografie selbst, jedoch hat<br />
sich die Komplexität, und somit auch<br />
der Aufwand, der Bearbeitung so stark<br />
reduziert, dass mittlerweile kein Fachwissen<br />
mehr dafür nötig ist. Adobe Photoshop,<br />
der Klassiker unter den Fotobearbeitungs-Programmen,<br />
geht bei seiner<br />
letzten Version noch einen Schritt weiter.<br />
Angeboten wird ein neuer Filter namens<br />
Neuralfilter, welcher mittels künstlicher<br />
Intelligenz die Mimik einer Person verändern<br />
kann. Somit habe das resultierende<br />
Foto nicht mehr viel mit dem ursprünglichen<br />
Entstehungsprozess zu tun. Laut<br />
Ziegelböck sehe das Ganze jetzt noch<br />
sehr „Frankenstein“-mäßig aus, aber<br />
wenn sich solche Filter weiter in diese<br />
Richtung entwickeln, falle ein ganz wesentlicher<br />
Aspekt des Fotografierens<br />
weg, nämlich einen guten Moment und<br />
die Ausstrahlung einer Person festzuhalten,<br />
denn diese ließen sich dadurch auch<br />
eventuell nachkonstruieren. Sie bezeichnet<br />
diese Art von Filtern als möglichen<br />
„Todesstoß“ für PortraitfotografInnen,<br />
die im Dienstleistungssektor tätig sind.<br />
Denn wenn die Kamera bereits den<br />
Großteil der Arbeit übernimmt, und Bilder<br />
dank Filter und leicht handzuhabenden<br />
Bearbeitungsprogrammen dann<br />
auch noch nach den eigenen Wünschen<br />
nachbearbeitet werden können – warum<br />
dann noch eine externe Person für diese<br />
Tätigkeit bezahlen?<br />
Opfer der Technologie<br />
Man sagt der Berufsfotografie schon<br />
lange nach, sie liege im Sterben. Profifotografin<br />
Anna Obermeier erinnert sich<br />
selbst noch an Aussagen, die sie während<br />
ihrer Fotografie-Ausbildung oft<br />
aufgeschnappt habe, dass der Beruf der<br />
Fotografin ein brotloser sei. Selbst stimme<br />
sie dieser Haltung aber nicht zu. Sie<br />
betont, dass es immer darauf ankäme,<br />
was man mache. Die Berufsfotografie im<br />
Bereich Portrait, Hochzeit etc. empfinde<br />
Das wirtschaftliche Standing professioneller Fotografie 13
© Copyright: adobe stock / Drobot Dean<br />
sie als nicht in der Krise. Ihren KundInnen<br />
sei es wichtig, qualitativ hochwertige<br />
Fotos, vor allem von einmaligen Ereignissen,<br />
zu erhalten und sich darauf verlassen<br />
zu können, dass jemand am Werk<br />
ist, die/der das Beste aus den Situationen<br />
raushole.<br />
Auch Ziegelböck betont, dass nur gewisse<br />
Bereiche der Fotografie den neuen<br />
Technologien zum Opfer fielen. Die Produktfotografie<br />
zum Beispiel sei ein Feld,<br />
bei dem die Kameras bereits jegliche<br />
Arbeit übernehmen. Der Beruf Fotograf/<br />
in sei dadurch um einiges elitärer geworden.<br />
Heute sei es wichtiger denn je,<br />
eine eigene Meinung zu kommunizieren<br />
und eine visuelle und wiedererkennbare<br />
Bildsprache zu haben. Ebenso solle<br />
man die subjektive Sicht präsentieren,<br />
nur so könne man sich noch als originär<br />
behaupten, denn fotografisch gebe es<br />
kaum noch etwas zu erfinden.<br />
Man kann tatsächlich nicht behaupten,<br />
dass das Fotografieren heutzutage an<br />
Stellenwert verloren hat. Dank Social<br />
Media-Plattformen wie „Instagram“,<br />
deren Inhalte aus Bildern und Videos<br />
bestehen, ist ein schönes und eindrucksvolles<br />
Bild für viele UserInnen von hoher<br />
Bedeutung. Obermeier sieht diese Entwicklung<br />
durchaus als Vorteil für Berufs-<br />
fotografInnen, denn die Zahl der Aufträge<br />
könne so steigen, da mehr Personen<br />
Wert auf qualitative, ansprechende Fotos<br />
legen. Von großer Bedeutung bei der<br />
Verbreitung über Social Media sei jedoch<br />
das Copyright der jeweiligen FotografInnen,<br />
für dessen Notwendigkeit es in der<br />
Gesellschaft teilweise noch an Bewusstsein<br />
fehle.<br />
Mehr als das Werkzeug<br />
Bei professioneller Portraitfotografie<br />
geht es darum, das Wesen der Menschen<br />
festzuhalten, einen Moment zu<br />
erwischen, der die Person zeigt, wie sie<br />
ist. Hier stehen zumeist Emotionen im<br />
Vordergrund. Nun ist es möglich Emotionen<br />
mittels Smartphones festzuhalten,<br />
für Obermeier ist jedoch klar, dass<br />
vielen Leuten bewusst sei, dass es für<br />
ein schönes Foto mehr brauche als ein<br />
gutes Smartphone. „Man darf nicht vergessen,<br />
dass es nicht nur das Werkzeug<br />
ist, das das Foto macht, sondern auch<br />
der- oder diejenige, der/die dahintersteht“.<br />
Es müsse mehr dahinterstecken<br />
als eine Person, die in die Kamera lächle,<br />
während eine andere abdrücke. Es gehe<br />
darum, Emotionen zu zeigen und sich<br />
auf zwischenmenschlicher Ebene auszutauschen.<br />
Auch in Zukunft verlasse sich<br />
Obermeier auf den zwischenmenschlichen<br />
Aspekt der Portraitfotografie<br />
– etwa beim Shooting eine gute Atmosphäre<br />
zu schaffen und es dadurch als<br />
Event zu begreifen, für das sich die KundInnen<br />
Zeit nehmen, auf das sie sich vorbereiten<br />
und freuen können. Außerdem<br />
– fügt sie hinzu – beim Shooting Momente<br />
abzulichten, die echt und natürlich<br />
und eben z.B. kein automatisiertes<br />
Lächeln sind. Das bedeute, Seiten und<br />
Aspekte des Gegenübers als „Zwischenmenschlichkeit“<br />
zu entdecken, die nichts<br />
Eingelerntes haben, sondern den Menschen<br />
in seiner Echtheit und Persönlichkeit<br />
zeigen. Dass der Beruf eines Tages<br />
zum größten Teil von automatischen<br />
Kameras oder Robotern übernommen<br />
werde, könne Obermeier aber nicht ausschließen.<br />
Und einige Menschen würden<br />
diese Dienste auch annehmen, aber<br />
wahrscheinlich nicht die Masse. Denn es<br />
gebe genauso Leute, die gerne auf das<br />
„Traditionelle“ zurückgreifen. Es könne<br />
schon sein, dass die Nachfrage etwas<br />
abnehmen könnte, aber „ich glaube, das<br />
ist etwas, mit dem ich mich nicht in naher<br />
Zukunft beschäftigen müsste, eher vielleicht,<br />
wenn ich in Pension bin.“<br />
von Ida Stabauer<br />
Anna Obermeier / Copyright: Kerstin Jahn<br />
© Copyright: adobe stick / Drobot Dean<br />
Maria Ziegelböck / Copyright: Sophie Kirchner<br />
14<br />
Das wirtschaftliche Standing professioneller Fotografie
Krisen im Schattendasein der Medien<br />
Im größten Flüchtlingslager der Welt Kutupalong sitzen 860.000 Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch fest<br />
(Stand 23.10.2020, UNHCR). Seit Jahren bombardiert Saudi-Arabien jemenitische Schulen und Krankenhäuser,<br />
während die jemenitische Regierung im Exil sitzt. Warum werden diese Krisen in den Massenmedien kaum<br />
behandelt und welche Folgen ergeben sich daraus? <strong>SUMO</strong> versucht Licht auf diesen unbeachteten Schatten zu<br />
werfen und sprach dazu mit Politikwissenschaftler Thomas Schmidinger und „Südwind“-Chefredakteur Richard<br />
Solder.<br />
© Copyright: Karin Pargfrieder<br />
Es ist stockfinster. Durch den Stromausfall<br />
erhoffen sich Behörden ein Ende der<br />
Proteste gegen die Regierung. Plötzlich<br />
beginnen Menschen in die Hände zu<br />
klatschen. Junge Menschen schaffen<br />
mit ihren Mobiltelefonen das einzige<br />
Licht im Vorort Khartums, der Hauptstadt<br />
des Sudans. In ihrer Mitte rezitiert<br />
und improvisiert ein junger Mann Protestgedichte,<br />
während er von den Mobiltelefonen<br />
beleuchtet wird. Yasuyoshi<br />
Chiba, ein japanischer „Agence France<br />
Press“-Fotograf, hält diesen Moment<br />
des friedlichen Protests mit seiner Kamera<br />
fest. 16 Monate später hängt dieser<br />
Moment als „World Press“-Siegerfoto<br />
im „Westlicht-Museum“ in Wien.<br />
Die Kühlanlage läuft im Hintergrund des<br />
offenen Ausstellungsraumes, in dem<br />
BesucherInnen fast andächtig von Bild<br />
zu Bild schlendern und angeregt über<br />
die dargestellten Situationen flüstern.<br />
Die Ticketverkäuferinnen kichern und<br />
unterhalten sich, was beinahe zu einer<br />
willkommenen Entspannung der tiefgründigen<br />
Atmosphäre im Raum führt.<br />
Auch Andrea ist mit ihrer Freundin hier.<br />
Sie hat den letzten Tag vor dem zweiten<br />
Lockdown genutzt, um die „World<br />
Press Photo“-Ausstellung zu besuchen.<br />
„Ich mache eigentlich alles immer am<br />
letzten Drücker. Ich bin hier, um mir bewusst<br />
zu machen, was in der Welt sonst<br />
noch so passiert.“ Über die Unruhen im<br />
Sudan, auf die der Fotograf mit seinem<br />
Bild aufmerksam machen wollte, habe<br />
sie noch nie etwas gehört. „Vielleicht<br />
lag es auch an Corona? Vielleicht sind<br />
wir dadurch einfach stumpf geworden<br />
gegenüber anderen Krisen?“<br />
Schauplatz Sudan<br />
Der Berichterstattungsvirus hat die<br />
Massenmedien am Beispiel vom Sudan<br />
nicht langfristig erreicht. Er ist schnell<br />
weitergezogen. Die Anzahl der APA-<br />
Pressemeldungen zeigt ein Bild des<br />
Vergessenwerdens einer Krise, die laut<br />
Thomas Schmidinger (u.a. Univ. Wien)<br />
nach dem Juni 2019 noch lange nicht<br />
vorbei gewesen sei. Dabei zeigen die<br />
Daten im Diagramm nicht nur Meldungen<br />
über Proteste oder Krisenthemen<br />
des nordostafrikanischen Landes, sondern<br />
sämtliche APA-Basisdienst-Meldungen,<br />
die den Suchbegriff „SUDAN“<br />
enthalten.<br />
Im Dezember 2018 beginnen Proteste<br />
gegen die sudanesische Regierung (1).<br />
Als im April 2019 der Präsident Al-Bashir<br />
nach 30 Jahren an der Macht vom<br />
Militär gestürzt wird (2) und 100 der<br />
friedlichen DemonstrantInnen getötet<br />
werden (3), ist das Medienecho groß.<br />
Doch die Krise sei laut Schmidinger<br />
noch lange nicht vorbei. Seit September<br />
2019 ist eine Übergangsregierung<br />
aus Regime, Oppositionsparteien und<br />
Militärregime an der Macht (4). Zen-<br />
trale Ereignisse seien auch die Friedensverhandlungen<br />
mit verschiedenen<br />
Guerillabewegungen (5) im Frühjahr<br />
2020 gewesen. Außerdem ist der Sudan<br />
stark von Corona betroffen (6) und<br />
seit Nilfluten (7) im September 2020<br />
sind zehntausende Menschen obdachlos.<br />
Dazu fliehen seit November 2020<br />
zehntausende Menschen aus dem Norden<br />
Äthiopiens vor dem Bürgerkrieg in<br />
Tigray in den Sudan (8), wo die humanitäre<br />
Situation bereits mehr als angespannt<br />
ist. Obwohl zentrale Ereignisse<br />
nach dem Sommer 2019 passierten,<br />
war die Resonanz in den Medien verschwindend<br />
gering.<br />
So nah und doch so fern<br />
In der Nachrichtenwerttheorie werden<br />
verschiedenen Faktoren definiert,<br />
die den Wert und darüber hinaus die<br />
„Wichtigkeit“ der Nachricht bestimmen.<br />
Der Nachrichtenfaktor „Nähe“ bezieht<br />
sich auf die räumliche, politische und<br />
kulturelle Nähe der RezipientInnen zu<br />
einer Nachricht. Wenn der Inhalt nah<br />
Thema<br />
Krisen im Schattendasein der Medien<br />
15
© Copyright: adobe stick / sakura<br />
genug am Leben der RezipientInnen<br />
sei, würde der Wert der Nachricht also<br />
steigen. Geografisch liegt Washington<br />
D.C. mit 7.126 km Luftlinie fast doppelt<br />
so weit entfernt wie die sudanesische<br />
Hauptstadt Khartum mit 3.917<br />
km. Doch in unseren Kinofilmen feiern<br />
James und Mary Thanksgiving in den<br />
USA und nicht Abdul-Aziz und Nemat<br />
Mawlid das Ende des Ramadans – Eid<br />
al Fitr – im Sudan.<br />
„Mit den USA verbindet uns sehr vieles.<br />
Wenn dort bewaffnete DemonstrantInnen<br />
auf die Straße gehen, gibt es eine<br />
gefühlte kulturelle Verbindung. Diese<br />
führt dazu, dass wir Nachrichten darüber<br />
rezipieren. Wenn in einem afrikanischen<br />
Land ein Bürgerkrieg ausbricht,<br />
verbindet man in Österreich sehr wenig<br />
damit und so schafft es dieser überhaupt<br />
nicht in die Schlagzeilen.“ Schmidinger<br />
fügt jedoch hinzu: „Selbst, wenn<br />
wir nie in den USA waren, glauben wir<br />
das Leben dort zu kennen. Real tun wir<br />
das nicht. Ich habe ein Jahr in den Vereinigten<br />
Staaten gelebt und finde die<br />
These, dass die USA uns kulturell näher<br />
sind als Nordafrika mehr als diskussionswürdig.“<br />
Richard Solder, Chefredakteur des von<br />
der gleichnamigen österreichischen<br />
NGO publizierten Magazins „Südwind“<br />
konstatiert, dass die gefühlte Distanz<br />
auch durch die fehlende Berichterstattung<br />
über Themen des globalen<br />
Südens untermauert werden würde.<br />
Man könne das Angebot auch anders<br />
formen, Nachrichtenwerte in Themen<br />
dieser Länder finden und RezipientInnen<br />
darüber informieren. „Da würde<br />
ich schon auch die Massenmedien in<br />
die Verantwortung nehmen, dass man<br />
hier mehr in andere Richtungen blicken<br />
könnte. Das klassische ‚Was ist los in<br />
Washington?‘ wird genug abgedeckt.“<br />
Neben der gefühlten Distanz nennt<br />
Politologe Schmidinger weitere Faktoren,<br />
die es Krisen schwer machen, in<br />
den Massenmedien diskutiert zu werden.<br />
Einerseits sei es von Bedeutung,<br />
ob österreichische JournalistInnen oder<br />
WissenschaftlerInnen eine Expertise zu<br />
betroffenen Gebieten hätten und andererseits,<br />
inwieweit seriöse Quellen<br />
verfügbar oder eine Reise in betroffene<br />
Gebiete möglich sei. „Ich wollte selbst<br />
auch einmal in den Jemen während des<br />
Bürgerkriegs. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.<br />
In Syrien und Libyen war<br />
es kein Ding der Unmöglichkeit. Das ist<br />
dann eine ganz andere Intensität der<br />
Berichterstattung, wenn ich vor Ort<br />
berichten kann.“ Jedoch sei nicht jeder<br />
Journalismus vor Ort tatsächlich gründlich<br />
recherchiert. Er habe es selbst im<br />
Libyenkrieg erlebt, als er sich in Benghazi<br />
in einem kleinen Altstadthotel niederließ,<br />
wohingegen der Großteil der internationalen<br />
JournalistInnen in einem<br />
5-Stern-Hotel untergebracht waren.<br />
Während er mit Menschen auf der Straße<br />
sprach, wurden die Fernsehbeiträge<br />
internationaler TV-Stationen von den<br />
Balkonen des Hotels gefilmt und sogenannte<br />
„Fixer“ bezahlt, um „Betroffene“<br />
in das Hotel zu bringen und Geschichten<br />
zu erzählen. „Das ist dann so ein<br />
Kriegsberichterstatter-Zirkus, der um<br />
die Welt geht. Das meine ich nicht mit<br />
Journalismus vor Ort.“<br />
Folgen des Schattendaseins<br />
Medien tragen durch ihre primäre<br />
Funktion der Information dazu bei, Unkenntnis<br />
zu verringern. Doch was geschieht,<br />
wenn die Unkenntnis bleibt?<br />
„Es ist wichtig, dass berichterstattet<br />
wird, um zu wissen, was passiert und<br />
wie geholfen werden kann. So wird die<br />
Aufmerksamkeit auf die Region gelenkt<br />
und Organisationen können etwa einsteigen,<br />
um Soforthilfe anzubieten“,<br />
fordert Solder. Darüber hinaus würde<br />
weltweite Diplomatie Konflikten entgegenwirken<br />
und bei Menschenrechtsverletzungen<br />
zum Eingreifen des internationalen<br />
Strafgerichtshofs führen.<br />
Solder unterstreicht, dass Medien nicht<br />
nur während der Krise vor Ort sein sollten,<br />
sondern auch den Prozess danach<br />
begleiten müssten. Dabei verweist er<br />
als ein Beispiel auf den Genozid in Ruanda<br />
von 1994. Man solle für die Men-<br />
Richard Solder / Copyright: Südwind<br />
schen vor Ort dranbleiben, um ihnen<br />
durch Aufklärung und Information Perspektiven<br />
zu bieten. In Ruanda habe die<br />
derzeitige politische und gesellschaftliche<br />
Situation immer noch mit den<br />
Ereignissen von 1994 zu tun, es gebe<br />
noch immer Probleme und Herausforderungen,<br />
die auf den Genozid vor mehr<br />
als 25 Jahren zurückzuführen seien.<br />
Wenn Ruanda heute in Wirtschaftsmedien<br />
als afrikanisches Vorzeigeland und<br />
Wirtschaftsmotor der Region bezeichnet<br />
werde, sollte nicht vergessen werden,<br />
dass die Bevölkerung noch immer<br />
nicht in einer Demokratie lebt und die<br />
Folgen der Krisen von einst bis heute<br />
mitschwingen. „Wenn Länder oder Regionen<br />
aus dem Fokus geraten, etwa<br />
wenn eine akute Krise vorüber ist, verliert<br />
man die weitere Entwicklung aus<br />
den Augen“, konstatiert Solder. Wenn<br />
Krisen durch mangelnde Berichterstattung<br />
gar nicht erst in den Fokus geraten,<br />
sei es laut Schmidinger schwierig,<br />
diese plötzlich zum Thema zu machen.<br />
Dann müssten sich JournalistInnen<br />
eingestehen, dass man ein wichtiges<br />
Thema bisher „versemmelt“ habe. Man<br />
müsse den LeserInnen erklären, was<br />
jetzt plötzlich der Nachrichtenwert sei<br />
von einem Konflikt, den es schon jahrelang<br />
gibt und über den bisher nicht<br />
berichtet wurde. Im Nachhinein sei es<br />
fast unmöglich, eine Verbindung herzustellen.<br />
„Wenn jetzt plötzlich 100.000<br />
JemenitInnen nach Europa fliehen,<br />
dann bin ich mir sicher, dass der Jemen<br />
ein Thema werden würde und<br />
dass sich JournalistInnen im Nachhinein<br />
in den Konflikt einlesen würden.“<br />
So würde eine bisher vergessene Krise<br />
in das Scheinwerferlicht gerückt<br />
werden. „Ansonsten plätschert das<br />
einfach vor sich hin. Die Saudis bombardieren<br />
weiter Spitäler und Schulen,<br />
die Huthi-Rebellen kontrollieren weiter<br />
den Norden des Landes und die jemenitische<br />
und international anerkannte<br />
Regierung sitzt weiterhin im saudischen<br />
Exil.“ Solange keine Verbindung<br />
vorhanden sei, wäre für Massenmedien<br />
auch kein Nachrichtenwert vorhanden.<br />
16<br />
Thema Krisen im Schattendasein der Medien
Wo weht der Wind in eine andere<br />
Richtung<br />
Die klassischen Nachrichtenwerte sind<br />
für das „Südwind“-Magazin nicht der<br />
einzige Orientierungspunkt, sagt dessen<br />
Chefredakteur: „Wir versuchen,<br />
Menschen aus dem globalen Süden<br />
eine Stimme zu geben, diese in Szene<br />
zu setzen und zu zeigen, was man<br />
sonst nicht oft sieht“. Das Magazin erscheint<br />
sechsmal im Jahr in Print und<br />
einmal im Monat via E-Mail-Newsletter<br />
aus der Redaktion. Es berichtet über<br />
Themen im Bereich der internationalen<br />
Politik, Kultur und Entwicklung. Auch<br />
wenn „Südwind“ bewusst nicht nur<br />
über Krisen berichten wolle, sehe man<br />
es als Auftrag hinzusehen, wenn der<br />
Fokus der großen Medien weg ist. Auf<br />
die Frage, unter welchen Umständen<br />
„Südwind“ die Berichterstattung auf<br />
Krisen lenke, meint Solder, dass das<br />
immer auch vom Anlassfall abhängig<br />
Thomas Schmidinger / Copyright: Privat<br />
sei. „Wir schauen einerseits, dass wir<br />
jemanden vor Ort oder in der Region<br />
haben und greifen nicht auf Agenturmeldungen<br />
zurück.“ Außerdem würde<br />
man die Themen auch danach aussuchen,<br />
dass sie in den zweimonatlichen<br />
Rhythmus passen. „Mitunter warten<br />
wir bestimmte Themen, etwa sehr<br />
dynamische Entwicklungen, bewusst<br />
ab und befassen uns damit, wenn die<br />
Massenmedien sie nicht mehr im Fokus<br />
haben.“ So blickte „Südwind“ auf<br />
die Waldbrände in Brasilien 2020, als<br />
große Medien sie schon wieder nicht<br />
mehr behandelten. „Südwind“ würde<br />
erst nach dem großen Medienecho<br />
genauer hinsehen: „Wie geht es jetzt<br />
weiter? Was machen die Menschen<br />
vor Ort?“ Dann sei es auch wichtig,<br />
Perspektiven für die Betroffenen zu<br />
schaffen. Die Jänner/Februar-Ausgabe<br />
2021 beschäftigt sich u.a. mit der<br />
Situation der Rohingya-Flüchtlinge, die<br />
zwischen Bangladesch und Myanmar<br />
im größten Flüchtlingslager der Welt<br />
feststecken. „Das ist ein ganz wichtiges<br />
Thema, wo viele Menschen vertrieben<br />
worden sind, das aber bei uns in Österreich<br />
quasi nicht vorkommt. Da sehen<br />
wir es als unseren Auftrag, dort hin zu<br />
schauen.“<br />
Das Europäische Amt für Humanitäre<br />
Hilfe (ECHO) veröffentlicht im jährlich<br />
erscheinenden „Forgotten Crisis<br />
Assessment“ eine Liste vergessener<br />
Krisen. ECHO spricht von einer vergessenen<br />
Krise, wenn die Faktoren<br />
Naturkatastrophe oder kriegerische<br />
Auseinandersetzung, eine besonders<br />
verwundbare Bevölkerung, geringes<br />
Hilfevolumen und wenig mediale Berichterstattung<br />
zutreffen. Im weltweiten<br />
Krisenjahr 2020 fanden sich Afghanistan,<br />
Algerien, Bangladesch, Burundi,<br />
Haiti, Kolumbien, Myanmar, Pakistan,<br />
Philippinen, die Sahelzone, Sudan, Ukraine,<br />
Venezuela, Zentralafrikanische<br />
Republik und Zentralamerika auf der<br />
Liste der „Vergessenen Krisen“ und<br />
NICHT in den Schlagzeilen der globalen<br />
Medienberichterstattung wieder.<br />
von Karin Pargfrieder<br />
© Copyright: adobe stick / Anas alhajj - Yemen<br />
Krisen im Schattendasein der Thema Medien<br />
17
„Reporter ohne Grenzen“ – oder doch mit?<br />
Ob autoritäre Regime, Populismus oder Kriege, Gründe für die weltweite Unterdrückung von Presse- und<br />
Meinungsfreiheit gibt es zur Genüge. Um diese Problematik zu beleuchten und mögliche Lösungen zu finden,<br />
sprach <strong>SUMO</strong> mit Martin Staudinger, Kriegsreporter und ehemaliger Auslandsressortleiter bei „Profil“,<br />
mittlerweile bei der Wochenzeitung „Falter“ angestellt, über seine persönlichen Erfahrungen, sowie mit<br />
Renan Akyavas, der Programmkoordinatorin des International Press Institutes (IPI), zuständig für die Türkei.<br />
Wirft man einen Blick auf die Statistik<br />
von „Reporter ohne Grenzen“ vom Jahr<br />
2020, wird deutlich, dass knapp der<br />
Hälfte der Weltbevölkerung der Zugang<br />
zu objektiver und unabhängiger Information<br />
fehlt. Die Türkei, auf Rang 154<br />
und Syrien, auf 174, sind somit von den<br />
insgesamt 180 aufgelisteten Ländern<br />
Teil des unteren Viertels. Doch was sind<br />
die Gründe dafür? Syrien ist seit langem<br />
gezeichnet von Krieg und Unterdrückung,<br />
und zwar auch die Medienlandschaft.<br />
In den von der syrischen<br />
Regierung kontrollierten Gebieten des<br />
Landes herrscht ein Medienmonopol,<br />
nämlich die Nachrichtenagentur<br />
„SANA“. Auch die neutralste Publikation<br />
von Fakten, beispielsweise die Erhöhung<br />
der Treibstoffpreise, kann zu einer<br />
Haftstrafe führen.<br />
Eine unabhängige, tagesaktuelle Berichterstattung<br />
ist kaum möglich und<br />
deshalb benötigt es AuslandsreporterInnen.<br />
Allerdings mussten sich diese<br />
während des Krieges beim Propagandaministerium<br />
melden, um einen „Minder“,<br />
also eine lokale Kontaktperson,<br />
zugewiesen zu bekommen, laut Staudinger.<br />
Diese sollten als Dolmetscher<br />
fungieren, seien aber eher Aufpasser<br />
der Regierung gewesen und hatten<br />
die Aufgabe, sicherzustellen, dass<br />
man nicht mit den „falschen Personen<br />
spricht“. Trotz dieser Maßnahme sei es<br />
aber dennoch möglich gewesen, sich<br />
mit anderen JournalistInnen vor Ort zusammenzufinden<br />
und auf eigene Faust<br />
zu recherchieren. Es war also „ein Mittelding,<br />
wir waren nicht unter permanenter<br />
Beobachtung, wie man es in autoritären<br />
Regimen immer wieder erlebt,<br />
aber auch nicht ganz frei“, rekapituliert<br />
Staudinger. Um einiges gefährlicher<br />
waren die Rebellengebiete, denn dort<br />
entwickelte sich eine Art „Entführungsindustrie“,<br />
deren Ziel (vor allem) westliche<br />
JournalistInnen waren, weshalb<br />
sich mit der Zeit kaum eine/r dorthin<br />
wagte. Nur in den Kurdengebieten sei<br />
es möglich gewesen, sich einigermaßen<br />
frei und sicher zu bewegen. Das wurde<br />
aber auch sehr stolz angepriesen. Eine<br />
der wenigen Möglichkeiten an Information<br />
zu gelangen, sind „Stringer“: Menschen,<br />
die vor Ort sind, beispielsweise<br />
Martin Staudinger / Copyright: Privat<br />
in Aleppo leben und sowohl Bild- als<br />
auch Videomaterial aufnehmen und an<br />
inländische und ausländische JournalistInnen<br />
schicken – ihr Ziel? Die Missstände<br />
und das Fehlverhalten des Regimes<br />
publik zu machen.<br />
Auch in der Türkei haben JournalistInnen<br />
mit Einschränkungen und Schwierigkeiten<br />
zu kämpfen – und gegen<br />
einen Mann an der Spitze, der darauf<br />
abzielt, auch an der Spitze zu bleiben.<br />
Allerdings unterscheidet sich das Vorgehen<br />
in der Essenz um Einiges, denn in<br />
der Türkei werde laut Staudinger buchstäblich<br />
„die Demokratie mit demokratischen<br />
Mitteln ausgehöhlt“. Gesetzesnovellen,<br />
wie zum Anti-Terror-Gesetz<br />
oder Social Media-Gesetz, tragen dazu<br />
bei, dass die ohnehin schon von Selbstund<br />
Außenzensur geprägte Berichterstattung<br />
nun noch eingeschränkter<br />
ist. Die Medienpolitik in der Türkei ist<br />
stark an den Staat gekoppelt, Radiound<br />
Fernsehsender werden von einer<br />
staatlichen Regulierungsbehörde, dem<br />
Obersten Rundfunk- und Fernsehrat<br />
(RTÜK), kontrolliert und auch sanktioniert.<br />
Der Rat besteht, wenig überraschend,<br />
größtenteils aus AKP-Mitgliedern<br />
(Erdogans Partei), aber auch ein<br />
paar wenige oppositionelle Mitglieder<br />
lassen sich finden. Dieser Rat setze<br />
systematisch Druckmittel gegen ganze<br />
Sender ein, konstatiert Akyavas. Die<br />
Justizbehörden begännen mit gerichtlicher<br />
Einschüchterung, andauernden<br />
Anklagen und Urteilen mit Freiheitsstrafen<br />
gegen einzelne JournalistInnen,<br />
der RTÜK setzt Geldstrafen, die sich<br />
viele Sender irgendwann nicht mehr<br />
leisten könnten. Somit würde man diese,<br />
als ersten Schritt, bereits ausschalten.<br />
Akyavas betont, dass es durch diese<br />
Schikanen gelang, die Selbstzensur<br />
in 90% aller Berichterstattungen zu<br />
etablieren, da die ReporterInnen und<br />
Medienhäuser Sanktionen und Haftstrafen<br />
fürchteten. Der RTÜK hat gerade<br />
die vier einflussreichsten noch<br />
unabhängig und kritisch berichtenden<br />
Fernsehsender in der Türkei im Visier,<br />
jedoch: „the main purpose of this high<br />
council is clearly to shut down these<br />
four TV channels.“<br />
Hilfe in Sicht?<br />
Laut Renan Akyavas habe das IPI 90%<br />
der stattgefundenen Verhandlungen<br />
gegen türkische JournalistInnen beobachtet<br />
und dokumentiert, 75% dieser<br />
Anklagen seien auf das Anti-Terror-Gesetz<br />
zurückzuführen. Die drei Haupttatbestände<br />
seien Verbreitung von<br />
terroristischem Propagandamaterial,<br />
Mitgliedschaft in einer terroristischen<br />
Organisation und Unterstützung einer<br />
Terrororganisation, ohne ein Mitglied<br />
zu sein. Als Beweismittel dienten häufig<br />
nur „Facebook“- oder „Twitter“-<br />
Posts. Oft säßen JournalistInnen monatelang<br />
in Untersuchungshaft, ohne<br />
einen fairen Prozess oder eine Anklage<br />
bekommen zu haben. „If there would<br />
be a guilty verdict at the end of a yearslong<br />
process, it would then be adjusted<br />
in court to reflect the prison sentence<br />
already served”, meint Akyavas. Das ist<br />
einer der Hauptgründe, weshalb viele<br />
internationale Organisationen bei<br />
solchen Gerichtsprozessen dabei sind,<br />
denn allein durch ihre Präsenz schafften<br />
sie es manchmal den Prozess zu<br />
beeinflussen, sodass die JournalistInnen<br />
freigesprochen werden würden<br />
oder zumindest ein faires Verfahren<br />
stattfände. Auch das bereits erwähnte<br />
Social-Media-Gesetz werde von NGOs<br />
stark kritisiert und man versuche, mit<br />
Hilfe der EU, Druck auf die Regierung<br />
in Ankara zur Gesetzesrücknahme<br />
auszuüben, da die Türkei immer noch<br />
als Beitrittskandidat in Frage komme.<br />
Allerdings sei die türkische Regierung<br />
18<br />
Thema „Reporter ohne Grenzen“ - oder doch mit?
starken Willens und strenger Bestimmtheit,<br />
das Gesetz zu implementieren,<br />
um an die Daten der NutzerInnen<br />
zu gelangen, sagt Akyavas. Dies sei gar<br />
nicht so unwahrscheinlich, denn laut ihr<br />
habe „Facebook“ anno 2019 70% der<br />
Tagesinformationsanfragen, also Nutzerdatenfreigaben,<br />
zugestimmt und die<br />
Daten an die Regierung weitergeleitet.<br />
Mit dem neuen Gesetz versuche die<br />
Regierung, die großen Plattformen unter<br />
Druck zu stellen und das habe einen<br />
guten Grund.<br />
Social Media sei Dank<br />
Denn „right now, social media is like<br />
news coverage as well. Other than writing<br />
these in their columns everyday<br />
they still write these opinions in their<br />
tweets.” Kein anderes Medium schaffte<br />
es bis jetzt, eine solche Vernetzung<br />
von Menschen in aller Welt zu gewährleisten<br />
und das kommt natürlich auch<br />
JournalistInnen weltweit zugute. Man<br />
kann zwar Inhalte löschen und Plattformen<br />
sperren, aber man wird immer<br />
einen Weg finden, um die Informationen<br />
an die Außenwelt zu tragen und<br />
das wissen autoritäre Machthaber nur<br />
zu gut. Social Media ist ein „sehr mächtiges<br />
Instrumentarium, an dem nicht so<br />
leicht vorbeizukommen ist“, formuliert<br />
Staudinger treffend. ReporterInnen<br />
zeigten vor allem in den letzten Jahren<br />
eine sehr hohe Courage und einen<br />
Drang nach Gerechtigkeit. Die Globalisierung<br />
ermöglicht die internationale<br />
Zusammenarbeit und Unterstützung<br />
zusätzlich und sie hilft uns, Informationen<br />
aus allen Teilen der Welt zu erlangen.<br />
Somit ist das Handeln von autoritären<br />
Regimen nun nicht mehr zu<br />
verschleiern.<br />
Durch die Verbreitung von faktenbasierter<br />
und unabhängiger Information<br />
ist es für die Bevölkerung vor Ort nun<br />
möglich, sich ein Bild außerhalb der<br />
propagandagesteuerten Medienlandschaft<br />
zu machen und vielleicht könnte<br />
Renan Akyavas / Copyright: IPI<br />
Renan Akyavas/ Copyright: IPI<br />
das zu einem Umbruch führen, wünschenswert<br />
wäre es allemal.<br />
In Anbetracht dessen sollte man eines<br />
immer im Hinterkopf behalten: „Freedom<br />
of information is the freedom that<br />
allows you to verify the existence of all<br />
the other freedoms” (Win Tin, burmesischer<br />
Journalist).<br />
von Kristina Petryshche<br />
© Copyright: adobe stick / intueri<br />
© Copyright: adobe stick / intueri<br />
„Reporter ohne Grenzen“ - oder doch Thema mit?<br />
19
Jobunsicherheit: „Goldene Ära<br />
des Journalismus ist vorbei“<br />
Wirtschaftliche Probleme, Stellenabbau, schlechtere Kollektivverträge,<br />
schwierige Arbeitsbedingungen. Österreichs JournalistInnen kämpfen<br />
schon seit längerem mit den Schwierigkeiten des Marktes. Doch fürchten<br />
sie um ihre Anstellungen und ist ein Berufswechsel notwendig? Darüber<br />
diskutierte <strong>SUMO</strong> mit AJOUR-Geschäftsführerin Lydia Ninz, der Journalistin<br />
Valentina Dirmaier sowie einer weiteren Journalistin.<br />
Dienstag, 4. August 2020. In der APA-<br />
Redaktion in der Wiener Laimgrubengasse<br />
ertönt ein Signalton. Eine<br />
OTS-Meldung ist eingegangen. In einer<br />
Nachrichtenagentur nichts Besonderes.<br />
Aber diese Meldung aus dem Konzern<br />
mit dem roten Bullen verändert Österreichs<br />
Medienlandschaft: Die vom<br />
Gründer finanzierte Rechercheplattform<br />
„Addendum“ wird nach nicht einmal drei<br />
Jahren eingestellt. 57 MitarbeiterInnen<br />
sind plötzlich arbeitslos. Zeitgleich, nur<br />
zehn Gehminuten von der APA entfernt,<br />
findet im aufwendig renovierten Wiener<br />
Büro in der Siebensterngasse eine besondere<br />
Redaktionssitzung statt. In der<br />
sogenannten „All-Star-Sitzung“ werden<br />
Valentina Dirmaier und ihre KollegInnen<br />
davon unterrichtet, dass sie ab Mitte<br />
September ohne Job dastehen werden.<br />
Ein Schlag ins Gesicht. Zwar wurde in der<br />
Branche schon länger darüber gemunkelt,<br />
aber die Belegschaft wog sich in trügerischer<br />
Sicherheit. Fehlende Kurzarbeit<br />
und besonders gute NutzerInnenzahlen,<br />
die auf datenjournalistische Aufbereitungen<br />
wie der ersten österreichischen<br />
Corona-Ampel zurückgehen, machen<br />
den gewählten Zeitpunkt unverständlich.<br />
So ist die kurzfristige Entscheidung ein<br />
Schock. Wie unerwartet das plötzliche<br />
Aus ist, zeigt das Beispiel eines ehemaligen<br />
Mitarbeiters, der sich gerade in einer<br />
heißen Quelle entspannt hat, als ihn die<br />
Nachricht aus der Redaktion erreicht.<br />
BeobachterInnen empfanden die Entscheidung<br />
aufgrund der EigentümerInnenstruktur<br />
nur als eine Frage der Zeit.<br />
Doch auch in anderen Medienunternehmen<br />
werden Stellen abgebaut. Große<br />
österreichische Medienunternehmen<br />
wie der ORF und die APA sehen sich aus<br />
Spargründen dazu gezwungen, MitarbeiterInnen<br />
zu entlassen. Seit 2007<br />
mussten beim ORF 800 Beschäftigte<br />
gehen, bei der APA wird aktuell (Stand<br />
November 2020) geplant, 25 Stellen zu<br />
streichen. Letzteres wird von Protesten<br />
der Belegschaft sowie der JournalistInnengewerkschaft<br />
GPA-djp und der Betriebsräte/-rätinnen<br />
österreichischer<br />
Medien – darunter der Styria Group –<br />
begleitet. Diese Beispiele zeigen einen<br />
Trend, der auch im „Österreichischen<br />
Journalismus-Report“ des Medienhaus<br />
Wien erkennbar ist. Denn vergleicht<br />
man den ersten Report aus dem Jahr<br />
2007 mit den Daten von 2019, ist erkennbar,<br />
dass die Zahl der JournalistInnen<br />
rückläufig ist. So verminderte sich<br />
jene der hauptberuflichen JournalistInnen<br />
von 7.100 auf 5.350. Auch Vollzeitbeschäftigungen<br />
sind seltener geworden:<br />
In der ersten Ausgabe waren<br />
76% aller JournalistInnen in Vollzeit angestellt,<br />
während das 2019 nur noch zu<br />
zwei Drittel der Fall war. Freie Journa-<br />
Lydia Ninz / Copyright: Kasper H.<br />
listInnen hingegen blieben – obwohl<br />
diese Zahl schwer messbar ist – auf<br />
demselben Niveau: ca. 900 Freiberufliche<br />
treffen zwölf Jahre später auf ungefähr<br />
600 bis 900. Diese Entwicklung<br />
beobachtet AJOUR-Geschäftsführerin<br />
Lydia Ninz mit Besorgnis: „Es werden<br />
immer weniger JournalistInnen, die<br />
immer mehr machen und deswegen<br />
passieren auch mehr Fehler. Dann gibt<br />
es mehr Kritik und die Glaubwürdigkeit<br />
der Medien innerhalb der Gesellschaft<br />
wird untergraben.“<br />
AJOUR-Coaching für arbeitslose<br />
JournalistInnen<br />
Solche Veränderungen konnten nicht<br />
nur mit Pensionierungen oder Wechsel<br />
© Copyright: adobe stick / Björn Wylezich<br />
20<br />
Thema Jobunsicherheit: „Goldene Ära des Journalismus ist vorbei“
des Berufsfeldes ausgeglichen werden.<br />
Laut AMS ist die Arbeitslosigkeit unter<br />
österreichischen JournalistInnen nach<br />
der Weltwirtschaftskrise 2008 von 410<br />
auf 641 Personen gestiegen. Kontinuierliche<br />
Anstiege, zwischen 2015 und<br />
2017 etwa in Höhe von knapp 10%<br />
folgten, bis 2019 die Zahl sogar bei 773<br />
arbeitslosen JournalistInnen lag. In dieser<br />
Zeit ist auch die Idee für die AMS-<br />
Initiative AJOUR geboren worden. „Es<br />
hat sich schon vor sechs, sieben Jahren<br />
abgezeichnet, dass es im Journalismus<br />
zu Umbrüchen und zu Arbeitslosigkeit<br />
kommt“, erklärt Ninz. Gründe dafür<br />
seien die vielen angehenden JungjournalistInnen<br />
am Markt, der Abbau bei<br />
traditionellen Medien und die Entstehung<br />
neuer Medien, die komplett andere<br />
Qualifikationen voraussetzen. Einer<br />
internen Langzeitstudie zufolge seien<br />
die KundInnen von AJOUR vor allem abgebaute<br />
JournalistInnen. Darunter seien<br />
zwei von vier KundInnen schon seit<br />
mindestens einem Jahr arbeitslos. Die<br />
Personen seien sehr unterschiedlich, es<br />
sei „von allem etwas dabei“. Ein „ziemlich<br />
starker“ Cluster zwischen 40 und<br />
50 sei aber schon bemerkbar. Jüngere<br />
KundInnen möchten sich oft neu orientieren.<br />
Doch was bietet die Einrichtung?<br />
AJOUR ist ein Service, das arbeitslose<br />
JournalistInnen ein halbes Jahr lang<br />
mit einem passenden Coach zur Seite<br />
steht. Es werde versucht, die Situation<br />
der Person zu analysieren und deren<br />
Fähigkeiten und Potentiale zu identifizieren.<br />
Das Ergebnis sei offen, journalistische<br />
Arbeit genauso möglich<br />
wie ein Wechsel in einen ganz anderen<br />
Bereich. Ninz versteht den Fokus von<br />
AJOUR folgendermaßen: „Wir stehen<br />
auf der Seite der Menschen, aber nicht<br />
als FreundInnen oder als Familie, sondern<br />
als professionelle Coaches, die<br />
aus ihnen herausholen, was in ihnen<br />
drinnen steckt.“ Das beinhalte nicht<br />
nur Kurse und Coaching, sondern auch<br />
Hilfe für den Start in die Selbstständigkeit.<br />
Die Wirkung des Konzepts zeigen<br />
beispielsweise die Zahlen des letzten<br />
Durchgangs aus dem Sommer 2020.<br />
Von 80 gecoachten Personen fanden<br />
42 Leute, deren Altersdurchschnitt bei<br />
39 Jahren lag, nach diesem Coaching<br />
einen Job oder in die Selbstständigkeit.<br />
Davon blieben 31% dem Journalismus<br />
treu, der Großteil (57%) wechselte aber<br />
in einen mediennahen Bereich wie zu<br />
PR-Agenturen. Drei weitere Personen<br />
haben eine neue, längere Ausbildung,<br />
beispielsweise ein Doktoratsstudium,<br />
begonnen.<br />
Unsicherheit, aber keine Angst<br />
Angesichts dieser Entwicklungen stellt<br />
sich die Frage, wie Österreichs JournalistInnen<br />
mit den Schwierigkeiten der<br />
Branche umgehen. Lisa (Anm.: Name<br />
geändert) arbeitet in einem Vollzeit-<br />
Beschäftigungsverhältnis für eine Tageszeitung.<br />
Davor war sie auch als freie<br />
Journalistin und bei anderen Medien<br />
tätig. Derzeit sieht sie ihren Job nicht<br />
in Gefahr. „Ich glaube, ich verdiene so<br />
wenig, dass ich nicht wirklich auffalle“,<br />
schmunzelt sie. Trotzdem wisse man<br />
als JournalistIn, dass Medien immer<br />
wenig Geld und Ressourcen haben. Es<br />
handle sich aber immer um eine Frage<br />
der Prioritätensetzung des jeweiligen<br />
Mediums und darum, welche Stellung<br />
man intern habe. Das sei immer sehr<br />
subjektiv. „Von der Chefredaktion und<br />
der Redaktion werde ich sehr wertgeschätzt,<br />
deswegen habe ich nicht so<br />
die Angst, dass ich abgebaut werde“,<br />
konstatiert die Redakteurin. Allerdings<br />
schwinge die Unsicherheit immer ein<br />
Valentina Dirmaier / Copyright: Privat<br />
bisschen mit. Das sei gar nicht so ein<br />
Problem, weil die Branche sehr schnelllebig<br />
sei. Sollte man einmal gefeuert<br />
werden, werde irgendwo anders wieder<br />
eine Stelle frei. Je länger man in der<br />
Branche sei und sich einen Namen gemacht<br />
habe, desto mehr Kontakte habe<br />
man und desto einfacher werde es, eine<br />
Alternative zu finden.<br />
Auch Valentina Dirmaier hatte vor ihrem<br />
„Addendum“-Rausschmiss keine<br />
Angst um ihren Job. Sie habe den Job<br />
mit dem Wissen angenommen, dass es<br />
morgen vorbei sein könnte. „Es ist ein<br />
bisschen ein Spiel mit dem Feuer, weil<br />
jede/r irgendwie weiß, dass es vorbei<br />
sein kann, egal ob jetzt oder später“,<br />
findet sie eine passende Metapher<br />
für die damalige Situation. Zu Beginn<br />
der Covid19-Pandemie habe sie sich<br />
schon Gedanken zur Branchenentwicklung<br />
gemacht und überlegt, ob sie der<br />
Branche den Rücken kehren solle. Sie<br />
glaubt auch, dass einige KollegInnen<br />
schon ähnliche Pläne schmiedeten und<br />
„mit einem Auge zum Stellenmarkt geschielt<br />
haben“. Niemand habe bei „Addendum“<br />
einen Job angenommen und<br />
geglaubt, dass es das Medium in den<br />
nächsten zehn bis 15 Jahren noch gibt.<br />
Valentina Dirmaier und Lisa sind sich<br />
einig, dass bei etablierten Medien wie<br />
dem ORF, dem „STANDARD“ oder der<br />
„Presse“ eine längere Beschäftigung<br />
erwartet werden könne und deswegen<br />
die Angst weniger groß sei. Lisa denkt,<br />
dass die Grundangst bei allen ein bisschen<br />
da sei, deren Ausmaß aber stark<br />
vom Medium abhänge. Denn wisse<br />
man, dass es das Unternehmen in baldiger<br />
Zukunft nicht mehr geben kann<br />
schwinge immer eine Grundangst mit.<br />
Deswegen schaue man sich auch nach<br />
neuen Positionen um und sei die ganze<br />
Zeit „mit einem Zeh schon draußen“.<br />
Das beeinflusse auch die Produktqualität<br />
des Mediums. Dieses Phänomen<br />
fasst Dirmaier wie folgt zusammen:<br />
„Bei neuen Projekten, wo nur ein Geldgeber<br />
dahintersteckt, ist das Risiko<br />
eines schnellen Todes hoch.“<br />
Befristete Verträge und einvernehmliche<br />
Lösungen<br />
Lisa erzählt, dass JungjournalistInnen<br />
meist mit befristeten Verträgen oder<br />
als Karenzvertretung in ein Medium<br />
einsteigen. Diese Zeit nutze das Unternehmen,<br />
um einen besser kennenzulernen.<br />
Das sei für die JournalistInnen mit<br />
viel Druck verbunden, weil man sich in<br />
dieser Zeit beweisen müsse. Dennoch<br />
sei es eine gute Möglichkeit, die viele<br />
Leute auch nutzen würden – jedoch<br />
mit einiger Unsicherheit verbunden.<br />
Für ihre jetzige Stelle hat Lisa sogar<br />
einen anderen Job aufgegeben, bekam<br />
aber bereits zu Beginn gesagt, dass<br />
eine Übernahme „relativ wahrscheinlich“<br />
sei. Einige ihrer jungen KollegInnen<br />
hingegen müssten bei jeder Vertragsverlängerung<br />
teilweise bis zum letzten<br />
Monat „zittern“, weil noch überlegt<br />
werde und Ressourcen herumgeschoben<br />
werden. Meistens finde sich dann<br />
doch noch irgendeine Lösung, weil die<br />
Branche in dem Sinn sehr flexibel sei,<br />
dass andere in Karenz gehen oder sich<br />
umorientieren und beispielsweise in die<br />
PR wechseln. Letztere Entscheidung<br />
hänge häufig mit der hohen Arbeitsbelastung<br />
zusammen. „Wenn man eine<br />
Zeit lang dabei ist, hat man schon das<br />
Gefühl, dass man immer mehr arbeiten<br />
und immer mehr Ergebnis bringen<br />
muss, ohne mehr bezahlt zu bekommen“,<br />
beschreibt Lisa den Druck. In<br />
der PR würden dann bessere Arbeitsbedingungen<br />
und Bezahlung erhofft<br />
werden. Komme es zur Beendigung von<br />
© Copyright: adobe stick / Björn Wylezich<br />
Jobunsicherheit: „Goldene Ära des Journalismus ist vorbei“ Thema<br />
21
Beschäftigungsverhältnissen, werde<br />
immer versucht, eine einvernehmliche<br />
Lösung zu finden. Sollte die Zusammenarbeit<br />
nicht passen, werde das<br />
den Personen von den Medien „durch<br />
die Blume“ klargemacht. In diesem Fall<br />
versuche man die Person sanft abzuschieben.<br />
Das sei eher bei langjährigen<br />
MitarbeiterInnen der Fall, ob derer<br />
Verträge hohe Ablösen bezahlt werden<br />
müssten. Meistens stehe aber eine<br />
reine Ressourcenfrage dahinter. Dann<br />
werde häufig versucht, sobald die notwendigen<br />
Ressourcen beschafft sind,<br />
die Person wiedereinzustellen.<br />
Auch die Jobsuche für JournalistInnen<br />
wird durch die Branchenprobleme erschwert.<br />
Praktika wurden 2020 von<br />
vielen Medien nicht besetzt. Valentina<br />
Dirmaier bewerbe sich, wenn der<br />
Markt etwas hergebe. Falls da nichts<br />
„Vernünftiges“ dabei sei, investiere<br />
sie lieber mit einem möglichen<br />
Rechtswissenschafts-Studium in ihre<br />
Bildung, das sich auch gut mit Journalismus<br />
verbinden ließe. Bei einigen<br />
Bewerbungsgesprächen sei ihr aber<br />
schon klar geworden, dass gewisse<br />
Stellen sehr schlecht bezahlt werden<br />
und man ab einem gewissen Alter<br />
nicht mehr so leben möchte. „Die goldene<br />
Ära des Journalismus ist vorbei“,<br />
ist sie sich bewusst und erinnert sich,<br />
dass sie das auch schon in ihrer Ausbildung<br />
zu spüren bekam. In jener Zeit<br />
sei der Kollektivvertrag neu ausgehandelt<br />
worden, folglich sei sie besser eingestuft<br />
worden. Mit einem Fixum von<br />
700 € sei sie in ihr erstes Ausbildungsjahr<br />
gestartet. Gerade am Anfang setze<br />
man sich nicht zur Wehr, weil man<br />
befürchte, sich eine Tür für einen späteren<br />
Job zu versperren.<br />
Alles, nur nicht frei<br />
Derzeit arbeite die ehemalige „Addendum“-Mitarbeiterin<br />
„aus Liebhabertum“<br />
als freie Journalistin. Etwas, das<br />
sie nicht auf Dauer tun möchte. „Als<br />
freie/r Angestellte/r in Österreich ist<br />
es eine Katastrophe. Das Honorar ist<br />
wirklich gering, man wird pro Anschlag<br />
oder pro Zeichen bezahlt. Egal ob man<br />
sich eine Kolumne aus den Fingern<br />
saugt oder ob man auf Reportage<br />
geht“, zeigt Dirmaier Probleme auf.<br />
Auch die Abstimmung mit der Redaktion<br />
und das „ewige Hin und Her“ seien<br />
sehr mühsam. Von den Redaktionen<br />
werde auch oft vergessen, dass vom<br />
Honorar eigentlich eine Versicherung,<br />
eine Pension, eine Wohnung, Zusatzsicherungen<br />
und sonstige Kosten gedeckt<br />
werden müssen. Neben ihrem<br />
Studium könne sie sich so eine Tätigkeit<br />
schon vorstellen, aber nicht mehr<br />
als einzige Beschäftigung. „So kann<br />
man in Österreich kaum überleben.<br />
Man muss PR oder sonst etwas nebenbei<br />
machen. Für eine rein journalistische<br />
Tätigkeit ist die Landschaft zu klein“,<br />
weiß Dirmaier, dass auch die geringe<br />
Marktgröße zur Schwierigkeit beiträgt.<br />
Auch Lisa spricht bei freien Dienstverhältnissen<br />
von „extrem schlechter“<br />
Bezahlung, weswegen viele Aufträge<br />
benötigt werden. Sie könne sich ebenfalls<br />
keine langfristige freie Tätigkeit<br />
vorstellen. Allerdings habe sie in dieser<br />
Zeit viel Organisatorisches und „Outof-the-Box“-Denken<br />
gelernt. Als positiv<br />
merkt sie auch das große Netzwerk<br />
mit Kontakten in der Medienbranche<br />
und möglichen InterviewpartnerInnen<br />
an. Ein Netzwerk mit anderen Freien sei<br />
auch sehr wichtig, damit man auf deren<br />
Erfahrungen zugreifen kann.<br />
In Anbetracht der schrumpfenden Zahl<br />
an fest angestellten Journalistinnen<br />
kann trotzdem nicht von einer Abschiebung<br />
in freie Dienstverhältnisse die<br />
Rede sein. Wenn Personen von einem<br />
Anstellungsverhältnis in jenes als Freie<br />
wechseln, passiere das meistens freiwillig.<br />
Gründe könnten zum Beispiel<br />
der Charakter, fehlende Zustimmung<br />
zur jeweiligen Blattlinie, ein größerer<br />
inhaltlicher Fokus als mediale Ressorts<br />
erlauben und keine Möglichkeiten für<br />
eine Festanstellung sein – oder aber<br />
unfreiwillig, weil ihnen gekündigt wurde.<br />
PR als Rettung?<br />
Ein Wechsel in die PR stellt für viele<br />
JournalistInnen eine Rettung vor all diesen<br />
Problemen dar. Das liege vor allem<br />
daran, dass sich die Berufsfelder nicht<br />
so ungleich sind. Valentina Dirmaier<br />
sieht darin aber keine Lösung und<br />
würde nur „ungern“ in die PR wechseln.<br />
Die einzigen Ausnahmen wären<br />
gewisse Projekte oder Start-Ups mit<br />
guten Ideen, Großkonzerne schließt sie<br />
aus. Eine der vielen JournalistInnen, die<br />
diesen Sprung wagten, ist Lydia Ninz.<br />
Nachdem sie mit 47 Jahren „abgebaut“<br />
wurde, war sie als Pressesprecherin<br />
© Copyright: adobe stick / Pormezz<br />
tätig. „Wenn ich weiß, wie JournalistInnen<br />
ticken, dann kann ich auch viel effizienter<br />
im PR-Bereich arbeiten“, stellt<br />
sie klar. Ein klarer Vorteil sei, dass man<br />
versteht „wie es in einer Redaktion zugeht“.<br />
Dann könne man auf der anderen<br />
Seite viel besser die Botschaften<br />
so entwickeln, dass es JournalistInnen<br />
auch interessiert. Das sieht Lisa auch<br />
so. Sie ist umgekehrt aus der PR in den<br />
Journalismus gewechselt. Die starke<br />
Verbundenheit der Berufe mit der Medienwelt<br />
und dass man die Zusammenarbeit<br />
im Arbeitsalltag schon kenne,<br />
seien ebenfalls positiv zu bewerten.<br />
Momentan könne sich Lisa zwar keinen<br />
erneuten Wechsel vorstellen, aber<br />
wenn sich die Medien in ihrer neuen<br />
Funktion nicht zurechtfinden sollten,<br />
sei die Gefahr schon da, dies tun<br />
zu müssen. Mittelfristig fühle sie ihre<br />
Arbeitsstelle nicht so sehr gefährdet,<br />
aber langfristig sei natürlich jeder Medienjob<br />
ein bisschen bedroht. Dementsprechend<br />
seien die PR oder andere<br />
mediennahe Berufe für JournalistInnen<br />
schon immer alternative Berufe. Es bestünde<br />
immer eine Möglichkeit im Hinterkopf<br />
und in gewisser Weise auch ein<br />
„Sicherheitsnetz“. Dass viele JournalistInnen<br />
ähnlich denken, könne man daran<br />
sehen, dass viele in den PR-Bereich<br />
wechseln. „Vielleicht ist das auch der<br />
Grund, warum ich mir nicht so Sorgen<br />
mache. Es ist nicht so, dass ich nur das<br />
kann und ansonsten aufgeschmissen<br />
wäre“, denkt Lisa laut nach.<br />
von Christiane Fürst<br />
22<br />
Jobunsicherheit: „Goldene Ära des Journalismus ist vorbei“
www.ip.at<br />
Zielgruppen<br />
von Alpha<br />
bis Boomer.<br />
Passt.<br />
Reichweitenboss. Passt. Egal, ob jung oder alt,<br />
mainstreamig oder ungewöhnlich – mit unserem<br />
Portfolio erreichen Werbekunden garantiert<br />
ihre Zielgruppe. Passt. Bereit für alles, was noch<br />
kommt. Passt.<br />
XXXXX<br />
23
Satire als Gegenmittel<br />
in Krisen<br />
Satire kennt viele Kanäle und Formen, die neben Unterhaltung auch tiefgründigere<br />
Funktionen haben. Aber welche Rolle spielt Satire in Krisensituationen,<br />
welchen Mehrwert hat sie und wo liegen die Grenzen? <strong>SUMO</strong><br />
sprach darüber mit Florian Scheuba, Schauspieler, Kabarettist, Buchautor,<br />
Kolumnist und Moderator, und Fritz Jergitsch, Kabarettist und Chefredakteur<br />
von „Die Tagespresse”.<br />
© Copyright: adobe stick / photokozyr<br />
Krisensituationen beeinflussen insbesondere<br />
das psychische Wohlergehen<br />
der Menschen und können unter anderem<br />
Angst, Stress und Verzweiflung<br />
verursachen. Im AXA Mental Health<br />
Report 2020 gaben 32% der Befragten<br />
eine Verschlechterung der eigenen<br />
psychischen Verfassung im Verlauf der<br />
Corona-Krise an. Ein Weg, mit einer<br />
solchen Belastung umzugehen, ist – zu<br />
lachen. Laut Fritz Jergitsch haben Satire<br />
und Humor eine psychohygienische<br />
Funktion. Sie könnten angespannte<br />
Situationen entkrampfen und dazu beitragen,<br />
besser mit ihnen umgehen zu<br />
können. „Im Englischen gibt es die Redewendung<br />
‚To make light of a bad situation‘,<br />
wenn man einen Witz über eine<br />
schwierige Situation macht. Ich denke,<br />
das sagt schon sehr viel darüber aus,<br />
was Humor in unserem Gehirn macht.<br />
Er hilft uns, den Alltag besser zu ertragen”.<br />
Die Konfrontation mit Ängsten<br />
ist besonders in Krisensituationen für<br />
viele Menschen ein Problem. Auch hier<br />
kann Humor ein Gegenmittel sein. Florian<br />
Scheuba beschreibt Satire als eine<br />
Notwehr gegen Zumutungen. In Krisensituationen<br />
könne satirischer Humor<br />
eine Methode sein, Angst zu nehmen<br />
und Abstand zu gewinnen. „Angst ist<br />
eine Degeneration der Aufmerksamkeit.<br />
Humor und Satire sind Kraftfutter<br />
für Aufmerksamkeit. Sie können Aufmerksamkeit<br />
wieder auf Dinge lenken<br />
und helfen, sie wieder einzuordnen und<br />
mit etwas weniger Angst auf diese zu<br />
schauen”.<br />
Kritik der Mächtigen<br />
Das Kritisieren von Personen, Ereignissen<br />
oder Zuständen gehört zu den<br />
Grundfunktionen von Satire. Mittels<br />
Stilelementen wie Ironie, Übertreibung<br />
und Spott können Missstände aufgegriffen<br />
und zum Nachdenken und Reflektieren<br />
angeregt werden. Satire ist<br />
daher im Gegensatz zur klassischen<br />
Comedy hochpolitisch. Diese Funktion<br />
ist auch besonders in Krisensituationen<br />
wichtig. Dazu sagt der Chefredakteur<br />
von „Die Tagespresse”: „Es gehört<br />
zur Grundaufgabe der Satire, dass sie<br />
denen da oben den Spiegel vorhält und<br />
durch das Mittel der satirischen Übertreibung<br />
Missstände sichtbarer macht,<br />
indem diese ein bisschen exzessiver<br />
dargestellt werden, als sie sind. So erfüllt<br />
Satire natürlich auch eine Funktion<br />
als Kritik der Politik und der Mächtigen”.<br />
Informationscharakter<br />
Satire hat einen größeren Mehrwert<br />
als die bloße Unterhaltung. Dieser ist<br />
jedoch oft nicht gleich ersichtlich und<br />
nur schwer quantifizierbar. Satire kann<br />
Wahrheiten, Nachrichtenwerte und<br />
Informationsgehalte übermitteln und<br />
dies anders verpacken als gewöhnlich.<br />
Humor und Wahrheit sind zwei eng<br />
miteinander verbundene Dinge. Laut<br />
Jergitsch funktionieren Witze nur mit<br />
einem wahren Kern. Scheuba betont<br />
auch die weitere wichtige Funktion von<br />
Satire, Inhalte zu vermitteln, die medial<br />
zu wenig gewürdigt werden. Damit<br />
sei auch ein gewisser Bildungsauftrag<br />
verbunden. Besonders in Krisenzeiten<br />
gingen oft wichtige Themen unter, auf<br />
die man mittels satirischer Darstellung<br />
Aufmerksamkeit lenken könne. Krisensituationen<br />
würden auch manchmal<br />
bewusst von Menschen genutzt werden,<br />
die darauf hoffen, dass eine Sache<br />
untergehe und medial nicht wahrgenommen<br />
werde. Dabei habe Satire die<br />
Fähigkeit, den Fokus des öffentlichen<br />
Interesses auf solche Themen lenken<br />
zu können.<br />
Wo liegen die Grenzen?<br />
Die Frage, wann Satire zu weit geht<br />
wird seit Ewigkeiten stark debattiert,<br />
aufgrund der potentiellen Reichweite<br />
im Internet noch heftiger. Kontroversen<br />
wie um Jan Böhmermanns Gedicht über<br />
den türkischen Präsidenten Erdoğan<br />
mit dem Titel „Schmähkritik“ sind Auslöser<br />
solcher Diskussionen. Grundsätzlich<br />
wird Satire in Österreich gesetzlich<br />
kraft der Meinungs- und Kunstfreiheit<br />
geschützt, ihre Grenzen liegen bei der<br />
Verletzung der menschlichen Ehre und<br />
der Menschenwürde. Aber nicht nur<br />
gesetzliche Vorschriften, sondern auch<br />
die subjektive Einschätzung darüber,<br />
24<br />
Satire als Gegenmittel in Krisen
wann Satire zu weit geht, spielt eine<br />
Rolle. Diese Grenze verläuft für jeden<br />
Menschen anders. „Wir orientieren<br />
uns eher an unserem Bauchgefühl. Wir<br />
überlegen uns bei jeder Schlagzeile: ‚‚Ist<br />
diese Schlagzeile gerechtfertigt‘? Bei<br />
einem härteren Witz denken wir noch<br />
ein bisschen länger nach und diskutieren<br />
vielleicht auch. Es kommt natürlich<br />
vor, dass dann Leute unter einen Artikel<br />
schreiben, dass dieser Inhalt zu weit<br />
geht”, so Jergitsch über die Abwägung<br />
der Grenzen bei Artikeln von „Die Tagespresse”.<br />
Des Weiteren achte Jergitsch<br />
darauf, keine Witze auf Kosten von<br />
Menschen mit Beeinträchtigungen und<br />
jenen, die es unverschuldet schwieriger<br />
haben zu machen. Rein thematisch<br />
gebe es für Florian Scheuba keine Grenzen:<br />
Es komme immer auf das Wie an.<br />
Ein und derselbe Scherz könne in einer<br />
speziellen Situation sehr unpassend<br />
und in einer anderen sehr passend sein.<br />
„Das Wesen von Humor ist es, dass er<br />
alles umfasst. Darum gibt es auch Phänomene<br />
wie den ‚schwarzen Humor‘,<br />
der auch dazu da ist, schlimme Dinge zu<br />
verarbeiten, weil Humor eine Form der<br />
Distanzierung ermöglicht”, so Scheuba.<br />
Lob und Kritik<br />
Die Wahrnehmung der RezipientInnen<br />
satirischer Inhalte sind bei heiklen Krisenthemen<br />
sehr unterschiedlich. Während<br />
einige den Humor positiv wahrnehmen,<br />
empören sich andere über<br />
dieselben Inhalte. „Nach dem Anschlag<br />
in Wien haben wir uns dazu geäußert<br />
und zu 70% positive Rückmeldungen<br />
bekommen. 30% haben Kommentare<br />
in der Bandbreite von ‚Leute, das ist<br />
zu früh‘ bis hin zu wüsten Beschimpfungen<br />
gepostet. Wenn man über ein<br />
solch extrem aufgeladenes und furchtbares<br />
Thema wie einen Terroranschlag<br />
schreibt, kommt es natürlich vor, dass<br />
es vielen Leuten zu weit geht. Wir sind<br />
der Meinung, dass man sich gerade in<br />
solchen Zeiten nicht durch Terror den<br />
Humor nehmen lassen und sich nicht<br />
zum Schweigen bringen lassen sollte”,<br />
berichtet Fritz Jergitsch.<br />
Zu einem anderen Krisenkontext, jenem<br />
von Corona, konstatiert Florian Scheuba:<br />
„Ich bin noch kurz vor dem Lockdown<br />
mit Florian Klenk, den ‚Staatskünstlern‘<br />
und auch solo aufgetreten<br />
und da hatte ich das Gefühl, dass die<br />
Menschen besonders aufmerksam und<br />
auch dankbar dafür sind, dass etwas<br />
auf der Bühne stattfindet und dabei<br />
Vieles satirisch beleuchtet wird. Ich<br />
glaube, dass dafür ein Bedürfnis da ist<br />
und dass es Menschen fehlt, wenn das<br />
derzeit auf Bühnen nicht möglich ist”.<br />
Sich zu amüsieren – auch über und in<br />
Krisen – ist ein menschliches Bedürfnis.<br />
von Christian Krückel<br />
Florian Scheuba / Copyright: Peter Rigaud<br />
Fritz Jergitsch / Copyright: Markus Wache<br />
Satire als Gegenmittel in Krisen<br />
25
ORF NIEDERÖSTERREICH<br />
DA BIN ICH DAHEIM<br />
RADIO NIEDERÖSTERREICH<br />
DIE MUSIK MEINES LEBENS<br />
NIEDERÖSTERREICH HEUTE IN HD<br />
TÄGLICH UM 19.00 UHR IN ORF 2 N<br />
UND VIA ORF-TVTHEK<br />
NÖ HEUTE KOMPAKT MO–FR UM 16.57 UHR IN ORF 2 N<br />
UND VIA ORF NÖ-APP<br />
NOE.ORF.AT ONLINE RUND UM DIE UHR<br />
26<br />
ORF NIEDERÖSTERREICH Radioplatz 1, 3109 St.Pölten<br />
Tel. 02742/22 10-0 - Fax 02742/22 10-23891<br />
Publikumsservice: Tel. 02742/23330<br />
Pressefreiheit Thema - Wahrheit kann bestraft werden
Auf der Suche nach Schnäppchen<br />
über Vergleichsportale<br />
Um die niedrigsten Preise zu finden, konsultieren immer mehr Menschen<br />
das Internet und kommen dabei nicht an diversen Vergleichsportalen<br />
vorbei. <strong>SUMO</strong> sprach darüber mit Reinhold Baudisch, dem<br />
Geschäftsführer von „durchblicker.at“, mit Markus Nigl und Michael<br />
Nikolajuk, dem Geschäftsführer und dem Marketingleiter von „geizhals.<br />
at“, sowie mit Gabi Kreindl, Versicherungsexpertin im Verein für Konsumenteninformation.<br />
„durchblicker.at“ verzeichnet durchschnittlich<br />
bis zu 800.000 Unique User<br />
pro Monat, bei „geizhals.at“ sind es<br />
sogar 3,5 Millionen. An diesen Zahlen<br />
erkennt man, dass Vergleichsportale in<br />
Österreich viel genutzt werden. Es gibt<br />
inzwischen kaum ein Produkt oder eine<br />
Dienstleistung, die durch solche Portale<br />
nicht abgedeckt werden – vom Urlaub<br />
über die Autoversicherung bis hin zur<br />
elektrischen Zahnbürste. Vergleichsportale<br />
entscheiden also inzwischen<br />
bei einer Vielzahl an KonsumentInnen,<br />
bei welchem Händler sie welches Produkt<br />
beziehungsweise welche Dienstleistung<br />
beziehen und zu welchen Konditionen.<br />
Da die Preislisten mehrmals<br />
pro Stunde aktualisiert werden, ist es<br />
möglich, jederzeit den günstigsten<br />
Preis zu finden. „Vergleichsportale werden<br />
von den KonsumentInnen sehr gut<br />
angenommen. Das Problem von Verbraucherschutzseite<br />
ist, dass oft unklar<br />
bleibt, welche Rolle das Portal hat und<br />
welche Anbieter überhaupt verglichen<br />
werden. Oft wird nicht der volle Markt<br />
abgedeckt“, berichtet Kreindl. Laut ihr<br />
sei noch einiges an Verbesserungspotential<br />
möglich, vor allem wenn es um<br />
die Transparenz und das Verständnis<br />
des Modells selbst gehe.<br />
Wer warum gelistet wird<br />
Das Auswahlverfahren variiert je nach<br />
Vergleichsseite, jedoch ist es das Ziel<br />
der meisten Vergleichsportale, dass ein<br />
möglichst breiter Umfang des Marktes<br />
wiedergegeben werden kann. Bei der<br />
Auswahl der gelisteten Unternehmen<br />
läuft es immer ähnlich ab. „Der Händler<br />
meldet sich bei uns oder wir kontaktieren<br />
ihn. Was einmal prinzipiell verlangt<br />
wird, sind grundlegende Fakten<br />
wie ein Handelsregisterauszug und ein<br />
Gewerbeschein. Danach werden die<br />
Preislisten von unserem Supportteam<br />
gecheckt und mit dem des Händlers abgeglichen“,<br />
so Geizhals-Geschäftsführer<br />
Markus Nigl über den Prozess. „Weiters<br />
kontrolliert werden gesetzliche Rahmenbedingungen<br />
wie die Allgemeinen<br />
Geschäftsbedingungen, das Impressum<br />
sowie das Einhalten von Widerrufs-<br />
und Fernabsatzrecht“. Im Grunde<br />
genommen würden jedoch die meisten<br />
Unternehmen auf den verschiedenen<br />
Plattformen abgebildet, nur in seltenen<br />
Fällen komme es tatsächlich vor, dass<br />
Unternehmen von dem Vergleich ausgeschlossen<br />
werden. „Ganz selten gibt<br />
es Ausnahmefälle. Aber wenn wir sehr<br />
häufig über einen Anbieter hören, dass<br />
dieser nicht seriös am Markt auftritt,<br />
dann kann es im Einzelfall schon mal<br />
sein, dass wir sagen, es ist besser, wir<br />
listen diesen nicht. Weil das wäre ja kein<br />
guter Rat den NutzerInnen gegenüber“,<br />
erklärt Durchblicker-Geschäftsführer<br />
Baudisch. Auch Schutzmechanismen<br />
wirken gegen unseriöse Händler. So<br />
© Copyright: adobe stock/ Gajus<br />
Auf der Suche nach Schnäppchen über Vergleichsportale<br />
27
© Copyright: adobe stock/ yetronic<br />
gibt es bei einigen Portalen eine Meldung<br />
an das Supportteam, sobald der<br />
Preis zu weit unter dem der anderen<br />
Anbieter fällt. Die Preislisten, welche<br />
ständig automatisiert überprüft werden,<br />
können in diesem Fall vom Supportteam<br />
manuell geprüft werden und<br />
im Falle eines Fehlers schnell korrigiert<br />
werden. Markus Nigl meint, dass weder<br />
KonsumentInnen noch ein Händler in<br />
diesem Fall profitieren würden. Einzig<br />
allein das Vergleichsportal selbst würde<br />
zumindest finanziell profitieren, da<br />
im Falle eines zu niedrigen Preises die<br />
UserInnen durch zahlreiche Klicks den<br />
Umsatz angekurbelt hätten.<br />
Geldfluss an die Portale<br />
Da die Portale nicht nur eine hohe Vergleichsreichweite<br />
bieten, sondern auch<br />
ein Stück vom Umsatz abbekommen<br />
möchten, stellt sich die Frage nach deren<br />
Finanzierung. In der Regel funktioniert<br />
diese entweder auf CPC, also Cost<br />
per Click-Basis oder auf CPO, sprich<br />
Cost per Order. „Aktuell bekommen wir<br />
(Geizhals) für jeden Click so um die 30<br />
Cent von einem Händler. Im Fall eines<br />
CPO-Vertrages bekommen wir einen<br />
gewissen Prozentbetrag als Provision“,<br />
erzählt Nigl. In der Regel komme es vor,<br />
dass sowohl die Händler den Kontakt<br />
zum Unternehmen suchen, als auch<br />
umgekehrt. Michael Nikolajuk, Geizhals-Marketingleiter,<br />
berichtet: „Als wir<br />
gewachsen sind, sind viele Händler auf<br />
uns zugekommen, aber irgendwann<br />
einmal hat man einen großen Händlerstamm.<br />
Dann wird es eher schwierig,<br />
dass diese aktiv auf uns zukommen,<br />
stattdessen versuchen wir aktiv auf die<br />
Händler, die wir noch nicht haben, zuzugehen.“<br />
Einflüsse durch Äußere und Innere<br />
Kaum ein Unternehmen, das Preisvergleiche<br />
durchführt steht alleine da. Zumeist<br />
sind diverse Gesellschafter oder<br />
Investoren an dem Geschäftsmodell<br />
beteiligt. „Wichtig ist, dass du als Vergleichsplattform<br />
niemanden als Eigentümer<br />
hast, der auf der Plattform mit<br />
verglichen wird“, sagt Baudisch. Durchblicker<br />
hat neben seinem Business<br />
Angle Hansi Hansmann auch weitere<br />
Gesellschafter, darunter der amerikanische<br />
Investor White Mountains, der<br />
45% der Anteile hält. White Mountains<br />
ist zwar in der Versicherungsbranche<br />
tätig, jedoch nicht in Österreich und<br />
auch nicht im B2C-Bereich. Geizhals hat<br />
ebenso eine Vielzahl an Gesellschafter,<br />
der weitaus mächtigste mit 90% Anteil<br />
ist der deutsche Medienkonzern Heise<br />
Gruppe. Auch hier wird <strong>SUMO</strong> versichert,<br />
dass die Mediengruppe am operativen<br />
Teil des Unternehmens keinen<br />
Einfluss habe und dass bis auf die Nutzung<br />
von Synergien und diversen Kooperationen<br />
keine weitere Beziehung<br />
bestehe, da die Geschäftsbereiche doch<br />
zu unterschiedlich seien. Da auch der<br />
Werbeanteil nur einen sehr geringen<br />
Anteil des Gesamtumsatzes einer Vergleichsseite<br />
ausmacht, sind auch hier<br />
wenige Einflüsse zu erwarten. Einzig bei<br />
der Gestaltung des Newsletters können<br />
die Portalbetreiber ihren eigenen<br />
Interessen nachgehen. „Wir platzieren<br />
im Newsletter auch neuere, nicht ganz<br />
so bekannte Produkte oder Features.<br />
Der Hintergrund ist natürlich auch der,<br />
dass wir versuchen, auch unsere Breite<br />
darzulegen. Wir werden immer als<br />
sehr techniklastiger Preisvergleich für<br />
Unterhaltungselektronik und Hardware<br />
wahrgenommen. Aber inzwischen kann<br />
man auch andere Dinge bei uns bekommen“,<br />
erzählt Nikolajuk.<br />
Zum Schutz der KonsumentInnen<br />
Aus Sicht des Konsumentenschutzes<br />
sind Vergleichsportale jedoch noch<br />
nicht ganz userfreundlich gestaltet.<br />
So ergab beispielsweise eine Studie<br />
des Europäischen Verbraucherzentrums<br />
Österreich aus dem Jahr 2015,<br />
dass nur 11% der Vergleichsportale in<br />
der EU Kontaktmöglichkeiten angeben<br />
und lediglich 34% aufzeigen, wohin<br />
man sich im Beschwerdefall wenden<br />
kann. Auch Gabi Kreindl meint, dass<br />
fehlende Transparenz noch immer ein<br />
großes Problem sei. Vor allem im Versicherungsbereich<br />
gehe oft nicht klar<br />
für KonsumentInnen hervor, ob es sich<br />
um ein Versicherungsunternehmen im<br />
Vergleich handelt oder einem/r Makler/<br />
in. Auch wenn es für viele Menschen<br />
angenehmer sein mag, sich nicht mit<br />
einem/r Versicherungsberater/in zusammenzusetzten,<br />
da der Druck zum<br />
Abschluss groß ist, so weiß man oft<br />
nicht, wer einen bei einem Schadensfall<br />
beraten wird oder wie lange der Vertrag<br />
gilt. Kreindl empfiehlt sich bei Vergleichsportalen<br />
immer zu fragen: „Sind<br />
alle oder möglichst viele Anbieter gelistet?<br />
Wie ist denn dieses Vergleichsportal<br />
finanziert? Wer zahlt da was wofür?<br />
Dann wird es schon ein bisschen klarer,<br />
was hier Sache ist.“<br />
von Laura Sophie Maihoffer<br />
Michael Nikolajuk / Copyright: Geizhals<br />
Markus Nigl / Copyright: Geizhals<br />
Reinhold Baudisch / Copyright: Sebastian Freiler<br />
Gabi Kreindl / Copyright: VKI<br />
28<br />
Auf der Suche nach Schnäppchen über Vergleichsportale
Keine Zukunft für Musikmedien?<br />
Was haben der einst so populäre Musik-TV-Sender „VIVA“ und die Musik- und Popkulturzeitschrift „SPEX“ gemeinsam?<br />
Beide haben in den vergangenen drei Jahren ihren Betrieb eingestellt. Heute stellt sich die Frage, ob<br />
im Zeitalter von „YouTube“ und „Spotify“ Musikfernsehen und -magazine überhaupt noch eine Rolle spielen.<br />
<strong>SUMO</strong> sprach daher mit dem Musiksoziologen Michael Huber und Theresa Ziegler, Chefredakteurin des österreichischen<br />
Kulturmagazins „The Gap“, über Musiksozialisation, wirtschaftliche Herausforderungen von Musikmedien<br />
sowie Musikwahrnehmung in der digitalen Ära.<br />
Ein Freitag im November 2013, 14:00<br />
Uhr. Ich eile von der Schule nach Hause,<br />
denn um 15 Uhr beginnen die „VIVA Top<br />
100“. Meine einzige Sorge: die ersten<br />
Musikclips zu verpassen. Mein Bruder<br />
wartet bereits gespannt vor dem Fernseher<br />
und ist bereit für das Highlight<br />
der Woche und den Start in das Wochenende.<br />
Das Leben ist einfach schön<br />
und die Welt in Ordnung.<br />
Die Rolle der Musiksozialisation<br />
So oder ähnlich ging es vielen jungen<br />
Erwachsenen in Deutschland und Österreich,<br />
die in den 1990er und 2000er<br />
Jahren mit „VIVA“ und MTV aufgewachsen<br />
sind. Auch Michael Huber, stellvertretender<br />
Leiter des Instituts für<br />
Musiksoziologie an der Universität für<br />
Musik und darstellende Kunst Wien,<br />
erinnert sich gerne zurück und verdeutlicht<br />
die Rolle der Musiksozialisation.<br />
Die MTV-Sendung „120 Minutes“, eine<br />
Musik-Show, in der die neuesten und<br />
interessantesten Clips gezeigt wurden,<br />
habe er damals mit seinem VHS-Rekorder<br />
aufgenommen, um am nächsten<br />
Tag nachzusehen, ob etwas Spannendes<br />
dabei war. Mit Fragen wie „Hast<br />
du schon das neue Video von ‚Nine<br />
Inch Nails‘ gesehen?“ wurden die Themen<br />
des nächsten Tages durch solche<br />
Sendungen festgelegt, wodurch man<br />
mit der Rezeption dieser Inhalte soziales<br />
Kapital innerhalb einer Gruppe<br />
generieren konnte, so Huber. Für die<br />
gebürtige Bayerin und Chefredakteurin<br />
von „The Gap“, Theresa Ziegler, war der<br />
österreichische Musikfernsehsender<br />
„gotv“ sogar der erste Zugang zu österreichischen<br />
Musikmedien und einer<br />
der ersten Anknüpfungspunkte für ihre<br />
spätere musikjournalistische Karriere.<br />
„Hier habe ich zum ersten Mal ein‚‚Bilderbuch‘-Musikvideo<br />
gesehen“, erzählt<br />
Ziegler.<br />
Geld ist nicht alles<br />
Als Paradebeispiel, dass es bei Musikmedien<br />
nicht ausschließlich um<br />
monetäre, sondern auch um gesellschaftliche<br />
Aspekte geht, dient „The<br />
Gap“. Aus Theresa Zieglers Sicht wäre<br />
ein monatliches Erscheinen des Magazins<br />
durchaus möglich, wobei sich<br />
dabei aber die Frage des Sinnes stellen<br />
würde. „Unter meiner Redaktion habe<br />
ich ‚The Gap‘ als Magazin verstanden,<br />
das in die Tiefe geht, also von AuskennerInnen<br />
für AuskennerInnen“. Dabei<br />
werde auch der Begriff Popkultur weit<br />
gefasst, da es nicht nur um konkrete<br />
Albumveröffentlichungen geht, sondern<br />
auch um „Strukturen und Bewegungen<br />
hinter den Themen“, so Ziegler<br />
weiter. Daher wäre der zweimonatige<br />
Erscheinungsrhythmus sinnvoller, weil<br />
dadurch mehr Zeit für intensivere Recherchen<br />
der Meta-Themen bleibe und<br />
gesellschaftspolitische Hintergründe<br />
besser beleuchtet würden. Mitte April<br />
2020, zur Zeit der ersten Corona-Welle,<br />
hat „The Gap“ beschlossen, Kulturschaffende<br />
in Österreich mit einem<br />
Kulturkalender zu unterstützen, in dem<br />
Online-Veranstaltungen der KünstlerInnen<br />
dort eingetragen wurden. Und<br />
das, obwohl man selbst auch nicht von<br />
der Krise verschont wurde: „Der erste<br />
Lockdown kam gerade bei einer Magazin-Produktion<br />
und das hat uns natürlich<br />
getroffen. Was passiert jetzt? Aber<br />
uns war schnell klar: Wir haben ein gewisses<br />
Verantwortungsgefühl gegenüber<br />
der Szene“, meint Ziegler. Dies sei<br />
etwas sehr österreichspezifisches, da<br />
Österreich zwar ein kleines Land, die<br />
© Copyright: adobe stock / xavier gallego morel<br />
Keine Zukunft für Musikmedien?<br />
29
Szene allerdings groß und divers sei.<br />
Damit hätte man als Musikmedium ein<br />
hohes Verantwortungsbewusstsein.<br />
Ein Mitgrund für die intensive Berichterstattung<br />
während dieser Zeit sei auch<br />
die mangelnde Aufmerksamkeit für die<br />
Beeinträchtigung der österreichischen<br />
Kulturlandschaft gewesen, so Ziegler<br />
weiter.<br />
„gotv“ gibt´s auch noch?<br />
Unverständnis für die immer noch existierenden<br />
Musik-TV-Sender zeigt Huber,<br />
denn für ihn sei es „völlig schleierhaft“,<br />
wie Quoten zustande kämen, die<br />
das Ganze für den Werbemarkt interessant<br />
machen. „Wenn ich durch die<br />
Fernsehsender zappe, denke ich mir:<br />
‚gotv‘ gibt’s auch noch? Und wenn ich<br />
ein Video sehe, das bei mir nostalgische<br />
Gefühle hervorruft, dann bleibe<br />
ich die paar Minuten dran und sehe es<br />
mir an.“ Abgesehen davon könne Huber<br />
den klassischen Musiksendern mittlerweile<br />
nichts mehr abgewinnen und das<br />
trotz der Tatsache, dass MTV während<br />
seiner Studentenzeit sein „täglich Brot“<br />
war. „‚‚YouTube‘ in Kombination mit dem<br />
Smartphone war der Anfang vom Ende<br />
des Musikfernsehens“, meint Huber.<br />
Durch die leichte Verfügbarkeit, überall<br />
und zu jeder Zeit, hätte „YouTube“<br />
den one-to-many-Musiksendern den<br />
Hahn abgedreht. „Musikfernsehen<br />
gibt mir vor, wann ich was zu schauen<br />
habe.“ Sendungen hätten früher den<br />
Tag strukturiert und heute habe man zu<br />
jeder Zeit Zugriff auf Musik. Daher sagt<br />
Huber auch: „Ich sehe keinen Grund,<br />
warum ich Musik-TV schauen sollte.“<br />
Zudem seien junge MusikhörerInnen<br />
Multi-Channel-User und würden daher<br />
oft den Musikclips nicht die volle Aufmerksamkeit<br />
schenken. Huber könne<br />
auch die Kritik am Musikfernsehen verstehen,<br />
die sich zu musikfreien Zonen<br />
entwickelten und statt spannenden<br />
Musikvideos dutzende Reality-,<br />
Fiction- und Spielshow-Formate zeigten,<br />
um die Quoten zu erhöhen. „Um<br />
Reality-Formate zu schauen, brauche<br />
ich keinen Musiksender“, so Huber. Das<br />
Alleinstellungsmerkmal von MTV war<br />
es, innovative Clips zu zeigen, die es nur<br />
dort zu sehen gab. Nur ist dieser Bedarf<br />
verschwunden als, „YouTube“ & Co. aufkamen.<br />
Als Ironie des Schicksals könnte<br />
man es bezeichnen, dass ausgerechnet<br />
„YouTube“-Stars innerhalb der letzten<br />
Sendeminuten von „VIVA“ Lebewohl<br />
sagen, denn gerade diese Video-Plattform<br />
hat dazu beigetragen, dass der<br />
Sender eingestellt wurde.<br />
„Gedruckte Musik“<br />
Andere Meinungen vertreten Huber<br />
und Ziegler allerdings, wenn es um gedruckte<br />
Musik geht. „Es gibt Dinge, die<br />
haptisch mehr Sinn machen“, erläutert<br />
Ziegler. Daher sei sie auch sehr zuversichtlich,<br />
was die Zukunft von „The Gap“<br />
betrifft, da die Marke sehr gut funktioniere<br />
und Teile der Zielgruppe es eher<br />
als Print-Magazin statt als Online-Medium<br />
kennen. Die Menschen, die in den<br />
1970er bis 1990er ihre Musiksozialisationsphase<br />
hatten, wären auch heute<br />
noch bereit, hohe Preise für Schallplatten<br />
und Special Interest-Magazine zu<br />
bezahlen, erläutert Huber. So lange diese<br />
Zielgruppe groß genug sei, zahle es<br />
sich für einzelne Magazine aus, diese zu<br />
produzieren. Warum „SPEX“ nicht mehr<br />
funktioniere, „The Gap“ aber sehr wohl,<br />
sei laut Ziegler nicht eindeutig zu sagen.<br />
„Der Markt in Deutschland ist anders<br />
als in Österreich, Musikmärkte lassen<br />
sich nicht vergleichen.“ Obwohl es der<br />
gleiche Sprachraum ist, sei die Kultur<br />
eben doch anders. „ ‚SPEX‘ war in den<br />
1980er Jahren ein kritisches Medium“,<br />
für innovative Inhalte sehe man sich<br />
heute jedoch lieber Blogs an, berichtet<br />
Huber und gibt an, dass das Internet<br />
„SPEX“ den Rang abgelaufen habe.<br />
30<br />
Keine Thema Zukunft für Musikmedien?
Musikwahrnehmung heute<br />
Laut dem Musiksoziologen habe die Bedeutung<br />
von Musikrezeption insgesamt<br />
verloren, denn „so intensiv beschäftigt<br />
sich heute niemand mehr mit Musik,<br />
also sich hinzusetzen und anzusehen,<br />
wie ein Cover gestaltet ist, Texte und<br />
Informationen zu KünstlerInnen nachzulesen,<br />
interessiert die Leute nicht<br />
mehr“. Grund dafür sei, dass die Freizeitgestaltung<br />
früher nur beschränkte<br />
Möglichkeiten bot und man heute wesentlich<br />
mehr Möglichkeiten hätte. Dieser<br />
Meinung ist Ziegler nicht, denn zumindest<br />
in ihrem Freundeskreis werde<br />
viel über Popmusik und „Hintergründe<br />
von KünstlerInnen sowie über gesellschaftspolitische<br />
Strömungen, die diese<br />
auslösen“, diskutiert. Doch nicht nur<br />
in ihrem Bekanntenkreis, auch auf Social<br />
Media gebe es viele Diskussionen,<br />
die bei einigen Fans mancher Künstler-<br />
Innen gar als Religionsersatz bezeichnet<br />
werden könnten. Bei der Fanbase<br />
von Taylor Swift etwa gäbe es „ganze<br />
Dissertationen, welche Sexualität und<br />
Hintergründe sie hat“ sowie penibelste<br />
Analysen ihrer Musik. Einig sind sich<br />
die beiden MusikexpertInnen bei der<br />
Überschwemmung des heutigen Musikangebots,<br />
was aber laut Ziegler nicht<br />
unbedingt zu einer verminderten Auseinandersetzung<br />
mit Musik führe, denn<br />
gerade aufgrund des vermehrten Angebots<br />
setzten sich MusikenthusiastInnen<br />
intensiver mit Musik auseinander.<br />
Musikmedien heute müssten daher als<br />
„Meinungsorgan auftreten, das Diskussionen<br />
anstößt und vor allem Kontextwissen<br />
anbietet“, fordert Ziegler. Wenn<br />
etwa die Veröffentlichung eines neuen<br />
Albums anstehe, müsse man laut Ziegler<br />
aufzeigen: „Was passiert dahinter,<br />
daneben, davor, darunter und darüber?“<br />
(Noch) Kein Ende in Sicht<br />
Auf die zukünftige Entwicklung von<br />
Musikmedien angesprochen, meint<br />
Theresa Ziegler, dass vor allem Print-<br />
Magazine sich weg von der Newsorientierung<br />
hin zu meinungs- und kontextbildenden<br />
Inhalten bewegen sollen,<br />
denn für News gebe es ja das Internet<br />
und die jeweiligen Social Media-Kanäle<br />
der KünstlerInnen selbst. In eine ähnliche<br />
Kerbe schlägt auch Michael Huber.<br />
„Es gibt nach wie vor eine kritische<br />
Masse, die gerne etwas in der Hand<br />
hat“ und solange diese Masse groß<br />
genug sei, werde es Musik in gedruckter<br />
Form geben. Dem Musikfernsehen<br />
hingegen beschert der Musiksoziologe<br />
keine Zukunft. „Wenn sie ‚gotv‘ morgen<br />
abdrehen, würde mir das nicht auffallen.“<br />
Dafür würde beispielsweise eine<br />
wöchentliche Sendung wie „Tracks“<br />
auf ARTE völlig ausreichen. Ein eigener,<br />
linearer 24 Stunden-Musiksender<br />
sei aufgrund von „YouTube“ mittlerweile<br />
überflüssig. Bei gedruckten Musikangeboten<br />
sieht er hingegen noch<br />
Potential. Das Magazin für Vinyl-Kultur<br />
„MINT“ etwa würde von Jahr zu Jahr<br />
umfangreicher. Auch Vinyl-Schallplattenspieler<br />
wären bereits out gewesen,<br />
mittlerweile kommen aber viele neue<br />
Einsteigermodelle auf den Markt. Einzig<br />
ein TV-Format, das all diese Interessen<br />
bündle könne funktionieren.<br />
No „VIVA“, no Friday<br />
Ein Freitag im November 2020, 14:00<br />
Uhr. Ich eile nicht von der Fachhochschule<br />
nach Hause, denn dank Corona<br />
und Fernlehre bin ich bereits da. Mein<br />
Bruder wartet nicht vor dem Fernseher,<br />
er ist ausgezogen. Die „VIVA Top 100“<br />
gibt es nicht mehr, da „VIVA“ Ende 2018<br />
eingestellt wurde.<br />
von David Pokes<br />
Michael Huber / Copyright: Daniel Willinger<br />
Theresa Ziegler / Copyright: Alexia Fin<br />
© Copyright: adobe stock / Mizkit<br />
Keine Zukunft für Musikmedien?<br />
31
© Copyright: adobe stock / pusteflower9024<br />
„Propaganda liegt in der Natur<br />
des Missionierens“<br />
Während alte Religionen den digitalen Wandel verschlafen haben, schaffen es andere, Social Media<br />
für ihre Zwecke zu nutzen. <strong>SUMO</strong> sprach mit Gert Pickel, Religionssoziologe an der Universität<br />
Leipzig, Frederik Elwert, „relNet“-Projektkoordinator der Ruhr-Universität Bochum, und Fabian<br />
Reicher, Sozialarbeiter der Extremismus-Beratungsstelle in Wien, über Religionspropaganda und<br />
Extremismus in sozialen Medien.<br />
„Facebook“, „Twitter“, „Instagram“… –<br />
laut „DataReportal“ benützte im Juli<br />
2020 jeder zweite Mensch auf der Welt<br />
Social Media. Obwohl soziale Medien in<br />
den vergangenen Jahren ein zentraler<br />
Bestandteil der postmodernen Kultur<br />
geworden sind, gibt es immer noch<br />
Bereiche, die von der Digitalisierung<br />
diesbezüglich nicht erreicht wurden.<br />
Ein Beispiel dafür ist Religion, allen<br />
voran die großen westlichen Kirchen.<br />
Diese zeigen sich nach wie vor zaghaft<br />
und weisen noch keine fundierte<br />
Social Media-Präsenz auf. „Die klassischen<br />
Kirchen tun sich noch etwas<br />
schwer. Die großen Volkskirchen sind<br />
eher wie Tanker und keine Schnellboote,<br />
sie bewegen sich sehr langsam. In<br />
vielen Gemeinden hängt es dann von<br />
den einzelnen Pfarrern ab“, erläutert<br />
Religionssoziologe Gert Pickel bildhaft.<br />
Es gebe sehr „Instagram“- und<br />
„Twitter“-affine Pfarrer und bestimmt<br />
auch solche, die im Umgang mit Computern<br />
absolut nicht firm seien. Laut<br />
Pickel arbeite man sich stückchenweise<br />
in den Bereich hinein. Vor allem für<br />
Mainstream-Kirchen sei Social Media<br />
schwer handzuhaben. Dies sei darauf<br />
zurückzuführen, dass sowohl die Kernanhängerschaft<br />
der Kirchen nicht mehr<br />
die jüngste sei und nicht unbedingt<br />
sicher betreffs Social Media. Frederik<br />
Elwert, Koordinator des Projektes „rel-<br />
Net“ – „Modellierung von Themen und<br />
Strukturen religiöser Online-Kommunikation“<br />
– sieht das ähnlich: „Die sozialen<br />
Medien fungieren nach einer anderen<br />
Logik, die nicht mit der Logik vieler<br />
Religionsgemeinschaften kompatibel<br />
ist. Bei der Frage wie ein Influencer Gehör<br />
erhält und sich eine Followerschaft<br />
aufbaut, muss das nicht der sein, der<br />
einen theologischen Grad hat und ein<br />
kirchliches Amt bekleidet. Sondern es<br />
sind dann vielleicht gerade eben nicht<br />
diese Personen.“ Obwohl sich die traditionellen<br />
Glaubensgemeinschaften<br />
mit dem Umstieg in soziale Netzwerke<br />
schwertäten, rät Pickel dennoch:<br />
„Man sollte es auf jeden Fall machen,<br />
aber sich auch nicht zu viel davon versprechen.<br />
Religionen sind ein sehr soziales<br />
Geschäft, persönlicher Kontakt<br />
ist dort sehr zentral.“ Es sei eine Möglichkeit<br />
Kontakte herzustellen, die man<br />
anschließend Face-to-Face vertiefen<br />
könne. Laut Pickel liege das Problem<br />
dabei, dass Social Media sehr persönlichkeitsorientiert<br />
seien. Dies würde es<br />
zwar erlauben, einzelnen Pfarrern sehr<br />
gut zu handeln, erschwere es aber einer<br />
riesigen Institution wie einer Kirche. „Da<br />
kommt man dann schnell steif, starr<br />
oder sogar peinlich rüber“, fügt Picke<br />
hinzu.<br />
Ein Beispiel für einen Priester, der einen<br />
modernen Umgang mit Social Media<br />
pflegt und großen Erfolg damit erzielt<br />
ist Reverend Christopher Lee von der<br />
Church of England. Er ist bekannt für<br />
Beiträge auf „YouTube“ und „Instagram“,<br />
wo er über sein Leben und seinen<br />
Glauben spricht. Seit nun über fünf Jahren<br />
hat er seinen „Instagram“-Account<br />
und konnte in der Zeit 177.000 AbonnentInnen<br />
gewinnen. In einem Interview<br />
mit „The Guardian“ (20.06.2020)<br />
erzählte er, was er alles teile: „On Instagram<br />
I share all the things I love –<br />
sport, my family, God – but I don’t do<br />
‘cut-and-paste church’. You won’t find<br />
long sermons from me”. Obwohl man<br />
den Zug bisher verpasst habe, seien die<br />
Kirchen laut Pickel gerade dabei, sich<br />
besser aufzustellen. Ein weiteres positives<br />
Beispiel dafür ist Papst Franziskus<br />
selbst. Neben einem „YouTube“-Kanal<br />
namens „Vatican News“ ist der Vatikan,<br />
insbesondere der Papst selbst, auf<br />
„Instagram“ und „Twitter“ aktiv und hat<br />
auf beiden Plattformen 7,5 Mio. sowie<br />
18,8 Mio. FollowerInnen. Laut dem Artikel<br />
„Kirche 2.0 – Religion im Zeitalter<br />
von Social Media“ von Katrin Lückhoff<br />
(„kingkalli.de“, 03.03.2017) sitze er<br />
zwar nicht persönlich am Smartphone<br />
und schreibt Tweets, sondern er habe<br />
ein Social Media-Team. Er entscheide<br />
jedoch über den Text und die Bilder, die<br />
sein Team ihm vorlege.<br />
Untätig seien beispielsweise die Evangelische<br />
Kirche Deutschlands oder die<br />
Katholische Kirche zwar nicht, jedoch<br />
32<br />
„Propaganda liegt in der Natur des Missionierens“
seien deren Internet-Auftritte nicht<br />
immer gelungen. „Wenn die Kirchen im<br />
Internet pop-mäßig auftreten und beispielsweise<br />
eine junge Frau irgendetwas<br />
rappen lassen, fragt man sich danach<br />
gerne:‚‚Leute, seid ihr noch ganz<br />
dicht?‘ So etwas kommt überhaupt<br />
nicht gut an und ist meistens nur peinlich“,<br />
stellt Pickel klar. Besser als die großen<br />
Religionsgemeinschaften schlügen<br />
sich kleinere, nicht nur traditionelle und<br />
stark auf Jugend ausgerichtete Gemeinschaften,<br />
gerade aus dem evangelikalen<br />
oder freikirchlichen Bereich. Diese<br />
würden oft einen Mix aus größeren<br />
Events und einer begleitenden Social<br />
Media-Strategie entwickeln und seien<br />
ausgesprochen modern aufgebaut.<br />
Im Allgemeinen profitieren kleinere<br />
Religionsgemeinschaften überdurchschnittlich<br />
von sozialen Netzwerken,<br />
da sie sich dadurch besser verknüpfen<br />
können.<br />
In den Tiefen der Online-Foren<br />
Ein Paralleltrend zu Social Media im<br />
religiösen Kontext stellen religiöse Online-Foren<br />
dar. Dort können sich Gläubige<br />
in unterschiedlichsten Räumen austauschen.<br />
Ruft man solch eine Seite auf,<br />
kann man oft nicht anders als schmunzeln<br />
– unabhängig von der eigenen<br />
(Nicht-)Religiosität. In zahlreichen Themenbereichen,<br />
die von „Bibel-Diskussion“<br />
über „Single-Chats für Christen“<br />
bis hin zu „Verschwörungstheorien<br />
und Korruption“ reichen, tauschen sich<br />
tausende Gläubige aus aller Welt aus,<br />
diskutieren oder streiten miteinander.<br />
Manche von ihnen besitzen sogar eine<br />
eigene Chat-App. Wagt man den Schritt<br />
sich diese runter zu laden, taucht man<br />
in eine skurrile Welt ein. Betritt man das<br />
erste Mal den grell-weißen Chatroom<br />
(Anm. der Red.: dieser wird bewusst<br />
nicht genannt), wird man von jeder anderen<br />
Person im Raum begrüßt – von<br />
jeder einzelnen. Nachdem sich die Flut<br />
aus Grußworten und lustigen Katzenbildern<br />
gelegt hat, kommt plötzlich die<br />
erste Nachricht von einer fremden Person,<br />
ohne zuvor ein Wort gewechselt<br />
zu haben, und wünscht mir: „Friede sei<br />
mit dir“. Der danach folgende Austausch<br />
bestehend aus Small-Talk-Floskeln gestaltet<br />
sich als sehr oberflächlich und<br />
oft von kurzer Dauer, da GesprächspartnerInnen<br />
oft spontan den Raum<br />
verlassen oder ihm beitreten.<br />
„Obwohl diese Technologie bereits in<br />
die Jahre und etwas aus der Mode gekommen<br />
ist, erfüllt sie durchaus noch<br />
einen Zweck“, konstatiert Frederik Elwert.<br />
Er war Projektkoordinator des<br />
Projekts „relNet“ und untersuchte dabei<br />
ebensolche Online-Foren. Der zuvor<br />
genannte Zweck könne darin bestehen,<br />
einfach mehr Kontrolle darüber zu haben,<br />
was für eine Art von Netzwerk<br />
man da für andere zugänglich mache.<br />
„Für religiöse Gemeinschaften kann es<br />
nach wie vor relevant sein, sich gegen<br />
eine ‚Facebook‘-Gruppe zu entscheiden<br />
und stattdessen so ein Forum zu<br />
gründen, um eben Einfluss darüber zu<br />
haben, welche Inhalte dort zu sehen<br />
sind“, erklärt Elwert. Diese Foren seien<br />
faszinierend, weil sie in gewisser Weise<br />
in sich abgeschlossene Mikrokosmen<br />
darstellen. Ein spezifisches Thema, für<br />
das sich sein Projekt besonders interessierte,<br />
war die Alltagsdimension der<br />
konservativen Gemeinschaften, die sich<br />
in den Online-Foren aufhielten. Obwohl<br />
es manchmal auch eine politische Diskussion<br />
gebe, habe es dort oft keinen<br />
aktivistischen Impetus und es gehe<br />
häufig darum, wie man bestimmte religiöse<br />
Alltagsregeln unter modernen<br />
Bedingungen anwende, die nicht 1:1<br />
aus der Bibel oder dem Koran ins reelle<br />
Leben übertragbar seien. Auch banale<br />
Themen ohne religiöse Dimension seien<br />
dort üblich, wie beispielsweise der<br />
Austausch von Kochrezepten. Religiöse<br />
Diskussionen mit Mitgliedern anderer<br />
Religionen fänden schwerpunktmäßig<br />
jedoch eher nicht statt. In den islamischen,<br />
stärker salafistisch ausgerichteten<br />
Foren spiele die Diskussion innerhalb<br />
der muslimischen Mission, vor<br />
allem zwischen Schia und Sunna, eine<br />
ganz starke Rolle. In christlichen Foren<br />
seien es meistens Diskussionen mit<br />
AtheistInnen, die sich dann auch zum<br />
Teil aktiv in dieses Forum einbrächten.<br />
Solche Foren würden meist unabhängig<br />
und von Privatpersonen oder christlichen<br />
Verlagen betrieben, anstatt von<br />
Seiten der offiziellen Religionen. Die<br />
großen Glaubensgemeinschaften hätten<br />
zwar Experimente in diese Richtung<br />
gestartet, diese hätten aber auf Dauer<br />
nicht gut funktioniert.<br />
Propaganda auf Social Media<br />
Die Frage was in sozialen Netzwerken<br />
und solchen Online-Foren schlussendlich<br />
unter Religionspropaganda fällt, ist<br />
nicht leicht zu beantworten. „Grundsätzlich<br />
ist Mission ein sehr propagandagesteuertes<br />
Unternehmen. Wenn<br />
man Mission richtig denkt, ist es vor<br />
allem im Christentum und Islam besonders<br />
ausgeprägt und der Gedanke von<br />
Mission und Gläubigen zentral. Dazu<br />
wird eigentlich nichts anderes als Propaganda<br />
verwendet“, erläutert Pickel.<br />
Und dies mache man gar nicht so ungeschickt<br />
an vielen Stellen. War man<br />
beispielsweise einmal in Lourdes, finde<br />
man dort überwiegend eine starke Inszenierung<br />
vor, in der auch Propagandabotschaften<br />
implementiert seien.<br />
Betrachte man Propaganda im klassischen<br />
politischen Verständnis, könne<br />
Gert Pickel / Copyright: Universität Leipzig<br />
Frederik Elwert / Copyright: Matthias Zucker<br />
man es vielleicht nicht als Propaganda<br />
bezeichnen. Der Übergang sei laut Pickel<br />
jedoch fließend, da das Ziel jeder<br />
Religionsgemeinschaft das Gewinnen<br />
und Halten von Mitgliedern sei. Von<br />
einem religiösen Standpunkt aus betrachtet,<br />
sei es schwierig zu sagen, was<br />
erlaubt sei und was nicht. „Das Einzige,<br />
was man als Grenze ziehen kann ist,<br />
was man generell bei Propaganda als<br />
Grenze zieht, sprich was menschenfeindliche<br />
oder antisemitische Inhalte<br />
besitzt“. Vor allem dogmatische religiöse<br />
Gemeinschaften, besonders aus den<br />
USA, weisen eine robuste Mitteilungspolitik<br />
auf, mit der sie Erfolge erzielen<br />
und die durchaus in den Rechtspopulismus<br />
oder sogar -extremismus hineinreiche.<br />
„Ein Missionar-Hintergrund liegt<br />
immer nahe, dass man Propaganda und<br />
Mitgliedergewinnung fährt, aber die<br />
Grenzen kann man nur jenseits eines<br />
Religiösen ziehen. Propaganda liegt<br />
in der Natur des Missionierens“, ergänzt<br />
Pickel. Das sei aber immer eine<br />
begriffsdefinitorische Sache, wofür<br />
Propaganda nun stehe. Verstehe man<br />
Propaganda als etwas, das dabei hilft<br />
meiner Gemeinschaft mehr Mitglieder<br />
„Propaganda liegt in der Natur des Missionierens“<br />
33
zukommen zu lassen, dann sei das was<br />
die Religionen machen Propaganda.<br />
Wenn man den Begriff politisch oder<br />
gar negativ konnotiert, vielleicht von<br />
der Verwendung im Nationalsozialismus<br />
geprägt, betrachtet, dann müsse<br />
man eine solche Übertragung vorsichtiger<br />
sehen. Betrachte man Glauben als<br />
Ideologie und möchte andere von dieser<br />
Ideologie überzeugen, sei man, laut<br />
Pickel, schon recht nahe an der politischen<br />
Propaganda.<br />
Extremismus auf Social Media<br />
In der extremsten Variante religiöser<br />
Propaganda wird Überzeugung schließlich<br />
zu Extremismus. Im Aufsatz „Soziale<br />
Medien und (De-)Radikalisierung“<br />
aus dem Buch „Digitale Polizeiarbeit“<br />
(2018) schrieb Holger Nitsch, dass soziale<br />
Medien heutzutage eine besondere,<br />
immer stärker werdende Rolle bei<br />
der Radikalisierung einnehmen. Laut<br />
Religionssoziologe Pickel finde man<br />
Anknüpfungspunkte zwischen religiöser<br />
und extremistischer Propaganda.<br />
Beispielsweise ließen sich ähnliche<br />
Positionen gegenüber Homosexuellen<br />
und MuslimInnen bei dogmatischen<br />
christlichen Gemeinschaften durchaus<br />
finden. Diese seien also nicht von Natur<br />
aus nur offen und tolerant, sondern auf<br />
dieser Ebene gelegentlich von Vorurteilen<br />
belastet. Hier komme es durchaus<br />
zu Überschneidungen von dogmatischen<br />
bis fundamentalistischen Christ-<br />
Innen mit Argumenten aus extremistischen<br />
Strömungen. In diesem Fall<br />
möchten Rechtsextreme Personen für<br />
sich gewinnen, die mit der modernen<br />
Gesellschaft schlecht zurechtkämen,<br />
die Homosexualität ganz fürchterlich<br />
fänden und vom Gender-Punkt genervt<br />
seien. Auf diese Weise denken sie Menschen<br />
bis in die Gesellschaftsmitte zu<br />
erreichen. Die Religiösen, die sich darauf<br />
einlassen, wollen nicht unbedingt<br />
rechtsextrem sein, fänden aber ein paar<br />
ihrer Argumente gut, wie sie beispielsweise<br />
auf PEGIDA-Versammlungen<br />
oder anderen Kundgebungen kundgetan<br />
würden.<br />
Auch der Islamische Staat (IS) benütze<br />
laut der Studie von Adam Badawy<br />
und Emilio Ferrara „The rise of Jihadist<br />
propaganda on social networks“<br />
(„Journal of Computational Social Science“,<br />
03.04.2018) vorwiegend soziale<br />
Netzwerke, vor allem „Twitter“, um ihre<br />
Propaganda zu verbreiten. Beispielsweise<br />
verbreiten sie ihre theologische<br />
Verteidigung und Rechtfertigungen<br />
online, nachdem sie Gewalt an Minderheiten<br />
ausüben. Diese Gruppierung und<br />
sonstige Extremisten machen sich laut<br />
Nitsch einen offensichtlichen Nachteil<br />
von Social Media zunutze: die schwierige<br />
Überprüfbarkeit der Validität dargebotener<br />
Informationen. Falsche oder<br />
unvollständige Informationen werden<br />
so ungeprüft und nicht widerlegt von<br />
den RezipientInnen übernommen. So<br />
genannte „foreign fighters“ des IS berichteten<br />
beispielsweise öfters über<br />
„Twitter“ über das „gute Leben“ in ihren<br />
Camps. Dabei werden gezielt normale<br />
Bedürfnisse wie Anerkennung,<br />
Selbstdarstellung, Macht oder Ruhm<br />
angesprochen – jedoch auf religiös<br />
verbrämt-machistische Art. Auch Mädchen<br />
und Frauen sind von ähnlicher<br />
Propaganda in sozialen Netzwerken<br />
betroffen. So sei laut Nitsch der Anteil<br />
der nach Syrien ausreisewilligen Frauen<br />
ab 2015 angestiegen. Diese würden<br />
zumeist etwas von dem Ruhm der<br />
„Gotteskrieger“ abhaben wollen. Auch<br />
andere Effekte wie Anonymität und<br />
Nutzerfreundlichkeit machen Social<br />
Media und das Internet generell interessant<br />
für Extremisten. Nitsch fand<br />
weiters heraus, dass der Radikalisierungsprozess<br />
zum Extremisten einen<br />
radikalen Wandel im Leben eines Individuums<br />
darstelle. Dieser Meinung ist<br />
auch Fabian Reicher, Sozialmitarbeiter<br />
der österreichischen Beratungsstelle<br />
für Extremismus: „Wir alle kennen<br />
das, jede/r hat im Leben Momente, in<br />
denen man anfällig ist. Es gibt eine Art<br />
Unmut oder eine Entfremdung von der<br />
Gesellschaft, und wenn dann jemand<br />
kommt, der einem/r eine Lösung anbietet<br />
und eine Erklärung liefert, warum es<br />
einem/r schlecht geht, beispielsweise<br />
weil der Westen MuslimInnen hasse,<br />
kann es zu Radikalisierungsprozessen<br />
kommen.“ Dem würden sich Gruppendynamiken<br />
anschließen, auch im Online-Bereich,<br />
denn einen Gruppenbezug<br />
gebe es immer. Wie Personen in Kontakt<br />
mit Extremisten kämen, sei laut<br />
Reicher sehr unterschiedlich. Manche<br />
hätten in ihrem Umfeld den Erstkontakt,<br />
sie kannten also jemanden persönlich<br />
oder lernten jemanden kennen,<br />
aber oft finde der erste Kontakt mit<br />
einer Ideologie im Internet statt. Gerade<br />
Gruppen wie IS und Al-Quaida finde<br />
man in Messenger-Diensten und Online-Foren.<br />
Gruppierungen, die Reicher<br />
als extremistisch einstufen würde, die<br />
jedoch im legalen Bereich tätig seien<br />
wie beispielsweise manche neo-salafistische<br />
und islamistische Gruppen,<br />
seien hingegen sehr stark auf „Instagram“<br />
vertreten. Diese seien aber etwas<br />
anderes als Jihadisten.<br />
Werbung (oder Propaganda) liegt in der<br />
Natur einer religiösen Gemeinschaft.<br />
Sie ist der Antrieb, der sie am Leben erhält<br />
und neue Mitglieder gewinnt. Soziale<br />
Netzwerke stellen ein mächtiges<br />
Sprachrohr für genau das dar. Manche<br />
haben es geschafft, das Potenzial dieser<br />
Werkzeuge zur Gänze auszunützen,<br />
andere, wie beispielsweise die Großkirchen,<br />
hinken noch hinterher. Letztendlich<br />
muss uns bewusst werden, dass<br />
nicht alle religiösen Gruppierungen auf<br />
Social Media mit ihren Botschaften<br />
immer unser Wohl im Sinn haben, sondern<br />
manchmal ihre eigene, extremere<br />
Agenda verfolgen.<br />
von Alexander Schuster<br />
© Copyright: adobe stock / Robert Przybysz<br />
34<br />
„Propaganda liegt in der Natur des Missionierens“
Auf der Flucht vor der Krise<br />
Krisensituationen können besonders belastend auf die Psyche wirken. Um unangenehmen Gedanken und Gefühlen<br />
aus dem Weg zu gehen, bietet die Rezeption von Medieninhalten viele Möglichkeiten. Dieses Fluchtverhalten<br />
vor der Realität wird mit dem Begriff Eskapismus beschrieben. Aber was genau ist medialer Eskapismus?<br />
Welche Rolle spielt er in Krisensituationen und wie wirkt er sich aus? Diesen Fragen besprach <strong>SUMO</strong> mit<br />
dem Rezeptions- und Wirkungsforscher Univ.-Prof. Jörg Matthes sowie einem anonymen Medienrezipienten.<br />
© Copyright: adobe stock / Alina Rosanova<br />
Der Begriff Eskapismus ist eng verwandt<br />
mit dem englischen Wort „escape” und<br />
beschreibt die Flucht vor der Realität. Er<br />
gilt in der Medienpsychologie als wichtiges<br />
Erklärungsmotiv für die Mediennutzung.<br />
„Es geht dabei um den Gedanken,<br />
dass ich vor den Problemen, die mich in<br />
meinem Leben beschäftigen, in eine andere<br />
Welt fliehe. Beispielsweise in eine<br />
Welt, die ich in den Medien, in Romanen<br />
und Filmen erleben kann. Eskapismus<br />
ist die Flucht vor Problemen in meinem<br />
Alltag”, so Matthes. Christoph Kuhlmann<br />
und Volker Gehrau teilen in „Auf der<br />
Flucht vor dem Tod?” (2011) den Begriff<br />
Eskapismus in die drei Formen Veränderung,<br />
Verschiebung und Verdrängung<br />
ein. Aber in welchen Situationen greifen<br />
Menschen auf Eskapismus zu? Dazu<br />
Matthes, Vorstand des Instituts für Publizistik-<br />
und Kommunikationswissenschaft<br />
Wien: „Wenn ich die Realität nicht<br />
mehr aushalte. Wenn die Gedanken, die<br />
mich in meiner Realität beschäftigen so<br />
belastend sind, dass ich in eine mediale,<br />
meist narrative Welt fliehe. In diese begibt<br />
man sich, fühlt und erlebt dort stellvertretend<br />
mit den AkteurInnen mit, um<br />
dann die eigenen Sorgen und Ängste in<br />
der eigenen Welt zu vergessen und diese<br />
auszublenden.”<br />
Die Differenzierung davon, ab wann<br />
man von Eskapismus spricht und wann<br />
nicht, ist schwer festzulegen. Dies sei<br />
ein Problem der Eskapismus-These.<br />
„Wenn beispielsweise aufgrund der Corona-Krise<br />
mehr Leute Serien schauen<br />
oder mehr Romane lesen, ist das nicht<br />
automatisch gleich mehr Eskapismus.<br />
Wenn ich mir zur Entspannung abends<br />
einen Film anschaue, ist das auch nicht<br />
automatisch Eskapismus. Eskapismus<br />
ist die Realitätsflucht, das Davonlaufen<br />
vor den Sorgen, die man hat und sich in<br />
einer mentalen Scheinwelt zu bewegen”,<br />
so Matthes. Man müsse darauf achten,<br />
das Verhalten der RezipientInnen nicht<br />
zu stark zu psychologisieren.<br />
Auf welche Medien wird zugegriffen?<br />
Für den Eskapismus würden sich laut<br />
Matthes vor allem narrative Medien und<br />
Angebote, die starke Emotionen vermitteln,<br />
eignen. „Das sind Medien, bei<br />
denen mir Geschichten erzählt werden.<br />
Geschichten, auf die ich mich einlassen<br />
kann, weil ich mich dann nicht mehr mit<br />
meinen eigenen Problemen auseinandersetzen<br />
muss, sondern mit den Problemen<br />
des Charakters oder Akteurs, der<br />
mir in den Medien gezeigt wird. In die<br />
ich mich hineinversetze, das Geschehen<br />
miterlebe. Man spricht in der Literatur<br />
auch von Transportation: Man transportiert<br />
sich in die Medienwelt hinein, ist<br />
dort stellvertretend anwesend und erlebt<br />
es mit, als ob man selbst dabei sei”.<br />
Kuhlmann und Gehrau untersuchten<br />
in ihrer Studie, welche Wirkungen die<br />
Mediennutzung auf die Beantwortung<br />
existenzieller Fragen hat. Besonders<br />
die Ergebnisse zum Medium Fernsehen<br />
und zu Computerspielen stechen dabei<br />
heraus. Rund 49% der Befragten gaben<br />
an zur Ablenkung fernzusehen, aber<br />
nur 8% um sich mit wichtigen Fragen zu<br />
beschäftigen. Computerspiele werden<br />
neunmal öfter zur Vermeidung von, als<br />
zur Beschäftigung mit wichtigen Fragen<br />
genutzt. Diese Differenzen weisen darauf<br />
hin, dass die beiden Medien eher zur<br />
Vermeidung taugen und deshalb besonders<br />
für Eskapismus relevant sind.<br />
Eskapismus in Krisensituationen<br />
Krisen können besonders das psychische<br />
Wohlergehen der betroffenen<br />
Personen beeinträchtigen. Dies bestätigt<br />
beispielsweise eine Umfrage<br />
der Donau-Universität Krems und des<br />
österreichischen Bundesverbands für<br />
Psychotherapie. Dabei wurden PsychotherapeutInnen<br />
zu den Auswirkungen<br />
der COVID-19 bedingten Maßnahmen<br />
auf die psychische Gesundheit befragt.<br />
Davon berichten 70% über ausschließlich<br />
negative Auswirkungen. Dies betrifft<br />
vor allem Angst, Einsamkeit und<br />
Beengtheit durch die Familie. „Wenn<br />
ich eine Krise tatsächlich als psychologische<br />
erlebe, steigt natürlich die<br />
Wahrscheinlichkeit für den Eskapismus”,<br />
stellt Matthes fest. Je stärker eine<br />
Krise auftrete, desto höher sei auch die<br />
Wahrscheinlichkeit des Eskapismus.<br />
Aber nicht jede verstärkte Mediennutzung<br />
sei automatisch als Eskapismus zu<br />
verstehen.<br />
Auf der Flucht vor der Krise<br />
35
Gefahren des Eskapismus<br />
„Die Flucht aus meiner Realität ist<br />
wahrscheinlich keine Lösung für die<br />
Probleme, die ich empfinde. Sobald ich<br />
den Fernseher wieder ausschalte, bin<br />
ich wieder zurück in meiner alten Welt<br />
und habe dieselben Probleme wie zuvor.<br />
Ich habe sie nur vertagt”, beschreibt<br />
Matthes. Das Problematische am Eskapismus<br />
sei vor allem die mangelnde<br />
Auseinandersetzung mit den Dingen,<br />
die die betroffene Person belasten. Dabei<br />
gebe es die Gefahr, in eine Spirale<br />
hineinzugelangen und die Kontrolle zu<br />
verlieren. Dieser Kontrollverlust über<br />
das Nutzungsverhalten werde auch exzessive<br />
Mediennutzung genannt.<br />
Wer trägt die Verantwortung?<br />
Bei der Betrachtung möglicher negativer<br />
Konsequenzen kommt die Frage<br />
auf, ob man dafür jemanden verantworten<br />
kann oder ob Eskapismus sogar<br />
gezielt von den Anbietern ausgenutzt<br />
wird. Grundsätzlich sei der/die AkteurIn<br />
selbst verantwortlich für die Entscheidungen,<br />
die er oder sie treffe. „Natürlich<br />
spielt auch die Kultur und der soziale<br />
Kontext, in dem wir uns bewegen eine<br />
Rolle. Man kann aber schwer sagen,<br />
dass die Produktionsfirmen und die<br />
Unterhaltungsindustrie dafür verantwortlich<br />
sind.” Der Versuch, für die produzierten<br />
Inhalte begeistern zu wollen<br />
sei dabei laut Matthes durchaus legitim.<br />
Erfahrungen eines Rezipienten<br />
„Ich bin eher ein extrovertierter Mensch<br />
und ziehe meine Energie aus der Gesellschaft<br />
mit anderen Menschen. Und<br />
wenn diese gesellschaftliche Situation<br />
fehlt, fehlt einem einfach der Ausgleich.<br />
Man sitzt zu Hause, es fehlt einem aufgrund<br />
der Fernlehre die Motivation für<br />
das Studium und man muss sich ständig<br />
vor den Eltern rechtfertigen, die die<br />
Situation nicht verstehen”, beschreibt<br />
der 21-jährige Medienrezipient seine<br />
Problemsituation. „Da ist es natürlich<br />
höchstkonventionell, beispielsweise<br />
das Handy in die Hand zu nehmen, damit<br />
man die Alltagsprobleme vergisst<br />
und ausschalten kann. Dann kann ich<br />
zum Beispiel über Social Media, Games,<br />
Filme oder Serien meine Gedanken vergessen.<br />
Ich würde das als Austausch der<br />
Probleme, die man im Kopf hat mit Content,<br />
den man sich von solchen Medien<br />
holt, beschreiben”. Vor allem Games<br />
würden das Gefühl vermitteln, in einer<br />
anderen Welt zu sein. „Der Grund, warum<br />
für mich Spiele so anziehend sind<br />
ist, dass du dich in eine Welt hineinversetzt,<br />
die du selbst in der Hand hast und<br />
in der du selbst Entscheidungen treffen<br />
kannst. Es werden einem in Spielen Probleme<br />
an den Kopf geworfen, die sich<br />
lösen lassen. Das ist dann Ablenkung,<br />
indem man virtuelle Probleme löst.”<br />
von Christian Krückel<br />
Jörg Matthes / Copyright: Barbara Mair<br />
mein wasichwillplus<br />
für Studenten<br />
15 %<br />
mehr fernsehen, internet, telefonie & mobile, mehr ich<br />
auf alle<br />
Internet-Produkte *<br />
0800 800 514 / kabelplus.at<br />
Ganz einfach<br />
mit Rabattcode<br />
k+2021<br />
bestellen<br />
* Aktion gültig bis auf Widerruf bei Neuanmeldung / Upgrade aller Internet Privat-Produkte (ausgenommen waveNET, OAN und kabelplusMOBILE Produkte) unter Angabe vom Aktionscode „k+2021“ bei der Bestellung. Auf alle NET und<br />
COMPLETE Produkte<br />
36 Medialer 15% Rabatt für 24 Eskapismus<br />
Monate bei 24 Monaten Mindestvertragsdauer, ab dem 25. Monat Preis lt. aktuell gültigem Tarifblatt. Exklusive Entgelte für HD Austria, Family HD, Family HD XL, Fremdsprachenpakete Russisch u.<br />
Serbisch, Adult, zusätzlicher Speicher, Hardwaremiete und kabelTEL Gesprächsentgelt. Zuzüglich Internet-Service-Pauschale 15 Euro/Jahr. Anschlussentgelt (im Wert von 69,90 Euro) ist kostenlos. Gilt für von kabelplus versorgbare Objekte.<br />
Technische Realisierbarkeit und eine Inskriptionsbestätigung ist Voraussetzung. Etwaige Kosten für Hausinstallation sind nicht inkludiert. Kombination mit Aktionen der letzten 6 Monate, Rabatte, Barablöse nicht möglich.
Bob Barbour/Minden Pictures/picturedesk.com<br />
Geballte PR-Power<br />
in einem Tool<br />
Sie haben eine integrierte Kommunikationsstrategie, aber Ihre Applikationen sind<br />
isoliert? Mit dem PR-Desk unter www.pr-desk.at bieten wir Ihnen ein zuverlässiges<br />
System, das Sie bei all ihren Abläufen professionell unterstützt.<br />
Verbreiten, Beobachten, Analysieren und Recherchieren in einem Tool – sparen Sie Zeit<br />
und gewinnen Sie Überblick! Wir beraten Sie gern.<br />
APA-Comm – PR-Desk Support<br />
+43 1 36060-5310<br />
pr-desk@apa.at<br />
pr-desk.at
Modern Loneliness: Zwischen<br />
Likes und Einsamkeit<br />
Likes, Klicks, Follower zur Einsamkeitsreduktion? Die sozialen Medien<br />
werden immer wieder als Grund für, aber auch gegen die Einsamkeit<br />
junger Menschen dargestellt. Die Validität dieser Aussagen bleibt bis lang<br />
unbestätigt. <strong>SUMO</strong> diskutierte mit der Forscherin Univ.-Prof. Sonja Utz<br />
vom Leibniz-Institut für Wissensmedien und Dr. Rebecca Nowland, Psychologin<br />
sowie Forscherin an der University of Central Lancashire, über<br />
den Zusammenhang von Einsamkeit und Social Media.<br />
© Copyright: adobe stock / rodikovay<br />
„Ich finde es eigentlich interessant, dass<br />
diese Frage immer wieder gestellt wird“,<br />
beginnt Sonja Utz ihre Antwort hinsichtlich<br />
der Assoziation von Einsamkeit mit<br />
Social Media. Und auch Psychologin Rebecca<br />
Nowland zeigt sich über diese Ansicht<br />
„frustriert“. Eine deutliche Aussage<br />
über den Einfluss der sozialen Medien<br />
auf die Einsamkeit der Menschen könne<br />
nicht gemacht werden, zahlreiche<br />
Studien seien widersprüchlich und die<br />
allfällig gefundenen Effekte dann sehr<br />
klein, so Utz. Selbst wenn ein negativer<br />
Zusammenhang gefunden werde,<br />
handle es sich oft um Querschnittsstudien.<br />
Man wisse daher nicht, ob die<br />
Nutzung sozialer Medien einsam mache<br />
oder ob einsame Menschen eher soziale<br />
Medien nutzen. Zudem müsse zwischen<br />
bloßem „Alleinsein“ und der „Einsamkeit“<br />
unterschieden werden.<br />
Die Einsamkeit sei ein subjektives Gefühl,<br />
das zeigt, deine Beziehungen treffen<br />
nicht deine Erwartungen, erläutert<br />
Rebecca Nowland. Einsam fühle man<br />
sich nicht nur, wenn man auch tatsächlich<br />
allein ist, denn auch in einem<br />
Raum voller Menschen könne dieses<br />
Gefühl aufkommen. Aber auch ältere<br />
Menschen, die womöglich wirklich allein<br />
sind, fühlen sich mit der Einsamkeit<br />
konfrontiert. Alleinsein hingegen sei, so<br />
Nowland, ein Zustand.<br />
Laut einer Umfrage der BBC aus dem<br />
Jahr 2018, an der rund 55.000 Menschen<br />
teilnahmen, sind besonders junge<br />
Menschen vom Einsamkeitsgefühl<br />
geplagt. Unter den sich in der Alterskohorte<br />
16 bis 24 Jahren befindlichen TeilnehmerInnen<br />
gaben knapp 40% an, mit<br />
dem Gefühl der Einsamkeit vertraut zu<br />
sein. Ob einer der Gründe dafür die sozialen<br />
Medien sind, bringt die BBC-Umfrage<br />
nicht hervor.<br />
Einsam durch den täglichen<br />
Wegbegleiter?<br />
Rebecca Nowland hat eine Antwort auf<br />
die Einsamkeit bei jungen Menschen:<br />
Sie sehe ein Problem, das in dieser<br />
Alterskohorte nicht unüblich sei. Heranwachsende<br />
befinden sich in einer<br />
Selbstfindungsphase, weshalb viele mit<br />
Depressionen und mentalen Problemen<br />
konfrontiert sind. Das Einsamkeitsgefühl<br />
basiere darüber hinaus auch auf<br />
Veränderungen in der Lebenssituation,<br />
erklärt Sonja Utz. Als Beispiel nennt sie<br />
besonders die StudentInnen, welche in<br />
eine neue Stadt ziehen und dort erstmal<br />
weniger Kontakte hätten. Hier scheinen<br />
soziale Medien eine eher nebensächliche<br />
Rolle zu spielen.<br />
Jedoch sei die Einsamkeit mit unseren<br />
Beziehungen in Verbindung zu bringen<br />
und ein Teil unserer Beziehungen im<br />
modernen Leben werden mit Social Media<br />
ergänzt, so Nowland. Die sozialen<br />
Medien tragen zur vermehrten Einsamkeit<br />
bei, seien aber nicht der ultimative<br />
Grund dafür, wie es gerne in den klassischen<br />
Medien dargestellt werde.<br />
Nowland beschreibt die sozialen Medien<br />
daher als „social snacking“, was<br />
so viel bedeutet: wir snacken ständig,<br />
brauchen aber eigentlich den ganzen<br />
Schokokuchen, alias physische Beziehungen.<br />
Die sozialen Medien fungieren<br />
also tadellos als Snack, aber das Völlegefühl<br />
wird nicht erreicht. Vor dem Hintergrund<br />
dessen sollte aber besonders<br />
auf eine angemessene Nutzung geachtet<br />
werden. Zwei Stunden pro Tag auf<br />
„Facebook“ und Co. machen uns nicht<br />
unbedingt einsam, aber wir verlieren<br />
zwei Stunden unseres Tages, sagt Nowland.<br />
Dies könne folglich ungesund sein.<br />
Demnach ist es unser gesundheitsschädigender<br />
Umgang mit den Plattformen,<br />
woraus Isolation resultieren könne.<br />
Aber auch die unzureichende Kontrolle<br />
und Beobachtung der sozialen Medien<br />
sowie die mangelhafte Befassung mit<br />
diesem Thema seien, laut Nowland, relevante<br />
Faktoren. Insofern sollten die<br />
sozialen Medien mehr überprüft werden,<br />
da sie einem nur das zeigen, was<br />
der Mensch davor wirklich sehen möchte<br />
(oder eben genau das Gegenteil). Die<br />
Folge sei die Sucht, die uns vier Stunden<br />
pro Tag davorsitzen lässt.<br />
Die Wirkung der sozialen Medien kann<br />
aber auch von Plattform zu Plattform<br />
38<br />
Modern Thema loneliness: Zwischen Likes und Einsamkeit
variieren. Die möglichen divergenten<br />
Effekte der Plattformen erklärt sich<br />
Sonja Utz aus den unterschiedlichen<br />
Reaktionen darauf. „Facebook“ und<br />
„Instagram“ beispielsweise hätten eine<br />
starke Positivitätsnorm: Menschen<br />
posten die positiven Ausschnitte ihres<br />
Lebens und verwenden dann die Filter,<br />
um diese noch schöner zu machen. Das<br />
Social Media-Phänomen „TikTok“ gebe<br />
stattdessen immer weniger gestylten<br />
und attraktiven Menschen eine Bühne.<br />
„Twitter“ halte eher den Status des<br />
Nachrichten- und Informationstools.<br />
„WhatsApp“ schneide in manchen Studien<br />
besonders gut als Einsamkeitsbekämpfer<br />
ab, welches besonders auf<br />
die zweiseitige Kommunikationsform<br />
zurückzuführen sei, so Utz.<br />
Virtuelle oder reale Freundschaften<br />
Die BBC-Umfrage wirft überdies auf,<br />
dass einsame Menschen eher auf<br />
Online-Freundschaften zurückgreifen.<br />
<strong>SUMO</strong> stellte sich nun die Frage, ob online<br />
überhaupt reale Freundschaften<br />
geschlossen werden können. Sonja Utz<br />
zeigt sich hierbei bedenklich. Die Standard-Nutzung<br />
umfasse eher den Kontakt<br />
mit Menschen, die einem bereits<br />
bekannt sind. Dennoch merkt sie an,<br />
dass „Facebook“-Gruppen, beispielsweise<br />
Gruppen für Mütter, zu einem<br />
themenfokussierten Austausch führen<br />
können. In Bezug auf Online-Freundschaften<br />
wird oftmals der Terminus<br />
„Fake Friends“ aufgeworfen. Rebecca<br />
Nowland beschmunzelt diesen Begriff.<br />
Er implementiere bereits, dass junge<br />
Menschen sich der Unechtheit mancher<br />
Freundschaften und Personen im World<br />
Wide Web sowie der Gefahren bewusst<br />
seien. Unter Gefahren verstehe sie hier<br />
keinesfalls die Einsamkeit, sondern eher<br />
den Promi-Status mancher Adoleszenten,<br />
die sich mit der Fülle an Aufmerksamkeit<br />
sichtlich überfordert fühlen.<br />
Hinsichtlich des Freundschaften-Schließens<br />
erwähnt Utz auch eher ältere<br />
Theorien, und zwar die „Social Compensation“-<br />
und die „Rich get Richer“-Idee.<br />
Letztere bezieht sich auf die ohnehin<br />
schon an Freundschaften „reichen“<br />
Menschen, die soziale Medien zur Gewinnung<br />
neuer FreundInnen benutzen.<br />
Das Konzept „Social Compensation“<br />
bezieht sich in diesem Zusammenhang<br />
eher auf diejenigen, die Schwierigkeiten<br />
haben offline Freunde zu finden. Sie<br />
können diesen Mangel mittels Online-<br />
Freundschaften kompensieren.<br />
#KeinerBleibtAllein<br />
Aber zurück zum Kuchen. Für viele ist die<br />
Verwendung von Social Media-Plattformen<br />
der einzige Weg vom Schokokuchen<br />
zu snacken. So kann man auch<br />
mit einer Freundin in Amerika sprechen,<br />
auch wenn man nicht den ganzen<br />
Schokokuchen für sich beanspruchen<br />
vermag. Hier stehen die sozialen Plattformen<br />
eher als Klatsch- und Tratsch-<br />
Tool zur Verwendung, aber auch wenn<br />
es um ernstere Themen geht, kann das<br />
Netzwerk hilfreich sein. Obendrein ermöglicht<br />
das Mitmach-Web auch zu<br />
inspirieren, sprich Ideen zu sammeln<br />
und zu unterhalten, wenn es stressig<br />
ist. Jedoch sei dieser Erholungseffekt<br />
nur gegeben, wenn man sich nicht zu<br />
lange im Web bewege, konstatiert Utz.<br />
Die sozialen Medien etablieren außerdem<br />
eine neue Form der Informationsaufnahme,<br />
und zwar die der „Ambient<br />
Awareness“. Man liest demnach Dinge<br />
nicht mehr so genau, sondern überfliegt<br />
sie nur oberflächlich, weshalb man so<br />
ungefähr über das Tagesgeschehen in<br />
seinem Netzwerk Bescheid weiß, merkt<br />
Utz an. Auch der berühmt-berüchtigte<br />
Hashtag hat sich in der Etablierung<br />
eines Gemeinsamkeitsgefühl bewährt.<br />
Auf „Instagram“ oder „Twitter“ kann<br />
man nach Hashtags sortieren, welche<br />
oftmals mit Aktionen verbunden sind,<br />
durch die man sich mit Menschen in<br />
Verbindung setzen kann.<br />
Unsere soziale Gesundheit als<br />
Schlüssel<br />
Nun stellt sich die Frage, ob wir gegen<br />
das vorkommende Isolationsgefühl<br />
präventiv vorgehen können. Sonja<br />
Utz rät Social Media aktiv zu nutzen,<br />
sprich selbst Fotos zu posten oder zu<br />
kommentieren, anstelle rein passiv auf<br />
Postings oder Stories zu reagieren. Rebecca<br />
Nowland blickt hier noch etwas<br />
weiter und appelliert auf das Achten<br />
unserer sozialen Gesundheit, wie wir es<br />
mit unserer mentalen und physischen<br />
Gesundheit auch tun würden. Wenn<br />
unsere soziale Gesundheit schwach<br />
sei, habe dies auch Effekte auf unsere<br />
physische und mentale Gesundheit<br />
und in weitere Folge sei dies auch ein<br />
Grund für frühe Sterblichkeit. Um dem<br />
gekonnt aus dem Weg zu gehen, gibt<br />
sie einen simplen Tipp: „Get balanced!“<br />
Sie erwähnt hier wieder die Wichtigkeit,<br />
die sozialen Medien schlicht als<br />
Ergänzung der physischen Beziehungen<br />
zu nutzen. Obwohl Social Media seine<br />
Tragweite besonders dann zeige, wenn<br />
man voneinander entfernt ist, könnten<br />
sie nie der Schokokuchen sein, den man<br />
brauche, stellt Nowland fest. Ferner<br />
müssten wir uns deutlich machen, dass<br />
wir alle verschiedene Persönlichkeiten<br />
haben. Nowland unterscheidet hier<br />
einerseits zwischen „Social Butterfly“,<br />
sprich derjenige/diejenige, der/die sich<br />
inmitten des Geschehens am wohlsten<br />
fühlt und deshalb viele Interaktionen<br />
benötigt. Andererseits und konträr zum<br />
„Social Butterfly“ erwähnt sie den/die<br />
„bei Partys in der Küche Sitzende/n“,<br />
der/die bedeutsame und tiefgreifende<br />
Unterhaltungen braucht. Dies seien<br />
Dinge, die wir nicht genug ansprechen,<br />
so Nowland. Man zeige mit den Fingern<br />
der Einfachheit halber auf „Instagram“,<br />
„Facebook“ und Co. Ob die sozialen Medien<br />
nun zu positiven oder negativen<br />
Effekten tendieren, sieht Sonja Utz als<br />
schwierig zu beantworten an, jedoch<br />
sieht sie eher die positiven Wirkungen<br />
deutlicher.<br />
von Lisa Schinagl<br />
Sonja Utz / Copyright: IWM Tübingen/Paavo Ruch<br />
Rebecca Nowland / Copyright: University of Lancashire<br />
Modern loneliness: Zwischen Likes und Einsamkeit Thema<br />
39
Filmregulierung: Zum Wohle<br />
der Kinder?<br />
„Aber Mama, ich bin doch schon alt genug!“ Viele Eltern verweisen dann<br />
möglicherweise auf die Altersfreigaben der Selbstregulation. Zurecht,<br />
und: Was steckt hinter diesen? <strong>SUMO</strong> diskutierte darüber mit Stefan Linz,<br />
Geschäftsführer der FSK GmbH, dem Filmjournalisten Daniel Schröckert<br />
– sowie einer Mutter.<br />
© Copyright: adobe stock / RATOCA<br />
Laut der Oberösterreichischen Kinder-Medien-Studie<br />
2020 (EduGroup)<br />
nutzen Kinder im Volksschulalter im<br />
Durchschnitt täglich circa 116 Minuten<br />
Fernsehen, „YouTube“ usw., Jugendliche<br />
im Alter von elf bis 18 Jahren 173 Minuten<br />
laut der Oberösterreichischen Jugend-Medien-Studie<br />
2019 (EduGroup).<br />
Welche Inhalte billigen ihnen Eltern zu<br />
– wo wäre warum einzugreifen?<br />
Nehmen wir einen x-beliebigen Film,<br />
etwa „Loro – Die Verführten“ des Oscar-prämierten<br />
Regisseurs Paolo Sorrentino<br />
über Silvio Berlusconi: Laut DVD<br />
freigegeben ab 12 Jahren enthält er<br />
über weite Teile Szenen exzessiver Sexualität<br />
und Drogenkonsumation. Die<br />
auf einem Jugendbuch basierte Serie<br />
„Maze Runner“ erhielt eine Freigabe für<br />
12-Jährige in Deutschland, für 14-Jährige<br />
in Österreich. Sind Film und Serie<br />
altersgerecht – und wer prüft das?<br />
Selbstregulative können dabei Abhilfe<br />
schaffen. Doch dringt dies auch in das<br />
heimische Wohnzimmer vor? Und was<br />
sind Selbstregulative überhaupt?<br />
Selbstregulative in Deutschland und<br />
Österreich<br />
In Deutschland existieren unter anderem<br />
die Freiwillige Selbstkontrolle<br />
Fernsehen (FSF) sowie den jene für<br />
den Online-Sektor. Darunter fallen die<br />
Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia<br />
(FSM), FSK.online und USK.online. Dabei<br />
handle es sich um Organisationen,<br />
welche auf Grundlage des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages<br />
agieren nach<br />
dem „Modell der regulierten Selbstregulierung“,<br />
erklärt Stefan Linz. Wobei<br />
„die Rechtsaufsicht die Möglichkeit<br />
hat, im Nachhinein Entscheidungen zu<br />
überprüfen“. Im Gegensatz dazu handle<br />
die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle<br />
(USK) sowie die Freiwillige Selbstkontrolle<br />
der Filmwirtschaft (FSK) auf<br />
Basis des Jugendschutzgesetzes, „nach<br />
dem Filme und Spiele eine gesetzliche<br />
Altersfreigabe brauchen, damit sie<br />
Kindern und Jugendlichen zugänglich<br />
gemacht werden können.“ Die beiden<br />
Selbstregulative würden hierbei durch<br />
eine Kooperation von staatlichen und<br />
wirtschaftlichen Akteuren handeln,<br />
eine sogenannte „Co-Regulierung“, erläutert<br />
er. Ein Austausch finde auf Tätigkeitslevel<br />
statt, sowie komme es zu<br />
einigen Kontaktpunkten zwischen den<br />
unterschiedlich regulierten Bereichen,<br />
führt Linz weiter aus. Zum Beispiel können<br />
Alterseinschätzungen der FSF nach<br />
einer Bestätigung durch die Rechtsaufsicht,<br />
die auf Grund der gesetzlichen<br />
Grundlagen notwendig ist, von der FSK<br />
übernommen werden, erzählt Linz.<br />
Stellvertretend für die zahlreichen<br />
Selbstregulative in Deutschland wird<br />
auf den Prüfvorgang der FSK näher<br />
eingegangen. Laut „fsk.de“ werden<br />
die Altersbeschränkungen in Prüfauschüssen<br />
– u.a. Arbeitsausschuss,<br />
Hauptausschuss und Appellationsausschuss<br />
– getroffen. Die ehrenamtlichen<br />
Mitglieder dieser Gremien bilden<br />
unterschiedliche Berufsfelder sowie<br />
verschiedene gesellschaftlich relevante<br />
Bereiche ab, dürfen hauptberuflich<br />
jedoch nicht in der Film- und Videowirtschaft<br />
tätig sein, um eine unabhängige<br />
Beurteilung sicherzustellen. und es finden<br />
laufend Schulungen statt. Die FSK<br />
klassifiziert Filme in die Altersstufen:<br />
ab 0, 6, 12, 16 und 18 Jahre. Linz führt<br />
aus, dass ausschließlich eine Beeinträchtigung<br />
von Heranwachsenden begutachtet<br />
wird und keine pädagogische<br />
Einordnung herausgegeben wird. Als<br />
Faktoren für die Entscheidung nennt<br />
Linz beispielhaft die Bereiche „Diskriminierung“,<br />
„Sexualität“ und „Gewalt“, die<br />
Einstufung werde aber für jeden Film<br />
individuell getroffen.<br />
In Österreich ist die Jugendmedienkommission<br />
(JMK) dafür zuständig,<br />
die im Bundesministerium für Bildung,<br />
Wissenschaft und Forschung angesiedelt<br />
ist. Laut deren Website deckt das<br />
Zuständigkeitsgebiet alle Bewegtbild-<br />
40<br />
Thema Filmregulierung: Zum Wohle der Kinder?
medien ab, sorgt für eine entsprechende<br />
Einteilung in Altersschranken und<br />
streicht Filme auch lobend hervor. Die<br />
Entscheidungen werden durch Gremien,<br />
welche sich aus Personen aus<br />
den Bereichen „Soziales“ und der Erziehungswissenschaften<br />
zusammensetzen<br />
anhand definierter Merkmale,<br />
zum Beispiel die Beeinträchtigung von<br />
„Körperlicher Gesundheit“ und „Religiösem<br />
Empfinden“, getroffen. Im Gegensatz<br />
zur FSK werden durch die JMK<br />
Einschätzungen ausgesprochen, die<br />
tatsächlichen Beschränkungen könnten<br />
anschließend von den Bundesländern<br />
unabhängig davon definiert werden und<br />
die bereits erwähnten Altersschranken<br />
starten bei Null und gehen ab sechs in<br />
zwei Jahresschritten bis 16 Jahre. Darüber<br />
hinaus werden in Österreich etwa<br />
bei Computerspielen die PEGI-Altersbeschränkungen<br />
verwendet (vgl. <strong>SUMO</strong><br />
Nr. 34).<br />
Die Alternativen<br />
Doch sind Selbstregulative die einzige<br />
Instanz? Laut der Kinder-Medien-Studie<br />
(Edugroup, 2020) rezipieren Kinder<br />
Videos mit geringer Dauer aus dem<br />
Netz öfters ohne Begleitung als TV oder<br />
Streaming-Angebote. Dies bietet den<br />
Anlass, auch andere Möglichkeiten zu<br />
betrachten. Linz sagt zu Plattformen<br />
wie „YouTube Kids“, dass unterschiedliche<br />
Angebotstypen auch verschiedene<br />
Einordnungssysteme notwendig machen<br />
würden, da es sich auf „YouTube“<br />
auch um von RezipientInnen erstellte<br />
Videos handle, sogenannte „Prosumer“.<br />
Hierbei kann der/die ErstellerIn<br />
für den Content eine Alterseinstufung<br />
vornehmen und der/die BetreiberIn der<br />
Plattform greife bei Hinweisen oder<br />
Beschwerden ein. Schröckert erläutert<br />
hinsichtlich der Erklärungen der FSK<br />
über Freigaben, dass es darüber hinaus<br />
noch mehrere Sites gebe, die aufklären,<br />
wieso bestimmte Filme für eine Altersgruppe<br />
zulässig seien. Als Beispiele<br />
führt er hier „kinderfilmblog.de“ sowie<br />
„kinderfilmwelt.de“ an.<br />
Der Zweck der Selbstregulative<br />
Linz betont hierbei, dass Selbstregulative<br />
vor allem in einem dynamischen<br />
Medienumfeld sinnvoll sind. Selbstkontrolleinrichtungen<br />
können agiler reagieren,<br />
da „die Wirtschaft als Träger einer<br />
solchen Institution tätig ist“. Wenn nur<br />
der Staat als regulativer Akteur beteiligt<br />
ist, wäre dies nicht in gleicher Form umsetzbar.<br />
Ein nächster großer Pluspunkt<br />
mitunter der FSK, der eben durch das<br />
Zusammenspiel von staatlichen sowie<br />
wirtschaftlichen Akteuren möglich ist,<br />
sei das Verhindern einer staatlichen<br />
Zensur sowie die „Rechts- und Vertriebssicherheit“,<br />
welche den HerstellerInnen<br />
in Verbindung mit den FSK-<br />
Altersfreigaben gewährt wird, so Linz.<br />
Schröckert sieht unter anderem positiv,<br />
„dass sich da so gesehen die Branche<br />
auch raushält oder beziehungsweise<br />
nicht mitinvolviert ist“. Es sei von Vorteil,<br />
dass die Altersfreigabe unabhängig<br />
vom Vertreiber getroffen werde, da dieser<br />
den „Film an ein möglichst breites<br />
Publikum bringen“ wolle. Ebenso sieht<br />
er es als positiv an, dass Personen von<br />
unterschiedlichen Feldern beteiligt<br />
sind, da somit etwa auch unterschiedliche<br />
religiöse Blickwinkel mitbedacht<br />
werden könnten.<br />
Die kritischen Stimmen<br />
Altersfreigaben erzeugen unterschiedliche<br />
Meinungen. Bei Kritiken abseits<br />
von möglichen Falscheinschätzungen,<br />
nennt Filmjournalist Schröckert<br />
die nicht mehr der heutigen Zeit entsprechenden<br />
deutschen Altersstufen:<br />
gewisse Abstände seien zu weit,<br />
andere zu klein. Kritik hinsichtlich der<br />
Festlegung der Schranken kann FSK-<br />
Geschäftsführer Linz nachvollziehen,<br />
setzt dem allerdings mehrere Argumente<br />
entgegen. Unter anderem seien<br />
die Freigabestufen in den Köpfen der<br />
Bevölkerung verankert, sowie durch<br />
die größeren Spannen etwa bei der Beurteilung<br />
des Alters im Kino von Vorteil.<br />
Schröckert jedoch wendet ein, möglicherweise<br />
noch eine darüberliegende<br />
Altersklasse zum Beispiel „ab 25“ einzuführen,<br />
da unter anderem manche<br />
Inhalte vielleicht erst mit reiferem Alter<br />
verstanden werden können. Als zweiten<br />
Punkt nannte Schröckert eine fehlende<br />
Klarheit bei der Urteilsfindung der<br />
FSK: Einige RezipientInnen würden sich<br />
Informationen über die Arbeitsweise<br />
der FSK anhand von Interviews wünschen.<br />
Ebenso, dass sich diese heute<br />
Wissen gerne ohne viel Aufwand aneignen<br />
würden, vor allem aus sozialen<br />
Netzwerken und dass gerade da noch<br />
nicht viel an Informationsvermittlung<br />
geschehe. Linz betont jedoch, dass in<br />
der kostenlosen FSK-App oder auf der<br />
Website Kurzbegründungen zu den<br />
Freigaben aller aktuellen Filme im Kino<br />
veröffentlicht würden und darüber hinaus,<br />
dass Beschwerden und Kritik immer<br />
gewissenhaft bearbeitet und beantwortet<br />
werden.<br />
Die Sichtweise der Eltern<br />
Doch was sagen Eltern dazu: Beachten<br />
sie Altersfreigaben und können<br />
so Selbstregulative Kindern helfen?<br />
Um die Frage zu beantworten, sprach<br />
<strong>SUMO</strong> mit einer Mutter von zwei Kindern<br />
im Alter von zwei und sieben Jahren.<br />
Sie gab an, bei der Auswahl von<br />
Filmen und Serien die Einschätzungen<br />
grundsätzlich zu beachten. Zusätzlich<br />
Filmregulierung: Zum Wohle der Kinder?<br />
41
evorzuge sie es, die Filme vorab anzusehen<br />
oder auf ihre Intuition zu vertrauen.<br />
Dabei achte sie auf Kriterien, ob<br />
etwa Kriminalität vorkomme oder wie<br />
die Figuren in Filmen oder Serien dargestellt<br />
würden. Auch im Bereich der<br />
Spiele für Konsolen sei es ihr wichtig,<br />
jene auszuwählen, die im Inhalt sowie<br />
in der Aufbereitung fürKinder geeignet<br />
seien. Auch Schröckert, Vater von zwei<br />
Kindern, gibt an, bei der Auswahl die<br />
FSK-Einschränkungen zu achten. Ebenso<br />
sollte man aber trotzdem ein Auge<br />
auf den gezeigten Inhalt haben und<br />
welchen Lerneffekt die Kinder haben<br />
könnten.<br />
Ein Blick in die Zukunft<br />
Die FSK plane in Zukunft auf vordefinierte<br />
inhaltliche Kriterien zu setzen,<br />
die auf bisherigen Erfahrungen beruhen.<br />
Im Zuge dessen wurde ein sogenanntes<br />
„Klassifizierungs-Tool“ kreiert.<br />
Stefan Linz ist im <strong>SUMO</strong>-Interview<br />
näher darauf eingegangen. Dieses Tool<br />
bildet sogenannte „Risikodimensionen“<br />
ab, welche sich in „Gewalt und Bedrohung,<br />
Verletzung und Leiden, Sexualität<br />
und Nacktheit, Drogenkonsum, Sprache<br />
und schädigendem Verhalten“ gliedern.<br />
Pro Risikodimension würden zahlreiche<br />
Unterkategorien ausgemacht,<br />
„und auch dort werden auch verstärkende<br />
und relativierende Faktoren berücksichtigt.“<br />
Er betont ebenso, dass<br />
nur geschulte Personen mit dem Tool<br />
arbeiten und Ergebnisse in Prüfausschüssen<br />
überprüft und die Spruchpraxis<br />
auch angepasst werden kann, da es<br />
sich beim Jugendschutz um „kein starres<br />
Konstrukt“ handle. Daniel Schröckert<br />
äußert sich kritisch gegenüber<br />
einer alleinigen Einschätzung durch ein<br />
System. Er stellt fest, dass Technologie<br />
bislang nicht in der Lage wäre, die emotionale<br />
Komplexität von Bewegtbild<br />
aufzufassen. Ebenso würden viel mehr<br />
Aspekte einen Einfluss darauf haben,<br />
wie Kinder einen Film wahrnehmen<br />
– etwa die Stärke des Einsatzes von<br />
Musik. Er bezweifelt, ob das Tool dies<br />
aufgreifen könnte. Ein Tool könne als<br />
ein Anhaltspunkt verwendet werden,<br />
welcher nach bestimmten Aspekten<br />
eine Einschätzung abgeben kann, dennoch<br />
sollten die endgültigen Freigaben<br />
von einer Person getroffen werden, so<br />
Schröckert.<br />
Abseits der Tricks zur Umgehung der<br />
Freigabe werden sich Kinder wohl weiterhin<br />
Filme ansehen wie…. (ohne Empfehlung).<br />
von Simone Poik<br />
Daniel Schröckert /<br />
Copyright: Rocket Beans Entertainment GmbH<br />
Stefan Linz / Copyright: FSK GmbH<br />
© Copyright: adobe stock / PixieMe<br />
© Copyright: adobe stock / vulkanov<br />
42<br />
Thema Filmregulierung: Zum Wohle der Kinder?
Journalismus heute: Alles<br />
geklaut und gelogen?<br />
Immer öfter kommt ans Tageslicht, dass JournalistInnen Inhalte frei erfinden<br />
oder gar klauen. <strong>SUMO</strong> sprach mit Stefan Schoeller, Rechtsanwalt<br />
für Medien- und Urheberrecht, sowie mit Benjamin Fredrich, Chefredakteur<br />
des deutschen populärwissenschaftlichen Magazins „Katapult“, über<br />
diese Entwicklung und versucht Licht ins Dunkel zu bringen.<br />
Es ist der 3. Dezember 2018, 03:05 Uhr.<br />
Der digitale Postkasten von Claas Relotius<br />
gibt einen Benachrichtigungston<br />
von sich: eine neue Mail. Die Pressebeauftragte<br />
einer Bürgerwehr in Arizona<br />
fragt, wie Relotius eine Reportage über<br />
ihre Gruppe und ihre Situation schreiben<br />
konnte, ohne je für ein Interview<br />
vorbeigekommen zu sein? Der Anfang<br />
vom Ende – Claas Relotius hat den<br />
Bogen überspannt. Am 17. Dezember<br />
reicht der vielfach ausgezeichnete Reporter<br />
beim „Spiegel“ seine Kündigung<br />
ein. Am 19. Dezember geht der „SPIE-<br />
GEL“ an die Öffentlichkeit. Relotius Texte<br />
– großteils gefälscht. Die Reportage<br />
– in der Kritik.<br />
Der Journalismus in einer Krise<br />
Claas Relotius hat den deutschsprachigen<br />
Journalismus endgültig in eine<br />
Krise gezogen. Nicht nur die Reportage<br />
selbst steht, aufgrund ihrer besonderen<br />
Anfälligkeit für fiktive Ergänzungen, besonders<br />
in der Kritik, der gesamte Journalismus<br />
ist in eine Krise geschlittert.<br />
Ein Fall wie dieser rüttelt an den Grundsätzen<br />
des Journalismus. An der Wahrhaftigkeit,<br />
an der journalistischen Sorgfalt.<br />
Die strukturellen Probleme mögen<br />
nicht so ausgeprägt sein, wie es der Fall<br />
Relotius impliziert, hingegen sind sie<br />
weitreichender als oft angenommen.<br />
Copy and Paste, Abschreiben, Plagiieren.<br />
Ungern wird darüber gesprochen,<br />
dennoch sind dies grundsätzliche Probleme<br />
im heutigen Journalismus. In<br />
einem Journalismus, welcher von Zeitdruck<br />
und Clickbaiting unterwandert<br />
wurde. Die Frage ist, woher rührt dies?<br />
Fredrich unterstreicht in seinem Interview,<br />
dass dies unter anderem dem<br />
steigenden Druck auf die Zeitungen<br />
geschuldet ist. Bringt eine Zeitung eine<br />
Story, so fühlen alle anderen den Drang<br />
diese auch drucken zu müssen. Dennoch<br />
spiegele sich dieser Trend eher bei<br />
regionalen Zeitungen wider – sie müssen<br />
unter enormem Zeitdruck arbeiten<br />
und haben weitläufig Personalmangel.<br />
So passiere es schnell, dass eine Meldung<br />
ident übernommen oder maximal<br />
der Satzbau leicht verändert werde.<br />
Genau dort lässt sich das strukturelle<br />
Problem erkennen: steigender Druck,<br />
einerseits durch Konkurrenz, andererseits<br />
durch einen schnell verfallenden<br />
Nachrichtenwert, sowie ein Mangel an<br />
– kompetentem – Personal. Die „Neue<br />
Zürcher Zeitung“ erklärte im September<br />
2014, dass Nachrichtendienste aufgrund<br />
einer endlos ausufernden Informationswelt<br />
besonders unter Druck<br />
stünden, es jedoch der falsche Weg<br />
wäre, den ambitionierten, hochwertigen<br />
Journalismus zu vernachlässigen.<br />
Leider lässt sich genau dies vielerorts<br />
beobachten. Obwohl profilierte Recherche<br />
an Relevanz und neuer Bedeutung<br />
gewinnt, im Gegensatz zu beinahe<br />
identen Artikeln, welche auf zehn unterschiedlichen<br />
Nachrichtenportalen zu<br />
lesen sind.<br />
Eine rechtliche Machtlosigkeit<br />
Es lässt sich folglich kaum anzweifeln:<br />
Ideen werden im Journalismus ohne<br />
weitere Recherche übernommen. Eine<br />
© Copyright: adobe stock / kengmerry<br />
Wie das Unternehmen selbst: Das Personal wächst stetig und besteht aus zertifizierten Systemspezialisten.<br />
Unser Augenmerk liegt nicht nur auf guten Shops, sondern auch auf Zusammenhalt in unserem<br />
dynamischen Team.<br />
www.mstage.at Thema<br />
43
Studie von „news aktuell“ hat 2017<br />
erhoben, dass das Übernehmen von<br />
Inhalten anderer Medien, sowie von<br />
Unternehmen bzw. PR-Agenturen, zu<br />
den größten Fehlern gehört, welche<br />
JournalistInnen heute begehen. Dennoch<br />
wird es gemacht. Da stellt sich<br />
die Frage: Warum unternimmt niemand<br />
etwas dagegen? Schoeller erklärt im Interview,<br />
dass hier geklärt werden müsse,<br />
ob es sich um ein Werk im Sinne des<br />
Urheberrechtsgesetzes handle. Dieses<br />
umfasst geistige und eigentümliche<br />
Schöpfungen auf dem Gebiet der Literatur,<br />
bildenden Kunst, Ton- und Filmkunst.<br />
Banale Arbeiten, wie etwa kurze<br />
Nachrichten, stellen laut ihm in diesem<br />
Sinne hingegen kein Werk im Sinne des<br />
Urheberrechts dar. Dies zeigt folglich,<br />
dass Inhalte erst dann geschützt sind,<br />
wenn sie eine eigentümliche Schöpfung<br />
darstellen. Eine Idee bzw. ein Inhalt<br />
selbst sind somit urheberrechtlich nicht<br />
geschützt, weil sie „keine konkrete Ausformung<br />
und Niederlegung haben“. Für<br />
Rechtsanwalt Schoeller ist die Situation<br />
klar: „Eine Gesellschaft funktioniert<br />
grundsätzlich nur, wenn in irgendeiner<br />
Form eine Weiterentwicklung zugänglich<br />
ist. Eine Weiterentwicklung findet<br />
nur statt, wenn auf dem momentanen<br />
Stand des Wissens aufgebaut werden<br />
kann.“ Somit sind Ideen nicht geschützt,<br />
um diese gesellschaftliche Weiterentwicklung<br />
zu gewährleisten. Benjamin<br />
Fredrich sieht das teilweise problematisch:<br />
„Bei Ideen und Konzepten ist das<br />
schwer. Wenn da jemand in Einzelfällen<br />
etwas macht, kann man tatsächlich nur<br />
zusehen. Da kann man nur warten und<br />
schauen, was die machen.“ Allerdings<br />
ist entscheidend, dass es rechtliche<br />
Möglichkeiten gibt, sobald es zur wiederholten,<br />
systematischen Übernahme<br />
von Inhalten kommt. Schoeller und<br />
Fredrich sind sich hier einig: „Wenn das<br />
häufiger passiert und man eine Systematik<br />
dahinter erkennt, dann kann<br />
man vom Urheberrecht weggehen und<br />
ins Wettbewerbsrecht gehen. Hier gibt<br />
es schon ein paar Spielregeln, so verstößt<br />
eine systematische Ausbeutung<br />
einer anderen Redaktion gegen diese<br />
Spielregeln“, so Fredrich im Interview.<br />
Schoeller stimmt zu: „Man spricht dann<br />
von einem Konglomerat an Einzelfällen.<br />
Wenn hier geschickt einzelne ungeschützte<br />
Elemente übernommen werden,<br />
wird, ab einer gewissen Intensität,<br />
das Wettbewerbsrecht verletzt.“ So gesehen<br />
ist eine Idee, ein Konzept, selbst<br />
ungeschützt und frei verwertbar. Erst<br />
durch eine konkrete Ausformung, durch<br />
das Erreichen des Schöpfungswertes,<br />
greift das Urheberrecht. Es sei denn, es<br />
findet eine systematische Ausbeutung<br />
eines anderen statt, dann eröffnet das<br />
Wettbewerbsrecht neue Möglichkeiten.<br />
Alles kopiert und geklaut?<br />
Im Folgenden hat <strong>SUMO</strong> einen konkreten<br />
Fall einer möglichen Rechtsverletzung<br />
betrachtet. Gemeinsam mit<br />
dem Verlag Hoffmann und Campe hat<br />
„Katapult“ ein Buch über „Karten, die<br />
deine Sicht auf die Welt verändern“<br />
verlegt. Die Idee, redaktionelle und<br />
kreative Arbeit, wie auch grafische Aufbereitung<br />
und Layouting lagen hier bei<br />
„Katapult“. Nach Veröffentlichung des<br />
© Copyright: adobe stock / zenzen<br />
44<br />
Thema<br />
Journalismus heute: Alles geklaut und gelogen?
Buches gab es allerdings Differenzen<br />
zwischen Verlag und Redaktion und das<br />
Magazin „Katapult“ entschloss sich, ein<br />
ursprünglich geplantes zweites Buch<br />
nicht mit Hoffmann und Campe zu<br />
verlegen. Die Überraschung kam, als<br />
der Verlag die Fortsetzung des Buches<br />
angekündigt hatte – ohne „Katapult“,<br />
stattdessen mit AutorInnen der „ZEIT“.<br />
Für Chefredakteur Fredrich unerwartet,<br />
jedoch müsse man das so hinnehmen:<br />
„Wenn sie das Buch nun mit der<br />
‚ZEIT‘, im Stil der ‚ZEIT‘, machen, dann<br />
ist das okay.“ „Katapult“ erlitt jedoch<br />
einen Schock, als bekannt wurde, dass<br />
sowohl Titel als auch zahlreiche Inhalte<br />
übernommen wurden. Für das Magazin<br />
keine leichte Situation. Der Titel musste<br />
zwar nach einer Unterlassungserklärung<br />
verändert werden, doch bezüglich<br />
der Inhalte und des Aufbaus ist die<br />
Lage komplizierter. Medienrechtsexperte<br />
Schoeller weist hier wieder darauf<br />
hin, dass zu untersuchen sei, ob<br />
ein Ausbeuten fremder Leistung stattfinde:<br />
„Wenn die Gesamtbetrachtung<br />
ergibt, dass hier so viele Elemente<br />
schmarotzerisch übernommen wurde,<br />
dass es ein wettbewerbsrechtliches<br />
Thema wird, so kann eine Klage Erfolg<br />
haben. Wenn die Gesamtbetrachtung<br />
allerdings ergibt, dass nur ungeschützte<br />
Elemente übernommen wurden, die<br />
es in ähnlicher Art und Weise schon<br />
gegeben hat, ist das aus rechtlicher<br />
Sicht in Ordnung.“ Für „Katapult“ galt<br />
es also zu entscheiden, eine Klage mit<br />
unsicherem Ausgang und möglicherweise<br />
enormen Kosten zu wagen oder<br />
den Vorgang öffentlich wirksam zu<br />
machen. Wie Benjamin Fredrich erzählt,<br />
war das keine leichte Abwägung,<br />
doch die Entscheidung, das gesamte<br />
Geschehen an die Öffentlichkeit zu<br />
bringen, sei im Nachhinein die richtige<br />
gewesen. Es tue ihm auch heute noch<br />
weh, wenn er daran denkt. Doch fest<br />
steht, dass dem Magazin dieser Vorfall<br />
zu enormem Wachstum verholfen<br />
hat und das hätte kein Gericht erwirken<br />
können. Folglich lässt sich festhalten,<br />
dass es schwierig ist, das Übernehmen<br />
von Inhalten oder Ideen zu unterbinden.<br />
Doch gerade das Magazin „Katapult“<br />
hat der Verlagsbranche und dem<br />
Journalismus gezeigt, dass man durch<br />
ein medienwirksames Auftreten und<br />
eine ausgeklügelte PR-Strategie aus<br />
einer Misere stärker hervortreten kann.<br />
Folgen für eine ganze Branche<br />
Die Krise nach dem Auffliegen der Affäre<br />
Claas Relotius war weitaus schwächer<br />
als befürchtet, jedenfalls für den<br />
Journalismus als Ganzem. Die Reportage<br />
aber gilt nach wie vor als problembehaftet.<br />
Auch wenn Aufklärungsarbeit<br />
geleistet wurde, wenn neue Systeme<br />
zu Verifikation eingeführt wurden,<br />
bleibt die Kritik bestehen. Selbst Diskussionen,<br />
welche aufgezeigt haben,<br />
dass sich das Problem Relotius auf<br />
den gesamten Journalismus umlegen<br />
lässt, blieben beinahe ohne Folgen.<br />
Verschiedene kritische Medienhäuser<br />
beschäftigen sich jedoch weiterhin mit<br />
der Thematik und versuchen dem Trend<br />
des Copy and Paste-Journalismus auf<br />
den Grund zu gehen. By the way: Franziska<br />
Wenger, Redakteurin von <strong>SUMO</strong>’s<br />
Online-Schwesternmagazin „sumomag.at“<br />
untersucht, passend zur Causa<br />
Relotius, die Gründe, warum JournalistInnen<br />
dazu verleitet werden Artikel zu<br />
fälschen.<br />
von Matthias Schnabel<br />
Benjamin Fredrich / Copyright: Katapult<br />
Stefan Schoeller / Copyright: Daniela Jakob<br />
shop-systeme<br />
mit qualiät<br />
Die Auswahl eines nachhaltigen Shopsystems mit Möglichkeit zur Skalierung, rascher time-to-market<br />
sowie die Wahl eines zuverlässigen und erfahrenen Partners ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Auf Basis<br />
unserer Erfahrungen aus mehr als 100 Projekten E-Commerce Spezialisierung helfen wir alle möglichen<br />
Pornografie Optionen - Gefahr für abzuwägen Kinder und und Jugendliche?<br />
einen Gesamtplan aufzustellen.<br />
www.mstage.at Thema<br />
45
Zwischen Liebe und Hass –<br />
Das Geschäft mit der Privatsphäre<br />
der Stars<br />
Es ist eine Beziehung im ständigen Wandel zwischen Liebe und Hass, die<br />
auf der internationalen Bühne zum Alltag von KünstlerInnen und anderen<br />
Personen des öffentlichen Lebens dazu gehört: Paparazzi. Sensationsberichterstattung,<br />
die auch für den Boulevard in Österreich wie ein gefundenes<br />
Fressen scheint, hierzulande aber kaum diskutiert wird. Warum, das<br />
besprach <strong>SUMO</strong> mit dem ehemaligen Paparazzo Edwin Walter und der<br />
Chefredakteurin der ORF-„Seitenblicke“, Ines Schwandner.<br />
31. August 1997. Schauplatz Paris.<br />
Eine Frau kommt mit ihrem damaligen<br />
Lebensgefährten gegen 0:20 Uhr<br />
aus einem Nobelrestaurant und steigt<br />
in einen Wagen. Die Frau, Mutter von<br />
zwei Söhnen (William und Harry), gilt zu<br />
diesem Zeitpunkt als die berühmteste<br />
Frau der Welt. Unter einem Blitzlichtgewitter,<br />
verursacht durch zahlreiche<br />
FotografInnen, fährt das Paar los in<br />
Richtung ihres Apartments. Dort sollten<br />
die beiden jedoch nie ankommen.<br />
Es ist jene Geschichte von Prinzessin<br />
Diana und der tödlichen Verfolgungsjagd<br />
mit einem Paparazzo, die bis dato<br />
den traurigen Tiefpunkt in einem Katzund<br />
Mausspiel zwischen Promis und<br />
der Profitgier sogenannter Sensationsmedien<br />
darstellt. Ein schrecklicher Unfall,<br />
dessen Auslöser ein einziges Foto<br />
sein sollte, das demjenigen eine irrsinnige<br />
Summe Geld bescheren würde, der<br />
es schießt. In vielen Fällen endete diese<br />
Jagd nach dem perfekten Schnappschuss<br />
schon vor Gericht, manche in<br />
jahrelangen Depressionen oder Krankheiten,<br />
in Extremfällen wie jenem von<br />
Lady Di sogar mit dem Tod für eine/n<br />
der Betroffenen. „Menschen wollen<br />
immer so nah wie möglich an die Stars<br />
herankommen. Von Medien werden<br />
daher Unsummen für das richtige Foto<br />
bezahlt. Dadurch kommt es zu solchen<br />
Extremfällen, bei denen leider immer<br />
wieder etwas passiert!“ Diese gesellschaftliche<br />
Frage immer überall dabei<br />
sein zu wollen sei es, die Fotografen wie<br />
den Wiener Edwin Walter auf die Lauer<br />
nach pikanten Foto- und Videoaufnahmen<br />
legen ließen. „In vielen anderen<br />
Bereichen verdienst du als Fotograf<br />
einfach kein Geld“, spricht der ehemalige<br />
Paparazzo offen über das oftmals so<br />
verpönte Geschäft mit der Privatsphäre<br />
anderer, das er selbst viele Jahre in den<br />
USA und Europa miterlebte.<br />
Regeln, aber kaum Grenzen<br />
International und vor allem in Hollywood<br />
kenne der Medientrubel um<br />
prominente Menschen nur selten irgendwelche<br />
Grenzen. Hunderte FotografInnen<br />
alleine im Raum Los Angeles<br />
würden dabei auf Tipps von InformantInnen<br />
die Hotspots bekannter Gesichter<br />
belagern. In abgesprochenen Teams<br />
aus mindestens zwei FotografInnen<br />
© Copyright: adobe stock / Konstantin Yuganov<br />
46<br />
Thema Zwischen Liebe und Hass - Das Geschäft mit der Privatsphäre der Stars
würden sich Massen an Kameras an<br />
den Vorder- und Hintereingängen von<br />
Hotels, Restaurants oder Geschäften<br />
positionieren.<br />
Warum in Zweierteams? Weil oftmals<br />
eben nicht nur zu Fuß, sondern wie vor<br />
23 Jahren bei Lady Di, auch auf dem<br />
Motorrad oder mit dem Auto die Verfolgung<br />
aufgenommen werde. Durch die<br />
aggressive Herangehensweise vieler<br />
KollegInnen, aber auch durch angriffslustige<br />
Bodyguards auf Seiten der Prominenten<br />
würden sich viele Begegnungen<br />
schnell hochschaukeln und nicht<br />
selten in körperlichen Auseinandersetzungen<br />
enden. „Wenn du sofort von<br />
den Begleitern der Stars beleidigt wirst,<br />
sobald sie dich sehen, bist du natürlich<br />
noch einmal extra motiviert und lässt<br />
nicht locker“. Umgekehrt würden jene<br />
sofort in Ruhe gelassen werden, die<br />
sich der Kamera stellen und respektvoll<br />
ihren Auftritt hinter sich bringen, anstatt<br />
ihm aus dem Weg zu gehen, beschreibt<br />
Walter den Umgang. Für den<br />
jetzigen Leiter einer Fotoagentur gebe<br />
es sehr wohl auch für Paparazzi Regeln,<br />
an die es sich zu halten gebe. Fotografieren<br />
hinein in private Räumlichkeiten<br />
wäre für ihn tabu.<br />
Jede/r kennt jede/n<br />
Ausartende Konfrontationen sind in<br />
Übersee dennoch häufige Szenen, die<br />
in Österreich aber nur in besonders<br />
tragischen Fällen Schlagzeilen machen<br />
und dabei Kopfschütteln hinterlassen.<br />
Denn hierzulande sei eine solche Vorgehensweise<br />
absolut kein Thema. Gezielte<br />
Skandale in der heimischen Starund<br />
Lifestyleberichterstattung wären<br />
wenig lukrativ und würden schlichtweg<br />
auch Wenige interessieren, wie Ines<br />
Schwandner, Chefredakteurin der ORF-<br />
Sendung „Seitenblicke“, anmerkt: „Bei<br />
uns reicht es schon, bei besonderen<br />
Veranstaltungen gesehen zu werden.<br />
Da braucht man nicht durch irgendeine<br />
Inszenierung von skandalösem Verhalten<br />
auffallen.“ Einerseits würden aufgrund<br />
der fehlenden Internationalität<br />
der heimischen Stars und Sternchen<br />
diverse Intrigen kaum für ein großes<br />
Publikum interessant sein. Auf der anderen<br />
Seite sei die gemeinsame Zusammenarbeit<br />
zwischen Prominenten<br />
und Medien viel wichtiger, als sich gegenseitig<br />
bloßzustellen. „In Österreich<br />
passieren die meisten Stories nach Einladung<br />
zu den jeweiligen Events. Dabei<br />
kennt jede/r jede/n. Wenn also ein<br />
Medium schlecht über eine Person berichtet,<br />
wird es beim nächsten Mal einfach<br />
nicht mehr eingeladen“, resümiert<br />
Schwandner.<br />
Dieses Risiko auf Seiten der Medien<br />
eben nicht mehr dabei zu sein, wäre<br />
den meisten deshalb zu groß, wie auch<br />
Edwin Walter bestätigt: „Du willst es dir<br />
in Österreich mit niemanden verscherzen.<br />
Der Markt ist sehr klein, dadurch<br />
fehlt die Anonymität.“ Etwaige Folgen<br />
durch die Betroffenen nach einer Verunglimpfung<br />
würden nicht lange auf<br />
sich warten lassen. Folgen, die auch der<br />
ehemalige Paparazzo am eigenen Leib<br />
zu spüren bekam. Nach der Veröffentlichung<br />
eines Fotos von Ex-Finanzminister<br />
Karl-Heinz Grasser aus dessen<br />
Privaturlaub folgte kurz danach eine<br />
Finanzprüfung für Walters Agentur.<br />
Zwar würden auch in Österreich private<br />
Medienhäuser aus dem Boulevardbereich<br />
diverse gerichtliche Nachwehen<br />
weniger fürchten, dennoch baue auch<br />
für diese die Branche auf Respekt. Laut<br />
Schwandner herrsche eine „kulturelle<br />
Sperre“, die vor unkonventionellen<br />
Methoden zurückschrecken ließe. Vielmehr<br />
überwiege ein gegenseitiges Ge-<br />
hidden champions<br />
mit weitsicht.<br />
Wir haben uns als E-Commerce Agentur einen Namen gemacht und sind überwiegend in Österreich sowie<br />
Deutschland tätig. Zu unseren Kunden zählen auch namhafte Unternehmen wie der renommierte<br />
Juwelier „Dorotheum“, „Lexis Nexis“ – ein führender Anbieter von Lösungen für die Rechts-, Steuern<br />
und Wirtschaftspraxis mit 2 Mio. Produkten im Shop, bis hin zu den Duftpionieren im Online-Handel:<br />
„Aus Liebe zum Duft“. Auch für Projekte wie die Effie-prämierte „Manner, meine Schnitte“-Kampagne und<br />
den Relaunch des brandneuen Dr. Oetker Online-Shops auf Shopware-Basis dürfen wir uns verantwortlich<br />
zeichnen. Wir leben nachhaltige Kundenbeziehungen mit Best-Practice Erfahrungsaustausch.<br />
www.mstage.at<br />
Die (Ohn-)Macht des Presserats Thema<br />
47
en und Nehmen, das immer wieder<br />
auch Freundschaften zwischen Promis<br />
und JournalistInnen entstehen ließe.<br />
„Es passiert nicht selten, dass man vorher<br />
versucht, jemanden vor die Kamera<br />
zu bekommen und später dann gemeinsam<br />
essen geht“, so Walter.<br />
Smartphone und Social Media – der<br />
neumoderne Paparazzo<br />
Hierzulande also ein Geschäft mit<br />
Handschlagqualität – ganz anders als<br />
wie im so glitzernden Hollywood oder<br />
auch in Großbritannien und Deutschland.<br />
Besonders in großen Ländern sei<br />
der Druck viel größer, sich von anderen<br />
abheben zu müssen und sich mit erniedrigendem<br />
Verhalten ins Gespräch<br />
zu bringen. Druck, der durch die schnelllebige<br />
Zeit mit Smartphones und Social<br />
Media noch einmal massiv zugenommen<br />
habe. So könne heutzutage jede/r<br />
mit einem fotofähigen Handy selbst<br />
zum Paparazzo werden. Ein Phänomen,<br />
das sich allerdings weniger beim Filmen<br />
von Stars und Sternchen, sondern vielmehr<br />
beim „Gaffen“ von Unfällen in der<br />
Gesellschaft etablierte. Auf der anderen<br />
Seite haben Prominente durch „Facebook“,<br />
„Instagram“ und ähnliche Kanäle<br />
selbst die Kontrolle übernommen, um<br />
zu entscheiden, welche privaten Einblicke<br />
sie der Öffentlichkeit gewähren.<br />
Anstatt FotografInnen auf die Lauer zu<br />
schicken, durchstöbern Klatsch- und<br />
Tratsch-Magazine die sozialen Netzwerke<br />
und verwerten die selbsterstellten<br />
Inhalte der Stars weiter. Ein Trend,<br />
der laut Ines Schwandner journalistisch<br />
noch weniger Wert hätte als das Erspähen<br />
von pikanten Aufnahmen durch<br />
zumindest kritische FotografInnen. „Als<br />
Medium sollte es das Ziel sein, selbst<br />
die Inhalte zu kreieren und nicht einfach<br />
nur den Computerbildschirm abzufilmen<br />
mit den Postings der Stars“,<br />
kritisiert die Chefredakteurin das Vorgehen<br />
zahlreicher Onlineportale wie<br />
„Promiflash“.<br />
Egal, ob durch die Begleitung von Fotografenlinsen<br />
oder durch Millionen Kameras<br />
von Smartphones: Gerade als<br />
Person des öffentlichen Lebens gebe<br />
es heutzutage „kein Entkommen vor einem<br />
Foto“, wie beide InterviewpartnerInnen<br />
bekräftigen. Paparazzi würden<br />
sich in den meisten Fällen jedoch zufriedengeben,<br />
wenn die Stars sie nicht<br />
ignorieren, sondern sich einfach einem<br />
Foto stellen würden. Ein Argument, das<br />
die traurige Geschichte von Prinzessin<br />
Diana vielleicht umgeschrieben hätte,<br />
beteuert Walter jene Nacht in Paris und<br />
fügt abschließend hinzu: „Die meisten<br />
Stars wissen sehr wohl auch, dass sie<br />
Paparazzi brauchen, um relevant zu<br />
bleiben.“ Ein (oft gefährliches) Spiel zwischen<br />
Liebe und Hass eben, das wie in<br />
allen Beziehungen nur durch gegenseitigen<br />
Respekt funktionieren kann.<br />
Edwin Walter / Copyright: Privat<br />
von Michael Geltner<br />
Ines Schwandner / Copyright: Babara Wirl<br />
© Copyright: adobe stock / Robert Daly/KOTO<br />
48<br />
Thema Zwischen Liebe und Hass - Das Geschäft mit der Privatsphäre der Stars
© Werner Jäger<br />
mstage wurde 2012 gegründet und ist eine zertifizierte E-Commerce Agentur mit einem großartigen<br />
Team, bestehend aus 15 festangestellten MitarbeiterInnen, mit Sitz im Herzen der St. Pöltner Innenstadt.<br />
Unsere Spezialisierung liegt in der Erstellung und Betreuung erfolgreicher Onlineshops, für sowohl<br />
nationale als auch internationale Projekte. Unsere Leistungen werden zur gesamtheitlichen Shoplösung,<br />
inklusive Konzept & Beratung, Design, Entwicklung des Themes sowie auch Individualfunktionen und<br />
Schnittstellen und ganz wichtig: eine nachhaltige Betreuung und Optimierung.<br />
mstage GmbH<br />
www.mstage.at<br />
Die (Ohn-)Macht des Presserates Thema<br />
49
Close up (or down), Cinema?!<br />
Streaming bietet nicht nur eine Vielzahl an verschiedenen Filmen und Serien, sondern ist auf Knopfdruck und<br />
pro Film gesehen günstiger. Aber was bedeutet der Umbruch von Kino auf Streaming und was sind die Geschäftsmodelle<br />
von Streaminganbietern? <strong>SUMO</strong> interviewte dazu den Obmann des Fachverbands für Kino-,<br />
Kultur- und Vergnügungsbetriebe der WKO Christian Dörfler und den Head of Communications von Sky Österreich<br />
Michael Huebner.<br />
Über 14 Millionen KinobesucherInnen<br />
verzeichnete das Kinojahr 2019 laut der<br />
von der AKM durchgeführten Statistik,<br />
was insgesamt ein Plus von knapp 6%<br />
zum Vorjahr ausmachte. Grundsätzlich<br />
schwanken die Besuchszahlen jährlich<br />
zwischen rund 13 bis 18 Millionen. Im<br />
Jahr von 2017 auf 2018 waren es rund<br />
minus 11%, also nur knappe 13 Millionen<br />
BesucherInnen und damit auch<br />
weniger als im Jahr 2017, mit über 15<br />
Millionen. Doch diese Schwankungen<br />
seien laut Christian Dörfler völlig normal.<br />
Vor allem der Rückgang im Jahr<br />
2018 zeichnete sich laut des Filmwirtschaftsberichts,<br />
durchgeführt im<br />
Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich,<br />
durch einen Mangel an Blockbustern<br />
und Komödien aus. Die Besonderheit<br />
an Blockbustern liegt darin,<br />
dass sie auf viele unterschiedliche Zielgruppen<br />
abzielen. Komödien gelten als<br />
das beliebteste Filmgenre und die geringe<br />
Anzahl dieses Genres anno 2018<br />
war auch Ausschlag für den Besucherausblieb.<br />
Aber nicht nur das Genre der<br />
Filme zählt als Besuchermotiv für das<br />
Kino, sondern vielmehr das Kino als gewissermaßen<br />
Eventlocation.<br />
Die Einzigartigkeit des Kinos spiegelt<br />
sich in der Technik, des Erlebnisses von<br />
Bild und Ton wider, mit dem die beste<br />
Heimanlage nicht mithalten kann. Das<br />
Ausgehen, einen Film ungestört sehen<br />
zu können, sowie das anschließende<br />
Austauschen und Diskutieren zählen,<br />
neben dem Film selbst, laut Dörfler zu<br />
den Hauptmotiven für den Gang ins<br />
Kino.<br />
Streamingdienste boomen<br />
Obwohl das letzte Kinojahr nicht<br />
schlecht ausfiel, sind die Geschäftsmodelle<br />
von Film- und Streamingdiensten<br />
erfolgreicher denn je. Doch was ist<br />
Streaming überhaupt? Michael Huebner<br />
klärt auf: „Streaming wird als das<br />
zur Verfügung stellen von Bewegtbild-<br />
Inhalten über digitale Verbreitungswege<br />
definiert. Dies kann sowohl linear<br />
als auch on Demand oder über Video/-<br />
Mediatheken erfolgen. Es ist ein paralleler,<br />
weiterer Verbreitungsweg zu den<br />
schon bekannten Distributionswegen<br />
Satelliten-, Kabel- und terrestrischer,<br />
also Antennen-Empfang.“<br />
Laut der Erhebung über den Einsatz<br />
von Informations- und Kommunikationstechnologien<br />
in Haushalten 2020,<br />
durchgeführt von Statistik Austria, nutzen<br />
6,6 Mio. ÖsterreicherInnen im Alter<br />
von 16 bis 75 Jahren Video-Streaming-<br />
Dienste. Von den Befragten streamten<br />
rund 64% kostenfreie Videos über<br />
Video-Sharing-Anbieter, 38% TV-Programme<br />
von Fernsehsendern in Echtzeit<br />
oder zeitversetzt und weitere 38%<br />
streamten kostenpflichtige Videos von<br />
kommerziellen Anbietern. Aber was<br />
genau bedeutet der Erfolg von Streaming<br />
für die Kinobranche? Die Frage, ob<br />
es überhaupt zu einem Umbruch von<br />
Streaming auf die Kinobranche kommt<br />
bzw. es einer ist bleibt offen. Dass sich<br />
etwas verändern werde, sei laut Dörfler<br />
natürlich keine Frage, aber wie genau<br />
es sich auswirke, könne man schlecht<br />
sagen. „Der Trend, dass Filme direkt auf<br />
Streaming-Plattformen ausgestrahlt<br />
werden und nicht auf die Leinwand<br />
kommen ist für die Kinos natürlich nicht<br />
positiv, aber wir befinden uns eben in<br />
einer Transformation der Medien.“ Laut<br />
Dörfler wisse man von früher, wenn die<br />
Kinoauswertung gut funktioniert hat,<br />
wird die Streamingauswertung auch<br />
gut funktionieren. Hier könnte es natürlich<br />
auch sein, dass man die Kinos<br />
unbedingt für die Auswertung braucht<br />
und sich deshalb kaum ändert.<br />
Für die Filmschaffenden sei es jedoch<br />
nicht von Vorteil, wenn nur auf Streamingauswertung<br />
ausgelegt wird, da<br />
es die Einnahmen drastisch reduziere.<br />
Ein Beispiel, das Dörfler hierfür nennt,<br />
ist der vor Kurzem erschienene Film<br />
„Mulan“, der direkt auf den Plattformen<br />
angeboten wurde und deshalb auch nur<br />
sehr wenig eingespielt habe.<br />
Umgekehrt ist Michael Huebner der<br />
Ansicht, dass auch Eigenproduktionen<br />
zukünftig vermehrt auf den Kinoleinwänden<br />
zu sehen sein würden. Im Gespräch<br />
mit <strong>SUMO</strong> berichtet er, dass dies<br />
innerhalb der Comcast Gruppe, beim<br />
NBC Universal Animationsfilm „Trolls<br />
World Tour“, schon gemacht wurde.<br />
Hier erfolgte der Kino- und der Streaming-Start<br />
des Filmes in den USA im<br />
April 2020 am selben Tag.<br />
Den besten Content über alle Devices<br />
<strong>SUMO</strong> sprach mit Michael Huebner<br />
auch über die Geschäftsmodelle von<br />
Film- und Serien-Streaminganbietern,<br />
wobei hier der Fokus beim Entertainment-Unternehmen<br />
Sky lag. Laut<br />
Huebner fokussiert sich Sky immer<br />
grundsätzlich darauf, dem TV- und Entertainmentfan<br />
das bestmögliche Angebot<br />
zu präsentieren und ihm dabei die<br />
flexibelste Zeitplanung zu ermöglichen.<br />
Sodass Menschen, die gerne Filme,<br />
Serien, Dokumentationen, Shows oder<br />
Live-Sport sehen, bei Sky die Adresse<br />
haben, auf die sie sich verlassen können<br />
und wo sie sagen: „Das ist für mich die<br />
Nummer eins auf der Fernbedienung.“<br />
Anders ausgedrückt versucht Sky seinen<br />
KundInnen die besten Inhalte über<br />
alle Devices zu jeder Zeit zur Verfügung<br />
zu stellen, um eben möglichst frei zu<br />
sein und sich den Alltag so angenehm<br />
und individuell wie nur möglich zu gestalten.<br />
Es gibt dabei, wie zu Beginn<br />
thematisiert, viele unterschiedliche<br />
Formen von „Streaming-Angeboten“.<br />
Zum einen Video-on-Demand, wo man<br />
Filme und Serien im Einzelabruf oder im<br />
Abonnement online „ausleihen“ kann,<br />
Videoportale, bei denen man kostenlose<br />
Videoclips ansehen, kommentieren<br />
oder selbst erstellen kann und auch<br />
Mediatheken für abrufbare Videoinhalte<br />
aus Programmen eines Senders. Der<br />
Grund, warum die Angebote der Streaminganbieter<br />
immer beliebter werden<br />
50<br />
Close Themaup (or down), Cinema?!
sei laut Huebner die große Freiheit<br />
Content jederzeit und überall verfügbar<br />
zu haben und ansehen zu können. Er<br />
spricht außerdem davon, dass es noch<br />
nie so viele Möglichkeiten gab Content<br />
zu rezipieren. Leute wollen unabhängig<br />
sein und frei entscheiden, welchem<br />
Anbieter sie sich zuwenden, was ebenfalls<br />
ein Teil und Charakteristikum des<br />
Streaming-Marktes sei.<br />
Laut Huebner gebe es bei Streamingmodellen<br />
weniger Risiken als beim<br />
klassischen TV, da es schlicht nur ein Internet-basierter,<br />
neuer Übertragungsweg<br />
sei. Hier überwiegen laut ihm also<br />
definitiv die Chancen. Wie man sich im<br />
Markt positioniere und von anderen abhebe,<br />
sei dann jedoch essenziell. Dabei<br />
werde es aber zukünftig zu einem wesentlich<br />
stärkeren Verdrängungs-Wettbewerb<br />
kommen, weil sich laut Huebner<br />
heutzutage jeder Anbieter inzwischen<br />
als Streamer bezeichne. Da der Markt<br />
relativ überfüllt sei, komme es – wie im<br />
TV-Markt – dazu, dass bestimmte Anbieter<br />
nicht mehr für den Kunden bzw.<br />
die Kundin interessant seien, da sie den<br />
entsprechenden, exklusiven Content<br />
nicht liefern, die Technik (Beispiel Ultra<br />
High Definition) nicht anbieten oder<br />
einen gemeinhin „akzeptablen Preis“<br />
durch ihr Geschäftsmodell nicht refinanzieren<br />
können. Laut Huebner sind<br />
dies die wichtigsten drei Kriterien, aber<br />
trotzdem bleibe das Programm das<br />
entscheidende Entscheidungsmerkmal.<br />
Ein dabei sehr wichtiger Aspekt<br />
im Geschäftsmodell von Streaminganbietern<br />
sind die sogenannten „Originals“,<br />
also deren Eigenproduktionen.<br />
„‚‚Sky Originals‘ seien extrem wichtig,<br />
weil sie damit die Marke Sky positionieren,<br />
das Markenprofil schärfen und<br />
wir dabei nahezu komplette Freiheit<br />
bezüglich der Verwertungs-Rechte haben“,<br />
so Huebner. Auch auf die Kinoleinwand<br />
schafften es zukünftig sicherlich<br />
mehr Originals. Huebners Ansicht nach<br />
würden Kino und Home Entertainment<br />
immer mehr zusammenrücken. „Bevor<br />
man kannibalisiert, arbeitet man besser<br />
zusammen und jeder profitiert von der<br />
Magie der großen Bilder und Geschichten.“<br />
Kinos wird es immer und ewig geben<br />
Laut Christian Dörfler sei der österreichische<br />
Kinomarkt Weltmarktführer,<br />
was Komfort und Technik betreffe.<br />
„Man wird in keinem Land so viele Imax,<br />
Atmos oder andere besondere Kinoformate<br />
in Prozent zur Bevölkerung finden,<br />
wie in Österreich“. Eine Möglichkeit den<br />
Kinobesuch wieder oder, besser gesagt,<br />
noch attraktiver für die BesucherInnen<br />
zu machen sei es laut Dörfler, das<br />
Ausgeherlebnis weiter aufzuwerten.<br />
Ein Beispiel, das er hierfür nennt, wäre<br />
etwa vor dem Ansehen eines französischen<br />
Films eine französische Weinverkostung<br />
zu machen oder ExpertInnen<br />
einzuladen. Bei Actionfilmen könnte es<br />
interessant sein, ExpertInnen einzuladen,<br />
die den ZuschauerInnen erklären,<br />
wie die Actionszenen funktionieren und<br />
gemacht werden.<br />
Auch Michael Huebner ist der Ansicht,<br />
dass man, wenn man vor einer schwierigen<br />
Situation stehe, kreativ und besser<br />
werden muss, als man das vorher<br />
oder je war. Seiner Ansicht nach seien<br />
viele Kinos erpicht darauf, das Entertainment<br />
zu verstärken und spricht<br />
dabei von neuen Audiotechnologien<br />
wie Dolby Atmos. Und: „Was nie sterben<br />
wird, ist das ‚‚Lagerfeuererlebnis‘,<br />
was man gerne hat. Dass man rausgeht<br />
und es auch in der Gruppe und in<br />
einem großen Raum wie dem Kino erleben<br />
möchte, das wird nie aussterben.<br />
Kinos wird es immer und ewig geben,<br />
aber eben parallel zu herausragenden<br />
Entertainment-Anbietern, die alle anderen<br />
Rezeptionswege bespielen und<br />
so die Fans bester Unterhaltung glücklich<br />
machen“, so Huebner.<br />
Eveline Hipeli / Copyright: Luisa Kehl<br />
von Julia Gstettner<br />
Christian Dörfler/ Copyright: fotoweinwurm.at<br />
Michael Huebner/ Copyright: Ana Chumroom<br />
© Copyright: adobe stock / metamorworks<br />
Close up (or down), Cinema?! Thema<br />
51
Wird nur noch bildlich<br />
gesprochen oder ist da doch<br />
zu viel Druck?<br />
Ihr Blick fiel wahrscheinlich als erstes auf das Hintergrundbild. Ohne es<br />
zu bemerken, haben Sie sich in der ersten Zehntelsekunde wortwörtlich<br />
schon ein grobes Bild von diesem Artikel gemacht, ohne zu wissen,<br />
wovon er überhaupt handelt. Fast zeitgleich haben Sie den Titel wahrgenommen<br />
und versuchten, das Bild mit ihm in Einklang zu bringen. Und<br />
nun fragen Sie sich, ob Sie wirklich so vorhersehbar sind.<br />
© Copyright: adobe stock / ardasavasciogullari<br />
<strong>SUMO</strong> hat sich dafür die fachkundige<br />
Meinung von Cornelia Brantner, Expertin<br />
für visuelle Kommunikation und seit<br />
Januar am Institut für Geografie, Medien<br />
und Kommunikation der Universität<br />
Karlstad in Schweden tätig, eingeholt.<br />
(Anm.: Das bereits fixierte zusätzliche<br />
Interview mit Bernhard Leitner, Chefredakteur<br />
des Gastronomie-Fachmagazins<br />
„ROLLING PIN“, konnte zeitbedingt<br />
nicht stattfinden.) Die Frage dieses<br />
Artikels ist nämlich eine der umstrittensten:<br />
Mehr Text oder doch lieber die<br />
derzeit beliebte Variante der Illustrationen?<br />
Denn der Trend der illustrierten<br />
Fachmagazine ist definitiv auf dem Vormarsch,<br />
Bildern wird eine große Bedeutung<br />
zugesprochen.<br />
Sind wir beeinflussbar?<br />
Auf die Frage, was das Auge als Erstes<br />
erkennt, wenn es ein Medium erfasst,<br />
antwortet Brantner ganz klar: das Bild<br />
(falls vorhanden). Studien haben mittels<br />
der Eye-Tracking-Methode belegt,<br />
dass beigefügte Bilder mehr Aufmerksamkeit<br />
erregen, sie sozusagen Einstiegspunkte<br />
darstellen. Auch würden<br />
Bilder laut Brantner besser erinnert<br />
als verbale oder geschriebene Texte<br />
und es bestehe ein höherer Wiedererkennungseffekt.<br />
Besitzt ein Bild mehr<br />
Aussagekraft, hält es mehr an Erzählungen<br />
bereit, als ein Text je vermitteln<br />
könnte? Betrachtet man das Ganze von<br />
außen, bekommen die LeserInnen beim<br />
Betrachten des Bildes eine ganz individuelle<br />
Reizüberflutung. Es kann viel<br />
besser Emotionen transportieren oder<br />
überhaupt emotionalisiert werden, da<br />
es eine sogenannte „Augenzeugenschaft“<br />
herstelle. Bilder seien glaubwürdiger,<br />
da man eher das glaubt, was<br />
man sieht als was man liest, denn „man<br />
vertraut ja seinen eigenen Sinnen.“ Dies<br />
nennt man den oben erwähnten Bildüberlegenheitseffekt.<br />
Durch Bilder bekomme<br />
man also wertvolle eigene Eindrücke,<br />
Emotionen, Assoziationen und<br />
bei manch einem/r wird die Phantasie<br />
angeregt. Auch könne dadurch eine<br />
Meinung transportiert werden oder<br />
eine Tendenz („visual bias“). Sie beeinflussen<br />
sozusagen dadurch, was man<br />
wie wahrnimmt, auch den später gelesenen<br />
Text. Die Textwahrnehmung wird<br />
also „geframed“, sozusagen in einen<br />
vom Journalisten bzw. von der Journalistin<br />
vorgefertigten Rahmen gesteckt.<br />
Wiederum ist es schwierig, den Kontext<br />
eines Artikels zu verstehen, wenn<br />
das angefügte, beschreibende Bild eine<br />
ganz andere Aussage vermittelt wie der<br />
Text. Brantner nennt dies die Bild-Text-<br />
Schere. Denn wenn das Bild nicht wirklich<br />
mit dem dazugehörigen Text übereinstimmt,<br />
ist das Verständnis recht<br />
schwierig. (Diesen Effekt kann man<br />
wahrscheinlich gut wahrnehmen, war<br />
das gewählte, additive Bild zu diesem<br />
Artikel doch ein Foto eines roten Porsches.<br />
Dies ist kein Text über schnelle<br />
Autos, wie man am Anfang hätte vermuten<br />
können, doch man war bis zu<br />
diesem Zeitpunkt dezent verwirrt über<br />
eben diese Bildauswahl.) Ein Bild und<br />
ein Text haben ja eine bestimmte Aussage,<br />
welche sich gegenseitig stützen<br />
soll. Bei der sogenannten Schere würde<br />
dies nicht berücksichtigt werden und<br />
52<br />
Wird nur noch bildlich gesprochen oder ist da doch zu viel Druck?
© Copyright: adobe stock / Maksim Kabakou<br />
daher wäre es schwierig, die Botschaft<br />
zu verstehen und sich diese zu merken.<br />
Man könnte als Erklärung hierfür in die<br />
Cue-Summation-Theorie tauchen. „Diese<br />
besagt, dass multimodal präsentierte<br />
Informationen, also Informationen,<br />
bei denen Bild und verbaler (gesprochener<br />
oder geschriebener) Text kombiniert<br />
werden, besser erinnert werden, weil<br />
sie kognitiv besser verarbeitet werden.<br />
Werden etwa zu Texten Bilder hinzugefügt,<br />
haben wir mehr Lernhinweise. Das<br />
gilt aber nur, wenn die Modi aufeinander<br />
abgestimmt sind“, wie Brantner es<br />
beschreibt. Bilder sind assoziativ, man<br />
verbindet schnell das Gesehene mit<br />
dem, was man weiß. Die Kommunikationswissenschaftlerin<br />
bringt dazu ein<br />
treffendes Beispiel: „Angenommen, Sie<br />
sehen ein Foto von einem bestimmten<br />
Auto. Da wissen Sie gleich, dass die<br />
Farbe, die man sieht, ,rot´ heißt und es<br />
sich bei dem Auto um einen Porsche<br />
handelt, weil man das gelernt hat. Man<br />
merkt sich zu dem Foto also auch noch<br />
die Bezeichnungen.“ Eine der Theorien,<br />
mit welcher dieser Vorgang erklärt werden<br />
kann, ist die sogenannte „Dual-Coding-Theorie“.<br />
Diese besagt, dass Bilder<br />
und konkrete Texte doppelt im Gehirn<br />
abgespeichert werden, abstrakte Texte<br />
hingegen nur einmal. Wie das funktioniert,<br />
erklärt die Expertin so: „Ein Bild<br />
wird verbal und visuell abgespeichert.<br />
Die überwiegend duale Codierung von<br />
Bildern im Vergleich zu Worten führt<br />
dann zu besagtem Bildüberlegenheitseffekt,<br />
also dass Bilder einprägsamer<br />
und besser erinnerbar sind.“ Das heißt,<br />
dass man sich von dem Beispiel vorhin<br />
das Bild merkt und die dazugehörigen,<br />
beschreibenden Begriffe. „Man merkt<br />
sich ja nicht, dass man ein rotes Objekt<br />
gesehen hat, sondern dass es ein<br />
Auto der Marke Porsche ist.“ Natürlich<br />
entstünden beim Lesen auch Bilder im<br />
Kopf, bei lebhaften Texten mehr wie<br />
bei abstrakten. Doch diese seien der<br />
eigenen Imagination überlassen, mit<br />
welchen dazugehörigen Details man<br />
sich diese Kopfbilder vorstelle. Da greift<br />
dann aber auch wieder die Dual-Coding-Theorie:<br />
Abstraktes (ob Bild oder<br />
Text) merkt man sich einfach schlechter,<br />
da die erforderlichen Assoziationen<br />
fehlen.<br />
man selten das eine ohne das andere.<br />
Diese beiden treten meist gemeinsam<br />
auf und wirken dementsprechend auch<br />
aufeinander ein. Sie „stützen sich gegenseitig,<br />
machen sich interpretierbar,<br />
eindeutiger und verständlicher.“ Jedoch<br />
ist das Bild in seiner Bedeutung offen<br />
– das Wort hingegen ist festgelegt.<br />
Das Illustrierte wird einem als Amuse-<br />
Gueule serviert, welches einen zu der<br />
konzentrationserforderlichen Hauptspeise<br />
führt. Bilder ergänzen meist den<br />
Text, da die Sprache nicht immer ausreicht,<br />
um einen Sachverhalt korrekt<br />
beschreiben zu können. Jedoch haben<br />
Bilder zwar eine intendierte Bedeutung,<br />
aber das, was man mit dem Bild sagen<br />
will, und das, was der/die Rezipient/<br />
in schlussendlich aus dem Bild herausliest,<br />
sind zwei verschiedene paar<br />
Schuhe. Und auch mit Text kann etwas<br />
zwar beschrieben werden, er überlässt<br />
es aber einem/r selbst und der eigenen<br />
Imagination, sich den Sachverhalt<br />
genau vorzustellen. Man interpretiert<br />
zwar nach dem was man sieht, aber<br />
das, zum Beispiel in einer Bildunterschrift,<br />
additiv Geschriebene gibt vor,<br />
was man sehen soll. Denn erst der Einsatz<br />
von Text reduziert Ambivalenzen.<br />
Medientexte sind nur selten rein visuell,<br />
eher wird sich der Modus Text und das<br />
Modus Bild ergänzen. Somit gewinnt<br />
der multimodale Text die Schlacht.<br />
Alles nur Schein, aber kein Sinn?<br />
Doch ein stilles Bild ist immer noch ein<br />
Bild, welches auf die Darstellung eines<br />
Moments beschränkt ist. Eine Handlungsfolge,<br />
welche im geschriebenen<br />
Zustand eine ganz andere Geschichte<br />
erzählen könnte, kann somit mit Illustrationen<br />
schwer umgesetzt werden,<br />
da eben nur ein bestimmter Moment<br />
erfasst wird. Auch bei der Wahl des<br />
Bildmittels muss bedacht werden, dass<br />
dieses verschiedene Ansichtsweisen<br />
der RezipientInnen erreichen kann.<br />
Der Kampf zwischen Lichtschrift versus<br />
Text<br />
Als ein Synonym für Bild findet man<br />
den Begriff „Lichtschrift“, da durch eine<br />
Kamera sozusagen mit Licht geschrieben<br />
wird. Doch so schön es auch klingt,<br />
es stellt sich immer noch die Frage, ob<br />
lieber vermehrt auf das Bild- oder Textlastige<br />
gesetzt werden soll. Allgemein<br />
könnte man Text und Bild als Konkurrenzmodi<br />
bezeichnen, jedoch findet<br />
Cornelia Brantner / Copyright: Martin Stellnberger<br />
Wird nur noch bildlich gesprochen oder ist da doch zu viel Thema Druck?<br />
53
© Copyright: adobe stock / metamorworks<br />
Nehmen wir die Farbstimmung als Beispiel:<br />
Ein Text kann noch so positiv verfasst<br />
sein, wird ein dunkles, mit wenig<br />
Intensität gewähltes Bild verwendet,<br />
mag der eine oder die andere denken,<br />
es handle sich um ein etwas düsteres<br />
Thema. Ginge es mehr ins Blaue,<br />
könnte es aber auch für Ruhe und Entspannung<br />
stehen. Tatsächlich ist unsere<br />
Farbwahrnehmung oftmals bereits<br />
durch unsere Sozialisierung und vor<br />
allem unsere Instinkte vordeterminiert,<br />
sodass wir automatisch verschiedenen<br />
Farbtönen verschiedene Assoziationen<br />
zuordnen. Und genau das macht das<br />
Phänomen Bild auch so eindrucksvoll,<br />
es kann ganz unvermittelt die unterschiedlichsten<br />
Gefühle in uns auslösen<br />
und uns somit unbewusst beeinflussen.<br />
Doch aus diesen Gründen könnte<br />
man auch das Bild als Verleumder und<br />
Lügner darstellen, das sagt jedenfalls<br />
der deutsche Dichter Ferdinand Avenarius,<br />
welcher dies schon bei Kriegsbildern<br />
und -propaganda des Ersten<br />
Weltkrieges bemerkt hatte. Doch das<br />
kann schon lange nicht mehr wirklich<br />
als richtig erachtet werden, lügen doch<br />
Personen – und nicht die Gegenstände.<br />
Lügen sollen eine Täuschung oder Irreführung<br />
einer/s anderen bewirken, so<br />
gesehen ist nicht alles Sein. Das Bild<br />
ist der Schein, aber dieser wird gerne<br />
durch den/die Retuscheur/in verändert,<br />
um den/die Betrachter/in zu täuschen.<br />
Es muss nicht also nicht der ganzen<br />
„Wahrheit“ entsprechen.<br />
„Papier ist geduldig, der Leser nicht“<br />
Man braucht nicht unbedingt Bildung<br />
für Bilder, um diese zu verstehen, wie<br />
es bei der Schrift der Fall ist. Der Zahn<br />
der Zeit nagt am Text und versucht ihn<br />
immer weiter einzukürzen. Plattformen<br />
wie „Facebook“ haben dazu nicht unwesentlich<br />
beigetragen, möchte man<br />
sich heutzutage doch meist sofort,<br />
wenn es einem danach ist, informieren<br />
können. Eine Nachricht muss kurz und<br />
knackig sein, aus einem Artikel soll man<br />
in einem Augenblick das wichtigste herauslesen<br />
können, am besten ein aussagekräftiges<br />
Bild als Unterstützung<br />
mitangeheftet. Doch stellt dies das<br />
Aus für die Printmedien dar? Cornelia<br />
Brantner ist nicht dieser Meinung, laut<br />
ihr werde der Lesemarkt für klassische<br />
Printmedien zwar kleiner und würden<br />
weniger gekauft werden, jedoch sieht<br />
sie Social Media nicht als Gefahr für<br />
journalistische Artikel an. Denn Social<br />
Media-Plattformen sind intermediär,<br />
das heißt, dass dort eine Vermischung<br />
von Öffentlichkeitsebenen passiert, sozusagen<br />
das Journalistische mit dem<br />
Privatem. Als Konkurrenz wäre es vielleicht<br />
in diesem Sinne anzusehen, da<br />
es einen Zeitabzug darstellt, denn „die<br />
Zeit, welche man auf Social Media verbringt,<br />
verbringt man eben nicht damit,<br />
einen Artikel eines Printmediums zu<br />
lesen“, so Brantner. Es zieht also Aufmerksamkeit<br />
auf sich und Nutzungsressourcen<br />
ab, jedoch soll es keine direkte<br />
Gefahr oder Schaden explizit für<br />
Magazine darstellen. Wo gerade von<br />
Magazinen gesprochen wird: Diese machen<br />
sich das Nutzerpotenzial dieser<br />
Plattformen zugunsten, um auch die<br />
jungen NutzerInnen auf sich aufmerksam<br />
zu machen. „Journalismus geht auf<br />
Social Media.“ Durch die entstandene<br />
Gratiskultur im Internet ist zwar eine<br />
Konkurrenz entstanden, da die RezipientInnen<br />
eher die kostenlose Onlineversion<br />
lesen, jedoch werden journalistische<br />
Texte nicht weniger gelesen, das<br />
Geschehen verlagert sich eher. Artikel<br />
auf solchen Plattformen werden meist<br />
mit einem ausdrucksstarken Bild und<br />
kurzen Text angeteasert, welcher auch<br />
den Link zum eigentlichen Medium beinhaltet.<br />
Gekommen, um zu bleiben<br />
Wenn man einen Blick in die Geschichtsbücher<br />
wirft, wird man entdecken,<br />
dass Bilder bereits 35.000 Jahre<br />
vor der Schrift erschienen sind. Man<br />
muss also schon bis zur analphabetischen<br />
Gesellschaft zurückgehen, um<br />
bildliche Darstellungen ganz ohne dazugehörigen<br />
Text in journalistischen<br />
Medien zu finden. „Mit der Digitalisierung<br />
ist auch ein Visualisierungsschub<br />
feststellbar – dies hat auch Auswirkung<br />
auf die journalistische Vorgehensweise.<br />
Studien zeigen, dass klassische Zeitungen<br />
mehr Bilder als früher verwenden“,<br />
konstatiert die Expertin. Sie ist der<br />
Auffassung, dass Bilder zwar auf dem<br />
Vormarsch seien, diese aber äußerst<br />
selten alleine stehen würden, es wird<br />
also immer etwas Multimodales geben.<br />
Der Text kann im Umkehrschluss<br />
auch beeinflussen, wie das Bild gelesen<br />
wird. Durch Bildunterschriften werden<br />
zum Beispiel auf dem Bild zu sehende<br />
Personen und Situationen beschrieben.<br />
Man befindet sich zwar im Zeitalter der<br />
Visualität, jedoch kommt man nicht<br />
ohne Sprache aus, nicht ohne Kontext<br />
und Text, in die die Bilder eingebettet<br />
sind.<br />
von Annika Schuntermann<br />
54<br />
Thema Wird nur noch bildlich gesprochen oder ist da doch zu viel Druck?
Der Traum der europäischen<br />
Datensouveränität<br />
Beinahe jeder Mensch, der einen Computer besitzt, benutzt sie: Clouddienste.<br />
Die erfolgreichsten Anbieter dieser haben ihren Sitz in den USA.<br />
Dies führt nicht nur zu Bedenken bei PrivatverbraucherInnen, sondern vor<br />
allem bei Unternehmen. <strong>SUMO</strong> bat dazu Reinhard Posch, Chief Information<br />
Officer der Bundesregierung, sowie Helmut Leopold, Head of Center<br />
for Digital Safety & Security am Austrian Institute of Technology (AIT), um<br />
Auskünfte.<br />
In der EU wird Datenschutz nunmehr<br />
eine große Bedeutung zugeschrieben.<br />
Ständig aufflammende Diskussionen<br />
zur Thematik zogen auch die Datenschutzgrundverordnung<br />
der EU nach<br />
sich. Diese bedeutete für Nicht-Privatpersonen<br />
vor allen Dingen ein<br />
Überdenken des Schutzes ihrer zu<br />
verarbeitenden Daten. Dank des Safe-<br />
Harbour-Abkommens und später des<br />
EU-US-Privacy-Shields war das Speichern<br />
beziehungsweise Verarbeiten<br />
personenbezogener Daten auf Servern<br />
US-amerikanischer Unternehmen –<br />
trotz der sehr differenten Datenschutzrichtlinien<br />
in den USA – soweit kein<br />
Problem.<br />
Regelung für nichtig erklärt<br />
Dies änderte sich allerdings mit dem<br />
Erfolg einer Nichtigkeitsklage der irischen<br />
Datenschutzbehörde vor dem<br />
Europäischen Gerichtshof, ausgelöst<br />
durch den Datenschutzaktivisten Max<br />
Schrems. Helmut Leopold erklärt die<br />
Situation in der EU folgendermaßen:<br />
„Wenn man beliebig unsere personenbezogenen<br />
Daten, also Daten, die einen<br />
Rückschluss auf uns erlauben und uns<br />
negativ einschränken könnten, verwenden<br />
kann, dann ist unsere Freiheit<br />
bedroht. Wir haben uns als Gesellschaft<br />
diesen Wert der Freiheit sehr hoch gelegt<br />
und haben uns dafür die Bürde gegeben,<br />
dass wir vorsichtig sind, wie wir<br />
mit den Daten umgehen und so kommt<br />
es zum Datenschutzgesetz. In Europa<br />
können wir Daten einem Datenanbieter<br />
geben, und weil er dem Gesetz unterliegt,<br />
schaut das Gesetz darauf, dass<br />
meine Daten nicht missbraucht werden.“<br />
Auch für Reinhard Posch machte<br />
diese Entscheidung durchaus Sinn:<br />
„Die US-Gesetzgebung hat in diesem<br />
Zusammenhang nicht den Gedanken<br />
territorial gebunden zu sein. Das heißt,<br />
wenn eine Firma auch in den USA wesentliche<br />
Geschäfte tätigt, geht das<br />
US-Gesetz davon aus, dass diese Firma<br />
von den Gesetzen betroffen ist. Sprich,<br />
wenn Microsoft in Österreich, Amazon<br />
in Irland ein Servicezentrum hat, dann<br />
gehen die US-Gesetze davon aus, dass<br />
der Zugriff, sofern er notwendig ist, gegeben<br />
ist. Und das ist ein beachtliches<br />
Souveränitätsproblem.“ Aus dieser Entscheidung<br />
folgt, dass es nun nicht mehr<br />
legal ist, personenbezogene Daten auf<br />
Servern US-amerikanischer Anbieter zu<br />
speichern, selbst wenn diese ihre Server<br />
in Europa haben. Doch dies bedeutet<br />
in erster Linie nicht, dass das Speichern<br />
auf Servern dieser gar nicht mehr<br />
möglich ist. Leopold beschreibt das wie<br />
folgt: „Somit fällt der Default-Mechanismus<br />
weg, die amerikanischen Anbieter<br />
sind hier erstmal ausgeschlossen<br />
und wir brauchen Alternativlösungen.<br />
Da gibt es zwei Ansätze: Zum einen<br />
muss man verstehen, dass das Datenschutzgesetz<br />
ja nicht prinzipiell verbietet,<br />
Daten im Ausland zu speichern,<br />
nur der Default-Mechanismus gilt nicht<br />
mehr. Es ist nun nur jede/r verpflichtet<br />
dafür Sorge zu tragen, dass sich auch<br />
ausländische Serviceanbieter an unsere<br />
Datenschutzgesetze halten – solange<br />
es dort äquivalente Mechanismen<br />
gibt, die unserem Datenschutzgesetz<br />
entsprechen, können auch im Ausland<br />
Daten gespeichert werden. Zum anderen<br />
stimuliert die neue Regelung natürlich<br />
den Markt für europäische Anbieter.<br />
Dafür braucht es aber nun auch<br />
entsprechende Angebote von europäischen<br />
Serviceanbietern.“<br />
Souveränitätsproblem in Europa<br />
Posch beschreibt dieses Problem folgenderweise:<br />
„Wenn wir etwas auf<br />
die Cloud abbilden, haben wir zwei<br />
wesentliche Aspekte. Der eine ist der,<br />
dass Informationen irgendwo hingehen<br />
könnten. Das ist traurig und das ist für<br />
manche Bereiche auch problematisch.<br />
Das heißt, Inhalt ist das eine, aber was<br />
oft völlig übersehen wird ist die prinzipielle<br />
Bereitstellung. Wenn Sie ein<br />
© Copyright: adobe stock / kras99<br />
Der Traum der europäischen Datensouveränität Thema<br />
55
© Copyright: adobe stock / Bernulius<br />
Service über eine Cloud anbieten, dann<br />
kann der Cloud-Anbieter morgen sagen,<br />
dass er seine Dienste einstellt. Stellen<br />
Sie sich vor, Sie hätten die Einsatzservices<br />
von Polizei- und Gesundheitsdiensten<br />
in der Cloud und der Provider<br />
stellt seinen Dienst ein: Da steht der<br />
österreichische Gesundheitsdienst, die<br />
Exekutive, die Finanzverwaltung. Das<br />
bedeutet ein Souveränitätsproblem des<br />
prinzipiellen Bestandes und das Souveränitätsproblem<br />
der Geheimhaltung.“<br />
Die Revidierung des Privacy Shields<br />
eröffnet nun enorme Chancen für den<br />
europäischen Markt. Blicken wir auf die<br />
weltweiten Marktanteile von Cloudservice-Anbietern,<br />
fällt schnell auf,<br />
dass europäische Anbieter keine Rolle<br />
spielen. Umso dringender wird es, dass<br />
die europäische Wirtschaft Services für<br />
den europäischen Markt anbietet und<br />
die ihr gegebene Chance adäquat nutzt.<br />
Auch der Experte für digitale Sicherheit<br />
Leopold erkennt dieses Problem: „Somit<br />
gibt es den marktwirtschaftlichen<br />
Effekt, dass Anbieter im europäischen<br />
Raum hier keinen Nachteil, oder sogar<br />
einen Vorteil, haben. Weiters gibt es die<br />
Herausforderung für die europäische<br />
Wirtschaft. Es muss natürlich Angebote<br />
geben, sonst kann der/die Kunde/in<br />
diese nicht berücksichtigen. Da gibt es<br />
sicher einen Aufholbedarf Europas, da<br />
haben wir uns zu lange in Sicherheit gewogen.“<br />
Pläne zu genuin europäischen<br />
Clouddiensten<br />
Seit des Kippens des Abkommens zwischen<br />
EU und USA wird das Thema zu<br />
genuin europäischen Clouds brisanter.<br />
Eine datensouveräne Europäische Union<br />
würde viele Vorteile mit sich bringen.<br />
Vor allen Dingen würden die personenbezogenen<br />
Daten, beziehungsweise<br />
die Daten europäischer Personen und<br />
Unternehmen generell, das Hoheitsgebiet<br />
der EU nicht mehr verlassen.<br />
Dennoch stellt sich die Frage, ob eine<br />
Datensouveränität und Datensicherheit<br />
durch das alleinige Bestehen und<br />
Verwenden europäischer Anbieter bestehen<br />
würde? Reinhard Posch, Leiter<br />
der Plattform „Digitales Österreich“,<br />
erklärt am Beispiel von „WhatsApp“,<br />
warum Europa wesentlich abhängiger<br />
von internationalen Anbietern ist, als<br />
es am ersten Blick erscheint: „Möglicherweise<br />
verwenden Sie ‚WhatsApp‘<br />
oder ähnliche Dienste, dann werden<br />
Sie dort extrem hinters Licht geführt.<br />
Sie steigen ein und sehen, es ist Endezu-Ende-verschlüsselt<br />
und dass alles<br />
gewahrt ist. Sie können dann jemanden<br />
zu einem Gespräch auf ‚WhatsApp‘<br />
einladen, aber das macht natürlich die<br />
App und im Hintergrund der Server. Ob<br />
Sie jetzt davon informiert werden, dass<br />
noch jemand zu diesem Gespräch eingeladen<br />
wird, ist einzig und allein Entscheidung<br />
der App bzw. des Servers.<br />
Damit sehen Sie, dass auch bei solchen<br />
Diensten, wo Privacy ‚vorgetäuscht‘<br />
wird, durchaus solche Mechanismen<br />
eingesetzt werden könnten, wenn<br />
sich US-Behörden dazu entscheiden.“<br />
Auch Leopold betont, wie wichtig eine<br />
Datensouveränität wäre: „Darum ist<br />
das Thema digitale Souveränität eine<br />
der wichtigsten Aufgaben für unsere<br />
Grundwerte der Demokratie und für die<br />
wirtschaftliche Überlebensfähigkeit.“<br />
Dieses Phänomen, wie am Beispiel<br />
„WhatsApp“ beschrieben, lässt sich<br />
nun auch auf andere Dienste umlegen.<br />
Vor allem auf Kommunikationsdienste,<br />
aber auch auf andere Softwareprodukte,<br />
wie Betriebssysteme von Smartphone<br />
und Computer. Es ist fraglich, ob<br />
man von einer Datensouveränität sprechen<br />
kann, wenn man dennoch auf diese<br />
Dienste angewiesen ist: „Auf solche<br />
Dienste zu verzichten ist schwer. Können<br />
Sie auf Microsoft Office verzichten?<br />
Es gibt natürlich Papiere, wie man aus<br />
Clouds aussteigen kann, Diskussionen<br />
wie man die Abhängigkeit von Herstellern<br />
beherrschen könnte, aber das<br />
würde im Cloudbereich extreme Investitionen<br />
erfordern. Das würde bedeuten,<br />
dass man nur für die Verwaltung<br />
eine völlig eigene Infrastruktur aufbauen<br />
müsste und dann sind die Vorteile,<br />
welche die Cloud predigt, finanziell<br />
kompensiert. Wir schaffen es nicht,<br />
auf solche Services zu verzichten, wir<br />
müssen mit diesem Dilemma leben und<br />
dagegen kämpfen, vor allem auch auf<br />
europäischer Ebene. Auf europäischer<br />
Ebene haben wir natürlich die Problematik,<br />
dass die Einflussgeber auf Brüssel<br />
zu 50% aus Firmen des US-Bereichs<br />
stammen. Und damit wird es deutlich<br />
schwieriger“, hebt Posch hervor.<br />
Wie soll es weitergehen?<br />
Eine – zumindest gewisse – europäische<br />
Datensouveränität ist ein mehr<br />
als nur anstrebenswertes Ziel. Darin<br />
sind sich auch Leopold und Posch einig.<br />
Doch wie soll die Zukunft aussehen?<br />
Auch in Bezug auf Diskussionen zu Si-<br />
56<br />
Der Thema Traum der europäischen Datensouveränität
cherungsanordnungen, welche es EU-<br />
Behörden erlauben sollen, auf Daten in<br />
Clouds zuzugreifen, insofern eine ausreichende<br />
Begründung vorliegt. Helmut<br />
Leopold meint hierzu, dass die Behörden<br />
in den USA über ihr Ziel hinausgeschossen<br />
hätten, dass es hier in der EU<br />
einer besseren Lösung bedürfe: „Aber<br />
wir sollten in Europa eine vernünftige<br />
Lösung finden, wo einerseits die Behörde<br />
Möglichkeiten bekommt, andererseits<br />
aber nicht unsere Grundrechte<br />
unterbindet.“ Auch Reinhard Posch<br />
weist auf die Dringlichkeit des Datenschutzes<br />
hin: „Wenn die österreichische<br />
Verwaltung eine Cloud verwendet,<br />
muss die österreichische Verwaltung<br />
auch Herr der Identifikationsmechanismen<br />
der Cloud sein. Eine derartige<br />
Cloud gibt es aber nicht. Und genau das<br />
widerspricht der Idee des Cloud Acts,<br />
denn wenn Österreich wieder Herr der<br />
Identitäten ist, kann nicht mehr in die<br />
Daten hineingeschaut werden, kann<br />
z.B. ‚WhatsApp‘ nicht mehr jemanden<br />
einladen. Weil er die Identitäten nicht<br />
mehr managen kann.“ Es fehlt also<br />
noch einiges an Diskussion und Entwicklung<br />
in der EU, bevor die eigenen<br />
Ziele erreicht werden können und von<br />
einer europäischen Datensouveränität<br />
gesprochen werden kann.<br />
von Matthias Schnabel<br />
Reinhard Posch / Copyright: Reinhard Posch<br />
Helmut Leopold / Copyright: Picture-<br />
People-AIT<br />
Der Traum der europäischen Datensouveränität Thema<br />
57
Steckt der österreichische Film<br />
in der Krise?<br />
<strong>SUMO</strong> hat mit Arie Bohrer, Film Commissioner bei Location Austria und<br />
Jakob Pochlatko, Geschäftsführer und Produzent bei epo-film, über die<br />
derzeitige Situation in der österreichischen Filmlandschaft gesprochen.<br />
Thematisiert wurden die Besonderheiten von Österreich, der Förderbedarf<br />
und wie Koproduktionen bzw. Streaming dem österreichischen Markt<br />
helfen könnten.<br />
Philipp H., geboren 1966, beschreibt die<br />
Zeit der heimischen Filmrezeption, als<br />
„Netflix“ und Co. noch nicht mal als Idee<br />
existierten. Damals hätte es nur Fernsehen<br />
zu bestimmten Uhrzeiten gegeben<br />
und nicht rund um die Uhr, wie man es<br />
heute kennt. Filme in Farbe zu sehen<br />
war keine Selbstverständlichkeit. Auch<br />
die Kino-Erfahrung war eine andere.<br />
Besuchte man beispielsweise das Gartenbaukino<br />
in Wien, so kaufte man sich<br />
um 7,50 bis 15 Schilling (0,55 bis 1,10<br />
EUR) ein Kinoticket für beispielsweise<br />
Disney’s „Ein toller Käfer“ oder „James<br />
Bond 007 – Diamantenfieber“ mit Sean<br />
Connory. Zum Ticket kaufte man sich<br />
ein „Kinogramm“: Dadurch konnte man<br />
Informationen bekommen zu der Besetzung<br />
und dem Produktionsteam und<br />
Fotos aus dem Film, sowie zum Inhalt<br />
des Films – bei Filmen wie „James Bond“<br />
auch Auszüge aus einem Interview mit<br />
BBC zum Film. Ehe der Film startete,<br />
gab es auch schon Werbung, allerdings<br />
in einer anderen Form, etwa dass eine<br />
bekannte österreichische Modekette<br />
wie Fürnkranz eine Modeschau mit der<br />
neuesten Kollektion vorführte.<br />
Und heute? <strong>SUMO</strong> hat den Filmproduzenten<br />
und Geschäftsführer von<br />
epo-film Jakob Pochlatko gefragt, wie<br />
es mit der Filmlandschaft in Österreich<br />
momentan aussieht und ob die<br />
großen Hollywood-Filmschaffenden<br />
und Franchises wie Marvel und Disney<br />
ein Grund sein könnten, wieso österreichische<br />
Filme nicht mehr so häufig<br />
rezipiert werden. Es gebe grundsätzlich<br />
eine erkennbare Schere bei den Kinobesucherzahlen.<br />
Sehr viele Menschen<br />
nutzen wenige große Filme und die Zahl<br />
an kleineren Filmen, mit soliden Zuschauerzahlen,<br />
ginge stärker zurück. Der<br />
Hauptanteil der Kinofilmbesucher*innen<br />
beziehe sich auf die wenigen Großen und<br />
man könne bemerken, dass Franchise<br />
und eingeführte Marken gut funktionieren,<br />
erklärt Pochlatko. „Marken und große<br />
Blockbuster-Produktionen mit dem<br />
entsprechenden Werbebudget tun sich<br />
leichter und ziehen einen Großteil der<br />
Zuschaueraufmerksamkeit auf sich. Das<br />
ist im Kino sicherlich so, aber auf der anderen<br />
Seite im linearen Fernsehen etwas<br />
anders, als dass österreichische Inhalte<br />
schon sehr stark nachgefragt werden.<br />
Das sieht man nach wie vor bei den sehr<br />
guten Quoten im ORF oder mittlerweile<br />
auch bei ‚‚Servus TV‘, die sich nach wie<br />
vor auf regionale Inhalte konzentrieren<br />
und das kommt gut bei den Zuschauer*innen<br />
an.“<br />
Österreich hat filmtechnisch viel zu bieten.<br />
Um den (Film)Standort Österreich zu<br />
promoten, gibt es Location Austria. Als<br />
Unterabteilung der ABA (Austrian Business<br />
Agency), der staatlichen Agentur für<br />
Industrieansiedlung- und Wirtschaftswerbung,<br />
ist sie die erste Anlaufstelle<br />
für internationale Filmproduktionen, die<br />
in Österreich drehen wollen. Arie Bohrer,<br />
Film Commissioner bei Location Austria,<br />
erklärt, dass die Kontaktaufnahme telefonisch,<br />
über Mail, die Website sowie<br />
über das vorhandene Netzwerk internationaler<br />
Kontakte erfolgen könne. Die<br />
Kund*innen von Location Austria seien<br />
zahlreiche internationale Produktionen.<br />
Deutsche Produktionsfirmen hätten<br />
aufgrund langjähriger Kooperationen<br />
ohnehin schon Kontakte in Österreich,<br />
daher kämen die meisten internationalen<br />
Kontakte beispielsweise aus Amerika,<br />
Großbritannien, Indien, Ungarn oder<br />
auch Tschechien. Die Kontaktvermittlung<br />
zu den betroffenen Locations laufe<br />
in den meisten Fällen über Location<br />
Austria, aber es sei abhängig, wie viel<br />
die Produzent*innen vorab recherchiert<br />
hätten und ob schon ein Kontakt zu der<br />
Location aufgebaut sei.<br />
Das Besondere an Österreich<br />
Was den (Film)Standort Österreich attraktiv<br />
mache, seien die Infrastruktur,<br />
die Motive bzw. Settings und, neben diversen<br />
anderen Fördereinrichtungen, die<br />
Förderinstitution Filmstandort Austria<br />
(FISA), so Bohrer. Die Förderung durch<br />
FISA biete auch für Produktionen, die<br />
nach Österreich kommen und keine Koproduktionen<br />
sind (wobei auch Letztere<br />
FISA-Förderung erhielten), die Möglichkeit,<br />
dass 30% der in Österreich getätigten<br />
Ausgaben refundiert werden können,<br />
fügt der Film Commissioner hinzu.<br />
Er erzählt, dass Berge häufig nachge-<br />
58<br />
Thema Steckt der österreichische Film in der Krise?
fragt werden würden, genauso wie die<br />
Städte Wien und Salzburg, aber es gebe<br />
keine „Peaks“. Aber wo ein Produktionsteam<br />
letztendlich filmt, sei abhängig<br />
vom Inhalt. Auch der Filmproduzent von<br />
epo-film stimmt zu, dass Österreichs<br />
Landschaft einen Teil beitrage: „Ich glaube,<br />
es ist die Kombination aus Humor,<br />
Landschaft und Schauspieler*innen. Die<br />
Zuschauer*innen sehen gerne Dinge, die<br />
sich in ihren Lebenswelten abspielen. Da<br />
holt man Leute emotional anders ab.“ Die<br />
Identifizierung mit der Lebenswelt sei<br />
sehr relevant: „Wenn das eine Lebenswelt<br />
ist, mit der sie sich identifizieren<br />
können, also eine Kombination von bekannten<br />
Regionen und Schauspieler*innen<br />
mit Wiedererkennungspotential.<br />
Humor ist in jedem Land anders“. Er fügt<br />
hinzu, dass der österreichische Humor<br />
speziell sei, aber natürlich sehr gut beim<br />
österreichischen und erfreulicherweise<br />
auch beim deutschen Publikumankomme.<br />
Dass deutschsprachige Komödien<br />
gerne von österreichischen Zuseher*innen<br />
rezipiert werden, wird von der Statistik<br />
der erfolgreichsten Filme in Österreich<br />
2018 bestätigt. Zieht man alle<br />
deutschsprachigen Filme heran, so sind<br />
vier von sechs Filmen der Kategorie „Comedy“<br />
zugeordnet konstatieren das Österreichische<br />
Filminstitut, Rentrak 2020<br />
bzw. Statistik Austria.<br />
Location-Suche<br />
Um für Filmproduzent*innen eine passende<br />
Location zu finden, werde zuerst<br />
bei Location Austria besprochen, was<br />
nötig sei, dann eingekreist, präzisiert<br />
und definiert, um sich dann auf die Suche<br />
zu machen. Das Team von Location<br />
Austria mache ihren Klient*innen dann<br />
Vorschläge, fertige bei Passung Bilder<br />
an und wenn diese entsprächen, folgen<br />
meist Terminbesichtigungen. Location<br />
Austria vermittle Locationmanager*innen<br />
und Produktionsfirmen. Sollten Probleme<br />
außerhalb der Routine auftauchen,<br />
beispielsweise Genehmigungen<br />
von Filmmotiven wie Transportmittel<br />
oder Schlösser, aber auch schwieriger<br />
erwerbbare, dann schalte sich die Institution<br />
ein. „Wir versuchen, Probleme zu<br />
lösen, die auftauchen könnten im Rahmen<br />
von Motivverträgen und Verhandlungen<br />
bezüglich diverser Filmmotive.<br />
Da gibt es oft hohe Erwartungen und<br />
Behörden oder Privatpersonen als Eigentümer*innen.<br />
Wir schalten uns dann<br />
in die Verhandlungen ein, um zu einem<br />
positiven Ergebnis zu kommen.“<br />
Förderungen<br />
Neben der Vermittlung von Locations<br />
gibt es noch die oben erwähnte Förderung,<br />
die über die Film Commission mit<br />
abgewickelt wird und über die das Austria<br />
Wirtschaftsservice (AWS) beantragt<br />
werden kann. Die FISA-Förderung ist<br />
ein Zuschuss, der nicht zurückgezahlt<br />
werden muss. FISA fördert die Herstel-<br />
Jakob Pochlatko / Copyright: Getty Images<br />
Arie Bohrer/ Copyright: ABA / Julius Silver<br />
FISA Förderungsbeträge:<br />
• Nationale Förderungen: max. 20 %<br />
• Österreich.-ausländische Koproduktionen: max. 25 %<br />
• Internationale Produktionen: max. 30 %<br />
© Copyright: adobe stock / Maksym Yemelyanov<br />
Steckt der österreichische Film in der Thema Krise?<br />
59
lungskosten und je nachdem, ob es sich<br />
um eine nationale, internationale oder<br />
eine Koproduktion handelt, wird mit<br />
einem anderen Zuschussprozentsatz<br />
gerechnet. Als Bemessungsgrundlage<br />
dienen maximal 80% der Herstellungskosten.<br />
Um Fördergelder von FISA zu<br />
bekommen, muss ein/e Förderungswerber*in<br />
Qualifikationskriterien erfüllen.<br />
Die Auswahl der Kriterien werde<br />
von einem Beirat festgelegt und nach<br />
internationalen Maßstäben ausgerichtet.<br />
Eines der Kriterien ist beispielsweise,<br />
dass ein vergleichbarer Referenzfilm<br />
in Österreich oder einem anderen Staat<br />
des Europäischen Wirtschaftsraums<br />
(EWR) hergestellt und kommerziell verwertet<br />
wurde. „Wenn zum Beispiel jemand<br />
im Fernsehfilmbereich aktiv war<br />
und nicht im Kinofilmbereich, aber nachweislich<br />
gute Arbeit geleistet hat, dann<br />
werden selten, aber doch, Ausnahmen<br />
gemacht“, erklärt der Film Commissioner.<br />
Bei einer Sache sind sich Bohrer und<br />
Pochlatko einig und zwar, dass es noch<br />
Förderungsbedarf gebe. „Österreich ist<br />
bei weitem nicht gut aufgestellt. Wir<br />
brauchen mehr für die FISA-Förderung,<br />
für internationale Produktion, und es<br />
wäre gut, wenn man die Bereiche Video<br />
on Demand (Streaming) und Fernsehen<br />
in den Fördergeldern inkludieren könnte.<br />
FISA ist nur zuständig für Kinofilm<br />
und das ist eigentlich zu wenig“, findet<br />
Bohrer. Filmproduzent Pochlatko sieht<br />
das ähnlich: „Wo es auf jeden Fall noch<br />
Bedarf gibt, ist die österreichische Fernsehförderung<br />
in Form des Fernsehfonds<br />
Austria. Es ist ein wirkungsvolles Instrument,<br />
um Österreich als Film- und Wirtschaftsstandort<br />
für Filmproduktionen<br />
attraktiv zu machen. Nun ist es so, dass<br />
momentan einfach mehr im TV-Bereich<br />
produziert wird, und auch mehr PayTV<br />
und Streaming-Anbieter auf den Markt<br />
drängen. Dahingehend gehört der Fernsehfonds<br />
aufgestockt und angepasst.“<br />
Das Budget sei seit Jahren das gleiche<br />
und würde die Entwicklungen und<br />
Fernsehen nicht berücksichtigen. Dies<br />
wird auch von Statistiken des Österreichischen<br />
Filminstituts, des Filmfonds<br />
Wien, der RTR und von FISA bestätigt:<br />
Sieht man sich die Gesamtdotierung an,<br />
so sind die Fördergelder bis zum Jahre<br />
2015 gestiegen und betrugen rund<br />
82 Mio. Euro, im Vergleich dazu lag der<br />
Betrag immer zwischen 72 und 75 Mio.<br />
Euro in den letzten Jahren. Auch bei Kinoproduktionen<br />
sei die Frage, ob sich<br />
Förderungen auf wenige Produktionen<br />
fokussieren sollten und diese mit mehr<br />
Geld ausstatten, oder es so belässt wie<br />
es sei. Grundsätzlich seien höhere Förderungen<br />
wichtig, da die Produktionen<br />
immer teurer werden: „Die Kollektivverträge<br />
steigen, die Teammitglieder*Innen<br />
werden besser bezahlt, Produktionen<br />
werden teurer und dementsprechend<br />
müssen die Förderungen angepasst<br />
werden.“ Man könne sich mit höheren<br />
Fördertöpfen trauen, innovative Projekte<br />
anzugehen. Pochlatko merkt an,<br />
dass mehr Geld nicht das einzige Mittel<br />
sei, damit ein Film erfolgreicher werde:<br />
eine klare Ausrichtung auf ein breites<br />
Publikum oder etwa ein künstlerischanspruchsvoller<br />
Film für Festivals und<br />
Bereit für mehr<br />
BEGEISTERTUNG?<br />
JETZT BEIM MARKTFÜHRER FÜR<br />
FACILITY MANAGEMENT BEWERBEN:<br />
JOBS.ISSWORLD.AT<br />
WENN SERVICE BEGEISTERT<br />
60<br />
Thema Steckt der österreichische Film in der Krise?
© Copyright: adobe stock / zef art<br />
internationale Anerkennung, - „im Idealfall<br />
eine Kombination aus beiden.“ Diese<br />
Grundsatzentscheidung müsse man<br />
sehr früh treffen. „Dann kann man mit<br />
den im Vergleich zu internationalen Studio-Produktionen<br />
budgetär beschränkten<br />
Produktionsmitteln in Österreich<br />
ein größeres Publikum erreichen.“ Der<br />
Produzent fügt hinzu, dass er das Fördersystem<br />
in Österreich als ein sehr gutes<br />
und im internationalen Vergleich gut<br />
ausgestattetes hält. Die relevanteste<br />
Förderung für die Filmherstellung daher<br />
sei laut Pochlatko die Herstellungsförderung:<br />
„In der Regel wird ein Drittel bis<br />
maximal die Hälfte aller Entwicklungen<br />
auch tatsächlich realisiert.“ Die Projektentwicklung<br />
erfolge zu großen Teilen mit<br />
eigenen Finanzierungsmitteln und somit<br />
mit eigenem Risiko. „Da wäre es schon<br />
gut, mit einem höheren Budget zu arbeiten<br />
– also auch höherer Förderung –,<br />
weil im Umkehrschluss dann die Möglichkeit<br />
bestünde, weniger Eigenmittel<br />
in die Produktion zu stecken. Dann hätte<br />
man weniger Druck, jeden Film, der in<br />
der Projektenwicklung steckt auch letztendlich<br />
zu produzieren.“ Deshalb wäre es<br />
wünschenswert, bereits in der Projektentwicklung<br />
die Möglichkeit zu haben,<br />
zumindest kleine Deckungsbeiträge zu<br />
erwirtschaften. Wenn man mehr Fördergeld<br />
für die Entwicklung hätte, so<br />
hätte man mehr Zeit und Ressourcen<br />
für eine ausführlichere Projektentwicklung.<br />
„Wenn man weniger Druck hat, die<br />
hohen Eigeninvestitionen zurückzuverdienen,<br />
hat man grundsätzlich die Möglichkeit,<br />
reifere Projekte zur Herstellungsförderung<br />
einzureichen“, erklärt<br />
Pochlatko. Denn: „Drehbücher brauchen<br />
oft lange.“ Als Beispiel nennt er eines, an<br />
dem sie seit knapp sechs Jahre arbeiteten<br />
und nun inhaltlich zufrieden seien,<br />
um es umzusetzen. Erfolgsrezepte gebe<br />
es keine. Krimis würden stark nachgefragt<br />
werden, aber man könne nicht<br />
immer nach einem „Schema F“ vorgehen:<br />
„Man muss sich da schon immer<br />
behutsam einem gewissen Innovationsprozess<br />
stellen, denn nur auf der Stelle<br />
treten wäre nicht zielführend.“ Bei einem<br />
Krimi müsse man dem Format treu<br />
bleiben, damit Zuseher*innen erkennt,<br />
worum es sich handelt. „Da muss man<br />
schon gewisse inhaltliche Rahmenbedingungen<br />
erfüllen, um dem Sendeplatz<br />
und dem Format gerecht zu werden.“<br />
Koproduktion und Streaming als Lösung<br />
am internationalen Markt<br />
Im Laufe des Gesprächs sind wir auch<br />
auf Koproduktionen eingegangen, beispielsweise<br />
den Film „Narziss und<br />
Goldmund“. „Der Film ist eine deutschösterreichische<br />
Koproduktion, die federführend<br />
aus Deutschland betrieben<br />
wurde und dann hat sich eine österreichische<br />
Produktionsfirma als Partner<br />
involviert.“ In Deutschland werde momentan<br />
viel produziert, sodass deutsche<br />
Anbieter nach Österreich blicken, um auf<br />
dem österreichischen Markt nach talentierten<br />
und etablierten Partnern zu suchen.<br />
Momentan seien österreichische<br />
Filmemacher*innen im Streaming, Pay<br />
TV-Diensten und im klassischen Fernsehen<br />
„hoch im Kurs“, erklärt Pochlatko.<br />
Um die österreichischen Beteiligten<br />
in einer Koproduktion hervorzuheben,<br />
hat der Filmproduzent folgenden Vorschlag:<br />
„Es würde möglicherweise schon<br />
helfen, wenn ein Film der zum größeren<br />
Teil aus Deutschland herausproduziert<br />
wird, man dann bei den Werbeankündigungen<br />
für den österreichischen Markt<br />
dazu sagt: vom österreichischen Filmemacher<br />
X.“ Sowohl im linearen Fernsehen<br />
als auch auf Streaming-Plattformen<br />
finde diese Nennung praktisch<br />
nicht statt. „Es gibt zum Beispiel jetzt die<br />
‚Netflix‘-Serie ‚Barbaren‘, bei der die Österreicherin<br />
Barbara Eder in den ersten<br />
vier Folgen Regie führte.“ Die Serie sei<br />
eine der erfolgreichsten nicht-englischsprachigen<br />
„Netflix“-Serien weltweit.<br />
„Doch es ist nicht Teil des Marketingkonzepts.<br />
In der Branche weiß man es,<br />
im breiten Publikum nicht.“ Die aktuell<br />
rege Produktionstätigkeit weltweit habe<br />
aber auch erschwerende Aspekte für die<br />
Produzent*innen in Österreich. „Es ist<br />
so, dass wir für unsere heimischen Produktionen<br />
österreichische Regisseur*innen<br />
oft nicht bekommen, weil sie schon<br />
bei deutschen Produktionen sind. Da<br />
muss man sehr frühzeitig, fast ein Jahr<br />
im Vorhinein reservieren.“ Global ausgerichtet<br />
sei das Filmgeschäft jedoch sehr<br />
spannend: „Es ist international gesehen<br />
interessant, dass jetzt durch die international<br />
agierenden Streaming-Angebote<br />
die Möglichkeit besteht, dass regionale<br />
Filme nun auch auf der ganzen Welt gesehen<br />
werden. Es gibt eine klare Aufgabenstellung<br />
von ‚Netflix‘, beispielsweise,<br />
dass österreichische Filme und Serien<br />
produziert werden, die auf der ganzen<br />
Welt verstanden werden können.“<br />
von Raphaela Hotarek<br />
Steckt der österreichische Film in der Thema Krise?<br />
61
Die Facetten der Angstlust<br />
Angstlust kann in etlichen Lebenssituationen erlebt werden. Im Zuge<br />
dieses Artikels hat <strong>SUMO</strong> es sich zur Aufgabe gemacht, sowohl psychologische<br />
als auch kommunikationswissenschaftliche Aspekte dieses<br />
Phänomens zu beleuchten. Dazu wurden Gespräche mit dem Medien-,<br />
Kinder-, und Jugendpsychologen Christian Gutschi und Kommunikationswissenschaftler<br />
Univ.-Prof. Jürgen Grimm geführt.<br />
© Copyright: adobe stock / terovesalainen<br />
Das ganze Kino hält den Atem an, die<br />
Spannung steigt ins Unermessliche.<br />
Plötzlich passiert etwas Unerwartetes<br />
und alle schreien auf. Danach tritt<br />
pure Erleichterung ein und die RezipientInnen<br />
fühlen sich befreit. Spannung,<br />
Angst, Erschrecken, Neugierde<br />
oder auch „Thrill“ – dies sind alles Begriffe,<br />
die die Herzen von Horrorfans<br />
oder AnhängerInnen ähnlicher Genres<br />
höherschlagen lassen. Ein zentrales<br />
Element, das zum Genuss solcher<br />
Genres führen kann, ist die Angstlust.<br />
Laut dem „Online Lexikon für Psychologie<br />
und Philosophie“ kann Angstlust<br />
nur dann verspürt werden, wenn sich<br />
Personen freiwillig einer äußeren oder<br />
einer scheinbaren Gefahr aussetzen<br />
und stets die Hoffnung haben, dass es<br />
am Ende einen guten Ausgang geben<br />
würde. Die Kommunikationswissenschafterin<br />
Stefania Voigt beschreibt in<br />
ihrer 2018 erschienenen Studie „Blut<br />
ist süßer als Honig: Angstlust im Horrorfilm<br />
im Kontext von Medientheorie<br />
und Medienpädagogik“ Angstlust als<br />
„komplexe, zugleich antizipierende und<br />
rückbezügliche Bewertungsleistung<br />
mit prophetischer Struktur“. RezipientInnen,<br />
die Angstlust erleben wollen<br />
haben laut Voigt eine gewisse Erwartung<br />
an die Angstlust-Erfahrung. Das<br />
bedeutet, dass sich die RezipientInnen<br />
bewusst seien, dass sie Angst erleben<br />
werden, dies aber bewusst wollen.<br />
Anfänge der Angstlust-Theorie<br />
Der Psychoanalytiker Michael Balint hat<br />
sich bereits Ende der 1950er Jahre mit<br />
dem Phänomen auseinandergesetzt.<br />
Er beschreibt in seinem Werk „Angstlust<br />
und Regression“, dass es zum einen<br />
das oknophile und zum anderen das<br />
philobatische Verhalten bezüglich des<br />
Erlebens von Angstlust gibt. Bei der<br />
oknophilen Verhaltensweise geht es<br />
darum, dass eine Person das Bedürfnis<br />
nach Schutz und Zuneigung hat und<br />
sich an etwas oder jemanden klammert,<br />
was dieses Bedürfnis befriedigen<br />
könne, dennoch ist die permanente<br />
Angst vorhanden, diesen Schutz oder<br />
diese Zuneigung zu verlieren. Bei der<br />
philobatischen Verhaltensweise geht<br />
Balint davon aus, dass Personen darauf<br />
abzielen, sich von einem gewissen<br />
Objekt oder einer Person abzugrenzen.<br />
Sowohl bei der oknophilen als auch bei<br />
der philobatischen Verhaltensweise<br />
sieht Ballint ein und dieselbe Ursache –<br />
die Loslösung des „primären Urobjekts“.<br />
So sollen beide Verhaltensmuster ein<br />
Versuch sein, ein Trauma, das durch die<br />
Loslösung der Mutter in der Kindheit<br />
ausgelöst wurde, zu überwinden.<br />
Psychologische Sichtweise<br />
Der Wiener Kinder-, Jugend-, und<br />
Medienpsychologe Christan Gutschi<br />
unterscheidet im Gespräch mit <strong>SUMO</strong><br />
zwischen zwei Persönlichkeitstypen.<br />
Zum einen gebe es jene Personen, die<br />
bewusst nach angstauslösenden Reizen<br />
suchen würden, zum anderen gebe<br />
es eine Gruppe, die versuchen würde,<br />
Angst zu vermeiden oder diese sogar<br />
leugnen. Es gebe jedoch noch etliche<br />
verschiedene Abstufungen zwischen<br />
diesen Extremata. Es hänge vom jeweiligen<br />
Charakter eines Menschen,<br />
dessen Temperament oder auch von<br />
Vorerfahrungen ab, zu welchem Persönlichkeitstyp<br />
eine Person zuzuordnen<br />
sei. Angst und Lust hätten auf den<br />
ersten Blick eine paradoxe Verbindung,<br />
bei näherer Betrachtung jedoch ließe<br />
sich eine Verbindung erkennen. Angstlust<br />
sei keine neue Erscheinung, denn<br />
bereits in griechischen Mythen, bei<br />
denen beispielsweise die Angst vor den<br />
Göttinnen und Göttern thematisiert<br />
wird, seien Merkmale der Angstlust<br />
vorhanden. Angstlust könne hilfreich<br />
sein und dazu dienen, besser mit tatsächlichen<br />
Ängsten umzugehen und<br />
so eine Angstbewältigungsstrategie<br />
entwickelt werden. Es könne der Fall<br />
sein, dass Personen mit traumatischen<br />
Erlebnissen sich unbewusst ähnlichen<br />
Situationen, wie der erlebten Trauma-<br />
Situation, aussetzen und so versuchen<br />
würden diese Traumata zu bewältigen.<br />
Gutschi betont auch die Grenzen<br />
der Angstlust. So etwa, wenn Angst in<br />
62<br />
Thema Die Facetten der Angstlust
Panik oder Kontrollverlust umschlage<br />
– diese Empfindungen würden jedoch<br />
nicht mehr unter den Begriff der Angstlust<br />
fallen. Christian Gutschi kann bei<br />
der Thematik auch einen Suchtcharakter<br />
feststellen. Dies sei gegeben, wenn<br />
die Dosis immer mehr erhöht werden<br />
müsse und die Angstlust Erlebnissen<br />
eine stetige Steigerung bieten müssten.<br />
Dies vermöge unter anderem sogar<br />
zu einer Selbstgefährdung führen,<br />
wenn kleine angstauslösende Situationen<br />
beispielsweise keine Wirkung<br />
mehr hätten. Es sei außerdem wichtig<br />
zu erwähnen, dass nicht nur Erwachsene,<br />
sondern auch schon Kinder und Jugendliche<br />
Angstlust empfinden können.<br />
So wollen Kinder die Angst ebenfalls<br />
bewusst erleben. Dies sei beispielsweise<br />
der Fall, wenn ein vierjähriges Kind<br />
versuche, über einen Baumstamm zu<br />
klettern, es also lustvoll seine Selbstwirksamkeit<br />
entdecke. Bei Jugendlichen<br />
sei beispielsweise der Drang Mutproben<br />
zu absolvieren groß. Diese Mutproben<br />
ließen sich auch als eine Form<br />
der Angstlust betrachten und können<br />
jedoch bisweilen hilfreich sein, da sie<br />
zur Persönlichkeitsentwicklung beitrügen<br />
und die Jugendlichen so auch ihre<br />
Grenzen erfahren würden.<br />
Kommunikationswissenschaftliche<br />
Sicht<br />
Im Interview mit <strong>SUMO</strong> erläutert Univ.-<br />
Prof. Jürgen Grimm (Institut für Publizistik-<br />
und Kommunikationswissenschaft,<br />
Univ. Wien), welche Besonderheiten<br />
er beim Phänomen der Angstlust aus<br />
kommunikationswissenschaftlicher<br />
Sicht erkennen kann. Betrachte man<br />
beispielsweise RezipientInnen von Horrorfilmen,<br />
erkenne man, dass es weniger<br />
um ein Geborgenheitserlebnis, als<br />
vielmehr um eine Art Mutprobe gehe.<br />
Hierbei gelte die „Angstkontroll-These“.<br />
Diese sei der Angstlust nahe, dennoch<br />
müssten Unterscheidungen getroffen<br />
werden. Es ginge nicht darum, sich in<br />
die Angst fallen zu lassen, wie Balint<br />
dies bereits 1959 skizziert hat, sondern<br />
um die Kontrolle der Angst. Es sei also<br />
nicht die Lust an der Angst, sondern<br />
die Lust an dem Erlebnis, dass man<br />
die Angst kontrollieren kann. Auch aus<br />
kommunikationswissenschaftlicher<br />
Sicht sei laut Grimm das Auftreten von<br />
Suchterscheinungen bei solchen Erlebnissen<br />
möglich. Einzelne könnten in der<br />
Konfrontation mit dem Schrecklichen,<br />
die das Kontrollmotiv bedient, einen<br />
mehr oder weniger starken Drang verspüren,<br />
dieses Erlebnis immer häufiger<br />
durchlaufen zu müssen. Dies sei insbesondere<br />
dann der Fall, wenn die Fähigkeit,<br />
Angst zu kontrollieren, durch Horrorfilme<br />
nicht wirklich steigt. Genau an<br />
diesem Punkt sei der Drang nach einer<br />
Die Facetten der Angstlust Thema<br />
63
höheren Dosis stark. Unter gewissen<br />
Bedingungen kann Horrorfilmkonsum<br />
auch zu einer Gefahr werden, erklärt<br />
Jürgen Grimm. Einige wenige – und<br />
das seien Ausnahmen – werden durch<br />
Horrorfilme tatsächlich zu Gewalttaten<br />
inspiriert. Solche Gewalttaten würden<br />
beispielsweise ausgeübt, wenn es zu<br />
einer Frustration im Bestreben, mit der<br />
eigenen Angst umgehen zu können,<br />
kommt. Es sind also in der Regel keine<br />
Nachahmungstaten, die von Horrorfilmen<br />
inspiriert werden. Vielmehr sind<br />
Fälle von Gewalttaten viel eher darauf<br />
zurückzuführen, dass die TäterInnen<br />
ein Angstproblem haben und dieses<br />
versuchen, mit einer Tat zu lösen. In<br />
erster Linie gehe es laut Grimm darum,<br />
ob RezipientInnen in der Lage sind, mit<br />
der Angst umgehen zu können. Die große<br />
Mehrheit der HorrorfilmseherInnen<br />
leiste das mit großer Souveränität. Er<br />
unterstreicht, dass, wie oben bereits<br />
erwähnt, das Motiv nicht Lust an der<br />
Angst, sondern der Genuss der Angstkontrolle<br />
sei. Vor allem Kinder und<br />
Jugendliche zwischen 12 und 16 rezipierten<br />
besonders häufig Horrorfilme.<br />
Dies könne damit erklärt werden, dass<br />
in diesem Alter Angst und Unsicherheit<br />
größer werden. Daraus ergebe sich ein<br />
Bedarf, sich Angstbewältigungsstrategien<br />
zurechtzulegen. Die Jugendlichen<br />
streben nicht danach Angst zu haben,<br />
sondern diese kontrollieren zu können.<br />
Daher sieht Grimm den Begriff<br />
der Angstlust als problematisch an und<br />
spricht vielmehr von Angstmanagement<br />
und Angstkontrolle.<br />
Ausblick<br />
Die Kommunikationswissenschaft und<br />
die Psychologie haben Erklärungen<br />
geliefert, weshalb es zum Genuss von<br />
Horrorfilmen kommen kann. Ob man<br />
das nun Angstlust nennt oder einen anderen<br />
Begriff verwendet, die dahinterstehenden<br />
Phänomene gibt es schon<br />
seit vielen Jahrhunderten. Mythen und<br />
Sagen über Göttinnen und Götter sind<br />
hierfür ein Beispiel. Doch auch in Zukunft<br />
wird die Faszination von Verbrechen<br />
und anderen angstbetonten Darstellungen<br />
fortbestehen. Das lasse sich<br />
– so erläutert Jürgen Grimm – schon<br />
daran ablesen, dass Crime-Formate im<br />
Fernsehen die größte Unterhaltungssparte<br />
darstellen und die Nachfrage<br />
auch im Netflix-Zeitalter immer weiter<br />
wächst.<br />
von Viktoria Strobl<br />
© Copyright: adobe stock / Mongkolchon<br />
64<br />
Die Thema Facetten der Angstlust
Geh deinen<br />
eigenen Weg.<br />
#glaubandich<br />
+<br />
Herr<br />
Maximilian<br />
Mustermann<br />
geboren am<br />
03.09.2005<br />
Gültig:<br />
Jugend<br />
01.01.2021 – 31.12.2021<br />
Hol dir gratis die ÖBB VORTEILSCARD Jugend zu<br />
deinem neuen spark7 Konto oder Studentenkonto<br />
und entdecke ganz Österreich vergünstigt.<br />
Angebot gültig für alle < 26 Jahre bei Eröffnung eines spark7 Kontos oder Studentenkontos bis einschließlich 31.12.2021 in jeder<br />
Filiale der Sparkasse. Es wird ein einmaliger Gutschein für eine ÖBB VORTEILSCARD Jugend (gültig für 1 Jahr) per Post zugesendet.<br />
Dieser ist nicht in bar ablösbar bzw. umtauschbar. Der Gutschein kann nur an den Ticketschaltern der ÖBB-Personenverkehr AG<br />
eingelöst werden. Alle Infos auf www.oebb.at. Nicht mit anderen Kontoeröffnungsaktionen der Sparkasse kombinierbar.<br />
Faszination Live-Sport Thema<br />
spknoe.at<br />
65
Man nehme einen Goldesel…<br />
oder etwa nicht? Europäische<br />
Filmfinanzierung<br />
„Das wäre der perfekte Inhalt für den nächsten europäischen Blockbuster.“<br />
Das dachten sich möglicherweise bereits viele. Doch wie finanziert<br />
man so ein Vorhaben? <strong>SUMO</strong> diskutierte mit Esther Krausz, österreichische<br />
Ansprechpartnerin für „Creative Europe – MEDIA“, und Paul Clemens<br />
Murschetz, Privatdozent und Medienökonom, über die unterschiedlichen<br />
Varianten.<br />
Wer kennt es nicht – die perfekte Filmidee<br />
spielt sich buchstäblich wie in<br />
einem Film vor dem inneren Auge ab,<br />
zumindest als Traum. Wenn man dann<br />
bedenkt, dass laut einer Studie der<br />
Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle<br />
(2018) für die Herstellung<br />
eines auf europäischer Ebene gezeigten<br />
Kinospielfilms im Jahr 2016 im<br />
Durchschnitt mehr als 3 Millionen Euro<br />
ausgegeben wurden, dann stellen sich<br />
die Fragen: Was tun, um diesen Traum<br />
zu verwirklichen und über die Landesgrenzen<br />
bekannt und erfolgreich zu<br />
machen? Mit den zahlreichen Förderformen<br />
– von direkter und indirekter<br />
Förderung über Product Placement und<br />
Crowdfunding – werden eine Bandbreite<br />
an Wegen geboten, um ein Vorhaben<br />
zu realisieren. Doch wie wichtig sind die<br />
einzelnen?<br />
Bei dem Instrumentarium der Förderung<br />
würden zwei Attribute im Fokus<br />
stehen: Effizienz und Effektivität, so<br />
Murschetz. „Institutionen der öffentlichen<br />
Filmförderung“ würden diese<br />
Prinzipien in die Praxis umsetzen, um<br />
eine Finanzierungsgrundlage für ProduzentInnen<br />
zu schaffen sowie Filmökosysteme<br />
insgesamt zu stärken.<br />
Die direkte, öffentliche Filmförderung<br />
Die „klassische“ Variante ist die direkte,<br />
öffentliche Filmförderung. Auf europäischer<br />
Ebene ist „Creative Europe“<br />
die Ansprechorganisation in solchen<br />
Belangen. Das aktuelle Programm,<br />
welches mit 2020 endet, unterteile<br />
sich in die Unterbereiche „Culture“ und<br />
„MEDIA“, so Esther Krausz. Mit ihrem<br />
umfangreichen Kontingent an 13 Förderschienen<br />
– etwa „TV-Koproduktion“,<br />
„Projektentwicklung“ und „Verleih“ –<br />
würde „Creative Europe – MEDIA“ das<br />
Ziel verfolgen, den europäischen Film<br />
vor allem in Bezug auf die amerikanische<br />
Konkurrenz zu kräftigen, erläutert<br />
Krausz. Darüber hinaus würde „Creative<br />
Europe – MEDIA“ mit Trainingsangeboten<br />
unter anderem die Qualifikationen<br />
der einzelnen AkteurInnen fördern. Bei<br />
der Vergabe der Förderungen werde vor<br />
allem auf die sogenannte „Europäische<br />
Relevanz“ geachtet werden. Krausz erklärt,<br />
dass Gründe aufgezeigt werden<br />
müssen, die unterstreichen, wieso beispielsweise<br />
ein Film „für ein europäisches<br />
Publikum interessant ist“. Dieser<br />
Aspekt müsse inhaltlich, aber auch auf<br />
Arbeitslevel belegt werden, denn es<br />
„muss immer eine Zusammenarbeit<br />
mit Menschen, Firmen oder Organisationen<br />
in anderen europäischen Ländern“<br />
geben. Darüber hinaus solle die Zielsetzung<br />
der Initiative erfüllt werden. Als<br />
Vorteile einer solchen europaweiten<br />
Förderinstitution sieht Krausz mehrere<br />
Aspekte, die ineinandergreifen. Unter<br />
Esther Krausz / Copyright: Privat<br />
Paul Clemens Murschetz / Copyright: Privat<br />
66<br />
Man Thema nehme einen Goldesel... oder etwa nicht? Europäische Filmfinanzierung
© Copyright: adobe stock / photoniko<br />
anderem könne durch ein gemeinsames<br />
Arbeiten der Staaten ein höheres<br />
Kapital generiert werden. Im Zuge dessen<br />
könne der Film wiederum auch an<br />
ein breiteres Publikum vertrieben werden.<br />
Murschetz sieht hierbei die „Europäische<br />
Integration“ und „Europa als<br />
Wertekontinent“ im Vordergrund, um<br />
„sozusagen im Sinne der Integration<br />
die gemeinsamen Werte Europas zu<br />
stärken“. Des Weiteren würde hier ein<br />
höherer Geldbetrag zur Verfügung stehen<br />
und dies sei vorwiegend für eher<br />
größere Projekte von Vorteil. Allerdings<br />
würden aber ebenso „kleinere, künstlerisch<br />
qualitativ wertvolle Produktionen“<br />
realisiert werden.<br />
Ein Programm mit dieser Reichweite<br />
müsse auch zugänglich gegenüber kritischen<br />
Stimmen sein, so Krausz. Sie erläutert,<br />
dass unter anderem der Aspekt<br />
der „Fairness“ genannt werde, sprich<br />
ob alle Staaten dieselben Möglichkeiten<br />
auf finanzielle Unterstützung haben.<br />
Hier habe „Creative Europe – ME-<br />
DIA“ mit einem „System der positiven<br />
Diskriminierung“ entgegengesteuert,<br />
um diese Fairness zu erreichen. „Einen<br />
weiteren Verbesserungsbedarf gibt es<br />
bei der Förderung für Nachwuchs“, da<br />
dieser es schwieriger hätte, Fördermittel<br />
zu erhalten. Da das Programm über<br />
eine Dauer von sieben Jahren verfügt,<br />
stellt sich auch die Frage, wie flexibel es<br />
agieren kann. Krausz erzählt, dass die<br />
Eckpunkte des Programmes definiert<br />
seien, Erfahrungen aber gezeigt hätten,<br />
dass es möglich sein müsse, spontaner<br />
zu reagieren.<br />
Murschetz konstatiert, dass im europäischen<br />
Kontext die positiven klar die<br />
negativen Aspekte dominieren würden.<br />
Darüber hinaus jedoch kristallisierten<br />
sich in seiner Forschungsarbeit „State<br />
Aid for Film and Audiovisual Services.<br />
A Synoptic Review of Key Principles<br />
and Governance Models in Europe and<br />
Abroad“, den Murschetz gemeinsam<br />
mit dem Direktor des Österreichischen<br />
Filminstituts Roland Teichmann (2019,<br />
unter Mithilfe von Sameera Javed) verfasste,<br />
die Nachteile eines direkten Förderungsmodells<br />
heraus. Hierbei liegen<br />
die negativen Argumente unter anderem<br />
bei der bürokratischen Verwaltung,<br />
der zu geringen Innovationsförderung,<br />
zu niedrigen Filmförderbudgets sowie<br />
in der Tatsache begründet, dass direkte<br />
Modelle zu Anpassungen im Sinne des<br />
sich verändernden Marktes nur begrenzte<br />
Wirkung zeigen.<br />
Ein Ausblick auf die nächste „Creative<br />
Europe“-Laufzeit bietet laut „creativeeurope.at“<br />
neue Themenkernpunkte,<br />
wie etwa „Green Filming“, „Innovatives<br />
Storytelling“ oder die Förderung des<br />
Streaming-Bereiches, aber auch bestehende<br />
sollen weitergeführt werden.<br />
Man nehme einen Goldesel... oder etwa nicht? Europäische Filmfinanzierung Thema<br />
67
(Anm.: Ausführlichere Informationen<br />
waren zu Redaktionsschluss noch nicht<br />
verfügbar.)<br />
Die Alternativen<br />
Darüber hinaus gibt es noch andere<br />
Möglichkeiten ein Filmvorhaben in die<br />
Tat umzusetzen. Neben der direkten,<br />
die indirekte Förderung. Neben öffentlicher,<br />
die private. Doch was steckt dahinter?<br />
Bei der indirekten Förderung<br />
handelt es sich um Steuererleichterungen<br />
bei Filmproduktionen sowie<br />
Vergünstigungen im Rahmen dessen<br />
Einzelpersonen oder Unternehmen<br />
in förderfähige Filmproduktionen investieren<br />
und diese Investitionen mit<br />
einer bestehenden Steuerschuld verrechnen<br />
können, erklärt Paul Clemens<br />
Murschetz. So würden Kosten eingespart<br />
werden können. Er führt weiter<br />
aus, dass dieses System ebenso eingesetzt<br />
werden würde, um Investoren<br />
in ein Förderland oder ein Gebiet zu locken.<br />
Beispielsweise kommen indische<br />
Filmproduktionsunternehmen für einen<br />
Dreh in die Schweiz, um das Bergpanorama<br />
einzufangen. Dort würden die<br />
internationalen Zusammenarbeiten<br />
zwischen den indischen und schweizerischen<br />
Unternehmen von der Schweiz<br />
unterstützt werden, so Murschetz. Als<br />
negativen Aspekt sei es allerdings im<br />
Zuge dessen zu einem regelrechten<br />
„Filmproduktionstourismus“ gekommen,<br />
wie beispielsweise in den USA<br />
zu beobachten gewesen sei, erläutert<br />
Murschetz. Dies hätte auch dazu geführt,<br />
dass sich Unternehmen nur für<br />
die Dauer der geförderten Produktion<br />
eben in den Regionen angesiedelt hät-<br />
ten, die diese Erleichterungen vorsehen<br />
und keinen nachhaltigen Aufbau einer<br />
Filminfrastruktur in den Förderregionen<br />
nach sich gezogen hätte.<br />
Bei einer von vielen privaten Investitionsformen<br />
handelt es sich um Product<br />
Placement. Laut dem „Gabler Wirtschaftslexikon“<br />
bezeichnet der Ausdruck<br />
im Generellen ein Instrument der<br />
Werbung, bei dem Waren von Marken<br />
bewusst als Ausstattungsgegenstände<br />
„in die Handlung eines Spielfilms“<br />
integriert werden. In der Medienwirtschaft<br />
wird dies gegen Bezahlung eingesetzt,<br />
um den Verkauf zu steigern, so<br />
das „Gabler Wirtschaftslexikon“. Daraus<br />
lässt sich schlussfolgern, dass neben<br />
den werbenden Unternehmen eben<br />
auch die Filmproduktionsfirmen davon<br />
profitieren. Laut Krausz könne dies ein<br />
bedeutsamer Aspekt der Finanzierung<br />
sein, der in Europa allerdings noch nicht<br />
so präsent sei. Private Investitionen im<br />
Allgemeinen werde in Europa nicht so<br />
sehr genutzt, allerdings sei unter anderem<br />
Frankreich hier ein Vorreiter.<br />
Eine weitere Alternative ist das „Film/<br />
Fernseh-Abkommen“ des ORF. Laut<br />
„filminstitut.at“ wird durch diese Initiative<br />
die Herstellung von österreichischen<br />
Kinofilmen gefördert. Hierbei<br />
handelt es sich um eine „Mit-Finanzierung“,<br />
welche an einige Bedingungen,<br />
beispielsweise der Bestätigung zur<br />
Förderung durch das Österreichische<br />
Filminstitut geknüpft ist. Des Weiteren<br />
muss unter anderem das ORF-Gesetz<br />
eingehalten werden. (vgl. <strong>SUMO</strong> 36:<br />
Steckt der österreichische Film in der<br />
Krise?)<br />
Aber auch Crowdfunding ist eine Mög-<br />
© Copyright: adobe stock / Tomasz Zajda<br />
68<br />
Man Thema nehme einen Goldesel... oder etwa nicht? Europäische Filmfinanzierung
lichkeit, einen Film zu finanzieren.<br />
Krausz sagt diesbezüglich, dass dies<br />
beispielsweise abhängig von der Art,<br />
dem Umfang sowie der Zielsetzung des<br />
Filmes sei. Des Weiteren sagt sie, dass<br />
es vorwiegend als „Marketinginstrument<br />
gut funktioniert“ hätte. Laut Murschetz<br />
eigne sich dies vorwiegend „für<br />
sehr kleine und kleinere Produktionen“,<br />
dabei erfülle privates Crowdfunding<br />
ebenso eine Filmförderungsfunktion.<br />
Es sei zumindest eine gute Strategie,<br />
sie ergänzend zur staatlichen Filmförderung<br />
anzuwenden.<br />
Die Bedeutung der einzelnen Fördermaßnahmen<br />
Die bereits angesprochene Studie der<br />
Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle<br />
(2018) zeigte auf, dass mit<br />
29% die „direkte öffentliche“ Filmförderung<br />
in 2016 die bedeutendste Finanzierungsmöglichkeit<br />
war, dicht gefolgt<br />
von „Investitionen von Rundfunkveranstaltern“<br />
(25 %). Darüber hinaus zählen<br />
zu den Top 5: investiertes Kapital durch<br />
ProduzentInnen, „steuerliche Anreize“<br />
(sprich: indirekte Förderung) sowie sogenannte<br />
„Vorabverkäufe“.<br />
Murschetz konstatiert diesbezüglich,<br />
dass die direkten Förderinstitutionen<br />
auf Grund des geschichtlichen Hintergrunds<br />
sehr bedeutend seien, „vor allem<br />
in den korporatistisch geprägten<br />
Medienlandschaften Europas“. Als Beispiel<br />
führt er Frankreich, Schweden und<br />
Österreich an. Aber auch den indirekten<br />
Förderungen sei ein hoher Stellenwert<br />
zuzuschreiben und habe in „letzter<br />
Zeit“ in der Frage der Relevanz sowie<br />
„mittlerweile“ im Punkt des Umfanges<br />
die direkten Fördermittel überholt.<br />
Insbesondere für größere, länderübergreifende<br />
Projekte sollte es verstärkt<br />
„internationale Kooperationen in Richtung<br />
Anreize und Förderinstrumente<br />
indirekter Natur“ geben, wie sie „Creative<br />
Europe – MEDIA“ betreibt. Des Weiteren<br />
sei es bei der Entscheidung, ob<br />
direkt oder indirekt, wichtig die beiden<br />
Möglichkeiten auf unterschiedlichen<br />
Ebenen zu vergleichen, sowie sich die<br />
Frage zu stellen: „Was sind die Stärken<br />
und Schwächen dieser jeweiligen Instrumente<br />
und Maßnahmen in Bezug auf<br />
den Filmerfolg insgesamt“, erläutert der<br />
Medienökonom.<br />
Laut Esther Krausz gebe es in Europa<br />
vor allem in den privaten Finanzierungsmodellen<br />
„Potential“, welches<br />
noch stärker genutzt werden sollte.<br />
Ebenso sei laut Krausz vor allem durch<br />
Krisensituationen unklar, wie sich die<br />
Finanzierungsmodelle entwickeln werden.<br />
Auch Murschetz betont, dass die<br />
aktuelle Krise möglicherweise „einen<br />
Zündeffekt hat sozusagen, die Filmfördersysteme<br />
insgesamt umzudenken.“<br />
Die Entscheidung der Wahl der Förderinstrumente<br />
werde nicht mehr genug<br />
sein, sondern neue Überlegungen, beispielsweise<br />
„wie messe ich überhaupt<br />
den Erfolg von Filmförderung an sich“,<br />
würden notwendig werden. Der Erfolg<br />
an der Kinokasse allein wird längst<br />
nicht mehr genügen.<br />
von Simone Poik<br />
NeuerJob?<br />
medienjobs.at<br />
die Jobbörse für Medienschaffende<br />
Man nehme einen Goldesel... oder etwa nicht? Europäische Filmfinanzierung Thema<br />
69
Kaufen oder nicht kaufen?<br />
- Testmagazine verraten<br />
es uns<br />
Sich zwischen 300 unterschiedlichen Optionen für das beste Produkt zu<br />
entscheiden, stellt für KäuferInnen oft eine Herausforderung dar. Testungen<br />
durch spezifische Magazine können hier Licht ins Dunkel bringen.<br />
Ob und warum diesen vertraut werden kann und welche Auswirkung<br />
ein Testergebnis auf das Kaufverhalten hat, ging <strong>SUMO</strong> im Interview mit<br />
Christian Kornherr, Bereichsleiter für Untersuchungen beim Testmagazin<br />
„KONSUMENT“, sowie dem deutschen Neuropsychologen Hans-Georg<br />
Häusel auf den Grund.<br />
© Copyright: adobe stock / iracosma<br />
Bei Kaufentscheidungen verlassen wir<br />
uns gerne auf eigene Erfahrungen oder<br />
Empfehlungen. Sind keine vorhanden,<br />
wird der Bewertung eines Testmagazins<br />
umso mehr Beachtung geschenkt. Mit<br />
Fakten, Zahlen und einer Gesamtnote<br />
im Schulnotensystem werden Produkte<br />
in Kategorien wie Sicherheit, Inhaltsstoffe<br />
oder Preis-Leistungs-Verhältnis<br />
getestet und verglichen. VerbraucherInnen<br />
erhalten dadurch einen neutralen<br />
Überblick, welche Dienstleistungen<br />
und Produkte angeboten werden. Dem<br />
Neuromarketing-Experten Häusel zufolge<br />
spielen Testmagazine auch aus<br />
psychologischer Sicht eine wichtige<br />
Rolle, „weil wir bei Kaufentscheidungen<br />
immer in Unsicherheit leben und Unsicherheit<br />
mag unser Gehirn nicht so<br />
gerne. Deswegen sind Testurteile von<br />
so großer Bedeutung für die Leute, weil<br />
sie damit Komplexität und Unsicherheit<br />
reduzieren können.“ Zusätzlich komme<br />
es beim Kauf eines „Testsiegers“ zu<br />
einer Belohnung: Das Gefühl das Beste<br />
gekauft zu haben wirke sich positiv auf<br />
unser Dominanzsystem aus, unser System<br />
für Macht und Selbstachtung.<br />
Was hinter Testmagazinen steckt<br />
Hinter „KONSUMENT“ steht der gemeinnützige<br />
Verein für Konsumenteninformation<br />
(VKI). Seit 60 Jahre veröffentlicht<br />
„KONSUMENT“ an die 1.000<br />
Produkte jährlich. Im Interview erklärt<br />
Kornherr, dass der VKI keineswegs allein<br />
alle veröffentlichten Tests durchführe.<br />
Der Verein gehört zusammen<br />
mit ungefähr 40 weiteren Organisationen<br />
zu einer internationalen Testgemeinschaft<br />
namens International<br />
Consumer Research and Testing (ICRT).<br />
„Es hätte wenig Sinn, wenn wir Smartphones,<br />
Notebooks und alles was globale<br />
Produkte und Produktion betrifft,<br />
als Österreich einzeln testen“, meint<br />
Kornherr. Es sei weder finanziell erschwinglich<br />
noch zielführend, dass 40<br />
Organisationen dasselbe Produkt unter<br />
die Lupe nehmen. Die Zielgruppe von<br />
„KONSUMENT“ sind prinzipiell alle ÖstereicherInnen.<br />
Nach den Bedürfnissen<br />
dieser LeserInnen richtet sich auch die<br />
Auswahl der untersuchten Produkte.<br />
Unterschieden wird nach mehreren<br />
Kategorien wie Gebrauchsgüter (etwa<br />
Waschmaschinen), Mediengeräte wie<br />
Smartphones, Fernseher und Co., sowie<br />
auch Lebensmittel, wo zum einen<br />
Grundnahrungsmittel wie Milch und<br />
Brot und zum anderen aktuelle Trends<br />
wie vegane Burger untersucht werden.<br />
Außerdem getestet wird in den Bereichen<br />
Gesundheit, Beratung und Finanzdienstleistungen.<br />
Der Vorfall Ritter Sport<br />
Die wohlbekannte „Testsieger“-Auszeichnung<br />
der Stiftung Warentest<br />
führt nicht selten zu zweistelligen Zuwachsraten.<br />
Kommt es aber zu einem<br />
schlechten Qualitätsurteil, kann dies<br />
von Umsatzrückgängen über Imageschädigung<br />
bis hin zu einer Krise der<br />
Marke führen. Zu so einem Vorfall kam<br />
es 2014 zwischen der deutschen Stiftung<br />
Warentest und dem Schokoladen-Hersteller<br />
Ritter Sport. Die Sorte<br />
Vollmilch-Nuss wurde mit „mangelhaft“<br />
bewertet, nachdem der chemisch<br />
erzeugte Aromastoff Piperonal darin<br />
gefunden wurde, welcher nicht auf der<br />
Verpackung angeschrieben war. Den<br />
folgenden Rechtsstreit verlor die Stiftung<br />
Warentest gegen Ritter Sport, laut<br />
„Horizont“ (25.9.2014). Daraus lässt<br />
sich schließen, dass auch seriöse Testmagazine<br />
nicht unfehlbar sind.<br />
Um unglückliche Vorfälle dieser Art zu<br />
vermeiden, kommt beim VKI ein Qualitätsmanagementsystem<br />
zum Einsatz.<br />
Kornherr, der Bereichsleiter für Untersuchungen,<br />
erklärt, dass jedes Produkt<br />
eine Nummer erhalte, die vom Einkauf<br />
bis zur Testveröffentlichung dieselbe<br />
70<br />
Thema Kaufen Wenn private oder nicht Daten kaufen? in den - Medien Testmagazine landen verraten es uns
leibe. Damit könne jede Aktion – prüfen,<br />
lagern oder auch nur fotografieren<br />
– dokumentiert werden. Somit sei gut<br />
nachvollziehbar, wie es zu dem Urteil<br />
komme. Doch woran macht man ein<br />
„sehr gutes“ Produkt fest, und welches<br />
ist mit Sicherheit „nicht zufriedenstellend“?<br />
Bei den Testergebnissen handelt<br />
es sich immer um eine vergleichende<br />
Bewertung. Nachdem mehrere ähnliche<br />
Produkte einem Test unterzogen<br />
wurden, erhält man eine Range an<br />
Werten. Für die besseren Werte erfolgt<br />
häufig eine mathematische Aufteilung<br />
auf die Noten. Für eine außerordentlich<br />
schlechte Bewertung wie ein „Nicht zufriedenstellend“<br />
muss es gravierende<br />
Fehler bei einem Testparameter geben.<br />
Entweder wird ein gesetzlicher Grenzwert<br />
missachtet, wie zum Beispiel der<br />
Schadstoffanteil bei Lebensmitteln,<br />
oder das Produkt ist gefährlich, der<br />
Klassiker hier: ein Kindersitz, bei dem<br />
der Gurt reißt. Kornherr betont bezüglich<br />
negativer Testurteile: „Da gehen wir<br />
sehr sensibel damit um und sagen, das<br />
ist wirklich nur wenn es Gesetze verletzt<br />
oder gefährlich ist“.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen,<br />
dass Testmagazine eine wichtige Rolle<br />
einnehmen, da sie die Wahrheit ans<br />
Licht bringen und helfen können, Vertuschungen<br />
oder gar Skandale aufzudecken.<br />
von Manuela Schiller<br />
Hans-Georg Häusel / Copyright: Hans-Georg Häusel<br />
Christian Kornherr / Copyright: Martina Draper<br />
Kaufen oder nicht kaufen? - Testmagazine verraten Thema es uns<br />
71
GIS Pfui, Pay TV/Streaming<br />
Hui?!<br />
Pay TV und Streaming erfreuen sich immer größer werdender Beliebtheit,<br />
aber auch die Haushalte der GIS-Gebührenzahler ließen einen Anstieg vermerken<br />
– wenn gleich die Gebühr stets zur Debatte steht. <strong>SUMO</strong> sprach<br />
darüber mit Konrad Mitschka, Verantwortlicher des Public Value-Berichts<br />
des ORF, sowie Thomas Höffinger, Geschäftsführer der NOGIS Handels<br />
GmbH, und führte eine kleine Umfrage zum Medienbudget von RezipientInnen<br />
durch.<br />
Von 2001 bis Ende 2019 stieg die Anzahl<br />
der GebührenzahlerInnen der GIS<br />
von 2,66 Millionen auf 3,66 Millionen,<br />
296.000 Haushalte sind (Stand: Dezember<br />
2019) von den Gebühren befreit.<br />
Etwa zwei Drittel der Gebühren fließen<br />
als Programmentgelt an den ORF.<br />
Das Programmentgelt entspricht einer<br />
Höhe von 17,21 Euro im Monat plus<br />
10% UST, welche in allen neun Bundesländern<br />
gleich ist. Sieben von den neun<br />
Bundesländern heben allerdings noch<br />
eine zusätzliche Landesabgabe ein, die<br />
überall einen unterschiedlichen Betrag<br />
ausweist. Die GebührenzahlerInnen erhalten<br />
dafür ein vielfältiges Angebot:<br />
die vier Fernsehkanäle ORF 1, ORF 2,<br />
ORF III, ORF SPORT+, drei österreichweite<br />
Radiosender: Ö3, Ö1, FM4; neun<br />
Landesstudios mit eigenen Beiträgen<br />
für TV, neun Regional-Radiosender aus<br />
den Bundesländern; Beteiligung an den<br />
Fernsehkanälen „3sat“ und ARTE; ORF-<br />
TELETEXT , ORF.at, ORF-TVthek.<br />
Doch die GIS hebt nicht nur das Programmentgelt<br />
für den ORF ein, sondern<br />
auch die Radio- und Fernsehgebühren<br />
sowie den Kunstförderungsbeitrag,<br />
die direkt an den Bund fließen. Laut<br />
Mitschka zahle man mit seinen Gebühren<br />
für die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen<br />
Auftrags. Dieser bringe<br />
einer Gesellschaft viel, so belegen das<br />
mehrere Studien, unter anderem stärke<br />
das die Demokratie. Er ist ebenfalls davon<br />
überzeugt, dass eine Gemeinschaft<br />
gut daran täte, öffentlich-rechtliche<br />
Medien zu stärken und zu schützen,<br />
weil sie zum Beispiel auch in Krisenzeiten<br />
stark nachgefragt seien und man<br />
nur nachhaltig vielfältigen Aufgaben<br />
und Programmaufträgen gerecht werden<br />
könne.<br />
Wer muss zahlen?<br />
Jeder Haushalt, in dem sich ein Rundfunkgerät<br />
befindet muss laut dem<br />
ORF-Gesetz eine Gebühr entrichten.<br />
Zu den Rundfunkgeräten zählen Fernsehgeräte,<br />
Kabel-TV und Satelliten-TV,<br />
außerdem Computer und Tablets mit<br />
DVB-T-Stick, TV-Karte oder Radio-Karte.<br />
Radiogeräte und sonstige Geräte<br />
mit UKW-Empfang sind ebenfalls gebührenpflichtig.<br />
Die Verbreitung über<br />
das Internet ist seit Juli 2015 laut Beschluss<br />
des Verwaltungsgerichtshofs<br />
nicht als Rundfunk zu deklarieren. Laut<br />
Copyright: adobe stock / Proxima Studio<br />
72<br />
Thema GIS PFUI, Streaming/Pay TV hui!
Mitschka brauchen wir ein Medium<br />
in unserer Gesellschaft, das so aufgestellt<br />
ist, dass es alle erreiche. Für<br />
ihn ist ebenso der Gedanke wichtig,<br />
dass alle MitgliederInnen dieser Gesellschaft<br />
dieses Medium finanzieren.<br />
Seiner Meinung nach müssten wir verhindern,<br />
dass manche Inhalte sozial<br />
exklusiv sind oder in Zukunft werden.<br />
„Ich möchte lieber in einem Land leben,<br />
in dem auch arme Leute Spitzensport<br />
rezipieren können und nicht davon abhängig<br />
sind, ob sie sich Pay-TV oder ein<br />
sonstiges Streamingangebot leisten<br />
können“, so Mitschka. Ein gemeinsam<br />
finanziertes Unternehmen, das alle erreiche,<br />
für alle relevant sei und über alle<br />
relevanten Medienkanäle ausspiele, indem<br />
alle ihren Beitrag leisten, den sie<br />
auch leisten können, sei das Ziel. Wenn<br />
jemand nicht über die entsprechenden<br />
finanziellen Mittel verfügt, wird das bei<br />
den Rundfunkgebühren berücksichtigt,<br />
während bei Streaming-Angeboten die<br />
Preise für alle gleich sind, unabhängig<br />
von sozialer Bedürftigkeit. Konkret:<br />
Wenn jemand alleine lebt und weniger<br />
als 1083,-- € Haushalts-Nettoeinkommen<br />
hat, muss er bzw. sie laut GIS-<br />
Website kein ORF-Teilnahmeentgelt<br />
zahlen.<br />
Pay-TV vs. Streaming<br />
Oft verwenden wir die Worte „Pay-TV“<br />
und „Streaming“ als Synonym. Fakt ist<br />
aber, dass Streaming eine Form von<br />
Pay-TV ist und Pay-TV etwas komplexer<br />
in seiner Systematisierung ist.<br />
Hierbei unterscheidet man zwischen<br />
drei Kategorien. Zum einen haben wir<br />
Entgeltfinanzierung von Programmanbietern<br />
ohne eigene Netzinfrastruktur,<br />
hierein fällt das klassische Pay-TV sowie<br />
der Anbieter Sky. Als nächstes gibt<br />
es Entgeltfinanzierung von Programmprovidern<br />
ohne eigene Netzinfrastruktur,<br />
sogenannte software-getriebene<br />
Video on Demand-Plattformen, wie<br />
„Netflix“ oder „Amazon Prime“. Und als<br />
letztes haben wir Entgeltfinanzierung<br />
von Programmprovidern mit eigener<br />
Netzinfrastruktur, die hardware-getrieben<br />
sind, Beispiele hierfür sind SimpliTV,<br />
A1-TV und Magenta.<br />
GIS umgehen?<br />
Eine Möglichkeit die GIS-Gebühren zu<br />
umgehen, ist unter anderem das Streamen<br />
auf Bildschirmen ohne Tuner und<br />
ohne Antennen. Das war unter anderem<br />
der Beweggrund für die Gründung<br />
der Firma NOGIS Handels GmbH, die<br />
genau solche Geräte herstellt. „Die<br />
Geräte kommen sehr gut bei den RezipientInnen<br />
an“, so Thomas Höffinger.<br />
„Und diese sind sehr durchgemischt.“<br />
Unter anderem befänden sich unter<br />
den NutzerInnen der NOGIS-Geräte<br />
GIS PFUI, Streaming/Pay TV Thema hui!<br />
73
laut Höffinger Menschen, die sich einfach<br />
die GIS sparen wollen, weil sie ihnen<br />
zu teuer sei, weil sie ORF einfach<br />
nicht nutzen oder sie aus Prinzip die GIS<br />
nicht bezahlen wollen.<br />
Die Zukunft liegt in jungen Händen<br />
Die Zahl der StreamerInnen stieg von<br />
2016 bis 2020 laut der Bewegtbildstudie<br />
der RTR und Arbeitsgemeinschaft<br />
Teletest um rund 11%. Bei der<br />
Altersgruppe zwischen 14 und 29<br />
Jahren betrug der Anstieg sogar plus<br />
27,4%, wobei sich deren Nutzung von<br />
linearem Fernsehen sogar halbiert hat.<br />
<strong>SUMO</strong> führte hierzu eine kleine anonyme<br />
– nicht repräsentative – Umfrage<br />
zum Budget der MediennutzerInnen<br />
durch. Hierbei waren sich aber nur vier<br />
der zehn Befragten einig: GIS würde ich<br />
freiwillig nicht bezahlen. Die 21-jährige<br />
Angestellte Katharina R. nutzt „HDAustria“,<br />
„Netflix“ und ist ebenso im Besitz<br />
eines „Amazon Prime“-Accounts. Diese<br />
Plattformen böten ihr eine große Vielfalt<br />
an Filmen und Serien und enthielten<br />
keine Werbeunterbrechungen. Bei<br />
den Angeboten des ORFs hingegen finde<br />
sie kaum Inhalt, der ihren Vorlieben<br />
entspricht und deswegen auch nicht<br />
nutzt. Ihrer Meinung nach sei da für ihr<br />
Alter einfach nichts dabei und sie würde<br />
nicht freiwillig für die GIS-Gebühr aufkommen<br />
wollen. Von den insgesamt<br />
zehn Befragten in der Alterspanne von<br />
20 bis 65 Jahren sind vier Personen bereit,<br />
zwischen 15 und 20 Euro an Medienbudget<br />
auszugeben und bei den<br />
restlichen sechs befragten liegt dieses<br />
zwischen 25 und 50 €. Mitschka ist<br />
aber davon überzeugt, dass vor allem<br />
die Jugendlichen sehr wohl wissen, was<br />
gut für sie sei, und meint, dass es von<br />
der Fragestellung abhänge. Wenn man<br />
Menschen frage, ob sie für etwas zahlen<br />
wollen, komme selten ein „Ja“ heraus.<br />
Jugendliche wollen zum Beispiel<br />
nicht für umweltgerechte Produkte, ein<br />
Bankkonto oder Spiele zahlen. Exemplarisch<br />
gegenteilig sei die Abstimmung<br />
zur Abschaffung der Rundfunkgebühren<br />
in der Schweiz verlaufen, bei der<br />
vor allem die jungen Menschen überproportional<br />
gegen eine Abschaffung<br />
waren. Er setzt Vertrauen in die Jugend,<br />
da sie wüsste, dass es gut sei, ein Medium<br />
zu haben, das unabhängig sei,<br />
vertrauenswürdige Nachrichten liefere<br />
und den öffentlich-rechtlichen Auftrag<br />
erfülle. Es wird sich erweisen, ob er damit<br />
recht hat.<br />
von Julia Gstettner<br />
Konrad Mitschka / Copyright: ORF Hans Leitner<br />
Thomas Höffinger / Copyright: Martin Bäck agoradesign.at<br />
Copyright: adobe stock / 4th Life Photography<br />
Die GIS steht für Gebühren Info Service GmbH und ist<br />
das Bindeglied zwischen GebührenzahlerInnen auf<br />
der einen Seite und ORF, Bund und Ländern auf der<br />
anderen Seite. Die GIS ist für das Einheben und Weiterleiten<br />
von Gebühren sowie Abgaben zuständig,<br />
als auch mit der Abwicklung von Gebührenbefreiung.<br />
74<br />
Thema GIS PFUI, Streaming/Pay TV hui!
Impressum<br />
Medieninhaberin:<br />
Fachhochschule St. Pölten GmbH<br />
c/o <strong>SUMO</strong><br />
Matthias Corvinus-Straße 15<br />
A-3100 St. Pölten<br />
Telefon: +43(2742) 313 228 - 200<br />
www.fhstp.ac.at<br />
Fachliche Leitung:<br />
FH-Prof. Mag. Roland Steiner<br />
E-Mail: roland.steiner@fhstp.ac.at<br />
Telefon: +43/676/847 228 425<br />
www.sumomag.at<br />
facebook.com/sumomag<br />
Copyright: jeweils Privat<br />
Das Team der Ausgabe 36 und des Online-Magazins www.sumomag.at<br />
Julia Allinger, Anja Stojanovic, Christiane Fürst, Michael Geltner, Julia Gstettner, Anna-Lena Horak, Raphaela Hotarek,<br />
Viktoria Strobl, Raphaela Kordovsky, Anna Kowatsch, Christian Krückel, Ndidi Maduba, Laura Sophie Maihoffer, Martin<br />
Möser, Lukas Pleyer, Simone Poik, David Pokes, Sophie Pratschner, Manuela Schiller, Lisa Schinagl, Matthias Schnabel,<br />
Annika Schuntermann, Alexander Schuster, Christopher Sochor, Ida Stabauer, Sebastian Suttner, Karin Pargfrieder,<br />
Kristina Petryshche<br />
BILDREDAKTION: Alexander Schuster (Ltd.), David Pokes (Ltd.), Sebastian Suttner (Ltd.), Raphaela Kordovsky, Annika<br />
Schuntermann, Matthias Schnabel<br />
DISTRIBUTION: Christiane Fürst (Ltd.), Anna Kowatsch, Lisa Schinagl, Kristina Petryshche<br />
PRINTPRODUKTION: Martin Möser (Ltd.), Ida Stabauer (Ltd), Christian Krückel, Christopher Sochor<br />
ONLINEPRODUKTION: Julia Allinger (Ltd.), Sophie Pratschner (Ltd.), Anna-Lena Horak, Laura Sophie Maihoffer<br />
SALES: Karin Pargfrieder (Ltd.) - Alle<br />
TEXTREDAKTION: Michael Geltner (Ltd.), Raphaela Hotarek (Ltd.) - Alle<br />
UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION: Anja Stojanovic (Ltd.), Viktoria Strobl (Ltd.), Simone Poik, Ndidi Maduba, Julia Gstettner<br />
Impressum<br />
75
Eine gute<br />
Ausbildung<br />
ist eine, die<br />
mir zeigt,<br />
was noch getan<br />
werden muss.<br />
Wissen, was<br />
morgen zählt.<br />
Eva Milgotin<br />
Studentin Wirtschafts- und<br />
Finanzkommunikation<br />
Christoph Rumpel<br />
Web-Entwickler & Autor (Selbstständig)<br />
Absolvent Medientechnik<br />
Acht Themenbereiche<br />
| Medien<br />
| Digitale Technologien<br />
| Informatik<br />
| Security<br />
| Bahntechnologie<br />
| Wirtschaft<br />
| Gesundheit<br />
| Soziales<br />
Jetzt informieren:<br />
fhstp.ac.at