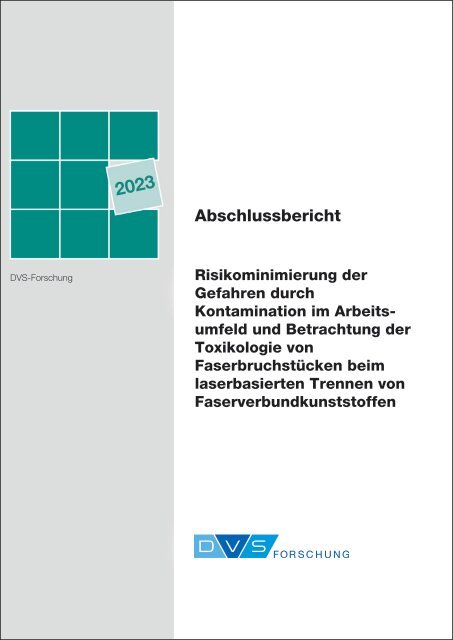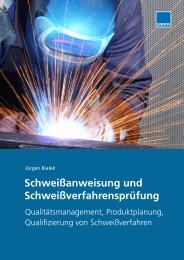Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2023<br />
Abschlussbericht<br />
DVS-Forschung<br />
Risikominimierung der<br />
Gefahren durch<br />
Kontamination im Arbeitsumfeld<br />
und Betrachtung der<br />
Toxikologie von<br />
Faserbruchstücken beim<br />
laserbasierten Trennen von<br />
Faserverbundkunststoffen
Risikominimierung der Gefahren<br />
durch Kontamination im<br />
Arbeitsumfeld und<br />
Betrachtung der Toxikologie von<br />
Faserbruchstücken beim<br />
laserbasierten Trennen von<br />
Faserverbundkunststoffen<br />
Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben<br />
IGF-Nr.: 21.629 N<br />
DVS-Nr.: Q6.3372<br />
Laser Zentrum Hannover e.V.<br />
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.<br />
(DGUV)<br />
Institut für Prävention und Arbeitsmedizin<br />
(IPA)<br />
Förderhinweis:<br />
Das IGF-Vorhaben Nr.: 21.629 N / DVS-Nr.: Q6.3372 der Forschungsvereinigung Schweißen<br />
und verwandte Verfahren e.V. des DVS, Aachener Str. 172, 40223 Düsseldorf, wurde über die<br />
AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)<br />
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des<br />
Deutschen Bundestages gefördert.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek<br />
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen<br />
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind online abrufbar<br />
unter: http://dnb.dnb.de<br />
© 2023 DVS Media GmbH, Düsseldorf<br />
DVS Forschung Band 576<br />
Bestell-Nr.: 170686<br />
I<strong>SB</strong>N: 978-3-96870-576-7<br />
Kontakt:<br />
Forschungsvereinigung Schweißen<br />
und verwandte Verfahren e.V. des DVS<br />
T +49 211 1591-0<br />
F +49 211 1591-200<br />
forschung@dvs-hg.de<br />
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung in andere Sprachen, bleiben<br />
vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung des Verlages sind Vervielfältigungen, Mikroverfilmungen und die<br />
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen nicht gestattet.
Seite IV des Schlussberichtes zum IGF-Vorhaben Nr. 21.629 N<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
1. Einleitung ............................................................................................................... 1<br />
1.1. Stand von Wissenschaft und Technik ............................................................... 3<br />
1.1.1. Gefährdungspotenzial von faserhaltigen Stäuben ...................................... 3<br />
1.1.2. Toxizitätsbewertung von faserhaltigen Stäuben ......................................... 5<br />
1.2. Aufgabenstellung und Vorgehensweise ............................................................ 7<br />
1.3. Wirtschaftliche Bedeutung der Forschungsergebnisse für kmU ....................... 9<br />
2. Ergebnisse der Forschungseinrichtungen ....................................................... 12<br />
2.1. Grundlagen und Definitionen (AP 1) ............................................................... 12<br />
2.1.1. Im Projekt eingesetzte Laser und Prozessparameter ............................... 12<br />
2.1.2. Verarbeitete Werkstoffe ............................................................................ 13<br />
2.1.3. Mechanische Referenzprozesse .............................................................. 13<br />
2.1.4. Auswahl von Mess- und Analysemethoden sowie<br />
Probenahmevorbereitung ......................................................................... 16<br />
2.2. Analyse von FVK-Schneidprozessen mit hohen Energiedichten (AP 2) ......... 18<br />
2.3. Staubprobenahme für die Untersuchungen auf Zelltoxizität und<br />
Migrationsverhalten (AP 3) ............................................................................. 21<br />
2.3.1. Berücksichtigung des Temperaturregimes im Prozess ............................. 23<br />
2.4. Toxikologische Analyse der Stäube (AP 4) ..................................................... 24<br />
2.4.1. Methoden ................................................................................................. 25<br />
2.4.1.1 AlamarBlue Test ....................................................................................... 25<br />
2.4.1.2 PICMA – Particle Induced Cell Migration Assay ....................................... 25<br />
2.4.2. Erzielte Ergebnisse................................................................................... 26<br />
2.4.2.1 Die Bereitung von Suspensionen ............................................................. 26<br />
2.4.3. Toxikologische Untersuchungen .............................................................. 27<br />
2.4.4. Zusammenfassende Bewertung ............................................................... 33<br />
2.5. Ermittlung von Kontaminationswegen und Verschleppungsarten (AP 5) ........ 34<br />
2.6. Bewertung der Gefahren für die Beschäftigten und das Arbeitsumfeld (AP 6)36<br />
2.7. Ausrüstung von Anlagen für das Schneiden von FVK sowie Optimierung von<br />
Handhabungsstrategien (AP 7) ....................................................................... 43
Seite V des Schlussberichtes zum IGF-Vorhaben Nr. 21.629 N<br />
2.8. Handlungsempfehlungen und Merkblatt (AP 8) .............................................. 44<br />
2.8.1. Tätigkeitsbezogene Handlungsempfehlungen und Schutzmaßnahmen 44<br />
2.8.2. Bereichsbezogene Handlungsempfehlungen und Schutzmaßnahmen . 45<br />
2.9. Abschließende Auswertung, Dokumentation und Schlussbericht (AP 9) ........ 47<br />
3. Diskussion der Ergebnisse ................................................................................ 47<br />
3.1. Fasern und Kunststoffmatrix ........................................................................... 47<br />
3.2. Arbeitsplatzmessungen .................................................................................. 48<br />
3.3. Ergebnisaufbereitung / Handlungsempfehlungen ........................................... 50<br />
3.3.1. Hinweise für die Prozessführung .............................................................. 50<br />
3.3.2. Empfehlungen für Erfassung und Reinigung ............................................ 51<br />
3.3.3. Hinweise für eine Gefährdungsanalyse .................................................... 52<br />
4. Verwendung der Zuwendung ............................................................................. 52<br />
4.1. Durch das LZH: ............................................................................................... 52<br />
4.2. Durch das IPA: ................................................................................................ 53<br />
5. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit .......................... 54<br />
6. Darstellung des wissenschaftlich-technischen und wirtschaftlichen Nutzens<br />
der erzielten Ergebnisse ..................................................................................... 55<br />
7. Plan zum Ergebnistransfer in die Wirtschaft .................................................... 56<br />
7.1. Durchgeführte Transfermaßnahmen während der Projektlaufzeit ................. 56<br />
7.2. Bereits durchgeführte und noch geplante spezifische Transfermaßnahmen<br />
nach Abschluss des Vorhabens ...................................................................... 57<br />
Liste der Veröffentlichungen ...................................................................................... 58<br />
Danksagung ................................................................................................................. 59<br />
Abbildungsverzeichnis ............................................................................................... 60<br />
Tabellenverzeichnis .................................................................................................... 62<br />
Verzeichnis der Abkürzungen .................................................................................... 63<br />
Literaturverzeichnis .................................................................................................... 66
Seite 1 des Schlussberichts zum IGF-Vorhaben Nr. 21.269 N<br />
Das IGF-Vorhaben Nr. 21.629 N „Risikominimierung der Gefahren durch Kontamination<br />
im Arbeitsumfeld und Betrachtung der Toxikologie von Faserbruchstücken beim laserbasierten<br />
Trennen von Faserverbundkunststoffen (RisoTto)“ wurde am 01.04.2021 mit einer<br />
Laufzeit bis zum 31.03.2023 bewilligt. Dieser Abschlussbericht enthält die Darstellung der<br />
im Zeitraum April 2021 bis März 2023 ausgeführten Arbeiten.<br />
Übergeordnetes Forschungsziel war die Erarbeitung applikations- und arbeitsumfeldübergreifender<br />
Grundlagen für den sauberen und sicheren Umgang mit den freigesetzten<br />
Gefahrstoffen beim laserbasierten Trennen von Faserverbundkunststoffen. Dabei ging<br />
es nicht nur um den Prozessschritt der abtragenden Bearbeitung selbst, sondern insbesondere<br />
auch um die begleitenden Schritte der Vor- und Nachbereitung. Weiterhin wurde<br />
die toxikologische Wirkung auf Zellen mittels partikelinduziertem Zellmigrationstest<br />
(PICMA) und die Verschleppung freigesetzter Faserbruchstücke in das Arbeitsumfeld<br />
evaluiert. Wegen der pandemischen Lage wurde auf die Einbeziehung des häuslichen<br />
Umfeldes verzichtet. Das erarbeitete Wissen wurde bei zwei Anwendern aus dem projektbegleitenden<br />
Ausschuss (PA) auf die Arbeitsabläufe in existierenden Produktionsund<br />
Versuchshallen für die laserbasierte und auch mechanische Fertigung übertragen<br />
und erfolgreich in der industriellen Praxis angewendet.<br />
Das Ziel des Forschungsvorhabens wurde erreicht.<br />
1. Einleitung<br />
Im Rahmen ihrer täglichen beruflichen Tätigkeit können Mitarbeiter von Unternehmen in<br />
Kontakt mit gesundheitsgefährdenden Stoffen (inkl. giftiger Stoffe sowie krebserzeugender,<br />
mutagener und reproduktionstoxischer Stoffe, der sog. KMR-Stoffe) gelangen. Gemäß<br />
§6 GefStoffV [5] hat der Arbeitgeber für den Arbeitsplatz bereits vor Tätigkeitsaufnahme<br />
eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen und geeignete Maßnahmen zum<br />
Schutz der Mitarbeiter und zur Gefährdungsminimierung zu ergreifen.<br />
Der Einsatz von Faserverbundkunststoffen (FVK) bei neuen Leichtbaukonzepten führt<br />
u. a. zur Einsparung von CO2–Emissionen. Im vorliegenden Fall erfolgt die trennende<br />
Bearbeitung von FVK mit kurzgepulster Laserstrahlung bei einer mittleren Leistung von<br />
1,5 kW. Dieser Prozess führt dazu, dass die Matrix zusammen mit der Faserverstärkung<br />
innerhalb kürzester Zeit zersetzt und eine große Anzahl an luftgetragenen und lungengängigen<br />
Faserbruchstücken generiert wird.<br />
Erhebliche Risiken, welche die Verbreitung der laserstrahlbasierten Technologie nach<br />
sich zieht, ergeben sich aus der Art der für die Produktion verwendeten Werkstoffe sowie<br />
aus der Wechselwirkung des Werkzeugs Laserstrahlung mit diesen Werkstoffen. Bei den<br />
verwendeten FVK handelt es sich zunächst um ungefährliche Materialien. In Analogie zu<br />
etablierten Laserabtragprozessen kommt es durch die konzentrierte Erzeugung thermischer<br />
Energie zur partiellen Freisetzung des Matrixwerkstoffes in die Gasphase durch<br />
Verdampfung und Faserbruchstücken durch Herausbrechen kleinster Partikel und Fasern,<br />
so dass innerhalb der Prozesszone im Bearbeitungsraum mit signifikanten Konzentrationen<br />
lungengängiger Partikel und Fasern (unterschiedlicher Dimensionen) zu
Seite 2 des Schlussberichts zum IGF-Vorhaben Nr. 21.269 N<br />
rechnen ist. Gesundheitlichen Auswirkungen der Freisetzung von einatembaren Faserbruchstücken<br />
bei der Bearbeitung von von Faserverbundkunststoffen und evtl. auftretende<br />
Langzeitfolgen für den Menschen sind Gegenstand intensiver Forschung (siehe [1], [2],<br />
[3])<br />
Im bestimmungsgemäßen Betrieb wird die gefahrstoffhaltige Prozessabluft mit den am<br />
Markt existierenden industriellen Erfassungs- und Filtersystemen unmittelbar erfasst und<br />
abgesaugt. Die erforderliche Filtertechnik lässt sich in der Regel ohne Weiteres so auslegen,<br />
dass die Grenzwerte gemäß TA-Luft [4] eingehalten werden.<br />
Ebenso ist bei (teil-) geschlossenen Roboter- bzw. Laserkabinen während der Laserbearbeitungsprozesse<br />
der Schutz der Beschäftigten gemäß Gefahrstoffverordnung (Gef-<br />
StoffV [5]) prinzipiell gewährleistet. Vor diesem Hintergrund und insbesondere im Vergleich<br />
zu konventionellen laserbasierten Prozessen der Kunststoffbearbeitung wie dem<br />
Lasertrennen, Laserbohren, Laserfügen und Laser-Durchstrahlschweißen stellt, der<br />
durch zusätzlich generierte lungengängige, elektrisch leitfähige Fasern eine Erhöhung<br />
des Gefährdungspotenzials dar. Des Weiteren entstehen Partikel und Fasern, die nicht<br />
luftgetragen sind und einen intensiven Kontakt mit diesen abgeschiedenen Prozessemissionen<br />
mit sich bringt.<br />
Eine direkte Folge der Wissenslücken ist neben den Defiziten im Hinblick des inhalativen<br />
Expositionsrisikos eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich der Gefahren durch Gefahrstoffverschleppung<br />
in andere Bereiche der betrachteten kmUs, z. B. in Büro- und Aufenthaltsräume,<br />
oder bis ins häusliche Umfeld der betroffenen Mitarbeiter (siehe Abb. 1.1).<br />
Zu dieser Fragestellung existieren bislang keine systematischen Kenntnisse.<br />
Primäres Projektziel war, die bestehenden Wissenslücken bzgl. Kontamination und Verschleppung<br />
bei der laserbasierten trennenden Bearbeitung von FVK durch eine ganzheitliche<br />
Betrachtung zu schließen und den kmU öffentlich verfügbare, leicht zugängliche<br />
Informationen und Anleitungen zur optimierten Organisation von Arbeitsabläufen und zur<br />
sicheren Gestaltung der Arbeitsplätze der Mitarbeiter in der Fertigung FVK-basierter<br />
Werkstücke zur Verfügung zu stellen. Dies wird Hemmschwellen bei der Verbreitung von<br />
FVK-Fertigungsverfahren senken und den Nutzen für kmU durch den sicheren Umgang<br />
bei der individualisierten Herstellung von solchen Produkten steigern.<br />
Abb. 1.1:<br />
Motivation zur Durchführung des Vorhabens
Seite 3 des Schlussberichts zum IGF-Vorhaben Nr. 21.269 N<br />
1.1. Stand von Wissenschaft und Technik<br />
1.1.1. Gefährdungspotenzial von faserhaltigen Stäuben<br />
In industriellen Fertigungsketten werden in Anlagen zur Bearbeitung von FVK-Bauteilen<br />
bisher häufig spanende oder abtragende Bearbeitungsverfahren eingesetzt, um die Bauteile<br />
auf Endkontur zu bringen. Während ihrer Tätigkeit kommen die Anlagenbediener mit<br />
partikel- und gasförmigen Stoffen in Kontakt. Diese Stoffe entstehen je nach Prozess<br />
durch mechanische Krafteinwirkung als staubförmiger Abrieb oder durch Zersetzungsprozesse<br />
von Polymermatrix und Faserverstärkung infolge der eingebrachten thermischen<br />
Energie (auch infolge Reibung). Die freigesetzten Stoffe enthalten neben sphärischen<br />
Partikeln auch potenziell gesundheitsgefährdende Fasern und Faserbruchstücke<br />
sowie flüchtige organische Komponenten (VOC), die als Zersetzungsprodukte der Polymermatrix<br />
in die Gasphase gelangen. Eine wesentliche Gefährdung der Anlagenbediener<br />
geht dabei von giftigen sowie krebserzeugenden, erbgutverändernden und reproduktionstoxischen<br />
Stoffen, den sog. KMR-Stoffen, aus.<br />
Ausgehend von ermittelten relevanten Literaturquellen bzw. Untersuchungsergebnissen<br />
[6-14] sowie von Sicherheitsdatenblättern für eingesetzte CFK und GFK kann die Gefährdungssituation<br />
beim Laserschneiden von FVK wie folgt zusammengefasst werden:<br />
Der Einsatz der Lasertechnik bei der FVK-Bearbeitung erfordert ein aufmerksames und<br />
sicheres sicherheitsbewusstes Verhalten der Mitarbeiter, um gesundheitliche Risiken zu<br />
minimieren. Nach [15] werden die mit Laserprozessen verbundenen Tätigkeiten wie Bestücken,<br />
Rüsten und Einstellen der Maschine je nach Dauer der Expositionskategorie 1<br />
(< 50.000 Fasern/m³ gemäß [16] und 1/10 des allg. Staubgrenzwertes gemäß [17]) oder<br />
2 (50.000 bis 250.000 Fasern/m³ gemäß [16] und/oder 1/10 des allg. Staubgrenzwertes<br />
gemäß [5]) zugeordnet. Für jede Expositionskategorie werden in [15] allgemeine Schutzmaßnahmen<br />
definiert, z.B. die Vermeidung des Hautkontakts mit faserhaltigen Stäuben<br />
durch das Tragen langärmliger Arbeitskleidung sowie des Einatmens von Stäuben mittels<br />
geeigneter Atemschutzmasken. Das Erfassen und Absaugen freigesetzter Gefahrstoffe<br />
an der Entstehungsstelle sowie die Vermeidung des Staubabblasens mit Druckluft und<br />
die Verwendung spezieller Industriestaubsauger für die Reinigung ist vorzusehen. Hier<br />
können auch die EMKG-Schutzleitfäden der BAuA [18] genutzt werden. Die Exposition<br />
mit Gefahrstoffgemischen, die neben mechanisch generierten Faserfragmenten und<br />
sphärischen Partikeln auch Gefahrstoffe aus der thermischen Zersetzung des Verbundes<br />
aus Polymermatrix und Faserverstärkung enthalten, wird in [23] nicht betrachtet. Hingewiesen<br />
wird lediglich darauf, dass eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung zum Arbeitsplatz<br />
durchzuführen ist. Dafür sind in [5] die anzuwendenden Luftgrenzwerte für partikel-<br />
und gasförmige Gefahrstoffe erfasst. Für ggf. enthaltene KMR-Stoffe ist die TRGS<br />
910 [19] anzuwenden, in der Akzeptanz- und Toleranzrisiken, zugehörige Konzentrationen<br />
sowie ein risikobezogenes Maßnahmenkonzept definiert ist.<br />
Auf Basis der genannten Referenzen können gesundheitsgefährdende Bedingungen<br />
nach fachgerechter Messung der inhalativen Exposition gemäß TRGS 402 [20] bewertet<br />
werden. Messverfahren, die sich gemäß [20] umsetzen lassen, sind prinzipiell in der DIN<br />
EN 482 [21] für Partikelexpositionen sowie in der VDI 3492 [22] und der ISO 14966 [23]