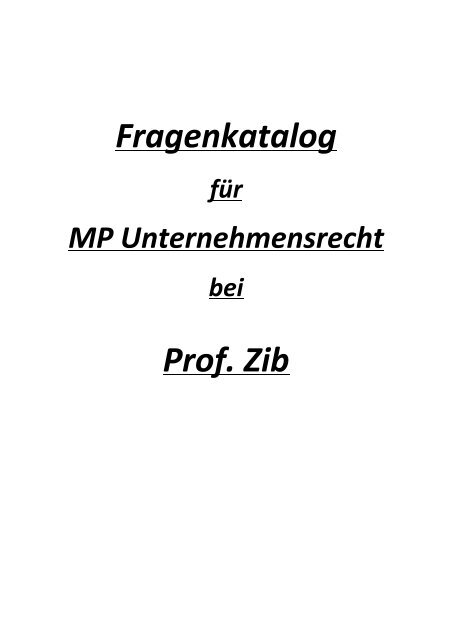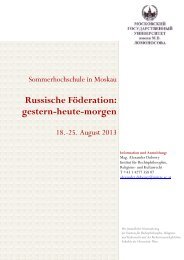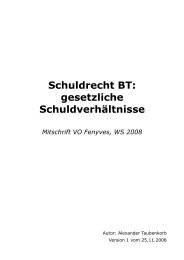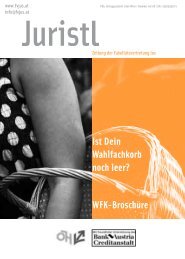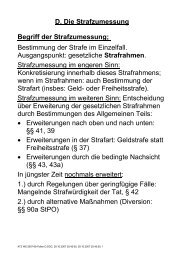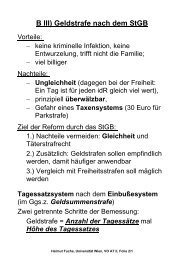Beantworteter Fragenkatalog Zib
Beantworteter Fragenkatalog Zib
Beantworteter Fragenkatalog Zib
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Fragenkatalog</strong><br />
für<br />
MP Unternehmensrecht<br />
bei<br />
Prof. <strong>Zib</strong>
Dieser <strong>Fragenkatalog</strong> wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und bezieht sich mit<br />
seinen Fragen auf den <strong>Fragenkatalog</strong> aus dem Forum welcher bis 2009 geführt wurde.<br />
Fragen die öfter in verschiedener Weise gestellt wurden, werden in diesem <strong>Fragenkatalog</strong><br />
zusammengefasst und als eine formuliert. Weiters ist dieser <strong>Fragenkatalog</strong> in die einzelnen<br />
Rechtsbereiche aufgeteilt um ein besseres Lernergebnis zu erzielen.<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Allgemeines Unternehmensrecht ........................................................................................................5<br />
Wertpapierrecht................................................................................................................................32<br />
Gesellschaftsrecht .............................................................................................................................46<br />
Personengesellschaften.................................................................................................................46<br />
Kapitalgesellschaften ....................................................................................................................53<br />
Grundzüge des Wettbewerbsrechts ..................................................................................................69<br />
Grundzüge des Immaterialgüterrechts..............................................................................................71<br />
Querschnittsmaterien........................................................................................................................73<br />
Merksätze und Aufzählungen............................................................................................................73<br />
Straube Kommentar zur fehlerhaften Gesellschaft ...........................................................................75<br />
Verzeichnis wichtiger Paragraphen...................................................................................................77<br />
Verzeichnis der Lehrbücher ...............................................................................................................77<br />
Stoffabgrenzung der mündlichen Modulprüfung Unternehmensrecht .............................................77<br />
3
Allgemeines Unternehmensrecht<br />
1. HGB zu UGB?<br />
-‐ 1862: Einführung des AHGB in Österreich<br />
-‐ Deutschland: BGB und HGB<br />
-‐ 1938: Einführung des HGB (+ 4. EVHGB) in Österreich<br />
-‐ Auch nach 1945 war es in Geltung (Rechtsüberleitung)<br />
-‐ 1998: Deutsche Handelsrechtsreform<br />
-‐ 2007: Eigenständiges UGB in Österreich; Es kam zur „Abnabelung“ vom deutschen HGB<br />
2. Für wen gilt das UGB?<br />
Dem UGB unterfällt, wer Unternehmer ist. Der Unternehmer betreibt selbständig ein<br />
Unternehmen. Das ist eine persönliche Eigenschaft, weswegen man auch vom subjektiven<br />
System des UGB spricht. Nach dem UGB ist also nur noch die unternehmerische Tätigkeit von<br />
Bedeutung. Gem §1 Abs 1 UGB “Unternehmer ist, wer ein Unternehmen betreibt.“<br />
Letztendlich entspricht also jede selbständige Erwerbstätigkeit dem weiten<br />
Unternehmerbegriff des UGB. JurP des öffentlichen Rechts können dem UGB nur dann<br />
unterstehen, wenn sie auch ein Unternehmen gem §1 Abs 2 UGB betreiben. Sowohl für die<br />
Angehörigen freier Berufe als auch den Land-‐ und Forstwirten besteht die Möglichkeit, sich<br />
freiwillig dem UGB und dessen Rechtsfolgen zu unterstellen, das so genannte opting-‐in (§4<br />
Abs 2 und 3 UGB). Jedoch findet auf sie das 3. Buch keine Anwendung da sie Selbstversorger<br />
sind. Unternehmer kraft Rechtsform (§2 UGB) unterstehen dem UGB nicht auf Grund der<br />
unternehmerischen Tätigkeit, sondern der gewählten Rechtsform (das sind so genannte<br />
Formunternehmer). §2 UGB hält fest wer als Formunternehmer gemeint ist: die AG, die<br />
GmbH, die Gen, der VVaG, die Sp, die EWIV, die SE und die SCE; Auf Unternehmer kraft<br />
Eintragung (§3 UGB) ist das UGB nur anwendbar, wenn die zu Unrecht eingetragenen unter<br />
ihrer Firma handeln. Sie müssen durch die Firmenführung im Geschäftsverkehr den Anschein<br />
erwecken Unternehmer zu sein. Der §3 UGB ist ein absoluter Verkehrsschutz. In seinem<br />
Zusammenhang wäre der §15 UGB zu erwähnen (hierzu siehe Frage 19).<br />
3. Wer einen Unternehmertatbestand erfüllt, muss nicht immer den gesamten 4 Büchern des<br />
UGB unterfallen. Welche Beispiele fallen Ihnen ein?<br />
-‐ Das 1. Buch ist auf Unternehmer iSd §§1-‐3 UGB anzuwenden. Für Freiberufliche gilt das<br />
1. Buch nur bis §6 UGB, sofern sie sich nicht freiwillig unterwerfen (so genanntes opting-‐<br />
in Prinzip). In diesem Fall würde das ganze 1. Buch für sie gelten. Achtung,<br />
Rechtsanwälten und Notaren ist es berufsrechtlich untersagt sich durch<br />
Firmenbucheintragung dem UGB freiwillig zu unterstellen.<br />
-‐ Das 2. Buch ist auf Freiberufliche nur anwendbar, wenn sie sich der Rechtsform einer OG<br />
bzw. KG bedienen.<br />
-‐ Das 3. Buch ist auf Freiberufliche niemals anwendbar, da ihre Tätigkeit<br />
höchstpersönlichen Charakter hat und sie kein Entgelt, sondern ein Honorar erhalten.<br />
Land-‐ und Forstwirte fallen auf Grund ihrer Selbstversorgereigenschaft nicht unter das 3.<br />
Buch.<br />
-‐ Das 4. Buch des UGB findet auf Freiberufliche immer Anwendung.<br />
5
-‐ Bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts, findet das 1. Buch Anwendung sofern<br />
sie ein Unternehmen betreiben. Hingegen unterfallen sie nicht dem 2. Buch. Das 3. Buch<br />
findet keine Anwendung weil im öffentlichen Recht das System der Kameralistik gilt. Das<br />
4. Buch wiederum findet immer dann Anwendung, wenn die juristische Person<br />
privatrechtlich tätig ist.<br />
4. Was sind Unternehmensbräuche?<br />
Das sind während einer gewissen Zeit tatsächlich geübte, von den Beteiligten<br />
unternehmerischen Verkehrskreisen anerkannte Gepflogenheit im Bereich des<br />
unternehmerischen Geschäftsverkehrs. Opinio iuris fehlt. Gegeben ist aber: opinio usus =<br />
weitgehend überstimmende Überzeugung der beteiligten Kreise, dass die zur Diskussion<br />
stehende Verhaltensweise als tätigkeitsspezifische Verkehrssitte anzusehen ist. Die<br />
Feststellung von Unternehmensbräuchen sind Tatsachenfragen (richterliche<br />
Beweiswürdigung). Wer sich auf einen Unternehmensbrauch beruft, der muss ihn auch<br />
nachweisen, und zwar mittels eines Sachverhaltsbeweis oder einem Gutachten der WKÖ. Die<br />
WKÖ erhebt Gutachten in ganz Österreich in Wege von Umfragen.<br />
5. Fallen Rechtsanwälte unter das Unternehmensrecht?<br />
Rechtsanwälten und Notaren ist es berufsrechtlich untersagt sich durch<br />
Firmenbucheintragung dem UGB freiwillig zu unterstellen (näheres siehe Frage 3).<br />
6. Wer unterfällt dem 4. Buch des UGB?<br />
Das 4. Buch des UGB erstreckt sich von den §§343 – 454 UGB und regelt die<br />
unternehmensbezogenen Geschäfte. Unternehmensbezogene Geschäfte sind alle Geschäfte<br />
eines Unternehmers, die zum Betrieb seines Unternehmens gehören. D.h. das 4. Buch gilt für<br />
alle Unternehmer iSd §§1-‐3 UGB. Die Unternehmereigenschaft muss im Zeitpunkt der<br />
Geschäftsvornahme vorliegen. Das 4. Buch ist auch auf juristische Personen anzuwenden,<br />
unabhängig davon ob die juristische Person des öffentlichen Rechts als Unternehmer tätig ist<br />
oder nicht. Das 4. Buch gilt auch für Freiberufler.<br />
7. Was wissen Sie über das unternehmerische Zurückbehaltungsrecht, und was ist der<br />
Unterschied zum zivilrechtlichen Zurückbehaltungsrecht?<br />
Es gibt gesetzliche und vertragliche Zurückbehaltungsrechte (Retentionsrechte).<br />
Das unternehmerische Retentionsrecht, gem §369 UGB, zeichnet sich gegenüber dem<br />
zivilrechtlichen vor allem dadurch aus, dass es keine Konnexität voraussetzt, sondern nur<br />
eine Forderung aus einem beiderseitigen unternehmensbezogenen Geschäft. Es gewährt<br />
außerdem ein pfandähnliches Befriedigungsrecht. In bestimmten Fällen erfordert es keine<br />
Fälligkeit des Anspruches, dessentwegen es zurückbehalten wird. Weiters muss die<br />
zurückbehaltene Sache nicht dem Schuldner gehören. Das zivilrechtliche<br />
Zurückbehaltungsrecht ist in §471 ABGB geregelt.<br />
Ein Zurückbehaltungsrecht nach §369 Abs 1 UGB hat ein Unternehmer (Gläubiger) wegen<br />
der grundsätzlich fälligen (Ausnahme: Notretention) Geldforderungen, die ihm gegen einen<br />
anderen Unternehmer (Schuldner) aus den zwischen ihnen bestehenden (also<br />
beiderseitigen) unternehmensbezogenen Geschäften zustehen, an den beweglichen Sachen<br />
und Wertpapieren (nur Inhaber-‐ und Orderpapiere; Rektapapiere sind nicht selbständig<br />
verwertbar) des Schuldners, welche mit Willen des Schuldners aufgrund von<br />
6
unternehmensbezogenen Geschäften in den Besitz (= Gewahrsame) des Gläubigers gelangt<br />
sind, sofern er sie noch in Gewahrsame hat (insb mittels Konnossements, Ladescheins oder<br />
Lagerscheins darüber verfügen kann). Ob der Schuldner oder der Gläubiger Eigentümer des<br />
Retentionsgutes ist, spielt dabei keine Rolle.<br />
Das Ende des Zurückbehaltungsrechts tritt ein bei Sicherheitsleistung des Schuldners,<br />
Untergang der zurückbehaltenen Sache, Erlöschen der zu sichernden Forderung, Aufgabe der<br />
Gewahrsame, sonstigen Verlust der Verfügungsmacht über die zurückbehaltene Sache.<br />
8. Was wissen Sie über das Notretentionsrecht?<br />
Das Notretentionsrecht bildet eine Ausnahme zum Erfordernis der Fälligkeit. In diesem Fall<br />
kann nämlich der Unternehmer das Zurückbehaltungsrecht wegen nicht fälliger Forderung<br />
geltend gemacht werden, wenn über das Vermögen des Schuldners der Konkurs eröffnet<br />
wurde oder aber der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat oder etwa eine<br />
Zwangsvollstreckung in das Schuldnervermögen erfolglos versucht wurde. In diesem Fällen<br />
steht das Zurückbehaltungsrecht auch dann zu wenn es sonst wegen einer<br />
Verwendungsbestimmung bzw Verpflichtung ausgeschlossen wäre, aber der Konkurs o.Ä.<br />
dem Gläubiger erst nach Übernahme des Retentionsgutes bekannt wurden.<br />
9. Was wissen Sie über das Befriedigungsrecht?<br />
Der Retentionsberechtigte ist befugt, sich aus dem Retentionsgut für seine Forderung zu<br />
befriedigen gem §371 UGB.<br />
10. Was ist der Vertrauensschaden beim ECG?<br />
Dieser ist zu ersetzen wenn sich der Händler im Fernabsatz nicht auf eine Bestellung meldet.<br />
Denn gem §10 Abs 2 ECG müsste er dem Besteller zumindest eine Empfangsbestätigung<br />
zukommen lassen. Hier bildet man also eine Haftung aus culpa in contrahendo. Wenn der<br />
Besteller im Vertrauen auf das Zugehen seiner Erklärung bereits Dispositionen getroffen hat.<br />
Manche geben ihm nur ein Rücktrittsrecht, denn nur deshalb weil sich der Händler nicht<br />
meldet, heißt das ja noch nicht, dass er das Angebot des Bestellers auch tatsächlich<br />
angenommen hätte. Diese Meinung ist jedoch strittig.<br />
11. Was wissen Sie über die Mängelrüge?<br />
Grundsätzlich findet weitgehend das allgemeine Leistungsstörungsrecht des bürgerlichen<br />
Rechts Anwendung auf Warenkäufe wie auf sonstige unternehmensbezogene Geschäfte.<br />
Eine wichtige Sonderregel kennt jedoch §377 UGB: die Obliegenheit in Fällen beiderseitiger<br />
unternehmensbezogener Geschäfte festgestellte Mängel der Ware binnen angemessener<br />
Frist zu rügen. Man spricht hier von der Mängelrüge.<br />
Diese Regel gilt nicht nur für Mängel, sondern auch für Falschlieferungen (aliud-‐Lieferungen),<br />
sofern die gelieferte Ware nicht offensichtlich von der Bestellung so erheblich abweicht, dass<br />
der Verkäufer die Genehmigung des Käufers als ausgeschlossen betrachten musste (§378<br />
UGB). §377 Abs 1 UGB bestimmt, dass im Falle eines beiderseitigen unternehmensbezogenen<br />
Geschäfts der Käufer binnen angemessener Frist nach Ablieferung der Ware, soweit dies<br />
nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, durch Untersuchung festgestellte Mängel<br />
der Ware dem Verkäufer anzuzeigen hat.<br />
Diese Obliegenheit gilt nicht für verstecke Mängel, doch sind diese bei Entdeckung<br />
unverzüglich anzuzeigen. Weiters gilt die Pflicht nicht bei Rechtsmängeln. Der Käufer wahrt<br />
7
seine Rechte, wenn er die Anzeige rechtzeitig absendet. Der Zweck der Mängelrüge liegt<br />
darin, dass der Verkäufer möglichst bald erfahren soll, ob seine Lieferung in Ordnung geht.<br />
Diese Dispositionssicherheit soll geschützt bzw gefördert werden. §§377f UGB sind<br />
dispositives Recht. Wenn der Käufer es versäumt die Mängelrüge anzustellen verliert er<br />
Ansprüche auf Gewährleistung, Ansprüche auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst,<br />
Ansprüche aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit der Sache. Nicht erwähnt wurde die<br />
Anfechtung des Vertrags wegen der Verkürzung über die Hälfte (laesio enormis), jedoch<br />
sprechen gute Gründe dafür, auch diese Ansprüche für verloren zu erachten.<br />
12. Mängelrüge beim Streckengeschäft?<br />
Das Streckengeschäft ist ein mehrpersonales Verhältnis. Für die Mängelrüge wird es als<br />
ausreichend erachtet, wenn nicht der ein Großhändler, sondern der Einzelhändler oder auch<br />
Verbraucher den Mangel beim Produzenten rügt, was oft auch vereinbart wird. Zu beachten<br />
ist, dass die strengen Regeln des Handelsrechts auch dann gelten, wenn der Letzterwerber<br />
nicht Kaufmann ist. In diesem Fall trifft den Vertragspartner des Letzterwerbers die<br />
Obliegenheit, dafür zu sorgen, dass der Rügepflicht ordnungsgemäß nachgekommen wird.<br />
D.h. bei originalverpackter weiterzuleitender Ware, soll die Ware mit Wissen des Verkäufers<br />
vom Käufer als Zwischenhändler originalverpackt an den Endabnehmer weitergeleitet<br />
werden, oder soll der Verkäufer die Waren auf Weisung des Käufers unmittelbar an den<br />
Endabnehmer senden, so muss der Käufer selbst keine Untersuchung vornehmen,<br />
Bemängelungen des Endabnehmers aber sofort an den Verkäufer weiterleiten.<br />
13. Wozu braucht man das Firmenbuch?<br />
Das Firmenbuch (im Folgenden nur noch FB) ist ein von den Gerichten im<br />
Außerstreitverfahren geführtes öffentliches Verzeichnis (Register) über bestimmte, für den<br />
Geschäftsverkehr wichtige Tatsachen zum Zweck der Offenlegung. Das FB trägt zur Publizität<br />
des Wirkens der eingetragenen Rechtsträger bei. Publizitätseffekt wird durch zusätzliche<br />
Bekanntmachungen verstärkt, die aber durch gesetzliche Bekanntmachungsfiktion an<br />
Bedeutung verloren haben.<br />
14. Haben ECG und KSchG denselben Anwendungsbereich? Was steht im ECG? Was heißt „auf<br />
Abruf“?<br />
Das ECG beruht auf der Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr und gilt für<br />
Dienste der Informationsgesellschaft. §3 Z1 ECG versteht darunter weitgehend jeden Verkauf<br />
von Gütern oder die Erbringung von Dienstleistungen, wobei der Dienst elektronisch im<br />
Fernabsatz bereitgestellt wird, und zwar idR gegen Entgelt und auf individuellen Abruf des<br />
Empfängers. Das ECG regelt daher einen weiten Bereich von wirtschaftlichen Tätigkeiten, wie<br />
z.B. den Online-‐Verkauf von Waren, die Online-‐Erbringung von Dienstleistungen durch<br />
Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer usw., Online-‐Finanzdienste, Online-‐<br />
Unterhaltungsdienste, RDB, Suchmaschinen, Hosting-‐Dienste u.v.m. Im Gegensatz zum §5a<br />
KSchG erfasst das ECG nicht nur Verbrauchergeschäfte, sondern auch Dienste von<br />
Unternehmern für Unternehmer (B2B).<br />
Auf Abruf bzw individueller Abruf liegt vor, wenn der Nutzer die Inanspruchnahme des<br />
Dienstes interaktiv auf individuelle Anforderung steuern kann, wie z.B. beim Internet-‐<br />
Einkauf, bei Live-‐Cam-‐Darbietungen, Video on Demand oder Music on Demand. Er fehlt<br />
hingegen bei Web-‐Radio und Web-‐TV.<br />
8
Der Entgelt-‐Begriff hier meint nicht einen iSd Zivilrechts sondern einen sehr viel weiteren.<br />
Der Dienstanbieter muss den Nutzern bestimmte Informationen leicht und unmittelbar<br />
zugänglich und ständig zur Verfügung stellen (§5 ECG). Ein Link an prominenter Stelle mit<br />
Impressum ist dafür hinreichend. Schließt der Dienstanbieter mit den Nutzern Verträge, so<br />
treffen ihn weitergehende Pflichten. Er muss den Nutzern über bestimmte<br />
vertragsabschlussbezogene Umstände klar und verständlich informieren, bevor dieser seine<br />
Vertragserklärung abgibt (§9 ECG). Verwendet der Anbieter AGB, so muss er sie dem Nutz so<br />
zur Verfügung stellen, dass dieser sie speichern und reproduzieren kann (§11 ECG). Der<br />
Dienstanbieter kann bei Verstoß gegen das ECG im Wege der Verbandsklage nach den §§28f<br />
KSchG auf Unterlassung geklagt werden, wenn Verbraucherinteressen beeinträchtigt sind.<br />
Daneben verschafft die Verletzung der Pflichten des ECG dem Dienstanbieter einen<br />
ungerechtfertigten Wettbewerbsvorsprung vor gesetzestreuen Mitbewerbern und bildet<br />
daher einen Wettbewerbsverstoß.<br />
15. Was geschieht mit Forderungen bei Unternehmensänderung?<br />
Bei Unternehmensänderungen oder Unternehmensübergang unterscheidet man zwischen<br />
Einzelrechtsnachfolge und Gesamtrechtsnachfolge. Bei der Einzelrechtsnachfolge müssen<br />
alle Rechtsverhältnisse im „Einzelnen“ übertragen werden. Forderungen müssen zediert<br />
werden. Im Wege der erbrechtlichen Gesamtrechtsnachfolge tritt der Erbe automatisch von<br />
Gesetzes wegen in alle Rechtsverhältnisse des Erblassers. Es gibt auch noch andere, nämlich<br />
die gesellschaftsrechtliche Gesamtrechtsnachfolge. Das sind z.B. Verschmelzung und<br />
Gesamtvermögensübertragung, die Umwandlung nach dem UmwG, die Fälle der Einbringung<br />
nach BWG und VAG und die Spaltung.<br />
16. Was wissen Sie über Zinsen im Unternehmensrecht?<br />
Der allgemein gesetzliche Zinssatz gem §1000 Abs 1 ABGB beträgt 4% p.a. Ebenso sind auch<br />
die Verzugszinsen (§1333 ABGB) 4%. Die unternehmerischen Verzugszinsen sind gem §352<br />
UGB bei Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen zwischen Unternehmern aus<br />
unternehmerischen Geschäften 8%punkte über dem Basiszinssatz. Für beiderseitige<br />
Unternehmergeschäfte können daher im Verzugsfall Zinsen von 8% über dem Basiszinssatz<br />
des jeweiligen Kalenderhalbjahres verrechnet werden. Der Basiszinssatz wird von der EZB<br />
festgelegt und von der OeNB im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht.<br />
Zwischen Unternehmern gilt kein Verbot des ultra alterum tantum gem §353 UGB, wenn es<br />
um Geldforderungen aus unternehmensbezogenen Geschäften geht.<br />
17. Unterschied zwischen Geschäftsführung und Vertretung?<br />
Die Vertretungsmacht regelt das rechtliche Können im Außenverhältnis, die<br />
Geschäftsführungsbefugnis das rechtliche Dürfen im Innenverhältnis zur Gesellschaft. Der<br />
Geschäftsführer einer GmbH ist per Gesetz unbeschränkt und unbeschränkbar mit<br />
Vertretungsmacht ausgestattet, kann aber durch die Gesellschafter im Innenverhältnis in<br />
seiner Geschäftsführungsbefugnis eingeschränkt werden.<br />
Die Formalvertretungsmacht von organschaftlichen Vertretern, haben der Geschäftsführer<br />
der GmbH, der Vorstand einer AG, die vertretungsbefugten Gesellschafter einer OG/KG. Die<br />
Beschränkungen der Vertretungsbefugnis wirken bei der Formalvertretungsmacht der<br />
Organe und der Prokura Dritten gegenüber nicht. Im Innenverhältnis machen sie sich jedoch<br />
schadenersatzpflichtig.<br />
9
18. Kombinationen von Geschäftsführer und Prokuristen im Gesellschaftsrecht?<br />
Sind möglich und fallen unter den Begriff gemischte Gesamtvertretung. Hier darf der<br />
Prokurist nur gemeinsam mit einem organschaftlichen Stellvertreter, einem<br />
vertretungsbefugten Gesellschafter oder sonstigen Dritten vertreten und umgekehrt. Wichtig<br />
ist hier, dass aus Gründen der Erhaltung der autonomen gesellschaftsrechtlichen<br />
Willensbildung und Vertretung die gemischte Gesamtvertretung nicht so konzipiert ist, dass<br />
es den organschaftlichen Vertretern unmöglich gemacht wird, die Gesellschaft auch ohne<br />
Mitwirkung eines Gesamtprokuristen zu vertreten. Der Umfang der gemischten<br />
Gesamtvertretungsbefugnis des Prokuristen reicht hier weiter als die Prokura. Im<br />
Allgemeinen wird angenommen, dass in diesem Fall die Vertretungsbefugnis des Prokuristen<br />
auf das Niveau des organschaftlichen Vertreters angehoben wird.<br />
19. Was versteht man unter dem firmenbuchrechtlichen Publizitätsprinzip?<br />
Hierbei geht es um den Schutz des guten Glaubens Dritter im Geschäftsverkehr. Die nötigen<br />
Regelungen finden sich in §15 UGB.<br />
§15 Abs 1 UGB ist die so genannte negative Publizität. Kurz, was nicht eingetragen ist, gilt<br />
nicht. Dritte sollen gegen die Folgen nicht eingetragener oder nicht bekanntgemachter<br />
Tatsachen geschützt werden. Es geht hier um die Wirkung des Schweigens des Firmenbuchs.<br />
Der Schutz des Dritten fällt erst bei positiver Kenntnis weg, jedoch ist der Dritte nicht zu<br />
Nachforschungen verpflichtet. Er muss also nicht das Firmenbuch einsehen. Ein weiteres<br />
Problem ist das Problem der nicht eingetragenen Vortatsache. Krejci meint hierzu, fehlt es<br />
am durch Eintragung der Vortatsache ausgelösten Rechtsschein, ist firmenbuchrechtlicher<br />
Vertrauensschutz unangebracht. Andere lassen den Schutz auch hier bestehen, was aber<br />
meiner Meinung nach höchst fragwürdig ist. Bei einer Handlungsvollmacht kann es kein<br />
negatives Publizitätsprinzip geben, weil sie gar nicht ins Firmenbuch eingetragen werden<br />
darf, da sie eine eintragungsunfähige Tatsache ist. Der Schutz des §15 Abs 1 UGB greift nur<br />
bei eintragungspflichtigen Tatsachen.<br />
§15 Abs 2 UGB ist die so genannte positive Publizität. Kurz, was eingetragen ist gilt.<br />
Normzweck dieser Bestimmung ist, das sich Dritte eingetragene und bekanntgemachte<br />
Tatsachen gegen sich gelten lassen müssen. Es gibt jedoch eine Schonfristregelung die<br />
besagt, dass die neue Eintragung für 15 Tage keine Rolle spielt, sofern der Dritte Beweist,<br />
dass er die eingetragene Tatsache weder kannte noch kennen musste. Wenn ihm also nicht<br />
zuzumuten ist, dass er das Firmenbuch konsultiert, darf er auf das vertrauen, was er für die<br />
richtige Tatsache hält. D.h. das nach Ablauf der Schonfrist der Firmenbuchstand<br />
außerbücherliche Vertrauenstatbestände unbeachtlich macht. Die Ausnahme bilden hier die<br />
rechtsmissbräuchlichen außerbücherlichen Verhaltensweisen.<br />
§15 Abs 3 UGB regelt die Fälle der Publizität bei ursprünglich unrichtigen Eintragungen. Der<br />
Gesetzgeber positiviert hier den in Lehre und Rsp anerkannten Grundsatz der<br />
Rechtsscheinhaftung für unrichtige Eintragungen. Es wird unterschiedene ob die unrichtige<br />
Eintragung aktiv veranlasst wurde (dann ist kein Verschulden erforderlich) oder ob die<br />
unrichtige Eintragung nicht gelöscht wurde (dann ist Verschulden erforderlich). Die<br />
Beweislast, dass die Unrichtigkeit der Eintragung nicht kausal war für das Handeln des<br />
Dritten oder dass der Dritte die Unrichtigkeit kannte oder kennen musste, trifft den der die<br />
unrichtige Eintragung veranlasst hat.<br />
10
20. Was ist die Immobiliarklausel?<br />
Die so genannten Immobiliarklausel besagt, dass ein Prokurist keine Grundstücke veräußern<br />
oder belasten darf. Er darf jedoch Grundstücke erwerben und den Kaufpreis mit einer<br />
Hypothek sichern, somit wird die Immobiliarklausel teleologisch reduziert.<br />
21. Was ist die Ladenvollmacht?<br />
Die Ladenvollmacht ist eine Art der Anscheinsvollmacht. Wer in einem Laden oder in einem<br />
offenen Warenlager angestellt ist, gilt als ermächtigt zu Verkaufen und Empfangnahmen, die<br />
in einem derartigen Laden oder Warenlager gewöhnlich geschehen (§56 UGB). Laden heißt<br />
jede Verkaufsstätte, auch wenn sie nur vorübergehend zu Verkaufszwecken benützt wird.<br />
Die Bedeutung der Laden und Lagervollmacht geht weit über jenen Rahmen hinaus, den der<br />
gesetzliche Tatbestand prima facie zieht. Denn es geht keineswegs nur um Läden und Lager.<br />
Auch andere spezifische Funktionen und Tätigkeiten, die im Rahmen eines Unternehmers<br />
einem Mitarbeiter zugewiesen werden, sind geeignet, einen entsprechenden<br />
Vollmachtsumfang zu gewähren. Dies schlägt die Brücke zur Verwaltervollmacht, dem wohl<br />
wichtigsten Fall der Anscheinsvollmacht (§1029 ABGB).<br />
22. Was ist die Formalvollmacht? Welche Formalvollmachten kennen Sie?<br />
Ein Beispiel für die Formalvollmacht ist die Prokura. Eine Beschränkung des Umfanges der<br />
Prokura ist Dritten gegenüber (also im Außenverhältnis) unwirksam (§50 Abs 1 UGB). Es liegt<br />
als gerade in der Unbeschränkbarkeit das Wesen der Formalvollmacht. Dirtte sollen sich<br />
nicht auf die Frage einlassen müssen, ob und inwieweit die erteilte Vertretungsmacht durch<br />
anders lautende Ermächtigungen bzw Aufträge eingeschränkt ist. Dies erleichtert den<br />
Geschäftsverkehr.<br />
23. Was ist die Prokura? Welchen Umfang hat sie und wo ist sie geregelt?<br />
Die Prokura (§§48-‐53 UGB) ist eine im FB einzutragende, jederzeit widerrufliche, ihrem<br />
Umfang nach gesetzlich festgelegte, unübertragbare und unbeschränkbare (und deshalb<br />
Formal-‐ ) Vollmacht, die nur ein ins FB eingetragener Unternehmer erteilen kann. Man sagt<br />
der Prokurist ist „alter ego“ des Unternehmens. Damit wird die Bedeutung der Prokura für<br />
den unternehmerischen Geschäftsverkehr hervorgehoben. Die Prokura vereinfacht den<br />
unternehmerischen Geschäftsverkehr. Sie erhöht die Rechtssicherheit durch bessere<br />
Publizität und entlastet den Geschäftsverkehr von hinderlichen privatautonomen<br />
Differenzierungen des Vollmachtumfanges.<br />
24. Welche Arten von Firmen kennen Sie?<br />
Einfache und zusammengesetzte Firmen. Einfach Firmen umfassen lediglich den gesetzlich<br />
vorgeschriebenen Firmenkern. Wird dieser durch Firmenzusätze angereichert, hat man eine<br />
zusammengesetzte Firma. Von solchen Firmenzusätzen ist der auf jeden Fall hinzukommende<br />
Rechtsformzusatz zu unterscheiden. Da aber auch der Rechtsformzusatz ein Firmenzusatz ist<br />
und dieser mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben ist, gibt es keine einfache Firmen mehr. Bis<br />
1.1.2010 mussten alle einfachen Firmen umgestellt werden.<br />
11
Weiters gibt es die Unterscheidung zwischen Personen-‐, Sach-‐ und gemischte Firmen.<br />
Fantasiefirmen enthalten keinen Namen lebender oder bereits verstorbener Personen, sie<br />
bestehen aus erfundenen Wörtern. Wird die Firma neu gebildet dann nennt man sie eine<br />
ursprüngliche Firma. Anders hingegen bei fortgeführten Firmen, diese heißen abgeleitete<br />
Firmen.<br />
25. Was ist ein Unternehmer kraft Rechtsform?<br />
Bei Unternehmern kraft Rechtsform (§2 UGB; man spricht auch von Formunternehmern)<br />
hängt die Unternehmereigenschaft nicht von unternehmerischer Tätigkeit ab, sondern<br />
ausschließlich von der gewählten Rechtsform. Weder auf die unternehmerische Tätigkeit<br />
noch auf eine bestimmte Größe kommt es an, wenn bestimmte Rechtsformen vorliegen.<br />
Entsteht die Rechtsform durch konstitutive Eintragung in das FB (was grundsätzlich der Fall<br />
ist), so ist die Eintragung Entscheidend. §2 UGB hält fest wer gemeint ist: die AG, GmbH, die<br />
Gen, der VVag, die Sp, die EWIV, die SE und die SCE.<br />
26. Was ist Franchising?<br />
Im Frenchisevertrag verpflichtet sich einerseits der Frenchisegeber, dem Frenchisenehmer<br />
Nutzungsrechte an Schutzrechten einzuräumen sowie Know-‐how zur Verfügung zu stellen.<br />
Andererseits verpflichtet sich der Frinchisenehmer, im eigenen Namen und auf eigene<br />
Rechnung die vertraglich bezeichnetet Produkte nach den vorgegebenen Vorstellungen des<br />
Frenchisegebers zu vertreiben und dem Frenchisegeber ein Entgelt zu bezahlen.<br />
Der Frenchisevertrag kombiniert einerseits Elemente des Lizenz-‐ mit solchen des Know-‐how-‐<br />
Vertrages. Frenchiseverträge gibt es in den unterschiedlichsten Bereichen: so in der<br />
Gastronomie, insb bei Schnellimbissketten (McDonald, BurgerKing, Vapiano), bei<br />
Hotelketten, bei Unterrichtsinstituten, Fitnessstudios u.v.m.<br />
Die Übernahme eines gesamten Marketing-‐Konzeptes macht es notwendig, dass der<br />
Frenchisegeber über weit reichende Überwachungs-‐ und Weisungsrechte in Anspruch<br />
nimmt.<br />
27. Welche Prinzipien des Unternehmensrechts kennen sie?<br />
Formfreiheit: Befreiung von nicht erforderlichen Schutz und Formvorschriften. Kein<br />
Verbraucher und Arbeitnehmerschutz für Unternehmer! Jetzt (im<br />
Gegensatz zum HGB) erfordern auch unternehmerische<br />
Bürgschaftserklärungen die Schriftform, weil der Unternehmerbegriff<br />
wesentlich erweitert wurde. Die einzige Ausnahme hierzu existiert<br />
bei Banken, hier ist die Bürgschaft weiterhin formfrei.<br />
Schnelligkeit bei: Z.B. die Regelungen über Selbsthilfeverkauf und Mängelrüge<br />
Abwicklung<br />
Vertrauensschutz: §3 UGB, §15 Abs 1 UGB<br />
Entgeltlichkeit: Im Zweifel gilt Entgeltlichkeit als ausgemacht.<br />
Erweiterte Selbsthilfe: Bei Pfandverwertung, im Annahmeverzug und das unternehmerische<br />
Zurückbehaltungsrecht.<br />
12
28. Wer führt eine Firma?<br />
Der ins FB eingetragene Rechtsträger. Dies kann auch ein Einzelunternehmer sein, sofern er<br />
sich ins FB eingetragen hat.<br />
Wenn man nicht ins FB eingetragen ist, kann man höchstens eine Geschäftsbezeichnung<br />
führen, dies ist der Name des Unternehmens. Der Rechtsschutz einer Geschäftsbezeichnung<br />
beschränkt sich auf den zivilrechtlichen Namensschutz (§43 ABGB) und unter Umständen auf<br />
den Schutz des Wettbewerbs-‐ und Immaterialgüterrechts.<br />
29. Was ist die Firma? Was ist bei der Firmenbildung zu beachten?<br />
Firma heißt der in das FB eingetragene Name eines Unternehmers, unter dem er seine<br />
Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt (§17 Abs 1 UGB). Ein Unternehmer kann im<br />
Verfahren vor Gerichten oder Verwaltungsbehörden seine Firma als Parteibezeichnung<br />
führen und mit seiner Firma als Partei bezeichnet werden. Eine Firma darf nur führen, wer<br />
ins FB eingetragen ist (Die PS ist zwar ins FB eingetragen, hat aber keine Firma sondern einen<br />
Namen). Die Firma dient der Publizität des Wirkens und der Identifizierung des<br />
Unternehmensträgers. Wer unter seiner Firma auftritt lässt erkennen, dass er als<br />
Unternehmer im Geschäftsverkehr teilnimmt und dem Regime des UGB unterliegt. Das<br />
subjektive Recht, eine Firma zu führen, besteht gegenüber jedermann. Es ist also ein<br />
absolutes Recht.<br />
Bei der Firmenbildung gibt es den Grundsatz der freien Firmenbildung. Durch die<br />
Liberalisierung des UGB müssen nur noch die Grundsätze der Kennzeichnungsfähigkeit, der<br />
Unterscheidungsfähigkeit, und des Fehlens der Irreführungseignung eingehalten werden.<br />
Durchbrochen durch das Verbot der Verwendung fremder Namen für Einzelunternehmer<br />
und eingetragenen Personengesellschaften. Es ist auch eine Sach-‐ oder Fantasiefirma<br />
möglich. Achtung, bei Rechtsformen, deren Vermögens und Haftungsordnung nach dem<br />
Trennungsprinzip gestaltet ist, dürfen fremde Namen in die Firma aufgenommen werden.<br />
Hier kann der Eindruck der persönlichen Haftung der in der Firma genannten nicht<br />
entstehen. Weiters existiert der Grundsatz des zwingenden Rechtsformzusatzes. Jeder<br />
eingetragene Unternehmer hat dem Kern seiner Firma einen Rechtsformzusatz beizufügen.<br />
Die Folgen der Nichteinhaltung dieser Grundsätze sind im Firmenschutz gem §37 UGB<br />
geregelt. Es gibt Unterlassungsansprüche für denjenigen, der in seinen Rechten dadurch<br />
verletzt wird, dass ein anderer seine Firma unbefugt gebraucht.<br />
30. Welche konstitutiven Firmenbucheintragungen gibt es?<br />
Die Eintragung des Nichtunternehmers, der OG/KG, der AG, der Gen, der GmbH. Einzutragen<br />
ist die Verschmelzung. Für Beginn des Fristenlaufs bei der Nachhaftung eines ausscheidenden<br />
Gesellschafters ist die Eintragung ins FB konstitutiv, denn ab diesem Zeitpunkt haftet er 5<br />
Jahre (Achtung: Die Eintragung des Ausscheidens ist bezüglich des Ausscheidens aber an sich<br />
nur deklarativ).<br />
31. Ist eine Satzungsänderung im FB einzutragen?<br />
GmbH: Hier ist notarielle Beurkundung und idR ¾ Mehrheitsbeschluss der<br />
Hauptversammlung notwendig (Änderung des Stammkapitals; Änderung des<br />
Unternehmensgegenstandes). Gem §49 Abs 2 GmbHG ist die Eintragung der<br />
Änderung der Geschäftsvereinbarung ins FB konstitutiv. Jede Änderung ist also<br />
sodann von sämtlichen Geschäftsführern zum FB anzumelden.<br />
AG: Die Hauptversammlung muss Satzungsänderungen mit einer ¾ Mehrheit (Kapital-‐,<br />
nicht Stimmenmehrheit) beschließen. Gem §148 AktG hat der Vorstand die<br />
Satzungsänderungen zur Eintragung ins FB anzumelden. Die Änderung hat auch hier<br />
keine Wirkung bevor sie nicht in das FB am Sitz der Gesellschaft eingetragen worden<br />
ist.<br />
13
32. Welche deklarativen Firmenbucheintragungen gibt es?<br />
Eintragung des Einzelunternehmers, Erteilung oder Widerruf der Prokura, Niederlegung der<br />
Geschäftsführung einer GmbH.<br />
33. Gesetzliche Beschränkungen des Prokuristen? Wann kann der Prokurist Grundstücke<br />
veräußern? Darf ein Prokurist Grundstücke erwerben?<br />
Die Prokura ermächtigt zu allen Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäften<br />
und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Unternehmens mit sich bringt (§49 Abs 1 UGB).<br />
Es kommt nicht auf den Gegenstand des konkreten Betriebes an, sondern es sind die<br />
Aktivitäten jedweden bzw irgendeines Unternehmens gemeint.<br />
Erfasst sind grundsätzlich gewöhnlich wie außergewöhnliche Geschäfte. Es kommt nicht<br />
darauf an, ob sie regelmäßig oder nur ausnahmsweise getätigt werden.<br />
Ein Prokurist darf folgende Geschäfte nicht tätigen:<br />
-‐ Veräußerung und Belastung von Grundstücken (§49 Abs 2 UGB; Immobiliarklausel)<br />
-‐ Erteilung einer Prokura (§48 Abs 1 UGB)<br />
-‐ Übertragung der eigenen Prokura auf einen anderen (§52 Abs 2 UGB)<br />
-‐ Anmeldungen zum FB (§12 UGB)<br />
-‐ Unterzeichnung des Jahresabschlusses (§194 UGB)<br />
-‐ Änderung des Gesellschaftsvertrages des Unternehmensträgers<br />
Grundstücke erwerben, verpachten oder vermieten darf der Prokurist schon. Er darf auch<br />
eine Hypothek auf ein neu erworbenes Grundstück aufnehmen, um so den Kaufpreis zu<br />
sichern. Insofern wird die Immobiliarklausel teleologisch reduziert.<br />
Ein Prokurist könnte jedoch mit einer Sondervollmacht für die Veräußerung von<br />
Grundstücken ausgestattet sein. In diesen Fällen agiert er jedoch nicht als Prokurist sondern<br />
als Vertreter.<br />
34. Was sind deklarative und konstitutive Firmenbucheintragungen?<br />
Eine deklarative Firmenbucheintragung wirkt nur rechtsbekundend. Sie ist also keine<br />
Voraussetzung damit das eingetragene Recht überhaupt zustande kommt (Eintragung der<br />
Prokura). Hingegen wirkt eine konstitutive Eintragung rechtsbegründend. Sie ist also eine<br />
Voraussetzung damit ein Recht wirksam entstehen kann.<br />
35. Welche Gesellschaften sind Unternehmer kraft Rechtsform?<br />
-‐ AG<br />
-‐ GmbH<br />
-‐ Gen<br />
-‐ VVaG<br />
-‐ Sp<br />
-‐ EWIV<br />
-‐ SE<br />
-‐ SCE<br />
Die OG/KG sind keine Unternehmer kraft Rechtsform. Sie sind zweckoffen und Unternehmer<br />
dann, wenn sie ein Unternehmen betreiben. Sie sind rechtsfähig aber keine juristische<br />
Person (nur eine quasi juristische Person), weil die keine KSt zahlen müssen.<br />
36. Was ist ein Handelsvertreter?<br />
Nach §1 Abs 1 HVertrG ist Handelsvertreter, wer von einem Unternehmer mit der<br />
Vermittlung oder dem Abschluss von Geschäften ausgenommen über unbewegliche Sachen,<br />
in dessen Namen und für dessen Rechnung ständig betraut ist und diese Tätigkeit selbständig<br />
und gewerbsmäßig ausübt. Handelsvertreter sind Unternehmer iSd §1 UGB.<br />
14
37. Publizitätswirkung des Firmenbuches?<br />
Man unterscheidet eintragungsfähige und eintragungspflichtige Tatsachen. Tatsachen die<br />
nicht einmal eintragungsfähig sind dürfen sie nicht ins FB eingetragen werden.<br />
38. Was passiert mit der Prokura beim Tod des Unternehmers?<br />
Sie endet nicht mit dem Tod des Unternehmers. Dadurch zeigt sich der besondere<br />
Unternehmensbezug der Prokura. Die Prokura endet durch jederzeit möglichen Widerruf<br />
seitens des Vertretenen, Kündigung durch Prokuristen, Tod des Prokuristen, Verlust der<br />
Geschäftsfähigkeit (Achtung: Beschränkte Geschäftsfähigkeit schadet nicht), Konkurs des<br />
Prokuristen, Konkurs des Vertretenen, übertragende Umwandlung und Verschmelzung,<br />
Einbringung und Spaltung, Verlust der Unternehmereigenschaft, Übernahme der Position des<br />
Vertretenen bzw einer Organfunktion.<br />
39. Kann ein Prokurist ein falsus procurator sein?<br />
Der Prokurist hat eine Formalvertretungsmacht, d.h. dass eine Beschränkung seiner<br />
Vertretungsmacht Dritten gegenüber nicht wirkt. Er kann daher niemals ein falsus procurator<br />
sein, weil er, sofern ihm die Prokura wirksam erteilt wurde, seine Vertretungsmacht im<br />
Außenverhältnis nicht überschreiten kann. Der Unternehmer wird durch seine Handlungen<br />
immer verpflichtet, außer im Falle der Kollision.<br />
40. Ich stelle eine Website ins Internet, welche Vorschriften sind zu beachten?<br />
Wenn ich die Website inhaltlich selbst gestalte, dann hafte ich für rechtswidrige Inhalte als<br />
unmittelbarer Täter uneingeschränkt nach UWG, MSchG, UrhG, ABGB,...; Dies gilt nicht wenn<br />
ich nur Inhaber einer Domain bin und nichts mit der inhaltlichen Gestaltung der Website zu<br />
tun habe. Es treffen mich bestimmte Informationspflichten und wenn ich mit den Nutzern<br />
Verträge abschließe, dann muss ich die vertragsabschlussbezogenen Vorschriften des ECG<br />
einhalten.<br />
41. Was ist die Providerhaftung?<br />
Die Providerhaftung ist im ECG geregelt. Die §§13ff ECG beschränken die Verantwortlichkeit<br />
von Dienstanbietern für die Rechtswidrigkeit fremder Inhalte, die sie nur vermitteln, ohne an<br />
der inhaltlichen Gestaltung mitzuwirken. Diese Bestimmungen beschränken nur eine nach<br />
anderen Gesetzen bestehende Gehilfen-‐ oder Mitstörerhaftung.<br />
Accessprovider vermitteln nur Zugang zu einem Informationsnetz oder stellt nur<br />
Leitunsinfrastruktur zur Verfügung, über welche die Inhalte Dritter transportiert werden.<br />
Beispiel für einen Accessprovider wäre die Telekom (mittlerweile A1). Für die<br />
Rechtswidrigkeit solcher bloß durchgeleiteter Inhalte trifft ihn keine Haftung. Die Haftung<br />
von Suchmaschinenbetreibern ist jenen der Accessprovider nachgebildet.<br />
Ein Hostprovider speichert von einem Nutzer eingegeben Informationen in dessen Auftrag,<br />
z.B. als Betreiber eines Online-‐Forums oder eines Gästebuchs. Haftung für gespeicherte<br />
Fremdinhalte tritt nur dann zu, wenn er vom rechtswidrigen Inhalt tatsächliche Kenntnis hat<br />
und er nicht sofort tätig wird, um den Inhalt zu entfernen oder den Zugang zu sperren. Die<br />
Verantwortlichkeit bei Links ist ähnlich der Hostprovider-‐Haftung. Wer durch setzen eines<br />
Links einen Zugang zu fremden Informationen eröffnet, ist für diese verantwortlich, wenn er<br />
von ihrem rechtswidrigem Inhalt tatsächliche Kenntnis hat.<br />
Wer selbst Inhalte ins Internet stellt haftet für rechtswidrige Inhalte als unmittelbarer Täter<br />
uneingeschränkt.<br />
15
42. Schadenersatz im UGB?<br />
Auch im Bereich des Schadenersatzes finden sich unternehmensrechtliche<br />
Sonderregelungen. Der Unternehmer hat seinen Kontakt und Vertragspartner gegenüber für<br />
die Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers einzustehen (§347 UGB). Er hat somit auf<br />
einen besonderen Sorgfaltsmaßstab zu achten. Das entspricht der im bürgerlichen Recht<br />
üblichen rollenspezifischen Konkretisierung der Sorgfaltsmaßstäbe. Ob jemand die Sorgfalt<br />
eines ordentlichen Unternehmers an den Tag legt, wird nach objektiven Gesichtspunkten<br />
beurteilt (objektiver Fahrlässigkeitsmaßstab). Es geht nicht nur um den Grad der<br />
Aufmerksamkeit und des Fleißes, der Unternehmer hat auch dafür einzustehen, dass er über<br />
die für seine Tätigkeit Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt (Garantiehaftung). Der<br />
Unternehmer steht insoweit einem Sachverständigen gleich (§1299 ABGB). Der §347 UGB<br />
erstreckt sich auf Unternehmer, vergleichbare Nichtunternehmer, Gehilfen des<br />
Unternehmers und unternehmensbezogene Geschäfte. Der Umfang der Schadenersatzpflicht<br />
gem §349 UGB ordnet an, dass der aufgrund von Schadenersatzansprüchen aus (auch<br />
einseitigen) unternehmensbezogenen Geschäften zu ersetzende Schaden auch bei leichter<br />
Fahrlässigkeit den entgangenen Gewinn mitumfasst. Anders ist es im Zivilrecht. Weiters gibt<br />
es noch das PHG an dieser Stelle zu erwähnen, welches eine verschuldensunabhängige<br />
Haftung des Unternehmers ist.<br />
43. Was wissen Sie über den Schadenersatz bei Nichterfüllung im UGB?<br />
Der Schadenersatz bei Nichterfüllung ist im §376 UGB geregelt. Es gibt sowohl eine abstrakte<br />
als auch eine konkrete Schadensberechnung. Bei der abstrakten Schadensberechnung ohne<br />
konkretem Deckungsgeschäft ergibt sich der Nichterfüllungsschaden, wenn die Ware einen<br />
Börsen oder Marktpreis hat, aus der Differenz zwischen vereinbarten Preis der Ware und<br />
ihrem Börsen oder Marktpreis zur Zeit und am Ort der geschuldeten Leistung (§376 Abs 2<br />
UGB). Es bedarf weder eines Deckungsgeschäfts noch eines Schadennachweises. Es genügt<br />
die Feststellung, dass sich der Käufer im Fälligkeitszeitpunkt mit gleicher, aber teurerer Ware<br />
hätte eindecken können (fiktiver Deckungs(ver)kauf). Bei konkreter Schadensberechnung<br />
muss aber der Verkauf sofort nach Ablauf der bedungenen Leistungsfrist stattfinden, und<br />
zwar entweder durch öffentliche Versteigerung oder durch einen zu solchen (Ver)Käufen<br />
befugten Unternehmer zum laufenden Preis.<br />
Hat die Ware keinen Börsen oder Marktpreis, so hat der Käufer grundsätzlich nur die<br />
Möglichkeit konkreter Schadensberechnung. Die hier genannten Regeln gelten nicht. Es sind<br />
vielmehr die zivilrechtlichen Regeln maßgebend (§921 ABGB).<br />
44. Was ist der Unterschied zwischen dem Vertragshändler und dem Franchising?<br />
Im Franchisevertrag verpflichtet sich einerseits der Franchisegeber, dem Franchisenehmer<br />
Nutzungsrechte an Schutzrechten einzuräumen sowie Know-‐how zur Verfügung zu stellen.<br />
Andererseits verpflichtet sich der Franchisenehmer, im eigenen Namen und auf eigene<br />
Rechnung die vertraglich bezeichnetet Produkte nach den vorgegebenen Vorstellungen des<br />
Franchisegebers zu vertreiben und dem Franchisegeber ein Entgelt zu bezahlen.<br />
Der Franchisenehmer wird verpflichtet gegen Entgelt die Ausstattung des Franchisegebers zu<br />
übernehmen. Der Franchisegeber rüstet das Unternehmen des Franchisenehmers auf dessen<br />
Kosten im Stil des Franchisegebers auf. Die Übernahme eines gesamten Marketingkonzeptes<br />
macht es notwendig, dass der Franchisegeber weitreichende Überwachungs-‐ und<br />
Weisungsrechte in Anspruch nimmt. Schlichte Vertragshändlerverträge überlassen es meist<br />
dem Vertragshändler, ein eigenes Marketingkonzept aufzubauen. Insoweit unterwirft sich<br />
also der Franchisenehmer weit mehr einem fremden Regime.<br />
16
Der Vertragshändler ist ein Unternehmer, der das Vertriebssystem eines anderen erweitert<br />
insofern, als er es ständig übernimmt, in eigenem Namen auf eigene Rechnung in einem<br />
bestimmten Gebiet die Waren des Vertragspartners zu vertreiben und den Absatz zu fördern,<br />
wobei er im Geschäftsverkehr auch die Firma und Marken des anderen herausstellt.<br />
45. Was sind die Rechtsfolgen beim Unternehmenserwerb und wie sieht es mit den<br />
Haftungsvorschriften aus?<br />
Unternehmen sind Organisationen, rechtlich stellen sie ein Sondervermögen dar. Sie<br />
bestehen also nicht nur aus körperlichen Sachen, auch mannigfaltige Rechtsverhältnisse wie<br />
Verträge, Forderungen, Verbindlichkeiten und Immaterialgüterrecht. Unternehmen sind<br />
häufig Gegenstand des Rechtsverkehrs. Unternehmen können auf die verschiedensten Arten<br />
übertragen werden (Einzelrechts-‐ und Gesamtrechtsnachfolge).<br />
Besondere Schwierigkeiten bereitet die Übertragung des Unternehmens auf ein anderes<br />
Zurechnungssubjekt im Wege der Einzelrechtsnachfolge. Denn in diesen Fällen geht das<br />
Unternehmen nicht uno actu mit all seinen sachen-‐, vermögens-‐ und<br />
immaterialgüterrechtlichen Rechtsbeziehungen auf den Erwerber über sondern muss im<br />
Einzelnen übertragen werden.<br />
In ein paar Verträge tritt der Erwerber jedoch automatisch von Rechts Wegen (z.B.<br />
Mitverträge, Arbeitsverträge, Lizenzverträge und Versicherungsverträge). Aus Gründen des<br />
Gläubigerschutzes gibt es Bestimmungen die den Erwerber zur Haftung für<br />
unternehmensbezogene Verbindlichkeiten heranziehen (§§1409 und 1409a ABGB; §§38ff<br />
UGB).<br />
§1409 ABGB sieht eine Haftung des Unternehmenserwerbers für solche Verbindlichkeiten<br />
des Veräußerers vor, die der Erbwerber kannte oder kennen musste. Diese Regelung ist<br />
zwingend (Rechtsscheintheorie).<br />
§38 Abs 1 UGB ordnet an, dass derjenige, der ein unter Lebenden erworbenes Unternehmen<br />
fortführt, sofern nichts anderes vereinbart ist, zum Zeitpunkt des Unternehmensübergangs<br />
die unternehmensbezogenen, nicht höchstpersönlichen Rechtsverhältnisse des Veräußerers<br />
mit den bis dahin entstandenen Rechten und Verbindlichkeiten übernimmt. Für diese<br />
Verbindlichkeiten bestehende Sicherheiten bleiben jedoch aufrecht.<br />
Zugleich wird festgehalten, dass der Veräußerer für die unternehmensbezogenen<br />
Verbindlichkeiten forthaftet, wobei diese Forthaftung zeitlich begrenzt ist. Der Veräußerer<br />
haftet gem §39 UGB für diese so genannten Altverbindlichkeiten aber nur, soweit sie vor<br />
Ablauf von fünf Jahren nach dem Unternehmensübergang fällig werden. Diese Ansprüche<br />
verjähren binnen drei Jahren. In §38 Abs 2 ist das Mitwirkungsrecht der Restpartei geregelt.<br />
§38 Abs 4 regelt die Haftung des Erwerbers, obwohl diese Fortsetzung ausgeschlossen wird.<br />
Auch diese Regelung ist dispositiv. Sollte sie aber rechtswirksam ausgeschlossen werden, so<br />
muss sie ins Firmenbuch eingetragen werden. Die Haftungsregel §1409 Abs 1 ABGB<br />
bestimmt, wer ein Vermögen oder Unternehmen rechtsgeschäftlich erwirbt, tritt zwingend<br />
(§1409 Abs 3 ABGB) jenen vermögens-‐ oder unternehmensbezogenen Schulden des<br />
Veräußerers bei, die er bei Übergabe kannte oder kennen musste. Leichte Fahrlässigkeit<br />
reicht aus (nahe Angehörige werden vermutet). Der Erwerber wird von der Haftung insoweit<br />
frei, als er an solchen Schulden schon so viel berichtigt hat, wie der Wert des übernommenen<br />
Vermögens oder Unternehmens beträgt. Er haftet pro viribus (§1409 Abs 1 lt Satz ABGB). Die<br />
Firma muss nicht fortgeführt werden.<br />
17
§38 UGB §1409 ABGB<br />
Dispositiv Zwingend<br />
Unbeschränkte Haftung Haftung pro viribus (bis zum Wert der<br />
übernommen Aktive)<br />
Kontinuitätstheorie Haftungsfondstheorie<br />
Gesetzliche Vertragsübernahme Gesetzlicher Schuldbeitritt<br />
Nachhaftungsbegrenzung Keine besondere Verjährungsregel<br />
zugunsten des Veräußerers<br />
46. Welche Geschäfte sind beiderseitige unternehmensbezogene Geschäfte?<br />
Unternehmensbezogene Geschäfte sind alle Geschäfte eines Unternehmers, die zum Betrieb<br />
seines Unternehmens gehören (§343 Abs 2 UGB). Unternehmer meint hier alle Unternehmer<br />
iSd §§1-‐3 UGB. Die Unternehmereigenschaft muss im Zeitpunkt der Geschäftsvornahme<br />
vorliegen. Geschäft meint alle Arten von Rechtsgeschäften und rechtsgeschäftsähnlichen<br />
Handlungen, nicht aber bloße Realakte und gesetzliche Schuldverhältnisse. Zum Betrieb des<br />
Unternehmers gehören alle Geschäfte, die eine unmittelbare Beziehung zur ausgeübten<br />
unternehmerischen Tätigkeit aufweisen. Beiderseitiges unternehmensbezogenes Geschäft<br />
liegt nun vor, wen sich zwei Unternehmer gegenüberstehen.<br />
47. Ist ein gutgläubiger Forderungserwerb möglich?<br />
Nein, da bei einem gutgläubigen Forderungserwerb der Rechtsschein des Besitzes fehlt,<br />
welcher beim Wertpapier aber gegeben ist. Daher ist der gutgläubige Forderungserwerb<br />
unzulässig. Man kann sagen: Rechte sind, auch wenn sie in Beweisurkunden dokumentiert<br />
sind, weit weniger verkehrsfähig als körperliche Sachen, will heißen: nur mit viel – und daher<br />
verkehrsbehindernd – Mühe rechtssicher übertragbar.<br />
48. Welche Arten der Vollmachtserteilung kennen Sie?<br />
-‐ Einzelprokura: Einzelprokura hat wer alleinvertretungsbefugt ist<br />
-‐ Gesamtprokura: Aktivvertretung nur gemeinsam, wenn einer alleine handelt, fehlt es an<br />
der Vertretungsbefugnis (falsus procurator)<br />
-‐ Gemischte Gesamtvertretung: Ein Prokurist darf nur gemeinsam mit einem<br />
organschaftlichen Vertreter, mit einem vertretungsbefugten Gesellschafter, oder mit<br />
einem sonstigen Dritten vertreten. Ein besserer Name ist hierfür die gemischte unechte<br />
Gesamtvertretung<br />
-‐ Halbseitige Gesamtprokura: Wenn ein Prokurist nur gemeinsam mit einem anderen<br />
vertreten darf, dieser aber auch alleine vertretungsbefugt ist<br />
-‐ Halbseitige gemischte Gesamtvertretung: Prinzipalprokura<br />
-‐ Filialprokurist: Prokura nur für Zweigniederlassung, setzt voraus, dass die<br />
Zweigniederlassung unter eigener Firma betrieben wird. Auch der Filialprokurist vertritt<br />
den Rechtsträger des gesamten Unternehmens weil die Zweigniederlassung keine eigene<br />
Rechtspersönlichkeit hat, daher dass die Filialprokura also auch unbeschränkbar ist<br />
können auch wirksame Geschäfte geschlossen werden die über den Aufgabenbereich der<br />
Filiale hinausgehen.<br />
18
49. Gilt eine Bestellung im Internet als wirksam angenommen, wenn der Webshop-‐Betreiber<br />
darauf nicht reagiert?<br />
Grundsätzlich nein, zumal bloßes Schweigen im österreichischen Recht nicht als gültige<br />
Vertragserklärung bzw kann nicht als Vertragsannahme gesehen werden. Daran ändert auch<br />
der Umstand nichts, dass im Anwendungsbereich des Konsumentenschutzgesetzes –<br />
mangels anderer Vereinbarungen – Bestellungen binnen 30 Tagen auszuführen wären.<br />
Unabhängig davon besteht jedoch eine Verpflichtung nach dem ECG, den Eingang einer<br />
Bestellung zu bestätigen.<br />
50. Wann muss bei Vertragsabschluss im Internet ein Rücktrittsrecht gewährt werden?<br />
Die Rücktrittsrechte sind im KSchG geregelt. Ein Rücktrittsrecht besteht daher nur für<br />
Konsumenten, nicht hingegen für Unternehmen. Grundsätzlich steht das Rücktrittsrecht<br />
immer zu, es gibt jedoch eine Reihe sehr detaillierter Ausnahmen. Die wichtigsten<br />
Ausnahmen sind: CDs, DVDs oder Software, wenn diese entsiegelt wurden, maßgefertigte<br />
Waren, und sogenannte Hauslieferungen. Unter Hauslieferungen versteht man die Lieferung<br />
von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs<br />
an den Wohnsitz, an den Aufenthaltsort oder an den Arbeitsplatz des Verbrauchers im<br />
Rahmen häufiger oder regelmäßiger Fahrten wie z.B. Online-‐Pizza-‐Dienst oder ein Online-‐<br />
Lebensmittelmarkt mit Hauszustellung.<br />
Ein Rücktrittsrecht steht sowohl bei Warenkäufen als auch bei Dienstleistungen im Internet<br />
zu. Auch für Dienstleistungen gibt es Ausnahmen. Die wichtigsten sind: Dienstleistungen mit<br />
deren Ausführung dem Verbraucher gegenüber vereinbarungsgemäß innerhalb von 7<br />
Werktagen (gerechnet ab Vertragsabschluss) begonnen wird, sowie sogenannte<br />
Freizeitdienstleistungen, das sind Dienstleistungen in den Bereichen Unterbringung,<br />
Beförderung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie Freizeitgestaltung, wenn der<br />
Zeitpunkt oder der Zeitraum der Erbringung der Dienstleistung bei Vertragsabschluss bereits<br />
fixiert wird wie z.B. eine Hotelzimmerreservierung.<br />
Wie lange ist die Rücktrittsfrist?<br />
Die Rücktrittsfrist beträgt 7 Werktage, wobei der Samstag nicht als Werktag mitzählt. Bei<br />
Warenkäufen beginnt die Rücktrittsfrist mit dem Tag der Empfangnahme der Ware durch<br />
den Konsumenten zu laufen. Bei Dienstleistungen beginnt die Rücktrittsfrist mit dem Tag des<br />
Vertragsabschlusses zu laufen.<br />
Kann sich die Rücktrittsfrist verlängern?<br />
Die Rücktrittsfrist verlängert sich automatisch auf 3 Monate, wenn der Unternehmer seinen<br />
relativ umfangreichen Informationspflichten gem §5e KSchG nicht oder nicht vollständig<br />
nachkommt. Das heißt bei Warenlieferungen, dass spätestens bei zur Auslieferung der Ware<br />
der Konsument über Folgendes informiert ist: Name und Anschrift des Unternehmers,<br />
wesentliche Eigenschaften der Ware, Preise inkl Steuern und Lieferkosten,<br />
Zahlungsbedingungen, Belehrungen über das Rücktrittsrecht, Anschrift für allfällige<br />
Reklamationen sowie Informationen bezüglich allfälligen Kundendiensten und<br />
Garantiebedingungen sowie bei mehr als einjähriger Vertragsdauer die<br />
Kündigungsbedingungen. Diese Informationen müssen auf einem dauerhaften Datenträger<br />
zur Verfügung gestellt werden und müssen reproduzierbar sein.<br />
19
Muss auf das Rücktrittsrecht extra hingewiesen werden?<br />
Ja. Das Rücktrittsrecht steht einem Konsumenten jedoch auch dann zu, wenn er darüber<br />
nicht belehrt wurde. In diesem Fall verlängert sich die Rücktrittsfrist von 7 Tagen auf 3<br />
Monate.<br />
51. Was wissen Sie über die Aufbewahrungspflicht beim Distanzkauf?<br />
§379 UGB regelt die Aufbewahrungspflicht, bei beiderseitig unternehmensbezogenen<br />
Geschäften hat der Distanzkäufer die Pflicht, bestellte, aber beanstandete Ware einstweilig<br />
aufzubewahren. Unbestellte Ware kann unverzüglich auf Kosten dessen zurückgesandt<br />
werden, der die Ware übersandt hat. Droht Verderb und ist Gefahr im Verzug, dürfen die<br />
Waren vom Distanzkäufer verkauft werden (Notverkauf). Der Grund der<br />
Aufbewahrungspflicht ist, dass bis zur Klärung der Frage, auf welche Weise der Verkäufer die<br />
beanstandete Ware wieder zurücknimmt, soll für ihre Verwahrung gesorgt sein. Diese<br />
Bestimmung nützt vor allem dem Verkäufer, denn der erspart sich vorerst die<br />
Rücksendungskosten und hat nur die Kosten der Verwahrung durch den Käufer oder durch<br />
den von diesem bestimmten Verwahrer zu tragen. Verletzt der Käufer die<br />
Verwahrungspflicht, kann das zu Ersatzpflichten führen. Der Verkäufer hat aber allein<br />
deshalb noch nicht das Recht vom Vertrag zurückzutreten. Das Recht zum Notverkauf setzt<br />
voraus, dass die beanstandete Ware verderblich ist und überdies Gefahr im Verzug ist. Der<br />
Notverkauf erfolgt dann im Namen und auf Rechnung des Verkäufers. Der Erlös gebührt dem<br />
Verkäufer (anders als beim Selbsthilfeverkauf).<br />
52. Wann darf ich mich Herman Maier GmbH nennen?<br />
Nur bei Personengesellschaften und Einzelunternehmen gilt der Grundsatz, dass die Firma<br />
nur den bürgerlichen Namen (der persönlich haftenden Gesellschafter) tragen darf – d.h.<br />
wenn damit nicht in ein anderes Namensrecht eingegriffen wird.<br />
53. Welcher Verband klagt bei einer Verbandsklage nach §28 KSchG?<br />
Der Dienstanbieter kann bei Verstößen gegen das ECG im Wege der Verbandsklage nach<br />
§§28ff KSchG auf Unterlassung geklagt werden, wenn Verbraucherinteressen beeinträchtigt<br />
sind. Klagebefugt sind unter anderem der Verein für Konsumenteninformation, die WKÖ und<br />
die Bundesarbeiterkammer.<br />
54. Ist §38 UGB bei Einbringung eines Unternehmens als Sacheinlage anwendbar?<br />
Ja, denn die Einbringung eines Unternehmens als Sacheinlage in eine Gesellschaft zählt zu<br />
dem einem Unternehmensübergang zugrunde liegenden Geschäften unter Lebenden.<br />
55. Was wissen Sie über den Händlerregress?<br />
Gem §933b Abs 1 ABGB hat ein Unternehmer einem Verbraucher Gewähr geleistet, so kann<br />
er von seinem Vormann, wenn auch dieser Unternehmer ist, auch nach Ablauf der Fristen<br />
des § 933 ABGB die Gewährleistung fordern. Dasselbe gilt für frühere Übergeber im<br />
Verhältnis zu ihren Vormännern, wenn sie selbst wegen der Gewährleistungsrechte des<br />
letzten Käufers ihrem Nachmann Gewähr geleistet haben. Der Anspruch ist mit der Höhe des<br />
eigenen Aufwandes beschränkt. Händlerregress gilt nur, wenn ein Verbrauchergeschäft das<br />
Ende der Absatzkette bildet. Die Ansprüche sind innerhalb 2 Monate ab Erfüllung der<br />
eigenen Gewährleistungsfrist geltend zu machen.<br />
20
56. Wer kann bei Verstoß gegen die Firmengründung vorgehen?<br />
Derjenige, der in seinen Rechten dadurch verletzt wird, dass ein anderer eine Firma unbefugt<br />
gebraucht, hat einen Unterlassungsanspruch nach §37 UGB. Überdies stehen einem so<br />
Geschädigten auch Schadensersatzansprüche. Einschreiten des Firmenbuchgerichts setzt<br />
nicht voraus, dass ein anderer in seinen Rechten verletzt wird. Aber gegen denjenigen, der<br />
eine ihm nicht zustehenden Firma gebraucht. Dies zieht Zwangsstrafen gem §24 FBG nach<br />
sich. Der Firmenberechtigte kann den Namensschutz iSd §43 ABGB in Anspruch nehmen.<br />
Nach §9 UWG kann derjenige, der sich einer Firma befugterweise bedient, gegen jemanden<br />
vorgehen, der im Geschäftsverkehr eine Firma so benützt, dass Verwechslungen<br />
hervorgerufen werden können (Unterlassung, Beseitigung, Schadenersatz).<br />
57. Sind Vorbereitungsgeschäfte schon unternehmensbezogene Geschäfte? Was gilt in Bezug<br />
auf Abwicklungsgeschäfte?<br />
Dieses Problem regelt der §343 Abs 2 UGB. Geschäfte die eine natürliche Person vor<br />
Aufnahme des Betriebes ihres Unternehmens zur Schaffung der Voraussetzungen dafür<br />
tätigt, zählen nicht zu den unternehmensbezogenen Geschäften (jetzt auch im UGB wie auch<br />
schon früher im KSchG). Diese Regeln gelten nur für natürliche Personen. Bereitet eine jurP<br />
(z.B. ein IV) ein Unternehmen vor, unterfallen diesbezügliche Vorbereitungsgeschäfte sehr<br />
wohl dem 4. Buch. Dies gilt nicht für OG/KG und auch nicht für §3-‐Unternehmer.<br />
Abwicklungsgeschäfte sind hingegen unternehmensbezogene Geschäfte.<br />
58. Was sind ÖNormen?<br />
ÖNormen sind vom Österreichischen Normungsinstitut (ON) auf Grundlage des NormenG<br />
1971 erarbeitete Richtlinien und dienen als Vertragsschablonen. ÖNormen sind grundsätzlich<br />
unverbindlich, sie können aber uU durch Gesetz und Verordnung für verbindlich erklärt<br />
werden.<br />
59. Wie kann die Prokura beendet werden?<br />
Die Prokura endet durch<br />
-‐ jederzeitigen Widerruf seitens des Vertretenen<br />
-‐ Kündigung durch den Prokuristen<br />
-‐ Tod des Prokuristen<br />
-‐ Verlust der Geschäftsfähigkeit<br />
-‐ Konkurs des Prokuristen<br />
-‐ Konkurs des Vertretenen<br />
-‐ uU bei Beendigung des vertraglichen Grundverhältnisses der Prokura<br />
-‐ übertragende Umwandlung und Verschmelzung<br />
-‐ Einbringung und Spaltung<br />
-‐ Verlust der Unternehmereigenschaft<br />
-‐ Übernahme der Position des Vertretenen bzw einer Organfunktion<br />
Die Prokura endet aber nicht durch den Tod des Vertretenen, hier zeigt sich der besondere<br />
Unternehmensbezug der Prokura.<br />
21
60. Was versteht man unter einer Firmenfortführung?<br />
Wird eine Firma von einem Rechtsnachfolger fortgeführt, spricht man von einer abgeleiteten<br />
Firma. Dass derartige Firmenfortführungen zulässig sind, ermöglicht der Grundsatz der<br />
Firmenbeständigkeit oder Firmenkontinuität.<br />
Fälle der Firmenfortführung sind die Namensänderung, der Unternehmenserwerb, der<br />
Eintritt oder das Ausscheiden eines Gesellschafters oder Gesellschafterwechsels, die<br />
Übernahme eines Gesellschaftsunternehmens durch einen Einzelunternehmer oder durch<br />
Umgründung.<br />
Der Wahrheitsgrundsatz setzt sich jedoch gegenüber dem Kontinuitätsgrundsatz in den<br />
Fällen der Rechtsformzusätze durch. Dies bedeutet, dass der Rechtsformzusatz einer<br />
fortgeführten Firma nicht beibehalten werden darf, wenn der die Firma Fortführende eine<br />
andere Rechtsform hat.<br />
61. Was ist die Rechtsscheinhaftung? Anwendungsfälle und Beispiele? Was versteht man<br />
darunter?<br />
Dem Schutz des Vertrauens auf den gesetzlich festgelegten Umfang der Vertretungsmacht<br />
verwandt sind jene Fälle, in denen der Gesetzgeber selbst dann das Vorliegen einer<br />
Vollmacht unterstellt, wenn rechtsgeschäftlich überhaupt keine erteilt wurde. Trotz Fehlens<br />
einer Vollmacht wird eine solche von Gesetzes wegen vermutet. Hier spricht man dann von<br />
Anscheinsvollmacht. Als Beispiele sein hier genannt die Laden und Lagervollmacht sowie die<br />
Empfangsvollmacht des Überbringers einer Quittung (§56 UGB; §§1029f ABGB).<br />
62. Was wissen Sie über den Schutz von Unternehmensbezeichnungen?<br />
Die Unternehmensbezeichnung ist die Firma. Diese wird durch die §37 UGB, §43 ABGB und<br />
§9 UWG geschützt.<br />
-‐ Unternehmensrechtlicher Firmenschutz: §37 UGB besagt, dass derjenige einen<br />
Unterlassungsanspruch hat, der in seinen Rechten dadurch verletzt wird, dass ein<br />
anderer eine Firma unbefugt gebraucht. Hinzukommen Schadensersatzansprüche<br />
(firmenrechtliche Vorschriften des UGB werden als Schutzgesetze iSd §1311 ABGB<br />
anerkannt), Zwangsstrafen durch das Firmenbuchgericht für denjenigen, der eine ihm<br />
nicht zustehende Firma gebraucht (§24 FBG), Löschung aus dem Firmenbuch (§10 FBG).<br />
-‐ Zivilrechtlicher Namensschutz: Eine Firma ist ein Name. Dem Firmenberechtigten kommt<br />
Namensschutz gem §43 ABGB zu. Dies steht nur dem Namensträger selbst zu. Ansprüche<br />
auf Unterlassung, Beseitigung des gesetzwidrigen Zustandes und bei Verschulden<br />
Schadenersatz. Wird Namensrecht bestritten: Urteilsveröffentlichung und Abgabe einer<br />
öffentlichen Erklärung.<br />
-‐ Wettbewerbsrechtlicher Firmenschutz: Wer im Geschäftsverkehr eine Firma in einer<br />
Weise benützt, die geeignet ist, Verwechslungen mit Unternehmenskennzeichen<br />
hervorzurufen, deren sich ein anderer befugter Weise bedient, kann von diesem auf<br />
Unterlassung, Beseitigung des gesetzwidrigen Zustandes verlangen und bei Verschulden<br />
Schadenersatz.<br />
-‐ Markenrechtlicher Firmenschutz: Firmen dürfen nicht ohne die Zustimmung des<br />
Berechtigten zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen gebraucht werden.<br />
Bei Verstoß hat der Geschädigte Anspruch auf angemessenes Entgelt, Herausgabe der<br />
Bereicherung und Schadenersatz.<br />
22
63. Was ist die positive Publizität wo ist sie relevant und wo ist sie geregelt?<br />
Die positive Publizität ist im §15 Abs 2 UGB geregelt. Dieser besagt, was eingetragen ist gilt.<br />
Ein Beispiel für die positive Publizität ist ein Prokurist dem die Prokura entzogen worden ist,<br />
aber immer noch im Firmenbuch eingetragen ist. Schließt dieser nun ein Geschäft ab so<br />
kommt dieses gültig zustande und der Dritte kann dem Unternehmer diese Tatsache<br />
entgegenhalten.<br />
64. Prokurist der ÖBB hat Züge in China gekauft -‐ ÖBB hat das jetzt geprüft der Prokurist darf<br />
das nicht. Stimmt das?<br />
Die Prokura ist eine unbeschränkbare Formalvollmacht. In dieser Unbeschränkbarkeit liegt<br />
auch ihr Wesen und ihre spezielle Funktion. Der Prokurist ist nur zu ein paar wenigen<br />
Geschäften nicht befugt, aber er darf Kaufverträge abschließen. In diesem Fall kommt also<br />
der Kaufvertrag der Züge gültig zustande, jedoch könnte er sich schadensersatzpflichtig<br />
machen im Innenverhältnis.<br />
65. Sonderformen vom Schadenersatz im UGB im Vergleich zum ABGB?<br />
-‐ Unternehmerische Sorgfaltspflicht: Der Unternehmer hat seinen Vertragspartner<br />
gegenüber mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers einzustehen. Er hat dafür<br />
einzustehen, dass er über die für seine Tätigkeit gebotenen Fähigkeiten und Kenntnisse<br />
verfügt (Garantiehaftung). Er steht insoweit einem Sachverständigen gleich (§1299<br />
ABGB).<br />
-‐ Anwendungsbereich des §347 UGB: Diese besondere Sorgfaltspflicht betrifft alle<br />
Unternehmer größenunabhängig, also auch Unternehmer iSd §3 UGB. Auch bei<br />
vergleichbaren Nicht-‐Unternehmern z.B. Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und<br />
Aufsichtsräte in der GmbH bzw in der AG müssen für Sorgfalt eines ordentlichen<br />
Geschäftsmannes bzw Geschäftsleiters einstehen.<br />
-‐ §347 UGB gilt für Sorgfaltspflichten aus Geschäften eines Unternehmers, die auf seiner<br />
Seite unternehmensbezogen sind. Das bezieht sich nicht auf rein deliktisches Verhalten.<br />
-‐ Umfang der Schadensersatzpflicht (Siehe Frage 42) wird so geregelt, dass der entgangene<br />
Gewinn auch bei leichter Fahrlässigkeit zu ersetzen ist, jedoch gilt das nicht im<br />
deliktischen Bereich.<br />
-‐ Solidarhaftung bei teilbarer Leistung: Gem §889 ABGB ist bei teilbaren Leistungen iZw ein<br />
Teilschuldverhältnis anzunehmen. §348 UGB ordnet demgegenüber iZw Gesamtschuld<br />
an, wenn sich mehrere Unternehmer aufgrund eines unternehmenesbezogenen<br />
Geschäfts gemeinschaftlich zu einer teilbaren Leistung verpflichten.<br />
66. Was regelt das UGB über den Annahmeverzug?<br />
Gem §373 Abs 1 UGB kann der Verkäufer bei Annahmeverzug des Käufers die Ware auf<br />
Gefahr und Kosten des Käufers in einem öffentlichen Lagerhaus oder sonst auf sichere Weise<br />
hinterlegen. Eine Schuldbefreiende Wirkung hat die Hinterlegung jedoch nicht.<br />
Gem §373 Abs 2 UGB besteht das Recht zum Selbsthilfeverkauf. Der Verkäufer ist ferner<br />
befugt, nach vorgängiger Androhung die Ware durch einen dazu befugten Unternehmer<br />
öffentlich versteigern zu lassen. Er kann, wenn die Ware einen Börsen-‐ oder Marktpreis hat,<br />
nach vorgängiger Androhung den Verkauf auch aus freier Hand durch einen dazu befugten<br />
Unternehmer zum laufenden Preis bewirken. Ist die Ware dem Verderb ausgesetzt und<br />
Gefahr im Verzuge, so bedarf es der vorgängigen Androhung nicht. Dasselbe gilt, wenn die<br />
Androhung aus anderen Gründen untunlich ist.<br />
23
Der Ablauf:<br />
1. Vorherige Androhung – außer bei Gefahr im Verzug oder rascher Verderblichkeit der<br />
Ware<br />
2. Öffentliche Versteigerung: Durch öffentliche Kundmachung wird zu allgemeiner<br />
Teilnahme eingeladen (Verkäufer und Käufer dürfen mitbieten)<br />
3. Freihandverkauf: Wenn die Ware einen Börsen oder Marktpreis hat, von einem dazu<br />
befugten Unternehmer (Berechtigung für das Gewerbe der Versteigerung beweglicher<br />
Sachen) zum laufenden Preis.<br />
4. Zeitpunkt: Frühestens zum Liefertermin<br />
5. Benachrichtigung des Käufers vom erfolgten Verkauf<br />
6. Die Rechtsfolgen eines nicht ordnungsgemäßen Selbsthilfeverkaufs sind, dass der Käufer<br />
ihn nicht als für seine Rechnung erfolgt gelten lassen. Der Selbsthilfeverkauf wirkt nicht<br />
schuldbefreiend.<br />
67. Was ist der Scheinunternehmer?<br />
Scheinunternehmer kraft Auftretens ist, wer wie ein Unternehmer auftritt, ohne es zu sein.<br />
Dieser muss sich vom Gutgläubigen wie ein Unternehmer behandeln lassen. Das heißt das<br />
geschlossene Geschäft darf, muss aber nicht, vom Vertrauenden als<br />
unternehmensbezogenes Geschäft gewertet werden. Die Grundlage dafür bildet die<br />
Rechtsscheinhaftung. Wer wie ein Unternehmer auftritt, ohne es zu sein, ist tadelnswert,<br />
weil er den Geschäftsverkehr durch sein zu Fehlschlüssen Anlass gebendes Verhalten irritiert.<br />
Zum Ausgleich hat er sich wie ein Unternehmer behandeln zu lassen. Wenn ein nachhaltiger<br />
objektiver äußerer Tatbestand begründet wird, der den Anschein erweckt, es trete ein<br />
Unternehmer auf, wenn der Rechtsschein auf einem Verhalten beruht, das dem<br />
Auftretenden zurechenbar ist, wenn der Rechtsschein für das Verhalten des Dritten kausal ist<br />
und wenn der Dritte schutzwürdig, weil gutgläubig ist, dann darf man sich auf den Umstand<br />
der Scheinunternehmerschaft kraft Auftretens berufen (Beispiele: Jemand tritt unter einer<br />
Bezeichnung auf, die der einer Firma entspricht, betreibt aber weder ein Unternehmen noch<br />
ist er im Firmenbuch eingetragen; Jemand verwendet Briefpapier, das den Eindruck erweckt,<br />
es sei Geschäftspapier eines Unternehmens).<br />
Der Rechtsschein wirkt für und nicht gegen den Gutgläubigen, er kann also wählen ob es als<br />
unternehmensbezogenes Geschäft gelten soll, oder nicht. Es gilt aber keine Rosinentheorie.<br />
Ob ein einseitiges oder zweiseitiges unternehmensbezogenes Geschäft vorliegt, hängt davon<br />
ab, ob der Gutgläubige auch Unternehmer ist.<br />
68. Freiberufler im UGB?<br />
Dazu gehören Tätigkeiten von eher wissenschaftlichen künstlerischen, religiösen, sozialen,<br />
lehrenden, heilenden oder rechtswahrenden Charakter. Abgrenzungen zu gewerblichen<br />
Tätigkeiten ist schwierig, aber bei Freiberuflern sind eher persönliche Dienste erwünscht,<br />
weil Leistung eng mit seinen persönlichen Fähigkeiten verbunden sind. Grundsätzlich sind<br />
freie Berufe und Land-‐ und Forstwirte nur gewissen Regeln des UGB unterstellt. Sie<br />
unterliegen also dem 2. und 4. Buch des UGB. Die übrigen Regeln des UGB gelten nur bei<br />
freiwilliger Unterwerfung. Eine Pflicht, sich in das Firmenbuch eintragen zu lassen, besteht<br />
für diese Tätigkeiten nicht. Lassen sich Freiberufler (und Land-‐ und Forstwirte) ins<br />
Firmenbuch eintragen, betrifft das nicht die Vorschriften über die Rechnungslegung.<br />
Nachdem jedenfalls auf sie das 2. und das 4. Buch anzuwenden sind und das 3. nie, betrifft<br />
die Unterwerfung nur das erste Buch.<br />
69. Wofür braucht man das Zurückbehaltungsrecht an eigenen Sachen?<br />
Diese Frage bezieht sich auf das Tatbestandsmerkmal des §369 UGB (für beiderseitige<br />
unternehmensbezogene Geschäfte), wonach der Schuldner nicht Eigentümer des<br />
Retentionsgutes sein muss, aber berechtigt, es vom Gläubiger heraus zu verlangen. Z.B. das<br />
Retentionsrecht an der mangelhaften Ware, wenn der Gläubiger Gewährleistungsansprüche<br />
24
hat, etwa nach einer Wandlung. (Die Wandlung führt nicht automatisch zum Rückfall des<br />
Eigentums an den Schuldner [den aus der Gewährleistung Verpflichteten], sondern<br />
begründet nur einen bereicherungsrechtlichen Rückabwicklungsanspruch).<br />
70. Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters?<br />
Nach Beendigung des Vertrages gebührt dem Handelsvertreter ein angemessener<br />
Ausgleichsanspruch, wenn und soweit er dem Unternehmer neue Kunden zugeführt oder<br />
bestehende Geschäftsverbindungen erweitert hat und daraus auch nach Vertragsauflösung<br />
noch wesentliche Vorteile zu erwarten sind und die Ausgleichszahlung unter<br />
Berücksichtigung v.a. der entgehenden Provisionen, der Billigkeit entspricht.<br />
Der Ausgleichsanspruch stellt eine Abgeltung künftig entgehender Provisionen dar. IZw<br />
beträgt der Ausgleichsanspruch höchstens eine Jahresvergütung, die aus dem Durchschnitt<br />
der letzten 5 Jahre errechnet wird. Maßgeblicher Umstand bei der Berechnung sind die dem<br />
Handelsvertreter entgehenden Provisionen. Es kommt nicht nur auf tatsächlich erzielte,<br />
sondern auch auf potenziell erzielbare Vorteile aus den vom Handelsvertreter akquirierten<br />
Geschäftsverbindungen an.<br />
71. Welche Rechtsträger sind ins Firmenbuch einzutragen?<br />
§2 FBG: Einzelunternehmer (nach §8 Abs 1 UGB, wenn sie der Pflicht zur Rechnungslegung<br />
unterliegen), OG/KG, AG, GmbH, Gen, VVaG, Sp, PS, EWIV, SE, SCE und sonstige Rechtsträger,<br />
deren Eintragung gesetzlich vorgesehen sind. Soweit sonstige Rechtsträger (IV, jurP des<br />
öffentlichen Rechts, Religionsgemeinschaften, politische Parteien) ein Unternehmen iSd §1<br />
UGB betreiben, können sie sich schon aufgrund ihrer Unternehmereigenschaft ins<br />
Firmenbuch eintragen lassen. §12 UGB bestimmt, dass ein Rechtsträger, dessen<br />
Hauptniederlassung oder Sitz im Ausland liegt, in das Firmenbuch einzutragen ist, wenn er im<br />
Inland eine Zweigniederlassung hat.<br />
72. Kann man sich die Firmenbucheintragung aussuchen?<br />
Bei Formunternehmern nach §2 UGB und bei OG/KG ist die Firmenbucheintragung<br />
konstitutiv, das heißt sie entstehen erst durch die Eintragung! Bei Einzelunternehmern<br />
besteht grundsätzlich keine Eintragungspflicht, sondern erst wenn man den Schwellenwert<br />
des §189 UGB überschritten hat. Der e.U. der darunter ist kann sich freiwillig eintragen<br />
lassen. GesBR dürfen sich nicht ins Firmenbuch eintragen lassen, aber wenn sie gewerblich<br />
tätig ist und den Schwellenwert des §189 UGB überschreitet, muss sich als OG oder KG<br />
eintragen lassen. Freiberufler sowie Land-‐ und Forstwirte können sich freiwillig eintragen<br />
lassen.<br />
73. Was sind Vorbereitungsgeschäfte?<br />
§343 Abs 3 UGB definiert, Geschäfte, die eine natürliche Person vor Betriebsaufnahme ihres<br />
Unternehmens zur Schaffung der Voraussetzungen dafür tätigt, sind keine<br />
unternehmensbezogenen Geschäfte sondern Vorbereitungsgeschäfte. Auf sie fällt keine<br />
Anwendung des 4. Buches. Achtung, dies gilt nicht für jurP, OG/KG, und Unternehmer iSd §3<br />
UGB.<br />
25
74. Wie regelt das UGB die Haftung für unternehmensbezogene Geschäfte?<br />
Es gibt zweiseitig (beiderseitige) und einseitig unternehmensbezogene Geschäfte.<br />
Grundsätzlich gilt das Unternehmensrecht auch für einseitig unternehmensbezogene<br />
Geschäfte, sofern sich aus dem UGB nichts anderes ergibt, d.h. auch der Nichtunternehmer<br />
untersteht grundsätzlich dem UGB. Aber folgende Regeln gelten nicht für Nicht-‐<br />
Unternehmer:<br />
-‐ Unternehmensbräuche<br />
-‐ Unternehmerische Sorgfaltspflicht<br />
-‐ Ausschluss der laesio enormis<br />
-‐ Regelungen über Zinsen<br />
-‐ Nach hM: Schweigen auf unternehmerische Bestätigungsschreiben<br />
-‐ Unternehmerisches Retentionsrecht<br />
-‐ Mängelrüge<br />
-‐ Aufbewahrungspflicht beim Warenkauf<br />
Zur Haftung für unternehmensbezogene Geschäfte: §347 UGB regelt die unternehmerische<br />
Sorgfaltspflicht. Dies gilt nur zu Lasten der am einseitigen unternehmensbezogenen Geschäft<br />
beteiligten Unternehmer. Dies entspricht einer Garantiehaftung der Unternehmer, weil der<br />
Unternehmer v.a. dafür einzustehen hat, dass er über die für seine Tätigkeit gebotenen<br />
Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt. Der Fahrlässigkeitsmaßstab ist dabei nach Berufs-‐ und<br />
Branchengruppen zu differenzieren. §347 UGB gilt für Sorgfaltspflichten aus Geschäften<br />
eines Unternehmers, die auf seiner Seite unternehmensbezogen sind. Es fallen aber auch<br />
schon Fälle aus culpa in contrahendo und andere Schutzpflichtverletzungen im Rahmen der<br />
geschäftlichen Tätigkeit darunter. §347 UGB bezieht sich aber nicht auf rein deliktisches<br />
Verhalten. Gem §349 UGB ist unter Unternehmern bei einem Schaden aus einem<br />
unternehmensbezogenen Geschäft auch bei leichter Fahrlässigkeit immer der entgangene<br />
Gewinn zu ersetzen.<br />
75. Gibt es Sondervorschriften im UGB für den Bürgschaftsvertrag?<br />
Im HGB als Handelsbürgschaft eigens geregelt, jetzt nicht mehr, es gilt nur noch §1346ff<br />
ABGB. Dadurch entfällt die ehemalige Formfreiheit. Auch unternehmerische<br />
Bürgschaftserklärungen erfordern die Schriftform. Achtung, bei Kreditinstituten als Bürge<br />
wurde die bisherige Formfreiheit beibehalten, da ihnen genügend Bonität zugewiesen wird.<br />
76. Was wissen Sie über die Aufbewahrungspflicht beim Distanzkauf und den telos (Zweck)<br />
dieser Bestimmung?<br />
§379 UGB regelt, dass bei beiderseitigen unternehmensbezogenen Geschäften der<br />
Distanzkäufer die Pflicht hat, bestellte, aber beanstandete Ware einstweilig aufzubewahren.<br />
Beanstandung heißt die Mitteilung, die Ware nicht behalten zu wollen. Mängelrüge muss<br />
deshalb noch keine vorliegen. Unbestellt zugesandte Ware darf sogleich und auf Kosten des<br />
Absenders zurückgesandt werden. Droht Verderb oder Gefahr im Verzug dürfen die Waren<br />
verkauft werden (Notverkauf). Ansonsten soll der Distanzkäufer die Waren bis zur Klärung<br />
der Frage, wie der Verkäufer die beanstandete Ware wieder zurücknimmt oder sonst verfügt,<br />
verwahren. Bestimmung nützt vor allem dem Verkäufer. Er erspart sich vorerst die Rück-‐ und<br />
Weitersendungskosten und muss nur für die Verwahrung des Käufers aufkommen. Der<br />
Käufer muss die Ware gar nicht selbst aufbewahren, sondern darf sie einem verlässlichen<br />
Dritten zur Aufbewahrung geben.<br />
26
77. Was wissen Sie über die Rechtsscheinwirkungen der elektronischen Signatur?<br />
a. Schriftformersatz: Sichere elektronische Signatur erfüllt das rechtliche Erfordernis der<br />
eigenhändigen Unterschrift, insbesondere der Schriftlichkeit iSd §886 ABGB.<br />
a. Ausnahmen von der schriftformersetzenden Wirkung:<br />
i. Bürgschaftserklärung als Privatgeschäft<br />
ii. Willenserklärungen oder Rechtsgeschäfte, die öffentlich beglaubigt oder<br />
beurkundet werden müssen oder notariatsaktpflichtig sind (Wegen<br />
Mitwirkungserfordernisse Dritter).<br />
iii. Willenserklärungen etc., die zu ihrer Eintragung ins Firmenbuch<br />
öffentlich beglaubigt werden müssen oder mit Notariatsakt<br />
iv. Und schriftformersetzende Wirkung ist dispositives Recht (Abbedingung<br />
möglich)<br />
b. Beweiswirkung: Die Vermutung für die Echtheit des Inhalts, dafür, dass die enthaltenen<br />
Erklärungen von der signierenden Person stammen.<br />
c. Haftung der Zertifizierungsstelle: Der Anbieter des Zertifizierungsdienstes haftet dafür,<br />
dass die Angaben im qualifizierten Zertifikat im Zeitpunkt der Ausstellung richtig sind,<br />
weiters für die Einhaltung bestimmter technischer Voraussetzungen.<br />
78. Bei welchen Schlechterfüllungen muss man die Mängelrüge anstellen?<br />
Es muss ein Mangel (Sachmangel) im gewährleistungsrechtlichen Sinne vorliegen, das ist jede<br />
Abweichung vom vertraglich Vereinbarten. Betroffen sind Qualitäts-‐ und Quantitätsmängel<br />
und auch genehmigungsfähige aliud-‐Lieferungen (§378 UGB analog; nicht<br />
genehmigungsfähig ist eine Sache nur, wenn kein Unternehmer mit so einer Ware den<br />
Versuch machen würde, den Vertrag zu erfüllen). Bei einer nicht genehmigungsfähigen aliud-‐<br />
Lieferung ist der Käufer nicht zur Mängelrüge verpflichtet, sondern der Verkäufer befindet<br />
sich im Leistungsverzug. Versteckte Mängel (sind solche die trotz ordnungsgemäßer<br />
Untersuchung der Ware nicht erkennbar sind) lösen die Rügeobliegenheit erst mit<br />
Entdeckung aus.<br />
79. Was ist eine aliud-‐Lieferung?<br />
Das ist eine so genannte Anderslieferung. Die Verschiedenheit der bestellten von der<br />
gelieferten Ware muss nach ihrer Beschaffenheit so erheblich sein, dass ein Unternehmer<br />
nicht versuchen würde, so den Vertrag zu erfüllen. Die gelieferte Ware muss mit der<br />
bestellten nichts mehr gemein haben, krasses Abweichen von der bestellten Ware, d.h. sie<br />
muss für den Zweck des Käufers untauglich sein. Das ist dann nicht gegeben, wenn nur 20%<br />
des Gelieferten die vertraglich vereinbarte Qualität nicht aufweisen. Wenn ein bestimmtes<br />
Material ausgewählt wurde und dann die Herstellung der Ware aus einem anderen Material<br />
erfolgt, stellt das ein nicht genehmigungsfähiges Aliud dar.<br />
80. Welche Schutzrechte werden beim Franchising überlassen?<br />
Der Franchisegeber räumt dem Franchisenehmer Nutzungsrechte an Schutzrechten gegen<br />
Entgelt ein. Insbesondere übernimmt der Franchisenehmer die Ausstattung des<br />
Franchisegebers, das sind Unternehmenskennzeichen iSd §9 UWG. Der Franchisevertrag ist<br />
ein Vertrag, der Elemente des Lizenz-‐ mit solchen des Know-‐How-‐Vertrags kombiniert.<br />
81. Was sind Beispiele für nicht konnexe Rechtsverhältnisse beim Retentionsrecht?<br />
Das UGB erfordert nicht, dass die zurückbehaltenen Sachen im Rahmen gerade jenes<br />
Rechtsverhältnisses dem Gläubiger zugekommen ist, aus dem die offene Forderung stammt,<br />
derentwegen die Sache zurückbehalten wird. Z.B. wenn der Unternehmer eine Sache<br />
zurückbehält, die er für den Schuldner verwahren soll, deshalb, weil der Schuldner ihm eine<br />
mangelhafte Sache geliefert hat, die erst einmal ausgetauscht werden soll im<br />
gewährleistungsrechtlichen Sinne, dann ist die Sache aus der Verwahrung ein Beispiel aus<br />
einer nicht konnexen Forderung.<br />
27
82. Welche wiederkehrenden Prinzipien im Unternehmensrecht kennen Sie?<br />
-‐ Beschleunigung des Geschäftsverkehrs durch Befreiung von nicht erforderlichen Schutz-‐<br />
und Sorgfaltspflichten sowie schnellere und einfachere Abwicklung (siehe<br />
Selbsthilfeverkauf, Notverkauf, Mängelrüge)<br />
-‐ Entgeltlichkeit, denn iZw ist unternehmerisches Handeln entgeltlich (der Unternehmer<br />
macht nichts gratis)<br />
-‐ Erweiterter Vertrauens-‐ und Verkehrsschutz beispielsweise bei Publizitätsvorschriften<br />
(im Firmenbuch) und bei der Stellvertretung.<br />
83. Unterschied zwischen Prokura und organschaftlicher Vertretung?<br />
Die Prokura ist eine Formalvollmacht, die Organe haben eine Formalvertretungsmacht kraft<br />
ihrer Stellung als Organe, sie muss ihnen nicht verliehen werden und kann ihnen, solange sie<br />
Organe sind, nicht entzogen werden. Sonst gilt für beide, dass sie unbeschränkt und<br />
unbeschränkbar sind und bei Verletzungen der Beschränkungen im Innenverhältnis<br />
schadenersatzpflichtig werden.<br />
84. Welche Informationen muss beim Einkauf im Webshop angegeben werden?<br />
§5 ECG regelt die Mindestangaben eines Dienstanbieters an die Nutzer:<br />
-‐ Namen und Firma<br />
-‐ Anschrift der Niederlassung<br />
-‐ Rasche Kontaktaufnahmemöglichkeiten, E-‐Mail Adresse (OGH: zumindest Angabe eines<br />
individuellen Kommunikationsweges<br />
-‐ Firmenbuchnummer und Firmenbuchgericht<br />
-‐ Aufsichtsbehörde<br />
-‐ Kammer, Berufsverband<br />
-‐ Umsatzsteuer-‐Identifikationsnummer<br />
-‐ Die Pflicht von Unternehmern, bei Preisangaben gegenüber Verbrauchern Bruttopreise<br />
auszuzeichnen, folgt aus den §§9 und 13 Preisauszeichnungsgesetz.<br />
85. Wie sieht die Providerhaftung im ECG aus?<br />
Die Bestimmungen haben keinen haftungsbegründenden Charakter, sondern beschränken<br />
die Verantwortlichkeit von Dienstanbietern für die Rechtswidrigkeit fremder Inhalte, die sie<br />
nur vermitteln, ohne an der Gestaltung mitzuwirken.<br />
Accessprovider: Keine Haftung bei bloß durchgeleiteten Fremdinhalten (z.B.<br />
Breitbandanbieter)<br />
Hostprovider: Speichert von einem Nutzer gegebene Infos in dessen Auftrag, für solche<br />
Inhalte haftet er nur, wenn er von dem rechtswidrigen Inhalt tatsächliche Kenntnis hat und<br />
danach nicht sofort tätig wird und den Inhalt entfernt bzw den Zugang sperrt. Für<br />
Schadenersatzansprüche geht es darum, dass dem Dienstbetreiber beim Hosting diese<br />
rechtswidrigen Inhalte offensichtlich sein müssen. Tatsächliche Kenntnis vermittelt nur ein<br />
konkreter Hinweis eines Dritten, unsubstantiierte Hinweise reichen nicht, der Betreiber muss<br />
mit zumutbaren Aufwand den angezeigten Inhalt ausfindig machen können, die Beweislast<br />
für Kenntnis des Providers trägt der Kläger. Offensichtlich ist der rechtswidrige Inhalt nur,<br />
wenn auch ein juristischer Laie die Rechtsverletzung ohne weiter Nachforschung erkennen<br />
kann.<br />
Für welche Ansprüche gilt die Haftungsbegrenzung?<br />
Für Schadensersatzansprüche und Ansprüche aus einem Straftatbestand (StGB). Nach §19<br />
ECG lässt die beschränkte Verantwortlichkeit der Provider gerichtliche oder sonst<br />
behördliche Unterlassungs-‐ und Beseitigungsansprüche unberührt. Das heißt keinen Schutz<br />
gegen Unterlassungsklagen nach dem UWG, MSchG und UrhG.<br />
28
86. Ist es Ihrer Meinung nach zulässig wenn sich jemand ÖBB nennt?<br />
Hierbei könnte es sich um einen Verstoß gegen das Irreführungsverbot handeln. Gem §18<br />
Abs 1 UGB hat die Firma den tatsächlichen Verhältnissen des Rechtsträgers zu entsprechen<br />
und weder zu täuschen noch irrezuführen. Firma soll wahr sein. Personenfirma:<br />
Einzelunternehmer darf nur seinen bürgerlichen Namen und Personengesellschaften dürfen<br />
nur Namen der unbeschränkt Haftenden (wenn sie nicht Sach-‐ oder Fantasiefirma wählen)<br />
annehmen. Sachfirmen müssen dem Gegenstand des Unternehmens entsprechen. Firma<br />
(Firmenzusatz) darf nicht dafür geeignet sein, Täuschung über Art und Umfang des Geschäfts<br />
oder der Verhältnisse des Geschäftsinhabers herbeizuführen. Prüfungsmaßstab orientiert<br />
sich an den angesprochenen Verkehrskreisen, sprich ob diese irregeführt werden.<br />
Täuschungsgefahr festzustellen obliegt dem Firmenbuchgericht. Wird aber seit der<br />
Handelsrechtsreform relativiert, weil im Verfahren vor dem Firmenbuchgericht die Eignung<br />
zur Irreführung nur berücksichtigt wird, wenn sie ersichtlich ist (Grobraster). Die<br />
Feinsteuerung erfolgt über die zivilrechtliche Unterlassungsklage.<br />
87. Unterschied zwischen Handelsvertreter und Vertragshändler?<br />
a) Vertragshändler: keine gesetzliche Definition vorhanden<br />
a. Unternehmer<br />
b. Der das Betriebssystem eines anderen erweitert<br />
c. Dadurch dass er ständig<br />
d. Im eigenen Namen und auf eigene Rechnung<br />
e. In einem bestimmten Gebiet<br />
f. Die Waren des Vertragspartners vertreibt und somit den Absatz fördert<br />
g. Und im Geschäftsverkehr auch die Firmen und Marken des anderen herausstellt.<br />
Der Vertragshändlervertrag zielt darauf ab, die Geschäfte eines anderen zu besorgen,<br />
dabei wird ein Rahmenvertrag geschlossen, aber im Unterschied zum<br />
Handelsvertreter handeln Vertragspartner nicht nur im eigenen Namen, sondern<br />
auch auf eigene Rechnung.<br />
Analoge Anwendung des §24 HVertrG über Ausgleichsanspruch ist nur zu bejahen,<br />
wenn das jeweils zu beurteilende Vertragshändlergeschäft im Wesentlichen dem<br />
eines Handelsvertreters gleicht.<br />
b) Handelsvertreter: Handelsvertreter sind im HVertrG geregelt und sind Unternehmer iSd<br />
§1 UGB.<br />
a. Wer von einem Unternehmer<br />
b. Mit Vermittlung oder Abschluss von Geschäften<br />
c. Ausgenommen über unbewegliche Sachen<br />
d. In dessen Namen<br />
e. Für dessen Rechnung<br />
f. Ständig betraut ist<br />
g. Und diese Tätigkeit selbständig und gewerbsmäßig ausführt<br />
88. Formpflichten im Gesellschaftsrecht ?<br />
Diverse Formvorschriften im Unternehmensrecht<br />
Bsp.: Bürgschaft, Wechsel, zwingende Angaben bei der Anmeldung bzw Eintragung zum<br />
Firmenbuch etc.<br />
29
89. Welche Geschäfte sind beidseitig unternehmensbezogene Geschäfte?<br />
Beiderseitig unternehmensbezogene Geschäfte liegen vor, wenn sich grundsätzlich zwei<br />
Unternehmer iSd §§1-‐3 UGB gegenüberstehen. §343 UGB regelt was<br />
unternehmensbezogene Geschäfte sind. Auch bei einem Scheinunternehemer der mit einem<br />
anderen Unternehmer contrahiert liegt ein zweiseitiges (beidseitiges)<br />
unternehmensbezogenes Geschäft vor.<br />
90. Wie lange hat man Zeit für die Mängelrüge?<br />
Seit der UGB-‐Reform ist binnen angemessener Frist zu rügen. Diese Frist setzt sich zusammen<br />
aus Untersuchungs-‐ und aus Anzeigefrist, iZw hat man 14 Tage Zeit, es kommt aber auf die<br />
Ware an (genauer kommt es auf die Branchenüblichkeit an). Es besteht keine Pflicht zur<br />
Untersuchung, es können dem Käufer auch ohne Untersuchung Mängel bekannt werden.<br />
Gibt es Mängel die erst später gerügt werden müssen?<br />
Bei verborgenen Mängeln gilt die Anzeigeobliegenheit ab Auftauchen des Mangels.<br />
Bei offensichtlichen Mängeln (sind Mängel die ins Auge fallen) entfällt die<br />
Untersuchungsfrist, sie sind sofort anzuzeigen.<br />
Kann man rügen ohne zu prüfen?<br />
Rügen konkreter Mängel auf Verdacht sichert dem Käufer seine Ansprüche, wenn sich sein<br />
Verdacht später bestätigt. Wird aber zu Unrecht auf Verdacht gerügt und erwachsen dem<br />
Verkäufer daraufhin Nachteile, sind diese vom Käufer zu ersetzen. K darf aber bei Verdacht<br />
eines Mangels nicht mit der Rüge warten, bis der Verdacht zur Gewissheit verdichtet hat, der<br />
Mangel muss aber zumindest aus Indizien objektiviert sein. Mängelrüge ist verspätet, wenn<br />
der Käufer trotz erheblicher Anzeichen für das Vorliegen eines Mangels untätig abwartet, bis<br />
sich der Verdacht zur Gewissheit verhärtet.<br />
In welcher Form gibt man die Rüge ab?<br />
Es muss sich um konkrete Mängel handeln, eine Globalrüge („Die Ware ist mangelhaft“)<br />
reicht nicht aus. Die Rüge muss substantiiert sein. Die Mängelrüge kann formfrei abgegeben<br />
werden, also auch konkludent (durch Rücksendung der Ware). Wird schriftlich gerügt<br />
entscheidet fristgerechtes Absenden.<br />
Welche Ansprüche verliert der Käufer bei säumiger Mängelrüge?<br />
-‐ Anspruch auf Gewährleistung<br />
-‐ Auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst<br />
-‐ Ansprüche aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit der Sache, weil die Mängel, die<br />
nicht gerügt wurden, als genehmigt gelten.<br />
Welche Ansprüche stehen dem Käufer trotz versäumter Mängelrüge sehr wohl noch zu?<br />
-‐ Schadensersatzansprüche aufgrund eines Mangelfolgeschadens<br />
-‐ Schadensersatzansprüche aus Delikt<br />
-‐ Auch Ersatzansprüche aus Schäden, die auf einer Verletzung unselbständiger Schutz-‐ und<br />
Sorgfaltspflichten beruhen, stehen zu.<br />
91. Was ist das unternehmerische Bestätigungsschreiben?<br />
Sind im Geschäftsverkehr übliche Mitteilungen über den Inhalt des bereits geschlossenen<br />
Vertrages. Diese wollen aktenkundig machen, was bereits rechtswirksam vereinbart ist.<br />
-‐ Wenn die mündliche Vereinbarung noch zu regelnde Fragen offen ließ ist der Vertrag<br />
noch nicht zustande gekommen und ein die offenen Fragen regelndes<br />
Bestätigungsschreiben ist ein annahmebedürftiges Anbot (den Vertrag iSd Inhalts des<br />
Schreibens zu schließen). So etwas nennt man konstitutives Bestätigungsschreiben.<br />
30
-‐ Ein deklaratives Bestätigungsschreiben bezieht sich auf einen bereits vollständig und<br />
rechtswirksam geschlossenen mündlichen Vertrag, dessen Inhalt zu Beweiszwecken<br />
bestätigt werden soll. Unproblematisch sofern sie mit dem bereits Vereinbarten<br />
übereinstimmen.<br />
-‐ Probleme treten dann auf, wenn das Bestätigungsschreiben den geschlossenen Vertrag<br />
nicht richtig widergibt, sondern ihn verändert bzw ergänzt. Lehre und Rsp haben<br />
Schweigen auf ein abweichendes Bestätigungsschreiben als Zustimmung anerkannt.<br />
-‐ Keine vertragsändernde Wirkung haben jene Bestätigungsschreiben, die so erheblich<br />
vom vereinbarten abweichen, dass der Absender auch nicht mit der Zustimmung des<br />
Empfängers rechnen darf, wenn dieser schweigt.<br />
92. Wer klagt bei einer Verbandsklage? Worauf wird geklagt?<br />
Nur wer die vereinbarten AGB’s für unzulässig hält und sie gerichtlich geltend macht erfasst<br />
die Rechtskraft des Urteils. Andere Vertragspartner können sich darauf berufen,<br />
Rechtswirkung hat sie aber nicht. Deshalb wurde § 28-‐30 KSchG eingeführt, die<br />
Verbandsklage. Ein Unternehmer, der AGB verwendet die gegen gute Sitten bzw Gesetz<br />
verstoßen kann auch von bestimmten Interessensverbänden auf Unterlassung geklagt<br />
werden. Sie verbietet dem Unternehmer die AGB weiterhin zu verwenden à AGB werden aus<br />
dem Verkehr gezogen. Klageberechtigt ist z.B. WKÖ, AK. Die Verbandsklage wird zwar nicht<br />
oft eingesetzt, hat aber dennoch gewisse Kontrolle.<br />
93. Was sind die Folgen von Erwerb und Fortführung eines Unternehmens? Was fällt Ihnen zu<br />
den Haftungsvorschriften ein?<br />
Unternehmen sind Organisationen, rechtlich stellen sie ein Sondervermögen dar. Sie<br />
bestehen aus also nicht nur aus körperlichen Sachen, auch mannigfache Rechtsverhältnisse<br />
wie Verträge, Forderungen, Verbindlichkeiten und Immaterialgüterrechte. Unternehmen sind<br />
häufig Gegenstand des Rechtsverkehrs. Unternehmen können auf die verschiedensten Arten<br />
übertragen werden (Einzelrechtsnachfolge oder Gesamtrechtsnachfolge). Besondere<br />
Schwierigkeiten bereitet die Übertragung des Unternehmens auf ein anderes<br />
Zurechnungssubjekt im Wege der Einzelrechtsnachfolge. Denn in diesen Fällen geht das<br />
Unternehmen nicht uno actu mit all seinen sachen-‐, vermögens-‐ und<br />
immaterialgüterrechtlichen Rechtsbeziehungen auf den Erwerber über, sondern muss im<br />
Einzelnen übertragen werden.<br />
In ein paar Verträge tritt der Unternehmer von Gesetzes Wegen ein, so bei Mietverträgen,<br />
Arbeitsverträgen, Versicherungsverträge und Lizenzverträge. Aus Gründen des<br />
Gläubigerschutzes gibt es Bestimmungen die den Erwerber zur Haftung für<br />
unternehmensbezogene Verbindlichkeiten heranziehen (§1409, §1409a ABGB; §§38ff UGB).<br />
§1409 ABGB sieht eine Haftung des Unternehmenserwerbers für solche Verbindlichkeiten<br />
des Veräußerers vor, die der Erwerber kannte oder kennen musste (bei Familienangehören<br />
wird das Kennen vermutet). Diese Regelung ist zwingend (Rechtsscheintheorie). §38 Abs 1<br />
UGB ordnet an, dass derjenige, der ein unter Lebenden erworbenes Unternehmen fortführt,<br />
sofern nichts anderes vereinbart ist, zum Zeitpunkt des Unternehmensübergangs die<br />
unternehmensbezogenen, nicht höchstpersönlichen Rechtsverhältnisse des Veräußerers mit<br />
den bis dahin entstandenen Rechten und Verbindlichkeiten übernimmt. Für diese<br />
Verbindlichkeiten bestehenden Sicherheiten bleiben aufrecht. Zugleich wird festgehalten,<br />
dass der Veräußerer für die unternehmensbezogenen Verbindlichkeiten forthaftet, wobei<br />
diese Forthaftung zeitlich beschränkt ist, vgl Nachhaftungsbegrenzung gem §39 UGB.<br />
Rechtsfolgen der §§38 und 39 UGB sind folgende, §38 Abs 1 UGB ist dispositiv und somit<br />
kann die Haftung des Erwerbers ausgeschlossen werden.<br />
Die Forthaftung bzw Nachhaftung des Veräußerers ist in §39 UGB geregelt. Der Gesetzgeber<br />
entlässt den Veräußerer also nicht einfach aus seiner Schuld sondern dieser muss zeitlich<br />
begrenzt nachhaften (Schuldbeitritt). Der Veräußerer haftet für diese Altverbindlichkeiten<br />
31
aber nur, soweit sie vor Ablauf von 5 Jahren nach dem Unternehmensübergang fällig werden.<br />
Diese Ansprüche verjähren binnen 3 Jahren.<br />
§38 Abs 2 UGB regelt das Mitwirkungsrecht der Restpartei. §38 Abs 4 regelt die Haftung des<br />
Erwerbers, obwohl diese Fortsetzung der Rechtsverhältnisse ausgeschlossen wird. Auch diese<br />
Regelung ist dispositiv (muss aber ins Firmenbuch eingetragen werden).<br />
Die Haftungsregel des §1409 Abs 1 ABGB bestimmt, wer ein Vermögen oder Unternehmen<br />
rechtsgeschäftlich erwirbt, tritt zwingend (§1409 Abs 3 ABGB) jenen vermögens-‐ oder<br />
unternehmensbezogenen Schulden des Veräußerers bei, die er bei Übergabe kannte oder<br />
kennen musste. Leichte Fahrlässigkeit reicht (nahe Angehörige werden vermutet). Der<br />
Erwerber wird von der Haftung insoweit frei, als er an solchen Schulden so viel berichtigt hat,<br />
wie der Wert des übernommenen Vermögens oder Unternehmens beträgt. Er haftet pro<br />
viribus (§1409 Abs 1 lt Satz ABGB).<br />
94. Welche Geschäfte sind beidseitig unternehmensbezogene Geschäfte?<br />
Unternehmensbezogene Geschäfte sind alle Geschäfte eines Unternehmers, die zum Betrieb<br />
seines Unternehmens gehören (§343 Abs 2 UGB). Unternehmer meint hier alle Unternehmer<br />
iSd §§1-‐3 UGB. Die Unternehmereigenschaft muss im Zeitpunkt der Geschäftsvornahme<br />
vorliegen. Geschäft meinte alle Arten von Rechtsgeschäften und rechtsgeschäftsähnlichen<br />
Handlungen nicht aber bloße Realakte und gesetzliche Schuldverhältnisse.<br />
Zum Betrieb des Unternehmens gehören alle Geschäfte, die eine unmittelbare oder<br />
mittelbare Beziehung zur ausgeübten Tätigkeit aufweisen. Beiderseitiges<br />
unternehmensbezogenes Geschäft liegt nun vor, wenn sich zwei Unternehmer<br />
gegenüberstehen.<br />
95. Was versteht man unter Firmenfortführung? Was sind die Vor-‐ und Nachteile dabei?<br />
Unter Firmenfortführung versteht man wenn eine Firma (Unternehmensbezeichnung) von<br />
einem Rechtsträger auf einen anderen übergeht (Verbot der Leerübertragung). Die Vorteile<br />
der Firmenfortführung sind beispielsweise der good will der Firma. Der Name könnte also<br />
einen wesentlich höheren Wert haben als das Unternehmen an sich (Coca-‐Cola). Die<br />
Nachteile einer Firmenfortführung sind möglicherweise das Irreführungsproblem oder aber<br />
auch bei Personenfirmen, dass der Namensträger der Firmenfortführung zustimmen kann.<br />
Wertpapierrecht<br />
1. Welche Arten von Wertpapieren kennen Sie?<br />
-‐ Inhaberpapiere<br />
-‐ Orderpapiere<br />
-‐ Rekta-‐ oder Namenspapiere<br />
-‐ Einfache Legitimationspapiere<br />
-‐ Beweisurkunden<br />
2. Was ist der Sinn und Zweck von Wertpapieren?<br />
Auch wenn Rechte schriftlich in Urkunden festgelegt sind, bleiben sie eine unkörperliche<br />
Sache gem §292 ABGB. Rechte sind, auch wenn in Beweisurkunden dokumentiert, weit<br />
weniger verkehrsfähig als körperliche Sachen, d.h. dass sie nur mit viel Mühe rechtssicher<br />
übertragbar sind (siehe Zession). Aber das Wirtschaftsleben braucht Begründung von<br />
vermögenswerten Rechten, die dem Schuldner schuldbefreiende Zahlung und dem Dritten<br />
rechtssicheren Erwerb gewährleisten. Daher kam die Festhaltung eines Rechts in einer<br />
Urkunde, der die Qualität eines Wertpapieres zukommt. Mit der wertpapiermäßigen<br />
Verbriefung eines Rechts in einer Urkunde als körperliche Sache wird das unkörperliche<br />
32
Recht verdinglicht. Insofern ist nur mehr der Papierinhaber über das mit Urkunde verbriefte<br />
Recht verfügungsberechtigt. Die Verbriefung schützt ihn also in seiner Inhaberschaft. Da das<br />
Recht jetzt körperlich existent geworden ist, ist es tauglicher Anknüpfungspunkt für den<br />
rechtlichen Verkehrs-‐, Vertrauens, und Gutglaubensschutz geworden.<br />
Ein Wertpapier ist eine Urkunde, in der ein privates Recht in der Weise verbrieft ist, dass zur<br />
Geltendmachung des Rechts die Innehabung der Urkunde erforderlich ist (sogenannte weite<br />
Wertpapierbegriff).<br />
3. Was sind Traditionspapiere?<br />
Mit der Übergabe (ggf. mit Indossament) dieser Traditionspapiere können gleichzeitig auch<br />
dingliche Rechte an der Sache, für die der Herausgabeanspruch besteht, übertragen werden.<br />
Konnossement (Seeladeschein), Lade-‐ und Lagerschein sind zudem Traditionspapiere:<br />
Übergabe kann auch zur Eigentums-‐(Pfandrechts-‐) Übertragung am Gut dienen, dessen<br />
Herausgabe sie verbriefen (Sonderform der Übergabe durch Zeichen). Die hat<br />
wertpapierrechtlich nichts zu tun. Sie ist eine rein sachenrechtliche Funktion, nichts anderes<br />
als eine Sonderform des § 427 ABGB, symbolische Übergabe, Übergabe durch Zeichen.<br />
4. Was sind Orderpapiere?<br />
Orderpapiere bezeichnen den Berechtigten und lauten auf den Namen des ersten<br />
Berechtigten oder dessen Order. Die Übertragung erfolgt nach sachenrechtlichen<br />
Grundsätzen. Zusätzlich zur Übergabe muss auf dem Papier ein Skripturakt gesetzt werden<br />
(das so genannte Indossament). Das Indossament ist eine unterschriebene Erklärung des<br />
Übertragenden, d.h. dass die bisherige Berechtigung des Genannten, auf den von ihm<br />
bezeichnete Person übergehen soll. Vom Indossant durch Übergabe und Indossament auf<br />
den Indossatar.<br />
Neben den Orderpapieren gibt es noch die Inhaberpapiere, dort tritt der Berechtigte in der<br />
Urkunde gar nicht in Erscheinung. Der Text verweist also auf den Inhaber als Berechtigten.<br />
Die Übertragung erfolgt hier nach den sachenrechtlichen Grundsätzen, also einfach durch<br />
Übereignung des Papiers.<br />
Die Haftung des Indossant ist im Art 15 WechselG geregelt.<br />
Wann wird ein Wechsel übertragen als wäre es ein Inhaberpapier?<br />
Bei einem Blankowechsel.<br />
Neben Order und Inhaberpapieren gibt es noch die Rektapapiere. Sie lauten auf einen<br />
bestimmten Berechtigten ohne die Möglichkeit der abstrakten Übertragung durch<br />
Indossament, sondern Übertragung des verbrieften Rechts nach schuldrechtlichen Regeln.<br />
Die §§1392ff ABGB sagen, dass Papierbesitz keine Vermutung für materielle Berechtigung<br />
begründet, die muss vom Gläubiger nachgewiesen werden, d.h. es entfällt die<br />
Legitimationsfunktion zugunsten des Gläubigers. Auch die Gutglaubensschutzfunktion und<br />
die Radierfunktion entfallen. Sperrfunktion und Beweisfunktion bleiben jedoch erhalten.<br />
Wenn Liberationsfunktion bei Rektapapieren vorhanden ist heißen sie qualifiziertes<br />
Legitimationspapier oder hinkendes Inhaberpapier.<br />
33
5. Was wissen Sie über das Indossament?<br />
So nennt man den Übertragungsvermerk auf einem Orderpapier, insbesondere beim<br />
Wechsel. Mit Hilfe des Indossaments überträgt der Inhaber des Orderpapiers (Indossant,<br />
Girant) das Eigentum und damit das Recht aus dem Papier auf den von ihm im Indossament<br />
Genannten (Indossatar, Giratar). Nach dem WechselG hat das Indossament eine dreifache<br />
Wirkung:<br />
-‐ die Rechtsübertragung (Transportfunktion: Alle Rechte aus dem Wechsel werden auf den<br />
Indossatar übertragen)<br />
-‐ die Haftungsübernahme (Garantiefunktion: Der Indossant haftet ebenso wie der<br />
Aussteller dem rechtmäßigen Wechselinhaber für Annahme und Zahlung des Wechsels)<br />
-‐ den Berechtigungsnachweis (Legitimationsfunktion: Eine ununterbrochene Kette von<br />
Indossaments beweist, wer den Wechsel zu Recht besitzt)<br />
Man unterscheidet folgende Arten von Indossaments:<br />
1. Kurz-‐ oder Blankoindossaments bestehen nur aus der<br />
Unterschrift des Indossanten. Es macht den Wechsel zum<br />
Inhaberpapier, da der Empfänger nicht namentlich genannt ist.<br />
2. Durch die sogenannte Angstklausel „ohne Obligio“ schließt der<br />
Indossant für sich jede Mithaftung aus.<br />
3. Rektaindossament: Durch den Zusatz „nicht an Order“<br />
(Rektaklausel) wird die Weitergabe des Wechsels verhindert, der<br />
Indossant haftet dem Indossatar, nicht den weiteren<br />
Nachmännern.<br />
4. Inkassoindossament (Vollmachts-‐ oder Prokuraindossament):<br />
Durch den Zusatz „zum Einzug“ oder „zum Inkasso“ wird der<br />
Wechselempfänger (meist ein Kreditinstitut) nur zum Einzug der<br />
Wechselsumme berechtigt. Eine Haftung trägt er nicht.<br />
5. Pfandindossament: Durch den Zusatz „Wert zum Pfand“ wird<br />
der Wechsel nur zur Sicherung übergeben, der Indossant bleibt<br />
Eigentümer. Eine Weitergabe ist nur zum Inkasso möglich.<br />
6. Was ist ein Blankowechsel?<br />
Ein Blankowechsel wird mit Willen des Ausstellers unvollständig abgegeben, weil er erst<br />
später durch Ausfüllung in einen vollständigen Wechsel verwandelt werden soll. Dem<br />
Blankowechsel fehlen noch ein oder mehrere Bestandteile, diese sollen nach dem<br />
Parteiwillen nachträglich eingesetzt werden. Der Erklärende erteilt dem Empfänger mit dem<br />
Begebungsvertrag die Ermächtigung, das Blankett mit Wirkung gegen ihn auszufüllen. Mit<br />
Begebung wird eine Vereinbarung über die Vervollständigung getroffen, die dem<br />
Wechselnehmer die Ausfüllungsbefugnis verschafft. Die notwendigen Bestandteile des<br />
Wechsels muss dieser spätestens im Zeitpunkt der Geltendmachung der Wechselforderung<br />
enthalten, da ansonsten keine wirksame Wechselforderung besteht. Der Blankowechsel<br />
entfaltet aber bereits vor der vollständigen Ausfüllung wechselrechtliche Wirkungen. Es<br />
können auf ihm wertpapierrechtliche Verpflichtungen eingegangen werden und er ist<br />
übertragbar. Ist bereits ein Begünstigter eingetragen, kann die Übertragung durch<br />
Indossament erfolgen. Auch wenn die Angabe eines Begünstigten fehlt, kann der Wechsel<br />
übertragen werden. In diesem Fall auch allein durch Einigung und Übergabe, verbunden mit<br />
34
der Weitergabe der Ausfüllungsbefugnis. Es liegt keine bloße Abtretung der<br />
Wechselforderung vor, sondern vollgültiger wechselrechtlicher Erwerb. Der Erwerber wird<br />
Eigentümer des Wechsels und kann diesen entsprechend der Ausfüllungsbefugnis<br />
vervollständigen. Weiters kann er akzeptiert werden (Blankoakzept). Mindestanforderungen<br />
für die Begründung einer Wechselverbindlichkeit ist eine Unterschrift auf dem Wechsel als<br />
Aussteller oder Akzeptant.<br />
7. Warum hat man den Wechsel erfunden?<br />
Entstanden ist der Wechsel im Mittelalter. Damals diente der Wechsel als Mittel des<br />
Zahlungsverkehrs zwischen verschiedenen Orten. Der Reisende erhielt einen Wechsel statt<br />
Bargeld, mit einem Zahlungsversprechen (einer Zahlungsanweisung) an einen Bankier in<br />
einem anderen Ort. Der gefährliche Transport von Bargeld wurde so vermieden, weil der<br />
Reisende das Geld am Bestimmungsort bekommen hat. Die ausstellenden Bankiers standen<br />
in Geschäftsbeziehung und verrechneten die eingelösten Wechsel untereinander. Heute hat<br />
der Wechsel weniger Zahlungsfunktion sondern es steht die Kreditfunktion im Vordergrund.<br />
Bis zum Fälligkeitszeitpunkt erhält der Aussteller Kredit.<br />
8. Was ist der Unterschied zwischen Übertragung durch Indossament und Zession?<br />
Indossament Zession<br />
Schriftform (Art 13 Abs 1 WechselG) Keine Schriftform<br />
Muss aus dem Wechsel hervorgehen (Art 13 Muss nicht aus dem Wechsel hervorgehen<br />
Abs 1 WechselG)<br />
Überträgt alle Rechte aus dem Wechsel, das<br />
Recht des Neugläubigers richtet sich nach der<br />
Urkunde, nur beschränkte<br />
Einwendungsmöglichkeiten<br />
WechselG<br />
nach Art 17<br />
Der Indossant haftet für Annahme und<br />
Zahlung (Art 15 Abs 1 WechselG)<br />
Der Indossant haftet jedem Nachmann<br />
unmittelbar (Art 47 Abs 1 und 2 WechselG),<br />
Sprungregress<br />
35<br />
Recht des neuen Gläubigers (Zessionar)<br />
richtet sich nach dem Recht des<br />
Altgläubigers (§1394 ABGB), daher<br />
Einwendungsmöglichkeit nach §1396 ABGB<br />
Haftung für Richtigkeit und Einbringlichkeit<br />
nur bei entgeltlicher Abtretung und nur bis<br />
zum Betrag, den er vom Übernehmer<br />
erhalten hat (§1397 ABGB)<br />
Der Zedent haftet nur dem unmittelbaren<br />
Nachmann (§1397 ABGB), Reihenregress<br />
9. Welche besonderen Indossamentarten kennen Sie?<br />
Neben dem Voll-‐ und Blankoindossament sind noch besondere Arten des Indossaments zu<br />
nennen.<br />
a) Rektaindossament<br />
b) Prokura-‐ oder Inkassoindossament<br />
c) Pfandindossament<br />
d) Garantieindossament<br />
e) Rückindossament<br />
f) Nachindossament
10. Was wissen Sie über den Wechselregress?<br />
Aus dem Wechsel haftet nicht nur der Akzeptant, sondern es haften daneben der Aussteller,<br />
sämtliche Indossanten sowie etwaiger Wechselbürgen. Ihre Haftung ist jedoch nur subsidiär.<br />
Sie haften nur unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dann wenn der Wechsel<br />
„notleidend“ wird. Der Rückgriff ist daher nicht sofort möglich, sondern ist an materielle und<br />
formelle Voraussetzungen geknüpft. Die Voraussetzungen des Rückgriffs sind ein<br />
vorliegender Rückgriffsgrund (Regress mangels Zahlung, Regress mangels Annahme, Regress<br />
mangels Sicherheit) und ein Protest. Der Protest ist die in einer öffentlichen Urkunde erfolgte<br />
Feststellung, dass eine wechselmäßige Leistung (Annahme oder Zahlung) ordnungsgemäß<br />
verlangt wurde, diese aber vom Bezogenen oder Akzeptanten verweigert wurde. Man<br />
unterscheidet entsprechend den Rückgriffsgründen Protest mangels Annahme, mangels<br />
Zahlung und Protest mangels Sicherheit.<br />
Im Weg der Rückgriffshaftung kann der Inhaber des (protestieren) Wechsels den Aussteller,<br />
jeden Indossanten und jeden Wechselbürgen in Anspruch nehmen. Man spricht insoweit<br />
vom Erstrückgriff.<br />
Alle Rückgriffsschuldner haften dabei dem Inhaber als Gesamtschuldner (Art 47 Abs 1<br />
WechselG). Es besteht Solidarhaftung. Der Inhaber kann jeden einzelnen oder mehrere oder<br />
alle zusammen in Anspruch nehmen, ohne an die Reihenfolge gebunden zu sein, in der sie<br />
sich verpflichtet haben. Sie haften jeweils nach ihrer wechselrechtlichen Erklärung.<br />
Das Recht Rückgriff zu nehmen, steht nach Art 47 Abs 3 WechselG dann auch jedem<br />
Wechselverpflichteten zu, der den Wechsel eingelöst hat. Man spricht dabei vom Weitergriff,<br />
Einlösungsrückgriff oder Remboursregress.<br />
11. Welches Wertpapier verbrieft Sachenrechte?<br />
Das Investmentzertifikat. Es wird ein Sondervermögen an Wertpapieren, der<br />
Investmentfonds, gebildet. Darin sind verschiedene Wertpapiere mit unterschiedlichem<br />
Risiko gebündelt (Risikostreuung). Dieser Investmentfonds steht im Miteigentum der<br />
Anteilsinhaber (sachenrechtliche Qualifikation). Zur Beteiligung an diesem Sondervermögen<br />
werden Anteilsscheine ausgegeben (Investmentzertifikate). Sie verbriefen den<br />
Miteigentumsanteil am Investmentfonds und die Rechte der Anteilsinhaber gegenüber der<br />
Kapitalanlagengesellschaft (von ihr wird das Sondervermögen verwaltet) sowie der<br />
Depotbank (dort werden die Wertpapiere, die das Sondervermögen bilden, verwahrt).<br />
Investmentzertifikate verbriefen damit auf ein Sachenrecht (daher sachenrechtliches<br />
Wertpapier). Sie verbriefen einen oder mehrere Anteile am Gesamtvermögen. Je nach Ertrag<br />
der Bewertung der Wertpapiere, die den Fonds bilden, steigt oder verringert sich der Wert<br />
des Investmentfonds und damit auch anteilig der Miteigentumsanteil des Anlegers.<br />
Anteilsscheine sind Wertpapiere und können entweder als Inhaber-‐ oder als Orderpapiere<br />
ausgestaltet sein.<br />
12. Wechsel an eigene Order?<br />
Der Wechsel kann an eigene Order des Ausstellers lauten. Als Begünstigter kann damit auch<br />
der Aussteller selbst genannt werden. Der Aussteller behält damit den Wechsel und kann ihn<br />
wirtschaftlich verwerten, entweder durch Geltendmachung bei Fälligkeit oder durch<br />
Indossament.<br />
36
13. Was wissen Sie über den weiten Wertpapierbegriff?<br />
Ein Wertpapier ist eine Urkunde, in der ein privates Recht in der Weise verbrieft ist, dass zur<br />
Geltendmachung des Rechts die Innehabung der Urkunde erforderlich ist.<br />
14. Enger Wertpapierbegriff<br />
Dieser macht dir Art der Übertragung zum entscheidenden Kriterium für Wertpapiere. Das<br />
verbriefte Recht muss durch Verfügung iSv Übertragung eines Sachenrechts übertragen<br />
werden. Daher zählen hier nur Inhaber-‐ und Orderpapiere dazu, nicht etwa Rektapapiere,<br />
denn hier wird die Forderung schuldrechtlich durch Zession übertragen.<br />
15. Welche Wertpapierfunktionen kennen Sie<br />
-‐ Beweisfunktion: Beweiswirkung einer Urkunde kann drei Aspekte betreffen, nämlich den<br />
Inhalt eines Rechts, seine Übertragung und die Legitimation des Berechtigten. Somit<br />
wirkt das Papier als Beweismittel.<br />
-‐ Liberationsfunktion: Der Schuldner kann mit befreiender Wirkung an jeden Inhaber der<br />
Urkunde leisten. Leistung an den Papierinhaber (= der formell Legitimierte) wirkt<br />
schuldbefreiend, keine Nachprüfung der materiellen Berechtigung jedes Mal. Art 40 Abs<br />
3 WechselG regelt, dass der Schuldner aus dem Wechsel, der bei Fälligkeit an den formell<br />
Legitimierten zahlt, von seiner Verbindlichkeit befreit wird, es sei denn er handelt<br />
arglistig oder grob fahrlässig.<br />
-‐ Sperrfunktion: Schuldner kann nur gegen Vorlage des Papiers leisten. Der Gläubiger der<br />
das Papier in der Hand hat, kann die Forderung nicht mehr verlieren. Damit wird eine für<br />
den Umlauf der Forderung nachteilige Zessionsregel ausgeschlossen. Der neue Gläubiger<br />
trägt nicht mehr das Risiko, dass der Schuldner noch an den alten Gläubiger zahlt und er<br />
dadurch die Forderung verliert. Schuldner ist Zug um Zug gegen Herausgabe des Papiers<br />
zur Leistung verpflichtet. Diese Funktion markiert nach hA die Grenze zwischen<br />
Wertpapier und sonstigen Rechte dokumentierenden Urkunden (weiter<br />
Wertpapierbegriff).<br />
-‐ Legitimationsfunktion zugunsten des Gläubigers: Der Schuldner muss an Papierinhaber<br />
leisten, soweit er nicht dessen Nichtberechtigung nachweist. Der Gläubiger braucht seine<br />
Berechtigung nicht mehr gesondert nachweisen. Der Papierinhaber gilt als formell<br />
legitimiert, dies begründet die widerlegliche Vermutung der materiellen Berechtigung.<br />
-‐ Gutglaubensschutzfunktion: Der Übernehmer der Forderung kann sich darauf verlassen,<br />
dass der Papierinhaber der Berechtigte ist. Wegen des Besitzes der Urkunde<br />
(Vertrauensgrundlage) sind die Regeln über den gutgläubigen Eigentumserwerb<br />
anzuwenden. Hat der Erwerber einen gültigen Titel erwirbt er allein aufgrund seines<br />
guten Glaubens Eigentum am Wertpapier.<br />
-‐ Garantie bzw Gewährleistungsfunktion (Radierfunktion): Bestimmte Wertpapiere<br />
garantieren dem rechtmäßigen Inhaber, dass das Recht in dem Umfang, der in der<br />
Urkunde verbrieft ist, tatsächlich besteht und dagegen grundsätzlich keine<br />
Einwendungen erhoben werden können. Nicht aus dem Papier ersichtliche<br />
Einwendungen uU gegenüber früheren Inhaber, sind ausradiert.<br />
16. Was ist der rückläufige Wechsel?<br />
Als rückläufiger Wechsel wird ein Wechsel bezeichnet, wenn keine Zahlung erfolgt,<br />
Protesterhoben wird und der Wechselregress einsetzt.<br />
37
17. Ist der GmbH-‐Geschäftsanteil ein Wertpapier?<br />
Gem §75 GmbhG bestimmt sich der Geschäftsanteil nach der Höhe vom Gesellschafter<br />
geleisteten Stammeinlage, er stellt das Mitgliedschaftsrecht an der GmbH mit allen Rechten<br />
und Pflichten dar. §75 Abs 3 besagt, dass wenn dem Gesellschafter über seine Beteiligung<br />
eine Urkunde ausgestellt wird, die Übertragung durch Indossament wirkungslos sei. Auch<br />
dürfen diese Urkunden keine Inhaberpapiere sein. Daher ist der Geschäftsanteil jedenfalls<br />
einmal kein Inhaber-‐ und kein Orderpapier.<br />
18. Was sind die Bestandteile des Wechsels?<br />
Es gibt einige Formerfordernisse. Der Wechsel ist streng formgebunden gem Art 1 WechselG.<br />
-‐ Wechselklausel: Bezeichnung als Wechsel im Text der Urkunde. Fehlt die Wechselklausel<br />
so liegt kein gültiger Wechsel vor.<br />
-‐ Zahlungsklausel: Ist die unbedingte Anweisung, eine bestimmte Geldsumme zu bezahlen.<br />
Der Wechsel ist zunächst ungültig wenn die Zahlungsklausel fehlt oder die Anweisung<br />
von einer Bedingung abhängig gemacht wird (der Wechsel ist bedingungsfeindlich). Die<br />
Geldsumme muss ausdrücklich bestimmt sein (Bestimmbarkeit reicht also nicht aus). Der<br />
Wechsel ist auch dann ungültig wenn die Währung fehlt. Die Wechselsumme entweder<br />
in Ziffern oder in Buchstaben (Weichen die Buchstaben von den Zahlen ab, so gilt im<br />
Zweifel die Buchstabenangabe). Grundsätzlich müssen alle Bestandteile der<br />
Wechselsumme bereits in der Wechselsumme aufgenommen werden.<br />
-‐ Bezogener: Ist der Namen dessen, der zahlen soll (Trassaten). Es genügt der mögliche<br />
Name einer natürlichen oder jurP, die als wechselrechtsfähig gedacht werden kann. Den<br />
Bezogenen muss es gar nicht geben, wird also eine nicht existierende Person<br />
eingetragen, so nennt man den Wechsel Kellerwechsel. Eine Annahme kommt hier gar<br />
nicht in Betracht, aber der Wechsel bleibt gültig und es haften Aussteller und allfällige<br />
Indossanten.<br />
-‐ Begünstigter: Ist der Name dessen, an den oder dessen Order gezahlt werden soll<br />
(Remittent). Ein Wechsel ohne Angabe des Remittenten ist unwirksam, ein Wechsel der<br />
auf Inhaber lautet ist nichtig. (Wechsel als geborenes Orderpapier kann niemals ein<br />
Inhaberpapier sein)<br />
-‐ Unterschrift des Ausstellers: Die Unterschrift muss eigenhändig und auf der Vorderseite<br />
abgegeben werden, sie muss den gesamten Text decken. Aus der Unterschrift resultiert<br />
zusammen mit dem Begebungsvertrag die wechselrechtliche Haftung des Ausstellers. Er<br />
haftet grundsätzlich für Annahme und Zahlung, nur Haftung für Annahme kann durch<br />
eine Angstklausel ausgeschlossen werden.<br />
-‐ Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung: Fehlt der Ausstellungstag, ist der<br />
Wechsel nichtig. Gilt grundsätzlich auch für den Ausstellungsort, aber dieser kann durch<br />
Ort, der beim Namen des Ausstellers steht ersetzt werden.<br />
-‐ Angabe der Verfallszeit: Jener Zeitpunkt, zu dem der Wechsel bezahlt werden soll<br />
(Fälligkeitszeitpunkt der Wechselforderung).<br />
19. Was ist ein Blankoindossament?<br />
Ein Blankoindossament bezeichnet den neuen Berechtigten nicht namentlich (im Unterschied<br />
zum Vollindossament). Gem Art 13 Abs 2 WechselG muss das Indossament den Indossatar<br />
nicht bezeichnen und kann selbst in der bloßen Unterschrift des Indossanten bestehen. Hier<br />
muss das Indossament aber auf der Rückseite oder auf dem Anhang des Wechsels gesetzt<br />
38
werden zur Unterscheidung von anderen wechselrechtlichen Erklärungen (z.B. im<br />
Unterschied zu einer Wechselbürgschaft). Ein Blankoindossament ist völlig gültig. Derjenige,<br />
der den Wechsel durch Blankoindossament vom bisherigen Inhaber erwirbt, wird Eigentümer<br />
des Wechsels und der Wechselforderung. Das ist ausreichend um die Geschlossenheit der<br />
Indossamentenkette herzustellen. Derjenige der den Wechsel durch Blankoindossament<br />
erhalten hat, kann zunächst das Indossament vervollständigen. Dadurch wird es zum<br />
Vollindossament. Er kann aber auch nach Blankoindossament ein weiteres Indossament<br />
setzen, dies kann entweder ein Vollindossament sein oder ein weiteres Blankoindossament<br />
sein. Die entscheidende Wirkung des Blankoindossaments ist die, dass der Inhaber des<br />
Wechsels ihn nun auch durch bloße Einigung und Übergabe übertragen kann (blanke<br />
Übergabe). Darin liegt keine Abtretung, sondern ein vollgültiger Erwerb des Wechsels. Die<br />
bloße Übereignung des Wechsels nach einem Blankoindossament hat den Vorteil, dass die<br />
Unterschrift des Überträgers des Wechsels auf dem Wechsel überhaupt nicht erscheint.<br />
Daher haftet er auch nicht wechselrechtlich für Annahme und Zahlung. Der Nachteil davon<br />
ist, dass der Wechsel nun Allfälliger für Veruntreuungen wird.<br />
20. Was wissen Sie über den Wechseldiskont?<br />
Unter Wechseldiskont versteht man den Erwerb bzw Verkauf eines noch nicht fälligen<br />
Wechsels unter Abzug der Diskont-‐ oder Zwischenzinsen (sowie Provision und Unkosten) an<br />
bzw von einem Kreditinstitut. Banken können Wechsel wiederum an die Österreichische<br />
Nationalbibliothek rediskontieren (Rediskont-‐ oder Eskontgeschäft).<br />
Die Voraussetzungen für die Diskontierbarkeit eines Wechsels ist der Warenwechsel, lautend<br />
auf Euro und Fälligkeit innerhalb von 3 Monaten vom Ankaufstag an gerechnet (sog<br />
Dreimonatskonzept) sowie die Haftung (aus dem Wechsel) von wenigstens zwei<br />
zahlungsfähigen Personen (z.B. Aussteller und Bezogener).<br />
Worin liegt die Attraktivität des Wechseldiskontgeschäfts, das zu den Bankgeschäften zählt?<br />
Beide Parteien des Grundgeschäfts und das beteiligte Kreditinstitut können Vorteile<br />
verbuchen. Der Käufer profitiert vor allem von der Kreditierung des Kaufpreises und von der<br />
damit einhergehenden Möglichkeit, bargeldlos zahlen zu können. Das dadurch<br />
eingegangene, höhere, Risiko des Verkäufers hält sich in Grenzen, zumal das Kreditinstitut<br />
nicht jeden Wechsel diskontiert, vielmehr Voraussetzungen gestellt werden, und zudem die<br />
formelle und materielle Wechselstrenge seiner Sicherheit dienen. Durch die<br />
Diskontierbarkeit des Wechsels bedeutet dieser für den Verkäufer fast soviel wie Bargeld.<br />
Der Verkäufer muss also nicht bis zum Verfallstag des Wechsels (seine Fälligkeit) warten, bis<br />
er zu seinem Geld kommt. Das Kreditinstitut macht schließlich ein Geschäft (§1 Abs 1 Z4<br />
BWG) und kann seinerseits an die Österreichische Nationalbank rediskontieren.<br />
21. Was ist der Ladeschein und was für ein Recht verkörpert er?<br />
Der Ladeschein ist ein unternehmerisches Wertpapier gem §363 UGB, er gehört zur Gruppe<br />
der Wertpapiere des Fracht-‐ und Lagerrechts und dient der Verfügung über Güter, die sich<br />
auf dem Transport auf dem Land oder Binnengewässer befinden. Der Frachtführer<br />
verpflichtet sich, das Frachtgut an denjenigen auszugeben, der den Ladeschein zurückgibt.<br />
Der Ladeschein kann durch Indossament übertragen werden und gehört somit (wie das<br />
Konnossement) zu den „gekorenen Orderpapieren“.<br />
39
Der Absender kann vom Frachtführer nach Übernahme des Transportgutes die<br />
Unterzeichnung eines Ladescheins verlangen (Rechtsgrundlage dafür wäre §444 HGB). Die<br />
Ausfertigung erfolgt in der Regel in einem Original und einer Abschrift, die anstelle eines<br />
Frachtbriefs als Begleitbrief in den Händen des Frachtführers verbleibt.<br />
Die Bedeutung davon ist die Empfangsbescheinigung, das Beförderungsversprechen, das<br />
Warenwertpapier (Traditionspapier), die Beweisurkunde über den Abschluss eines<br />
Transportvertrages sowie das Auslieferungsversprechen gegen Rückgabe des Originals.<br />
Der Ladeschein verkörpert einen Herausgabeanspruch sowie die sachenrechtliche<br />
Bedeutung. Ist das Gut durch den Verfrachter oder Lagerhalter übernommen worden, hat die<br />
Übergabe des Papiers an denjenigen, der durch das Papier zur Empfangnahme legitimiert<br />
wird, dieselbe Wirkung wie die Übergabe des Gutes. Nach dem Konzept des ABGB ist das ein<br />
Fall der Übergabe durch Zeichen nach §427 ABGB. Die Übergabe des Papiers ersetzt damit<br />
die körperliche Übergabe als Modus der sachenrechtlichen Übertragung.<br />
22. Was ist der Lagerschein?<br />
Der Lagerschein ist ein unternehmerisches Wertpapier gem §363 UGB. Er findet im<br />
Lagergeschäft Verwendung und verbrieft einen Herausgabeanspruch hinsichtlich der<br />
eingelagerten Güter. Der Lagerschein ist eine vom Lagerhalter ausgestellte Urkunde, in der er<br />
erklärt, die Güter zur Einlagerung empfangen zu haben und sich verpflichtet, sie gegen<br />
Aushändigen des Lagerscheins auszuliefern. Der Lagerschein enthält eine<br />
Empfangsbestätigung über das Lagergut und eine Auslieferungsverpflichtung gegenüber dem<br />
legitimierten Inhaber.<br />
23. Erklären Sie den gutgläubigen Erwerb im Wertpapierrecht.<br />
Den gutgläubigen Wechselerwerb regelt Art 16 Abs 2 WechselG. Der gutgläubige<br />
Wechselerwerb des Nichtberechtigten ist ein Sonderproblem der Transportwirkung des<br />
Indossaments (d.h. dass das Recht des Erwerbers des Wechsels sich grundsätzlich nach dem<br />
Inhalt der Urkunde richtet). Ist der Wechsel einem früheren Inhaber „irgendwie abhanden<br />
gekommen“ (weite Auslegung, z.B. Verlust, Diebstahl, Veruntreuung u.ä.), dann ist der neue<br />
Inhaber, der sein Recht durch eine ununterbrochene Indossamentenkette nachweist, zur<br />
Herausgabe nur verpflichtet, wenn er ihn im bösen Glauben erworben hat oder ihm beim<br />
Erwerb grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Unerheblich ist, auf welche Weise der Vormann<br />
den Wechsel erlangt hat. Der gute Glaube des Erwerbers ist ausgeschlossen, wenn er den<br />
Wechsel bösgläubig erwirbt oder ihm beim Erwerb grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Leichte<br />
Fahrlässigkeit schadet (anders als im ABGB) nicht. Der gute Glaube muss nur zum<br />
Erwerbszeitpunkt vorliegen. Andere Mängel als das fehlende Eigentum bzw die fehlende<br />
Verfügungsbefugnis werden vom Art 16 Abs 2 nicht geheilt.<br />
24. Was ist eine Indossamentenkette und wie sieht sie aus?<br />
Zur Legitimation des Indossanten, der ein Wertpapier übergeben will, ist außer Vorlage noch<br />
eine lückenlose Kette von Übertragungsvermerken notwendig, die vom jetzigen Berechtigten<br />
bis zum ersten namentlich angegebenen Berechtigten zurückführen muss. Der Schuldner ist<br />
verpflichtet an den im Papier Benannten oder an den Inhaber, zu dem eine geschlossene<br />
Indossamentenkette hinführt, zu leisten.<br />
40
25. Was sind Effekten und welche Art von Wertpapieren sind sie?<br />
Effekten sind Wertpapiere des Kapitalmarktes und dadurch gekennzeichnet, dass sie in<br />
großer Zahl mit gleichem Inhalt ausgegeben werden. Sie sind vertretbar. Aus der Sicht des<br />
ausgebenden Unternehmers, des Emittenten, diesen sie der Kapitalaufbringung, aus Sicht<br />
der Anleger der Kapitalanlage. Effekten sind vertretbare Wertpapiere die der Kapitalanlage<br />
dienen und sind durch einen periodischen oder einmaligen Ertrag gekennzeichnet. Die Aktie<br />
und die Inhaberschuldverschreibungen sind die wichtigsten Wertpapiere des Kapitalmarktes.<br />
Inhaberschuldverschreibungen und Inhaberaktien sind Inhaberpapiere. Die Namensaktie ist<br />
ein Orderpapier. Somit erfolgt die Übertragung nach sachenrechtlichen Grundsätzen.<br />
Inhaberaktien und Namensaktien können in einer AG nebeneinander bestehen. Das ist nicht<br />
so wenn es darum geht, wie die Aktie ausgegeben werden soll. Also entweder als<br />
Nennbetrags-‐ oder als Stückaktie.<br />
26. Was ist eine Namensaktie?<br />
Die Namensaktie ist ein Orderpapier, bis zur vollen Leistung der Einlage dürfen nur<br />
Namensaktien ausgegeben werden, keine Inhaberaktien. Inhaberaktien werden durch<br />
Einigung und Übergabe (in Verbindung mit dem Begebungsvertrag) übertragen. Bei<br />
Namensaktien erfolgt die Übertragung durch Indossament. Namensaktien sind unter<br />
Bezeichnung des Inhabers in das Aktienbuch der Gesellschaft einzutragen, Übertragung der<br />
Namensaktie ist der Gesellschaft zu melden, Eintragung im Aktienbuch hat nur Wirkung<br />
gegenüber der Gesellschaft, d.h. der Gesellschaft gegenüber gilt als Aktionär, wer ins<br />
Aktienbuch eingetragen ist. Weil die Übertragung durch Indossament ohne weiteres möglich<br />
ist und keine eigenen Orderklausel notwendig ist, ist die Namensaktie ein geborenes<br />
Orderpapier.<br />
27. Akzept eines Wechsel, was versteht man darunter?<br />
Die Ausstellung eines Wechsels alleine begründet noch keine Zahlungsverpflichtung des<br />
Bezogenen, es ist eine Annahme erforderlich, welche Akzept genannt wird. Durch die<br />
Annahme wird der Bezogene Hauptschuldner. Es können aber auch nicht angenommene<br />
Wechsel ausgestellt werden. Bis zum Verfallszeitpunkt kann der Wechsel vorgelegt werden.<br />
Die Annahmeerklärung besteht aus einem spezifischen Skripturakt auf der Urkunde (Akzept)<br />
und dem Begebungsvertrag. Die Annahme muss schriftlich erfolgen und ist vom Bezogenen<br />
zu unterschreiben. Auch ein Teilakzept ist zulässig, ein bedingter aber nicht (Verweigerung).<br />
28. Was ist die Haftung ohne Akzept?<br />
Wechselregress. Der Rückgriffsgrund ist Regress mangels Annahme. Der Inhaber des<br />
Wechsels kann hier auch vor Verfall Rückgriff nehmen, wenn die Annahme ganz oder gar<br />
teilweise verweigert wird. Die Zahlung ist zwar noch möglich, aber unwahrscheinlich, deshalb<br />
kann der Inhaber bereits vor Verfall den Rückgriffsschuldner in Anspruch nehmen. Die<br />
Voraussetzung ist, dass der Wechsel dem Bezogenen ordnungsgemäß zur Annahme<br />
vorgelegt wurde (Wechsel ist dem Bezogenen an seinem Wohnort bzw in seinen<br />
Geschäftsräumen vorzulegen). Möglichkeit zur Vorlegung ab Ausstellungstag bis zum<br />
Verfallstag. Ab Verfallstag kann Inhaber nur noch Zahlungen verlangen.<br />
41
29. Ist der Wechsel ein geborenes Orderpapier?<br />
Ja der Wechsel ist ein geborenes Orderpapier, denn er kann einfach durch Indossament<br />
übertragen werden, ohne dass es dazu einer Orderklausel bedarf.<br />
Geborene Orderpapiere Gekorene Orderpapiere<br />
Wechsel, Namensscheck, Namensaktie,<br />
Namensanteilscheine von<br />
Investmentgesellschaften<br />
42<br />
Unternehmerische Wertpapiere gem §363<br />
UGB: Sie können durch Indossament<br />
übertragen werden, wenn sie an Order<br />
lauten (Orderklausel).<br />
30. Was ist ein Rektawechsel?<br />
Das ist ein Wechsel, der durch einen Zusatz (z.B. nicht an Order) zu einem Rektapapier<br />
gemacht wird. Der Wechsel, der als geborenes Orderpapier durch Indossament übertragen<br />
wird, kann durch diese negative Orderklausel nur noch durch Abtretung weitergegeben<br />
werden. Da der Wechsel nicht mehr durch Indossament übertragen werden kann, kann die<br />
Forderung nur mehr im Wege der Zession übertragen werden. Der Wechsel ist damit ein<br />
Rektapapier (Rektawechsel). Übertragung löst nur mehr zessionsrechtliche Wirkungen aus.<br />
§11 KSchG sieht für Verbrauchergeschäfte ein Verbot des Orderwechsels vor.<br />
31. Welche Art von Wertpapieren sind Aktien? Gibt es auch voll einbezahlte Aktien?<br />
Aktien sind Kapitalmarktpapiere, also Effekten. Es gibt Aktien als Inhaberpapiere<br />
(Inhaberaktien) und als Orderpapiere (Namensaktien).<br />
32. Welche Wertpapiere werden an der Börse gehandelt?<br />
Kapitalmarktpapiere sind handelbar, damit grundsätzlich auch börsenfähig. Aufgrund ihrer<br />
Austauschbarkeit kann sich damit ein Marktpreis (Wert der Wertpapiere) oder ein<br />
Börsenpreis (Gewinnerwartung der Anleger) bilden. Anlegerschutz ist das Regelungsziel des<br />
Kapitalmarktes.<br />
33. Was sind Genussscheine?<br />
Genussscheine verbriefen Genussrechte, die Vermögensrechten eines Aktionärs<br />
nachgebildet sind. Sie verbriefen schuldrechtlich zumeist eine Gewinnbeteiligung (als<br />
Gegenleistung für die Zurverfügungstellung eines Kapitals). Sie verbriefen weder ein<br />
Mitgliedschaftsrecht noch Mitwirkungsrechte. Für sie gelten auch die aktienrechtlichen<br />
Bestimmungen über die Ausgabe von Gewinnschuldverschreibungen (Zustimmung der<br />
Hauptversammlung, Mehrheit von ¾ des bei Beschlussfassung vertretenen Kapitals).<br />
Der Genussschein stellt die verbriefte Form eines Genussrechts dar. Es handelt sich um ein<br />
gesetzlich nicht geregeltes Wertpapier, welches je nach individueller Ausgestaltung der<br />
verbrieften Rechte eher einer Aktie und damit Eigenkapital oder aber einer Anleihe und<br />
damit Fremdkapital ähnelt.<br />
Genussscheine werden in der Regel nachrangig ausgestaltet, d.h. die Verbindlichkeiten<br />
werden im Falle einer Insolvenz erst nach den Forderungen der anderen<br />
Fremdkapitalgläubiger bedient. Wie eine Anleihe auch , gewähren die „Genüsse“ in der Regel<br />
die Rückzahlung des Anlagebetrages zum Nominalwert am Laufzeitende sowie einen<br />
jährlichen Zinsanspruch. Die Höhe dieser nicht garantierten Verzinsung hängt aber , wie die
Dividende, vom Jahresgewinn des emittierenden Unternehmens ab. Oftmals wird bei<br />
Genussscheinen eine Verlustbeteiligung bis zur Höhe des Kapitaleinsatzes vereinbart.<br />
Genussscheine sind ein Instrument der Mezzanine-‐Finanzierung, da sie Eigenkapital und<br />
Fremdkapitalcharakteristika aufweisen. Wirtschaftlich wird Genusskapital als Eigenkapital<br />
angesehen, vor allem aufgrund der Nachrangigkeit und der gewinnabhängigen Verzinsung.<br />
Dennoch beinhaltet ein Genussschein kein Mitspracherecht bei der Geschäftsführung und<br />
kein Stimmrecht. Steuerlich werden Genussscheine als Fremdkapital behandelt, wenn für<br />
den Investor keine Beteiligung am Gewinn und Liquidationserlös des Unternehmens<br />
vereinbart ist. In diesem Fall sind die Ausschüttungen als Betriebsausgabe steuerliche<br />
abzugsfähig. Daher schließen viele Genussscheine in Deutschland eine Beteiligung am<br />
Liquidationserlös aus.<br />
Genussscheine kommen als Inhaber-‐, aber auch als Namenspapiere vor und haben in der<br />
Regel eine begrenzte Laufzeit, die mit Kündigung und Rückzahlung oder mit Fristablauf<br />
endet. Für die Ausgabe von Genussscheinen durch Aktiengesellschaften ist in Deutschland<br />
mindestens eine ¾Mehrheit in der Hauptversammlung erforderlich, außerdem steht den<br />
Aktionären ein Bezugsrecht zu. Gleichwohl ist die Emission von Genussscheinen an keine<br />
bestimmte Rechtsform geknüpft.<br />
Genussscheine können börsentäglich veräußert werden. Stückzinsen werden bei<br />
Genussscheinen nicht berechnet. Sie werden flat notiert. Stattdessen beinhaltet der jeweilige<br />
Kurs den rechnerisch abgelaufenen Zins.<br />
Kreditinstitute unterschiedlicher Rechtsformen können das durch die Emission von<br />
Genussscheinen erhaltene Kapital unter bestimmten Voraussetzungen dem haftenden<br />
Eigenkapital hinzurechen.<br />
34. Was ist ein Scheck?<br />
Wie der Wechsel ist auch der Scheck eine in einer bestimmten Form ausgestellte schriftliche<br />
Anweisung. Auch dem Scheck liegt daher das dreipersonale Verhältnis aus Aussteller,<br />
Begünstigtem und Bezogenem zu Grunde<br />
Entspricht eine Urkunde den gesetzlich vorgesehenen Formerfordernissen, wozu auch die<br />
ausdrückliche Bezeichnung als Scheck im Text der Urkunde zählt, dann unterliegt der Scheck<br />
besonderen gesetzlichen Bestimmungen. Geregelt ist der Scheck im ScheckG 1955. Subsidiär<br />
gelten wiederrum allgemeines Unternehmensrecht und bürgerliches Recht. Nach Art 59a<br />
ScheckG gelten für den Scheck auch die Bestimmungen über das Wechselverfahren und das<br />
Wechselmandatsverfahren, sowie das KEG.<br />
Als notwendige Angaben muss der Scheck die in Art 1 ScheckG genannten Bestandteile<br />
enthalten.<br />
-‐ Die Bezeichnung als Scheck im Text der Urkunde (Scheckklausel) Art 1 Z1 ScheckG<br />
-‐ Die unbedingte Anweisung, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen (Art 1 Z2 ScheckG)<br />
-‐ Den Namen des Bezogenen (Art 1 Z3 ScheckG)<br />
-‐ Die Unterschrift des Ausstellers (Art 1 Z6 ScheckG)<br />
-‐ Die Angabe des Zahlungsorts (Art 1 Z4 ScheckG)<br />
-‐ Die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung (Art 1 Z5 ScheckG)<br />
35. Was ist der Unterschied zwischen Wechsel und Scheck?<br />
Im Gegensatz zum Wechsel hat der Scheck nur Zahlungsfunktion und keine Kreditfunktion.<br />
Einer der zentralen Unterschiede zwischen Wechsel und Scheck ist das Akzeptverbot beim<br />
43
Scheck, das sich aus Art 4 ScheckG ergibt. Danach kann der Scheck nicht angenommen<br />
(akzeptiert) werden. Ein auf den Scheck gesetzter Annahmevermerk gilt als nicht<br />
geschrieben. Aus dem Akzeptverbot in Verbindung mit der Anweisungskonstruktion ergibt<br />
sich, dass es beim Scheck keinen Hauptschuldner gibt. Der Nehmer des Schecks erhält damit<br />
immer nur eine Zahlungschance durch den Bezogenen, aber keinen durchsetzbaren<br />
Anspruch. Auch darin kommt die bloße Zahlungsfunktion des Schecks zum Ausdruck. Gem<br />
Art 3 ScheckG darf der Scheck nur auf eine Bank (Kreditinstitut) gezogen werden, bei der der<br />
Aussteller Guthaben hat.<br />
Der Scheck ist ebenso wie der Wechsel ein geborenes Orderpapier, d.h. er lautet auf den<br />
Namen des Berechtigten oder an dessen Order und kann durch Indossament übertragen<br />
werden. Er kann auch mit einem entsprechenden Vermerk (Rektaklausel) auch als<br />
Rektapapier ausgestaltet sein.<br />
Gem Art 28 ScheckG ist der Scheck bei Sicht zahlbar (anderes gilt als nicht geschrieben).<br />
Hauptunterschiede zwischen Wechsel und Scheck:<br />
Wechsel Scheck<br />
Kredit und Zahlungsfunktion Nur Zahlungsfunktion<br />
Annahme durch Akzept auf dem Wechsel Akzeptverbot<br />
Akzeptant ist Hauptschuldner und<br />
verpflichtet, den Wechsel bei Verfall zu<br />
bezahlen<br />
Es gibt keinen Akzeptanten<br />
Bezogener kann jedermann sein Bezogener kann nur ein Kreditinstitut sein,<br />
berührt aber die Gültigkeit des Schecks nicht<br />
Geborenes Orderpapier, Rektaklausel Geborenes Orderpapier, Rekta-‐ oder<br />
möglich<br />
Inhaberpapier möglich<br />
Tag-‐, Dato-‐, Sich-‐, und Nachsichtwechsel Zahlbarkeit bei Sicht zwingend<br />
Dispositive Vorlegungsfristen Zwingende kurze Vorlegungsfristen<br />
Protest ist Voraussetzung für den Rückgriff Vorlegungsbescheinigung durch den<br />
Bezogenen ist ausreichend<br />
36. Was ist die Sammelurkunde?<br />
Neben der Sammelverwahrung besteht darüber hinaus auch die Möglichkeit, die einzelnen<br />
Wertpapiere, die einen Anteil an der Gesamtemission verbriefen, überhaupt nicht mehr<br />
gesondert auszugeben, sondern sie lediglich in einer Sammelurkunde zu verbriefen. Damit<br />
können Kosten für Herstellung und Verwahrung der einzelnen Wertpapiere vermieden<br />
werden. Faktisch ergibt sich dabei im Geschäftsablauf für den Erwerber der Wertpapiere im<br />
Vergleich zur Sammelverwahrung kein Unterschied, da auch hier im Regelfall die einzelnen<br />
Stücke nicht mehr ausgefolgt werden.<br />
Es wird entweder nur eine Sammelurkunde ausgegeben oder bei<br />
Bundesschuldbuchforderungen auf eine Verbriefung überhaupt verzichtet. Auf beide Formen<br />
sind nach §24 DepotG grundsätzlich auch die Bestimmungen über die Sammelverwahrung<br />
entsprechend anzuwenden.<br />
37. Was ist ein Wertpapier?<br />
Ein Wertpapier ist ein verbrieftes Recht. Mit einem Wertpapier wird eine unkörperliche<br />
Sache (z.B. eine Kaufpreisforderung) zu einer körperlichen und somit verkehrsfähigen Sache<br />
44
gemacht. Es gibt die verschiedensten Arten von Wertpapieren. Zunächst sind die klassischen<br />
Wertpapiere wie Wechsel und Scheck zu nennen (WechselG; ScheckG). Im Rahmen des UGB<br />
gibt es noch die so genannten unternehmerischen Wertpapiere. Es handelt sich dabei um die<br />
unternehmerische Anweisung, den unternehmerischen Verpflichtungsschein, den<br />
Lagerschein, den Ladeschein und das Konnossement. Die Aktie und ihre Nebenpapiere sind<br />
im AktG geregelt. Daneben bestehen Inhaberschuldverschreibungen in verschiedenen<br />
Formen. Pfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen stellen Sonderformen der<br />
Schuldverschreibung dar und sind in Spezialgesetzen geregelt. Investmentzertifikate und<br />
Genussscheine sind weitere Papiere der Kapitalanlage, die sondergesetzlich geregelt sind.<br />
Der individuellen Kapitalanlage dient auch das Sparbuch.<br />
38. Welche Rechte kann ein Wertpapier vermitteln?<br />
Im Folgenden sind die einzelnen Wirkungen näher darzustellen, die mit der Ausstellung einer<br />
Urkunde als Wertpapier verbunden sind. Es wird sich dabei zeigen, dass das Festhalten eines<br />
privaten Rechts in körperlicher Form verschiedene abgestufte Rechtswirkungen hervorrufen<br />
kann, die über die der unverbrieften Forderung hinausgehen. Es geht hier um die<br />
Funktionen, die mit der Ausstellung des Wertpapiers verbunden sein können.<br />
-‐ Beweisfunktion<br />
-‐ Liberationsfunktion (Legitimationsfunktion zugunsten des Schuldners)<br />
-‐ Sperrfunktion (Einlösungs-‐ oder Vorlegungsfunktion)<br />
-‐ Legitimationsfunktion zugunsten des Gläubigers<br />
-‐ Gutglaubensschutzfunktion<br />
-‐ Garantie-‐ bzw Gewährleistungsfunktion (Radierfunktion)<br />
39. Was sind Inhaberpapiere?<br />
Bei den Inhaberpapieren tritt der Berechtigte in der Urkunde überhaupt nicht in Erscheinung.<br />
Der Text verweist auf den Inhaber als Berechtigten. Sie lautet also auf den Inhaber bzw<br />
Überbringer oder der erste Berechtigte ist nicht namentlich genannt. Bei den<br />
Inhaberpapieren sind die genannten Wertpapierfunktionen in vollkommener Weise<br />
ausgebildet. Die Übertragung folgt bei den Inhaberpapieren sachenrechtlichen Grundsätzen,<br />
also durch Übereignung des Papiers. Damit ist auch gutgläubiger Eigentumserwerb vom<br />
Nichtberechtigten möglich.<br />
40. Was sind Wertrechte? Sind Wertpapierfunktionen auf sie trotzdem anzuwenden?<br />
Bei den Wertrechten nimmt man abstand von der Verbriefung eines Rechts in einer Urkunde,<br />
sprich in einem Wertpapier. Es ist alles in einem Registerangeführt. Meiner Meinung nach<br />
sind aber die Wertpapierfunktionen auf sie nicht anwendbar.<br />
41. Was ist eine Schuldverschreibung?<br />
Die Schuldverschreibung ist ein Wertpapier des Kapitalmarkts (Effekten). Sie verbrieft den<br />
schuldrechtlichen Rückzahlungsanspruch eines bestimmten Betrags, der dem Emittenten zur<br />
Verfügung gestellt wird. Es handelt sich dabei um Fremdkapital, der Inhaber der<br />
Schuldverschreibung wird Gläubiger des Emittenten.<br />
42. Was sind Investmentzertifikate?<br />
Sie sind sachenrechtliche Wertpapiere. Sie verbriefen ein Sachenrecht. Es verbrieft einen<br />
Miteigentumsanteil an den Vermögenswerten des Investmentfonds.<br />
45
43. Was ist ein eigener Wechsel?<br />
Beim eigenen Wechsel verspricht der Aussteller selbst eine Leistung an den Begünstigten zu<br />
erbringen. Der Begünstigte erhält also ein unbedingtes Zahlungsversprechen des Ausstellers.<br />
Als weitere Bezeichnung kommen Eigenwechsel, Solawechsel, Alleinwechsel oder trockener<br />
Wechsel vor.<br />
Als Zahlungsversprechen verbrieft der eigene Wechsel daher eine rein zweipersonale<br />
Forderung. Der Aussteller ist Schuldner, der Begünstigte Gläubiger der Wechselforderung.<br />
44. Formen des Wechsels?<br />
-‐ Sichtwechsel<br />
-‐ Nachsichtwechsel<br />
-‐ Datowechsel<br />
-‐ Tagwechsel<br />
45. Welche Formen von Aktien gibt es? (gemeint waren Aktientypen)<br />
46. Welche Aktien sind Orderpapiere? Was ist dabei zu beachten?<br />
47. Wenn man heute eine Aktie kauft, bekommt man sie noch ausgehändigt?<br />
Gesellschaftsrecht<br />
Personengesellschaften<br />
1. Für welche Tätigkeiten steht die GesBR zur Verfügung?<br />
Eine GesBR kann für jede erlaubte Tätigkeit gegründet werden. Sie darf nicht zu illegalen<br />
Zwecken erschaffen werden.<br />
2. Was für Gesellschaftsformen kennen Sie? Unterschiede?<br />
Stille Gesellschaft, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit<br />
beschränkter Haftung, EWIV, Erwerbsgenossenschaft, Versicherungsverein auf<br />
Gegenseitigkeit, Offene Gesellschaft, Kommanditgesellschaft, Verein, SE, SCE. Man<br />
unterscheidet zwischen Personen-‐ und Kapitalgesellschaften, sowie zwischen Innen-‐ und<br />
Außengesellschaften.<br />
3. Was ist der Unterschied zwischen der GesBR und der OG?<br />
Die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts (§1175 ABGB) ist eine durch Vertrag begründete<br />
Gesellschaft zu einem gemeinschaftlichen Erwerb. Sie hat keine Rechtspersönlichkeit, ist<br />
keine juristische Person und ist nicht parteifähig. Sie ist eine Personengesellschaft und kann<br />
entweder eine Außen-‐ oder eine Innengesellschaft sein. Es gibt die GesBR als<br />
Zusammenschluss zum Betrieb eines nicht rechnungslegungspflichtigen gewerblichen<br />
Unternehmens. Wenn GesBR den Schwellenwert des §189 UGB überschreitet müssen sie<br />
sich als OG bzw KG ins Firmenbuch eintragen lassen. Die GesBR ist ein Zusammenschluss zur<br />
gemeinsamen Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit bzw einer land-‐ und<br />
forstwirtschaftlichen Tätigkeit. Sie ist oftmals eine Vorgründungsgesellschaft.<br />
Die GesBR kann einen Hauptstamm bilden (Summe aller Einlagen), dieser ist sodann im<br />
gemeinschaftlichen Eigentum aller Gesellschafter. Die Art und die Höhe der Einlagen die zu<br />
erbringen sind richten sich nach dem Gesellschaftsvertrag. Sie sind anders als bei OG oder KG<br />
nicht an bestimmte Bewertungsvorschriften gebunden (weil die Gesellschafter hier ohnehin<br />
mit ihrem ganzen Privatvermögen haften). Das Gesellschaftsvermögen steht im Miteigentum<br />
46
der Gesellschafter. Arbeitsgesellschafter sind nicht am Gesellschaftsvermögen beteiligt, sie<br />
haben nur Anspruch auf Gewinn. Anders ist dies bei der OG, dort drückt der Kapitalanteil die<br />
Beteiligung des Gesellschafters am Gesellschaftsvermögen aus, sachenrechtlich ist aber das<br />
Vermögen der OG als Rechtssubjekt zuzuordnen.<br />
Weil die GesBR keine Rechte erwerben kann (OG hingegen schon, da sie rechtsfähig ist) und<br />
keine Verbindlichkeiten eingehen kann, stehen Forderungen aus Geschäften nur den<br />
Gesellschaftern zu. Jeder Gesellschafter hat einen Teilanspruch auf die Forderungen nach<br />
Maßgabe seines Kapitalanspruches. Aber Forderungen hingegen, werden abweichend vom<br />
Wortlaut des §1203 ABGB nach hA als Gesamthandforderungen betrachtet. Diese können<br />
nur von allen Gesellschaftern gemeinsam geltend gemacht werden.<br />
Die OG ist eine unter eigener Firma geführte Gesellschaft, bei der die Gesellschafter<br />
gesamthandlich verbunden sind und bei keinem der Gesellschafter ist die Haftung gegenüber<br />
den Gläubigern eingeschränkt.<br />
Die OG ist rechtsfähig, sie kann ins Firmenbuch eingetragen werden. Sie ist keine juristische<br />
Person (sondern nur eine Quasi-‐juristische Person) Sie kann Unternehmereigenschaft<br />
besitzen. Die OG ist in den §§105 – 160 UGB geregelt. Der Gesellschaftsvertrag kommt<br />
zwischen mindestens zwei Gesellschaftern zustande (niemals nur einer). Gesellschafter kann<br />
jeder sein der rechtsfähig ist. Daher kann keine GesBR Gesellschafter einer OG werden.<br />
Sie entsteht mit der Eintragung ins Firmenbuch (konstitutive Eintragung). Jede OG ist zur<br />
Eintragung ins Firmenbuch anzumelden. Zur Anmeldung sind sämtliche Gesellschafter<br />
verpflichtet.<br />
4. Was können Sie mir zu Personengesellschaften erzählen?<br />
Zu den Personengesellschaften zählen die stille Gesellschaft (stG), die Gesellschaft<br />
Bürgerlichen Rechts (GesBR), die offene Gesellschaft (OG), die Kommanditgesellschaft (KG)<br />
sowie die Europäische Wirtschafts-‐ und Interessenvereinigung (EWIV). Das Wesensmerkmal<br />
der Personengesellschaften ist die enge Verbundenheit zu ihren Mitgliedern (Tod eines<br />
Gesellschafters führt zur Auflösung der Gesellschaft). Bei ihnen stehen die Mitgesellschafter<br />
also eher im Vordergrund als das Kapital. Bei den Personengesellschaften haften meistens<br />
die Gesellschafter auch mit ihrem Privatvermögen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft<br />
(Ausnahme: Kommanditisten der KG).<br />
5. Wie kommt es zum Erlöschen einer OG? Welche Auswirkungen hat der Tod eines OG-‐<br />
Gesellschafters?<br />
Grundsätzlich gibt es einige Auflösungstatbestände, welche die OG zum erlöschen bringen.<br />
Die gesetzlichen Auflösungsgründe sind nach hM taxativ in §131 UGB aufgelistet. Die<br />
Gesellschafter könnten jedoch durch vertragliche Gestaltung die Auflösung verhindern, auch<br />
wenn ein Auflösungsgrund eingetreten ist. Im Gesellschaftsvertrag können aber überdies<br />
beliebig viele vertragliche Auflösungsgründe festgelegt werden. Zu nennen sind Zeitablauf,<br />
Auflösungsbeschluss, Konkurseröffnung über das Vermögen der Gesellschaft oder durch die<br />
rechtskräftige Nichteröffnung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens mangels<br />
kostendeckenden Vermögens, Tod eines Gesellschafters, Konkurseröffnung über das<br />
Vermögen eines Gesellschafters bzw rechtskräftige Nichteröffnung oder Aufhebung des<br />
Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens und Kündigung. Der Tod eines<br />
Gesellschafters hat insofern auflösende Wirkung als es keine vertragliche Gestaltung darüber<br />
gibt wie weiter verfahren werden soll. Es gibt nämlich die Weiterführungsklausel, die<br />
Eintrittsklausel und die Nachfolgeklausel.<br />
47
6. Was ist der Unterschied zwischen einem Komplementär und einem unbeschränkt<br />
haftenden Kommanditisten?<br />
Der Komplementär haftet wie die Gesellschafter einer OG (die auch Komplementäre genannt<br />
werden) voll mit seinem Privaten vermögen für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Der<br />
Kommanditist haftet nur bis zu seiner (ins Firmenbuch eingetragenen) Haftsumme. Die<br />
Befugnisse des Kommanditisten sind beschränkt aber können erweitert aber auch ganz<br />
eingeschränkt werden (Bestellung eines Prokuristen).<br />
7. Wie haftet ein Gesellschafter einer OG?<br />
Der Gesellschafter einer OG (auch Komplementär genannt) haftet voll mit seinem<br />
Privatvermögen für Verbindlichkeiten der Gesellschaft.<br />
8. Warum gibt es bei Personen-‐ und Kapitalgesellschaften getrennte Bestimmungen über die<br />
Geschäftsführung und Vertretung?<br />
Bei Personengesellschaften haften die einzelnen Gesellschafter oft mit ihrem<br />
Privatvermögen, weil das Risiko größer ist sollen auch die Mitspracherechte der<br />
Gesellschafter in Geschäftsführungs-‐ und Vertretungsangelegenheiten größer sein. Die<br />
Personengesellschaften sind personalistischer. Bei den Kapitalgesellschaften haften die<br />
Gesellschafter nicht persönlich mit ihrem Privatvermögen, die Gesellschaft (GmbH und AG)<br />
sind juristische Personen und können nur durch Organe handeln.<br />
9. Wie ist die Vertretung bei Personengesellschaften und wie bei Kapitalgesellschaften?<br />
Personengesellschaft Kapitalgesellschaft<br />
Prinzip der Selbstorganschaft Prinzip der Fremd-‐ oder Drittorganschaft<br />
Bei der OG ist jeder Gesellschafter Bei der GmbH obliegt die gerichtliche und<br />
einzelvertretungsbefugt, dies gilt sowohl für außergerichtliche Vertretung der<br />
gewöhnliche als auch außergewöhnliche Geschäftsführung, iZw ist Gesamtvertretung<br />
Geschäfte.<br />
vorgesehen.<br />
Vertragliche Vertretungsregeln: einzelne Im Gesellschaftsvertrag kann auch<br />
Gesellschafter können ausgeschlossen Einzelvertretungsbefugnis oder unechte<br />
werden, echte Gesamtvertretung, halbseitige Gesamtvertretung vorgesehen sein. Für die<br />
Gesamtvertretung, unechte/gemischte Bestellung eines Prokuristen nur durch alle<br />
Gesamtvertretung<br />
Geschäftsführer gemeinsam. In bestimmten<br />
Fällen sind andere Organe vertretungsbefugt.<br />
Der Aufsichtsrat wenn es um Vertretung der<br />
Gesellschaft bei Rechtsstreitigkeiten mit dem<br />
Geschäftsführer geht oder auch die<br />
Gesellschafter beim Abschluss des<br />
Anstellungsvertrages<br />
Geschäftsführer<br />
mit dem<br />
Umfang der Vertretungsmacht für alle Der Umfang der Vertretung ist unbeschränkt<br />
gerichtlichen und außergerichtlichen und unbeschränkbar.<br />
Handlungen, ausgenommen sind<br />
Grundlagengeschäfte<br />
Entzug: Auf Antrag aller anderen durch Widerruf der Bestellung des Geschäftsführers<br />
gerichtliche Entscheidung, wenn wichtiger kann jederzeit mit einfacher Mehrheit der<br />
Grund<br />
Generalversammlung erfolgen<br />
Eintragung ins Firmenbuch aller Bestellung der Geschäftsführer durch<br />
vertretungsbefugten Gesellschafter und jede Gesellschafterbeschluss und Eintragung der<br />
Änderung<br />
einzutragen.<br />
der Vertretungsmacht ist Geschäftsführer sofort im Firmenbuch<br />
48
Bei der KG ist der Kommanditist von der<br />
Vertretung zwingend ausgeschlossen. Nur<br />
die Komplementäre sind zur<br />
organschaftlichen Vertretung befugt.<br />
49<br />
Bei der AG obliegt dem Vorstand die<br />
Geschäftsführung und die Vertretung nach<br />
der AG nach außen. Wird durch den<br />
Aufsichtsrat gewählt und abberufen.<br />
10. Muss der Gläubiger zuerst auf die OG greifen oder kann er gleich den Gesellschafter in<br />
Anspruch nehmen?<br />
Nein er kann gleich den Gläubiger in Anspruch nehmen. Dieser wiederrum kann sich gemäß<br />
dem Gesellschaftsvertrag bei den anderen Gesellschaftern regressieren.<br />
11. Wann entsteht eine OG?<br />
Man unterscheidet die Begriffe Errichtung und Entstehung. Mit fertig abgeschlossenem<br />
Gesellschaftsvertrag ist die OG errichtet. Mit Eintragung in das Firmenbuch entsteht sie<br />
(konstitutive Eintragung). Jedoch die Errichtung der Gesellschaft verpflichtet die<br />
Gesellschafter die OG auch entstehen zu lassen.<br />
12. Was geschieht bei Tod eines Gesellschafters einer OG?<br />
Auflösung der OG<br />
(§ 131 Z4 UGB)<br />
Tod eines<br />
Gesellschakers<br />
Fortsetzungsbeschluss<br />
(§141 UGB)<br />
Fortsetzungsklausel<br />
Geselscha|svertragliche<br />
Vorkehrungen<br />
Nachfolgeklausel<br />
(§139 UGB)<br />
Eintri}sklausel<br />
Der Tod eines Gesellschafters hat grundsätzlich die Auflösung der Gesellschaft zur Folge. Die<br />
verbleibenden Gesellschafter können die Fortsetzung der Gesellschaft einstimmig<br />
beschließen. Einer Zustimmung der Erben bedarf es nicht. Bereits im Gesellschaftsvertrag<br />
kann entsprechend vorgesorgt werden. Grundsätzlich stehen für die Fortführung der<br />
Gesellschaft nach dem Tod eines Gesellschafters 3 Möglichkeiten offen:<br />
-‐ Die Gesellschafter können die Fortsetzung unter den verbleibenden Gesellschaftern<br />
vereinbaren (Fortsetzungsklausel).<br />
-‐ Die Gesellschaft kann mit dem (den) Erben fortgesetzt werden (Nachfolgeklausel).<br />
-‐ Für die Erben oder sonstige Personen kann ein Eintrittsrecht vorgesehen werden<br />
(Eintrittsklausel).
13. Ein Gesellschafter scheidet aus der OG aus wie haftet er?<br />
Den Interessen der Gläubiger und der ausscheidenden Gesellschafter trägt der §160 UGB<br />
Rechnung. Scheidet der Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so haftet er grundsätzlich<br />
nur für ihre bis dahin entstandenen Verbindlichkeiten. Maßgeblich ist nach dem Wortlaut<br />
des §160 Abs 1 UGB nur der Zeitpunkt des Ausscheidens und nicht die Eintragung ins<br />
Firmenbuch (Achtung: §15 Abs 1 UGB). Der ausgeschiedene Gesellschafter haftet nur für<br />
solche Verbindlichkeiten, die bis zum Ausscheiden entstanden sind (auf Vertragsabschluss<br />
kommt es an). Für entstandene Verbindlichkeiten haftet der Gesellschafter nur, wenn sie vor<br />
Ablauf von 5 Jahren nach dem Ausscheiden fällig sind. Nach §160 Abs 2 beginnt die Frist mit<br />
dem Ende des Tages, an dem das Ausscheiden des Gesellschafters ins Firmenbuch<br />
eingetragen wird. Für Verbindlichkeiten, die vor Ablauf von 5 Jahren nach dem Ausscheiden<br />
fällig werden, kann der ausgeschiedene Gesellschafter innerhalb der für die jeweilige<br />
Verbindlichkeit geltenden Verjährungsfrist, längstens jedoch 3 Jahre in Anspruch genommen<br />
werden. Im Innenverhältnis können natürlich andere Haftungsbeschränkungen vereinbart<br />
werden. Der Gesellschafter der mittels Ausscheidungsklage aus der Gesellschaft ausscheidet<br />
haftet auch nur im Innenverhältnis nicht weiter für die Verbindlichkeiten.<br />
14. Wenn ein OG-‐Gesellschafter eine Gesellschaftsschuld begleicht, kann er sich dann bei der<br />
Gesellschaft regressieren?<br />
Grundsätzlich haften alle Gesellschafter persönlich, unbeschränkt, unbeschränkbar, primär,<br />
unmittelbar und solidarisch. Der Gesellschafter der nun in Anspruch genommen wird (muss<br />
zwar die volle Schuld begleichen), kann sich bei der Gesellschaft oder anderen<br />
Gesellschaftern regressieren. Jeder haftet für seine dem Innenverhältnis nach geregelten<br />
Anteil.<br />
15. Welche Gesellschaften stehen Freiberuflern offen?<br />
Freiberuflern steht jede Art von Personengesellschaft offen. Sie können sowohl eine Innen-‐<br />
als auch eine Außengesellschaft gründen. Zu nennen sind hier also die GesBR, die OG, die KG<br />
und die stille Gesellschaft.<br />
16. Wer ist in einer OG geschäftsführungs-‐ und vertretungsbefugt?<br />
Zur Geschäftsführung zählen alle rechtlichen und tatsächlichen Handlungen, die der<br />
Verwirklichung des Gesellschaftszweckes dienen. Erfasst werden damit vor allem jene<br />
Managementfunktionen, die zur Führung eines Unternehmens gehören. Dazu gehören die<br />
Planung, Umsetzung und Kontrolle unternehmerischer Tätigkeiten (Erledigung der<br />
Korrespondenz, Führung der Bücher, Erstellung von Finanzplänen Organisation des<br />
Betriebes). Nicht der Geschäftsführung unterliegen Maßnahmen, die die Grundlagen der<br />
Gesellschaft betreffen oder die Beziehung der Gesellschafter untereinander regeln (sog<br />
Grundlagengeschäfte). Anders als im Recht der Kapitalgesellschaften gibt es kein eigenes<br />
Organ (wie z.B. den Geschäftsführer oder Vorstand), dem die ausschließliche<br />
Geschäftsführungskompetenz zukommt. Den Prinzipien der Selbstorganschaft und der<br />
Gleichbehandlung entsprechend kommt die Geschäftsführung grundsätzlich allen<br />
Gesellschaftern zu. Es können natürlich andere Vereinbarungen im Gesellschaftsvertrag<br />
enthalten sein.<br />
Nach dem für Personengesellschaften geltenden Prinzip der Selbstorganschaft wird die OG<br />
durch ihre Gesellschafter vertreten. Dritte können grundsätzlich nicht organschaftliche<br />
Vertreter sein, wohl kann ihnen aber durch Vertrag Vertretungsmacht eingeräumt werden<br />
(z.B. Prokura, Handlungsvollmacht, Prozessvollmacht etc.). Gem §125 Abs 1 UGB ist jeder<br />
Gesellschafter einzelvertretungsbefugt. Dies gilt – im Gegensatz zur Geschäftsführung –<br />
sowohl für gewöhnliche als auch außergewöhnliche Geschäfte.<br />
50
17. Was wissen Sie über die Beendigung der OG<br />
Auch bei der OG vollzieht sich die Beendigung der Gesellschaft grundsätzlich in zwei Phasen.<br />
Ist ein die Auflösung auslösender Sachverhalt erfüllt, tritt die Gesellschaft in das Stadium der<br />
Abwicklung. Die Gesellschaft ist nicht beendet, sondern sie besteht zunächst fort. Es ändert<br />
sich nur ihr Zweck. War dieser bisher auf Erwerb gerichtet, so besteht er nunmehr in der<br />
Abwicklung und Beendigung aller geschäftlichen Beziehungen. Die Gesellschaft ist erst<br />
vollbeendigt, wenn die Abwicklung durchgeführt und das gesamte Gesellschaftsvermögen<br />
verteilt ist.<br />
18. Was ist die Liquidation?<br />
Die Liquidation ist ein außergerichtliches Verfahren zur Lösung der persönlichen und<br />
vermögensrechtlichen Beziehungen der Gesellschaft untereinander und zur Beendigung der<br />
rechtlichen Verhältnisse zu Dritten mit dem Ziel der Vollbeendigung der Gesellschaft.<br />
Insbesondere sollen das Gesellschaftsvermögen verwertet und die Schulden beglichen<br />
werden. Ein allfälliger Liquidationsgewinn ist auf die Gesellschafter zu verteilen, ein<br />
Liquidationsverlust von den Gesellschaftern auszugleichen.<br />
19. Was für Arten von Liquidatoren kennen Sie?<br />
-‐ Gekorene Liquidatoren<br />
-‐ Geborene Liquidatoren<br />
-‐ Gerichtliche Liquidatoren<br />
20. Was wissen Sie über den Kommanditisten?<br />
Die Kommanditisten haben rechtlich und wirtschaftlich eine ganz andere Position als die<br />
Komplementäre. Die Funktion der Kommanditisten soll im Wesentlichen auf die Rolle eines<br />
Geldgebers beschränkt sein, wobei ihnen bestimmte Mitwirkungs-‐ und Kontrollrechte<br />
zustehen. In gewisser Weise ist die wirtschaftliche Stellung des Kommanditisten mit der eines<br />
stillen Gesellschafters vergleichbar. Der wesentliche Unterschied zum stillen Gesellschafter<br />
besteht darin, dass die Kapitalbeteiligung des Kommanditisten nach außen in Erscheinung<br />
tritt.<br />
Ebenso wie die Komplementäre verpflichten sich auch die Kommanditisten zur Leistung von<br />
Beiträgen im weiteren bzw im engeren Sinn. Der Betrag der für die Haftung des<br />
Kommanditisten gegenüber den Gesellschaftsgläubigern maßgeblich ist, heißt Haftsumme.<br />
Diese wird ins Firmenbuch eingetragen (anders als die Pflichteinlage). Nicht ersichtlich ist<br />
daher, inwieweit die Pflichteinlage geleistet wurde, dies ist aber im Hinblick auf die Haftung<br />
des Kommanditisten gegenüber den Gesellschaftsgläubigern von Bedeutung. Das für<br />
Komplementäre bestehende Wettbewerbsverbot gilt gem §165 UGB nicht für<br />
Kommanditisten, jedoch können diese durch gesellschaftsvertragliche Vereinbarungen sehr<br />
wohl dem Wettbewerbsverbot unterworfen werden.<br />
Gem §170 UGB ist ein Kommanditist von der Vertretung der Gesellschaft ausgeschlossen.<br />
Diese Vorschrift ist zwingend. Der Ausschluss von der organschaftlichen Vertretung hindert<br />
nicht, dass dem Kommanditisten eine durch Rechtsgeschäft begründete Vertretungsmacht<br />
als Prokurist, Handlungsbevollmächtigter etc. eingeräumt wird. Wird dem Kommanditisten<br />
die Prokura bereits im Gesellschaftsvertrag zugesichert, so kann sie ihm nach hL nur bei<br />
Vorliegen eines wichtigen Grundes entzogen werden.<br />
Kommanditisten haften wie Komplementäre primär, unmittelbar, persönlich und solidarisch.<br />
Im Unterschied zum Komplementär haftet der Kommanditist grundsätzlich aber beschränkt.<br />
Die Haftung ist mit der ins Firmenbuch eingetragenen Haftsumme beschränkt.<br />
51
21. Wie haftet ein Kommanditist nach seinem Ausscheiden aus der KG noch für<br />
Gesellschaftsschulden?<br />
Soweit der Kommanditist überhaupt unmittelbar gegenüber den Gläubigern haftet, kommen<br />
für ihn die Bestimmungen des §160 UGB zur Anwendung. Der ausscheidende Kommanditist<br />
haftet gem §160 UGB für die bis zu seinem Ausscheiden begründeten Verbindlichkeiten,<br />
wenn sie vor Ablauf von 5 Jahren nach der Eintragung seines Ausscheidens fällig sind. Aus<br />
haftungsrechtlicher Sicht bedeutsam ist die Abfindung des ausscheidenden Kommanditisten.<br />
Die Abfindungszahlung kann entweder aus dem Privatvermögen der übrigen Gesellschafter<br />
oder aus dem Gesellschaftsvermögen geleistet werden. Erfolgt die Abfindung aus dem<br />
Gesellschaftsvermögen, so stellt dies eine Einlagenrückgewähr dar, die die Haftung wieder<br />
aufleben lässt. Hat der Kommanditist dagegen seine Einlage nicht zurückerhalten, so haftet<br />
er für Verbindlichkeiten nicht, selbst wenn seinem Rechtsnachfolger die Einlage<br />
zurückgewährt wird (§172 Abs 3 UGB).<br />
22. Was ist die stille Gesellschaft?<br />
Eine stille Gesellschaft (stG) liegt vor, wenn sich jemand an einem Unternehmen, das ein<br />
anderer betreibt, beteiligt (vgl §179 UGB). Der Stille leistet eine Vermögenseinlage, die in das<br />
Vermögen des Inhabers des Unternehmens übergeht. Im Gegenzug ist der stille<br />
Gesellschafter zwingend am Gewinn beteiligt. Sie ist eine Innengesellschaft, die nicht<br />
rechtsfähig ist.<br />
23. Was versteht man unter einer fehlerhaften Gesellschaft?<br />
Mängel beim Vertragsabschluss können zur Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Anfechtbarkeit<br />
des Vertrages führen. Bei Dauerschuldverhältnissen werde die Rechtsfolgen solcher<br />
Wurzelmängel unter Umständen dahingehend modifiziert, dass an die Stelle der<br />
Rückabwicklung ex tunc die Auflösung ex nunc tritt. Die Lehre von der fehlerhaften<br />
Gesellschaft ist eine Ausprägung des Grundsatzes, die dem Umstand Rechnung trägt, dass<br />
durch die (wenn auch fehlerhafte) Gesellschaftsgründung ein Rechtsträger ins Leben gerufen<br />
wurde, dessen rückwirkender Entfall zu unauflösbaren Rückabwicklungsschwierigkeiten<br />
führen würde. Daher ist auch im Verhältnis zu Dritten die rückwirkende Nichtigkeit und<br />
Vernichtbarkeit der Gesellschaft ausgeschlossen, sobald die in Vollzug gesetzt wurde. An die<br />
Stelle der Rückabwicklung tritt die Abwicklung.<br />
24. Formpflichten im Gesellschaftsrecht?<br />
Abschluss des Gesellschaftsvertrags, formfreie Entstehung bei den Personengesellschaften<br />
(GesBR, OG, KG, stG). Einfache Schriftform bei EWIV und Genossenschaft. Notariatsaktform<br />
bei AG, GmbH, Stiftung.<br />
25. Wie kann man aus einer OG zwei machen?<br />
Mittels Realteilung. Unter Realteilung wird die Übertragung von Vermögen von<br />
Personengesellschaften aufgrund eines Teilungsvertrages zum Ausgleich untergehender<br />
Gesellschaftsrechte oder ohne wesentliche Ausgleichszahlung auf Nachfolgeunternehmen<br />
verstanden.<br />
Vermögen ist in diesem Zusammenhang wiederum ein Betrieb, Teilbetrieb oder ein<br />
Mitunternehmeranteil (nicht auch ein Kapitalanteil). Das Vermögen muss einen positiven<br />
Verkehrswert besitzen. Die Realteilung ist die Spaltung einer Personengesellschaft. Wir<br />
kennen zwei Formen der Realteilung:<br />
-‐ Durch die Abteilung wird ein Betrieb von einer Gesellschaft getrennt und in Form einer<br />
eigenen (neugegründeten) Personengesellschaft weitergeführt. Die<br />
Vermögensübertragung erfolgt dabei zu Buchwerten.<br />
52
-‐ Die Aufteilung führt zum Untergang der ursprünglichen Personengesellschaft und zur<br />
Weiterführung der Betriebe in Form von selbständigen Unternehmungen.<br />
Auch die Realteilung erfolgt aufgrund eines Realteilungsvertrages (Gesellschaftsvertrag)<br />
sowie einer Bilanz zu einem Stichtag.<br />
26. Was geschieht mit den Unternehmensschulden, wenn ein Unternehmen in eine KG<br />
eingebracht wird?<br />
Wird durch einen Gründer ein bestehendes Unternehmen eingebracht (Sacheinlage), so<br />
verpflichten die im Unternehmen abgeschlossenen Geschäfte ebenfalls die KG mit ihrer<br />
Entstehung. Die KG übernimmt also alle Rechte und Pflichten des übernommenen<br />
Unternehmens.<br />
27. Ein Kommanditist wird in die Gesellschaft aufgenommen und nicht ins Firmenbuch<br />
eingetragen -‐ wie sieht es mit seiner Haftung aus?<br />
Entweder er haftet gar nicht oder voll. Denn würde der Dritte positive Kenntnis von der<br />
Aufnahme haben, so würde mMn der Kommanditist trotz beschränkter Haftung voll haften<br />
müssen. Hingegen ist im Firmenbuch nicht ersichtlich, dass der Kommanditist in die<br />
Gesellschaft aufgenommen wurde, daher stellt sich die Frage, wer denn überhaupt den<br />
Kommanditisten in Anspruch nehmen wollen würde.<br />
Kapitalgesellschaften<br />
1. Was ist die Verschmelzung und welche Arten gibt es?<br />
Verschmelzung (Fusion) bedeutet die Vereinigung von Gesellschaften mit eigener<br />
Rechtspersönlichkeit unter Ausschluss der Liquidation im Wege der Gesamtrechtsnachfolge<br />
(Universalsukzession).<br />
-‐ Verschmelzung von GmbH<br />
o In Form von Verschmelzung durch Aufnahme<br />
o In Form von Verschmelzung durch Neugründung<br />
-‐ Rechtsformübergreifende Verschmelzung<br />
-‐ Grenzüberschreitende Verschmelzung<br />
2. Welche Arten der Umwandlung kennen Sie?<br />
-‐ Formändernde Umwandlung (identitätswahrende Umwandlung)<br />
-‐ Übertragende Umwandlung<br />
o Umwandlung durch Übertragung des Unternehmens auf den Hauptgesellschafter<br />
(der mind 90% halten muss)<br />
o Errichtende Umwandlung (in eine OG beispielsweise)<br />
3. Wie wird die GmbH beendigt?<br />
Die Auflösung der GmbH erfolgt durch gesetzliche oder vertragliche Auflösungsgründe. Zu den<br />
gesetzlichen Auflösungsgründen vgl §84 GmbHG:<br />
-‐ Zeitablauf<br />
-‐ Gesellschafterbeschluss<br />
-‐ Verschmelzung<br />
-‐ Konkurseröffnung<br />
-‐ Verwaltungsbehördliche Verfügung<br />
-‐ Amtswegige Löschung<br />
Dazu kommen (nach anderen Rechtsgrundlagen):<br />
53
-‐ Nichteröffnung bzw Aufhebung des Insolvenzvermögens mangels kostendeckenden<br />
Vermögens<br />
-‐ Löschung wegen Vermögenslosigkeit<br />
-‐ Verstaatlichung<br />
-‐ Umgründungen<br />
Als gesellschaftsvertragliche Auflösungsgründe kommen in der Praxis etwa eingeräumte<br />
Kündigungsrechte oder die Insolvenz eines Gesellschafters vor. Die GmbH ist im<br />
Auflösungszeitpunkt noch nicht beendet, es schließt sich das Liquidationsstadium.<br />
4. Was ist eine GmbH und wie entsteht sie?<br />
Die GmbH ist eine Körperschaft mit Rechtspersönlichkeit, deren Mitglieder eine<br />
Vermögenseinlage an die Gesellschaft erbringen. Diese Stammeinlagen bilden das<br />
Stammkapital der Gesellschaft. Die Gesellschafter haften grundsätzlich nicht für<br />
Gesellschaftsverbindlichkeiten (Ausnahme: Durchbrechungsprinzip). Die GmbH ist<br />
Außengesellschaft, da sie als Träger von Rechten und Pflichten im rechtsgeschäftlichen<br />
Verkehr auftritt. Die GmbH ist juristische Person (vgl §61 Abs 1 GmbHG). Nach dem sog<br />
Trennungsprinzip bedeutet dies, dass sie selbst Trägerin von Rechten und Pflichten ist. Das<br />
Gesellschaftsvermögen ist von jenem der Gesellschafter getrennt.<br />
Gem §1 Abs 1 GmbHG kann eine GmbH für jeden gesetzlich zulässigen Zweck errichtet<br />
werden. Darin kommt zum Ausdruck, dass für die Gründung das Normativsystem gilt. Es gibt<br />
also keine Konzessionspflicht, mit Ausnahmen für Bankgeschäfte, Betriebe der Eisenbahn<br />
oder eines Luftfahrtunternehmens.<br />
Seit 1996 ist die Einmanngründung zulässig. An die Stelle des Gesellschaftsvertrages tritt die<br />
Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft.<br />
Grundsätzlich benötigt man einen Abschluss eines Vorvertrages durch die Gesellschafter.<br />
Weiters benötigt man den Abschluss eines Gesellschaftsvertrages in Notariatsform. Der<br />
notwendige Inhalt ergibt sich aus §4 GmbHG. Alle anderen Regelungen bilden den<br />
fakultativen Inhalt. Weiters braucht man die Bestellung (Wahl) von Aufsichtsratsmitgliedern<br />
und Geschäftsführern durch Gesellschafterbeschluss sofern die Bestellung nicht schon im<br />
Gesellschaftsvertrag erfolgt ist. Einholung einer steuerlichen<br />
Unbedenklichkeitsbescheinigung oder Selbstberechnungserklärung. Die Einzahlung der<br />
Einlagen im gesetzlich vorgesehenen Ausmaß nach §10 Abs 1 GmbHG ist auch zwingender<br />
Bestandteil. Einholung aller allfälligen behördlichen Genehmigungen sowie die Anmeldung<br />
zum Firmenbuch.<br />
Man unterscheidet die Begriffe Errichtung und Entstehung der GmbH. Erst mit der<br />
Firmenbucheintragung entsteht die GmbH.<br />
5. Was wissen Sie über die Vorgesellschaft?<br />
Die Vorgesellschaft wird als GesBR qualifiziert und für sie gilt sinngemäß nicht das GmbHG<br />
sondern das ABGB. Sie liegt zwischen der Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages und<br />
Entstehung der GmbH vor.<br />
6. Was ist das Vorbelastungsverbot?<br />
Das Vorbelastungsverbot sagt, dass die GmbH nicht von Anfang an mit Verbindlichkeiten<br />
belastet sein soll, die vor ihrer Entstehung eingegangen worden sind. Deshalb sollen nur<br />
Handelnde haften. Die Gesellschaft kann nach ihrer Entstehung entscheiden, ob sie die<br />
Verbindlichkeiten übernehmen will oder nicht. Jedoch kann das Vorbelastungsverbot heute<br />
als aufgelassen angesehen werden.<br />
54
7. Was wissen sie über den Haftungsdurchgriff?<br />
Für Schulden der GmbH haften die Gesellschafter grundsätzlich nicht. Unter besonderen<br />
Voraussetzungen kommt es jedoch zu einer Möglichkeit eines Haftungsdurchgriffes auf die<br />
Gesellschafter. Es kommt also zu einer Durchbrechung des Trennungsprinzips. Die<br />
wichtigsten Fallgruppen sind:<br />
-‐ Qualifizierte Unterkapitalisierung<br />
-‐ Vermögens und Sphärenvermischung<br />
-‐ Allgemein missbräuchliche Verwendung der juristischen Person<br />
-‐ Haftung als faktischer Geschäftsführer<br />
-‐ Existenzvernichtungshaftung<br />
8. Wann und wem haftet eine GmbH-‐Gesellschafter?<br />
Grundsätzlich haftet ein GmbH-‐Gesellschafter nicht den Gläubigern sofern er, seine Einlage<br />
pflichtgemäß geleistet hat. Ausnahmen regeln das Durchbrechungsprinzip. Hier haften die<br />
Gesellschafter den Gläubigern dann direkt wenn einer der folgenden Fälle vorliegt:<br />
-‐ Qualifizierte Unterkapitalisierung<br />
-‐ Vermögens-‐ bzw Sphärenvermischung<br />
-‐ Allgemein missbräuchliche Verwendung der juristischen Person<br />
-‐ Haftung als faktischer Geschäftsführer<br />
9. Was können Sie mir über die Kapitalerhöhung erzählen?<br />
Die Kapitalerhöhung ist eine Änderung des Gesellschaftsvertrages, bei der das Stammkapital<br />
der Gesellschaft erhöht wird (§§52 ff GmbHG). Man unterscheidet die effektive<br />
Kapitalerhöhung durch Einbringung zusätzlicher Mittel und die nominelle Kapitalerhöhung.<br />
Die ordentliche (effektive) Kapitalerhöhung des Stammkapitals setzt einen Beschluss mit<br />
Dreiviertelmehrheit voraus, der notariell beurkundet werden muss. Die Erhöhung kann auf<br />
einen festen Betrag lauten, es kann aber auch ein Höchstbetrag festgesetzt werden. Zur<br />
Übernahme der neuen Stammeinlagen können Gesellschafter oder auch anderen Personen<br />
zugelassen werden. Nach §52 Abs 3 besteht zunächst ein vorrangiges Bezugsrecht der<br />
Gesellschafter nach Maßgabe ihrer bisherigen Beteiligungsquote (zur Wahrung dieser Quote<br />
nach Erhöhung). Wird es nicht ausgeübt, wächst es nach hA anteilig den anderen<br />
Gesellschaftern zu. Das Bezugsrecht kann allerdings durch Gesellschafterbeschluss<br />
ausgeschlossen werden. Die Übernahmen erfolgt aufgrund eines Übernahmevertrages<br />
zwischen Übernehmer und Gesellschaft durch Übernahmserklärung in Form eines<br />
Notariatsakts und die Einzahlung des erforderlichen Mindestbetrages (§10 GmbHG). Die<br />
Kapitalerhöhung ist anzumelden und wird im Firmenbuch eingetragen. Sie wird mit<br />
Eintragung wirksam. Bei Übernahme durch Gesellschafter erhöhen sich die bestehenden<br />
Geschäftsanteile, ansonsten entstehen neue.<br />
Die nominelle Kapitalerhöhung oder Kapitalberichtigung bewirkt eine Kapitalerhöhung aus<br />
Gesellschaftsmitteln. Rechtsgrundlage ist das KapBG 1967. Die nominelle Kapitalerhöhung<br />
hat den Zweck, das Stammkapital aus in der Gesellschaft selbst vorhandenen Mitteln zu<br />
erhöhen, was idR die Kreditwürdigkeit der Gesellschaft vergrößert. Für die<br />
Gesellschaftsgläubiger bietet sie den Vorteil, dass Gesellschaftsmittel, die als Rücklagen<br />
aufgelöst werden könnten, so in der Gesellschaft gebunden bleiben. Die nominelle<br />
Kapitalerhöhung erfolgt durch die Umwandlung offener Rücklagen in Stammkapital der<br />
Gesellschaft. Das Gesellschaftsvermögen bleibt also unverändert. Die neuen Anteilsrechte<br />
55
wachsen zwingend den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung zu. Zu<br />
beachten ist, dass die gesetzliche Rücklage mit der Mindestquote erhalten bleiben muss<br />
(10% oder höher laut Gesellschaftsvertrag).<br />
10. Wie lange bleibt man Geschäftsführer bei der GmbH?<br />
Es gibt die Möglichkeiten der zeitlichen Begrenzung, der Abberufung und des Rücktritts.<br />
11. Aufgaben des Aufsichtsrates einer Kapitalgesellschaft?<br />
Nach §29 GmbHG muss ein Aufsichtsrat bestellt werden, wenn das Stammkapital 70.000€<br />
und die Anzahl der Gesellschafter 50 übersteigt oder die Anzahl der Arbeitnehmer im<br />
Durchschnitt 300 übersteigt. Weiters wenn eine Gesellschaft selbst leitende Gesellschaft in<br />
einem Konzern ist, dessen Untergesellschaften (AG oder GmbH) aufsichtsratpflichtig sind und<br />
die Anzahl der Arbeitnehmer aller Gesellschafter zusammen 300 übersteigt oder die<br />
Gesellschaft persönlich haftender Gesellschafter einen Kommanditgesellschaft ist und wieder<br />
zusammen mehr als 300 Arbeitnehmer beschäftigt sind.<br />
Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung in allen Bereichen zu überwachen. Er muss<br />
mindestens vier mal im Jahr (zeitlich gesehen vierteljährlich) zu Sitzungen zusammentreten.<br />
Der Aufsichtsrat hat die Generalversammlung einzuberufen, wenn dies für das Wohl der<br />
Gesellschaft erforderlich ist. Nach §30k GmbHG hat der Aufsichtsrat den von den<br />
Geschäftsführern erstellten Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die<br />
Gewinnverteilung, gegebenenfalls auch den Konzernabschluss und Konzernlagebericht, zu<br />
prüfen und der Generalversammlung über die Prüfung zu berichten. Den Sitzungen für diese<br />
Tätigkeiten ist der Abschlussprüfer beizuziehen. Nach §30j Abs 5 GmbHG besteh für<br />
bestimmte Geschäfte ein Genehmigungsrecht des Aufsichtsrates (vgl den Katalog in Z1-‐11).<br />
Bei Rechtsgeschäften zwischen Geschäftsführern und Gesellschaft hat der Aufsichtsrat die<br />
Gesellschaft zu vertreten und auch allfällige Rechtsstreitigkeiten zu führen.<br />
12. Was ist eine Holding?<br />
Eine Holding ist eine Gesellschaft, deren Geschäftsgegenstand die Beteiligung an anderen<br />
Unternehmen ist. In diesem Fall ist ein Konzernverhältnis möglich, wenn die Beteiligungen<br />
ein Ausmaß haben, durch das Einfluss ausgeübt werden kann oder Einfluss durch andere<br />
Umstände möglich ist und auch ausgeübt wird. Dies ist aber nicht notwendigerweise der Fall.<br />
13. Welche Vertragsbindung besteht zw. Tochter-‐ und Muttergesellschaft?<br />
Ein Unterordnungskonzern besteht dann, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen<br />
Unternehmen oder Gesellschaften besteht, das durch Beteiligung, aber auch anders (etwa<br />
durch Vertragsbindungen) gegeben sein kann. Beim Unterordnungskonzern sind die Begriffe<br />
Mutter und Tochterunternehmen üblich.<br />
14. Was ist eine Mantelgründung und wie funktioniert ihre Gründung?<br />
Eine Mantel-‐ oder Vorratsgründung liegt nach gebräuchlicher Definition dann vor, wenn eine<br />
GmbH gegründet wird, die vorerst nicht am Rechtsverkehr teilnehmen soll. Der Sinn einer<br />
Mantelgründung liegt darin, bei Bedarf sofort eine Gesellschaft zur Verfügung zu haben.<br />
Zulässig ist die Mantelgründung dann, wenn im Gesellschaftsvertrag der vorläufige Zweck der<br />
Gesellschaft offen gelegt wird, als Unternehmensgegenstand also die Verwaltung des<br />
Gesellschaftsvermögens angegeben ist (offene Mantelgründung). Von der offenen<br />
Mantelgründung ist die verdeckte Mantelgründung zu unterscheiden, bei der zwar die<br />
Gesellschaft auch vorerst auch noch kein Unternehmen betreiben soll, dies aber im<br />
Unternehemensgegenstand nicht offengelegt wird. Verdeckte Mantelgründungen sind<br />
unzulässig. Da aber insbesondere Bargründungen ohnedies rasch möglich sind, ist die<br />
56
praktische Bedeutung relativ gering. Die Ausführungen gelten sowohl für die GmbH als auch<br />
die AG.<br />
15. Können GmbH Anteile im Wege der Gesamtrechtsnachfolge übergehen?<br />
Ja und zwar durch Verschmelzung. Die Verschmelzung ist eine Vereinigung von<br />
Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit unter Ausschluss von Liquidation im Wege<br />
der Gesamtrechtsnachfolge. Geschäftsanteile sind grundsätzlich vererblich (der<br />
Gesellschaftsvertrag kann hier abweichende Regelungen vorsehen).<br />
16. Welche Gesellschaftsformen können Tochtergesellschaften sein?<br />
Der Begriff Tochtergesellschaften wird in einem Unterordnungskonzern verwendet. Ein<br />
Unterordnungskonzern besteht dann, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen den<br />
Unternehmen oder Gesellschaften besteht, das durch Beteiligung, aber auch anders (etwa<br />
durch Vertragsbindungen) gegeben sein kann. Meiner Meinung nach können alle<br />
Außengesellschaften (sprich keine stillte Gesellschaft oder GesBR) Tochtergesellschaften<br />
sein. Möglicherweise könnte man aber auch mit ins Firmenbuch eingetragenen<br />
Unternehmen argumentieren.<br />
17. Wie viele Geschäftsführer sind bei einer GmbH zu bestellen?<br />
Mindestens eine physische Person, für Kapitalanlagegesellschaften und GmbH, die<br />
Kreditgeschäfte betreiben sind mindestens zwei erforderlich.<br />
18. Wie funktioniert der Aktienverkauf?<br />
Auch heute bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis der an einer Börse gehandelten<br />
Wertpapiere, Devisen oder Rohstoffe. Der Handel wird nicht direkt zwischen Käufer und<br />
Verkäufer abgeschlossen, sondern von dazu berechtigten Maklern, und die gehandelten<br />
Güter sind nicht physisch anwesend. Anleger erledigen also ihre Geschäfte weder vor Ort<br />
noch selbst, sondern beauftragen über ihre Bank einen Wertpapierhändler damit, eine<br />
bestimmte Anzahl von Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Oder sie arbeiten mit einem<br />
Diskont-‐Broker beim Online-‐Aktienhandel. Der Aktienpreis beläuft sich also auf den Kurs.<br />
19. Was sind Gratisaktien?<br />
Gratisaktien sind Aktien, die bei nominellen Kapitalerhöhungen aus Gesellschaftsmitteln<br />
ausgegeben werden.<br />
20. Formen der Umgründung?<br />
Es gibt die Verschmelzung die Umwandlung und die Spaltung.<br />
21. Unterschied zwischen Bar und Sacheinlagen?<br />
Bareinlagen sind wie der Name schon sagt, Einlagen die einen klaren Geldwert besitzen und<br />
nicht erst einer Bewertung unterliegen müssen (20.000€). Hingegen Sacheinlagen (ein<br />
Unternehmen im Wert von 80.000€) sind Gegenstände, die erst bewertet werden müssen.<br />
22. Was ist das Kaduzierungsverfahren und was sind die Rechtsfolgen davon?<br />
Erfüllt ein Gesellschafter seine Einlageverpflichtung nicht, so kann die ausständige Einlage<br />
von der Gesellschaft entweder klagsweise eingefordert werden oder aber das<br />
Kaduzierungsverfahren (§§ 66ff GmbHG) eingeleitet werden. Hier wird dem säumigen<br />
Gesellschafter mittels eingeschriebenem Brief der Ausschluss angedroht, wobei ihm eine<br />
Nachfrist von mindestens einem Monat zu setzen ist. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist<br />
ist der säumige Gesellschafter durch die Geschäftsführung als ausgeschlossen zu erklären.<br />
Mit der Zustellung dieser Erklärung (eingeschriebener Brief) an den Gesellschafter tritt der<br />
Verlust sämtlicher Rechte aus dem Geschäftsanteil (auch der darauf geleistete Einzahlungen)<br />
57
ein. Wegen des Gleichbehandlungsgrundsatzes muss das Kaduzierungsverfahren gegen alle<br />
säumigen Gesellschafter eingeleitet werden (§66 Abs 1 S3 GmbHG). Die Rechtsfolgen der<br />
Kaduzierung sind:<br />
-‐ Der Gesellschafter verliert sämtliche Rechte aus der Gesellschaft<br />
-‐ Der Gesellschafter haftet weiter für den unberichtigten Teil der Stammeinlage<br />
-‐ Daneben besteht (ab Ausschluss des säumigen Gesellschafters) eine Haftung aller<br />
Rechtsvorgänger des ausgeschlossenen Gesellschafters, die innerhalb der letzten fünf<br />
Jahre vor Erlassung der Einzahlungsaufforderung (bzw vor dem gesellschaftsvertraglich<br />
festgelegten Zeitpunkt der Zahlungsverpflichtung) als Gesellschafter im Firmenbuch<br />
verzeichnet waren. Die Inanspruchnahme erfolgt in Form eines Reihenregresses. Mit der<br />
Zahlung erwirbt der Vormann ipso iure den Geschäftsanteil, ohne weitere Vergütungen<br />
leisten zu müssen.<br />
-‐ Zahlt keiner der Vormänner oder ist kein Vormann vorhanden, so ist nach §68 GmbHG<br />
der Anteil zu verwerten. Übersteigt der Erlös den geschuldeten Betrag, so ist er auf den<br />
noch unberichtigten Teil der Stammeinlage anzurechnen. Ein weiterer Überschuss fließt<br />
dem ausgeschlossenen Gesellschafter zu.<br />
-‐ Wenn eine Stammeinlage nicht von den bezeichneten Zahlungspflichtigen eingebracht<br />
und auch durch Verwertung des Geschäftsanteiles nicht gedeckt werden kann, so haben<br />
die übrigen Gesellschafter den Fehlbetrag nach dem Verhältnis ihrer Stammeinlagen<br />
aufzubringen.<br />
-‐ Der Ausgeschlossene verliert also den Geschäftsanteil und die bisherigen Einzahlungen.<br />
Er haftet außerdem weiter für den rückständigen Betrag und daneben auch noch für in<br />
Zukunft fällig werdende Einzahlungen.<br />
23. Was ist eine Genossenschaft?<br />
Die Genossenschaft ist gem §1 Abs 1 GenG eine Personenvereinigung mit<br />
Rechtspersönlichkeit von nicht geschlossener Mitgliederzahl, die im Wesentlichen der<br />
Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder dienen. Die Genossenschaft ist<br />
eine Körperschaft mit Rechtspersönlichkeit. Sie ist ins Firmenbuch einzutragen. Die<br />
gesetzliche Regelung ist weitgehend zwingend. Da auch die Genossenschaft juristische<br />
Person ist, braucht sie Organe für rechtsgeschäftliches Handeln. Zwingende Organe sind der<br />
Vorstand und die Generalversammlung. In bestimmten Fällen ist auch ein Aufsichtsrat<br />
erforderlich. Die Genossenschaft ist Unternehmer kraft Rechtsform. Wesentliches und<br />
charakteristisches Merkmal der Genossenschaft ist der Förderungsauftrag. Die<br />
Genossenschaft darf daher nicht primär auch Gewinnerzielung gerichtet sein. Der<br />
Gegenstand der Genossenschaft ergibt sich primär aus dem Förderungsauftrag. Die<br />
Personenanzahl bzw Mitgliedschaft ist nicht begrenzt, kann aber statutenmäßig auf einen<br />
bestimmten Personenkreis eingeschränkt sein. Das Gesetz kennt folgende Typen der<br />
Genossenschaft:<br />
-‐ Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung der Mitglieder<br />
-‐ Genossenschaft mit beschränkter Haftung der Mitglieder<br />
-‐ Genossenschaft mit Geschäftsanteilhaftung<br />
Die Genossenschaft muss zwingend den Firmenzusatz „eingetragene Genossenschaft“ bzw<br />
e.Gen. tragen.<br />
24. Wenn wir eine GmbH gründen wollen wie viel Geld müssen wir dann aufbringen?<br />
Das mindest Stammkapital einer GmbH beträgt 35.000€. Davon müssen die Gesellschafter<br />
mindestens 17.500€ einzahlen. Es gibt ein paar gesetzliche Ausnahmen wie zB Glückspiel<br />
oder Luftfahrt.<br />
58
25. Was ist eine Ein-‐Mann-‐Gesellschaft?<br />
Das ist eine Gesellschaft bei der alle Gesellschaftsanteile in einer Hand vereinigt sind. Ist nur<br />
bei Kapitalgesellschaften Möglich, nicht hingegen bei Personengesellschaften.<br />
26. Was wissen Sie über die Geschäftsführerhaftung?<br />
Nach §25 Abs 1 GmbHG haben die Geschäftsführer die Sorgfalt eines ordentlichen<br />
Geschäftsmannes anzuwenden. Das bedeutet, dass die Geschäftsführer die Kenntnisse und<br />
Fähigkeiten besitzen müssen, die für den Gesellschaftszweck der GmbH üblicherweise<br />
erforderlich sind. Bei Verletzung der Geschäftsführerpflichten besteht für die betroffenen<br />
Geschäftsführer Haftung zur ungeteilten Hand für den daraus entstandenen Schaden (§25<br />
Abs 2 GmbHG). Es handelt sich um eine Verschuldenshaftung. Das DHG ist nach hA nicht<br />
anzuwenden.<br />
Die daraus resultierenden Schadenersatzansprüche stehen der Gesellschaft zu (vertreten<br />
durch den Aufsichtsrat, wenn ein solcher fehlt, durch andere Geschäftsführer oder einen<br />
besonders bestellten Prozessvertreter. In der Insolvenz der GmbH ist der Anspruch vom<br />
Insolvenzverwalter geltend zu machen). Der Anspruch verjährt nach §25 Abs 6 in fünf Jahren.<br />
Die Gläubiger der Gesellschaft haben keinen unmittelbaren Anspruch darauf, dass die<br />
Gesellschaft diese Ansprüche auch verfolgt, um Mittel zur Gläubigerbefriedigung zu erhalten.<br />
Ein Weisungsbeschluss der Gesellschafter, der zu einer schadensverursachenden<br />
Geschäftsführerhandlung führt, wirkt grundsätzlich haftungsentlastend.<br />
27. Unterschied Zweigniederlassung und Tochtergesellschaft?<br />
Eine Zweigniederlassung ist nur eine Nebenstelle oder Filiale, sie hat keine<br />
Rechtspersönlichkeit und unterscheidet sich nicht durch den Rechtsträger der Hauptstelle.<br />
Weiters hat sie keine eigene Rechtspersönlichkeit. Anders hingegen die Tochtergesellschaft,<br />
die einen eigenen Rechtsträger und eigene Rechtspersönlichkeit hat. Sie steht zwar in einem<br />
gewissen Abhängigkeitsverhältnis zum Mutterkonzern ist aber dennoch eine eigene<br />
Gesellschaft.<br />
28. Was wissen Sie über die Generalversammlung der GmbH?<br />
Die §§34ff GmbHG regeln die Bestimmungen zu der Generalversammlung. Die<br />
Generalversammlung ist das oberste willensbildende Organ der GmbH. Sie wird durch die<br />
Gesamtheit der Gesellschafter gebildet. Sie ist für alle Gesellschaftsangelegenheiten<br />
zuständig, die ihr nicht im Gesetz oder durch Gesellschaftsvertrag entzogen der anderen<br />
Organen zugewiesen sind. In der Generalversammlung kann der einzelne Gesellschafter<br />
durch Ausübung seines Stimmrechts Einfluss auf die Entscheidungen der Gesellschaft<br />
nehmen. Die Willensbildung der GmbH erfolgt grundsätzlich durch Beschlüsse.<br />
Beschlüsse sind idR mehrseitige Rechtsgeschäfte, mit denen der Beschlussinhalt als Wille der<br />
Gesellschaft verbindlich festgelegt wird.<br />
Nach §36 Abs 1 GmbHG berufen idR die Geschäftsführer die Generalversammlung am Sitz<br />
der Gesellschaft ein. Es ist mindestens einmal jährlich eine Generalversammlung<br />
einzuberufen (ordentliche Generalversammlung). Geschäftsführer und Aufsichtsrat sind<br />
außerdem zur Einberufung verpflichtet, wenn es das Wohl der GmbH erfordert<br />
(außerordentliche Generalversammlung).<br />
Die Einberufung erfolgt in der gesellschaftsvertraglich festgelegten Form. Ist nichts<br />
festgelegt, so hat sie in Form eines eingeschriebenen Briefes zu erfolgen.<br />
Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn der im Gesetz (10%) oder im<br />
Gesellschaftsvertrag festgesetzte Teil des Stammkapitals anwesend oder vertreten ist. Ist das<br />
nicht der Fall, so ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die<br />
Höhe des vertretenen Stammkapitals beschlussfähig ist.<br />
59
Zur Teilnahme an der Generalversammlung ist grundsätzlich jeder im Firmenbuch<br />
eingetragener Gesellschafter berechtigt. Das gilt auch für jene Gesellschafter, die einem<br />
Stimmverbot unterliegen.<br />
Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen<br />
Stimmen gefasst, soweit im Gesetz und Vertrag nichts anderes bestimmt ist.<br />
29. Was wissen Sie über die Beendigung der GmbH?<br />
Die Auflösung der GmbH erfolgt durch gesetzliche oder vertragliche Auflösungsgründe. Zu<br />
den gesetzlichen Auflösungsgründen vgl §84 GmbHG.<br />
-‐ Zeitablauf bei Gesellschaften auf Zeit<br />
-‐ Gesellschafterbeschluss<br />
-‐ Verschmelzung<br />
-‐ Konkurseröffnung bzw Nichteröffnung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens<br />
-‐ Verwaltungsbehördliche Verfügung<br />
-‐ amtswegige Löschung durch das Firmenbuchgericht<br />
Dazu kommen (nach anderen Rechtsgrundlagen):<br />
-‐ Nichteröffnung bzw Aufhebung des Insolvenzvermögens mangels kostendeckenden<br />
Vermögens<br />
-‐ Löschung wegen Vermögenslosigkeit<br />
-‐ Verstaatlichung<br />
-‐ Umgründung<br />
Als gesellschaftsvertragliche Auflösungsgründe kommen in der Praxis etwa eingeräumte<br />
Kündigungsrechte oder die Insolvenz eines Gesellschafters vor.<br />
Die GmbH ist im Auflösungszeitpunkt idR noch nicht beendet, es schließt sich das<br />
Liquidationsstadium an. Die Auflösung ist von den Geschäftsführern beim Firmenbuchgericht<br />
anzumelden. Bei Unterlassung der Anmeldung oder amtswegiger Kenntnisnahme ist die<br />
Auflösung von Amts wegen einzutragen. Mit Beginn des Liquidationsstadiums tritt eine<br />
Änderung des Gesellschaftszweckes ein (Abwicklungszweck).<br />
30. Wer bestellt die Organvertreter bei der GmbH?<br />
Die GmbH ist juristische Person mit eigener Rechtspersönlichkeit. Als juristische Person<br />
braucht sie Organe die sie für handeln und vertreten. Bei der GmbH gibt es die<br />
Geschäftsführung, (gegebenenfalls gem §29 GmbHG) einen Aufsichtsrat, den<br />
Abschlussprüfer und eine Generalversammlung. An der Generalversammlung ist jeder<br />
Gesellschafter beteiligt. Diese bestimmt den Aufsichtsrat (mind 3 physische Personen;<br />
Drittelparität), den Abschlussprüfer und die Geschäftsführung. Der erste Aufsichtsrat sowie<br />
der erste Abschlussprüfer können durch den Gesellschaftsvertrag bestellt werden.<br />
31. Satzungsinhalt der GmbH?<br />
Der notwendige Inhalt des Gesellschaftsvertrages (Satzung oder Statut genannt) ergibt sich<br />
aus §4 GmbHG. Dazu zählen Firma und Sitz der Gesellschaft, Gegenstand des Unternehmens,<br />
Höhe des Stammkapitals, Betrag der Stammeinlage der Gesellschafter. Dazu komme allfällige<br />
Vereinbarungen über besondere Begünstigungen eines Gesellschafters, über<br />
Gründungskosten oder Sacheinlagen. Alle anderen Regelungen des Gesellschaftsvertrages<br />
bilden den fakultativen Inhalt.<br />
60
32. Gesellschafterbeschluss verstößt gegen Vorschrift – was kann ich als Gesellschafter<br />
dagegen tun?<br />
Die fehlerhaften und gesetzwidrigen Beschlüsse sind in den §§41ff GmbHG geregelt. Diese<br />
regeln die Klage auf Nichtigerklärung eines Gesellschafterbeschlusses. Sie ist damit keine<br />
Feststellungsklage, sondern eine Rechtsgestaltungsklage (Anfechtung). Anfechtbare<br />
Beschlüsse gem §41 Abs 1 GmbHG sind:<br />
-‐ Beschlüsse, die nach dem GmbHG oder dem Gesellschaftsvertrag als nicht zustande<br />
gekommen anzusehen sind (formelle Mängel)<br />
-‐ Beschlüsse, die dem Inhalt nach gegen zwingende Normen des Gesetzes oder den<br />
Gesellschaftsvertrag verstoßen (inhaltliche oder materielle Mängel)<br />
Die Anfechtungsbefugnis steht allen in der Generalversammlung erschienenen<br />
Gesellschaftern zu, die Widerspruch zu Protokoll gegeben haben, sowie jedem nicht<br />
erschienenen Gesellschafter, der unberechtigterweise nicht zugelassen war oder durch<br />
Mängel in der Einberufung am Erscheinen gehindert war. Bei schriftlichen Beschlüssen ist<br />
jeder Gesellschafter anfechtungsbefugt, der übergangen wurde oder der gegen den<br />
Beschluss gestimmt hat.<br />
Die Anfechtungsfrist beträgt einen Monat ab Absendung des Beschlusses an die<br />
Gesellschafter. Die Klage ist gegen die Gesellschaft zu richten. Die Anfechtung schiebt die<br />
Wirksamkeit des Gesellschafterbeschlusses nicht hinaus, sie kann jedoch bei einem<br />
drohenden unwiederbringlichen Nachteil für die Gesellschaft mit einer einstwilligen<br />
Verfügung verbunden werden.<br />
Das die Nichtigkeit erklärende Urteil wirkt für und gegen alle Gesellschafter und führt zur ex-‐<br />
tunc-‐Nichtigkeit des Beschlusses.<br />
33. Wie oft muss eine Generalversammlung stattfinden? Von wem wird sie einberufen?<br />
Gem §36 Abs 1 GmbHG berufen idR die Geschäftsführer die Generalversammlung am Sitz der<br />
Gesellschaft ein. Die Generalversammlung muss mindestens einmal jährlich einberufen<br />
werden (ordentliche Generalversammlung). Geschäftsführer und Aufsichtsrat sind<br />
außerdem zur Einberufung verpflichtet, wenn es das Wohl der GmbH erfordert<br />
(außerordentliche Generalversammlung). Eine besondere Pflicht zur Einberufung besteht<br />
bei Verlust der Hälfte des Stammkapitals.<br />
Die Einberufung erfolgt in der gesellschaftsvertraglich festgelegten Form. Ist nichts<br />
festgelegt, so hat sie in Form einer Verständigung durch einen eingeschriebenen Brief zu<br />
erfolgen.<br />
34. Was ist der Sitz der Gesellschaft?<br />
Das ist der Hauptstandort der Gesellschaft. Der ist dort, wo sich Verwaltung und<br />
Geschäftsführung befinden. Das ist also quasi die Zentrale des Unternehmens (Apple,<br />
Cupertino). Als Sitz der Gesellschaft ist der Ort zu bestimmen, wo die Gesellschaft einen<br />
Betrieb hat oder wo sich die Geschäftsleitung befindet oder die Verwaltung geführt wird.<br />
Auch von dieser Vorschrift darf aus wichtigem Grund abgewichen werden (§5 AktG).<br />
35. Wie kommt die Geschäftsführung zustande?<br />
Die Geschäftsführer (seien es Gesellschafter oder Drittorgane) werden durch<br />
Gesellschafterbeschluss bestellt, der in der Generalversammlung oder außerhalb in<br />
schriftlicher Form gefasst wird. Gesellschafter können auch bereits im Gesellschaftsvertrag<br />
zu Geschäftsführern bestellt werden. Es ist mindestens ein Geschäftsführer zu bestellen<br />
(physische Person). Die jeweiligen Geschäftsführer bzw das Erlöschen oder eine Änderung<br />
der Vertretungsbefugnis sind ohne Verzug zum Firmenbuch anzumelden.<br />
61
36. Was wissen Sie über den Notgeschäftsführer? Was wenn dieser Geschäfte abschließt<br />
obwohl schon ein neuer Geschäftsführer bestellt wurde?<br />
Nach §15a GmbHG hat das Firmenbuchgericht in dringenden Fällen auf Antrag eines<br />
Beteiligten einen oder mehrere Geschäftsführer zu bestellen, wenn die zur Vertretung der<br />
Gesellschaft erforderlichen Geschäftsführer fehlen oder kein Geschäftsführer seinen<br />
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Die Bestellung erfolgt für die Zeit bis zur Behebung<br />
des Mangels (sog Notgeschäftsführer). Die gerichtliche Bestellung setzt voraus, dass<br />
entweder überhaupt kein Geschäftsführer vorhanden ist oder die vorhandenen<br />
handlungsunfähig sind bzw keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben. Beteiligter<br />
kann ein Gesellschafter, ein Organmitglied, aber auch ein Gesellschaftsgläubiger sein.<br />
37. Was bekommt ein Gesellschafter, der ausscheidet?<br />
Der ausscheidende Gesellschafter erhält eine Abfindung. Diese setzt sich zusammen aus der<br />
Stammeinlage und des ihm zugesicherten Gewinns bzw Verlustes.<br />
38. Was ist der Unternehmensgegenstand, was der Gesellschaftszweck bei der GmbH?<br />
Der Unternehmensgegenstand ist der Teil der in der Satzung steht womit ich den<br />
Gesellschaftszweck erreiche. Es gibt ideelle und materielle Gesellschaftszwecke. Ich betreibe<br />
eine Suppenküche (Unternehmensgegenstand) um Obdachlose mit Essen zu versorgen<br />
(ideeller Gesellschaftszweck). Bei der GmbH gibt es nur wenig Beschränkungen, alles was<br />
erlaubt ist kann also der Gesellschaftszweck sein.<br />
39. Unterschied zwischen Verschmelzung und Einbringung?<br />
Verschmelzung bedeutet die Vereinigung von Gesellschaften mit eigener<br />
Rechtspersönlichkeit unter Ausschluss der Liquidation im Wege der Gesamtrechtsnachfolge<br />
(Universalsukzession). Gesellschaften verschmelzen miteinander. Eine Verschmelzung kann<br />
aber auch als Sacheinlage eingebracht werden.<br />
40. Wie kann man aus zwei GmbHs eine machen?<br />
Mittels einer Spaltung. Bei den Kapitalgesellschaften allgemein mit Spaltung und bei<br />
Personengesellschaften mit einer Realteilung.<br />
41. Was ist eine Spaltung? Wie funktioniert sie?<br />
Eine Vermögensspaltung von Kapitalgesellschaften (also auch von AG) ist in vier<br />
Grundformen möglich. Aufspaltung zur Neugründung, Aufspaltung zur Aufnahme,<br />
Abspaltung zur Neugründung und Aufspaltung zur Aufnahme.<br />
Die Übertragung erfolgt gegen Gewährung von Anteilen (Aktien oder Geschäftsanteilen) der<br />
neuen bzw aufnehmenden Gesellschaft(en) an die Anteilsinhaber der übertragenden<br />
Gesellschaft. Möglich sind dabei auch nicht verhältniswahrende Spaltungen. In diesem Fall ist<br />
ein Austritt jener Gesellschafter, die der Spaltung nicht zugestimmt haben, gegen Gewährung<br />
einer angemessenen Barablöse möglich (§9 SpaltG).<br />
Bei einer rechtsformübergreifenden Spaltung steht den Anteilsinhabern unter den<br />
Voraussetzungen des §11 SpaltG ebenfalls ein Anspruch auf angemessene Barabfindung zu.<br />
Folgendes schildert das Verfahren in Grundzügen.<br />
Der Vorstand (die Geschäftsführer) der übertragenden Gesellschaft hat einen Spaltungsplan<br />
aufzustellen, in dem ua das Umtauschverhältnis der Anteile, die Einzelheiten des Erwerbs der<br />
Anteile an den beteiligten Gesellschaften, die Rechte der Anteilsinhaber an den neuen<br />
Gesellschaften und gegebenenfalls die angebotenen Barabfindungen festzulegen sind.<br />
Sodann ist ein Spaltungsbericht zu erstellen.<br />
Prüfungen erfolgen durch einen Spaltungsprüfer und durch den Aufsichtsrat der<br />
übertragenden Gesellschaft. Bei der Spaltung zur Aufnahme gelten für die übernehmende<br />
Gesellschaft die Vorschriften über die Verschmelzung durch Aufnahme. Wichtig sind<br />
insbesondere die Gläubiger-‐ und Gesellschafterschutzvorschriften.<br />
62
Die Spaltung bedarf sodann eines Beschlusses der Anteilsinhaber, der notariell zu<br />
beurkunden ist. Entsprechend dem Spaltungsplan werden die Anteile an den beteiligten<br />
Gesellschaften erworben.<br />
42. Wie kommt es dazu, dass eine Gesellschaft liquidiert wird?<br />
Wenn eine Gesellschaft aufgelöst wird kommt es zur Liquidation. Bei den<br />
Umgründungsformen kommt es zu keiner Liquidation ebenso nicht wenn das<br />
Insolvenzverfahren über dem Vermögen der Gesellschaft eröffnet wurde.<br />
43. Was passiert mit dem Anteil eines ausscheidenden Gesellschafters?<br />
Den Gesellschaftsanteil eines ausscheidenden Gesellschafters können die verbleibenden<br />
Gesellschafter entweder kaufen oder aber sie veräußern den Anteil. Erwirbt ein oder<br />
mehrere Gesellschafter den Anteil so steigt seine Anteilsbeteiligung an der Gesellschaft.<br />
Kauft ein Dritter den Anteil so tritt er automatisch als Gesellschafter in die Gesellschaft ein.<br />
44. Wie werden GmbH-‐Anteile veräußert? Welchen Formpflichten unterliegt ein Vorvertrag<br />
bei einer GmbH Anteilsveräußerung?<br />
Gesellschafterstellung kann auch durch Übertragung der Gesellschafterstellung erworben<br />
werden. Die Übertragung ist nach §76 Abs 2 GmbHG durch Notariatsakt erschwert (Zweck:<br />
„Immobiliarisierung“ der GmbH-‐Geschäftsanteile, daneben Klarstellung der<br />
Gesellschaftereigenschaft). Formpflichtig sind nach neuerer Rsp sowohl das Verpflichtungs-‐<br />
als auch das Verfügungsgeschäft. Formpflichtig sind auch Vereinbarungen, die den<br />
Gesellschafter zur künftigen Übertragung seines Geschäftsanteils verpflichten.<br />
45. Was sind vinkulierte Aktien?<br />
Das sind so genannte gebundene Aktien. Die Übertragung von Namensaktien kann durch die<br />
Satzung an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden werden. Die Zustimmung gibt der<br />
Vorstand, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt. Sie darf nur aus wichtigem Grund<br />
verweigert werden. Bei Verweigerung kann der Aktionär einen Antrag beim<br />
Firmenbuchgericht auf Gestattung der Übertragung stellen. Das Gericht hat dann im<br />
Außerstreitverfahren zu prüfen, ob ein wichtiger Grund vorliegt und ob die Übertragung<br />
ohne Schädigung der Gesellschaft, der übrigen Gesellschafter und der Gesellschaftsgläubiger<br />
erfolgen kann. Verneint das Gericht das Vorliegen eines wichtigen Grundes und stimmt es<br />
der Übertragung deshalb zu, so kann die Gesellschaft einen Ersatzerwerber zu gleichen<br />
Konditionen benennen.<br />
Eine Vinkulierung ist zwingend für Aktien, die mit dem Recht der Entsendung eines Mitglieds<br />
in den Aufsichtsrat verbunden ist, bei den Nebenleistungsaktien und durch sondergesetzliche<br />
Anordnung bei bestimmten Aktiengesellschaften.<br />
Eine Übertragung vinkulierter Aktien ohne Zustimmung der AG wird von der hA als<br />
unwirksam angesehen.<br />
46. Was sind Vorratsaktien?<br />
Vorratsaktien sind Aktien, die von einem Gründer oder Zeichner oder in Ausübung eines<br />
Bezugsrechts für Rechnung der Gesellschaft oder eines Tochterunternehmens übernommen<br />
werden. Der Aktionär haftet ohne Rücksicht auf abweichende Vereinbarungen auf die volle<br />
Einlage. Er kann sich nicht darauf berufen, die Aktie nicht auf eigene Rechnung übernommen<br />
zu haben. Bevor er die Aktie für eigene Rechnung übernommen hat, stehen ihm jedoch keine<br />
Rechte aus der Aktie zu.<br />
Manchmal werden Vorratsaktien auch Verwaltungs-‐ oder Verwertungsaktien bezeichnet.<br />
63
47. Beschreiben Sie den Ablauf bei der Gründung einer AG?<br />
-‐ Abschluss eines Vorgründungsvertrages (Vorvertrag; Notariatsakt notwendig)<br />
-‐ Feststellung der Satzung durch den/die Gründer. Gem §16 Abs 1 AktG ist die Satzung in<br />
Form eines Notariatsaktes festzustellen.<br />
-‐ Übernahme der Aktien durch den/die Gründer. Damit ist die Gesellschaft errichtet, sie<br />
besteht aber vor der Eintragung in das Firmenbuch noch nicht als AG, besteht also wie<br />
bei der GmbH eine Vorgesellschaft. Gleichzeitig müssen Verträge über Sacheinlage und<br />
Sachübernahmen abgeschlossen werden.<br />
-‐ Die Gründer bestellen sodann den ersten Aufsichtsrat und die ersten Abschlussprüfer<br />
(notarielle Beurkundung erforderlich). Der Aufsichtsrat bestellt sodann den ersten<br />
Vorstand.<br />
-‐ Erstattung eines schriftlichen Berichts über den Gründungshergang durch die Gründer.<br />
-‐ Prüfung des Grundherganges durch Vorstand, Aufsichtsrat und unabhängige<br />
Gründungsprüfer. Die Gründungsprüfer werden vom Gericht aus dem in §25 Abs 4 AktG<br />
genannten Personenkreis bestellt. Zu prüfen ist vor allem die Angemessenheit der<br />
vereinbarten Leistungen für den Gründungsaufwand und die Bewertung von<br />
Sacheinlagen und Sachübernahmen.<br />
-‐ Antrag auf Bemessung der Gesellschaftssteuer und Einholung der steuerlichen<br />
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes.<br />
-‐ Leistung der Bareinlagen und der Sacheinlagen.<br />
-‐ Anmeldung der Gesellschaft zur Eintragung in das Firmenbuch durch alle Gründer und<br />
alle Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat.<br />
-‐ Prüfung durch das Firmenbuchgericht, ob die gesetzlichen Gründungsvorschriften<br />
eingehalten wurden und ob der Inhalt der Satzung gesetzeskonform ist. Mit der<br />
Eintragung entsteht die AG wirksam.<br />
48. Welche Organe gibt es bei der AG und wer bestellt sie?<br />
Die Organisation der AG beruht auf dem Grundsatz der Drittorganschaft. Es bestehen<br />
weitgehend zwingende Regeln. Die AG kennt vier obligatorische Organe. Den Vorstand, den<br />
Aufsichtsrat, die Hauptversammlung und die Abschlussprüfer. Neben diesen zwingenden<br />
Organen sind auch fakultative Organe möglich (z.B. ein Beirat als beratendes Organ). Der<br />
Vorstand wird durch den Beschluss des Aufsichtsrates auf höchstens fünf Jahre bestellt (eine<br />
Wiederbestellung ist möglich). Es ist mindestens ein Mitglied (natürliche Person) zu<br />
bestellen. Der Aufsichtsrat hat aus mindestens drei Mitgliedern (physische Personen) zu<br />
bestehen (ohne Einrechnung der Arbeitnehmervertreter). Die Satzung kann eine höhere Zahl<br />
(maximal 20) vorsehen. Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder durch die Gründer (erster<br />
Aufsichtsrat). Wahl durch die Hauptversammlung (Normalfall) mit<br />
Minderheitensonderrechten. Die Satzung kann bestimmten Aktionären oder den jeweiligen<br />
Inhabern von vinkulierten Namensaktien das Recht einräumen, ein Aufsichtsratsmitglied zu<br />
entsenden. Hat der Aufsichtsrat länger als drei Monate nicht die zur Beschlussfähigkeit<br />
nötige Zahl von Mitgliedern, so kann auf Antrag des Vorstandes, eines Aufsichtsratsmitglieds<br />
oder eines Aktionärs eine Bestellung durch das Gericht erfolgen. Nach dem Grundsatz der<br />
Drittelparität, dh dass für zwei von der AG bestellte Aufsichtsräte ein weiterer Aufsichtsrat<br />
vom Betriebsrat zu entsenden ist (bei ungerader Zahl einer mehr). Die Funktionsdauer der<br />
Aufsichtsratsmitglieder ist funktionell festgelegt (aus der Norm ergibt sich eine<br />
Aufsichtsratsperiode von maximal 5-‐6 Jahren). Die Hauptversammlung ist die Versammlung<br />
der Aktionäre und dient der gemeinschaftlichen Willensbildung in<br />
Gesellschaftsangelegenheiten. Sie beschließt in den im Gesetz oder der Satzung ausdrücklich<br />
bestimmten Fällen. Sie muss an einem Ort im Inland einberufen werden, den die Satzung<br />
bestimmt. Abschlussprüfer mindestens einer ist bei der AG zwingend. Sie werden von der<br />
Hauptversammlung gewählt (die Abschlussprüfer für den ersten Jahresabschluss werden von<br />
den Gründern bestellt).<br />
64
49. Überblick über die Organfunktionen?<br />
Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft (er besitzt<br />
das Geschäftsführungs-‐ und Vertretungsmonopol in der AG).<br />
Dem Aufsichtsrat ist die Bestellung und die Abberufung des Vorstands sowie seine<br />
Überwachung zugewiesen. Außerdem bestehen Zustimmungsbefugnisse für bestimmte<br />
Geschäfte.<br />
Der Hauptversammlung ist die Bestellung und Abberufung des Aufsichtsrates und des<br />
Abschlussprüfers zugewiesen. Sie hat außerdem über Satzungsänderungen und über die<br />
Gewinnverteilung zu beschließen.<br />
Dem Abschlussprüfer obliegt die Kontrolle der Rechnungslegung und die Erteilung des<br />
Bestätigungsvermerkes.<br />
50. Was sind die Aufgaben des Aufsichtsrates?<br />
-‐ Bestellung und Abberufung des Vorstandes<br />
-‐ Überwachung des Vorstandes<br />
-‐ Zustimmung zu bestimmten Geschäften<br />
-‐ Einberufung der Hauptversammlung, wenn es das Wohl der Gesellschaft erfordert<br />
-‐ Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses<br />
51. Was versteht man unter der Hauptversammlung?<br />
Die Hauptversammlung ist die Versammlung der Aktionäre und dient der gemeinschaftlichen<br />
Willensbildung in Gesellschaftsangelegenheiten. Sie beschließt in den im Gesetz oder der<br />
Satzung ausdrücklich bestimmten Fällen. Sie muss an einem Ort im Inland einberufen<br />
werden, den die Satzung bestimmt.<br />
52. Wie beruft der Vorstand die Hauptversammlung ein?<br />
Zur Einberufung berechtigt ist der Vorstand für die ordentliche Hauptversammlung, im Fall<br />
eines Verlustes in der Höhe des halben Grundkapitals oder bei berechtigtem Antrag einer<br />
Aktionärsminderheit. Der Vorstand ist zur Mitwirkung verpflichtet. Das<br />
Einberufungsverfahren ist in den §§106ff AktG detailliert geregelt. Die Bekanntmachung der<br />
Einberufung muss durch Veröffentlichung erfolgen. Sind die Aktionäre namentlich bekannt,<br />
so kann stattdessen per Einschreibebrief oder ein Email einberufen werden (sofern die<br />
Satzung das nicht ausschließt). Bei einer ordentlichen Hauptversammlung ist die Einberufung<br />
bis spätestens am 28. Tag, ansonsten spätestens am 21. Tag vor dem Termin bekannt zu<br />
machen.<br />
Wird die Hauptversammlung von einem Nichtberechtigten einberufen oder nicht gehörig<br />
bekannt gemacht, so sind die gefassten Beschlüsse nichtig, falls nicht sämtliche Aktionäre<br />
anwesend oder zumindest vertreten sind.<br />
53. Was sind die wichtigsten Gegenstände der Beschlussfassung?<br />
-‐ Gewinnverteilung und Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrar, allenfalls Feststellung<br />
des Jahresabschlusses<br />
-‐ Wahl der Aufsichtsratsmitglieder und der Abschlussprüfer<br />
-‐ Beschlussfassung über von Vorstand oder Aufsichtsrat vorgelegte<br />
Geschäftsführungsangelegenheiten<br />
-‐ Bestellung von Sonderprüfern<br />
-‐ Satzungsänderungen<br />
-‐ Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegenüber Vorstand und Aufsichtsrat<br />
54. Was können Aktionäre machen, wenn keine ordnungsgemäße Bekanntmachung erfolgte?<br />
Beschlüsse, die unter bestimmten Einberufungs-‐ und Beurkundungsmängeln leiden, sind<br />
nichtig. Die Nichtigkeit kann mit Feststellungsklage nach §201 AktG, aber auch durch Einrede<br />
geltend gemacht werden. Die Klage kann von jedem Aktionär, dem Vorstand sowie jedem<br />
65
einzelnen Vorstands-‐ sowie Aufsichtsratsmitglied erhoben werden. Ferner kann jeder Dritte,<br />
der ein rechtliches Interesse an der Feststellung der Nichtigkeit eines Beschlusses<br />
nachweisen kann, Klage erheben.<br />
55. Was ist die nominelle Kapitalerhöhung?<br />
Bei der nominellen Kapitalerhöhung (Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln) werden<br />
offene Rücklagen in Grundkapital umgewandelt. Die gesetzliche Rücklage darf dadurch nicht<br />
unter 10% des Grundkapitals sinken. Die Kapitalerhöhung heißt nominell, weil das<br />
Gesellschaftsvermögen nicht verändert wird. Die neu ausgegeben Aktien fallen den<br />
Aktionären anteilsmäßig zu. Das sind sogenannte Gratisaktien, da für die Aktionäre keine<br />
neuen Einlageverpflichtungen entstehen. Bezugsrechte sind daher nicht erforderlich.<br />
56. Was ist die bedingte Kapitalerhöhung?<br />
Die bedingte Kapitalerhöhung ist eine besondere Kapitalerhöhungsform zu bestimmten<br />
Zwecken.<br />
57. Was ist eine Stammaktie?<br />
Der Begriff Stammaktie bezeichnet die Eigenschaft einer Aktie, mit Stimmrechten behaftet zu<br />
sein. Das Gegenstück zu einer Stammaktie ist die Vorzugsaktie, die keine Stimmrechte hat,<br />
jedoch im Ausgleich dazu bevorzugt wird (z.B. bei Dividenden).<br />
58. Was wissen Sie über Umlaufbeschlüsse bei der GmbH?<br />
Die Willensbildung der GmbH erfolgt durch Beschlüsse der Generalversammlung, sie können<br />
in der Generalversammlung gefasst werden oder auch auf schriftlichem Wege (sogenannte<br />
Umlaufbeschlüsse). Dort wird die erforderliche Mehrheit nicht nach der Zahl der<br />
abgegebenen, sondern nach der Gesamtzahl der allen Gesellschaftern zustehenden Stimmen<br />
berechnet (Stimmrecht der einzelnen Gesellschafter bemisst sich idR nach der<br />
übernommenen Stammeinlage. Eine Stimme je volle 10€. Es kann anderes vereinbart<br />
werden).<br />
59. Ein Scheich möchte bei der AUA einsteigen? Wie erhält er Aktien, wenn die restlichen<br />
Aktionäre nicht verkaufen wollen?<br />
Durch eine Kapitalerhöhung. Einbringung neuer Mittel durch Einlagen der Gesellschafter<br />
oder Dritter gegen Ausgabe von Aktien („junge Aktien“). Die Erhöhung des Grundkapitals<br />
bedarf einer Dreiviertelmehrheit in der Hauptversammlung und den Aktionären kommt ein<br />
Bezugsrecht zu, entsprechend ihrem bisherigen Anteil. Das Bezugsrecht kann nur im<br />
Erhöhungsbeschluss der Hauptversammlung mit Dreiviertelmehrheit ganz oder teilweise<br />
ausgeschlossen werden (wichtiger Grund). Der Vorstand muss der Hauptversammlung einen<br />
schriftlichen Bericht über den Ausschlussgrund erstatten. Mit Eintragung der Durchführung<br />
ins Firmenbuch ist die Kapitalerhöhung wirksam. Aber wenn es darum geht, dass ein neuer<br />
Investor sich beteiligen will, muss man die Aktionäre irgendwie von ihrem Bezugsrecht<br />
ausschließen. Für solche Fälle gibt es die bedingte Kapitalerhöhung. Denn hier besteht kein<br />
Aktionärsbezugsrecht.<br />
60. Was ist eine Anleihe?<br />
Eine Anleihe ist ein Vertrag, in dem genau geregelt ist, dass im Zuge einer Anleihe-‐Emission<br />
(Ausgabe) mehrere Zeichner (Anleger) dem Emittenten (Ausgeber) für eine vereinbarte<br />
Laufzeit und Verzinsung ein bestimmtes Kapital überlassen. Der Zeichner ist somit Gläubiger<br />
des Emittenten und hat ein Recht auf Verzinsung sowie auf Rückzahlung (Tilgung) zu<br />
behalten oder sie vorher weiterzuverkaufen. Verändert sich das allgemeine Zinsniveau, das<br />
66
in erster Linie von volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängt, dann ändert sich<br />
auch der Preis der Anleihe bei einem vor der Tilgung liegenden Kauf oder Verkauf. Steigt das<br />
Zinsniveau, so fällt der Preis der Anleihe. Fällt allerdings das Zinsniveau, so steigt der Preis<br />
der Anleihe. Der Verkauf von Wertpapieren bei der Emission wird als Primärmarkt<br />
bezeichnet, der Handel an den Märkten des Börseunternehmens oder der außerbörsliche<br />
Handel als Sekundärmarkt.<br />
Was ist die Bedeutung von Anleihen?<br />
Bei Anleihen gibt es im Voraus vereinbarte Zinsen, die in der Regel höher als bei einem<br />
Sparbuch sind. Die Verzinsung kann über die gesamte Laufzeit fix sein oder variieren.<br />
Anleihen können jederzeit verkauft werden, allerdings besteht ein gewisses Kursrisiko. Ein<br />
entscheidendes Thema für Anleger ist die Bonität des Emittenten, also dessen Fähigkeit,<br />
während der Laufzeit der Anleihe alle finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen.<br />
Was gibt es für Arten von Anleihen?<br />
Es gibt fix verzinste und variabel-‐verzinste Anleihen. Weiters die Nullkupon-‐Anleihen,<br />
Wandelanleihen, Optionsanleihen, Gewinn und Schuldverschreibungen, Inlands-‐ und<br />
Auslandsanleihen.<br />
61. Was wissen Sie über die Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung bei der GmbH?<br />
Kapitalerhöhung<br />
Die Kapitalerhöhung ist eine Änderung des Gesellschaftsvertrages, bei der das Stammkapital<br />
der Gesellschaft erhöht wird. Man unterscheidet die effektive Kapitalerhöhung durch<br />
Einbringung zusätzlicher Mittel und die nominelle Kapitalerhöhung.<br />
Ordentliche (effektive) Kapitalerhöhung<br />
Die Erhöhung des Stammkapitals setzt einen Beschluss mit Dreiviertelmehrheit voraus, der<br />
notariell beurkundet werden muss. Die Erhöhung kann auf einen festen Betrag lauten, es<br />
kann aber auch ein Höchstbetrag festgelegt werden. Die Zulässigkeit von Sacheinlagen bzw<br />
Sachübernahmen bei einer Kapitalerhöhung richtet sich also nach §6a GmbHG.<br />
Zur Übernahme der neuen Stammeinlagen können Gesellschafter oder auch andere<br />
Personen zugelassen werden. Die Gesellschafter haben ein vorrangiges Bezugsrecht nach<br />
Maßgabe ihrer bisherigen Beteiligungsquote. Das Bezugsrecht kann allerding durch<br />
Gesellschafterbeschluss ausgeschlossen werden. Die Übernahme aufgrund eines<br />
Übernahmevertrages zwischen Übernehmer und Gesellschaft durch Übernahmserklärung in<br />
Form eines Notariatsakts und die Einzahlung des erforderlichen Mindestbetrages. Die<br />
Kapitalerhöhung ist zum Firmenbuch anzumelden und wird mit Eintragung wirksam.<br />
Nominelle Kapitalerhöhung (Kapitalberichtigung)<br />
Die nominelle Kapitalerhöhung oder Kapitalberichtigung bewirkt eine Kapitalerhöhung aus<br />
Gesellschaftsmitteln. Die nominelle Kapitalerhöhung hat den Zweck, das Stammkapital aus in<br />
der Gesellschaft selbst vorhandenen Mitteln zu erhöhen, was idR die Kreditwürdigkeit der<br />
Gesellschaft vergrößert. Für die Gesellschaftsgläubiger bietet sie den Vorteil, dass<br />
Gesellschaftsmittel, die als Rücklagen aufgelöst werden könnten, so in der Gesellschaft<br />
gebunden bleiben. Die nominelle Kapitalerhöhung erfolgt durch die Umwandlung offener<br />
Rücklagen in Stammkapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftsvermögen bleibt also<br />
67
unverändert. Die Kapitalberichtigung ist zum Firmenbuch anzumelden und wird mit der<br />
Eintragung wirksam.<br />
Kapitalherabsetzung<br />
Unter Kapitalherabsetzung versteht man die Verminderung des Stammkapitals einer<br />
Gesellschaft. Sie kann verschiedenen Zwecken dienen, beispielsweise der Ausschüttung<br />
überflüssiger Eigenmittel der GmbH an die Gesellschafter.<br />
Ordentliche (effektive) Kapitalherabsetzung<br />
Die ordentliche Kapitalherabsetzung ist eine effektive. Sie führt zur Rückzahlung von<br />
Stammeinlagen an die Gesellschafter oder zu einer Befreiung von Einlageverpflichtungen.<br />
Auch sie ist eine Änderung des Gesellschaftsvertrages und bedarf damit eines<br />
Gesellschafterbeschlusses mit Dreiviertelmehrheit.<br />
Nominelle Kapitalherabsetzung<br />
Bei der nominellen Kapitalherabsetzung erfolgt eine (proportionale) Herabsetzung des<br />
Nennbetrages der Stammeinlagen und damit des Stammkapitals, um Gesellschaftsverluste<br />
auszugleichen. Es erfolgt keine Auszahlung an die Gesellschafter bzw keine Befreiung von<br />
Einlageverpflichtungen.<br />
Vereinfachte nominelle Kapitalherabsetzung<br />
Es handelt sich dabei um eine nominelle Kapitalherabsetzung, weil dabei das Stammkapital<br />
an das Gesellschaftsvermögen angeglichen wird.<br />
Die vereinfachte Kapitalherabsetzung kann (nur) beschlossen werden, wenn bei der GmbH<br />
ein sonst auszuweisender Bilanzverlust zu decken und allenfalls Beträge in die gebundene<br />
Kapitalrücklage einzustellen sind.<br />
62. Offenlegung von Jahresabschlüssen? Wie und wo ist offenzulegen?<br />
Grundsätzlich ist im Firmenbuch offenzulegen. Jahresabschluss legen muss jeder der die<br />
Grenzen §189 überschreitet. Firmenbuch, Internet und Amtsblatt zur Wiener Zeitung (bei<br />
AG).<br />
63. Wenn wir uns über die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens informieren wollen wo<br />
können wir nachschauen? Wo finden wir den Jahresabschluss? Wie kann etwas im FB<br />
offengelegt werden? Welche Jahresabschlüsse finden wir im FB?<br />
Man kann sich einen Jahresabschluss im Firmenbuch anschauen. Dieser ist im Firmenbuch<br />
offenzulegen und öffentlich zugänglich zu machen. Man findet alle Jahresabschlüsse den<br />
letzten immer aktuell und die aus den Jahren davor findet man in der Historie.<br />
64. Was ist ein Umlaufbeschluss? Besonderheiten bei Stimmzählung?<br />
Ein Umlaufbeschluss ist ein Beschluss außerhalb der Generalversammlung (nur bei GmbH).<br />
Das Besondere daran ist, dass der Beschluss entweder mit Einstimmigkeit angenommen wird<br />
(diesen als solchen durchzuführen) oder aber er ist ungültig. Die Stimmzählung erfolgt quasi<br />
immer mit allen Gesellschaftern, da eine Enthaltung automatisch als Gegenstimme gezählt<br />
wird.<br />
68
65. Gegen wen ist die Abfindung gerichtet?<br />
Gegen die Gesellschaft. Es hat also der Ausscheidende Gesellschafter einen Anspruch auf<br />
Abfindung gegenüber der Gesellschaft. Diese kann mittels effektiver Kapitalherabsetzung<br />
beispielsweise, den Anteil des Ausscheidenden wieder verflüssigen und ausgeben.<br />
66. Welcher Wert wird bei der Abfindungsberechnung herangezogen?<br />
Grundzüge des Wettbewerbsrechts<br />
1. Was ist das Wettbewerbsrecht und was ist sein Zweck?<br />
Freier Wettbewerb bildet das Fundament der Marktwirtschaft. Der wirtschaftliche<br />
Wettbewerb bedarf aber eines Schutzes durch die Rechtsordnung. Sowohl Lauterkeitsrecht<br />
als auch das Kartellrecht schützen jeweils auf ihre spezielle Art und Weise die<br />
Wettbewerbsordnung. Der Begriff Wettbewerbsrecht wird daher oft als Oberbegriff für<br />
beide Rechtsbereiche gebraucht. Zweck des Lauterkeitsrechts ist somit, einen<br />
schrankenlosen Konkurrenzkampf zu verhindern, der Mitbewerber, Konsumenten<br />
(Verbraucher) und die Allgemeinheit schädigt. Ursprünglich war das UWG als reines<br />
Mitbewerberschutzgesetz konzipiert. Heute ist allgemein anerkannt, dass Schutzsubjekt des<br />
Wettbewerbsrechts die Interessen der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der<br />
Allgemeinheit sind. Hier erkennt man den so genannten Schutzzwecktrias.<br />
2. Unternehmerbegriff im UWG?<br />
Normadressaten sind Unternehmer, wobei der Unternehmerbegriff ungefähr dem des UBG<br />
entspricht, erfasst sind auch freie Berufe und Körperschaften öffentlichen Rechts, soweit sie<br />
im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung tätig werden.<br />
3. Welche Konsequenzen drohen bei Verstoß gegen das UWG?<br />
Als Rechtsschutz sieht das UWG sowohl zivilrechtliche als auch strafrechtliche und<br />
verwaltungsrechtliche Sanktionen vor. Die zivilrechtlichen Sanktionen sind der<br />
Unterlassungsanspruch (§14 UWG), der Beseitigungsanspruch, der Widerrufsanspruch, der<br />
Anspruch auf Urteilsveröffentlichung, der Schadenersatzanspruch und der<br />
Auskunftsanspruch.<br />
4. Wer kann nach dem UWG klagen?<br />
Gem dem UWG steht der Unterlassungsanspruch jedem zu, der durch den<br />
Wettbewerbsverstoß unmittelbar konkret betroffen wurde. Der Anspruch ergibt sich dabei<br />
unmittelbar aus der verletzten Norm und nicht aus §14 UWG. Aktivlegitimiert sind also<br />
Mitbewerber, Verbände und individuell Betroffene (Verbraucher).<br />
5. Können Sie mir die vier Fallgruppen der Generalklausel nennen?<br />
-‐ Behinderung<br />
-‐ Kundenfang<br />
-‐ Rechtsbruch<br />
-‐ Ausbeutung<br />
6. Was ist der Normzweck und wer sind die Normadressaten des UWG?<br />
Der ursprüngliche Zweck des UWG im Allgemeinen und des Irreführungstatbestands im<br />
Besonderen ist der Schutz der Mitbewerber. Die Absatzchancen eines Anbieters sollen<br />
nämlich nicht dadurch geschmälert werden, dass einzelne Mitbewerber „zu Zwecken des<br />
Wettbewerbs“ irreführende Angaben über ihre Waren und Dienstleistungen einsetzen. Der<br />
Schutz der Marktgegenseite, sprich der Kunden (Verbraucher), wurde früher bloß als<br />
erwünschter Reflex bezeichnet. Dies spiegelte sich in der Klagelegitimation wieder, denn<br />
ursprünglich kam nur Mitbewerbern und deren Interessenverbänden die Aktivlegitimation<br />
69
zu. Später wurde die Unterlassungsklage, auf bestimmte Verbraucherverbände (insb VKI und<br />
AK) ausgedehnt. Darin spiegelt sich nun auch die Lehre von der Schutzzwecktrias wieder,<br />
wonach neben den Mitbewerbern auch Verbraucher und die Allgemeinheit vom<br />
Schutzbereich des UWG erfasst sind.<br />
7. Weitere Sondertatbestände des UWG?<br />
Weiter Sondertatbestände neben den §§1, 1a, 2 und 2a UWG sind die Herabsetzung eines<br />
Unternehmens gem §7 UWG, Missbrauch von Kennzeichen eines Unternehmens gem §9<br />
UWG, Zugaben gem §9a UWG und die verwaltungsrechtlichen Sondertatbestände (wie<br />
Schneeballsystem, glücksartiger Vertrieb von Produkten, Anmaßungen von Auszeichnungen<br />
und Vorrechten) gem §§27 -‐ 33 UWG.<br />
8. Steht im UWG wie der Verbraucher zu definieren ist? Wurde er früher anders definiert und<br />
woher kommt die heutige Definition?<br />
Das sogenannte Verbraucherleitbild, das nicht nur im Lauterkeitsrecht, sondern auch für die<br />
Beurteilung zivilrechtlicher Fragen bedeutsam ist, ist ein wandelbarer, gesetzlich nicht<br />
determinierter Maßstab. Das Verbraucherleitbild ist ein Instrument der Rechtsanwendung,<br />
das aufgrund des großteils harmonisierten Verbraucherschutzrechts vor allem durch die Rsp<br />
des EuGH beeinflusst wird. Weder dem UWG noch dem normativen Teil der UGP-‐RL ist eine<br />
entsprechende Definition des Verbraucherleitbilds zu entnehmen. Erläutert wird der<br />
Verbraucherbegriff allerdings in ErwGr 18 UGP-‐RL. Danach ist der Durchschnittsverbraucher<br />
als ein Verbraucher anzusehen, der unter Berücksichtigung sozialer, kultureller und<br />
sprachlicher Faktoren in der Auslegung des Gerichtshofs angemessen gut unterrichtet,<br />
angemessen aufmerksam und kritisch ist. Diese Definition entspricht dem bisherigen<br />
Maßstab des EuGH.<br />
Der Werbende darf vom Werbeadressaten (Verbraucher) nur einen durchschnittlichen<br />
Informationsstand erwarten, zumal die Informiertheit innerhalb des angesprochenen<br />
Verkehrskreises idR unterschiedlich verteilt ist. Daher ist weder der wenigst-‐ noch der<br />
bestinformierte Verbraucher als Maßstab heranzuziehen. Der Durchschnittsverbraucher<br />
widmet sich Geschäftspraktiken mit durchschnittlicher bzw angemessener Aufmerksamkeit.<br />
Bei speziellen Gruppen ist der Durchschnittsverbraucher aus dem Durchschnitt der Gruppe<br />
zu nehmen.<br />
In der österreichischen, wie auch deutschen Rsp galt lange Zeit das Leitbild des „flüchtigen<br />
Verbrauchers“. Dem lag die Vermutung zugrunde, dass sich der Durchschnittsverbraucher<br />
einer Werbeaussage nur flüchtig und mit durchschnittlicher Aufmerksamkeit widmet. Der<br />
Durchschnittsverbraucher, der mit durchschnittlicher Intelligenz und Sachkunde ausgestattet<br />
ist, pflege demnach eine Werbeaussage weder genau, vollständig und kritisch zu würdigen,<br />
noch grammatikalische und philologische Überlegungen anzustellen.<br />
9. Was wissen Sie über die Zugabenregelung? Wie sieht es mit Gewinnspielen aus?<br />
Das Zugabenverbot ist in §9a UWG geregelt. Es bezweckt einerseits den Schutz der Käufer<br />
vor unsachlicher und irreführender Wertreklame und die Vermeidung eines gegenseitigen<br />
Übersteigerns von Mitbewerbern mit Nebenleistungen. Andererseits soll der Mitbewerber<br />
vor unsachlicher Nachfrageverlagerung geschützt werden.<br />
Eine Zugabe iSd §9a UWG ist ein zusätzlicher Vorteil, der neben der Hauptware (bzw<br />
Hauptleistung) ohne besondere Berechnung angekündigt wird, um den Absatz der<br />
Hauptware oder die Verwertung der Hauptleistung zu fördern. Gegenstand einer Zugabe<br />
kann jeder wirtschaftliche (dh geldwerte) Vorteil sein, der nicht als Teil der Hauptleistung<br />
angesehen wird. Dabei muss der Zugabengegenstand gegenüber der Hauptware selbständig<br />
und damit von ihr isolierbar sein sowie einen eigenen Verkehrswert besitzen. Die Zugabe ist<br />
eine Nebenware bzw Nebenleistung zu einer entgeltlichen Hauptleistung. Damit eine Zugabe<br />
iSd §9a UWG vorliegt muss sie gewissen Merkmale aufweisen. Die Zugabe muss ein Werbe-‐<br />
oder Lockmittel sein, es muss die Abhängigkeit der Zugabe vom Abschluss des<br />
70
Hauptgeschäfts vorliegen (Akzessorietät), die Zugabe muss klar unentgeltlich präsentiert<br />
werden, sie muss die Kaufentscheidung beeinflussen und weiters muss der Lockeffekt der<br />
Zugabe geeignet sein, eine nicht unerhebliche Nachfrageverlagerung hervorzurufen.<br />
Die Regelungen für Gewinnspiele finden sich im §9a Abs 2 Z8 UWG.<br />
10. Gilt Verbot der irreführenden Geschäftspraktiken auch im Internet? Was sind die<br />
Konsequenzen? Wo ist das geregelt?<br />
Ja, denn auch hier sind die Mitbewerber gem UWG berechtigt den, der unlauter handelt, auf<br />
Unterlassung zu klagen nach dem UWG. Weiters bestehen nach dem ECG diverse<br />
Sonderregelungen die eingehalten werden müssen.<br />
11. Verstoß gegen unlauteren Wettbewerb -‐ § 1 UWG? Welche Handlungen sind nach UWG<br />
verboten?<br />
Ob ein Verstoß gegen das UWG vorliegt ist in vier Schritten zu Prüfen. Grundsätzlich schaut<br />
man ob ein Tatbestand der Sondertatbestände der §§7, 9 und 9a UWG vorliegt. Diese gehen<br />
nämlich der Generalklausel (§1 UWG) aufgrund der lex specialis-‐Regel vor. Ist dies nicht der<br />
Fall versucht man den Sachverhalt unter einen den im Anhang (schwarze Liste)<br />
beschriebenen Tatbeständen zu subsumieren. Ist das auch erfolglos überprüft man aufgrund<br />
objektiver Kriterien ob ein irreführende oder aggressive Geschäftspraktik der beiden kleinen<br />
Generalklauseln -‐ §1a und §2 UWG – vorliegt. Ist selbst das zu verneinen so ist mit der<br />
großen – zweigeteilten – Generalklausel (als Auffangtatbestand) der Sachverhalt zu<br />
überprüfen ob eine unlautere Geschäftspraktik vorliegt.<br />
Gem dem UWG sind alle unlauteren Geschäftshandlungen untersagt. Zu nennen sind<br />
beispielsweise die §§1, 1a, 2, 2a, 7, 9 und 9a UWG. Hefermehl beschreibt vier<br />
Hauptkategorien, nämlich Behinderung, Ausbeutung, Rechtsbruch und Kundenfang.<br />
12. Jemand macht Werbung mit: Wir sind das beste Unternehmen Österreichs.<br />
Hier liegt ein Verstoß gegen §2 Abs 1 Z6 UWG vor. Es liegt also eine unlautere Handlung gem<br />
dem UWG vor.<br />
Grundzüge des Immaterialgüterrechts<br />
1. Was ist eine Marke und welche Arten gibt es?<br />
Gem §1 MSchG normiert, dass Marken alle Zeichen sein können, die sich grafisch darstellen<br />
lassen, insb Wörter, einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und<br />
die Form oder Aufmachung einer Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder<br />
Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu<br />
unterscheiden. Es handelt sich hierbei um einen weiten Markenbegriff.<br />
Die Marke hat im Wirtschaftsleben verschiedene Funktionen, die auch in unterschiedlichem<br />
Umfang rechtlich anerkannt sind und in verschiedenen markenrechtlichen<br />
Einzelbestimmungen Niederschlag gefunden haben. Die Marke hat Herkunftsfunktion,<br />
Qualitätsfunktion (Garantie-‐ oder Vertrauensfunktion), Kommunikations-‐ und<br />
Werbefunktion. Da die Marke aus den verschiedensten Zeichen bestehen kann, gibt es<br />
natürlich auch verschiedene Markenarten wie zum Beispiel die Wort-‐ und Bildmarken,<br />
Buchstaben-‐ bzw Ziffernmarken, die Formmarke, die Klang-‐ Geruchs-‐ und Farbmarke.<br />
2. „Marke als strategischer Erfolgsfaktor“ – was fällt Ihnen dazu ein?<br />
Auf den heute zunehmend homogenisierten, mit Informationen und Werbung überfluteten<br />
Märkten wird es für Unternehmen immer schwerer, zu Konsumenten durchzudringen. Um<br />
sich bei stetig steigender Wettbewerbsintensität am Markt durchsetzen zu können, fehlt es<br />
den Produkten vieler Unternehmen schlichtweg an Differenzierungskraft.<br />
71
Der Aufbau von Marken stellt mitunter die einzige Möglichkeit dar, eine<br />
Differenzierungsgrundlage für Produkt-‐ und Dienstleistungen zu schaffen. Mit dem Einsatz<br />
von Marken können Unternehmen Präferenzen bei Konsumenten schaffen, sich von<br />
Wettbewerbern abgrenzen und somit einen strategischen Wettbewerbsvorteil am Markt<br />
erlangen. Markenführung mit dem Ziel, unverwechselbare Marken aufzubauen und zu<br />
pflegen, ist daher zum strategischen Erfolgsfaktor für Unternehmen geworden. Zu überlegen<br />
ist auch, was denn letztendlich den Ausschlag für die Wahl einer Marke gibt und welche<br />
Positionierungsstrategien zur Verfügung stehen?<br />
3. Werk iSd Urheberrechtsgesetzes?<br />
Ein Werk oder Schutzgegenstand des Urheberrechts ist eine eigentümliche geistige<br />
Schöpfung in den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der<br />
Filmkunst. Diese Schöpfungen werden in der Terminologie des UrhG als Werke bezeichnet<br />
(§1 Abs 1 UrhG) und genießen sowohl im Ganzen als auch in ihren einzelnen Teilen<br />
urheberrechtlichen Schutz. Der Werkbegriff des UrhG ist zweckneutral und objektiv.<br />
4. Verwertungsrechte?<br />
Verwertungsrechte sind in den §§14 – 18 UrhG geregelt. Der Urheber eines Werks ist<br />
berechtigt, sein Werk auf die im Gesetz taxativ angeführten Arten zu verwerten. Die<br />
Benutzung eines Werks in den gesetzlich geschützten Formen ist daher – regelmäßig gegen<br />
Entgelt – von der Billigung des Urhebers abhängig. Diese kann durch zwei Formen, durch<br />
Einräumung von Werknutzungsbewilligungen oder Werknutzungsrechten, erfolgen. Die ihm<br />
gewährten, ausschließlichen Verwertungsrechte unterliegen wiederum genau definierten<br />
Schranken, den sog. freien Werknutzungen.<br />
-‐ Vervielfältigungsrecht<br />
-‐ Verbreitungsrecht<br />
-‐ Bearbeitungs-‐ und Übersetzungsrecht<br />
-‐ Recht der ersten Inhaltsangabe<br />
-‐ Vermiet-‐ und Verleihrecht<br />
-‐ Folgerecht<br />
-‐ Senderecht<br />
-‐ Recht der öffentlichen Wiedergabe<br />
-‐ Zuverfügungsstellungsrechte<br />
5. Bittorrent im Lichte des Urheberrechts? Um welches Verwertungsrecht könnte es sich<br />
handeln?<br />
Grundsätzlich stehen nur dem Urheber eines Werkes die Verwertungsrechte zu. Er ist<br />
berechtigt, sein Werk auf die im Gesetz taxativ angeführten Arten zu verwerten. Die<br />
Benutzung eines Werks in den gesetzlich geschützten Formen ist daher – regelmäßig gegen<br />
Entgelt – von der Billigung des Urhebers abhängig. Bei Bittorrent wird ganz klar gegen das<br />
Vervielfältigungsrecht (§15 UrhG) verstoßen. Durch die Funktionsweise könnte man ebenso<br />
an einen Verstoß gegen §16 UrhG denken (Verbreitungsrecht), dies ist hingegen klar zu<br />
verneinen. Die Anknüpfung der Erschöpfung an körperliche Werkstücke erscheint insofern<br />
geboten, als dass rein digitalen Werkexemplaren ein erhöhtes Missbrauchsrisiko innewohnt.<br />
Elektronische, unkörperliche Dateien lassen sich beliebig oft (und ohne Qualitätsverlust)<br />
reproduzieren und praktisch unendlich verbreiten, sodass dem Schutzzweck des §16 UrhG<br />
eine Ausweitung auf unkörperliche Werkexemplare zuwiderlaufen würde.<br />
72
6. Was ist eine Verwertungsgesellschaft?<br />
Verwertungsgesellschaften sind Unternehmen, denen die kollektive Wahrnehmung von<br />
Rechten an Werken und verwandten Schutzrechten in gesammelter Form obliegt. Dieser<br />
Unternehmenszweck wird erreicht, indem sie Nutzern gegen Entgelt entsprechende<br />
Werknutzungsbewilligungen erteilen. Das Ausüben der Tätigkeit als Verwertungsgesellschaft<br />
bedarf einer Betriebsgenehmigung durch die KommAustria als Aufsichtsbehörde für<br />
Verwertungsgesellschaften.<br />
7. Ist das Buch, nach dem Sie gelernt haben, ein Werk?<br />
Ja, denn es ist eine eigentümliche Schöpfung auf dem Gebiet der Literatur.<br />
Querschnittsmaterien<br />
Merksätze und Aufzählungen<br />
Das subjektive System des UGB<br />
Den Regeln des UGB unterfällt, wer Unternehmer ist. Er betreibt selbständig ein<br />
Unternehmen -‐> persönliche Eigenschaft -‐> subjektives System<br />
Nach dem UGB entscheidet also nur noch die unternehmerische Tätigkeit<br />
Begriff des Unternehmers und des Unternehmens<br />
Unternehmer iSd UGB ist, wer ein Unternehmen betreibt §1 Abs 1 UGB.<br />
Begriff des Handelsvertreters<br />
Nach §1 Abs 1 HVertrG ist Handelsvertreter, wer von einem Unternehmer mit der<br />
Vermittlung oder dem Abschluss von Geschäften ausgenommen über unbewegliche Sachen,<br />
in dessen Namen und für dessen Rechnung ständig betraut ist und diese Tätigkeit selbständig<br />
und gewerbsmäßig ausübt.<br />
Handelsvertreter sind Unternehmer iSd §1 UGB.<br />
Begriff des Maklers<br />
Nach §1 MaklerG ist Makler, wer aufgrund einer privatrechtlichen Vereinbarung<br />
(Maklervertrag) für einen Auftraggeber Geschäfte mit einem Dritten vermittelt, ohne ständig<br />
damit betraut zu sein. Eine Vermittlungspflicht besteht nicht.<br />
Begriff des Handelsmaklers<br />
Handelsmakler ist, wer als Makler (§1 MaklerG) gewerbsmäßig Geschäfte über Gegenstände<br />
des Handelsverkehrs vermittelt (§19 Abs 1 MaklerG). Gemeint ist der unternehmerische<br />
Geschäftsverkehr. Handelsmakler sind Unternehmer iSd §1 UGB.<br />
Ein Unternehmer kraft Rechtsform muss kein Unternehmen betreiben, um Unternehmer zu<br />
sein. Ihm kommt die Unternehmereigenschaft eben kraft Rechtsform zu.<br />
Handeln ohne Vertretungsmacht<br />
Wer ohne Vertretungsmacht im Namen eines anderen auftritt, heißt falsus procurator,<br />
Scheinvertreter oder Vertreter ohne Vertretungsmacht.<br />
Begriff des unternehmensbezogenen Geschäfts<br />
Unternehmensbezogene Geschäfte sind alle Geschäfte eines Unternehmers, die zum Betrieb<br />
seines Unternehmens gehören (§343 Abs 2 UGB).<br />
73
Sperrfunktion<br />
Die Sperrfunktion ist die zentrale, das Wertpapier von anderen Urkunden definitorisch<br />
abhebende Funktion, dass das verbriefte Recht nur gegen Vorlage des Papiers geltend<br />
gemacht werden kann (Zug um Zug).<br />
Liberationsfunktion<br />
Das heißt das der Schuldner an den Papierinhaber schuldbefreiend leisten kann.<br />
Weiter Wertpapierbegriff<br />
Ein Wertpapier ist eine Urkunde, in der ein privates Recht in der Weise verbrieft ist, dass zur<br />
Geltendmachung des Rechts die Innehabung der Urkunde erforderlich ist.<br />
Enger Wertpapierbegriff<br />
Dieser macht dir Art der Übertragung zum entscheidenden Kriterium für Wertpapiere. Das<br />
verbriefte Recht muss durch Verfügung iSv Übertragung eines Sachenrechts übertragen<br />
werden. Daher zählen hier nur Inhaber-‐ und Orderpapiere dazu, nicht etwa Rektapapiere,<br />
denn hier wird die Forderung schuldrechtlich durch Zession übertragen.<br />
Zwingende Bestandteile eines Wechsels<br />
-‐ Wechselklausel<br />
-‐ Zahlungsklausel<br />
-‐ Bezogener<br />
-‐ Wechselnehmer<br />
-‐ Unterschrift des Ausstellers<br />
-‐ Ausstellungszeit<br />
-‐ Ausstellungs-‐ und Zahlungsort (sind eventuell ersetzbar)<br />
-‐ Zahlungszeit (ist entbehrlich)<br />
Wertpapierfunktionen bei unterschiedlichen Wertpapierarten<br />
Inhaberpapiere Orderpapiere Rektapapiere Qualifizierte<br />
Einfache<br />
Legitimationspapiere Legitimationspapiere<br />
Beweisfunktion x x x x x<br />
Liberationsfunktion x x x x<br />
Sperrfunktion x x x x<br />
Legitimationsfunktion x x<br />
Gutglaubensschutzfunktion x x<br />
Garantie-‐,<br />
Gewährleistungsfunktion<br />
x x<br />
Allgemeine Definition einer Gesellschaft<br />
Allgemein definiert man eine Gesellschaft als eine durch Rechtsgeschäft begründete<br />
Rechtsgemeinschaft mindestens zweier Personen, die einen bestimmten gemeinsamen<br />
Zweck durch organisiertes Zusammenwirken erreichen will. Aufgrund dieser traditionellen<br />
Definition ergeben sich vier Wesensmerkmale:<br />
-‐ Begründung durch Rechtsgeschäft<br />
-‐ Rechtsgemeinschaft<br />
-‐ Bestimmter gemeinsamer Zweck<br />
-‐ Organisiertes Zusammenwirken<br />
Arten der Einlagenleistung<br />
-‐ Einbringung quoad dominum: Die Einlage geht in das Eigentum der Gesellschaft über.<br />
-‐ Einbringung quoad usum: Die Sacheinlage wird der Gesellschaft bloß zur Nutzung<br />
überlassen.<br />
74
-‐ Einbringung quoad sortem: Die Einlage wird zwar nach außen hin nicht Teil des<br />
Gesellschaftsvermögens, wird aber intern so behandelt, als ob die Gesellschaft<br />
Eigentümer wäre.<br />
Die Liquidation<br />
Die Liquidation ist ein außergerichtliches Verfahren zur Lösung der persönlichen und<br />
vermögensrechtlichen Beziehungen der Gesellschafter untereinander und zur Beendigung<br />
der rechtlichen Verhältnisse zu Dritten mit dem Ziel der Vollbeendigung der Gesellschaft.<br />
Insbesondere sollen das Gesellschaftsvermögen verwertet und die Schulden beglichen<br />
werden. Ein allfälliger Liquidationsgewinn ist auf die Gesellschafter aufzuteilen, ein<br />
Liquidationsverlust von den Gesellschaftern auszugleichen.<br />
Straube Kommentar zur fehlerhaften Gesellschaft<br />
1. Fehlerhafte Gesellschaft<br />
RZ 35<br />
Die Probleme allfälliger Mängel des Gesellschaftsvertrags (etwa Willens-‐ und Formmängel,<br />
Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot oder die guten Sitten) werden nach der Lehre von der<br />
fehlerhaften Gesellschaft beurteilt und gelöst. Diese schließt, ausgehend von den<br />
Wertungskriterien des Verkehrsschutzes im Außenverhältnis und des Bestandsschutzes im<br />
Innenverhältnis (EvBl 2001/58 = wbl 2001, 230), uU die rückwirkende Nichtigkeit oder<br />
Vernichtung einer bereits in Vollzug gesetzten Gesellschaft aus, obwohl der Mangel nach<br />
allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen den Gesellschaftsvertrag insgesamt ex tunc zu Fall<br />
bringen würde (s nur RIS-‐Justiz RS0018376). Es handelt sich um das Ergebnis einer<br />
kontinuierlichen richterlichen Rechtsfortbildung (Boujong, in Ebenroth/Joost/Boujong, § 105<br />
Rz 177; ausf Ulmer, ZHR 161 [1997] 102, 115 ff; s auch Emmerich, in Heymann2 § 105 Rz 71<br />
ff). Über die dogmatischen Grundlagen herrscht noch immer Uneinigkeit (dazu zB Ulmer, in<br />
MüKo BGB3 § 705 Rz 265 ff mwN). Die Verwandtschaft mit dem allgemeinen<br />
privatrechtlichen Grundsatz, dass laufende Dauerschuldverhältnisse uU nicht mehr ex tunc<br />
aufgelöst werden können (vgl nur Welser, Grundriss II12, 9), ist unverkennbar (vgl Jabornegg,<br />
in Jabornegg, § 105 Rz 26, 28; Michalski, OHG-‐Recht, § 105 Rz 87). Zum Teil wird (zumindest<br />
im Außenverhältnis) der Schutz gutgläubiger Dritter nach Rechtsscheingrundsätzen als<br />
ausreichend angesehen (vgl Jabornegg, in Jabornegg, § 105 Rz 26, 28; Koppensteiner, unten §<br />
123 Rz 7 iVm § 130 Rz 9). Hingegen geht die hL zu Recht davon aus, dass die fehlerhafte<br />
Gesellschaft auch im Außenverhältnis besteht (Kastner/Doralt/Nowotny5, 18 f;<br />
Hämmerle/Wünsch II4, 143), uzw unabhängig von dem guten Glauben Dritter (ausdrücklich<br />
G.H. Roth/Fitz, Rz 160, 189, 193 f; Oberhammer, Zivilprozeß, 249; deutlich auch K. Schmidt,<br />
Gesellschaftsrecht4, 139). Es handelt sich um eine sachgerechte Ausprägung des erwähnten<br />
Grundsatzes über Dauerschuldverhältnisse. Die Regeln des Zivilrechts, die zur<br />
Rückabwicklung zwingen würden, passen nicht auf in Vollzug gesetzte Gesellschaftsverträge<br />
(EvBl 2001/58 = wbl 2001, 230; K. Schmidt, Gesellschaftrecht4, 141). Denn zum einen würden<br />
die ohnedies bestehenden Rückabwicklungsschwierigkeiten unter den Gesellschaftern durch<br />
die Verneinung der Existenz der fehlerhaften Gesellschaft im Außenverhältnis noch verstärkt,<br />
weil die geschlossenen Verträge dann allesamt namens eines nicht existierenden<br />
Rechtssubjekts abgeschlossen worden wären (vgl dazu auch K. Schmidt, Gesellschaftsrecht4,<br />
139); zum anderen enthalten die Rechtsfolgen des Zivilrechts eine Abwägung der Interessen<br />
der Beteiligten, die nicht nur nicht auf Dauerschuldverhältnisse im Allgemeinen, sondern<br />
auch nicht darauf angelegt ist, dass auch Dritte eine Rolle spielen (vgl auch G.H. Roth/Fitz, Rz<br />
174, 189). §§ 216, 218 AktG sind nichts anderes als eine gesetzliche Anerkennung dieses<br />
Umstands. Die Gründe, die allgemein gegen die ex-‐tunc-‐Auflösung von<br />
Dauerschuldverhältnissen sprechen, werden bei fehlerhaften Gesellschaften also dadurch<br />
verstärkt, dass nach außen eine (wenn auch fehlerhafte) Organisation ins Leben gerufen<br />
75
wurde (s jeweils mwN Ulmer, ZHR 161 [1997] 102, 119; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht4, 139,<br />
140 f; Baumbach/Hopt30 § 105 Rz 76) und die Rechtsordnung den dadurch geschaffenen<br />
Zustand nicht negieren kann (G.H. Roth/Fitz, Rz 160, 189; vgl auch SZ 61/111). Diesen<br />
Gedanken hat zu Recht auch der OGH in den Vordergrund gestellt und folgerichtig die<br />
Anwendbarkeit der Regeln über die fehlerhafte Gesellschaft auf eine typische stille<br />
Gesellschaft verneint (EvBl 2001/58 = wbl 2001, 230; s dazu auch unten § 178 Rz 7). Zu<br />
beachten ist, dass die Regeln über die Beendigung fehlerhafter Dauerschuldverhältnisse noch<br />
dadurch modifiziert werden, dass die §§ 133 ff anzuwenden sind und die Liquidation gem §§<br />
145 ff folgt (vgl Ulmer, ZHR 161 [1997] 102, 116 f mwN zur Entwicklung der Rsp; s unten Rz<br />
37). Es handelt sich um die spezielleren Regeln über die Beendigung ex nunc und ihre Folgen.<br />
RZ 36<br />
Voraussetzungen: Die Anwendung der Regeln über die fehlerhafte Gesellschaft setzt<br />
zunächst einen (nichtigen oder vernichtbaren; ausf Westermann I4 Rz 174 ff)<br />
Gesellschaftsvertrag, also darauf gerichtete (wenn auch fehlerhafte) Willenserklärungen<br />
voraus (Baumbach/Hopt30 § 105 Rz 79 f; Boujong, in Ebenroth/Boujong/Joost, § 105 Rz 179<br />
mwN; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht4, 147 f). Bloße Teilnichtigkeit begründet keine<br />
fehlerhafte Gesellschaft (Krejci, EGG § 1 Rz 161; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht4, 137 f; v<br />
Gerkan, in Röhricht/Graf v Westphalen, § 105 Rz 40). Wenn nicht einmal ein mangelhafter<br />
Gesellschaftsvertrag vorliegt, sind die Regeln über die „Scheingesellschaft“ anzuwenden<br />
(unten Rz 39 f). Zweite Voraussetzung ist die Invollzugsetzung der Gesellschaft (vgl auch SZ<br />
61/111, 185 f). Wann dies der Fall ist, wird uneinheitlich beurteilt (vgl K. Schmidt,<br />
Gesellschaftsrecht4, 148). Es besteht eine reiche Kasuistik (s Boujong, in<br />
Ebenroth/Boujong/Joost, § 105 Rz 181 ff). Um der Rechtssicherheit willen sollte uE auf die<br />
Tatbestände des § 123 abgestellt werden (iE auch Baumbach/Hopt30 § 105 Rz 82; vgl auch<br />
G.H. Roth/Fitz, Rz 191). Das deckt sich iE ohnedies weitestgehend mit der hM (vgl K. Schmidt,<br />
Gesellschaftsrecht4, 144, 148; Boujong, in Ebenroth/Boujong/Joost, § 105 Rz 182). Dritte<br />
(negative) Voraussetzung ist schließlich nach hM, dass die Anerkennung der Gesellschaft<br />
nicht ausnahmsweise aus „gewichtigen Belangen der Allgemeinheit oder bestimmter<br />
schutzwürdiger Personen unvertretbar ist“ (EvBl 2001/58 = wbl 2001, 230;<br />
Kastner/Doralt/Nowotny5, 19 mwN; Paschinger, 108 f). Anwendungsfälle seien uU die<br />
Gesetz-‐ oder Sittenwidrigkeit, qualifizierte Willensmängel (Arglist [insofern aA SZ 61/111],<br />
Drohung) sowie die Beteiligung nicht oder beschränkt geschäftsfähiger Personen (G.H.<br />
Roth/Fitz, Rz 192; Krejci, EGG § 1 Rz 161; ausf Baumbach/Hopt30 § 105 Rz 83; Emmerich, in<br />
Heymann2 § 105 Rz 83 ff; Boujong, in Ebenroth/Boujong/Joost, § 105 Rz 186 ff). Nach einer<br />
Mindermeinung besteht diese dritte Voraussetzung nicht (Schlegelberger/Schmidt5 § 105 Rz<br />
210 ff). Tatsächlich führt sie zT sogar zu kontraproduktiven Ergebnissen (s dazu K. Schmidt,<br />
Gesellschaftsrecht4, 149 ff). Festgehalten sollte uE aber an der Vorrangigkeit des Schutzes<br />
nicht ausreichend geschäftsfähiger Personen werden (§ 21 ABGB). Auch können sie nicht<br />
anders zu behandeln sein als Personen, die beim Abschluss des Gesellschaftsvertrags<br />
mangels erteilter Vollmacht nur angeblich vertreten wurden und die nach zutr hM nicht<br />
Mitglieder einer fehlerhaften Gesellschaft werden (Boujong, in Ebenroth/Boujong/Joost, §<br />
105 Rz 184, 192 mwN). Die Unwirksamkeit der Beteiligung von Personen, denen die darauf<br />
gerichteten Willenserklärungen nicht zurechenbar sind (vgl auch G.H. Roth/Fitz, Rz 193),<br />
steht freilich der Bildung einer (zumindest fehlerhaften) Gesellschaft unter mehreren<br />
anderen Gesellschaftern nicht entgegen (Boujong, in Ebenroth/Boujong/Joost, § 105 Rz 189<br />
mwN).<br />
RZ 37<br />
Rechtsfolge ist, dass die fehlerhafte, in Vollzug gesetzte Gesellschaft nach innen und außen<br />
wirksam ist (Baumbach/Hopt30 § 105 Rz 85 ff; Emmerich, in Heymann2 § 105 Rz 91 ff; s<br />
außerdem die wN oben Rz 35). Die Fehlerhaftigkeit kann, soweit sie sich nicht bloß auf<br />
einzelne Vertragsklauseln beschränkt, je nach den Verhältnissen des Einzelfalls durch eine<br />
76
der Gestaltungsklagen der §§ 133 (Auflösung aus wichtigem Grund), 140 (Ausschließung),<br />
142 (Übernahme) mit Wirkung ex nunc geltend gemacht werden (GesRZ 1972, 50; ausf<br />
Boujong, in Ebenroth/Boujong/Joost, § 105 Rz 196). Ein nicht weggefallener Mangel (oben Rz<br />
35), der den gesamten Gesellschaftsvertrag erfasst, ist jedenfalls ein wichtiger Grund iSd §<br />
133 (vgl K. Schmidt, Gesellschaftsrecht4, 149; dens, in Schlegelberger5 § 105 Rz 219). Wenn<br />
der Gesellschaftsvertrag ein solches Gestaltungsrecht vorsieht oder der Anlass eine<br />
entsprechende Vertragsergänzung rechtfertigt, kommt auch die Kündigung (Auflösung) durch<br />
einseitige Erklärung des betroffenen Gesellschafters in Betracht (Ulmer, in GroßK4 § 105 Rz<br />
362; Boujong, in Ebenroth/Boujong/Joost, § 105 Rz 197). Auf die Auflösung folgt die<br />
Auseinandersetzung gem §§ 145 ff (§ 145 Rz 17; vgl auch SZ 61/111, 186). Der konkrete<br />
Mangel des Gesellschaftsvertrags kann zur Unanwendbarkeit seiner Bestimmungen über die<br />
Auseinandersetzung führen (im Einzelnen str, s dazu Emmerich, in Heymann2 § 105 Rz 98<br />
iVm 94; Boujong, in Ebenroth/Boujong/Joost, § 105 Rz 198; Baumbach/Hopt30 § 105 Rz 90<br />
iVm 86). Hinzu kommen Ansprüche nach bürgerlichem Recht (insb gem § 874 ABGB). Ein<br />
Gesellschafter, der durch Drohung oder List zum Beitritt bewogen wurde, hat einen<br />
schuldrechtlichen Anspruch darauf, so gestellt zu werden, als wäre er niemals Gesellschafter<br />
geworden (vgl K. Schmidt, Gesellschaftsrecht4, 152; vgl oben Rz 36).<br />
Verzeichnis wichtiger Paragraphen<br />
Siehe Tabelle wichtiger Paragraphen<br />
Verzeichnis der Lehrbücher<br />
- Krejci, Unternehmensrecht 4<br />
- Orac-Skriptum Personengesellschaften<br />
- Orac-Skriptum Kapitalgesellschaften<br />
- Orac-Skriptum Wettbewerbsrecht I – UWG<br />
- Orac-Skriptum Grundzüge des Marken- und Immaterialgüterrechts<br />
- Straube, HGB I 3 § 105 Rz 35 - 37 (fehlerhafte Gesellschaft)<br />
- Wiebe, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht (nur ergänzend)<br />
Stoffabgrenzung der mündlichen Modulprüfung Unternehmensrecht<br />
Studienplan 2006:<br />
- Allgemeines Unternehmensrecht<br />
- Gesellschaftsrecht<br />
- Wertpapier und Kapitalmarktrecht<br />
- E-‐Commerce Recht<br />
- UWG<br />
- Markenrecht<br />
- Urheberrecht<br />
- Rechnungslegung nur in Grundzügen<br />
Geprüft wird nicht:<br />
- Transportrecht (Speditions-‐, Fracht-‐ und Lagergeschäft)<br />
- Kommissionär<br />
77