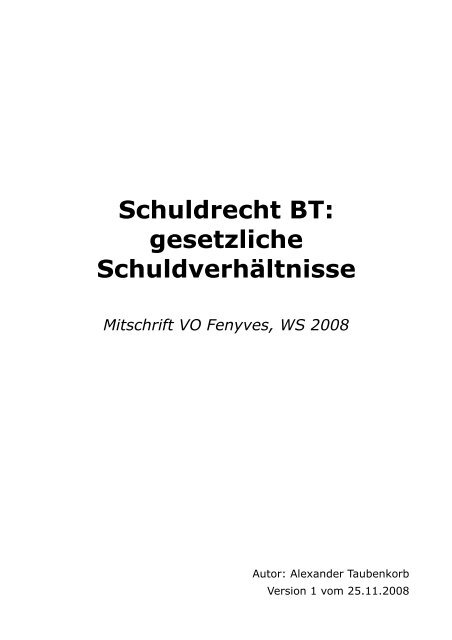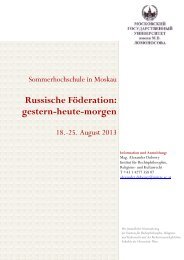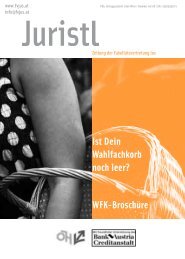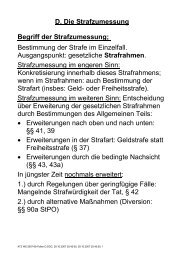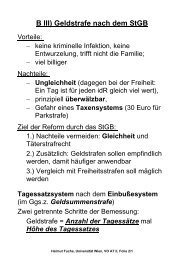Schuldrecht BT: gesetzliche Schuldverhältnisse Mitschrift VO ...
Schuldrecht BT: gesetzliche Schuldverhältnisse Mitschrift VO ...
Schuldrecht BT: gesetzliche Schuldverhältnisse Mitschrift VO ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>:<br />
<strong>gesetzliche</strong><br />
<strong>Schuldverhältnisse</strong><br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Autor: Alexander Taubenkorb<br />
Version 1 vom 25.11.2008
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
Vorwort<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Ich habe diese <strong>Mitschrift</strong> nach bestem Gewissen zusammengestellt. Dies kann Fehler<br />
jedoch leider nicht vollständig ausschließen. Falls dir daher Fehler auffallen oder du<br />
Verbesserungsvorschläge hast, zögere bitte nicht mir diese unter meiner E-Mail<br />
a0609321@unet.univie.ac.at mitzuteilen.<br />
Paragraphen ohne Bezeichnung eines bestimmten Gesetzes beziehen sich immer auf das<br />
ABGB.<br />
Dieses <strong>Mitschrift</strong> ist unvollständig, da ich die Prüfung während der Lehrveranstaltung<br />
bestanden habe.<br />
Dieses Dokument ist unter der Creative Commons Lizenz „Attribution-NonCommercial-<br />
ShareAlike 2.0 Austria“ lizenziert, verfügbar unter http://creativecommons.org/licenses/bync-sa/2.0/at/.<br />
Seite 2 von 26<br />
Alexander Taubenkorb
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Vorwort...................................................................................................................................2<br />
Inhaltsverzeichnis...................................................................................................................3<br />
Abkürzungsverzeichnis..........................................................................................................3<br />
1. Schadenersatz .................................................................................................................5<br />
1.1. Allgemeines ................................................................................................................5<br />
1.2. Verschuldenshaftung und Grundbegriffe....................................................................6<br />
1.2.1. Schaden..............................................................................................................6<br />
1.2.2. Verursachung......................................................................................................7<br />
1.2.2.1. Verursachungsprinzip...................................................................................7<br />
1.2.2.2. Ausnahmen vom Verursachungsprinzip......................................................9<br />
1.2.3. Rechtswidrigkeit................................................................................................10<br />
1.2.3.1. Verletzung von Schutzgesetzen.................................................................11<br />
1.2.3.2. Eingriff in ein absolut geschütztes Recht...................................................12<br />
1.2.3.3. Kausalzusammenhang..............................................................................13<br />
1.2.3.4. Rechtfertigung............................................................................................14<br />
1.2.4. Verschulden.......................................................................................................16<br />
1.3. Gefährdungshaftung.................................................................................................18<br />
1.3.1. Allgemeines.......................................................................................................18<br />
1.3.2. Adäquanz und Schutzzweck.............................................................................19<br />
1.4. Leistung des Schadenersatzes................................................................................20<br />
1.4.1. Art des Schadenersatzes..................................................................................20<br />
1.4.2. Umfang des Schadenersatzes..........................................................................21<br />
1.4.3. Gegliederter Schadensbegriff............................................................................21<br />
1.4.4. Mitverantwortlichkeit des Geschädigten............................................................23<br />
1.4.5. Vorteilsausgleichung.........................................................................................24<br />
1.4.6. Drittschaden......................................................................................................25<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
Abs Absatz<br />
aE am Ende<br />
aM andere Meinung<br />
Anm Anmerkung<br />
arg argumento<br />
Art Artikel<br />
ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz<br />
AtomHG Atomhaftungsgesetz<br />
BauO Bauordnung<br />
BGH Bundesgerichtshof<br />
Seite 3 von 26<br />
Bsp Beispiel<br />
bzw beziehungsweise<br />
ca circa<br />
cic culpa in contrahendo<br />
dh das heißt<br />
DHG Dienstnehmerhaftpflichtgesetz<br />
EKHG Eisenbahn. Und Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz<br />
EO Exekutionsordnung<br />
etc et cetera<br />
EU Europäische Union
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
EuGH Europäischer Gerichtshof<br />
FN Fußnote<br />
ForstG Forstgesetz<br />
G Gesetz<br />
GmbH Gesellschaft mit beschränkter<br />
Haftung<br />
GoA Geschäftsführung ohne Auftrag<br />
hA herrschende Ansicht<br />
hL herrschende Lehre<br />
hM herrschende Meinung<br />
idR in der Regel<br />
insb insbesondere<br />
iSd im Sinne des/der<br />
iVm in Verbindung mit<br />
iZw im Zweifel<br />
Jud Judikatur<br />
KO Konkursordnung<br />
KSchG Konsumentenschutz<br />
LFG Luftfahrtgesetz<br />
lit litera<br />
Seite 4 von 26<br />
MRG Mietrechtsgesetz<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
OGH Oberster Gerichtshof<br />
RHPflG Reichshaftpflichtgesetz<br />
RL Richtlinie<br />
Rs Rechtssache<br />
Rsp Rechtsprechung<br />
S Satz<br />
sog so genannt<br />
StGB Strafgesetzbuch<br />
stRsp ständige Rechtsprechung<br />
ua unter anderem<br />
UGB Unternehmensgesetzbuch<br />
usw und so weiter<br />
uU unter Umständen<br />
VersVG Versicherungsvertragsgesetz<br />
VfGH Verfassungsgerichtshof<br />
Z Ziffer<br />
zB zum Beispiel<br />
ZPO Zivilprozessordnung
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
13. Oktober 2008<br />
Die <strong>gesetzliche</strong>n <strong>Schuldverhältnisse</strong> (§ 859) umfassen insb Schadenersatz, Bereicherungsrecht,<br />
die GoA und die Gastwirtehaftung.<br />
1. Schadenersatz<br />
1.1. Allgemeines<br />
In der aktuellen Finanzkrise stellen sich Fragen über die Haftung von Anlageberatern,<br />
der FMA, etc.<br />
Wer einen Schaden erleidet muss ihn grundsätzlich selber tragen (§ 1311). Das Schadenersatzrecht<br />
bestimmt wann ein Schaden nicht von einem selbst sondern von einem anderen<br />
getragen wird. Es geht daher um die Schadensüberwälzung.<br />
Es gibt verschiedenste Arten der schadenersatzrechtlichen Haftung. Die dominierende ist<br />
die Verschuldenshaftung, bei dem dem Schädiger ein Vorwurf (das Verschulden) gemacht<br />
wird. Ohne dieses Verschulden gibt es keine Haftung.<br />
Lange Zeit dachte man, dass dies ist die einzige Möglichkeit sei einen Schaden überzuwälzen.<br />
Durch die Einführung der Eisenbahn, genauer durch deren Funkenflug wurden<br />
Flächen in Brand gesteckt. Hier gab es kein Verschulden. Man erlaubt jemanden eine bestimmte<br />
Tätigkeit, daraus bezieht der Betreiber einen Nutzen. Der Betreiber ist am ehesten<br />
in der Lage die Gefahr zu beherrschen. Daraus ergibt sich die Gefährdungshaftung.<br />
Beide Haftungsformen sind notwendig und somit gleichrangig.<br />
Die Eingriffshaftung ist der Gefährdungshaftung ähnlich. Es geht jedoch um den erlaubten<br />
Eingriff in ein fremdes Recht. Hier wird nicht nur die Gefährdung, sondern auch der<br />
Eingriff erlaubt. Als Kompensation wird ein verschuldensunabhängiger Ausgleichsanspruch<br />
gegeben. Normalerweise kann man etwa Emissionen untersagen. Handelt es sich<br />
jedoch um eine behördlich genehmigte Anlage (§ 364a), so ist der Grundbesitzer nur berechtigt<br />
den zugefügten Schaden zu verlangen.<br />
Die Haftung des Deliktsunfähigen (§ 1310 = Billigkeitshaftung) ist ein weiteres Beispiel.<br />
Das Schadenersatzrecht hat mehre Zwecke:<br />
● Der Hauptzweck des Schadenersatzrechts ist der Ausgleichsgedanke. Der Schädiger<br />
soll den Schaden auch tragen (Kompensation). Dh nicht, dass immer der gesamte<br />
Schaden zu tragen ist.<br />
● Der zweite Gedanke ist Prävention, also durch die Statuierung einer Schadenersatzpflicht<br />
veranlasst man mehr Vorsicht. Unbestritten ist dies bei der Verschuldenshaftung.<br />
Bei der Gefährdungshaftung ist dies nicht mehr eindeutig. Bei der Eingriffshaftung<br />
wird der Eingriff sogar erlaubt, daher gibt es keine Prävention.<br />
● Der dritte Charakter ist der Pönalcharakter. Die Pflicht den Schaden zu tragen richtet<br />
sich etwa nach dem Verschulden. Je vorwerfbarer man handelt, desto mehr<br />
muss man leisten. Dies hat im Vergleich zum angloamerikanischen Recht nur eine<br />
untergeordnete Bedeutung. Dort gibt es die punitive damage. Dabei kann das Gericht<br />
zusätzlich zum entstandenen Schaden noch eine zusätzliche Strafe verhängen.<br />
Der Ford Pinto explodierte etwa regelmäßig bei Unfällen. Ford reagierte darauf<br />
Seite 5 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
nicht und lies den Tank an der heiklen Stelle, da dies billiger koxymmen sollte. Das<br />
Gericht verhängte jedoch eine Zusatzstrafe.<br />
● Der vierte Gedanke ist der Rechtfortsetzungsgedanke. Nach Wilburg ist der<br />
Schadenersatz die Fortsetzung des verletzten Rechtsguts. Das Eigentum setzt sich<br />
im Schadenersatz fort, wird also durch diesen substituiert. Daraus lässt sich ableiten,<br />
dass zumindest der entstandene Schaden zu ersetzen ist. Wenn jemand etwas<br />
subjektiv nicht als Schaden enpfindet (etwa eine neue Beule im Auto) so kann er<br />
trotzdem den objektiven Schaden erfolgen.<br />
Arbeitsunfälle basieren auf einer Versicherungsleistung. Bei einem Arbeitsunfall bekommt<br />
man von der Versicherung einen Ausgleich. Nach § 332 ASVG kann sich der Sozialversicherungsträger<br />
beim Schädiger uU regressieren. Es gab auch Bestrebungen die<br />
Arzthaftung mit einer Versicherungsleistung zu ersetzen.<br />
Es gibt derzeit eine heftige Diskussion über Reform des Schadenersatzrechts. Sehr vieles,<br />
was heute anerkannt ist, ist nicht im Gesetz positiviert. Sehr vieles ist heute Richterrecht.<br />
Man kann sich daher durch das Gesetz alleine keinen Überblick verschaffen. Man<br />
müsste zusätzlich Literatur, Entscheidungen und Kommentare lesen. Das Schadenersatzrecht<br />
ist nicht nur im ABGB konzentriert (zB Gefährdungshaftung). Es gibt daher Rechtszersplitterung<br />
und Rechtsunsicherheit. 2005 gab es einen Entwurf für die gänzliche Reform<br />
des Schadenersatzrechts.<br />
1.2. Verschuldenshaftung und Grundbegriffe<br />
1.2.1. Schaden<br />
Es stellt sich die Frage ob der Schaden ein vorgegebener, natürlicher (als solcher empfunden)<br />
oder aber ein normativer (<strong>gesetzliche</strong>r) Begriff ist. Unser Gesetz geht von einem<br />
normativen Begriff aus. Es muss daher nicht alles ersetzt werden, was subjektiv als Schaden<br />
empfunden wird. Wenn ein Konzert abgesagt wird werden alle Zuhörer, die Gardarobe,<br />
die Restaurants, etc geschädigt. Das bedeutet aber noch nicht, dass diese schadenersatzberechtigt<br />
sind. Es ist daher abzugrenzen zwischen den mittelbar und den unmittelbar<br />
Geschädigten. Nach § 1293 ist Schaden. Es wird nur der Unterschwied zwischen dem positiven<br />
Schaden und dem entgangenen Gewinn beschrieben.<br />
● Man unterscheidet zwischen dem realen und dem rechnerischen Vermögensschaden.<br />
Der reale Schaden ist die tatsächliche Vermögensveränderung (zB Beule<br />
im Auto). Das ABGB geht vom Vorrang der Naturalrestitution aus. Der vorherige Zustand<br />
soll wieder hergestellt, also der reale Schaden beseitigt werden. Nur wenn<br />
dies nicht möglich oder untunlich ist, ist gem § 1323 der rechnerische Schaden zu<br />
bezahlen.<br />
● Weiters unterscheidet man Vermögensschaden (materiell) und ideeler Schaden<br />
(inmateriell). Der Vermögensschaden ergibt sich im Vermögen des Geschädigten.<br />
Der ideele Schaden ist jedoch ein Gefühlsschaden (Trauer, etc).<br />
○ Darunter wird der abgeleitete und der reine Vermögensschaden wird unterschieden.<br />
Bei einer Körperverletzung wird das absolut geschützte Recht der körperlichen<br />
Unversehrtheit. Bei einem Verdienstentgang. Bei einem reinen Vermögensschaden<br />
werden keine absoluten Rechte sondern nur das Vermögen ge-<br />
Seite 6 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
schädigt. Diese Abgrenzung ist wichtig für die Rechtsfolgen. Vollständig wird nur<br />
der reine Vermögensschaden ersetzt.<br />
○ Wenn man am Körper verletzt wird erleidet man Schmerzen. Das Schmerzengeld<br />
leitet sich von der Verletzung ab und wird daher abgeleiteter ideeller Schaden.<br />
Schock und Trauerschäden sind hingegen reine ideelle Schäden, da sie<br />
sich nicht aus einer eigenen Verletzung ergeben. Auch hier geht es um den Ersatz,<br />
da reine ideelle Schäden uferlos werden können.<br />
● Man unterscheidet weiters zwischen dem positiven Schaden und dem entgangenen<br />
Gewinn. Der Umfang hängt vom Verschulden ab. Bei leichter Fahrlässigkeit<br />
wird nur der positive Schaden, bei grober Fahrlässigkeit auch der entgangene Gewinn<br />
ersetzt. Der positive Schaden wird vom ABGB als erlittener oder wirklicher<br />
Schaden bezeichnen. Beide gemeinsam bilden das gesamte Interesse, gem ABGB<br />
volle Genugtuung.<br />
● Die Abgrenzung zwischen positivem Schaden und negativem Schaden spielt bei<br />
Schadenersatz wegen Vertragsverletzung eine Rolle. Wenn ein Vertrag vorliegt und<br />
eine Partei den Vertrag nicht rechtzeitig erfüllt, so steht dem Anderen ein Ersatz des<br />
Erfüllungsinteresses (so wie wenn er stehen würde, wenn der Vertrag gehörig erfüllt<br />
wird) zu. Beim negativen Schaden geht es um einen Vertrag mit Wurzelmangel (zB<br />
List, Irrtum). Der negative Schaden ist das Vertrauensinteresse (wenn man nicht auf<br />
den Vertrag vertraut hätte => insb Aufwandsersatz).<br />
Wenn Mietwagenkosten aufgewendet werden müssen sie jedenfalls ersetzt werden. Wenn<br />
man sie jedoch nicht aufwendet stellt sich die Frage ob der Schädiger sie trotzdem tragen<br />
muss, da es den Schädiger ja nichts angeht ob man sie aufwendet oder nicht. Es kommt<br />
hier nicht zu einem Schadenersatz-Anspruch, da kein Vermögensschaden eingetreten ist.<br />
Es könnte nur um den ideellen Schaden gehen (Verlust an Bequemlichkeit). Fiktive Mietwagenkosten<br />
sind daher nicht zu ersetzen.<br />
Der Schadenersatz für entgangene Urlaubsfreude war strittig. Ideelle Schäden werden<br />
grundsätzlich nur dort ersetzt, wo der Ersatz extra im Gesetz verankert ist. Wenn man<br />
nicht das bekommt, was man bestellt hat kann man jedenfalls Gewährleistung geltend machen.<br />
Man kann jedoch nicht dauernd Urlaub machen und hat somit einen Gefühlsschaden<br />
erlitten. Nach der alten Jud galt dies als ideeller Schaden und war somit nicht zu ersetzen,<br />
da es nicht eigens im Gesetz verankert war. § 31e Abs 3 KSchG regelt den Ersatz<br />
für eine Pauschalreise (§ 31b Abs 2 Z 1).<br />
1.2.2. Verursachung<br />
1.2.2.1. Verursachungsprinzip<br />
13. Oktober 2008<br />
Wenn eine Mutter ein Kind bekommt, dass sowieso behindert geboren worden wäre stellt<br />
sich die Frage ob Schadenersatz gefordert werden kann Wenn die Mutter gewusst hätte,<br />
dass das Kind behindert auf die Welt kommt, hätte sie abgetrieben. Es geht um die Begriffe:<br />
Wrongful Birth und Wrongful Live. Es stellt sich die Frage ob das Kind Schadenersatz<br />
fordern kann, da es lieber nicht auf die Welt gekommen wäre und ein Wrongful Live<br />
führen muss. Die zweite Frage ist ob die Eltern Schadenersatz fordern können, da sie bei<br />
Seite 7 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Kenntnis das Kind nicht bekommen hätten und nun erhöhte Unterhaltskosten leisten müssen.<br />
Einigkeit besteht darin, dass das Kind selbst keinen Schadenersatz fordern kann, da es<br />
immer behindert zur Welt gekommen wäre. Ein immaterieller Schaden wird abgelehnt, da<br />
man sonst sagen müsste, dass ein behindertes Leben ein belastetes (unwertes) Leben ist.<br />
In Frankreich ist diese Ansicht jedoch gegenteilig.<br />
Die Eltern müssten ohne behindertes Kind überhaupt keinen Unterhalt bezahlen. Der Unterhaltsanspruch<br />
wird zugesprochen. Es geht um die Frage ob der gesamte Unterhalt oder<br />
nur der Mehraufwand ersetzt wird. Nach älterer Meinung des OGH kann nur der Mehraufwand<br />
gefordert werden und auch nur dann wenn die Eltern dadurch belastet werden. Ein<br />
anderer Senat hat hingegen den gesamten Unterhalt zugesprochen.. Die Lehre vertritt jedoch<br />
die Meinung der ersten Entscheidung. Nicht das Kind ist der Schaden, sondern der<br />
Mehraufwand.<br />
Minimalvoraussetzung jedes Schadenersatzes ist, dass der Schädiger den Schaden verursacht<br />
haben muss. Der Beschädigte muss beweisen, dass der Schädiger den Schaden<br />
verursacht hat.<br />
• Dazu wird als erstes die Äquivalenz- oder Bedingungstheorie angewandt. Man<br />
überlegt ob die Handlung des Täters eine conditio sine qua non, also eine Bedingung<br />
die für den Eintritt des Schadens kausal ist. Man denkt sich die Handlung des<br />
Täters dabei weg und prüft ob der Schaden trotzdem eingetreten wäre. Bei einer<br />
Unterlassung muss man sich die Handlung hinzudenken. Strittig ist ob man sich nur<br />
eine mögliche oder auch schon eine pflichtgemäße Handlung hinzudenken muss.<br />
• Alle Ursachen die zu einem Schaden geführt haben sind gleich gut. Wenn man dies<br />
bis zum Schluss denkt, kommt man bis zu Adam und Eva. Auch der Verkäufer eines<br />
Hammers wäre dann für einen Schaden, der durch die Benutzung des Käufers entstand<br />
verantwortlich. In einem zweiten Schritt prüft man anhand der Adäquanztheorie.<br />
Man prüft ob die gesetzte Ursache für den Schaden adäquat war. Man soll<br />
nur Schäden zurechnen, die einigermaßen vorhersehbar und beherrschbar sind.<br />
Man haftet aber nicht nur für typische, sondern nur für ganz atypische Schadensfolgen<br />
nicht. Wer jemanden bei einem Verkehrsunfall verletzt, dem ist auch zuzurechnen,<br />
wenn der Geschädigte durch die Verletzung später einen Luftschutzbunker<br />
nicht mehr erreicht. Die Behinderung müsste außerhalb jeder Lebenserfahrung<br />
sein. Wenn eine Frau vergewaltigt wird und sich daraufhin umbringt ist dies ebenfalls<br />
adäquat.<br />
Bei psychischer Kausalität hat man zwei Personen, die jeweils Ursachen setzen. A setzt<br />
eine Ursache für eine Willensbetätigung des B, der zu einem Schaden führt, der ohne die<br />
von A gesetzte Ursache nicht entstanden wäre. Ein Beispiel wäre ein durch A verursachter<br />
Verkehrsunfall, bei dem B durch den Versuch zu Helfen verletzt wird. Ein weiteres Beispiel<br />
ist, wenn Dieb von der Polizei verfolgt wird und dadurch der Polizist oder Dritte verletzt<br />
werden. Kausalität (Äquivalenz und Adäquanz) ist hier problemlos gegeben. Die Frage<br />
wird daher auf der Ebene der Rechtswidrigkeit (Rechtswidrigkeitszusammenhang) gelöst.<br />
Bei Unterbrechung des Kausalzusammenhangs setzt A eine Kausalkette in Gang.<br />
Dann setzt B eine zweite Handlung, die mit der ersten Kausalkette nicht notwendig verbunden<br />
ist. Diese Handlung unterbricht die Kausalkette des A. Dazu zählen alle Fälle der<br />
psychischen Kausalität, aber auch andere zB A verursacht einen Verkehrsunfall und der<br />
behandelnde Arzt tötet das Opfer absichtlich. Hier stellt wieder die Kausalität kein Problem<br />
Seite 8 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
dar. Es geht wieder um den Rechtswidrigkeitszusammenhang bzw um den Schutzzweck<br />
der Norm.<br />
Die Kausalität von Aufwendungen. Bei Aufwendungen muss man unterscheiden:<br />
• Wenn der Schädiger aufgrund der Ursache Aufwendungen (conditio sine qua non)<br />
getätigt hat (zB Autoreparatur wegen Verkehrsunfall) sind die Aufwendungen jedenfalls<br />
zu ersetzen. Fiktive Aufwendungen sind nicht zu ersetzen.<br />
• Vorbeugende Aufwendungen sind hingegen problematisch. Verkehrsbetriebe halten<br />
etwa vorbeugend weitere Verkehrsgarnituren bereit. Wenn man sich das schädigende<br />
Verhalten wegdenkt, wären die Kosten trotzdem entstanden. Auf der anderen<br />
Seite ist es unbefriedigend, wenn der Schädiger keine Kosten übernehmen<br />
muss. Die Jud löst die Frage mittels einer GoA (§ 1035 ff). In der Lehre wird kritisiert,<br />
dass die Vorbeugung nicht im Interesse des Schädigers liegt. Ein Beispiel für<br />
eine Anwendung ist § 1042 analog. Bei einem Dieb stellt sich die Frage ob er nicht<br />
für die vorbeugenden Maßnahmen haften muss. Hier kann man nicht sagen, dass<br />
die Maßnahmen im Interesse des Diebes sind. Sehr wohl wird jedoch die Fangprämie<br />
ersetzt, da diese eindeutig verursacht wurden.<br />
• Frustrierte Aufwendungen sind Aufwendungen, die nutzlos geworden sind. Bei einem<br />
Verkehrsunfall ist etwa die Versicherungsprämie und der Garagenplatz während<br />
der Zeit der Reparatur nutzlos. Der Schädiger kann nun wieder sagen, dass er<br />
nicht kausal war, da sein Verhalten keine conditio sine qua non ist. Die Jud spricht<br />
hier trotzdem einen Schadenersatz zu, wenn es sich um typische Schäden handelt.<br />
1.2.2.2. Ausnahmen vom Verursachungsprinzip<br />
Bei den Ausnahmen vom Verursachungsprinzip reicht bereits der Kausalitätsverdacht.<br />
In § 1301 wird die Mittäterschaft geregelt. Die Rechtsfolgen sind in § 1302 geregelt.<br />
Mittäter handeln gemeinschaftlich und vorsätzlich. Sie haften solidarisch. Die zweite Möglichkeit<br />
ist, dass sie als Nebentäter handeln. Wenn sich die Anteile bestimmen lassen,<br />
dann haften sie anteilig, ansonsten solidarisch (Potentielle Kausalität). Es stellt sich die<br />
Frage, warum man die Kausalität nicht nachweisen muss. Vorsätzliche Täter werden<br />
durch die solidarische Haftung bestraft. Bei Nebentätern sind die Folgen milder. Die Begründung<br />
ist, dass die Unaufklärbarkeit eher bei den Schädigern als beim geschädigten<br />
liegen soll.<br />
Der erste gesetzlich nicht geregelte Fall ist der Fall der alternativen Kausalität. Es kommen<br />
dabei mehrere Personen als Schädiger in Betracht. Es kann jedoch nicht festgestellt<br />
werden, welcher Täter kausal für den Schaden war. Es gab jedoch sicher nur einen Täter.<br />
Die hA ist dass § 1302 analog angewandt wird. Es haften daher wieder alle potentiellen<br />
Täter solidarisch. Äußerst umstritten ist der Fall in dem ein Verhalten mit dem Zufall konkurriert.<br />
Den Zufall trifft gem § 1311 grundsätzlich den Geschädigten. Wenn jemand operiert<br />
wurde und durch die Operation stirbt lässt sich zB nicht feststellen ob der Tod durch<br />
einen Kunstfehler des Arztes oder durch das normale Operationsrisiko verursacht wurde.<br />
Die hA und auch der OGH nehmen eine Schadensteilung in Analogie zum Gedanken des<br />
Mitverschuldens gem § 1304 vor. Welser ist hingegen gegen diese Auffassung.<br />
Bei kumulativer Kausalität gibt es zwei oder mehrere Täter, die gleichzeitig eine Ursache<br />
setzen, die jede für sich allein den Schaden herbeiführen könnte. Hier scheint die Lehre<br />
der conditio sine qua non ein problem darzustellen, da man sich beide Handlungen einzeln<br />
Seite 9 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
wegdenken könnte und der Schaden trotzdem eintreten würde. Daher ist die hA, dass<br />
man § 1302 aufgrund eines Größenschlusses (a minori ad maius) anwendet. Wenn schon<br />
beide<br />
Der Unterschied zwischen der überholenden Kausalität und der kumulativen Kausalität<br />
ist ein Zeitmoment. Bei der überholenden Kausalität handeln die Personen nacheinander.<br />
Wenn jemand ein Haus verunstaltet und das Haus dann von einem Anderen abgebrannt<br />
wird fehlt es wieder an der Kausalität des ersten Schädigers. Auch hier ist die Lösung sehr<br />
umstritten. Nach der hL wird differenziert, welche Berechnungsmethode zur Anwendung<br />
kommt. Wenn subjektiv-konkret (zumindest grobe Fahrlässigkeit) berechnet wird kann<br />
man den hypothetischen Schädiger berücksichtigen. Dies würde eine Schadensteilung ermöglichen.<br />
Bei einer Gefährdungshaftung könnte man mit diesem Trick nicht weiterkommen.<br />
Es leuchtet auch nicht ein, dass der grob fahrlässige Ersttäter schlechter behandelt<br />
wird, als der leicht fahrlässige Ersttäter. Die Opposition ist daher der Meinung, dass nur<br />
der Zweittäter haftet.<br />
Ein körperlich angelegter Schaden ist zB Arthritis, die sich durch einen Verkehrsunfall<br />
etwa in Arthrose verwandelt. Der Schaden ist dabei nur vorverlegt worden, da er sowieso,<br />
jedoch später eingetreten wäre. Der Schädiger muss nur für den Schaden einstehen, der<br />
durch die Vorverlegung eingetreten ist.<br />
Es gibt Fälle der Verursachungsvermutung (zB AtomHG, ForstG, BergG, WRG = Wasserrechtsgesetz).<br />
Dabei wird die Kausalität vermutet. Der Schädiger muss sich freibeweisen.<br />
Das Mittel des Anscheinsbeweises ist im Bereich der Arzthaftung relevant. Wenn der<br />
Patient nachweisen kann, dass der Arzt einen Behandlungsfehler begangen hat, löst dies<br />
einen Anscheinsbeweis für den Schaden aus. Der Arzt muss dann die Kausalität widerlegen.<br />
1.2.3. Rechtswidrigkeit<br />
27. Oktober 2008<br />
Sie spielt in der Verschuldenshaftung eine Rolle. In der Gefährdungshaftung und der<br />
Eingriffshaftung benötigt man keine Rechtswidrigkeit.<br />
Für die Billigkeitshaftung gem § 1306a und § 1310 ist sie ebenfalls ein Tatbestandsmerkmal.<br />
Unter Rechtswidrigkeit versteht man, dass eine Handlung gegen Gebote oder Verbote<br />
der Rechtsordnung oder gegen die guten Sitten. Ein Verstoß gegen <strong>gesetzliche</strong> Verbote ist<br />
auch die Verletzung von vertraglichen Pflichten. Sie bezieht sich also immer nur auf<br />
menschliches Verhalten. Tiere können daher nicht rechtswidrig handeln.<br />
Es stellt sich die Frage ob man am Erfolg (Lehre vom Erfolgsunrecht) oder am Verhalten<br />
(Lehre vom Verhaltensunrecht) ausgehen soll. Es gilt nach hA die Lehre vom Verhaltensunrecht.<br />
Die Rechtswidrigkeit muss ex ante bei Setzung des Verhaltens beurteilt werden.<br />
Das Erfolgsunrecht spielt deshalb aber trotzdem eine Rolle. Bei Abwehrrechten des Bedrohten<br />
(zB Notwehr, Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche) genügt das Drohen eines<br />
schädigenden Erfolgs.<br />
Es können grundsätzlich Verstoße gegen alle Rechtsnormen (zB Verwaltungsrecht,<br />
Grundrecht, Steuerrecht, Strafrecht) zur Rechtswidrigkeit führen. Es gibt im Gegensatz<br />
zum Strafrecht kein Analogieverbot.<br />
Seite 10 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Es ist zu unterscheiden ob es sich um eine vertragliche oder deliktische Rechtswidrigkeit<br />
handelt. Gem § 1295 kann ein Schaden durch „Übertretung einer Vertragspflicht oder<br />
ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht worden sein“. Dies vermittelt den Anschein,<br />
dass die Unterscheidung irrelevant ist.<br />
Der Grund für die Unterscheidung ist:<br />
• Bei einem Vertrag treten die Parteien in Kontakt und müssen somit mehr aufeinander<br />
aufpassen. Man öffnet sich dem Vertragspartner und schenkt ihm Vertrauen,<br />
wodurch eine Schädigung leichter wird. Daher muss man sich gegenüber dem Vertragspartner<br />
sorgfältiger als gegenüber dem Umfeld verhalten.<br />
• Ein Übermaß an Verpflichtungen der Allgemeinheit gegenüber würde zu einer defensiven<br />
Grundhaltung führen. Man würde das Selbstbestimmungsrecht einschränken.<br />
Die vertragliche Haftung kann sich ergeben aus:<br />
1. Der Vertrag bildet den Maßstab. Ein Verstoß dagegen ist rechtswidrig.<br />
2. Bei culpa in contrahendo (cic) werden die Parteien so behandelt, als hätten sie bereits<br />
einen Vertrag geschlossen, da in diesem Vorstadium erhöhte Sorgfaltspflichten<br />
eingehalten werden müssen. Ein Bsp ist das Ausrutschen auf einer Bananenschale<br />
in einem Supermarkt. Die Verletzung nachwirkender Pflichten (zB Fortsetzungspflicht<br />
beim Auftrag) ist ebenfalls rechtswidrig.<br />
3. Positive Forderungsverletzungen. Bei der Vertragsabwicklung wird ein Schaden an<br />
den Rechtsgütern des Vertragspartners verursacht (zB Installateur lässt Hammer<br />
fallen). Es geht nicht um die vertraglichen Verpflichtungen, sondern um Schäden<br />
die auch deliktisch geschützt wären. Der Geschädigte kann sich auf die günstiger<br />
vertragliche Haftung stützen.<br />
Die vertragliche Haftung ist günstiger wegen:<br />
• § 1298 Beweislastumkehr<br />
• § 1313a bessere Erfüllungsgehilfenhaftung anstatt Besorgungsgehilfenhaftung<br />
(§ 1315)<br />
• Haftung für reine Vermögensschäden.<br />
Die Rechtswidrigkeit kann sich auch durch die Verletzung eines Schutzgesetzes ergeben.<br />
Absolut geschützte Rechtsgüter sind gegen den Eingriff von jedermann geschützt. Sie<br />
sind nicht aufgezählt, aber umfassen etwa die persönliche Freiheit, Persönlichkeitsrechte,<br />
das Eigentumsrecht, etc.<br />
Wenn kein vorheriger Tatbestand greift, so kommt die unsicherste Variante: § 1295 Abs 2<br />
(sittenwidrige Schädigung) zur Anwendung.<br />
1.2.3.1. Verletzung von Schutzgesetzen<br />
§ 1311 positiviert die Verletzung von Schutzgesetzen. Der Sinn von Schutzgesetzen ist,<br />
dass man bestimmte Dinge schützen will.<br />
Bei Schutzgesetzen gibt es zwei Problembereiche (sachlicher Anwendungsbereich, und<br />
wer ist geschützt = personell).<br />
Seite 11 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
1. Sachlicher Anwendungsbereich:<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
1. Es stellt sich die Fragen ob die Schäden im Zusammenhang mit dem Schutzzweck<br />
der Norm stehen.<br />
Bsp: Wenn Minderjährige gegen die Vorschriften länger arbeiten muss man sich<br />
fragen ob die Schutzvorschriften für Arbeitnehmer einen Schaden verhindern<br />
sollen oder nur die Ruhezeiten sichern sollen.<br />
Bsp: Bei Kreuzungen gibt es für das Parken einen Mindestabstand von fünf Metern.<br />
Es stellt sich die Frage ob die Regelung der Flüssigkeit des Verkehrs oder<br />
auch der Vorbeugung von Unfällen dienen soll.<br />
2. Bei diesem sachlichen Anwendungsbereich kann sich eine zweite Frage stellen:<br />
Welche Typen von Schäden sind erfasst. Die BauO soll insb das Einstürzen<br />
von Gebäuden verhindern. Sind aber auch Vermögensschaden erfasst? Durch<br />
den Lärm bei Gebäudebauten kann etwa ein anliegendes Gebäude weniger<br />
wert werden. Die BauO soll aber nicht diesen Vermögensschaden verhindern,<br />
wodurch keine Amtshaftung möglich ist.<br />
2. Personeller Anwendungsbereich<br />
Schadenersatz kann nur der unmittelbar Geschädigte verlangen. Wenn jemand<br />
eine Stromleitung schädigt und durch die Unterbrechung ein Kunde Nachteile erleidet<br />
stellt sich die Frage ob der Kunde noch im Schutzbereich der Norm ist. Nach<br />
der hA ist der Kunde nur mittelbar Geschädigter und bekommt keinen Schadenersatz.<br />
Auf bei der Gefährdungshaftung muss man auf den Schutzbereich der Norm schauen.<br />
§ 1 EKHG verlangt, dass jemand „durch einen Unfall beim Betrieb einer Eisenbahn oder<br />
beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs“. Ist ein Kraftfahrzeug in Betrieb wenn der Motor abgestellt<br />
ist? Ja, der Schutzzweck der Norm umfasst auch das Fahren mit abgeschaltetem<br />
Motor.<br />
Auch bei vertraglichen <strong>Schuldverhältnisse</strong>n stellt sich ebenfalls die Frage vom Schutzzweck<br />
der Norm. Wenn sich Dritte auf ein Gutachten eines Sachverständigen berufen,<br />
welches jedoch nur intern für den Auftraggeber gedacht ist ergibt sich kein Vertrag mit<br />
Schutzwirkung zugunsten Dritter.<br />
1.2.3.2. Eingriff in ein absolut geschütztes Recht<br />
Wenn man kein Schutzgesetz findet ist der nächste Schritt zu prüfen ob ein absolut geschütztes<br />
Recht verletzt wird.<br />
Der Eingriff bedeutet jedoch nicht sofort die Rechtswidrigkeit sondern indiziert diese<br />
nur. Man muss zusätzlich noch eine umfassende Interessenabwägung durchführen. Wenn<br />
sofort der Eingriff rechtswidrig wäre, würde es sich um die Erfolgsunrechtslehre handeln.<br />
Dies würde wieder zur Unbeweglichkeit führen, da man nie in andere Rechtsgüter eingreifen<br />
darf. Beim Sport (zB Ski, Fußball) kann man sich nie so verhalten, dass man nie in andere<br />
Rechtsgüter eingreifen wird.<br />
Absolut geschützte Rechtsgüter haben eine Art Hof um sich.<br />
Verkehrssicherungspflichten: Jeder der einen Verkehr eröffnet oder eine Gefahrenquelle<br />
schafft muss andere Rechtssubjekte möglichst schützen.<br />
Seite 12 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
1. Die Eröffnung eines Verkehrs beinhaltet die Eröffnung eines Gebäudes in das viele<br />
gehen, die Eröffnung eines Fitnessparcours etc.<br />
2. Schaffung einer Gefahrenquelle und Bestehenlassen dieser (zB Baugrube).<br />
Die Bedeutung der Verkehrssicherungspflichten ist die Verpflichtung zu einem aktiven<br />
Tun und dass bereits abstrakte Gefährdung bereits verboten ist .<br />
Das bloße Vermögen ist kein absolut geschütztes Rechtsgut. Man muss zwischen einem<br />
abgeleiteten (von der Verletzung eines absolut geschützten Rechts) und einem reinen/bloßen<br />
Vermögensschaden unterscheiden. Das bloße Vermögen ist wegen der Uferlosigkeit<br />
grundsätzlich nicht geschützt. Es wird jedoch zB geschützt wenn ein Schutzgesetz existiert,<br />
welches auch das bloße Vermögen schützt und bei der Vertragshaftung. Weitere Tatbestände<br />
sind § 874 Irrtum, § 1300 wissentliche Erteilung eines falschen Rats, § 408 ZPO<br />
mutwillige Prozessführung.<br />
Das Handeln auf eigene Gefahr schließt die Rechtswidrigkeit aus. Wenn sich jemand bewusst<br />
einer Gefahr aussetzt und dadurch Schaden leidet kann dies dazu führen, dass keine<br />
Rechtswidrigkeit<br />
Man unterscheidet echtes und unechtes Handeln auf eigene Gefahr. Beim echten gibt es<br />
gar keine Schutzpflichten. Der Geschädigte kommt da § 1319a (Wegehalter): „Ist der<br />
Schaden bei einer unerlaubten [...] Benützung des Weges entstanden und ist die Unerlaubtheit<br />
dem Benützer […] erkennbar gewesen, so kann sich der Geschädigte auf den<br />
mangelhaften Zustand des Weges nicht berufen“. Ein weiteres Beispiel ist § 176 Abs1<br />
ForstG.<br />
Beim unechten Handeln auf eigene Gefahr treffen den Gefährder doch gewisse Pflichten.<br />
Bei Rennveranstaltungen muss der Veranstalter alles tun um Unfälle zu vermeiden. Er<br />
muss daher auch fähiges Personal einsetzen. Beim Bungeejumping nimmt jeder ein gewisses<br />
Risiko in Kauf. Dieses beinhaltet aber nicht etwa das Lösen des Seils.<br />
Eine Rechtswidrigkeit von Unterlassungen ist gegeben, wenn eine Pflicht zu Handeln<br />
besteht. Es gibt nach hA keine Pflicht zur Abwendung von Schäden. Dies ergibt sich aus<br />
den §§ 1301 („nur durch Unterlassung der besonderen Verbindlichkeit“), 1312.<br />
Eine <strong>gesetzliche</strong> Verpflichtung gibt es zB hinsichtlich der Eltern. Die Eltern haben eine <strong>gesetzliche</strong><br />
Fürsorgepflicht. Vertragliche Verpflichtungen gibt es zB bei einem Bergführer. Die<br />
Verpflichtung kann sich aufgrund des Ingerenzprinzips (Schaffung der Gefahr) entstehen.<br />
Es gibt auch strafrechtliche Anknüpfungspunkte: §§ 94 (Imstichlassen eines Verletzten),<br />
95 (Unterlassung der Hilfeleistung), 286 (Unterlassung der Verhinderung einer strafbaren<br />
Handlung) StGB.<br />
1.2.3.3. Kausalzusammenhang<br />
03. November 2008<br />
Fälle der psychischen Kausalität und Unterbrechungen des Kausalzusammenhangs<br />
werden nicht auf der Ebene der Kausalität sondern erst auf der Ebene der Rechtswidrigkeit<br />
behandelt.<br />
Bei einer Verfolgungsjagd stellt sich die Frage ob einem Dieb der Schaden der dadurch<br />
entstanden ist zugerechnet werden kann. Grundsätzlich muss jeder die Folgen seiner Entscheidung<br />
tragen. Daher müsste der Polizist für seine Entscheidung einstehen. Gegen die<br />
Seite 13 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Haftung des Diebes würde auch sprechen, dass jemand anderer sich an dem Verhalten<br />
des Diebes orientiert. Man ist nur für sein Verhalten und nicht für das anderer Personen<br />
verantwortlich. Somit kann Rechtswidrigkeit nur dann entstehen, wenn belastete Elemente<br />
hinzukommen (Rechtswidrigkeit, fehlende Einsicht eines Anderen). Der Polizist handelt im<br />
Interesse der Allgemeinheit. Der Dieb muss daher für die Schäden einstehen, sofern der<br />
Polizist nicht übermäßig reagiert hat.<br />
Wenn man bei Rot über die Kreuzung geht und andere folgen nach, so sind diese grundsätzlich<br />
für sich selbst verantwortlich. Etwas anderes gilt, wenn neben einem ein kleines<br />
Kind steht und man dieses bemerkt. Kinder orientieren sich am Verhalten der Erwachsenen.<br />
1.2.3.4. Rechtfertigung<br />
Die Rechtfertigung führt zu einer Verneinung der Rechtswidrigkeit. Die Rechtfertigung<br />
kommt durch eine Interessenabwägung zustande.<br />
Rechtfertigungsgründe sind in erster Linie Notwehr und Notstand.<br />
1. Notwehr ist im ABGB nicht besonders intensiv geregelt. § 19 S 2 sagt „Wer sich<br />
aber mit Hintansetzung derselben der eigenmächtigen Hilfe bedient, oder, wer die<br />
Grenzen der Notwehr überschreitet, ist dafür verantwortlich.“. Der Begriff Notwehr<br />
wird hier vorausgesetzt. § 344 „Zu den Rechten des Besitzes gehört auch das<br />
Recht, sich in seinem Besitze zu schützen, und in dem Falle, dass die richterliche<br />
Hilfe zu spät kommen würde, Gewalt mit angemessener Gewalt abzutreiben.“<br />
Das ABGB geht vom Notwehrbegriff des StGB aus. Notwehr liegt gem § 3 Abs 1<br />
StGB vor wenn man „sich nur der Verteidigung bedient, die notwendig ist, um einen<br />
gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden rechtswidrigen Angriff auf Leben, Gesundheit,<br />
körperliche Unversehrtheit, Freiheit oder Vermögen von sich oder einem<br />
anderen abzuwehren“. Ehre ist nach dem Strafrecht nicht notwehrfähig. Im Zivilrecht<br />
ist dies umstritten.<br />
Ein schuldhaften Notwehrexzess ist rechtswidrig. Die Handlung ist nach Abs 2<br />
“nicht gerechtfertigt, wenn es offensichtlich ist, dass dem Angegriffenen bloß ein geringer<br />
Nachteil droht und die Verteidigung, insbesondere wegen der Schwere der<br />
zur Abwehr nötigen Beeinträchtigung des Angreifers, unangemessen ist“.<br />
Bei der Putativnotwehr glaubt der Verteidigende, dass ein rechtswidriger Angriff<br />
vorliegt. Dieser rechtswidrige Angriff besteht jedoch nicht. Ob es zu einer Haftung<br />
kommt, hängt davon ab man dem Verteidiger einen Vorwurf machen kann. Das Ergebnis<br />
ist daher gleich wie bei einem Notwehrexzess.<br />
Bei der Nothilfe verteidigt man nicht eigene Güter sondern die eines Anderen.<br />
2. Bei einem Notstand liegt kein rechtswidriger Angriff vor. Trotzdem besteht eine Gefahr.<br />
Der Eigentümer kann jedoch für die Gefahrenlage nichts dafür. Der Notstand<br />
ist eine Rechtfertigung, wenn die Interessen des Eingreifenden jene des Eigentümers<br />
beträchtlich überwiegen → rechtfertigender Notstand. Wenn die Interessen<br />
nicht so deutlich überwiegen kann das Verschulden anstatt der Rechtswidrigkeit<br />
entfallen → entschuldigender Notstand. Der Notstand ist ebenfalls nicht eigens im<br />
ABGB geregelt. § 1306a regelt einen Fall der Billigkeitshaftung: „Wenn jemand im<br />
Seite 14 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Notstand einen Schaden verursacht […] hat der Richter [...] zu erkennen, ob und in<br />
welchem Umfange der Schaden zu ersetzen ist“.<br />
„Wenn sich jemand aus eigenem Verschulden […] in einen Notstand versetzt hat,<br />
so ist auch der in demselben verursachte Schade seinem Verschulden zuzuschreiben“.<br />
Die Befreiung des § 1306 gilt hier somit nicht (§ 1307).<br />
Der Schadenersatzanspruch des § 1306a hängt von verschiedenen Faktoren ab.<br />
Es gibt nicht jedenfalls einen Schadenersatz. Der Richter kann entscheiden wie viel<br />
Schadenersatz zusteht. Die Richter hat „unter Erwägung, ob der Beschädigte die<br />
Abwehr aus Rücksicht auf die dem anderen drohende Gefahr unterlassen a) hat, sowie<br />
des Verhältnisses der Größe der Beschädigung zu dieser Gefahr b) oder endlich<br />
des Vermögens des Beschädigers und des Beschädigten c) zu erkennen, ob und in<br />
welchem Umfange der Schaden zu ersetzen ist.“<br />
a) Für einen Schadenersatz spricht, wenn er eine mögliche Abwehr unterlassen<br />
hat.<br />
b) Weiters ist eine Abwägung zwischen Gefahr und Beschädigung durchzuführen<br />
(zB Zertrümmern der gesamten Holzhütte).<br />
c) Der dritte Punkt ist die Kapazität der Schadenstragung. Dabei können auch Versicherungsüberlegungen<br />
eine Rolle spielen.<br />
Notwehr und Notstand bilden die Fälle der defensiven Selbsthilfe.<br />
3. Hingegen gibt es auch die offensive Selbsthilfe (§ 19). Diese ist noch weniger erwünscht,<br />
da der Staat das Gewaltmonopol hat. Wenn richterliche Hilfe zu spät kommen<br />
würde ist sie erlaubt. Die §§ 1321, 1101 sind gesetzlich erlaubte Fälle der Eigenmacht.<br />
§ 1321: „Wer auf seinem Grund und Boden fremdes Vieh antrifft, ist deswegen<br />
noch nicht berechtigt, es zu töten. Er kann es durch anpassende Gewalt verjagen;<br />
oder, wenn er dadurch Schaden gelitten hat, das Recht der Privat-Pfändung über<br />
so viele Stücke Viehes ausüben, als zu seiner Entschädigung hinreicht.“<br />
§ 1101 Abs 2 regelt das Perklusionsrecht (=Sperrecht) des Vermieters. „Zieht der<br />
Mieter aus oder werden Sachen verschleppt, ohne das der Zins entrichtet oder sichergestellt<br />
ist, so kann der Vermieter die Sachen auf eigene Gefahr zurückbehalten,<br />
doch muss er binnen drei Tagen um die pfandweise Beschreibung ansuchen<br />
oder die Sachen herausgeben“.<br />
Der Eingreifer muss jedoch immer möglichst schnell die Gerichte anrufen.<br />
Es stellt sich die Frage was passiert, wenn der Mieter nicht im Rückstand war. Die<br />
hA nimmt eine verschuldensunabhängige Haftung in Analogie zu § 394 Abs 1 EO (=<br />
Schäden aus einer einstweiligen Verfügung) an.<br />
3. Der vierte Rechtfertigungsgrund ist die Einwilligung des Verletzten. Dies ist allerdings<br />
nur dann möglich, wenn der Einwilligende über ein disponibles Gut verfügt.<br />
Es ergeben sich daher Probleme bei Körperverletzung und Tötung (zB Tötung auf<br />
Verlangen, Eigenmächtige Heilbehandlung). Eine Einwilligung in eine Heilbehandlung<br />
ist nur dann wirksam, wenn der Arzt seiner Aufklärungspflicht (alle Risiken) voll<br />
entsprochen hat.<br />
Seite 15 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
4. Ein fünfter möglicher Rechtfertigungsgrund ist die GoA im Notfall. Diese liegt dann<br />
vor wenn ein Schaden abgewendet werden soll. § 1302 regelt die Folgen: „Wer in<br />
einem Notfalle jemanden einen Dienst geleistet hat, dem wird der Schade, welchen<br />
er nicht verhütet hat, nicht zugerechnet; es wäre denn, das er einen Andern, der<br />
noch mehr geleistet haben würde, durch eine Schuld daran verhindert hätte“. Es<br />
kann somit sehr wohl zu Haftungsfolgen kommen.<br />
§ 1035 „Wer weder durch ausdrücklichen oder stillschweigenden Vertrag, noch vom<br />
Gerichte, noch aus dem Gesetze das Befugnis erhalten hat, darf der Regel nach<br />
sich in das Geschäft eines Andern nicht mengen. Hätte er sich dessen angemaßt;<br />
so ist er für alle Folgen verantwortlich.“ Es geht die Grundhaltung des Gesetzes<br />
hervor: Man soll sich nicht in andere Geschäfte einmischen.<br />
5. 6. Als letzter Grund ist die <strong>gesetzliche</strong> Ermächtigung zum Handeln zu nennen (zB<br />
Waffengebrauchsgesetz, Einsichtsmöglichkeiten).<br />
1.2.4. Verschulden<br />
Im Bereich der Verschuldenshaftung muss zusätzlich noch ein Verschulden, dh ein vorwerfbares<br />
Verhalten, hinzutreten. Die Rechtswidrigkeit ist ein objektiver, das Verschulden<br />
ein subjektiver Vorwurf. Rechtswidrigkeit heißt, dass der Betroffene anders hätte handeln<br />
sollen, Verschulden heißt, dass er dies auch hätte können.<br />
Bei einem Mitverschulden (§ 1304) liegt keine Rechtswidrigkeit vor, da es keine Verpflichtung<br />
sich in eigenen Dingen sorgfältig zu verhalten gibt. Es handelt sich der nicht um ein<br />
Verschulden im technischen Sinn.<br />
Bei einem Verschulden kommt es auch auf seine subjektiven Fähigkeiten insb seine Deliktsfähigkeit<br />
an (geregelt § 153). Unter Umständen kann auch ohne Verschulden eine Haftung<br />
begründet werden (§§ 1310, 1306a Billigkeitshaftung).<br />
Gem § 1302 gibt es bei Vorsatz einen vermutete Kausalität. Die Grenze der Adäquanz<br />
wird je weiter hinausgeschoben je vorwerfbarer der Täter handelt.<br />
Das Verschulden wird nur für die Haftungsbegründung nicht auch für die Haftungsausfüllung<br />
vorausgesetzt. Man muss nur den ersten Schaden voraussehen und verhindern<br />
können. Die weiteren Folgeschäden müssen nicht vorausgesehen werden können.<br />
Bei Schutzgesetzen gilt eine Besonderheit. Aus dem abstrakt gefährlichen Verhalten können<br />
sich leicht Schäden entwickelt. Das Verschulden muss sich nur auf den Verstoß gegen<br />
die Norm und nicht auf die damit verbundenen Schäden richten. Die Vorverlagerung<br />
des Verschuldens erfolgt, da mit der Verletzung der Norm gewöhnlich Schäden eintreten<br />
Gem § 1294 gründet sich die willkürliche Beschädigung „teils in einer bösen Absicht, wenn<br />
der Schade mit Wissen und Willen; teils in einem Versehen, wenn er aus schuldbarer Unwissenheit,<br />
oder aus Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit, oder des gehörigen Fleißes<br />
verursacht worden ist“. Daraus lassen sich zwei Schuldformen ableiten: böse Absicht (Vorsatz)<br />
und Versehen (Fahrlässigkeit).<br />
Vorsatz liegt vor wenn der Täter den Schaden voraussieht und ihn zumindest billigend in<br />
Kauf nimmt (dolus eventualis). Beim direkten Vorsatz (dolus specialis) will man direkt<br />
einen Erfolg verwirklichen. Schadenersatzrechtlich gibt es jedoch keinen Unterschied. Relevant<br />
ist der Unterschied zwischen bedingter Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit.<br />
Seite 16 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Für § 1295 Abs 2 genügt nach hA das Bewusstsein der Umstände aus denen sich die Sittenwidrigkeit<br />
ergibt. Man muss nicht das Bewusstsein der Sittenwidrigkeit haben.<br />
Das Gegenstück zum Vorsatz ist die Fahrlässigkeit. Man unterscheidet die grobe (auffallende<br />
Sorglosigkeit) und die leichte Fahrlässigkeit (Versehen).<br />
Daneben kommen zwei weitere Begriffe:<br />
• Die entschuldbare Fehlleistung ist wichtig für die Haftung des Arbeitnehmers<br />
(DHG). Liegt eine solche vor, so haftet der Dienstnehmer überhaupt nicht. Es stellt<br />
sich die Frage was die entschuldbare Fehlleistung ist. Wenn es nicht einmal leichte<br />
Fahrlässigkeit wäre, müsste man es nicht extra ausnehmen. Somit muss es eine<br />
besonders leichte Fahrlässigkeit sein.<br />
• Innerhalb der groben Fahrlässigkeit unterscheidet die Jud zwischen einer krassen<br />
(fast schon Vorsatz) und der schlichten groben Fahrlässigkeit.<br />
Es gibt daher vier Stufen: entschuldbare Fehlleistung → leichte Fahrlässigkeit → schlichte<br />
grobe Fahrlässigkeit → krasse grobe Fahrlässigkeit.<br />
10. November 2008<br />
Leichte Fahrlässigkeit liegt vor wenn ein Verhalten gegeben ist, dass jedermann einmal<br />
passieren kann. Grobe Fahrlässigkeit ist hingegen ein Verhalten, dass niemandem unterlaufen<br />
soll.<br />
Die Unterscheidung zwischen der „schlichten“ und der „krassen“ groben Fahrlässigkeit<br />
wurde vom OGH im Zusammenhang mit der Freizeichnungsklausel (§ 6 Abs 1 Z 9<br />
KSchG = Vereinbarung einer eingeschränkten Haftung für Schäden) entwickelt. Im Verbrauchergeschäft<br />
kann man somit die Haftung für Personenschäden überhaupt nicht, für<br />
Sach- und Vermögensschäden jedoch für leichte Fahrlässigkeit ausschließen. In dem Anlassfall<br />
hat eine Bank eine Freizeichnung für Beratungsverschulden auch für grobe Fahrlässigkeit<br />
ausgeschlossen. Da sich die Regelung im KSchG befindet liegt die Annahme<br />
nahe, dass die Regelung nur für Verbraucher gilt. Die einzige Mögliche Schranke wäre die<br />
Sittenwidrigkeit gem § 879. Nach Ansicht des OGH kann man die Haftung jedoch nicht immer<br />
ausschließen, nämlich für die krasse grobe Fahrlässigkeit (reich nahe an der Vorsatz<br />
heran) nicht.<br />
Das Verschulden ist die subjektive Vorwerfbarkeit. Gem § 1294 gründet sich die willkürliche<br />
Beschädigung „in einer bösen Absicht, wenn der Schade mit Wissen und Willen“, auf<br />
„einem Versehen, wenn er aus schuldbarer Unwissenheit, oder aus Mangel der gehörigen<br />
Aufmerksamkeit, oder des gehörigen Fleißes verursacht worden ist“. Es gibt daher zwei<br />
Komponenten: die schuldbare Unwissenheit (Wissenskomonente) und den Mangel der gehörigen<br />
Aufmerksamkeit oder des gehörigen Fleißes (Willenselement).<br />
Wie die beiden zu bewerten sind steht nicht in § 1294 sondern in § 1297. Gem § 1297<br />
„wird aber auch vermutet, das jeder den Verstandesgebrauch besitzt, eines solchen Grades<br />
des Fleißes und der Aufmerksamkeit fähig sei, welcher bei gewöhnlichen Fähigkeiten<br />
angewendet werden kann“. Für die Wissenskomponente wird daher ein subjektiver Maßstab<br />
angelegt. E contrario wird vermutet, dass dies für die Willenskomponente nicht gilt<br />
und somit ein objektiver Maßstab anzuwenden ist.<br />
§ 1299 normiert die Sachverständigenhaftung. Sachverständig ist ziemlich jeder der<br />
einen Beruf ausübt in diesem Bereich. Wer sich also „zu einem [...] Gewerbe oder Handwerke<br />
öffentlich bekennt […] gibt dadurch zu erkennen, das er sich den notwendigen Fleiß<br />
Seite 17 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
und die erforderlichen, nicht gewöhnlichen, Kenntnisse zutraue; er muss daher den Mangel<br />
derselben vertreten“. Wer sich als Sachverständiger ausgibt erweckt Vertrauen. Durch<br />
die Regelung sollen die Kunden nicht enttäuscht werden. Es gilt für Sachverständige daher<br />
ein objektiver Maßstab. Das gleiche gilt gem § 347 UGB für Unternehmer.<br />
Von der Lehre wird insb vertreten, dass auch in der Vertragshaftung von einem objektiven<br />
Fahrlässigkeitsmaßstab ausgegangen wird. Somit finden die vorherigen Paragraphen<br />
hauptsächlich Anwendung für den deliktischen Bereich.<br />
1.3. Gefährdungshaftung<br />
1.3.1. Allgemeines<br />
Man darf eine Gefahrenquelle schaffen. Aus dieser Quelle können sich jedoch Schäden<br />
entwickeln. Der Gefährder steht näher zur Gefahrenquelle als der Geschädigte und er<br />
zieht den Nutzen aus ihr, wodurch seine Haftung begründet wird („guter Tropfen – böser<br />
Tropen“).<br />
Die Gefährdungshaftung ist nicht mit der Eingriffshaftung zu verwechseln obwohl sie auf<br />
ähnlichen Überlegungen beruht. Bei der Gefährdungshaftung wird nur die Gefährdung erlaubt,<br />
nicht auch die Schädigung selbst. Man darf Autofahren aber niemanden schädigen.<br />
Bei der Eingriffshaftung ist hingegen der Eingriff erlaubt und der Schadenersatz gebührt<br />
als Ausgleich für den Eingriff (zB § 364a).<br />
Bsp für Eingriffshaftung ist etwa § 1306a (Notstand). Bei § 21 f KO handelt es sich dogmatisch<br />
um eine Eingriffshaftung. Der Gesetzgeber erlaubt den Masseverwalter in Verträge<br />
einzugreifen. Der Vertragspartner kann sich nicht wehren bekommt aber als Ausgleich<br />
eine verschuldensunabhängigen Ausgleichsanspruchs.<br />
Weite Bsp sind § 394 EO (einstweilige Verfügung) und das Polizeibefugnis-Entschädigungsgesetz.<br />
§ 36 MRG regelt den Ersatz des Ausmietungsschadens. Wenn ein Vermieter sich etwa auf<br />
Eigenbedarf beruft und die Kündigung wirksam wird, er aber die Wohnung dann nicht in<br />
Anspruch nimmt, so steht auch ein verschuldensunabhängiger Schadenersatzanspruch<br />
zu.<br />
Die Haftung ist in mehrerer Hinsicht begrenzt::<br />
• Es gibt zum Teil Haftungshöchstgrenzen. Diese sind jedoch bei der Gefährdungshaftung<br />
im ABGB nicht vorgesehen (Gastwirtehaftung (§ 970), Risikohaftung des<br />
Arbeitgebers (§ 1114), Haftung für Herabfallen von Sachen aus Wohnungen<br />
(§ 1318), Schäden ddurch Bauwerke (§ 1319), Schäden durch ein Tier (§ 1320).<br />
Weiters gibt es keine Höchstgrenzen im BergG, ForstG, AtomHG.<br />
• Eine zweite Begrenzung ist die Begrenzung durch den Schutzzweck. Nach dem<br />
EKHG werden zB nur Schäden beim Betrieb des Kraftfahrzeugs ersetzt. Der Betrieb<br />
erfasst aber auch das Fahren mit abgestellten Motor, da auch zB das Abrollen<br />
auf einem Berg vom Schutzzweck erfasst sein soll.<br />
• Wenn die Gefahr unbeherrschbar wird kann man sie nicht mehr kontrollieren. Somit<br />
gibt zB den Haftungsausschluss bei einem unabwendbares Ereignis (§ 9<br />
EKHG) oder den Ausschluss bei höherer Gewalt. Bei dem AtomHG und dem LFG<br />
geht es um so große Gefahren, dass nur der Schutzzweck erfüllt sein muss.<br />
Seite 18 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Es gibt viele Gesetze, die eine Gefährdungshaftung regeln, wie zB das EKHG, das Atom-<br />
HG, das ForstG, das Rohrleitungsgesetz, das RHPflG, etc. Aus diesen Gesetzen könnte<br />
man den Schluss ziehen, dass jeder der eine Gefahrenquelle schafft für diese verschuldensunabhängig<br />
einstehen muss. Nach einer Ansicht handele es sich bei diesen Gesetzen<br />
um Ausnahmetatbestände welche taxativ zu sehen sind. Es gäbe somit keine Lücke.<br />
Die Gegenauffassung ist der Meinung, dass der Gesetzgeber nur das geregelt habe, was<br />
gerade konkret notwendig war. Daraus könne man nicht ableiten, dass die Tatbestände taxativ<br />
zu sehen ist. Der BGH ist gegen eine Analogie, der OGH vertritt hingegen die Analogie<br />
mit Zustimmung der Lehre. Der OGH hat die Regel aufgestellt, dass jemand der einen<br />
gefährlichen Betrieb aufstellt für den Betrieb verschuldensunabhängig haften muss. Für<br />
Motorboote und Pistenraupen wurde eine Analogie jedoch abgelehnt.<br />
1.3.2. Adäquanz und Schutzzweck<br />
Es stellt sich die Frage wie Adäquanz und Schutzzweck zueinander stehen.<br />
Bei der Adäquanz geht es darum ob man einer Person den Schaden noch vernünftig zurechnen<br />
kann. Die Jud leugnet jedoch sehr selten die Adäquanz. Der Gesetzgeber dürfte<br />
anordnen, dass für alle Schäden einzustehen ist. Bsp für solche Anordnungen sind §§ 460<br />
(Pfandrecht), 965, 979 (Leih und Verwahrungsvertrag) und 1311 (zufälliger Untergang)<br />
§ 460: „Hat der Gläubiger das Pfand weiter verpfändet; so haftet er selbst für einen solchen<br />
Zufall, wodurch das Pfand bei ihm nicht zu Grunde gegangen oder verschlimmert<br />
worden wäre“. (casus mixtus-Haftung).<br />
Die Adäquanzgrenze ist beweglich. Wer vorsätzlich handelt muss für mehr einstehen, als<br />
jemand der nur fahrlässig handelt. Dies spielt praktisch jedoch eine geringe Rolle, da die<br />
Adäquanzgrenze sowieso sehr hoch ist.<br />
Beim Schutzzweck geht es ob ein Schaden noch im Schutzzweck der Norm liegt. Liegt<br />
der Schaden innerhalb so handelt es sich um einen unmittelbare Schaden, liegt er außerhalb<br />
so handelt es sich um einen mittelbaren Schaden für den grundsätzlich nicht einzustehen<br />
ist.<br />
Das rechtmäßige Alternativverhalten ist eine Einwendung des Schädigers. Der Schaden<br />
wäre dabei auch bei rechtmäßigem Alternativverhalten entstanden. Bsp: Inhaftierung ohne<br />
Haftbefehl, es liegen jedoch Haftgründe vor (Tun); lege artis Operation ohne Aufklärung,<br />
Behandelter hätte aber eingewilligt (Unterlassung). Bei der Unterlassung fehlt es bereits<br />
an der Kausalität (hätte er aufgeklärt wäre die Behandlung nicht unterblieben). Das Problem<br />
des rechtmäßigen Alternativverhaltens stellt sich also nur bei einem aktiven Tun.<br />
Wenn der Gesetzgeber jedoch ein bestimmtes Verfahren gewährleisten will so gibt es die<br />
Einwendung des rechtmäßigen Alternativverhaltens nicht, da sonst das Verfahren nie eingehalten<br />
werden würde. Daher ist die Inhaftierung ohne Haftbefehl zurechenbar.<br />
Adäquanztheorie und die Lehre vom Schutzzweck sind unterschiedliche Gesichtspunkte<br />
und somit nebeneinander anzuwenden. Sie können auch zu unterschiedlichen Ergebnissen<br />
führen (Tenor wird überfahren → viele Schäden wie Buffet, Zuschauer, Garderobe, etc<br />
[adäquat aber nicht im Schutzzweck]).<br />
Seite 19 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
1.4. Leistung des Schadenersatzes<br />
1.4.1. Art des Schadenersatzes<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
17. November 2008<br />
In § 1323 wird der Grundsatz der Naturalrestitution aufgestellt (Primat der Naturalrestitution).<br />
Nur wenn diese nicht tunlich oder nicht möglich ist kommt es zum Geldersatz.<br />
§ 1323 erwähnt nur die Tunlichkeit, aber bei einer Unmöglichkeit ist selbstverständlich<br />
auch nur Wertersatz möglich.<br />
Möglich bedeutet es, wenn durch den Austausch oder die Reparatur ein gleichwertiger<br />
oder ein gleichartiger Zustand herbeigeführt werden kann.<br />
Untunlichkeit kann sich aus den Interessen des Schädigers kommen, nämlich wenn die<br />
Reparatur oder der Austausch unverhältnismäßig mehr kosten würde als der Geldersatz<br />
(zB (Auto mit einem Zeitwert von 10.000€ aber Reparaturkosten von 11.000€). Ein unverhältnismäßig<br />
hoher Aufwand ist schwer zu definieren. Nach der Jud kann die Reparatur<br />
noch verlangt werden, wenn sie nicht mehr als 10% des Zeitwerts übersteigt (Im Bsp wäre<br />
Naturalrestitution daher noch tunlich). Die deutsche Jud gestehen hier eine Überschreitung<br />
von 30% zu.<br />
Eine Ausnahme normiert § 1332a für Tiere. Gem § 285a sind Tiere „keine Sachen; […].<br />
Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine<br />
abweichenden Regelungen bestehen.“ nach § 1332a gebühren bei Verletzung eines Tieres<br />
„die tatsächlich aufgewendeten Kosten der Heilung oder der versuchten Heilung auch<br />
dann, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen, soweit auch ein verständiger Tierhalter<br />
in der Lage des Geschädigten diese Kosten aufgewendet hätte“. Es gibt hier also keine<br />
10%-Grenze sondern nur die Grenze des Aufwands eines verständigen Tierhalters.<br />
Die Untunlichkeit kann sich auch aus der Sphäre des Geschädigten ergeben, wenn er<br />
keine Naturalrestitution sondern nur Geldersatz möchte. § 1323 scheint hier dagegen zu<br />
sprechen. Nach Koziol ist Naturalrestitution nur ein Recht und keine Pflicht des Geschädigten,<br />
wodurch er auch von vornherein Geldersatz verlangen kann. Nach Welser besteht<br />
jedoch kein Wahlrecht. In der Praxis geht man von der Möglichkeit Geldersatz zu verlangen<br />
aus (zB für KFZ-Schäden).<br />
Wenn man selbst die Naturalrestitution durchführt stellt sich die Frage ob man einen<br />
Anspruch auf die Kosten hat. Man hat einen Anspruch, da ja der Schädiger den Aufwand<br />
hätte machen müsste. Man hat nach einer Auffassung Anspruch gem § 1042, nach einer<br />
anderen Meinung einen Anspruch aus § 1323 selbst (gleiches Ergebnis). Man hat den Anspruch<br />
nur wenn man den Aufwand wirklich tätigt (keine fiktiven Mietwagenkosten).<br />
Bei Schmerzen und Trauer (ideelle Schäden) erscheinen die Schäden nicht mehr aus der<br />
Welt geschafft zu werden können. Es geht aber nur um die Schadensverlagerung und<br />
nicht um das komplette Beseitigen des Schadens. Bei der Ehrenbeleidigung gem § 1330<br />
Abs 2 (Kreditschädigung) kann man den Widerruf und Urteilsveröffentlichung verlangen.<br />
Damit wird die Ehre (zeitversetzt) wieder hergestellt. Daher ist auch (bei manchen) ideellen<br />
Schäden Naturalrestitution möglich. Ideelle Schäden sind jedoch viel schwerer für<br />
den Geldersatz zu objektivieren und zu bewerten. Die Praxis nimmt dazu zB Schmerzengeldtabellen,<br />
Tabellen für die entgangene Urlaubsfreude → Geldersatz.<br />
Seite 20 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Wenn Naturalrestitution vorgenommen wird, kann es dazu kommen, dass eine Werterhöhung<br />
stattfindet („neu für alt“). Nach der hA ist in diesen Fällen die Naturalrestitution untunlich<br />
und es kann daher nur Geldersatz verlangt werden. Die ältere Lehre ging von einem<br />
Vorteilersatzausgleich aus.<br />
1.4.2. Umfang des Schadenersatzes<br />
Nur was der Gesetzgeber als Schaden definiert ist ein Schaden und nicht das, was jemand<br />
als Schaden empfindet.<br />
Bei der Verschuldenshaftung gibt es den gegliederten Schadensbegriff. Bei leichter<br />
Fahrlässigkeit wird der positive Schaden, bei grober Fahrlässigkeit auch der entgangene<br />
Gewinn ersetzt. Auch die Berechnungsmethode hängt von dem Verschulden ab. Bei leichter<br />
Fahrlässigkeit wird objektiv abstrakt berechnet, bei grober Fahrlässigkeit subjektiv konkret.<br />
Die §§ 1306a (Notstand) und 1310 (Deliktsunfähiger) sind Fälle der Billigkeitshaftung.<br />
Dort entscheidet der Richter ob und wie viel zu ersetzen ist.<br />
Unbestritten ist, dass in den Fällen der Eingriffshaftung immer das gesamte Interesse<br />
(positiver Schaden + entgangener Gewinn) zu ersetzen ist.<br />
In den §§ 1318, 1319, 970 (Gefährdungshaftung) gibt es keine solche Regelung. Im<br />
EKHG und PHG stellt sich die Frage was der Geschädigte verlangen kann. Die hA ist bei<br />
beiden Gesetzen der Auffassung, dass nur der positive Schaden und nicht der entgangene<br />
Gewinn ersetzt werden kann. Eine aM meint, dass die Gefährdungshaftung gleichwertig<br />
zur Verschuldenshaftung ist und das Interesse nach diesen Bestimmungen zu ersetzen ist.<br />
In der Praxis war dies jedoch noch kein Problem.<br />
Im Unternehmensrecht gibt es Abweichungen. Früher war bei (auch einseitigen)<br />
Handelsgeschäften immer das Interesse zu ersetzen. Daher bestand die strenge Haftung<br />
auch wenn der Nicht-Kaufmann den Kaufmann schädigt. Es wurde vorgeschlagen den<br />
Gesetzeswortlaut teleologisch zu reduzieren. Der neue § 349 UGB hat diese Aufgabe<br />
übernommen. Nur der Unternehmer haftet für das Interesse.<br />
1.4.3. Gegliederter Schadensbegriff<br />
§ 1323: „Betrifft der Ersatz nur den erlittenen Schaden, so wird er eigentlich eine Schadloshaltung;<br />
wofern er sich aber auch auf den entgangenen Gewinn, und die Tilgung der<br />
verursachten Beleidigung erstreckt, volle Genugtuung genannt. Der positive Schaden<br />
wird eigentliche Schadloshaltung, die Tilgung der verursachten Beleidigung, positiver<br />
Schaden + entgangener Gewinn = gesamte Interesse genannt.<br />
§ 1324 konkretisiert dies. „In dem Falle eines aus böser Absicht, oder aus einer auffallenden<br />
Sorglosigkeit verursachten Schadens; ist der Beschädigte volle Genugtuung; in den<br />
übrigen Fällen aber nur die eigentliche Schadloshaltung zu fordern berechtigt“.<br />
Gem § 1331 ist jemandem der an seinem Vermögen „vorsätzlich oder durch auffallende<br />
Sorglosigkeit eines Andern beschädigt“ wird „auch den entgangenen Gewinn, und wenn<br />
der Schade vermittelst einer durch ein Strafgesetz verbotenen Handlung, oder aus Mutwillen<br />
und Schadenfreude verursacht ist, den Wert der besonderen Vorliebe zu fordern berechtigt“.<br />
Seite 21 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Gem § 1332 wird „der Schade, welcher aus einem mindern Grade des Versehens oder der<br />
Nachlässigkeit verursacht worden ist […] nach dem gemeinen Werte, den die Sache zur<br />
Zeit der Beschädigung hatte, ersetzt“. Dies bezeichnet man als objektiv abstrakte Berechnungsmethode.<br />
Der Wert wird nach dem gemeinen Wert im Zeitpunkt der Schädigung<br />
berechnet (Momentaufnahme).<br />
Bei einer groben Fahrlässigkeit oder bei Vorsatz wird subjektiv konkret berechnet. Es<br />
wird also die Auswirkung im Vermögen des Geschädigten untersucht. Dies umfasst auch<br />
künftige Veränderungen.<br />
Bsp: Bei einer kompletten Markensammlung wird zB eine Marke beschädigt. Objektiv konkret<br />
steht nur der Wert der einzelnen Marke zu. Bei subjektiv konkreter Berechnung ist<br />
auch die Wertminderung des gesamten Satzes zu berücksichtigen.<br />
Der positive Schaden kommt man um das was man schon hat, beim entgangenen Gewinn<br />
kommt man um das was man sonst hätte.<br />
Vom positiven Schaden kann man nur sprechen wenn es eine rechtlich gesicherte Chance<br />
gibt. Es wäre jedoch ungerecht für einen Taxi-Fahrer den entgangenen Lohn nicht zum positiven<br />
Schaden zu zählen obwohl er sicher Kunden bekommen hätte. Wenn man ein Los<br />
gekauft hat und dieses von einem Dritten leicht fahrlässig vernichtet wird stellt dieses gewinnende<br />
Los eine rechtlich gesicherte Chance dar und es handelt sich somit um einen<br />
positiven Schaden.<br />
Der gemeine Wert ist der allgemeine Wert. Das ABGB definiert diesen Begriff in § 305:<br />
„Wird eine Sache nach dem Nutzen geschätzt, den sie mit Rücksicht auf Zeit und Ort gewöhnlich<br />
und allgemein leistet, so fällt der ordentliche und gemeine Preis aus“. Wenn man<br />
ein total beschädigtes Auto hat stellt sich die Frage ob der gemeine Wert der Ver- oder der<br />
Einkaufspreis ist. In Frage kommt auch der Ertragswert (was bringt die Sache) oder der<br />
Herstellungswert (wieviel ist notwendig um die gleiche Sache herzustellen). IdR kommt es<br />
für den gemeinen Wert auf den Verkehrswert in Form des Einkaufspreises an: was muss<br />
man aufwenden um ein vergleichbares Auto zu bekommen. Nur wenn es einen solchen<br />
Einkaufspreis nicht gibt, weil es keinen Markt gibt muss man auf die anderen Werte subsidiär<br />
zurückgreifen (Ertragswert, Herstellungswert).<br />
Wenn der Schaden in einer besonders verwerflichen Weise herbeigeführt wird (§ 1331:<br />
„vermittelst einer durch ein Strafgesetz verbotenen Handlung, oder aus Mutwillen und<br />
Schadenfreude“) ist auf den Wert der besonderen Vorliebe (Affektionsinteresse) abzustellen,<br />
weil der Schädiger nicht schutzwürdig ist. Es kommen daher subjektive Elemente<br />
zum Tragen.<br />
Bei dem Problem „neu für alt“ muss man bei objektiv abstrakter Berechnung nur den Zeitwert<br />
ersetzen. Bei subjektiv konkreter Berechnung kann man hingegen die Vorverlagerung<br />
der Notwendigkeit von Aufwendungen (Früherer Neukauf des Autos → zB Kreditzinsen)<br />
berücksichtigen. In der Praxis wird dies jedoch nicht durchgeführt.<br />
Der merkantile Minderwert ist die Minderung der Werts des reparierten Objekts durch<br />
den Schaden. Wenn ein Auto beschädigt wird und Naturalrestitution geleistet wird so wird<br />
das Auto zwar repariert aber das reparierte Auto ist am Markt weniger wert (Unfallauto).<br />
Dies ist eine Frage des positiven Schadens, da das Auto jetzt schon weniger wert ist. Daher<br />
ist er auch bei leichter Fahrlässigkeit zu ersetzen. In der Praxis gilt dies nur für 1-2<br />
Jahre alte Autos, da der merkantile Minderwert bei älteren Autos idR keine Rolle mehr<br />
spielt.<br />
Seite 22 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Bei subjektiv konkreter Berechnungsmethode wird ein Vergleich der Vermögenslage<br />
vorher mit der nachher angestellt. Der Wertmaßstab bleibt jedoch objektiv. Es wird daher<br />
nicht darauf abgestellt wie der Geschädigte den Schaden empfindet. Eine subjektive Komponente<br />
kommt beim Affektionsinteresse hinzu. Der Geschädigte hat in diesem Fall ein<br />
Wahlrecht. Er kann daher den Schaden auch objektiv abstrakt berechnen lassen. Ihm<br />
steht der objektive Schaden als Minimum zu. Dies wird mit dem Grundsatz der Wertverfolgung<br />
begründet. Wenn man seine kaputte Autotüre nicht reparieren lassen will liegt ja<br />
„kein Schaden“ vor. Man kann jedoch den Zeitwert verlangen.<br />
24. November 2008<br />
§ 1323 verwendet den Begriff der „Tilgung der verursachten Beleidigung“. Es geht dabei<br />
um ideelle Schäden. Es stellt sich die Frage ob die Norm eine eigenständige Bedeutung<br />
hat oder bloß andeuten soll, dass uU der ideelle Schaden zu ersetzen ist. Eine Meinung<br />
ist, dass bereits § 1293 die Lösung enthält und der positive Schaden schon die idellen<br />
Schäden erfasst. Nach Franz Bydlinski ist der reine Gefühlsschaden nur bei grober<br />
Fahrlässigkeit zu ersetzen und ein abgeleiteter (klammert sich an Vermögensschaden an)<br />
nur bei qualifizierten Verschulden zu ersetzen. Das Gesetz kann jedoch davon abweichen.<br />
§ 1325 normiert etwa das Schmerzensgeld schon für leichte Fahrlässigkeit. Ehrenbeleidigung<br />
§ 1330: „Wenn jemandem durch Ehrenbeleidigung ein wirklicher Schade [positiver<br />
Schaden] oder Entgang des Gewinnes verursacht worden ist, so ist er berechtigt, den Ersatz<br />
zu fordern“. Der ideelle Schaden soll nach dieser Norm eindeutig nicht ersetzt werden.<br />
Die Jud hat dies jedoch nicht so gesehen und hat den Grundsatz aufgestellt, dass der ideelle<br />
Schaden nur dort zu ersetzen ist, wo dies ausdrücklich im Gesetz normiert wurde.<br />
Dies widerspricht § 1323. Daher kann ideeller Schaden nur nach den §§ 1325 (Schmerzensgeld<br />
bei Körperverletzung), 1328 (Recht auf Wahrung der Privatsphäre), § 1328a (geschlechtlichen<br />
Selbstbestimmung), 1329 (Freiheitsberaubung), 1331 (Wert der besonderen<br />
Vorliebe) und 31e Abs 3 KSchG (entgangene Urlaubsfreude) ersetzt werden. Die Jud<br />
hat jedoch bei der Trauer der Angehörigen (§ 1325) eine Ausnahme gemacht. Bei schweren<br />
Verschulden kann auch bloße Trauer schadenersatzpflichtig machen.<br />
1.4.4. Mitverantwortlichkeit des Geschädigten<br />
Es geht nicht nur um das Mitverschulden. Beim Mitverschulden ist auch auf Seiten des<br />
Geschädigten ein Verschulden zu verzeichnen. Nach § 1304 ist diese Mitverschulden zu<br />
berücksichtigen. IZw ist von einer Halbierung des Schadens auszugehen.<br />
Mit seinem eigenen Vermögen sorgfältig umzugehen ist nur eine Verletzung der Obliegenheit,<br />
da keine Pflicht besteht sich mit seinen Sachen sorgsam umzugehen. Es liegt<br />
daher kein Mitverschulden vor.<br />
Die Kulpakompensation lässt den Ersatz des Schadens zur Gänze entfallen. Es gab früher<br />
drei Fälle (+§ 866). Heute gibt es noch zwei Möglichkeiten: §§ 878 S 3, 1308.<br />
• § 878 regelt die anfängliche Unmöglichkeit. Nach Satz 3 hat „wer bei Abschließung<br />
des Vertrages die Unmöglichkeit kannte oder kennen musste, […] dem anderen Teile,<br />
falls von diesem nicht dasselbe gilt, den Schaden zu ersetzen, den er durch das<br />
Vertrauen auf die Gültigkeit des Vertrages erlitten hat“. Wenn daher beide Seite die<br />
Unmöglichkeit kennen kommt es zu einer Kulpakompensation und es gibt daher<br />
keinen Schadenersatz.<br />
Seite 23 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
• Nach § 1308 kann „wenn Personen, die den Gebrauch der Vernunft nicht haben,<br />
oder Unmündige jemanden beschädigen“, derjenige, der „durch irgendein Verschulden<br />
hierzu selbst Veranlassung gegeben hat [...] keinen Ersatz ansprechen“.<br />
• § 866 ist entfallen. Damals ist die Volljährigkeit erst mit 19 eingetreten. Wenn jemand<br />
mit einem 18-jährigen ein Geschäft geschlossen hat war der 18-jähriige<br />
schützenswerter (noch nicht voll geschäftsfähig)<br />
§ 1304 (Mitverschulden) ist auch in der Gefährdungshaftung zu beachten. Die §§ 7<br />
EKHG, 11 PHG normieren dies nochmal ausdrücklich. Bei der Eingriffshaftung ist dies<br />
kaum denkbar, da ein Mitverschulden praktisch ausgeschlossen ist.<br />
Es gilt eine Anlegepflicht für Gurte und eine Pflicht für Motorradfahrer Sturzhelme zu tragen.<br />
Dies könnte zu einem Mitverschulden führen. Dies wollte man aber nicht und hat daher<br />
die Relevanz des Mitverschuldens auf das Schmerzensgeld reduziert. Dies wurde als<br />
verfassungswidrig empfunden, hat aber die Prüfung des VfGH bestanden. Bei Gurten ist<br />
es denkbar, dass in bestimmten Situationen der angelegte Gurt die Gefahr beim Unfall erhöht.<br />
Dafür gibt es im Verkehrsopferentschädigungsgesetz einen eigenen Ausgleich. Nach<br />
§ 7 dieses Gesetzes gibt es einen Anspruch des Sozialversicherungsträgers wenn man<br />
auf diese . Dies ist ein Fall der Eingriffshaftung. Man muss den Gurt anlegen. Für diese<br />
Verpflichtung zugunsten der Allgemeinheit gibt es einen verschuldensunabhängigen Ausgleichsanspruch.<br />
Die Gehilfenzurechnung für den Geschädigten stellt ein Problem auf. Auf der Seite des<br />
Schädigers gelten die §§ 1313a oder 1315. Man nennt den Gehilfen des Geschädigten<br />
Bewahrungsgehilfe (terminus technicus) Nach § 7 Abs 2 EKHG steht „dem Verschulden<br />
des Geschädigten […] im Falle der Tötung das Verschulden des Getöteten und im Falle<br />
der Beschädigung einer Sache das Verschulden desjenigen gleich, der die tatsächliche<br />
Gewalt über die Sache ausübte“. Man muss sich also das Verschulden des Bewahrungsgehilfen<br />
anrechnen lassen. Ähnliche Regelungen enthalten die §§ 1a RHPflG, 15 Atom-<br />
HG, 61 LFG. Es ist umstritten ob sich bei diesen Regelungen um allgemeine Grundsätze<br />
oder nur Einzelbestimmungen handelt. Die hA geht von einer generell anzuwendenden<br />
Regelung aus. Die Opposition bringt die Gleichbehandlungsthese entgegen (auch nur Anwendung<br />
der §§1313a und 1315).<br />
Eng verwandt mit § 1304 ist das Problem der Schadenminderungspflicht. Beim Mitverschulden<br />
hat man die Entstehung, bei der Schadenminderungspflicht die Weiterentwicklung<br />
des Schadens nicht verhindert. Der Schaden der sich durch die eigene Sorglosigkeit<br />
erst weiterentwickelt hat kann nicht gefordert werden. Die Grenze liegt in der Zumutbarkeit.<br />
Wenn man die Unfallfolgen nur durch eine risikoreiche Operation ausgleichen könnte<br />
so ist dies nicht mehr zumutbar.<br />
1.4.5. Vorteilsausgleichung<br />
Sehr umstritten ist die Vorteilsausgleichung (Vorteilsanrechnung). Es geht darum, dass<br />
durch eine Schädigung im Vermögen des Geschädigten auch Vorteile entstehen können.<br />
Das Schadenersatzrecht geht von einem Ausgleichsgedanken aus. Wenn jemand durch<br />
einen Unfall ins Spital muss erspart er sich die Haushaltsaufwendungen (zB Essen) und<br />
bekommt uU Geld von einem Verwandten als Trost. Es stellt sich die Frage ob die Zuwendung<br />
zu berücksichtigen ist. Es gibt aber auch Fälle ohne Zuwendung (zB Jockey gewinnt<br />
Preis mit kranken Pferd dadurch, dass er entgegen der Anweisung des Eigentümers das<br />
Pferd zu sehr beansprucht, wodurch das Pferd stirbt).<br />
Seite 24 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Es wurde verursacht dieses Problem mit der Schadenberechnungsmethode zu lösen: Nur<br />
wenn der Schaden konkret berechnete wird ist nicht auf den Zeitpunkt der Schädigung abzustellen<br />
sondern die gesamte Entwicklung im Vermögen zu berücksichtigen. Daher ist<br />
dort die Vorteilsausgleichung grundsätzlich möglich. Bei der abstrakten Berechnung<br />
kommt es nur auf den Zeitpunkt der Schädigung an. Daher würde dort die Vorteilsausgleichung<br />
nicht möglich sein.<br />
Gegen diese Lösungsmethode bestehen jedoch Bedenken. In der Gefährdungshaftung<br />
nützt dieser Ansatz etwa nichts. Daher setzt sich immer mehr die Auffassung durch, dass<br />
es grundsätzlich immer Schadensausgleich geben muss unabhängig von der Haftung außer<br />
es sprechen konkrete Gründe dagegen.<br />
Man muss daher auf den Zweck der Zuwendung schauen: Soll die Zuwendung auch den<br />
Schädiger entlasten oder wird sie nur dem Geschädigten gegenüber erbracht? Eine<br />
Schenkung als Trost soll zB nur dem Geschädigten zukommen.<br />
In den Fällen der Legalzession soll es nicht zum Vorteilsausgleichung kommen = verhinderte<br />
Vorteilsausgleichung. Dies ist jedenfalls bei den §§ 332 Abs 1 ASVG und 67 Abs 1<br />
VersVG gegeben. Bei einer Feuerversicherung<br />
Der Anspruch auf Schadenersatz geht gem § 67 Abs 1 VersVG auf den Versicherer über<br />
(Legalzession), wenn „dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen<br />
einen Dritten“ zusteht „soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt“.<br />
Wenn es zur Vorteilsausgleichung kommen würde, würde kein Schaden mehr bestehen<br />
und der Schadenersatzanspruch könnte nicht auf den Versicherer übergehen.<br />
Die Jud hat zu vielen dieser Probleme noch keine Stellung nehmen müssen, wodurch die<br />
Folgen noch unklar sind.<br />
1.4.6. Drittschaden<br />
Bei einem Drittschaden entsteht der Schaden bei einem mittelbaren Geschädigten. Bei<br />
der Vorteilsausgleichung geht es darum ob die Leistung des Dritten angerechnet wird, bei<br />
dem Drittschaden geht es darum ob dem Dritten ein Schaden entstanden ist. Die Verletzung<br />
des Opernstars schädigt jedenfalls den Veranstalter. Aber auch die Buffetiers, Taxifahrer,<br />
Zuschauer, umliegende Restaurants sind betroffen.<br />
Es wird daher eine Flutwelle von weiteren Schäden ausgelöst. Daher droht die Uferlosigkeit.<br />
Nicht mehr eindeutig ist die Uferlosigkeit bei einem indirekten Stellvertreter: Man beauftragt<br />
jemanden ein Auto zu kaufen. Das Auto wird nach dem Kauf durch Verschulden<br />
eines Dritten zerstört. Der indirekte Stellvertreter ist Eigentümer des Autos geworden. Er<br />
hat einen Aufwandsersatzanspruch gegen den Auftraggeber und somit keine Schaden.<br />
Der Auftraggeber ist jedoch kein Eigentümer und es wurde daher nicht in sein absolut geschütztes<br />
Recht eingegriffen. Er hat daher ebenfalls keinen Schaden.<br />
§ 1295 Abs 1 scheint hier eine einfache Lösung anzubieten: „Jedermann ist berechtigt,<br />
von dem Beschädiger den Ersatz des Schadens, welchen dieser ihm aus Verschulden zugefügt<br />
hat, zu fordern;“ = Jedermannthese. Dies ist jedoch nicht mehr die hA sondern es<br />
kommt auf den Schutzbereich der Norm an. Diejenigen die sich innerhalb des Schutzbereichs<br />
befinden sind die unmittelbar Geschädigten, diejenigen die sich außerhalb des<br />
Schutzbereichs stehen sind die mittelbar Geschädigten und haben daher grundsätzlich<br />
keinen Anspruch auf Schadenersatz.<br />
Seite 25 von 26
<strong>Schuldrecht</strong> <strong>BT</strong>: <strong>gesetzliche</strong> <strong>Schuldverhältnisse</strong> 1<br />
<strong>Mitschrift</strong> <strong>VO</strong> Fenyves, WS 2008<br />
Bei § 1327 geht es um die Unterhaltsansprüche gegen den Getöteten. Mit einem Gedankenexperiment<br />
kann die Uferlosigkeit überprüfen: Wenn der Geschädigte nicht stirbt sondern<br />
nur einen Verdienstentgang erleidet so kann er den Unterhalt nicht mehr leisten. Er<br />
kann daher nicht schlechter gestellt werden wenn er getötet wird. Die Höhe des Schadens<br />
ändert sich daher nicht. Es kommt daher nicht zur Uferlosigkeit.<br />
Bei einer bloßen Schadensverlagerung ist der Schaden auch zu ersetzen (Drittschadensliquidation).<br />
Dies ist dann gegeben wenn es bloß zu einer Verlagerung des Schadens<br />
kommt (zB bei der indirekten Stellvertretung) und es somit nicht zu einer Uferlosigkeit<br />
kommen kann. Auch der mittelbar Geschädigte kann daher den Schaden geltend machen.<br />
Es bleibt jedoch offen ob der mittelbare oder der unmittelbar Geschädigte formal<br />
den Anspruch geltend machen muss. Bei der Gefahrtragung im Gläubigerverzug liegt, wie<br />
auch bei der Lohnfortzahlung gem § 1154b, ebenfalls ein Fall der Schadensverlagerung<br />
vor.<br />
25. Dezember 2008<br />
Da ich heute meine mündliche Prüfung bestanden habe endet die <strong>Mitschrift</strong> hier. Es<br />
fehlt daher der Rest der Lehrveranstaltung.<br />
Seite 26 von 26