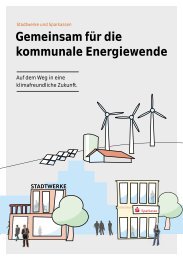green technology - Verantwortung Zukunft
green technology - Verantwortung Zukunft
green technology - Verantwortung Zukunft
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
trieb ist die kompakte Form. Das Volumen<br />
der A320-Originalfelge durfte nicht überschritten<br />
werden. Bei den Motoren selbst<br />
handelt es sich um permanent erregte,<br />
getaktet angesteuerte Gleichstrommotoren.<br />
Einfach aufgebaut und mit einer hocheffizienten<br />
Steuerelektronik ausgestattet, könnte<br />
diese Motorenart später kommerziell<br />
genutzt werden. Mit einem Zielgewicht von<br />
65 Kilogramm pro Motor fällt das Zusatzgewicht<br />
des Antriebs moderat aus.<br />
Bis ein neues System im Flugzeug Verwendung<br />
findet, muss jede Komponente einen<br />
sehr anspruchsvollen Überprüfungsprozess<br />
durchlaufen. Die entsprechende Entwicklungsleistung<br />
wird eindeutig dokumentiert,<br />
bei negativem Testergebnis durchläuft jedes<br />
Bauteil erneut einen Verbesserungs- und<br />
Qualifizierungsprozess. Wenn Software zum<br />
Einsatz kommt, muss diese auf qualifizierten<br />
und zertifizierten Entwicklungsplattformen<br />
aufgebaut und anschließend getestet<br />
werden. Hardwarebasierte Schaltungen sind<br />
oft aus diesem Grund erste Wahl, vor allem<br />
bei Kleinserien.<br />
Für ein Forschungs- und Experimentalsystem<br />
gelten zwar einige vereinfachte Routinen.<br />
Die Sicherheit des Gesamtsystems und<br />
des Flugzeugs muss jedoch durch einfache,<br />
aber wirkungsvolle Abschaltroutinen jederzeit<br />
gewährleistet sein. Die für das Experiment<br />
verwendete Abschaltkette beinhaltete<br />
Seite 48 //<br />
mehr als 40 unabhängige Abschaltroutinen,<br />
viele davon in Hardwareausführung.<br />
Die Qualifizierung und die Testfreigabe sind<br />
folglich nur durch die Zusammenarbeit von<br />
Forschung und Flugzeughersteller, flankiert<br />
von einem luftfahrttechnischen Betrieb,<br />
möglich. Zu meistern sind dabei kommunikative<br />
Situationen, die einer babylonischen<br />
Herausforderung gleichen. Für die Entwicklung<br />
eines serienreifen Produktes und den<br />
späteren kommerziellen Einsatz sind jeweils<br />
ein Entwicklungs- und ein Qualifizierungsprozess<br />
notwendig, die eine Zusammenarbeit<br />
mit Flugzeugzulieferbetrieben notwendig<br />
machen.<br />
Getestet wurde auf ebener Fläche. Die<br />
Befürchtung einiger Ingenieure, die Räder<br />
könnten, wie bei einem Kavaliersstart, aufgrund<br />
der geringen Masse von 4 Tonnen,<br />
die auf den Bugrädern lastet, die Haftung<br />
verlieren und durchdrehen, hat sich nicht<br />
bewahrheitet. Ähnliche Versuche eines amerikanisch-tschechischen<br />
Konsortiums haben<br />
sogar bestätigt, dass mit solch einem Antriebskonzept<br />
auf vereister Fläche gefahren<br />
werden kann. Eine weitere Lösung wurde<br />
vor einiger Zeit mit einem elektrischen<br />
Hauptradantrieb vom Hochleistungsmotorenhersteller<br />
Magnet-Motor in Zusammenarbeit<br />
mit der Lufthansa demonstriert. Dort<br />
konnten hohe Geschwindigkeiten von über<br />
30 Stundenkilometern erreicht werden. In-<br />
ternen DLR-Berechnungen zufolge hat der<br />
Einsatz eines Antriebssystems, basierend auf<br />
der Kombination aus Brennstoffzelle und<br />
elektrischem Radantrieb, sowohl Vorteile bei<br />
der Reduzierung von Emissionen als auch<br />
bei der Kostenreduzierung im Betrieb. Vor<br />
allem der Einsatz bei Kurzstreckenflügen bis<br />
1,5 Stunden, wie sie in dichtbesiedelten Gebieten<br />
wie Mitteleuropa vorkommen, bietet<br />
aufgrund des hohen Verhältnisses von Roll-<br />
zu Flugzeit einen Vorteil. Laut detaillierten<br />
Verbrauchs- und Rollzeitdaten könnten am<br />
Flughafen Frankfurt am Main durch den<br />
Einsatz dieser kombinierten Technologie bis<br />
zu 44 Tonnen Kerosin am Tag eingespart<br />
werden. Der dafür notwendige Wasserstoffbedarf<br />
würde aufgrund der höheren Effizienz<br />
des Systems und der höheren Energiedichte<br />
des Wasserstoffs bei ca. 2,5 Tonnen<br />
liegen.<br />
Weitere Vorteile ergeben sich bei der Reduzierung<br />
der Lärmbelastung, denn sowohl die<br />
Brennstoffzelle als auch der elektrische Motor<br />
können geräuscharm betrieben werden.<br />
Ein finanziell interessanter Aspekt ist darüber<br />
hinaus die Einsparung der Haupttriebwerkslaufzeit.<br />
Bei Berücksichtigung der<br />
notwendigen Abkühl- und Vorwärmzeiten<br />
fallen rein rechnerisch ca. 700–1.000 Stunden<br />
weniger Laufzeit pro Flugzeug an.<br />
Wartungsintervalle können damit verlängert<br />
werden, und Geld wird eingespart. Die<br />
traktorlose Zufahrt zum dichtgepackten<br />
Ausgabe 3-2012 // Aus der Forschung<br />
Gate-Bereich und vor allem die autarke<br />
Rückwärtsfahrt wurde im Flughafenbetrieb<br />
skeptisch gesehen. Diejenigen Piloten, die<br />
ein solches Manöver durchgeführt haben,<br />
zeigten sich jedoch zuversichtlich, dass mit<br />
einem Training die entsprechenden Fertigkeiten<br />
und Routinen entwickelt und in<br />
den Betriebsalltag implementiert werden<br />
können.<br />
Auf dem Weg zum „more electric aircraft“<br />
könnten sowohl der elektrische Bodenantrieb<br />
als auch die Einführung der Brennstoffzelle<br />
eine tragende Rolle bei der Emissionsreduzierung<br />
spielen. Werden die<br />
zusätzlichen Vorteile der Brennstoffzelle<br />
wie Wasser- und Inertgasproduktion in<br />
einem „multifunktionalen Einsatz“ zusammengefasst,<br />
könnte sich das Spannungsfeld<br />
Umweltschutz und Business-Case positiv<br />
auflösen. Für kleine Flugzeuge wie die „DLR<br />
H2“ oder solche mit bis zu zehn Passagieren<br />
ist sogar ein rein elektrischer Brennstoffzellenantrieb<br />
denk- bzw. realisierbar. Große<br />
Verkehrsmaschinen werden jedoch auf<br />
Kohlenwasserstoffe als Treibstoff zurückgreifen<br />
müssen.<br />
Dr. Josef Kallo, Leiter Fachgebiet Elektrochemische<br />
Systeme, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt<br />
(DLR), Institut für Technische Thermodynamik,<br />
Abteilung Elektrochemische Energietechnik