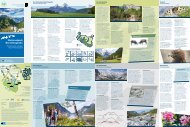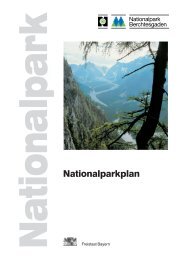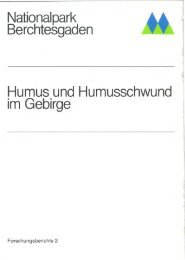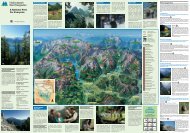Gyps fulvus - Nationalpark Berchtesgaden
Gyps fulvus - Nationalpark Berchtesgaden
Gyps fulvus - Nationalpark Berchtesgaden
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
gab. Ein andermal genügten wenige imitierte Rufe, um<br />
ihn zum Singen oder gar zum Angriff zu veranlassen.<br />
Man sollte allerdings den Vogel nicht unnötig reizen.<br />
Das "Hassen« der Kleinvögel auf den Gesang des Sperlingskauzes<br />
wird erlernt (König 1970, Curio et al. 1978)<br />
und von den Vögeln aber auch innerhalb mehrerer Wochen<br />
wieder vergessen. Deshalb ist die "Meisenreaktion«<br />
ein guter Hinweis auf das Vorkommen des Sperlingskauzes.<br />
Näheres hierüber ist einer späteren Publikation<br />
vorbehalten. Neben der eigenen Suche nach<br />
Sperlingskauzvorkommen wurde ein Rundschreiben mit<br />
einem kleinen Merkblatt an die Forstämter mit der Bitte<br />
um Unterstützung der Arbeit geschickt. Auf diese Weise<br />
erhielten wir weitere Hinweise, die natürlich überprüft<br />
wurden.<br />
Diese Bestandserhebungen liefen während mehrerer<br />
Jahre, um durch natürliche Bestandsschwankungen<br />
hervorgerufene Fehler zu vermeiden. Es ist ja bekannt,<br />
daß Eulenbestände - je nach Nahrungsangebot - sehr<br />
stark schwanken können, vor allem im Hinblick auf die<br />
Brutdichte. Solche galt es auszuscheiden, zumindest<br />
weitgehend, da ja noch nicht alle Faktoren, die solche<br />
Phänomene verursachen, bekannt sind. Zwischen 1962<br />
und 1967 waren zwei sehr gute" Eulenjahre« mit hohem<br />
Nahrungsangebot an Mäusen. Auf den Bestand des<br />
Sperlingskauzes hatten sie jedoch keinen feststellbaren<br />
Einfluß. Die Population im Schwarzwald nahm weiter ab.<br />
Während 1962 noch mindestens 10 Reviere besetzt waren,<br />
fand 1966 die letzte nachgewiesene Brut statt. 1967<br />
verschwand, wie bereits erwähnt, der letzte Sperlingskauz<br />
nach einem schweren Winterrückfall Ende März/<br />
Anfang April. Kontrollen in diesem Jahr erbrachten keinen<br />
Nachweis, auch nicht in Form einer Meisenreaktion.<br />
Die Art mußte im Schwarzwald als ausgestorben gelten.<br />
Faktoren, die zum Verschwinden des<br />
Sperlingskauzes führten<br />
Wie kam es nun zum Rückgang und schließlich zum Verschwinden<br />
des "Spauzes«, wie wir den Sperlingskauz<br />
nennen? Die Antwort ist nicht ganz einfach, sondern in<br />
einem komplexen Vorgang zu sehen. Zunächst sind hier<br />
Umwandlungen im Waldcharakter verantwortlich zu machen.<br />
Zwar hat sich in den Waldstücken, in denen die<br />
letzten Späuze lebten, nichts oder nicht viel verändert;<br />
aber es fanden gewaltige E;ingriffe in das Gesamtgefüge<br />
des Schwarzwaldes durch großflächige Abholzungen,<br />
besonders durch die sogen. "Franzosenhiebe« statt.<br />
Dadurch wurde der bisher weitgehend geschlossene<br />
Waldbestand vielerorts stark aufgelockert. Die Anlage<br />
neuer Schneisen und vor allem breiter Holzabfuhrwege<br />
trugen weiterhin zu einer Zergliederung des Waldes bei.<br />
Somit war vielerorts ein völlig anderer Waldcharakter<br />
entstanden und Altholzbestände waren zu regelrechten<br />
»Inseln« zusammengeschrumpft.<br />
Diese Waldveränderung brachte natürlich auch Änderungen<br />
in der Fauna mit sich. Der Waldkauz (Strix aluco),<br />
der den geschlossenen Wald gemieden hatte, konnte<br />
jetzt höher aufsteigen, da mit der Aufgliederung der<br />
Waldungen das Nahrungsangebot besser geworden<br />
war. So erreichte er die höchsten Lagen des Schwarzwaldes<br />
und entwickelte gebietsweise eine hohe Popula-<br />
18<br />
Abbildung 2: Sperlingskauzweibchen mit Maus in der Nähe der Bruthöhle.<br />
tionsdichte. Der kleine Spauz war hier natürlich im Nachteil.<br />
Es ist ja bekannt, daß der Waldkauz kleinere Eulenarten<br />
als Beute schlägt. Besonders ausgeflogene Junge<br />
sowie Altvögel in schneereichen Wintern, wenn diese<br />
u.U. sogar noch in tiefere Lagen ausweichen, sind gefährdet.<br />
Dazu kam noch, daß der Hauptfeind des Waldkauzes,<br />
der Habicht (Accipiter gentilis) durch gnadenlose<br />
Verfolgung sehr selten geworden war. Dazu wurden<br />
die in gut durchforsteten Wäldern nur noch in geringer<br />
Zahl vorhandenen Spechthöhlen von den beiden häufiger<br />
gewordenen Marderarten kontrolliert.<br />
Kein Wunder, daß die auf die verbliebenen Altholzbestände<br />
und andere extensiv bewirtschaftete Wälder zurückgedrängten<br />
Sperlingskäuze unter dem verstärkten<br />
Feinddruck zu leiden hatten (vgl. Bezzel & Ranftl 1974<br />
sowie Scherzinger 1974). Obwohl sich die Wunden im<br />
Wald durch die Anlage von Jungkulturen allmählich immer<br />
mehr schlossen und manche Regionen dadurch sowie<br />
durch die schutzbedingte Zunahme des Habichtbestandes,<br />
verbunden mit schneereichen Wintern, für den<br />
Waldkauz kaum noch bewohnbar wurden (was gebietsweise<br />
sogar zum Verschwinden der Art führte), wurden<br />
die Späuze immer seltener. Offensichtlich war die verbliebene<br />
Restpopulation zu klein, um sich aus eigener<br />
Kraft erholen zu können. Sie brach schließlich zusammen,<br />
obwohl sich die Bedingungen verbessert hatten.<br />
Ob Pestizide noch im Spiel waren, konnte nicht geklärt