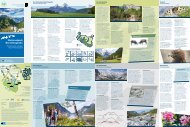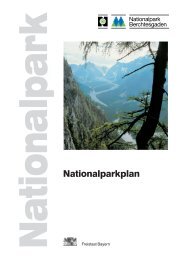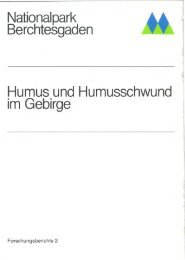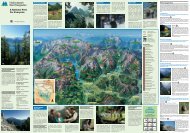Gyps fulvus - Nationalpark Berchtesgaden
Gyps fulvus - Nationalpark Berchtesgaden
Gyps fulvus - Nationalpark Berchtesgaden
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
nach Salzburger Vorbild diskutiert wird. Da die Salzburger<br />
Gruppe 1980 erstmals 2 Jungtiere in freier Wildbahn<br />
hervorgebracht hat, könnte so eine nordalpine, künstlich<br />
gestützte Gänsegeierbrutpopulation entstehen. Von<br />
einzelnen Kritikern wurde in diesem Zusammenhang<br />
der Vorwurf der Unnatürlichkeit erhoben. Dazu ist erstens<br />
zu sagen, daß sogar die gegenwärtige Geierverbreitung<br />
in diesem Sinne unnatürlich ist, da sie nur auf<br />
Grund von extensiver Weidewirtschaft bestehen kann<br />
und zweitens werden wir für viele Vogelarten noch viel<br />
Unnatürlicheres tun müssen als füttern, um sie überhaupt<br />
zu erhalten.<br />
Der Gefangenschaftsbestand an Gänsegeiern ist durch<br />
das Entgegenkommmen mehrerer Tiergärten ermöglicht<br />
worden. Besonders hervorzuheben ist hier der Zoo<br />
Rotterdam, der 2 Tiere seiner Zucht als Geschenk dem<br />
Projekt zu Verfügung stellte.<br />
Bartgeier haben etwa die gleiche Größe wie Gänsegeier,<br />
durch ihren langen Schwanz jedoch ein Flugbild, das<br />
eher einem Riesenfalken gleicht. Er ist der sagenhafte<br />
Lämmergeier der Alpen, den man bis hin zur Kindesentführung<br />
so ziemlich alles Schlechte angedichtet hat. In<br />
Spanien wußte man um seine Hauptnahrung offenbar<br />
immer schon besser Bescheid: dort heißt er Quebrantahuesos<br />
= Knochenbrecher. Der Ausrottungsfeldzug in<br />
den Alpen war systematisch und total, bis zur Jahrhundertwende<br />
war er praktisch aus dem Alpenbogen verschwunden.<br />
Auch in den anderen Verbreitungsländern<br />
erging es ihm nicht viel besser; in Europa leben heute<br />
nur mehr etwa 120 bis 150 Exemplare. Ausgehend von<br />
den Zuchterfolgen im Innsbrucker Alpenzoo wurde ein<br />
Gemeinschaftsprojekt WWF/Frankfurter Zoologische<br />
Gesellschaft ins Leben gerufen, das in drei Phasen aufgebaut<br />
ist:<br />
Phase 1: Zucht mit Hilfe von bereits in Gefangenschaft<br />
befindlichen Tieren.<br />
Phase 2: Vorbereitung der Ausbürgerung (Auswahl von<br />
Gebieten, Public Relation für den Bartgeier<br />
und die Greifvögel im allgemeinen)<br />
Phase 3: Freilassung mit Überwachung der Erfolges.<br />
Der neue und vielleicht richtungsweisende Weg bestand<br />
darin, die in Zoos gehaltenen Tiere heranzuziehen und<br />
unter den Hut des Projektes zu bringen. Sollte das Projekt<br />
der Freilassung scheitern, ist nichts weniger Schlimmes<br />
passiert, als daß aus Zoobeständen einer gefährdeten<br />
Tierart eine funktionierende Zuchtgruppe aufgebaut<br />
wurde. Die Einstellung der Tiergärten erwies sich als<br />
überaus kooperativ und unbürokratisch, wobei Dr. Faust<br />
von der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft eine<br />
tragfähige Plattform geschaffen hat. Mit einer Ausnahme<br />
(Westberlin) sind alle Bartgeier in europäischen Tiergärten<br />
unter dem Hut des Projektes vereint. Teilweise<br />
wurden Tiere leihweise zur Verfügung gestellt, teilweise<br />
verkauft und teilweise wurden in den Zoos selbst Paare<br />
zusammengestellt. Besonderer Dank gebührt hier dem<br />
Zoo Amsterdam, der dem Alpenzoo Innsbruck ein Weibchen<br />
zum Geschenk machte und damit die Fortführung<br />
der Zucht ermöglichte. Ein Großteil der Tiere befindet<br />
sich bei Dr. Frey von der Vet. med. Universität Wien, wobei<br />
diese Station von der Frankfurter Zoolog. Gesell<br />
schaft finanziert wird. Von den in den Saisonen 1979 und<br />
1980 produzierten Jungvögeln (insgesamt 10 in der<br />
Schweiz, in Holland und Österreich) konnten bereits<br />
einige an Zoos zurückgegeben werden, die adulte Vögel<br />
zur Verfügung gestellt hatten. Diese Zoos werden im<br />
Rahmen des Projektes selbst an der Weiterzucht arbeiten.<br />
Das Gesamtprojekt erstreckt sich im Moment auf die<br />
Schweiz, Frankreich und Österreich, Kooperationsgespräche<br />
mit dem <strong>Nationalpark</strong> <strong>Berchtesgaden</strong> sind im<br />
Gange.<br />
Von einem Schweizer Wissenschafterteam wird simultan<br />
zur Phase 1 bereits an der Auswahl der Freilassungsgebiete<br />
gearbeitet. Für Österreich ist diese Frage<br />
von untergeordneter Bedeutung, da durch die bestehende<br />
"Geierhilfsinfrastruktur« für die Gänsegeier in den<br />
Hohen Tauern und durch die Anwesenheit dieser sich<br />
der Freilassungsplatz von selbst anbietet.<br />
Zweifellos ist die Anwesenheit von Gänsegeiern für die<br />
Freilassung von Bartgeiern ein Vorteil: sie kennen die<br />
Luftstraßen (Thermikentwicklungen), was für das hochalpine<br />
Gebiet von besonderer Bedeutung sein dürfte, sie<br />
kennen die Nahrungsquellen (u.a. den Futterplatz) und<br />
wirken als Anzeiger. Aus eigenen Beobachtungen in den<br />
Pyrenäen ist bekannt, daß sich Bartgeier sehr intensiv<br />
für Gänsegeieranhäufungen im Bereich ihres Territoriums<br />
interessieren.<br />
Noch nicht ausdiskutiert ist die Technik der Freilassung,<br />
da hier die zu erwartenden Erfahrungen mit den Gänsegeiern<br />
mit einbezogen werden. Unter Umständen werden<br />
hier die dem Projekt angeschlossenen Länder zunächst<br />
verschiedene Wege gehen. Fest steht jetzt<br />
schon, daß Jungtiere in Gruppen freigelassen werden<br />
sollen. Obwohl ab der Paarbildung territorial, verhalten<br />
sich junge Bartgeier durchaus sozial: aus Südafrika gibt<br />
es Beispiele für das gleichzeitige Auftreten von bis zu 7<br />
jungen Bartgeiern an Futterplätzen, die für den Cape<br />
Vulture errichtet wurden.<br />
Das Futterangebot ist derzeit wesentlich höher als zur<br />
Zeit der Ausrottung des Bartgeier, zumindest im ostalpinen<br />
Raum sind die Wilddichten teilweise um ein mehrfaches<br />
höher als im vergangenen Jahrhundert. Für die<br />
Brutzeit war der Nahrungsanteil, der von Jungtierkadavern<br />
stammt, immer schon bedeutungslos. Der Bartgeier<br />
ist ein Winterbrüter mit Eiablage im Dezember/Jänner,<br />
also zu Zeiten, wo nie Weidevieh aufgetrieben wurde.<br />
Im Hinblick auf das doch zunehmende Verständnis<br />
der Jägerschaft für die Greifvögel und unter Berücksichtigung<br />
der sicherlich notwendigen Pulic - Relation - Kampagne<br />
der Phase 2 vor der Aussetzung, ist das Risiko<br />
von Abschüssen (hoffentlich) nicht zu groß. Die geplante<br />
vollständige, telemetrische Verfolgung der freigesetzten<br />
Tiere zumindest in der Anfangsphase wird sicherlich helfen,<br />
etwaige Übergriffe aufzudecken. Ein echtes Problem<br />
könnte der unabsichtliche Fallenfang (Fuchseisen)<br />
darstellen. Hier wird ein enger Kontakt zur Jägerschaft<br />
notwendig sein, damit Verluste durch sorgfältige Wahl<br />
der Aufstellungsplätze der Fallen vermieden werden.<br />
Die im Gang befindliche Diskussion über die Sinnhaftigkeit<br />
des Fallenfanges an sich, die unter anderem auch<br />
aus gravierenden Tierschutzaspekten geführt wird,<br />
könnte auch dem Bartgeier nützen.<br />
39