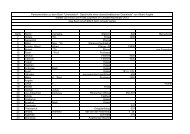men Schelhorn, Schellhorn oder Schöllhorn - Die Genealogie der ...
men Schelhorn, Schellhorn oder Schöllhorn - Die Genealogie der ...
men Schelhorn, Schellhorn oder Schöllhorn - Die Genealogie der ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
18<br />
Ergänzend mag noch erwähnt werden, dass Zweifel darüber bestehen, ob das althochdeutsche<br />
Wort scela, mittelhochdeutsch Schelch, wirklich die Bezeichnung für<br />
den Riesenhirsch (Megaceros) war. Es wird die Ansicht vertreten, dass unter Schelch<br />
das männliche Elentier, im Gegensatz zum weiblichen Elch, zu verstehen sei. In einer<br />
Abhandlung „Der Riesenhirsch“, von Prof. Dr. Karl Hescheler, die im Neujahrsblatt<br />
1909 <strong>der</strong> Naturforschenden Gesellschaft Zürich erschienen ist, wird folgendes<br />
aufgeführt:<br />
Im Nibelungenliede ist in den Versen 3753 – 3773 <strong>der</strong> St. Galler Handschrift<br />
(von <strong>der</strong> Hagens Ausg. 1816) von den Jagdtaten Siegfrieds die Rede, und es findet<br />
sich die Stelle:<br />
„Darnach sluoch er schiere einen wisent und einen elch,<br />
starcher uore viere, und einen grim<strong>men</strong> schelch;<br />
sin ros in truoch so balde, daz er im nicht entrann:<br />
hirze <strong>o<strong>der</strong></strong> hinden chunde im wenich engan. 1<br />
Der „grimme Schelch“ soll nun <strong>der</strong> Riesenhirsch sein, <strong>der</strong> also darnach noch<br />
zu den Zeiten des Mittelalters in den germanischen Gauen gelebt hätte. Viel<br />
Scharfsinn und, man darf wohl auch sagen, viel Papier und Tinte ist an die Aus-<br />
legung dieser Stelle seither verwendet worden. Wir müssen uns versagen, auf das<br />
Nähere einzugehen und wollen uns mit dem einem Hinweis auf eine neuere Zusam<strong>men</strong>-<br />
stellung dieser Literatur mit ihren verschiedenen Auffassungen begnügen, die von<br />
Dahms (1898= publiziert worden ist und worin dieser Autor selbst den Beweis zu<br />
erbringen versucht, dass in dem Schelch das männliche Elentier, im Gegensatz<br />
zu „Elch“, dem weiblichen, verstanden sei 2 . <strong>Die</strong> Diskussion, die sich an diese<br />
Publikation knüpft, in <strong>der</strong> Wilser (1898) wie<strong>der</strong> für die wenige Jahre früher von<br />
Hahn (1892) vertretene Anschauung einsteht, es sei <strong>der</strong> Schelch ein Wildhengst,<br />
lag Dahms (1898 a) selbst geneigt wäre, seine Auffassung zugunsten <strong>der</strong> Aus-<br />
legung Schelch (Megaceros) wie<strong>der</strong> aufzugeben, beweist deutlich genug, dass man<br />
auch heute noch nicht sicher sagen kann, was unter Schelch zu verstehen ist;<br />
dass wir aber den Megaceros mit guten Gründen ausschliessen dürfen, ist einger-<br />
massen sicher und soll unten noch weiter erörtert werden. Der Name „Schelch“<br />
<strong>o<strong>der</strong></strong> „scelo“ kommt auch in an<strong>der</strong>n Doku<strong>men</strong>ten des Mittelalters vor, ist aber hier<br />
ebenso fraglicher Natur wie im Nibelungenlieg.<br />
Nach diesen Feststellungen seien noch einige an<strong>der</strong>e Ableitungen des Na<strong>men</strong>s erwähnt.<br />
Der heutige Weiler <strong>Schöllhorn</strong>, Gemeinde Spindelwag, <strong>der</strong> als Hof <strong>Schellhorn</strong> schon 1469 genannt<br />
wird, liegt wenige Wegstunden westlich von Memmingen, und zwar auf einer Höhe, die<br />
gegen die Vereinigung zweier Bäche wie ein Horn ausläuft. Aus <strong>der</strong> Karte S. 21 ist dies deutlich<br />
zu ersehen.<br />
Das Württ. Statistische Landesamt äussert sich zu <strong>der</strong> Frage <strong>der</strong> Herkunft des Na<strong>men</strong>s <strong>Schöllhorn</strong><br />
ungefähr wie folgt:<br />
„Es ist zweifelhaft, ob es sich hier ursprünglich um einen Orts- <strong>o<strong>der</strong></strong> um einen Personen-na<strong>men</strong><br />
handelt. „Horn“ findet sich in Orts- und Flurna<strong>men</strong> häufig und bedeutet einen Berg-vorsprung<br />
<strong>o<strong>der</strong></strong> eine in einen See vorspringende Landzunge. Das Wort „Schell“ <strong>o<strong>der</strong></strong> „Schöll“ ist mehrdeutig<br />
und kann sowohl mit Schele-Hengst (Beschäl-Hengst) <strong>o<strong>der</strong></strong> mit Schelle (von Schall kom<strong>men</strong>d)<br />
zusam<strong>men</strong>hängen.“<br />
1 In <strong>der</strong> Übertragung von H. A. Junghans:<br />
Darnach schlug er zu Tode einen Wisent, einen Elch,<br />
Der starken Auer viere und einen grim<strong>men</strong> Schelch;<br />
Sein Roß trug ihn geschwinde, so daß ihm nichts entrann;<br />
Der Hirsche und <strong>der</strong> Hinden <strong>der</strong> Degen bei<strong>der</strong> viel gewann<br />
2 I n Brockhaus‘ Konversations-Lexikon v. 1883 ist die Ansicht vertreten, dass Schelch und<br />
Elch identisch seien: „Wahrscheinlich ist mit dem Ausdruck „grimmer Schelch“ (im Nibelungen-<br />
liede) ebenfalls des Elentier gemeint.