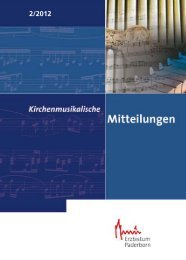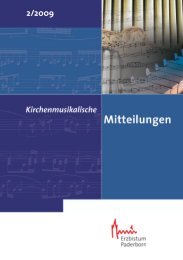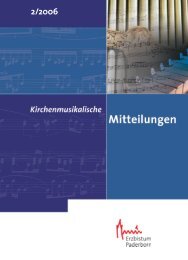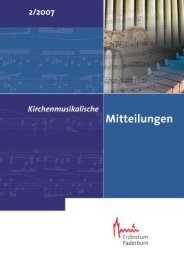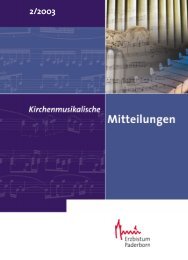Inhalt IPD_1.2007 - Kirchenmusik im Erzbistum Paderborn
Inhalt IPD_1.2007 - Kirchenmusik im Erzbistum Paderborn
Inhalt IPD_1.2007 - Kirchenmusik im Erzbistum Paderborn
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Erzbischöfliches Generalvikariat<br />
Referat <strong>Kirchenmusik</strong><br />
Domplatz 3<br />
33098 <strong>Paderborn</strong><br />
1/2007
Vorwort<br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
eine in der letzten Zeit oft gehörte Frage lautet: „Wann erscheint das neue Gotteslob?“<br />
Einen Erscheinungstermin können wir noch nicht nennen, aber wir glauben sagen zu<br />
dürfen, dass alles auf einem guten Weg ist und ein Buch <strong>im</strong> Entstehen begriffen ist, das<br />
unseren Gemeinden eine wichtige Hilfe sein wird bei der Feier der unterschiedlichen<br />
Gottesdienstformen.<br />
Recht häufig wird auch die Frage gestellt, wie es denn mit der <strong>Kirchenmusik</strong> in unserem<br />
<strong>Erzbistum</strong> weiter gehe. Hierzu ist zu sagen, dass der Erzbischof eine Steuerungsgruppe<br />
beauftragt hat, ein Konzept zu erarbeiten, dass den neuen Bistumsstrukturen angepasst<br />
ist. Dieses Konzept liegt vor und wird in den verschiedenen Gremien beraten. Im ersten<br />
Halbjahr 2007 wird es zu Entscheidungen kommen. In diesem Zusammenhang<br />
verweisen wir auf die Rubrik „Im Blickpunkt“, in der Sie Gedanken zur <strong>Kirchenmusik</strong><br />
finden, die Weihbischof Dr. Wiesemann anlässlich der Weihe der Orgel der<br />
Liebfrauenkirche Hamm geäußert hat.<br />
Mit guten Wünschen für das Jahr 2007<br />
Thomas Dornseifer Dr. Paul Thissen<br />
Monsignore Referatsleiter <strong>Kirchenmusik</strong>
<strong>Inhalt</strong><br />
Im Blickpunkt 2<br />
Literaturhinweise 6<br />
Berichte und Nachrichten 18<br />
Termine 32<br />
Orgeln 5<br />
Anschriften 81<br />
1
Im Blickpunkt<br />
Weihbischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann<br />
Gedanken zur Bedeutung der Musik in der Kirche<br />
„Überall nach dem Nutzen suchen, passt nicht für den Hochgemuten und den<br />
Freien.“ (Aristoteles)<br />
Dieser Satz des großen griechischen<br />
Philosophen findet sich erstaunlicherweise<br />
<strong>im</strong> achten Buch der Politik, das<br />
Aristoteles fast ganz der Musik widmet.<br />
1 Was hat die Musik in einem „politischen“<br />
Buche zu suchen?<br />
Aristoteles versucht darin, die wesentlichen<br />
Grundlagen des Gemeinwesens,<br />
der „polis“, darzustellen. Dabei<br />
spielt für ihn die Erziehung der<br />
Jugend zu tugendhaften, hochgesinnten<br />
und freien Menschen eine<br />
wichtige Rolle. Worin aber besteht<br />
das wahrhafte menschliche Bildungsziel<br />
nach diesem Philosophen der<br />
griechischen Antike? Worin besteht<br />
die höchste Weise der Verwirklichung<br />
menschlicher Fähigkeiten und Anlagen?<br />
Die Antwort klingt in den Ohren<br />
einer modernen Leistungsgesellschaft<br />
befremdlich: nicht in der Arbeit,<br />
sondern in der Muße! „Denn wer<br />
arbeitet, arbeitet für ein Ziel, das er<br />
noch nicht erreicht hat, das wahre<br />
Glück aber ist selbst Ziel und bringt,<br />
wie allen feststeht, nicht Schmerz,<br />
2<br />
sondern Lust.“ „Die Muße schein Lust,<br />
wahres Glück und seliges Leben in<br />
sich selbst zu tragen. Das ist aber<br />
nicht der Anteil derer, die arbeiten,<br />
sondern derer, die feiern.“ 2<br />
Wer nun meint, Aristoteles würde<br />
hiermit einem müßiggängerischen<br />
Schlendrian das Wort reden, hat sich<br />
natürlich gründlich geirrt. Auch<br />
schätzt Aristoteles den Wert der<br />
menschlichen Arbeit, die für uns gerade<br />
auf dem Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit<br />
von besonderer Bedeutung<br />
ist, nicht gering. Aber er weiß,<br />
dass für die Würde des Menschen<br />
noch etwas ausschlaggebend ist, das<br />
er mit dem alten Wort „Muße“ bezeichnet.<br />
Für ihn zeigt sich die Kultur<br />
und Überlebensfähigkeit einer Gesellschaft<br />
darin, ob sie fähig zur Muße ist;<br />
das heißt, dass sie die Tugendhaftig-<br />
1 Vgl. hierzu J. Ratzinger, Das Fest des Glaubens.<br />
Versuche zur Theologie des Gottesdienstes, Einsiedeln<br />
1981, 86-111, insbes. 98 Anm. 27.<br />
2 Aristoteles, Politik VIII, 3; 1338 a, 1ff.
keit besitzt, sich nicht von den niedrigen<br />
Dingen in Bann schlagen zu lassen,<br />
sondern <strong>im</strong> Gegenteil Räume<br />
und Zeiten für die Ruhe öffnet und<br />
schützt, um sich den über den Alltag<br />
erhebenden Dingen zuwenden zu<br />
können. Solch ein freies Sich-Erheben<br />
vollzieht und erhält sich nicht von<br />
selbst, es muss geradezu von Kindheit<br />
an eingeübt werden: „Und so leuchtet<br />
denn ein, dass man auch für den<br />
würdigen Genuss der Muße erzogen<br />
werden und manches lernen muss,<br />
und dass diese Seite der Erziehung<br />
und des Unterrichts ihrer selbst wegen<br />
da ist, während das, was für die<br />
Arbeit gelernt wird, der Notdurft<br />
dient und Mittel zum Zwecke ist.“ 3<br />
Was ein solcher Gedanke für Auswirkungen<br />
auf die Bedeutung des Schutzes<br />
der Sonntagsruhe und der Erhaltung<br />
echter sonntäglicher Feier und<br />
Kultur beinhaltet – insbesondere auf<br />
dem Hintergrund der momentan in<br />
jedes Heiligtum einbrechenden „Allmacht“<br />
des Wirtschafts- und<br />
Konsumlebens – kann nur angedeutet<br />
werden.<br />
Aristoteles zögert jedenfalls nicht,<br />
Menschen, die sich nur von der Arbeit<br />
her definieren, „Banausen“ zu nennen.<br />
Und auch der aktuellen<br />
Bildungsdebatte täten diese Gedan-<br />
ken gut. Stattdessen wird nicht selten<br />
trotz aller alarmierenden Signale<br />
noch weiterhin an der musischen Bildung<br />
gekürzt – oder sie auf Weise der<br />
Banausen betrieben. 4 Umso kostbarer<br />
die Orte, wo echte Kultur gepflegt<br />
und gefördert wird!<br />
Unter allem, was zur Bildung des<br />
Menschen gehört, n<strong>im</strong>mt für Aristoteles<br />
die Musik eine Sonderstellung<br />
ein. Sie ist keinem Geschäft und keinem<br />
Zweck zugeordnet, sie ist nicht<br />
ihres Nutzens wegen da, sondern sie<br />
ist „für edle Geistesbefriedigung in<br />
der Muße best<strong>im</strong>mt“. Musik finden<br />
wir bei den alten Philosophen unter<br />
den Beschäftigungen, „die eines freien<br />
Mannes würdig sind.“ 5 In diesem<br />
Zusammenhang fällt bei Aristoteles<br />
der eingangs zitierte Satz: „Überall<br />
den Nutzen suchen, passt nicht für<br />
den Hochgemuten und Freien.“ 6<br />
3 A. a. O., 8ff<br />
4 Das soll kein Angriff auf die wertvollen Bemühungen<br />
der Pädagogen und Musiker sein, sondern die<br />
Umstände, unter denen nicht selten die Erziehungsarbeit<br />
durchgeführt werden muss, beleuchten,<br />
da diese ebenfalls nicht selten von solchen<br />
gesetzt werden, die nicht allzu viel Ahnung hiervon<br />
haben. Umso erfreulicher dort, wo es sich nicht so<br />
verhält!<br />
5 Aristoteles, Politik VIII, 3; 1338a, 21ff.<br />
6 A. a. O., 1338b, 2ff (hier zitiert nach Ratzinger, a. a.<br />
O., 98).<br />
3<br />
Im Blickpunkt
Im Blickpunkt<br />
Die Liebfrauen-Gemeinde in Hamm<br />
leistet sich den „Luxus“ einer neuen<br />
Orgel und die Kultur anspruchsvoller,<br />
gepflegter <strong>Kirchenmusik</strong>. Da mag<br />
man, gerade in unserer Zeit, schnell<br />
geneigt sein, Kosten-Nutzen-Rechnung<br />
zu erstellen. Und auch für Jesus<br />
gehört das rationale Kalkül durchaus<br />
zu den wichtigen Lebensgrundlagen<br />
(vgl. Lk 14, 28ff). Aber dann gibt es<br />
auch das Große, das über jeden Nutzen<br />
und jedes Kalkül Erhabene, das<br />
Überschwängliche und dem Anschein<br />
nach Verschwenderische in seinem<br />
ganzen Wesen und seiner Haltung.<br />
Vielleicht ist Judas, den wir den Verräter<br />
nennen und von dem das Johannesevangelium<br />
sagt, dass er die Kasse<br />
hatte, genau daran in dem Moment<br />
zerbrochen, als Maria, die Schwester<br />
Lazarus, sechs Tage vor dem Paschafest<br />
ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl<br />
nahm und es über die Füße<br />
Jesu goss – und er sie gewähren ließ<br />
(vgl. Joh 12,1ff).<br />
Die Musik in der Kirche ist vergleichbar<br />
mit diesem wertvollen, duftenden<br />
Öl, mit dessen Kostbarkeit und Sinnlichkeit,<br />
die von Erhabenheit und<br />
Würde künden. Die Musik vermag in<br />
uns das Große anzurühren, das uns<br />
über die reine Notdurft des Lebens<br />
4<br />
erhebt und uns für Tabor-Augenblikke<br />
in die Nähe Gottes führt: „Die Armen<br />
habt ihr <strong>im</strong>mer bei euch, mich<br />
aber habt ihr nicht <strong>im</strong>mer bei euch“<br />
(Joh 12,8). Das Öl in den Lampen all<br />
derer, die zum Hochzeitsmahl geladen<br />
sind, das sind die Lob- und Dankgesänge<br />
in ihren Herzen und auf ihren<br />
Lippen (vgl. Mt 25, 1ff).<br />
Indem Aristoteles gegen den<br />
Platonismus den Sinnen wieder den<br />
angemessenen Platz in der Erfassung<br />
der Wirklichkeit gegeben und der große<br />
Kirchenlehrer Thomas von Aquin<br />
diesen Ansatz für die Kirche fruchtbar<br />
gemacht hat, konnte letztlich ein falscher<br />
Purismus <strong>im</strong> Gottesdienst der<br />
Kirche vermieden werden. „Durch das<br />
Lob Gottes“, so schreibt der hl. Thomas,<br />
„steigt der Mensch <strong>im</strong> Gemüt zu<br />
Gott empor“ und er fährt fort: „So<br />
werden wir alle Zuhörenden zur Ehrfurcht<br />
geführt“; d. h. Zur Erfahrung<br />
der Größe Gottes zusammen mit den<br />
anderen Gläubigen in der erlebten<br />
Gemeinschaft der Kirche. 7 Nach dem<br />
Zusammenbruch des römischen<br />
Staatswesens wurde das Christentum<br />
zur neuen gestalterischen Kraft<br />
des Gemeinwesens. Die Kirche verstand<br />
sich als „neue Polis“, mit der<br />
7 Zitiert nach Ratzinger, a. a. O., 102.
Vision jener neuen Stadt in Geist und<br />
Herzen, die vom H<strong>im</strong>mel niedersteigt,<br />
und in der Lobgesang Gottes, das Musizieren<br />
der Engel und aller Erlösten,<br />
der schönste Ausdruck ihrer nie endenden<br />
Lebensfreude ist (vgl. Offb 14,<br />
3; 19, 1ff; 21, 1ff).<br />
So spiegelt die Musik über allen innerweltlichen<br />
Nutzen und Gebrauch hinweg<br />
etwas von der Unverfügbarkeit<br />
und Würde, von der durchgeistigten<br />
Sinnlichkeit und Lebensfülle des H<strong>im</strong>mels,<br />
von der Freude und Freiheit der<br />
Kinder Gottes wider. Sie vermag alle<br />
menschlichen Situationen und St<strong>im</strong>mungen,<br />
Trauer wie Freude, Verzweiflung<br />
wie Hoffnung in die Gegenwart<br />
des lebendigen Gottes hinein<br />
zu sammeln. Sie ist daher dem<br />
christlichen Gottesdienst, vor allem in<br />
seiner Höchstform, der Eucharistiefeier,<br />
<strong>im</strong> Innersten angemessen; ja,<br />
sie ist selbst lebendiger Teil der Liturgie.<br />
Sie n<strong>im</strong>mt von uns nicht die Sorge<br />
um das, was nottut, aber sie ist,<br />
vor allem innerhalb des Gottesdienstes,<br />
eine Kraftquelle, eine Quelle innerer<br />
Erneuerung für diesen wesentlichen<br />
christlichen Dienst an den „Armen“.<br />
Sie gibt das Bewusstsein für<br />
das, was uns über alle rein iridischen<br />
Definitionen erhebt, für das, was uns<br />
die Würde der Kinder Gottes, die<br />
Würde der „Hochgesinnten und Freien“<br />
gibt. Was wäre notwendiger gerade<br />
in unserer Zeit?<br />
aus: Festschrift anlässlich der Weihe<br />
der neuen Orgel in der Liebfrauenkirche<br />
Hamm<br />
5<br />
Im Blickpunkt
Literaturhinweise<br />
Bücher<br />
Josef Ratzinger /Benedikt XVI:<br />
Der Geist der Liturgie<br />
Eine Einführung<br />
Sonderausgabe 2006<br />
Verlag Herder Freiburg <strong>im</strong> Breisgau<br />
2000/2006<br />
ISBN -13: 978-3-451-29063-3<br />
ISBN-10: 3-451-29063-4<br />
Josef Ratzinger geht es in diesem<br />
Buch nicht um wissenschaftliche Auseinandersetzungen<br />
oder Forschungen,<br />
sondern um Hilfe zum Verstehen<br />
des Glaubens und zum rechten Vollzug<br />
seiner zentralen Ausdrucksform<br />
in der Liturgie. In seinem Vorwort vergleicht<br />
er die Liturgie mit einem<br />
Fresco, welches in der Zeit vor dem II.<br />
Vatikanischen Konzil „zwar unversehrt<br />
bewahrt, aber von einer späteren<br />
Übertünchung fast verdeckt war:<br />
Im Messbuch , nach dem der Priester<br />
sie feierte, wär ihre von den Ursprüngen<br />
her gewachsene Gestalt ganz gegenwärtig,<br />
aber für die Gläubigen<br />
war sie weithin unter privaten<br />
Gebetsanleitungen und -formen verborgen.<br />
Durch die Liturgische Bewegung<br />
und definitiv durch das II. Vatikanische<br />
Konzil wurde das Fresco frei-<br />
6<br />
gelegt.... inzwischen ist es durch kl<strong>im</strong>atische<br />
Bedingungen wie auch<br />
durch mancherlei Restaurationen<br />
oder Rekonstruktionen gefährdet<br />
oder droht zerstört zu werden, wenn<br />
nicht schnell das Nötigste getan wird,<br />
um diesen schädlichen Einflüssen<br />
Einhalt zu gebieten.“<br />
Das Buch gliedert sich in die folgenden<br />
vier Teile: Vom Wesen der Liturgie;<br />
Zeit und Raum in der Liturgie;<br />
Kunst und Liturgie; Liturgische Gestalt.<br />
Insgesamt 20 Seiten beschäftigen<br />
sich dabei ausschließlich mit dem<br />
Verhältnis Musik und Liturgie.<br />
Das Buch liefert jede Menge Antworten<br />
auf das, was Liturgie <strong>im</strong> Wesentlichen<br />
ausmacht und bietet gerade<br />
auch dem <strong>Kirchenmusik</strong>er Wissen<br />
und Orientierungshilfe bei einem seiner<br />
zentralen Aufgaben.<br />
Gokus<br />
„Max Reger –<br />
Briefe an Karl Straube“<br />
Herausgegeben von Susanne Popp<br />
Ferd. Dümmlers Verlag<br />
Die Briefe zeugen von der Beziehung<br />
und Wechselwirkung von Komponist<br />
und Interpret, letztlich von der<br />
Einflussnahme Straubes auf den
Entstehungsprozess Regerscher Komposition.<br />
Straube und Reger wurden <strong>im</strong> gleichen<br />
Jahr 1873 geboren. Reger wuchs<br />
in der Enge einer oberpfälzer Kleinstadt<br />
auf, Straube dagegen in Berlin<br />
in weltoffener, großbürgerlicher Umgebung.<br />
Straube wird 1888 Schüler<br />
Heinrich Re<strong>im</strong>anns, damals Organist<br />
an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche;<br />
Reger wird 1890 von Hugo<br />
Riemann in Sondershausen in Wiesbaden.<br />
Berühmt wurde Straubes Bachinterpretation;<br />
er nutzte be<strong>im</strong> Spiel<br />
Bachscher Orgelwerke die Möglichkeiten<br />
der romantischen Orgel zu<br />
großangelegten dynamischen Steigerungen.<br />
Markus Breker<br />
Nikolaus Nonn:<br />
Singt Psalmen, Hymnen und Lieder<br />
Kleines Handbuch für den Kantorendienst<br />
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz<br />
ISBN 3-7867-2509-8<br />
(mit Begleit-CD)<br />
Bei dieser nützlichen Veröffentlichung<br />
handelt es sich um ein Handbuch,<br />
bei dem die Bezeichnung „aus<br />
der Praxis – für die Praxis“ wirklich<br />
zutreffend ist. Der Verfasser ist<br />
Ordensmitglied in der Abtei Königsmünster<br />
in Meschede und dort u. a.<br />
als Kantor tätig. Die besondere Beziehung<br />
und Erfahrung des Autors zu<br />
der beschriebenen Tätigkeit drückt<br />
sich in vielen Beispielen, oft auch<br />
durch persönliche Bemerkungen in<br />
klaren und verständlichen Worten<br />
aus. Neben einem ausführlichen<br />
theoretischen Teil, in dem u. a. die<br />
Formen des Stundengebets, die Psalmen,<br />
die Psalmodie, Psalmtöne und<br />
auch die Quadratnotation erläutert<br />
werden, gibt es auch einen Abschnitt<br />
mit praktischen Tipps, die von der<br />
Sprech- und St<strong>im</strong>mbildung bis hin zu<br />
den verschiedensten Formen musikalischer<br />
Gestaltung reichen. Dieses<br />
wird ergänzt und hörbar gemacht<br />
durch eine Begleit-CD, die praxisnah<br />
und ungekünstelt mit den Kantoren<br />
des Konventes und einem Mescheder<br />
Kirchenchor die angeführten<br />
Gesangsbeispiele hörbar macht.<br />
Besonders erfreulich ist die anschauliche<br />
Art der schriftlichen Darstellung,<br />
welche die einzelnen Bereiche ebenso<br />
pointiert wie umfassend, pragmatisch,<br />
aber nie oberflächlich und zugleich<br />
leicht einprägsam zu vermitteln<br />
weiß sowie die Tatsache, dass<br />
7<br />
Literaturhinweise
Literaturhinweise<br />
über die Gestaltung der Antwortgesänge<br />
hinaus auch weitere Vorschläge<br />
zu Kantorengesängen gegeben<br />
werden, die in der vorgeschlagenen<br />
Vielfalt zweifellos eine große Bereicherung<br />
in den verschiedenen Formen<br />
des Gottesdienstes sein können.<br />
Noten<br />
Ariel Ramirez (*1921)<br />
8<br />
Krutmann<br />
Misa Criolla, Capriccio Musikverlag<br />
GmbH, Hamburg<br />
Diese lateinamerikanische Volksmesse<br />
wurde 1963 von Ariel Ramirez<br />
komponiert und gliedert sich auf in<br />
die fünf Ordinariumsteile einer traditionellen<br />
Messe. Nachdem sie 1964 in<br />
Buenos Aires zum ersten Mal aufgenommen<br />
wurde, zeichnete sich schon<br />
deutlich ab, dass dieses Werk weltweiten<br />
Anklang finden würde. Musikalisch<br />
beteiligt sind eine Solost<strong>im</strong>me<br />
(Tenor oder auch Alt), ein vierst<strong>im</strong>miger<br />
Chor, Klavier, Gitarre (Charango),<br />
eine Bauernflöte (Quena), bolivianische<br />
Panflöte (Siku) und eine Vielzahl<br />
von regionalen Schlaginstrumenten.<br />
Da es sich aber um eine „Volksmesse“<br />
handelt, lässt sie sich auch gut an die<br />
europäischen Gegebenheiten anpassen<br />
und verliert ihre Leidenschaft<br />
durch eine örtlich variierende Besetzung<br />
nicht.<br />
Das Kyrie spiegelt sehr eindrucksvoll<br />
die Einsamkeit eines argentinischen<br />
Hochplateaus wieder. Es ist ein wahrhaftiges<br />
Herabflehen des Herrn. Im<br />
Gloria findet man Rhythmen des argentinischen<br />
Karnevals wieder. Credo<br />
und Sanktus sind in einem 3 /4 und<br />
6 /8 Rhythmus notiert was zu ständigen<br />
Verschiebungen der schwereren<br />
Zeit führt. Das lyrische Agnus die ist<br />
<strong>im</strong> Stil der einhe<strong>im</strong>ischen Musik der<br />
südamerikanischen Grasebene und<br />
<strong>im</strong> quasi recitativo gehalten.<br />
Wer einmal nicht nur die südamerikanischen<br />
Farben, sondern auch die besondere<br />
theologische Tiefe dieser<br />
dort lebenden Menschen in seine<br />
Chorarbeit integrieren möchte, für<br />
den kann diese Messe zu einem reizvollen<br />
Erlebnis werden. Besonders beeindruckend<br />
ist die <strong>im</strong> Jahr 1998 bei<br />
Decca Records entstandene Aufnahme<br />
mit Mercedes Sosa.<br />
Komischke
Guido Haazen: Missa Luba<br />
Messe in kongolesischen Stil für Tenor<br />
solo, gemischten Chor und<br />
Percussion<br />
Warner, Miami (Florida), Chorpartitur<br />
und Percussion 9,95 Euro<br />
Die Missa Luba ist eine afrikanische<br />
Messvertonung, die vor etwa 50 Jahren<br />
von dem belgischen Kongo-Missionar<br />
Père Guido Haazen auf der<br />
Grundlage charakteristischer afrikanischer<br />
Musikelemente geschrieben<br />
wurde.<br />
Das Notieren von Musik ist ein europäischer<br />
Kompromiss, für afrikanische<br />
Verhältnisse ist die Komposition<br />
eines Musikstückes grundsätzlich ungewöhnlich.<br />
Dort wird Musik nicht<br />
rational als Vortragsstück angesehen,<br />
sondern als eine Kunst, die den ganzen<br />
Menschen erfasst und von allen<br />
gemeinsam ausgeführt wird. Durch<br />
die Notierung von Basiselementen<br />
afrikanischer Musik bietet sich mit<br />
dieser Messe auch für europäische<br />
Chöre die Chance, sich dieser Musikform<br />
zu nähern, deren Wurzeln ebenso<br />
traditionell wie archaisch sind.<br />
Neben dem Gesang (die Solost<strong>im</strong>me<br />
kann einzeln oder durch eine kleinere<br />
Gruppe ausgeführt werden) sind<br />
Trommeln und verschiedenen<br />
Percussionsinstrumente die einzige<br />
musikalische Begleitung. Besonders<br />
den Trommeln kommt eine wichtige<br />
Bedeutung zu, durch sie können <strong>im</strong><br />
afrikanischen Kulturraum alle wesentlichen<br />
Aspekte des menschlichen<br />
Lebens ihren kulturellen Ausdruck erfahren.<br />
Durch die Verwendung von<br />
Ostinato-Modellen und antiphonale<br />
Techniken (Call und Response) entsteht<br />
eine Gemeinschaftsmusik, die<br />
von vielen schnell aufgenommen und<br />
mitgemacht werden kann. Durch<br />
mehrfache Wiederholungen erhält<br />
die Musik beschwörende Züge bis hin<br />
zum Ekstatischen und lässt je nach<br />
emotionaler Ergriffenheit und regionalen<br />
Konventionen Raum für die verschiedensten<br />
Arten von musikalischer<br />
und gestischer Beteiligung wie<br />
Sprechgesang, Klatschen, singen oder<br />
tanzen. Durch die Elemente von Musik,<br />
Bewegung und Improvisation ergibt<br />
sich <strong>im</strong> Gottesdienst afrikanischer<br />
Christen oftmals eine Lebendigkeit,<br />
die für europäische Christen<br />
nicht leicht nachzuvollziehen ist.<br />
In der Verbindung eines lateinischen<br />
Messtextes, der exemplarisch die europäische<br />
Kultur vertritt auf der einen<br />
9<br />
Literaturhinweise
Literaturhinweise<br />
und traditioneller afrikanischer Elemente<br />
auf der anderen Seite stellt die<br />
Missa Luba auch noch nach fast 50<br />
Jahren eine Herausforderung für die<br />
Weltkirche dar. Dies wird erst in vollen<br />
Maß deutlich, wenn man sich den<br />
Unterschied zwischen dem europäischen<br />
kognitiven, kontemplativen<br />
und dem afrikanisch emotionalen,<br />
beschwörenden Kult vergegenwärtigt.<br />
Hier kann die Missa Luba eine<br />
Brücke zum Prozess der Inkulturation<br />
bilden und Begegnung schaffen.<br />
Nach eigenen Erfahrungen mit verschiedenen<br />
Aufführungen sowohl der<br />
Missa Luba als auch mit der Missa<br />
Criolla können in einer interkulturellen<br />
Zusammenarbeit von<br />
Chören und afrikanischen bzw. Südamerikanischen<br />
Musikern bereichernde<br />
Begegnungen und spannende musikalische<br />
Prozesse geschehen. Aber<br />
auch in eigenen Aufführungen kann<br />
diese Musik für viele Gruppen interessant<br />
und belebend sein.<br />
Im Umgang mit dem Notentext sollte<br />
man es nicht an Flexibilität und Kreativität<br />
fehlen lassen, die bis zu Arrangements<br />
für die jeweiligen Verhältnisse<br />
gehen darf. Hier könnten sowohl<br />
in der Anordnung der Partitur-<br />
10<br />
systeme und der St<strong>im</strong>mverteilung als<br />
auch <strong>im</strong> Ambitus (teilweise hohe Lagen<br />
für die Frauenst<strong>im</strong>men) Eingriffe<br />
bis hin zu Oktavierungen erfolgen,<br />
ohne der Musik substanziell schädlich<br />
zu sein.<br />
Krutmann<br />
Lore-Ley<br />
Chorbuch Deutsche Volkslieder<br />
für gemischten Chor a cappella<br />
Carus Verlag 2.201 (27,40 Euro,<br />
ab 10 Exempl. 13,70 Euro)<br />
Woran mag ein Chorleiter denken,<br />
wenn er <strong>im</strong> Verzeichnis die<br />
Komponistennamen Thomas Gabriel,<br />
Alan Wilson, John Hoybye, Vic Nees;<br />
Józef Swider oder Vytautas Miskinis<br />
sieht? Wahrscheinlich eher an NGL-<br />
Arrangements oder moderne geistliche<br />
Chormusik, aber doch nicht etwa<br />
an deutsches Volkslied...<br />
Doch genau so ist es, neben diesen<br />
bekannten und angesagten<br />
Komponistennamen treten natürlich<br />
noch einige andere auf, die zum Thema<br />
Volkslied neue, brauchbare und<br />
abwechlungsreiche Sätze aufs Papier<br />
gebracht haben. Insgesamt 146 Sätze<br />
auf 222 Seiten bieten eine reichhaltige<br />
Auswahl – wie es <strong>im</strong> Vorwort heißt<br />
– an „zeitgemäßen, patina-
ereinigten“ Liedsätzen, die vom Anspruch<br />
her mit einem Laien- oder<br />
Schulchor rechnen und <strong>im</strong> mittleren<br />
Schwierigkeitsgrad anzuordnen sind.<br />
Bei den oben genannten<br />
Komponistennamen fällt bereits auf,<br />
dass der Begriff deutsches Volkslied,<br />
der für manchen noch historisch stigmatisiert<br />
sein mag, nicht mehr in<br />
enge musikalische Grenzen zu fassen<br />
ist. Neben modernen, teils jazzigen<br />
Arrangements sind hier aber ebenso<br />
Liedsätze der Renaissance (Isaac,<br />
Senfl) und der romantischen Tradition<br />
(Brahms, Silcher, Reger) und auch<br />
weihnachtliche Kirchenliedsätze anzutreffen.<br />
Eine insgesamt sehr gelungene, erfrischende<br />
Edition, an der auch Kirchenchöre<br />
ihren weltlichen Repertoireanteil<br />
renovieren mögen.<br />
Druck, Notensatz, Index und Zusatzinformationen<br />
sind in gewohnter<br />
Qualität, viele Sätze sind Erstveröffentlichungen,<br />
die meisten sind zudem<br />
als Einzelausgaben erhältlich.<br />
Krutmann<br />
Laula kultani – European Folk Songs<br />
Europäische Volkslieder in der<br />
Originalsprache<br />
in Sätzen für gemischte St<strong>im</strong>men<br />
Carus 2.301 (80 Seiten, 17,90 Euro,<br />
ab 10 Exempl. 8,95 Euro)<br />
Begleit-CD Carus 2.301/99 (Noten und<br />
CD: 24,- Euro)<br />
Laula kultani – European Folk Songs<br />
Europäische Volkslieder in der<br />
Originalsprache<br />
in Sätzen für gleiche St<strong>im</strong>men<br />
Carus 2.501 (64 Seiten, 17,00 Euro,<br />
ab 10 Exempl. 8,50 Euro)<br />
Begleit-CD Carus 2.501/99<br />
Begleit-CD mit gesprochenen Texten<br />
Carus 2.301/98 (6,30 Euro)<br />
Wer sich weiter mit dem Thema<br />
Volkslied/Folklore beschäftigen<br />
möchte, für den gibt es diese Sammlung<br />
mit Volksliedern in der jeweiligen<br />
Originalsprache. Hier sind die angebotenen<br />
Begleit-CDs tatsächlich<br />
eine große Hilfe, da sie Aufnahmen<br />
von verschiedenen Chören aus Europa<br />
bieten, die diese Lieder in ihrer<br />
Muttersprache singen. Darüber hinaus<br />
bietet das Verlagsangebot eine<br />
Aufnahme nur mit den Texten, die<br />
von jeweils muttersprachlichen Sprechern<br />
rezitiert werden.<br />
Krutmann<br />
11<br />
Literaturhinweise
Literaturhinweise<br />
Freiburger Kantorenbuch<br />
Antwortpsalmen <strong>im</strong> Kirchenjahr<br />
Carus Verlag 19.075 (42,- Euro)<br />
Der Herr ist mein Hirt<br />
Begleit-CD aus dem Kantorenbuch<br />
und weiteren Psalmvertonungen für<br />
Soli oder gemischten Chor)<br />
Carus 19.075/99 (15,- Euro)<br />
Wesentliches Novum dieses<br />
Kantorenbuches ist der Vertonungsstil<br />
der Verse, der statt der herkömmlichen<br />
modalen Art der bekannten<br />
früheren Veröffentlichungen hier nun<br />
in spätromantischer Dur/Moll-Tonalität<br />
verfasst ist. Muster waren dafür<br />
nach Angaben des Herausgebers englische<br />
Psalmodien. Auch die Textfassung<br />
geht eigene Wege, indem sie<br />
statt der Einheitsübersetzung die Fassung<br />
des Münsterschwarzacher<br />
Psalters benutzt. Enthalten sind die<br />
Antwortpsalmen der drei Lesejahre<br />
für Sonntage, Feiertage sowie Herrenfeste<br />
und zahlreiche Heiligenfeste,<br />
der Umfang beträgt etwa 320 Seiten.<br />
Gewöhnungsbedürftig mag zunächst<br />
die Notierung sein, die bei den Achtelnoten<br />
den natürlichen Sprachrhythmus<br />
äqualisieren könnte, auch<br />
wenn <strong>im</strong> Vorwort darauf hingewiesen<br />
wird, dass dieses nicht geschehen<br />
12<br />
möge. Zweifellos sind diese Melodien<br />
in ihrem gefälligen Duktus und in dieser<br />
liturgischen Vollständigkeit ein<br />
Novum <strong>im</strong> Bereich des solistischen<br />
Kantorengesangs, und auch die harmonische<br />
Bereicherung der ausgeschriebenen<br />
Orgelbegleitung wird<br />
Anklang finden. Bei geübten Sängern<br />
erscheint allerdings das Mitspielen<br />
der Gesangslinie als hinfällig und<br />
klanglich nicht bereichernd.<br />
Die Begleit-CD bietet sieben Beispiele<br />
aus dem Freiburger Kantorenbuch,<br />
die in der Praxis – normale akustische<br />
Verhältnisse vorausgesetzt – vielleicht<br />
etwas zügiger ausfallen könnten.<br />
Bei den weiteren Psalmvertonungen<br />
handelt es sich um Werke<br />
für eine St<strong>im</strong>me mit Orgelbegleitung<br />
und Werke für gemischten<br />
Chor, teilweise mit Orgelbegleitung<br />
sowie zwei Orgelwerke<br />
nach Psalmtexten. Auch hier ist eine<br />
Präferenz englischer Komponisten<br />
erkennbar, die Beteiligten musizieren<br />
auf hohem Niveau.<br />
Sollte diese Aufnahme für die praktische<br />
Erarbeitung der Kantorengesänge<br />
dienen, so ist anzunehmen,<br />
dass diesem Interessierten jegliche<br />
Vorbildung fehlt, allerdings möchte<br />
man in diesem Fall doch lieber zum
Kantorenkurs o. ä. Ausbildungsgängen<br />
raten. Eine Bildung des Sängers<br />
kann und soll diese Einspielung nicht<br />
ersetzen, für das Repertoire des <strong>Kirchenmusik</strong>ers<br />
gibt es einige interessante<br />
Kompositionen.<br />
Abschließend kann das Freiburger<br />
Kantorenbuch als Abwechslung und<br />
Bereicherung der Gestaltung des<br />
Antwortpsalms bezeichnet werden.<br />
Zusammen mit dem bereits in einer<br />
früheren Ausgabe der <strong>Kirchenmusik</strong>alischen<br />
Mitteilungen vorgestellten<br />
Freiburger Orgelbuch kann es<br />
vielen Kantoren und Organisten empfohlen<br />
werden.<br />
Krutmann<br />
„Vier kleine Choralvorspiele“<br />
für Orgel<br />
Franz Schmitt<br />
Leuckart Verlag, München, L 8820<br />
Franz Schmidt (1874 – 1939) gilt als<br />
einer der bedeutensten österreichischen<br />
Komponisten des frühen 20.<br />
Jahrhunderts. Sein Personalstil ist<br />
durch die Synthese von spätromantischer<br />
Harmonik, klassischer<br />
Form und polyphoner Satztechnik gekennzeichnet.<br />
Die „Vier kleinen Choralvorspiele“ aus<br />
dem Jahr 1926 sind in einer Art viersätzigen<br />
Orgelsonate komponiert:<br />
Der Kopfsatz über den Choral<br />
„O Ewigkeit du Donnerwort“ ist<br />
streng fünfst<strong>im</strong>mig, die Choralmelodie<br />
tritt <strong>im</strong> Kanon auf. Anstelle<br />
eines Scherzos steht der Choral „Was<br />
mein Gott will, das g´scheh allzeit“,<br />
bei dem die einzelnen Choralverse<br />
zunächst manualiter und dann mit<br />
dem Cantus firmus <strong>im</strong> Pedal durchgeführt<br />
werden. An dritter Stelle steht<br />
der Adagio-Satz „O wie selig seid ihr<br />
doch, ihr Frommen“ mit kolorierter<br />
Choralst<strong>im</strong>me. „Nun danket alle<br />
Gott“ beschließt das Werks als<br />
Postludium „in organo pleno“.<br />
Die Intentionen Schmidts sind denen<br />
Johann Sebastian Bachs (vgl. das Vorwort<br />
zu dessen „Orgelbüchlein“) nahe<br />
stehend: Zum einen veranschaulicht<br />
er eindrücklich verschiedene anspruchsvollereChoralbearbeitungstechniken<br />
und schafft damit gleichzeitig<br />
Werke zur spieltechnischen<br />
Weiterentwicklung des Organisten.<br />
Zum anderen deutet er den jeweils<br />
zugrunde liegenden Choraltext musikalisch<br />
aus, was den einzelnen Stükken<br />
insbesondere bei zyklischer Aufführung<br />
eine ausgesprochene Ausdruckskraft<br />
verleiht.<br />
13<br />
Literaturhinweise
Literaturhinweise<br />
Wer letztlich an einer aufschlussreichen<br />
Einspielung an einer adäquaten<br />
Orgel interessiert ist, dem sei die CD<br />
„Orgellandschaft Wien“ (erschienen<br />
bei Musikproduktion Dabringshaus &<br />
Gr<strong>im</strong>m, Detmold, MD+G O 3343) mit<br />
der Salzburger Orgelprofessorin Elisabeth<br />
Ullmann wärmstens empfohlen.<br />
14<br />
Peter Wagner M.A.<br />
„Intonationen – Anleitung und<br />
Tipps für leichte Intonationen auf<br />
der Orgel“<br />
Christiane Michel Ostertrun<br />
Strube Verlag München, VS 3091<br />
Für viele Orgelschüler ist der erste<br />
Schritt zur Improvisation mit einer<br />
Hemmschwelle verbunden, die zu<br />
überwinden, häufig einige Mühen<br />
bedeutet. Als eine konkrete Handreichung<br />
sei das genannte Heft kurz vorgestellt:<br />
Die Autorin gibt in ihrem Lese- und<br />
Lernheft praktische Anleitungen, mit<br />
einfachen Mitteln klare und prägnante<br />
Formen der Improvisation zu entwickeln.<br />
Der erste Teil gründet sich<br />
auf die Verwendung der Begleitsätze<br />
des Orgelbuchs zum Gotteslob als<br />
„Tonlieferant“, womit man folgenden<br />
Kapiteln begegnet: „Der Begleitsatz<br />
als Baukasten“, „Begleitsatz mit<br />
wechselnder St<strong>im</strong>menzahl“,<br />
„Begleitsatz mit Verzierungen“, „Arrangierter<br />
Begleitsatz“, und „Weitere<br />
Möglichkeiten“. Der zweite Teil gibt<br />
Anregungen zur Intonationen ohne<br />
Verwendung der Begleitsätze: „Modale<br />
Begleitung“, „Ostinato-Formen“,<br />
„Begleitung aus Cantus-firmus-Tönen“<br />
und „Weitere Möglichkeiten“.<br />
Nebenbei sei hier bemerkt, dass zur<br />
Umsetzung elementare Kenntnisse<br />
der Harmonielehre ausreichend sind.<br />
So finden sich in diesem kompakten<br />
Heft auf 28 Seiten genau 56 verschiedene<br />
Intonationstypen, die wenig<br />
Vorbereitungszeit erfordern, geeignet<br />
sind die eigene Kreativität anzuregen<br />
und wirkungsvoll den Gottesdienstalltag<br />
beleben können.<br />
CD‘s<br />
Peter Wagner M. A.<br />
Gesualdo – Tenebrae Responsories<br />
for Maundy Thursday (The King´s<br />
Singers)<br />
Signum Records Ltd, 2004<br />
Die vorliegende CD der King´s Singers<br />
enthält liturgische Gesänge in Verto-
nungen Don Carlo Gesualdos (1566-<br />
1613) zum Gründonnerstag, dem ersten<br />
Tag des Triduum Sacrum am<br />
Ende der Karwoche. Jeder Frühgottesdienst<br />
des Triduum Sacrum ist<br />
unterteilt in drei Nokturnen mit<br />
Psalmengesang, drei Lesungen und<br />
drei Responsorien. So ist auch die CD<br />
in drei Teile untergliedert, die mit je<br />
einer Lesung beginnen, die den Klageliedern<br />
Jeremias entnommen sind. Es<br />
folgen jeweils die entsprechenden<br />
Responsorien der drei Nokturnen. Der<br />
letzte Teil des Gottesdienstes beginnt<br />
mit dem durch Gesualdos <strong>im</strong><br />
Alternat<strong>im</strong>-Stil vertonten Lobgesang<br />
des Zacharias Benedictus Dominus<br />
Deus Israel, dem die Antiphon<br />
Traditor autem vor- und nachgestellt<br />
ist. Der gesungene Teil des Gottesdienstes<br />
endet mit einem Teil der<br />
Versikel Christus factus est, zu der in<br />
der Liturgie der zwei Folgetage des<br />
Triduum Sacrum mehr Text hinzugefügt<br />
wird, bis schließlich am Karsamstag<br />
der vollständige Text vorgetragen<br />
wird. Auch wenn die Auswahl der<br />
Lesungen nicht den liturgischen Vorgaben<br />
des Tages entspricht, so kann<br />
doch ein gewisser Eindruck von der<br />
Feier der tatsächlichen<br />
Gründonnerstagsliturgie gewonnen<br />
werden.<br />
Die King´s Singers nähern sich der<br />
Musik Gesualdos recht neutral und<br />
lassen ihre starke Expressivität eher<br />
durch perfekte Intonation und beeindruckende<br />
Genauigkeit in der Textdeklamation<br />
und Phrasenbildung als<br />
durch eine überschwängliche emotionale<br />
Interpretation wirken. Die dynamischen<br />
Entwicklungen und die gewählten<br />
Temporelationen sind stets<br />
gut durchdacht, sie stehen in engem<br />
Zusammenhang mit dem textlichen<br />
<strong>Inhalt</strong> und dienen einer angemessenen<br />
Diktion des Texts. In der Tat ist<br />
die Musik selbst aufgrund der zahlreichen<br />
Dissonanzen und den – <strong>im</strong> historischen<br />
Kontext gesehen – ungewohnten<br />
Akkordverbindungen derart<br />
ausdrucksstark, dass die schlichte<br />
Herangehensweise der Musik durchaus<br />
dienlich ist. So verstehen die<br />
King´s Singers, den jeweiligen Charakter<br />
der Stücke mit ihrer Interpretation<br />
gut zu treffen. Der geneigte Hörer<br />
wird die besondere Homogenität<br />
des Ensembles, die nicht nur in der<br />
erstaunlich identischen Vokalisation<br />
aller Sänger und in der ausgewogenen<br />
dynamischen Balance der St<strong>im</strong>men<br />
vom Bass zum Diskant innerhalb<br />
der Akkordstrukturen, mit jeweils<br />
stärkstem Gewicht auf dem Grundton,<br />
gefolgt von den schwächeren<br />
15<br />
Literaturhinweise
Literaturhinweise<br />
Quinten bis hin zur leisen Terz, begründet<br />
ist, zu schätzen wissen. Ebenso<br />
wird das Ohr durch eine stets reine<br />
Intonation mit tiefen Dur-Terzen und<br />
hohen Moll-Terzen bei dieser wiederum<br />
rundum gelungenen Aufnahme<br />
der King´s Singers verwöhnt. Abgerundet<br />
wird das künstlerische Gesamtkonzept<br />
dieser CD durch ein informatives<br />
dreisprachiges Booklet<br />
(englisch, deutsch, französisch) sowie<br />
ein ansprechendes Cover, auf dem ein<br />
pyramidenförmiger 15-flammiger<br />
Tenebrae-Leuchter abgebildet ist, womit<br />
auch visuell ein Bezug zur Feier<br />
des Frühgottesdienstes am Gründonnerstag<br />
nach altem katholischen Ritus<br />
hergestellt werden konnte. Sehr<br />
empfehlenswert!<br />
Daniel Beckmann<br />
Dietrich Buxtehude:<br />
Membra Jesu Nostri<br />
Cantus Coelln<br />
Konrad Junghänel<br />
HMC 901912<br />
LC 7045<br />
Eines der wichtigsten Komponistenjubiläen<br />
in diesem Jahr, der 300. Todestag<br />
von Dietrich Buxtehude, dürfte<br />
vor allem den Organisten und<br />
16<br />
Orgelmusikfreunden bewusst sein.<br />
Dass sein umfangreiches geistliches<br />
Vokalwerk, Konzerte, Choräle, Arien,<br />
Kantaten und Oratorien, die er in erster<br />
Linie für die berühmten Abendmusiken<br />
in der Lübecker Marienkirche<br />
geschrieben hat, nicht diesen Bekanntheitsgrad<br />
erreicht hat, liegt<br />
wohl daran, dass der größte Teil dieser<br />
Kompositionen verloren gegangen<br />
ist. Der vorliegende Kantatenzyklus<br />
„Membra Jesu Nostri“, BuxWV<br />
75, entstand 1680 <strong>im</strong> Auftrag des<br />
schwedischen Hofkapellmeisters Gustav<br />
Düben, das Original überlebte in<br />
Stockholm und Uppsala.<br />
Textliche Grundlage ist der mittelalterliche<br />
Hymnenzyklus „Salve mundi<br />
salutare“, mystische Betrachtungen<br />
der einzelnen Gliedmaße des gekreuzigten<br />
Christus. Diese werden von<br />
Buxtehude als fünfst<strong>im</strong>mige Tutti-<br />
Sätze, Terzette und Arien in sieben,<br />
jeweils fünfteiligen Kantaten vertont.<br />
Die ausdrucksvolle Melodik und der<br />
mit schlichter Harmonik gehaltene<br />
durchsichtige Satz erinnern dabei an<br />
italienische Vorbilder. Dass diese eher<br />
emotionalen Elemente den ehrfürchtigen<br />
distanzierten Gestus der protestantischen<br />
norddeutschen Schule<br />
nicht leugnen, sondern mit diesem
eine faszinierende Synthese eingehen,<br />
ist der Verdienst der individuellen<br />
Schreibweise Buxtehudes und<br />
macht den besonderen Reiz dieser<br />
Komposition wie auch der die CD ergänzenden<br />
Choralkantate „N<strong>im</strong>m<br />
von uns, Herr, du treuer Gott“, BuxWV<br />
78, aus.<br />
Als vorzüglicher Anwalt der durch diese<br />
stilistische Gratwanderung zum<br />
Ausdruck gebrachten Absichten Buxtehudes<br />
erweist sich „Cantus Coelln“<br />
unter der Leitung von Conrad<br />
Junghänel. Das mit renommierten<br />
Vokalsolisten besetzte Ensemble<br />
überzeugt nicht nur in den Arien und<br />
Terzetten, sondern entwickelt in den<br />
Tutti-Sätzen auch einen angenehm<br />
homogenen Chorklang, der auf historischem<br />
Instrumentarium stets adäquat<br />
begleitet wird.<br />
Internet<br />
Roland Krane<br />
Das WWW bietet mittlerweile eine<br />
Fundgrube an frei verfügbaren Noten<br />
in verschiedenen Formaten. Bequem<br />
zu Ausdruck sind vor allem die Noten<br />
<strong>im</strong> PDF-Format, weil sie nur auf den<br />
Akrobat Reader von Adobe zugreifen,<br />
der meist auf jedem Rechner zu finden<br />
ist und kein spezielles Notenprogramm<br />
erfordert.<br />
Wer für das Buxtehudejahr 2007<br />
noch Noten von z. B. Der Kantate „Alles<br />
was ihr tut“ sucht, ist auf der Seite<br />
www.kantoreiarchiv.de bestens aufgehoben.<br />
Neben dem kompletten<br />
Material dieser und anderer<br />
Buxtehudewerke findet sich einiges<br />
von Einst<strong>im</strong>migem über Instrumentalmusik<br />
bis zu Orgelmusik. Drei Kataloge,<br />
sortiert nach Besetzung,<br />
Komponistenname und Verwendbarkeit<br />
<strong>im</strong> Kirchenjahr (zur Zeit nur<br />
Weihnachten), erleichtern die Suche.<br />
Eine hilfreiche Zusammenstellung<br />
rund um das Neue Geistliche Lied findet<br />
man unter der sehr übersichtlichen<br />
Site www.ngl-deutschland.de.<br />
Noten sucht man hier vergeblich aber<br />
u. a. eine umfangreiche Literaturliste<br />
und die Liste mit Verlagen und Komponisten<br />
kann bei mancher Projektvorbereitung<br />
hilfreiche Dienste leisten.<br />
17<br />
Literaturhinweise
Berichte nd Nachrichten<br />
Thomas Berning tritt die Nachfolge<br />
Theodor Holthoffs als<br />
Domkapellmeister am Hohen Dom<br />
zu <strong>Paderborn</strong> an<br />
Nach A-Examen<br />
in Dortmund,<br />
Reifeprüfung<br />
und Konzertexamen<br />
an der<br />
Kölner Musikhochschule<br />
und<br />
Kapellmeisterstudien<br />
bei Professor Jöris in Hannover<br />
trat Theodor Holthoff 1972 als<br />
jüngster der damaligen Bewerber seinen<br />
Dienst als Domkapellmeister am<br />
Hohen Dom zu <strong>Paderborn</strong> an. 34 Jahre<br />
prägte Holthoff die <strong>Paderborn</strong>er<br />
Dommusik und ist in diesen Jahren zu<br />
einer „Institution“ geworden, die Generationen<br />
von jungen Menschen<br />
prägte und an den Schatz der <strong>Kirchenmusik</strong><br />
heranführte. Spontane<br />
Begeisterung und künstlerischer Ehrgeiz<br />
zeichnete seine Beziehung zu<br />
„seinem Domchor“ ebenso aus, wie<br />
die hohe pädagogische Kunst, junge<br />
Menschen anzustecken und zu einem<br />
Erfolg zu führen und das mit einem<br />
nicht gerade mit einem von Jugendlichen<br />
favorisierten Gegenstand – der<br />
geistlichen Chormusik. Jahr um Jahr<br />
18<br />
zog Theodor Holthoff durch <strong>Paderborn</strong>s<br />
Grundschulen, um Nachwuchs<br />
für die 70-köpfige Sängerschar zu<br />
aquirieren, ein Engagement, für das<br />
anderenorts Internate<br />
und<br />
Musikgymnasien<br />
zur Verfügung<br />
stehen. Wieviel<br />
Überzeugungsarbeit<br />
bei Eltern<br />
war wohl nötig,<br />
wieviel künstlerische<br />
Leidenschaft musste „überspringen“,<br />
um Kinder und Jugendliche vom<br />
Wert der musikalischen Gestaltung<br />
der Liturgie zu überzeugen? - von<br />
Palestrina und Bach, von Mozart und<br />
Britten, von der Gregorianik bis zu<br />
Petr Eben.<br />
Am 1. Januar 2007 trat Thomas<br />
Berning – von einer<br />
Findungskommission, der u. a. die<br />
Domkapellmeister Metternich (Köln)<br />
und Böhmann (Freiburg) angehörten,<br />
aus 36 Bewerbern ausgewählt – die<br />
Nachfolge Theodor Holthoffs an.<br />
Berning wurde 1966 in Havixbeck (bei<br />
Münster/Westf.) geboren und studierte<br />
an der Hochschule für Musik in<br />
Detmold <strong>Kirchenmusik</strong> und Orgel. Zu
seinen Lehrern <strong>im</strong> Fach Dirigieren<br />
zählten Prof. Alexander Wagner, dessen<br />
Assistent bei der Cappella der<br />
Nordwestdeutschen Musikakademie<br />
er war, Prof. Georg Christoph Biller,<br />
Prof. Karl-Heinz Bloemeke und Prof.<br />
Joach<strong>im</strong> Harder.. Weitere Impulse erhielt<br />
er von Prof. Heinz Hennig und<br />
Prof. Uwe Gronostay, Berlin. Während<br />
seines Aufbaustudiums <strong>im</strong> Fach Orgel<br />
bei Prof. Gerhard Weinberger unterrichtete<br />
er als dessen Lehrassistent <strong>im</strong><br />
Fach Orgel.<br />
1993 wurde er 1. Preisträger <strong>im</strong> 1. Internationalen<br />
„Gottfried-Silbermann-<br />
Orgelwettbewerb“ in Freiberg (Sachsen).<br />
Von 1992 bis 1995 war er Kantor an<br />
der St. Antoniuskirche in Herten<br />
(NRW). Hier leitete er auch den Madrigalchor<br />
Recklinghausen und gründete<br />
den beachteten „Vestischen<br />
Kammerchor“.<br />
Seit November 1995 ist er Bezirkskantor<br />
der Erzdiözese Freiburg an der<br />
Jesuitenkirche in Heidelberg, Leiter<br />
der Cappella Palatina Heidelberg und<br />
seit 1996 zudem Lehrbeauftragter für<br />
künstlerisches Orgelspiel und Orgelbau<br />
an der Hochschule für <strong>Kirchenmusik</strong><br />
in Heidelberg. Mit dem<br />
Konzertchor und dem von ihm gegründeten<br />
Kammerchor der Cappella<br />
Palatina führte er ein breites Repertoire<br />
an oratorischen Werken und Acappella-Chormusik<br />
auf, darunter die<br />
großen Werke Johann Sebastian<br />
Bachs und zwei Uraufführungen großer<br />
Werke von Tilo Medek und Friedrich<br />
Voss.<br />
Daneben ist er auch weiterhin als<br />
Konzertorganist tätig. Neben großen<br />
Teilen des Gesamtwerks von Johann<br />
Sebastian Bach umfasst sein Repertoire<br />
ein breites Spektrum der europäischen<br />
Barockmusik und der deutschen<br />
und französischen Orgelromantik.<br />
Er initiierte das Orgelneubauprojekt<br />
in der Jesuitenkirche Heidelberg und<br />
ist Mitherausgeber des „Freiburger<br />
Orgelbuchs“.<br />
Kunert/Thissen<br />
Seminartag „Orgel<strong>im</strong>provisation <strong>im</strong><br />
Gottesdienst“<br />
Schauplatz für einen Seminartag zum<br />
Thema „Orgel<strong>im</strong>provisation <strong>im</strong> Gottesdienst“<br />
war der Mindener Dom.<br />
Dort empfing Peter Wagner die zahlreichen<br />
Teilnehmer. Wagner gilt als<br />
ausgewiesener Improvisationsexperte.<br />
Er hat zu diesem Thema bereits<br />
zwei Bücher verfasst, die als<br />
Standardwerke gelten. Wer aber be-<br />
19<br />
Berichte nd Nachrichten
Berichte und Nachrichten<br />
fürchtete, der Domorganist könnte<br />
mit seinem umfangreichen Wissen<br />
und Können die Teilnehmer mit ihren<br />
ganz unterschiedlichen Voraussetzungen<br />
überfordern, sah sich schnell<br />
eines Besseren belehrt.<br />
Nach einer kurzen Andacht durch<br />
Domvikar Ra<strong>im</strong>und Kinold und einem<br />
gemeinsamen Lied stellte Wagner an<br />
der großen Domorgel einige<br />
Improvisationsmodell vor, die er in<br />
späteren Unterrichtseinheiten anschaulich<br />
erläuterte und dabei ihren<br />
einfachen Charakter offen legte.<br />
Denn darum ging es: einfache, erlernbare<br />
Techniken und Grundmuster,<br />
um die Intonation, das Vorspiel<br />
für den sonntäglichen<br />
Gemeindegesang mit neuen Ideen zu<br />
beleben, ohne durch übersteigerte<br />
spieltechnische Mindestanforderungen<br />
auszuschließen. Und tatsächlich:<br />
Kaum etwas ging über jene Fertigkeiten<br />
hinaus, die sich ein engagierter<br />
Schüler nach zweijährigem Orgelunterricht<br />
angeeignet haben sollte;<br />
und klang dabei doch <strong>im</strong>mer voll und<br />
ausgereift.<br />
Das Wissen, das Peter Wagner in den<br />
beiden Bänden „Orgel<strong>im</strong>provisation<br />
mit Pfiff“ dargelegt hat, wusste er<br />
20<br />
auch als Dozent unter Einbeziehung<br />
der einen oder anderen Pointe anschaulich<br />
zu vermitteln. Das Auditorium<br />
dankte am Ende mit lang anhaltendem<br />
Beifall und bat um Fortsetzung<br />
in Form einer vertiefenden<br />
Folgeveranstaltung.<br />
Mindener Tageblatt<br />
Gemeinschaftsprojekt „Festliche<br />
Serenade <strong>im</strong> Mindener Dom“<br />
Anlässlich des 25jährigen<br />
Partnerschaftsjubiläums zwischen<br />
dem Kreis Minden-Lübbecke und dem<br />
Bezirk Hermagor (Österreich), unter<br />
Beteiligung des Kreises Viljandi (Estland)<br />
wurde eine festliche Serenade<br />
<strong>im</strong> Dom zu Minden aufgeführt. Begrüßt<br />
wurden die Gäste <strong>im</strong> vollbesetzten<br />
Dom durch Propst Roland<br />
Falkenhahn, Grußworte sprachen<br />
Landrat Wilhelm Krömer, Dr. Heinz<br />
Pansi, Bezirkshauptmann von<br />
Hermagor und Kalle Küttis, Landrat<br />
von Viljandi.<br />
Ein Projektchor mit Sängerinnen und<br />
Sängern des Domchores, des katholischen<br />
St.-Paulus-Chores und der<br />
evangelischen Kantorei St. Martini<br />
sowie des Vokalensembles „Paistu“<br />
(Estland) gestalteten zusammen mit
dem Sinfonischen Bläserensemble<br />
Hermagor (Österreich) das festliche<br />
Konzert.<br />
Zur Aufführung kamen Werke von<br />
Johann Sebastian Bach, Paul Dukas,<br />
Flor Peeters, James Curnow, sowie<br />
Tönis Mägi, Max Reger, Andres<br />
Valkonen und Anton Bruckner. Den<br />
festlichen Abschluss nach einem gemeinsamen<br />
Gebet bildete die Toccata<br />
D-Dur op. 42/3 von Félix Alexandre<br />
Guilmant für Orgel, gespielt von<br />
Domorganist Peter Wagner, der auch<br />
für die musikalische Gesamtleitung<br />
verantwortlich zeichnete und daran<br />
anschließend der Hymnus „Klänge<br />
der Freude“ von Edward Elgar unter<br />
dem Dirigat von Günter Brummundt.<br />
Die Zuhörer dankten allen Ausführenden<br />
mit einem lang anhaltenden<br />
Schlussapplaus.<br />
Mindener Tageblatt<br />
„Go(o)d Music“<br />
Veranstaltung des AK Popular in<br />
Hardehausen, 11. November 2006<br />
Rund 70 Teilnehmer kamen am 11.<br />
November 2006 zum ganztägigen<br />
Workshop „Go(o)d Music“ nach<br />
Hardehausen, der vom Arbeitskreis<br />
Popularmusik des Referats <strong>Kirchenmusik</strong><br />
in Zusammenarbeit mit dem<br />
Jugendhaus angeboten wurde. Es<br />
war ein Workshoptag für Leiter von<br />
Bands und Chören in der Jugendarbeit<br />
und fortgeschrittene Musiker, der<br />
sich zwischen E- und U-Musik,<br />
Sacropop, Rock und Worldmusic und<br />
traditionellem Kirchenlied bewegt. In<br />
kreativer und ungezwungener Atmosphäre<br />
holt der Tag die Leute da ab,<br />
wo sie gerade musikalisch sind und<br />
bringt sie weiter, damit die Familiengottesdienste<br />
von heute sich nicht<br />
mehr so anhören wie die Jugendgottesdienste<br />
von gestern. Damit die<br />
Jugendgottesdienste von heute auch<br />
nach heute klingen.<br />
Um 9.30 Uhr trafen sich die Teilnehmer<br />
<strong>im</strong> Kreuzgang zu „Coffee and<br />
who is who“, wo erstes Kennen lernen<br />
und die Verteilung auf die Workshops<br />
angesagt war. Vier Themen<br />
waren <strong>im</strong> Angebot. Martin Berens,<br />
Schlagzeuger und Toningenieur aus<br />
Kirchhundem, bot einen Workshop<br />
für Schlagzeuger, Percussionisten und<br />
Rockbandmusiker an, die den Rhythmus<br />
füllen wollen, ohne <strong>im</strong> Lärm zu<br />
versinken. Thema: „Zwischen<br />
Gewölbelärm und wohltemperierter<br />
Rockband“. „Die Finger von Carlos<br />
Santana!?“, so hieß das zweite Ange-<br />
21<br />
Berichte und Nachrichten
Berichte und Nachrichten<br />
bot. Ludger Bollinger, Musiklehrer<br />
und Gitarrist in Herne, sprach mit diesem<br />
Angebot A- und E-Gitarristen<br />
gleichermaßen an. Ziel war die Perfektionierung<br />
jedes einzelnen Instrumentalisten<br />
auf seinem Instrument<br />
und seinen möglichen und unentdeckten<br />
Fähigkeiten. Werner<br />
Komischke, Dekanatskirchenmusiker<br />
in Medebach, betreute den Workshop<br />
chorisches Singen. Unter dem Thema<br />
„Gott kann Samba“ wurde die „Misa<br />
Criolla“ des argentinischen Komponisten<br />
Ariel Ramirez eingeübt. Rhythmen,<br />
Groove, und schöne Klänge<br />
zeichnen seine Musik aus. „Geht<br />
nicht, gibt’s nicht“ hieß der letzte<br />
Workshop von Dekanatskirchenmusiker<br />
Michael Störmer aus Schwerte,<br />
in dem Arrangements für alle<br />
möglichen und unmöglichen Instrumente<br />
zwischen Blech, Streich und<br />
Zupf, zwischen „Schwerter Liederbuch“<br />
und „Ihm und uns“ entstanden.<br />
Der Tag endete mit einem „etwas anderen“<br />
Gottesdienst. Viel Musik gab<br />
es hier zu hören, natürlich unter dem<br />
Thema Go(o)d Music.<br />
Störmer<br />
22<br />
„Spielen sie – spielen sie, ich weiß,<br />
dass sie es können!“<br />
Im Rahmen der Orgelwoche zur Weihe<br />
der neuen Goll-Orgel in der Liebfrauenkirche<br />
zu Hamm konnte Professor<br />
Stefan Engels als Gastdozent<br />
für ein eintägiges Orgelseminar am<br />
3. Oktober 2006 gewonnen werden.<br />
Auf dem Kursprogramm standen Orgelwerke<br />
von Felix Mendelssohn-Bartholdy,<br />
Sigfried Karg-Elert und Louis<br />
Vierne. Haupt- und nebenamtliche<br />
Organisten nutzten die Gelegenheit,<br />
an der Interpretation ihrer<br />
Repertoirestücke vertiefend zu arbeiten.<br />
Stefan Engels ist seit dem Wintersemester<br />
2005/2006 Professor für<br />
künstlerisches Orgelspiel an der<br />
Hochschule für Musik und Theater<br />
„Felix Mendelssohn-Bartholdy“ in<br />
Leipzig. Von 1999 bis 2005 war er Professor<br />
für künstlerisches Orgelspiel<br />
am Westminster Choir College in<br />
Princeton (USA). Seit 2003 arbeitet er<br />
an der Weltersteinspielung des Orgelgesamtwerks<br />
von Sigfried Karg-Elert.<br />
Inspirierend und an<strong>im</strong>ierend führte<br />
Engels die Kursteilnehmer von ihrer<br />
individuellen Lernausgangslage aus<br />
weiter. Beginnend bei der Technik,<br />
über Interpretation und Artikulation<br />
bis hin zur Registrierung konnte er
detaillierte Arbeitshilfen mit auf den<br />
Weg geben, wobei ihm die einwandfreie<br />
Kontrolle des technischen Apparates<br />
ein großes Anliegen war. Dabei<br />
betonte Engels jedoch, die musikalischen<br />
Gesichtspunkte nicht in den<br />
Hintergrund treten zu lassen.<br />
Ebenso ließ sich der Dozent bei den<br />
jeweiligen Kursteilnehmern auf ihre<br />
persönlichen Assoziationen bei der<br />
Erarbeitung von Phrasierungen und<br />
der Auswahl von Registerkombinationen<br />
ein. Diese sind unentbehrlich<br />
für die Gesamtinterpretation<br />
und Wirkung des Musikstücks. So erlebten<br />
die Kursteilnehmer z. B. dramatische,<br />
aber dennoch geistliche<br />
Klänge bei Mendelssohns Eingangschoral<br />
Vater unser <strong>im</strong> H<strong>im</strong>melreich.<br />
Ein Kursteilnehmer assoziiert seit seiner<br />
Kindheit den Klang der sechsten<br />
Sonate mit einer Art „Dracula“-Registrierung.<br />
Bleibt schließlich die Vorfreude auf<br />
das kommende Interpretations-Seminar<br />
mit Professor Jean-Claude<br />
Zehnder aus Basel. Es findet am<br />
Samstag, den 12. Mai 2006 an der<br />
West-Orgel der Hagener St. Meinolf<br />
Kirche statt. Auf dem Kursprogramm<br />
stehen dann galante Elemente <strong>im</strong> Orgelwerk<br />
Johann Sebastian Bachs.<br />
Und bis dahin „Spielen sie – spielen<br />
sie, ich weiß, dass sie es können!“<br />
(Prof. Stefan Engels, 3.10.2006,<br />
Hamm)<br />
Georg Hellebrandt<br />
Kinderchorforum<br />
Mit Fantasie, Bildern, Rhythmik und<br />
Bewegung eroberte die Gesangspädagogin<br />
Marlies Buchmann<br />
(Aachen) <strong>im</strong> Nu die Herzen der Kinder.<br />
Das Referat <strong>Kirchenmusik</strong> hatte am 2.<br />
September 2006 zu einer Fortbildung<br />
nach Nehe<strong>im</strong> eingeladen, zu der die<br />
Teilnehmer (Leiter/innen von Kinderchören,<br />
C-Kurs-Absolventen) Kinder<br />
aus den eigenen Chören mitbringen<br />
konnten.<br />
Viele Erklärungen erübrigten sich in<br />
einer lebendigen Chorprobe. Sämtliche<br />
Erläuterungen fanden in Vor- und<br />
Nachgesprächen statt.<br />
St<strong>im</strong>mbildung mit Kindern war der<br />
Gesangspädagogin ein großes Anliegen.<br />
Ganz unbemerkt ließ die sie <strong>im</strong>mer<br />
wieder St<strong>im</strong>mübungen in die<br />
Probe einfließen und erreichte damit<br />
schnell eine Verbesserung der Kinderst<strong>im</strong>men.<br />
Für ihre Arbeit legt die Referentin<br />
auch besonderen Wert auf eine<br />
altersgemäße Heranführung bei neu-<br />
23<br />
Berichte und Nachrichten
Berichte und Nachrichten<br />
en Liedern, denn nur so wird bei den<br />
Kindern eine Verinnerlichung erreicht<br />
und das Verständnis von Text und<br />
Melodie gefördert. Dann wächst auch<br />
die Freude, regelmäßig zur Chorprobe<br />
zu kommen und das Lied zu wiederholen.<br />
Neben dem „wie“ für eine gute Chorprobe<br />
wurde auch die Möglichkeit<br />
geboten, sich über Literatur und Noten<br />
zu informieren. Alle erarbeiteten<br />
Stücke und manche Anregungen<br />
konnten in Noten mit nach Hause genommen<br />
werden. Zum Abschluss des<br />
Tages wurde von allen „kleinen und<br />
großen Teilnehmern“ die Vorabendmesse<br />
<strong>im</strong> Nehe<strong>im</strong>er Dom mitgestaltet.<br />
Die Reihe Kinderchorforum wird fortgesetzt<br />
am 12. Mai 2007 in Wiedenbrück,<br />
St. Aegidius.<br />
Dieter Moers<br />
Berichte aus den Dekanaten<br />
Dekanat Hellweg<br />
Konzerte zur Orgelweihe in der<br />
Liebfrauenkirche Hamm<br />
Am 1. Oktober 2006 fand in der Liebfrauenkirche<br />
Hamm die Weihe der<br />
neuen Goll-Orgel (III/52) statt. Bevor<br />
24<br />
jedoch die ersten Töne des neuen Instrumentes<br />
zu hören waren, erklangen<br />
<strong>im</strong> ersten Teil des Pontifikalhochamtes<br />
noch einmal die beiden<br />
Inter<strong>im</strong>sinstrumente mit italienischen<br />
Sonaten für zwei Orgeln. In seiner<br />
Predigt wies Weihbischof Wiesemann<br />
auf die Ausdrucksfülle und die<br />
Bedeutung der Psalmen hin, die den<br />
Menschen in seinen unterschiedlichsten<br />
Lebenssituationen in Beziehung<br />
zu Gott setzen und Komponisten aller<br />
Epochen <strong>im</strong>mer wieder zu tiefen musikalischen<br />
Meisterwerken inspiriert<br />
haben. Dabei wies er auch auf die Bedeutung<br />
der Musik als spirituelle<br />
Kraft hin. Nach der feierlichen Weihe<br />
der Orgel wurden die ersten Töne in<br />
der vollbesetzten Kirche mit größter<br />
Spannung erwartet.<br />
Mit dem Praeludium G-Dur BWV 541<br />
von Johann Sebastian Bach fanden<br />
diese Erwartungen einen sicherlich<br />
sehr angemessenen Ausdruck. Daran<br />
schloss sich eine reichhaltige Folge<br />
von <strong>im</strong>provisierten Orgelversetten<br />
und Gemeindegesang über das<br />
Gottesloblied 474 an, in der sowohl<br />
die Klangmöglichkeit der neuen Orgel<br />
als auch die große Freude des Momentes<br />
geradezu mitreißend deutlich<br />
wurden.
Im weiteren Tagesverlauf folgte eine<br />
Orgelführung durch die Orgelbauer<br />
der Firma Goll (Luzern), die mit einfachen<br />
und klaren Worten und gelungenen<br />
Improvisationen sowohl dem<br />
interessierten Laien als auch dem<br />
Kenner informative Einblicke gewährte.<br />
Das erste Konzert wurde von Domorganist<br />
Gereon Krahforst mit Werken<br />
von Bach, Mozart, Widor und Improvisationen<br />
gestaltet. Dabei dürfte<br />
vor allem ein Scherzo <strong>im</strong> Stil von<br />
Schostakowitsch als fulminante Stilkopie<br />
jedem Zuhörer in Erinnerung<br />
bleiben. Als liturgischer und musikalischer<br />
Abschluss des Tages folgte eine<br />
sogenannte Orgelmesse, in der nach<br />
der Weihe am Morgen noch einmal<br />
DKM Johannes Krutmann mit Werken<br />
von Bach, Piroye, Alain u. a. zu hören<br />
war.<br />
Dem langen Tag der Orgelweihe folgte<br />
eine ganze Orgelwoche mit unterschiedlichsten<br />
Formen von Veranstaltungen.<br />
Hier wurde u. a. ein Orgelkurs,<br />
eine Orgelmeditation, Konzerte<br />
und sogar eine ganze Orgelnacht angeboten.<br />
Knapp 20 Teilnehmer fanden sich am<br />
3. Oktober auf der Orgelempore der<br />
Liebfrauenkirche ein, um sich mit Orgelwerken<br />
von Mendelssohn, Karg-<br />
Elert und Vierne zu beschäftigen. Bei<br />
diesem Interpretationskurs zeigte der<br />
in Leipzig lehrende Prof. Stefan Engels<br />
bemerkenswertes Einfühlungsvermögen,<br />
didaktisches Geschick und großes<br />
musikalisches Engagement, das<br />
sich auf die jeweiligen Bedürfnisse<br />
der Teilnehmer einstellen konnte und<br />
diese pointiert zu neuen Erkenntnissen<br />
sowie reflektiertem Hören und<br />
Musizieren zu motivieren wusste. Im<br />
abendlichen Konzert mit Werken von<br />
Grigny, Bach, Karg-Elert und Reger<br />
erwies er sich zudem als exzellenter<br />
Interpret.<br />
Eine Orgelmeditation zur eucharistischen<br />
Anbetung brachte nach den<br />
euphorischen konzertanten Anfängen<br />
das neue Instrument in einen<br />
sehr kontemplativen Kontext. Doch<br />
auch hier konnte die Orgel ihre große<br />
Vielfalt und Wandlungsfähigkeit mit<br />
Elevationsmusik vom Mittelalter über<br />
Frescobaldi bis Arvo Pärt unter Beweis<br />
stellen.<br />
Drei Konzerte, drei Chöre und drei Organisten<br />
bildeten den Rahmen der<br />
ersten Orgelnacht am Samstag dieser<br />
25<br />
Berichte und Nachrichten
Berichte und Nachrichten<br />
Orgelwoche. Nach der feierlichen Vorabendmesse<br />
mit Orgelwerken von<br />
Mendelssohn und der klangvollen<br />
„Messe héroique de Jeanne d’Arc“ von<br />
Henri Nibelle zeigte sich bald, dass die<br />
Menge der Zuhörer den geplanten<br />
Ablauf erheblich verzögern würde,<br />
zumal zwischen den Konzerten <strong>im</strong><br />
benachbarten Restaurant Gratisspeisen<br />
der mediterranen Küche angeboten<br />
und ebenso stark goutiert<br />
wurden.<br />
So breitete sich die Orgelnacht von<br />
18.00 Uhr bis fast 1.00 Uhr aus und<br />
erweiterte den ausgewiesenen<br />
Programmtitel „in organo et choro“<br />
um Oregano und Vino...<br />
Im Verlauf der Nacht wurde der nicht<br />
schwächer werdenden Zuhörerzahl<br />
u. a. das doppelchörige Te Deum von<br />
Mendelssohn (mit der Mendener<br />
Kantorei un dem Bach Chor Hagen<br />
unter der Leitung Johannes<br />
Krutmann) dargeboten. Die Organisten<br />
Gerhard Blum aus Köln (mit Sonaten<br />
von Ritter und Guilmant), Ansgar<br />
Wallenhorst aus Ratingen (Improvisationen<br />
und Liszt: Ad nos) und<br />
Gianluca Libertucci aus Rom<br />
(Frescobaldi, Bach, Franck, Bossi u. a.)<br />
ließen die begeisterte Zuhörerschaft<br />
hohe Orgelkunst <strong>im</strong> Bereich der Inter-<br />
26<br />
pretation, Improvisation und in gewisser<br />
Weise auch <strong>im</strong> Bereich des Orgelbaus<br />
erleben. Die nächtlichen Zugaben<br />
wurden <strong>im</strong> letzten Konzert erst<br />
mit einem augenzwinkernden, demonstrativen<br />
Antippen der Armbanduhr<br />
des römischen Organisten beendet.<br />
Den Abschluss der Orgelwoche bildete<br />
am nächsten Morgen eine Veranstaltung<br />
mit <strong>im</strong>provisierten Klang<strong>im</strong>pressionen<br />
für die Orgelpatenschaften,<br />
bei der vor allem<br />
strahlende Kinderaugen be<strong>im</strong> Hören<br />
„ihrer“ Pfeife <strong>im</strong> Gedächtnis bleiben<br />
werden.<br />
Bei aller Zurückhaltung, Klänge zu<br />
beschreiben und das eigene Instrument<br />
objektiv zu bewerten darf doch<br />
eine oftmals geäußerte Aussage zitiert<br />
werden, welche die Klangmöglichkeiten<br />
der Orgel möglicherweise<br />
zutreffend beschreibt: „Wenn<br />
man hier Werke aus unterschiedlichen<br />
Epochen hört, denkt man bei<br />
jedem neuen Stück, hier passt dieser<br />
oder jener Klang besonders gut, obwohl<br />
die Orgel <strong>im</strong>mer sehr charakteristisch<br />
bleibt und überhaupt keine<br />
Kompromissorgel ist.“
Festschriften zur Orgelweihe mit Beiträgen<br />
u. a. zur Stilistik und zum<br />
Klang der neuen Goll-Orgel sind zum<br />
Preis von 8,- _ bei DKM Johannes<br />
Krutmann (Wichernstraße 1, 59063<br />
Hamm, Tel./Fax: 02381/53540,<br />
Krutmann@web.de) oder <strong>im</strong> Büro der<br />
Liebfrauengemeinde (Liebfrauenweg<br />
2, 59063 Hamm, Tel.: 02381/50444)<br />
erhältlich.<br />
Krutmann<br />
Dekanat Rietberg-Wiedenbrück<br />
„Einer Königin genähert!<br />
Rhedaer Orgeltage: Biblische<br />
Schöpfungsgeschichte<br />
(Westfalenblatt, 27. Oktober 2006)<br />
Mit ihren schier unerschöpflichen<br />
Klangfarben gilt die Kirchenorgel gemeinhin<br />
als „Königin der Instrumente“.<br />
Sich dieser erlauchten Damen anzunähern,<br />
ist die Intention der Organisatoren<br />
der Rhedaer Orgeltage.<br />
Jetzt stand die Verklanglichung der<br />
biblischen Schöpfungsgeschichte <strong>im</strong><br />
Mittelpunkt. Dabei wurde es ziemlich<br />
eng auf der Empore der St. Clemens-<br />
Kirche zu Rheda.<br />
Mehr als 120 kleine und große Besucher<br />
waren es, die diesen Höhepunkt<br />
innerhalb der Orgeltage miterleben<br />
wollten. Harald Gokus, <strong>Kirchenmusik</strong>er<br />
an St. Clemens und Leiter der<br />
Orgelwoche, stellte zunächst ganz<br />
unterschiedliche Orgelpfeifen vor.<br />
Kleine und große, welche mit Deckel,<br />
andere mit einem Röhrchen, welche,<br />
die nach Flöte klingen, andere, die<br />
merkwürdig schnarrende Geräusche<br />
von sich geben, einige die dumpf und<br />
düster klingen, andere wiederum, die<br />
ein unangenehm hohes Pfeifen von<br />
sich geben. Von diesen Klängen hat<br />
die Clemens-Orgel mit ihren 3663<br />
Pfeifen gleich 50 aufzuweisen. Register<br />
heißen die und sind ganz besonders<br />
geeignet, Klanggeschichten zu<br />
„erzählen“.<br />
Diesmal hatte Organist Harald Gokus<br />
und Burkhard Schlüter als Sprecher<br />
die Schöpfungsgeschichte aus der<br />
Bibel ausgewählt. Der Komponist<br />
Larry Visser hat den Text aus dem Alten<br />
Testament kindgerecht aufbereitet<br />
und fasst die einzelnen Tage der<br />
Erschaffung der Welt in unterschiedlichen<br />
Klängen und Rhythmen zusammen.<br />
Mal in kantigen Viertel-Akkorden<br />
und ganz laut, mal in fließenden<br />
Sechzehntel-Bewegungen und mit<br />
Zungenregistern. Mal mit Principalen<br />
und die Flöten allein, dann, ganz mysteriös<br />
<strong>im</strong> Klang, mit sanften<br />
27<br />
Berichte und Nachrichten
Berichte und Nachrichten<br />
Streicherst<strong>im</strong>men. Zum Schluss,<br />
nachdem Gott die Welt und auch den<br />
Menschen geschaffen hat und sich<br />
am siebten Tag, dem „heiligen Tag“<br />
ausruht, dann mit voller Orgel und<br />
mit Toccatenfiguren.<br />
Immer aber war, mal mehr, mal weniger<br />
deutlich, eine Melodie zu hören.<br />
Die Melodie des Schöpfungsliedes<br />
„Alle schönen Dinge fein“, das Klein<br />
und Groß zu Beginn eingeübt hatten,<br />
um es am Ende der Geschichte gemeinsam<br />
und schwungvoll zu singen.<br />
„Ihr habt alle ganz toll mitgemacht“<br />
lobte Gokus den Riesenchor auf der<br />
Empore, der sodann eingeladen war,<br />
Fragen zu stellen. Wie alt ist die Orgel?<br />
Was wiegt sie? Welches ist der<br />
tiefste, welches der höchste Ton? Wie<br />
ist sie hier hoch gekommen? Bereitwillig<br />
gaben Gokus und Schlüter zunächst<br />
Auskunft und später den<br />
Spieltisch frei, damit die Mädchen<br />
und Jungen eigene Klavierstücke mal<br />
auf der Kirchenorgel spielen konnten.<br />
Das taten sie nur zu gern, auch wenn<br />
sie ein wenig aufgeregt waren bei so<br />
vielen Zuhörern. Der starke Applaus<br />
nach der Aufführung der Visserschen<br />
Komposition machte die Begeisterung<br />
der Besucher für die Orgel als<br />
„Erzählinstrument“ biblischer Ge-<br />
28<br />
schichte deutlich. Sie haben die<br />
Kirchenorgel, die sie sonst nur aus<br />
einer gewissen Distanz erleben, zudem<br />
einmal aus ihrer Nähe kennen<br />
lernen dürfen. Das Konzert für Kinder<br />
und Erwachsene ist dahier eine eminent<br />
wichtige Initiative zur Hinführung<br />
des Nachwuchses an ein liturgisch<br />
und konzertant eingesetztes<br />
sakrales Instrument, zur Hinführung<br />
an die <strong>Kirchenmusik</strong> überhaupt.<br />
Hubertus Ebbesmeyer<br />
Dekanat Lippstadt Rüthen<br />
Orgeltage in Lippstadt 2006<br />
„Die orgl ist doch in meinen augen<br />
und ohren der könig aller<br />
jnstrumenten“<br />
Unter diesem Mozart Zitat standen in<br />
diesem Jahr die 33. Orgeltage in<br />
Lippstadt. Eine stattliche Hörerzahl<br />
hatte sich zum Eröffnungskonzert am<br />
20. August in der Pfarrkirche St. Josef<br />
<strong>im</strong> Ortsteil Bad Waldliesborn eingefunden<br />
um durch Kantor Johannes<br />
Tusch einen Einblick in die musikalische<br />
Umwelt W. A. Mozarts zu erhalten.<br />
Im ersten Teil standen Werke von<br />
Komponisten, die Mozart unmittelbar<br />
beeinflußt haben, in der Mitte eines
seiner drei Orgelwerke, das „Andante“<br />
in F KV 616, komponiert in seinem<br />
letzten Lebensjahr „für ein Orgelwerk<br />
in einer Uhr“. Danach folgten drei<br />
Werke von Komponisten, die mit dem<br />
Meister befreundet waren und deren<br />
Kompositionen unverkennbar seinen<br />
Geist atmen.<br />
50 Besucher machten sich am Montag<br />
dem 28. August in die Domstadt<br />
auf, um sich von Domorganist Gereon<br />
Krahforst die renovierte Orgel des Domes<br />
vorführen zu lassen. Die detaillierte<br />
Einführung in die Renovierungsmaßnahme<br />
und die excellenten<br />
Klangdemonstrationen waren von<br />
nachhaltiger Wirkung auf die Zuhörer.<br />
Große Resonanz erfreute sich auch<br />
das 3. Konzert mit Michal<br />
Markuszweski, (Warschau), das die<br />
Lippstädter Orgelfreunde nach St. Ida<br />
Herzfeld führte. Der „weiße Dom an<br />
der Lippe“ verfügt seit November<br />
2002 über eine Orgel, die zum Anziehungspunkt<br />
für Freunde der Orgelkunst<br />
geworden ist. Das <strong>im</strong> historischen<br />
Gehäuse disponierte Instrument<br />
verfügt über 47 Register auf<br />
drei Manualen und Pedal. Das Instrument<br />
ist so angelegt, dass die zunächst<br />
romantisch anmutende Disposition<br />
neben orchestraler Klang-<br />
vielfalt auch barocke Klangfarben bereitstellt<br />
und sich die für verschiedene<br />
Epochen typischen Klangmischungen<br />
trotz der unterschiedlichen Stilrichtungen<br />
gut zusammenstellen lassen.<br />
In ökumenischer Verbundenheit fanden<br />
zwei Nachmittagskonzerte an<br />
der Orgel von St. Marien statt. An der<br />
durch Schuke Berlin renovierten Ott<br />
Orgel erklangen <strong>im</strong> ersten Konzert<br />
Werke von Komponisten, deren<br />
Schaffen musikgeschichtlich in diesem<br />
Jahr besondere Beachtung finden.<br />
In einer Transkription für Orgel<br />
war der Kanon von Johann Pachelbel<br />
(300. Todestag) zu hören, „Neue<br />
Orgelstücke nach der Ordnung unter<br />
dem Amte der heiligen Messe zu spielen“<br />
von Pater Theodor Grünberger<br />
(250. Geburtstag) das Voluntary in D<br />
von John Alcock, (200. Todestag) sowie<br />
das Festival Postlude in C von<br />
Cuthbert Harris (150. Geburtstag). In<br />
der folgenden Woche spielte Thomas<br />
Beile, Absolvent des C-Kurses aus<br />
Lippetal – Lippborg Kompositionen<br />
von Johann Pachelbel, Joh. Seb. Bach,<br />
Antonio Vivaldi und Antonio Soler.<br />
Am Anfang der Jubiläumsfeierlichkeiten<br />
„1125 Jahre Gemeinde<br />
Hörste“ stand ein Festgottesdienst, in<br />
dem durch die Capella vocalis<br />
29<br />
Berichte und Nachrichten
Berichte und Nachrichten<br />
Lippstadt unter der Leitung von Kantor<br />
Johannes Tusch die Missa brevis in<br />
D von Michael Haydn sowie zwei weitere<br />
Vokalkompositionen von Joseph<br />
Haydn aufgeführt wurden. Eine weitere<br />
Bereicherung erfuhr der Gottesdienst<br />
durch festliche Musik für<br />
Trompete und Orgel von Leopold Mozart.<br />
Während die Gemeinde zum Festgottesdienst<br />
das altehrwürdige Gotteshaus<br />
bis auf den letzten Platz gefüllt<br />
hatte, zog das Konzert „Jubiläen zum<br />
Jubiläum“ am Ende der Woche mehr<br />
Interessenten zum Kreisschützenfest<br />
in den Nachbarort. Auf dem Programm<br />
„Jubiläen zum Jubiläum“<br />
standen Werke von Komponisten, die<br />
in diesem Jahr einen runden Gedenktag<br />
haben. Es waren dies der vor 300<br />
Jahre gestorbene Johann Pachelbel,<br />
die vor 300 Jahren geborenen Padre<br />
Giovan Battista Martini, Baltasare<br />
Galuppi, die vor 250 Jahren geborenen<br />
Pater Theodor Grünberger und<br />
W. A. Mozart sowie die vor 200 Jahren<br />
verstorbenen Michael Haydn und<br />
John Alcock.<br />
Am Sonntag, dem 24. September gingen<br />
die Orgeltage mit einem Konzert<br />
in St. Joh. Evangelist in Bad<br />
Westernkotten zu Ende. Vor 10 Jahren<br />
wurde die Orgel in der kath. Pfarrkir-<br />
30<br />
che eingeweiht. In dieser Zeit fanden<br />
zahlreiche Konzerte statt, die von der<br />
Gemeinde und von den in Bad<br />
Westernkotten weilenden Kurgästen<br />
<strong>im</strong>mer dankbar angenommen und<br />
als wertvolle kulturelle Bereicherung<br />
empfunden wurden. Aus Anlass des<br />
„10jährigen“ spielte das Bläserensemble<br />
Brasso festivo Kompositionen<br />
von Jean Joseph Mouret, Johann<br />
Pachelbel, Tylmann Susato u. a. An<br />
der Orgel erklangen Kompositionen<br />
von Francois Bernoist und Carl Sattler.<br />
Tusch<br />
Dekanat Bielefeld-Lippe<br />
Dekanatschortreffen in St. Michael,<br />
Bielefeld-Ummeln<br />
Passend zur Neustrukturierung der<br />
Dekanate trafen sich am 16. September<br />
2006 die Kirchenchöre der Dekanate<br />
Bielefeld und Herford zu ihrem<br />
schon traditionellen Dekanatschortreffen.<br />
Die heilige Messe, in der der Gesamtchor<br />
von ca. 200 Sängerinnen und<br />
Sängern zu hören war, wurde zelebriert<br />
von dem Dekan des neuen<br />
Dekanats Bielefeld-Lippe, Klaus Fussy<br />
von der kath. Gemeinde St. Johannes<br />
Baptist in Bielefeld-Schildesche.<br />
Zur Vorbereitung hatte Georg Gusia,
Kantor an St. Jodokus in Bielefeld, ein<br />
Chorheft erstellt, aus dem in den gemeldeten<br />
Chören <strong>im</strong> Laufe des Sommers<br />
intensiv geprobt worden war.<br />
Am Nachmittag des 16. September<br />
2006 wurden nun die erarbeiteten<br />
Werke zusammengeführt und <strong>im</strong><br />
Gesamtchor gemeinsam perfektioniert<br />
und in der Vorabendmesse zur<br />
Aufführung gebracht. Unter anderem<br />
wurde von Heinrich Schütz „Lobt Gott<br />
mit Schall“ und „Dank sagen wir alle<br />
Gott“ (Schlusschor der Weihnachtshistoria),<br />
das „Kyrie“ und „Agnus Dei“<br />
aus der „Missa Octavi Toni“ von<br />
Orlando die Lasso, ein „Alleluia“ von<br />
William Boyce, das „Ave verum“ von<br />
Edward Elgar und das „Verleih uns<br />
Frieden gnädiglich“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy<br />
zum Vortrag gebracht.<br />
An der symphonischen Stockmann-Orgel<br />
wurden die Chöre sehr<br />
einfühlsam von Alexander Grötzner<br />
begleitet.<br />
Die Vielfalt der Musik aus verschiedenen<br />
Zeitepochen und das Singen in<br />
einem so großen Chor machten den<br />
Tag für alle Beteiligten zu einem unvergessenen<br />
Erlebnis.<br />
Wir alle freuen uns auf eine Neuauflage<br />
des Dekanatschortreffen in zwei<br />
Jahren.<br />
Andreas Koch<br />
31<br />
Berichte und Nachrichten
Termine<br />
Ausbildungskurs Kinderchorleitung<br />
Im Frühjahr 2007 beginnt ein erster, über ein Jahr sich erstreckender Lehrgang<br />
„Kinderchorleitung“. Zur Zielgruppe gehören LeiterInnen von Kinder- und<br />
Jugendchören, Singgruppen und Singkreisen, ErzieherInnen,<br />
GrundschullehrerInnen, GemeindereferentenInnen und alle, die mit Kindern<br />
und Jugendlichen musikalisch arbeiten wollen.<br />
Der Eignungstest findet am 10. März 2007 in <strong>Paderborn</strong> statt. Die Kursgebühr<br />
beträgt 150,– € .<br />
Weitere Informationen erhalten Sie über das Referat <strong>Kirchenmusik</strong> (s. Anschriften)<br />
oder über die Internetseite des Referats (www.<strong>Kirchenmusik</strong>-<strong>Erzbistum</strong>-<br />
<strong>Paderborn</strong>.de oder Startseite des <strong>Erzbistum</strong>s <strong>Paderborn</strong>, Button oben rechts).<br />
Weiterbildungsveranstaltungen<br />
Bildungstage für <strong>Kirchenmusik</strong><br />
Zielgruppe: Alle Interessierten<br />
Ort: Kath. Akademie Schwerte<br />
Zeit: Dienstag, 2. Januar 2007 bis Freitag, 5. Januar 2007<br />
Thematik: Dietrich Buxtehude und Jean Langlais<br />
Referenten: Daniel Beckmann, Franz-Josef Breuer, Jörg Kraemer, Helga Lange,<br />
Dr. Paul Thissen<br />
Kosten: 150,– €<br />
Orgel<strong>im</strong>provisation in der liturgischen Praxis<br />
Zielgruppe: alle nebenamtlichen Organisten<br />
Termin: Samstag, 27. Januar 2007, 10.00-16.00 Uhr<br />
Ort: Castrop-Rauxel, Pfarrkirche St. Lambertus<br />
Referent: Christian Vorbeck<br />
32
Termin: Samstag, 24. Februar 2007, 10.00-16.00 Uhr<br />
Ort: Rheda-Wiedenbrück, Pfarrkirche St. Clemens<br />
Referent: Markus Breker<br />
Termin: Samstag, 24. März 2007, 10.00-16.00 Uhr<br />
Ort: Bielefeld, Pfarrkirche Heilig-Geist<br />
Referent: Peter Wagner<br />
Termin: Samstag, 28. April 2007, 10.00-16.00 Uhr<br />
Ort: Olpe, Pfarrkirche St. Martinus<br />
Referent: Christian Vorbeck<br />
Termin: Samstag, 02. Juni 2007, 10.00-16.00 Uhr<br />
Ort: Iserlohn, Pfarrkirche St. Aloyisius<br />
Referent: Markus Breker<br />
Termin: Samstag, 16. Juni 2007, 10.00-16.00 Uhr<br />
Ort: Meschede, Pfarrkirche St. Walburga<br />
Referent: Peter Wagner<br />
Themen: Vor-, Zwischen- und Nachspiele nach dem Orgelbuch bzw. auf der<br />
Basis eigener Harmonisierung (Präludium, Meditation, Cantus<br />
coloratus, Toccata und weitere Charakterstücke, Spieltipps und<br />
Registrierung)<br />
Choräle, Kehrverse, Antwortgesänge, Halleluja-Rufe und Psalmen<br />
Improvisieren größerer Formen (Concerto, Rondo, Sonatenhauptsatzformen)<br />
Referenten: Markus Breker, Herne<br />
Christian Vorbeck, Witten<br />
Peter Wagner M.A., Minden<br />
33<br />
Termine
Termine<br />
Liturgiegesang:<br />
„Deus in adiutorium meum intende“ (Psalm 69)<br />
Zielgruppe: Interessierte Sängerinnen und Sänger<br />
Ort: St. Patrokli-Dom, Soest<br />
Zeit: Freitag, 09. 03. 2007, 18.00 bis 21.30 Uhr<br />
Thematik: Eröffnungsgottesdienst <strong>im</strong> Hochchor –<br />
Gestaltet von der Schola an St. Patrokli<br />
Vortrag und Gedankenaustausch –<br />
Einst<strong>im</strong>miger Liturgiegesang von der Urkirche bis heute<br />
Gemeinsame musikalische Arbeit –<br />
Einüben von deutschen und lateinischen Gesängen<br />
Komplet <strong>im</strong> Hochchor –<br />
Gestaltet von den Teilnehmern<br />
Referenten: Roland Krane, Christian Vorbeck<br />
Tipps und Tricks<br />
der Chor-Einstudierung<br />
Zielgruppe: aktive Teilnahme für Chorleiter und C-Kurs-Absolventen, passive<br />
Teilnahme von interessierten Chorleitern und Sängern<br />
Ort: Rheda-Wiedenbrück, St. Clemens, Wilhelmstr.<br />
Zeit: Samstag, 10. März 2007, 10-19 Uhr<br />
Ort: Siegen, St.-Joseph-Kirche, Weidenauer Str.<br />
Zeit: Samstag, 28. April 2007, 10-19 Uhr<br />
Anmeldung bis 2 Wochen vor dem Termin<br />
Jeweils max<strong>im</strong>al 5 aktive Teilnehmer<br />
Noten werden nach der Anmeldung zugesandt<br />
34
Thematik: Klaviereinsatz (auch) in der a-capella Literatur<br />
Mitspielen? - „Chorpraktisches“ Klavierspiel;<br />
Einstudierungsmodelle an Hand leichter romantischer Chormusik;<br />
Tonsilben und Decksilben und ihre Einsatzmöglichkeiten;<br />
Übetechniken für schwere Stellen wie Intervalle, Überbindungen,<br />
Koloraturen, Akkordverbindungen usw.;<br />
Aufführung der Kursteilnehmer u. a. mit den „Drei geistlichen Liedern“<br />
von Felix Mendelssohn-Bartholdy für Alt, Chor und Orgel in<br />
der Vorabendmesse<br />
Referenten: Franz-Josef Breuer, Harald Gokus, Johannes Krutmann,<br />
Gregor Schwarz<br />
Kosten: für Verpflegung<br />
Orgelbau<br />
Zielgruppe: Alle Interessierten<br />
Ort: St. Nikolaus, Arnsberg-Rumbeck<br />
Zeit: Samstag, 24. März 2007, 10.00-13.00 Uhr<br />
Thematik: Die Klausing-Orgel in der St. Nikolaus-Kirche in Arnsberg-Rumbeck<br />
Die Orgel der St. Nikolaus-Kirche in Arnsberg-Rumbeck wurde 1700<br />
von dem Herforder Orgelbauer Hinrich Klausing unter Verwendung<br />
älteren Pfeifenmaterials erbaut. Im Laufe ihrer Geschichte erfuhr<br />
das Instrument mehrere Erweiterungen und Überformungen. 2006<br />
wurde die Orgel durch die Firma Gebr. Hillebrand (Hannover) restauriert.<br />
Die Annäherung an den Zustand von 1700 in klanglicher<br />
und technischer Hinsicht war ein zentrales Restaurierungsziel. Jedoch<br />
wurden auch die Ergänzungen des 19. Jahrhunderts <strong>im</strong> Sinne<br />
eines gewachsenen Zustands in das Restaurierungskonzept integriert.<br />
Auf dem Programm des Workshops stehen eine klangliche Vorführung,<br />
die Erläuterung der Geschichte und die Restaurierung sowie<br />
35<br />
Termine
Termine<br />
praktische Fragestellungen bezüglich der Verwendung einer Orgel<br />
mit verschiedenen historischen Schichten <strong>im</strong> liturgischen Alltag.<br />
Referenten: OBM Martin Hillebrand<br />
Thomas Niemand<br />
Jörg Kraemer<br />
Werkwoche<br />
Zielgruppe: C-Kurs-Teilnehmerinnen und Interessierte<br />
Ort: Bildungsstätte Liborianum, <strong>Paderborn</strong><br />
Zeit: Dienstag, 10. April 2007 bis Samstag, 14. April 2007<br />
Thematik: Musikgeschichte und Orgelbau<br />
Referenten: Jörg Kraemer, Dr. Paul Thissen<br />
Orgel-Interpretationskurs<br />
Zielgruppe: Haupt- und nebenberufliche <strong>Kirchenmusik</strong>er/innen, Studierende<br />
Ort: St. Meinolf-Kirche, Hagen<br />
Zeit: Samstag, 12. Mai 2007, 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr<br />
Thematik: Galante Elemente in den Leipziger Werken J. S. Bachs<br />
Referent: Prof. Jean-Claude Zehnder (Basel)<br />
Kosten: 10,– €<br />
Anmeldeschluss: 30. April 2007<br />
Jean-Claude Zehnder (*1941 in Winterthur) ist ein Schweizer Organist und Musikwissenschaftler.<br />
Zehnder studierte am Konservatorium seiner He<strong>im</strong>atstadt,<br />
an der Universität Zürich, sowie an der Musikakademie Wien bei Anton Heiler<br />
und in Amsterdam bei Gustav Leonhardt. Seit 1972 leitet er eine Orgelklasse an<br />
der Schola Cantorum Basiliensis un ist Organist an der Silbermann-Orgel <strong>im</strong><br />
Dom zu Arleshe<strong>im</strong>. Er veröffentlichte zahlreiche CD-Einspielungen und trat mit<br />
wissenschaftlichen Publikationen zum Frühwerk Johann Sebastian Bachs hervor.<br />
Hierfür wurde ihm 2002 die Ehrendoktorwürde der Universität Dortmund<br />
verliehen.<br />
Referentenkonzert am Freitag, 11. Mai 2007 um 20.00 Uhr (St. Meinolf-Kirche,<br />
Hagen)<br />
36
Geistliche Musik <strong>im</strong> <strong>Erzbistum</strong> <strong>Paderborn</strong><br />
Hoher Dom<br />
Das Kapitelsamt zum Fest der Heiligen Familie am Sonntag, 31. Dezember um<br />
10.00 Uhr wird musikalisch vom Domchor mit der Missa Papae Marcelli von<br />
Giovanni P. da Palestrina gestaltet. Die Leitung hat während dieses Kapitelsamtes<br />
zum letzten Mal Domkapellmeister Theodor Holthoff, der am 1.. Januar<br />
2007 seinen wohlverdienten Ruhestand antritt.<br />
Der Stellenantritt von Domkapellmeister Thomas Berning findet <strong>im</strong> Kapitelsamt<br />
am Sonntag, den 21. Januar um 10.00 Uhr <strong>im</strong> Hohen Dom statt. Der Domchor<br />
singt die Missa Brevis in F-Dur von Joseph Haydn sowie „Laudate Dominum“<br />
von Wolfgang Amadeus Mozart; ferner werden die Kirchensonate F-Dur KV 244<br />
von Mozart sowie Orgelwerke von Bach aufgeführt.<br />
Domkonzert<br />
Freitag, 11. Mai 2007 19.30 Uhr<br />
Joseph Haydn (1732-1809): Trompetenkonzert Es-Dur sowie „Theresienmesse“<br />
B-Dur<br />
N.N., Solisten<br />
Kammerphilharmoniker Kaiserpfalz<br />
Leitung: Domkapellmeister Thomas Berning<br />
Orgelmusik <strong>im</strong> Hohen Dom<br />
Angelus-Matinéen<br />
30 Minuten Orgelmusik an den Domorgeln – Eintritt frei<br />
Jeden Samstag findet <strong>im</strong> Hohen Dom ein Mittagsgebet (Angelus) mit einem<br />
Domkapitular statt; anschließend wird 30 Minuten Orgelmusik an den Domorgeln<br />
angeboten. Interpret ist bis auf wenige Ausnahmen Gereon Krahforst.<br />
Der Eintritt ist frei. Am Karsamstag fällt die Matinée aus.<br />
Die jeweiligen Programme mit Orgelmusik sind den Internetseiten der Dom-<br />
37<br />
Termine
Termine<br />
musik (www.paderborner-dommusik.de) oder wöchentlich veröffentlichten Plakaten<br />
zu entnehmen. Hauptsächlich erklingen <strong>im</strong> Jahr 2007 neben dem gesamten<br />
Orgelwerk Dietrich Buxtehudes (1637-1707) viele Orgelwerke von Jean<br />
Langlais (1907-1991) und Karl Höller (1907-1987).<br />
Internationale Orgelkonzerte <strong>im</strong> Hohen Dom zu <strong>Paderborn</strong><br />
<strong>im</strong> ersten Halbjahr 2007<br />
Montag, 8. Januar, 19.30 Uhr<br />
Stefan Emmanuel Knauer, Bad Lippspringe<br />
Eintritt: 6,– € bzw. 4,– €<br />
Montag, 12. Februar, 19.30 Uhr<br />
Serge Schoonbroodt, Warsage/Belgien<br />
Eintritt: 6,– € bzw. 4,– €<br />
Montag, 12. März, 19.30 Uhr<br />
Bruder Andreas Warler SDS, Basilika Steinfeld/Eifel<br />
Eintritt: 6,– € bzw. 4,– €<br />
Montag, 16. April, 19.30 Uhr<br />
Domorganist Gereon Krahforst, <strong>Paderborn</strong><br />
(Petr Eben: Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens für Orgel und<br />
Sprecher)<br />
Monika Lipsewers, Rezitation<br />
Eintritt: 6,– € bzw. 4,– €<br />
Montag, 14. Mai, 19.30 Uhr<br />
Thierry Escaich, Paris<br />
Eintritt: 6,– € bzw. 4,– €<br />
Montag, 11. Juni, 19.30 Uhr<br />
Domorganist Gereon Krahforst, <strong>Paderborn</strong><br />
Eintritt: 6,– € bzw. 4,– €<br />
38
Attendorn, St. Johannes Baptist<br />
Sonntag, 4. Februar 17.00 Uhr, Collegium Bernardinum<br />
Konzert für Trompete und Orgel<br />
Orgel: Helga Bauer<br />
Trompete: Ingo Samp<br />
Sonntag, 4. März 16.30 Uhr<br />
Konzert zum 2. Fastensonntag<br />
Mendener Kantorei<br />
Leitung: Johannes Krutmann<br />
Sonntag, 18. März 16.30 Uhr<br />
Passionskonzert<br />
Attendorner Kammerorchester (Ltg.: Werner Fichten) & Orgel (Helga Lange)<br />
Karfreitag, 6. April 15.00 Uhr<br />
Passionsmotetten der Renaissance mit dem Projektchor<br />
Leitung: Helga Lange<br />
Samstag, 7. April 21.00 Uhr<br />
Osternacht mit Trompete (Ingo Samp) und Orgel (Helga Lange)<br />
und einer Schola<br />
Sonntag, 8. April 10.30 Uhr<br />
Der Franziskus-Chor singt während des Hochamtes Motetten zur Osterzeit<br />
Sonntag, 20. Mai 17.00 Uhr<br />
Orgelkonzert zu österlichen und pfingstlichen Themen<br />
Orgel: Helga Lange<br />
39<br />
Termine
Termine<br />
St. Jodokus, Bielefeld<br />
Sonntag, 4. Februar 2007, 16.00 Uhr<br />
Chorkonzert<br />
Zum 25-jährigen Bestehen des Lüdenscheider Vokalensembles<br />
Sonntag, 11. März 2007, 17.00 Uhr<br />
Orgelkonzert<br />
Georg Gusia spielt Werke von Max Reger (Choralfantasie „Straf’ mich nicht in<br />
deinem Zorn“), Trios op. 47, Stücke aus op. 129 und op. 63, Choralfantasie „Alle<br />
Menschen müssen sterben“)<br />
Eintritt 5,–/3,– €<br />
Karfreitag, 6. April 2007, 15.00 Uhr<br />
Feier vom Leiden und Sterben Christi, darin<br />
Leonhard Lechner (1553-1606) – Das Leiden unseres Herrn Jesu Christi<br />
aus dem Evangelisten Johannes anno 1594 und Motetten von Vittoria, Obrecht<br />
und Palestrina<br />
Ausführende: Vokalkreis St. Jodokus<br />
Ltg. Georg Gusia<br />
Ostermontag, 9. April 2007, 10.00 Uhr<br />
Festhochamt<br />
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) – Mass in G-minor (1922)<br />
Ausführende: Kammerchor St. Jodokus<br />
Ltg. Georg Gusia<br />
Sonntag, 20. Mai 2007, 10.00 Uhr<br />
Hochamt<br />
Anton Dvorak (1841-1904) – Messe in D-Dur, op. 86 für Chor und Orgel<br />
Ausführende: Kirchenchor St. Jodokus<br />
Ltg. Georg Gusia<br />
40
Sonntag, 3. Juni 2007. 17.00 Uhr<br />
Orgelkonzert<br />
Georg Gusia spielt Werke von deutscher und französischer Romantik (Franz Liszt<br />
– Fantasie und Fuge über „Ad nos, ad salutarem undam“; Louis Vierne – Symphonie<br />
Nr. 6)<br />
Sonntag, 17. Juni 2007, 20.30 Uhr<br />
Breezy-art-ensemble spielt „Bach und ich“<br />
Detlef Re<strong>im</strong>ers-Quartett<br />
Collegium Bernardinum Attendorn, Nordwall 26<br />
Sonntag, 04.02.2007, 17.oo Uhr<br />
Orgel und Trompete<br />
Helga Lange, Orgel<br />
Ingo Samp, Trompete<br />
Kapelle<br />
Sonntag, 25.03.2007, 17.00 Uhr<br />
Konzert für Klavier und Violine<br />
Tobias Bigger, Klavier<br />
Inna Kogan, Violine<br />
Aula<br />
Mittwoch, 02.05.2007, 19.30 Uhr<br />
Orgel und Gesang<br />
Daniel Beckmann, Orgel<br />
Christina Beckmann, Sopran<br />
Kapelle<br />
41<br />
Termine
Termine<br />
St. Johannes Baptist, <strong>Paderborn</strong>-Wewer<br />
Sonntag, 14. Januar 2007, 11.00 Uhr<br />
4. Orgelmatinée<br />
Regina Werbick, Detmold<br />
Sonntag, 11. Februar 2007, 11.00 Uhr<br />
5. Orgelmatinée<br />
Franz Liszt: Fantasie und Fuge über „Ad nos, ad salutarem undam“<br />
Su-Jin Back, Detmold<br />
Samstag, 24. Februar 2007, 19.30 Uhr<br />
Matthias Schlubeck, Panflöte<br />
Dietmar Mettlach, Orgel<br />
11. Orgelzyklus<br />
Sonntag, 11. März 2007, 17.00 Uhr<br />
N. N.<br />
Sonntag, 18. März 2007, 17.00 Uhr<br />
DKM Johannes Krutmann, Hamm<br />
Sonntag, 25. März 2007, 17.00 Uhr<br />
Domkapellmeister Thomas Berning, <strong>Paderborn</strong><br />
Sonntag, 13. Mai 2007, 17.00 Uhr<br />
Alte Musik in solistischer Besetzung<br />
Deutsche Vocal-Concertisten:<br />
Christina Beckmann, Sopran (<strong>Paderborn</strong>)<br />
Alexandra Rawohl, Mezzosopran (Basel)<br />
Ulrich Cordes, Tenor (Köln)<br />
Andreas Wolf, Bass (Detmold)<br />
Daniel Beckmann, Leitung und Truhenorgel<br />
42
Donnerstag, 17. Mai 2007, 10.00 Uhr<br />
Festhochamt Christi H<strong>im</strong>melfahrt<br />
Olivier Messiaen: L’Ascension (H<strong>im</strong>melfahrt)<br />
Daniel Beckmann, Orgel<br />
Sonntag, 20. Mai 2007, 11.00 Uhr<br />
6. Orgelmatinée<br />
Dominik König, Detmold<br />
Sonntag, 3. Juni 2007, 17.00 Uhr<br />
Geistliche Abendmusik<br />
Barocke Cellosonaten<br />
Caroline Busser, Violoncello;<br />
Daniel Beckmann, Truhenorgel<br />
Sonntag, 10. Juni 2007, 11.00 Uhr<br />
7. Orgelmatinée<br />
Benno Schachtner, Detmold<br />
Dortmund, Propsteikirche<br />
Sonntag, 4. Februar 19.30 Uhr<br />
Konzert mit Studenten/-innen der Universität Dortmund<br />
Ltg.: Prof. Dr. Eva-Maria Houben<br />
Sonntag, 4. März 19.30 Uhr<br />
Propstei-Trio Dortmund<br />
(Orgel – Violine – Gesang)<br />
Sonntag, 6. Mai 19.30 Uhr<br />
Orgelkonzert<br />
Dr. Martin Patzlaff<br />
Sonntag, 15. Mai<br />
Bläserensemble Huckarde-Kirchlinde/Rahm<br />
Ltg. Carsten Schlagowski<br />
Orgel: Wolfgang Hohmann<br />
43<br />
Termine
Termine<br />
Sonntag, 3. Juni 19.30 Uhr<br />
Orgelkonzert<br />
Gerard Habraken<br />
(Eindhoven/Holland)<br />
St. Patrokli, Soest<br />
Sonntag, 18. März 2007<br />
Orgelmatinée<br />
Roland Krane<br />
Sonntag, 17. Juni 2007<br />
Orgelmatinée<br />
Engelbert Schön<br />
St. Martinus, Olpe<br />
Sonntag, 28. Januar 2007, 17.00 Uhr<br />
Geistliches Konzert<br />
„Voices St. Martinus“, Kirchenchor St. Martinus<br />
Leitung Dieter Moers<br />
Sonntag, 11. Februar 2007, 9.30 Uhr<br />
Festhochamt St. Agatha<br />
Messe breve C (Gounod)<br />
Kirchenchor St. Martinus<br />
Pfingstmontag, 28. Mai 2007, 17.00 Uhr<br />
Geistliches Konzert mit<br />
Frauenchor „Vocale unisono“<br />
44
St. Clemens, Rheda-Wiedenbrück<br />
Geistliche Abendmusik<br />
Jeweils am ersten Freitag <strong>im</strong> Monat um 18.30 Uhr in den Monaten September<br />
2006 bis Mai 2007<br />
Orgelmusik zum Feierabend<br />
An jedem Freitag um 18.30 Uhr in den Monaten Juni, Juli und August 2007<br />
Minden, Dom<br />
Passionskonzert<br />
Mittwoch, 28. März, 19.30 Uhr, Dom<br />
Bielefelder Streichquartett, Orgel: Peter Wagner M.A.<br />
Historische Stadtführung mit Orgelkonzert:<br />
Sonntag, 6. Mai 15.30 Uhr, Dom (Konzert: 17.00 – 17.45 Uhr)<br />
Orgel: Peter Wagner M.A.<br />
Sonntag, 13. Mai 15.30 Uhr, St. Martini (Konzert 17.00 – 17.45 Uhr)<br />
Orgel: Wolfgang Lüschen<br />
Sonntag, 20. Mai 15.30 Uhr, St. Martini (Konzert 17.00 – 17.45 Uhr)<br />
Orgel: Manuel Doormann<br />
Vortrag „Salve Regina – Mit Maria durch das Jahr II“ / Mariensingen<br />
Mittwoch, 9. Mai, 15-30 – 16-30 Uhr, Haus am Dom<br />
Referent: Peter Wagner M.A.<br />
Festkonzert zum Domjubiläum:<br />
Dienstag, 26. Juni, 19.30 Uhr, Dom<br />
Domchor, Christuskantorei, Tookula-Kinderchor, Blue Lake Symphonic Orchestra,<br />
Michigan (USA)<br />
45<br />
Termine
Termine<br />
St. Joseph, Siegen-Weidenau<br />
Jeden 2. Sonntag <strong>im</strong> Monat nach dem Hochamt 10.40 – 11.10 Uhr: Matinee<br />
Das Programm wird in Presse und Pfarrnachrichten veröffentlicht.<br />
Sonntag, 28. Januar 2007, 18.00 Uhr<br />
D. Buxtehude: Magnificat<br />
G. F. Händel: Konzert für Orgel und Orchester op. 4 Nr. 4<br />
W. A. Mozart: Offertorium „Misericordias Domini“<br />
U. von Wassenaer: Concertino II für Orchester<br />
Joseph Haydn: Mariazeller-Messe<br />
Camerata Instrumentale Siegen<br />
Maryam Haiawi, Orgel<br />
Kammerchor Weidenau<br />
Leitung: Franz-Josef Breuer<br />
Sonntag, 18. Februar 2007, 18.00 Uhr<br />
„Crossover“ - Konzert für Orgel, E-Gitarre und Schlagzeug<br />
Peter Blaschke (E-Gitarre), Michael Blaschke (Schlagzeug) und Michael Störmer<br />
(Orgel).<br />
Sonntag, 18. März 2007, 18.00 Uhr<br />
Passionsmusik<br />
J. Rheinberger: Stabat Mater<br />
F. Mendelssohn-Bartholdy: O Lamm Gottes<br />
Orgelwerke<br />
Kammerchor Weidenau<br />
Leitung und Orgel: Franz-Josef Breuer<br />
Sonntag, 20. Mai 2007, 18.00 Uhr<br />
Marianische Chor- und Orgelmusik<br />
Kammerchor Weidenau<br />
46
St. Marien, Schwerte<br />
Kleine Festwoche anlässlich des 40. Geburtstages der Marienorgel<br />
• Sonntag, 4. Februar, 20.00 Uhr<br />
Orgelkonzert – César Franck und Alexandre Guilmant<br />
zwei große Pariser Organisten<br />
Orgel: Michael Störmer<br />
• Dienstag, 6. Februar, 20.00 Uhr<br />
Gespräch an der Orgel<br />
Werke von Bach, Mendelssohn u. a.<br />
Orgel: Michael Störmer<br />
• Donnerstag, 8. Februar, 20.00 Uhr<br />
Heiteres zu Karneval aus der Orgelszene<br />
Orgel: Michael Störmer<br />
• Sonntag, 11. Februar, 17.00 Uhr<br />
Orgelmusik aus Barock, Klassik und Romantik zu zwei und vier Händen<br />
Orgel: Klaus Irmscher, Michael Störmer<br />
Sonntag, 11. März, 17.00 Uhr<br />
Orgelkonzert zur Fastenzeit<br />
mit Werken von Scheidemann, Klicka u. a.<br />
Orgel: Thomas Flegr<br />
Sonntag, 25. März, 18.00 Uhr in St. Antonius<br />
Orgelmusik zum Kreuzweg<br />
mit Werken von Bach, Reger u. a.<br />
Orgel: Michael Störmer<br />
47<br />
Termine
Termine<br />
St. Walburga, Meschede<br />
Da bei Redaktionsschluss noch keine Entscheidung über die anstehende Innenrenovierung<br />
der Pfarrkirche Mariä H<strong>im</strong>melfahrt getroffen war, so kann es möglich<br />
sein, dass die für diese Kirche vorgesehenen Veranstaltungen nach St. Walburga<br />
verlegt werden müssen.<br />
Näheres erfahren Sie auf unserer Internetseite www.st-walburga-meschede.de<br />
Sonntag, 21. Januar, 17.00 Uhr – Pfarrkirche St. Walburga<br />
Teilnehmerkonzert des C-Kurses<br />
Sonntag, 25. Februar, 18.00 Uhr – Pfarrkirche St. Walburga<br />
Patronatsfest<br />
Katholischer Kirchenchor Meschede, & Capella Instrumentalis<br />
Charles Gounod: Messe Brève Nr. 5, Motetten von Palestrina, Faulstich,<br />
Ehlert u. a.<br />
Sonntag, 11. März, 17.00 Uhr – Pfarrkirche St. Walburga<br />
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater Dolorosa<br />
Ruth Fiedler – Sopran<br />
Moritz von Cube – Altus<br />
Ensemble Amontillado auf historischen Instrumenten<br />
Samstag, 31. März, 19.30 Uhr – Pfarrkirche St. Walburga<br />
Kantorei St. Johannes Bremen-Sodenmatt; Ltg. Uwe Emshoff<br />
Christoph Demantius: Johannespassion<br />
Montag, 9. April, 17.00 Uhr – Pfarrkirche St. Walburga<br />
Heinrich Schütz: Auferstehungshistorie<br />
Solisten<br />
Auswahlchor des Katholischen Kirchenchors Meschede<br />
Ensemble Amontillado auf historischen Instrumenten<br />
48
Sonntag, 22. April, nachmittags – Pfarrkirche Mariä H<strong>im</strong>melfahrt<br />
10 Jahre Partnerschaft mit Peru<br />
Musik in & um die Kirche mit verschiedenen Gruppen der Gemeinde<br />
Samstag, 30. Juni, 19.00 – 24.00 Uhr – Pfarrkirche St. Walburga<br />
Eine kleine geistliche Nachtmusik<br />
Orgel-, Chor- und Clavichordmusik<br />
als Gast: Schirin Partowi (Gesang) & Harry Hoffmann (Laute)<br />
jeden Freitag: 11.00-11.30 Uhr – Pfarrkirche St. Walburga<br />
Musik zur Marktzeit<br />
30 Minuten Musik in verschiedenen Besetzungen<br />
St. Bonifatius, Herne<br />
Sonntag, 18. März 2007, 17.00 Uhr<br />
Orgelkonzert<br />
Markus Breker, Herne<br />
St. Nicolai, Lippstadt<br />
Sonntag, 28. Januar 2007, 16.30 Uhr<br />
Großes Chor- und Orchesterkonzert<br />
Chor- und Orchesterkonzert<br />
ELIAS-Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy:<br />
Julia Heße, Sopran<br />
Stephanie Firnhes, Alt<br />
Joach<strong>im</strong> Keuper, Tenor<br />
Alexander Knop, Bass<br />
Chor an St. Nicolai<br />
Kammerchor Lippstadt<br />
Leitung: Harduin Boeven<br />
49<br />
Termine
Termine<br />
Samstag, 16. Juni 2007, 20.00 Uhr<br />
„Hebe Deine Augen auf...“<br />
Geistliche Vokal- und Orgelwerke von Felix Mendelssohn-Bartholdy<br />
Ensemble Cadenza<br />
Harduin Boeven, Orgel<br />
Nähere Informationen zu diesen Konzerten und über Gottesdienstgestaltungen<br />
finden Sie unter www.musik-in-st-nicolai-lippstadt.de.<br />
St. Marien, Hagen<br />
Donnerstag, 04. Januar 2007, 18.00 Uhr<br />
Weihnachtslieder op. 8<br />
von Peter Cornelius (1824-1874)<br />
Donnerstag, 01. Februar 2007, 18.00 Uhr<br />
„Der Psalter Davids“ nach Cornelius Becker<br />
von Heinrich Schütz (1585-1672)<br />
Donnerstag, 01.März 2007, 18.00 Uhr<br />
Cantabo Domino aus Finnentrop-Heggen<br />
3. Mai 2007, 18.00 Uhr<br />
Messe brève von Léo Delibes (1863-1891)<br />
für Frauenst<strong>im</strong>men und Orgel<br />
31. Mai 2007, 18.00 Uhr<br />
Pfingstmotetten<br />
Ensemble Marien<br />
Termine und Informationen: www.st-marien-hagen-mitte.de<br />
50
St. Meinolf, Hagen<br />
Samstag, 03. März 2007, 20.00 Uhr<br />
Orgelkonzert mit Michail Markuscewski, Warschau<br />
Buxtehude, Bach, Franck, Improvisationen<br />
Samstag, 31. März 2007, 20.00 Uhr<br />
Passionskonzert mit Helmut Schröder, Orgel<br />
Dupré, Brahms, Liszt<br />
Freitag, 11. Mai 2007, 20.00 Uhr<br />
Orgelkonzert mit Jean-Claude Zehnder, Basel<br />
Samstag, 12. Mai 2007<br />
Orgelkonzert mit Helmut Schröder<br />
Bach/Middelschulte: Chaconne in d-moll,<br />
J. S. Bach „Musikalisches Opfer“<br />
Freitag, 23. Juni 2007, 20.00 Uhr<br />
Orgelkonzert mit Burkard Ascherl, Bad Kissingen<br />
St. Marien, Witten<br />
Sonntag, 1. Januar 2007, 10.00 Uhr, Neujahr<br />
Orgelmesse<br />
Sonntag, 4. Februar 2007, 10.00 Uhr, 5. Sonntag <strong>im</strong> Jahreskreis<br />
Orgelmesse<br />
Sonntag, 4. März 2007, 10.00 Uhr, 2. Fastensonntag<br />
Orgelmesse<br />
Sonntag, 6. Mai 2007, 10.00 Uhr, 5. Ostersonntag<br />
Orgelmesse<br />
51<br />
Termine
Termine<br />
Sonntag, 3. Juni 2007, 10.00 Uhr, Dreifaltigkeitsfest<br />
Orgelmesse<br />
www.marien-witten.de<br />
Johanneskirche, Witten<br />
Johann Sebastian Bach: Konzert-Triduum 2007<br />
Christian Vorbeck an der Paschen-Orgel<br />
Alle Konzerte um 19.00 Uhr:<br />
Sonntag, 15. April – Das musikalische Opfer<br />
Mittwoch, 18. April – Goldbergvariationen<br />
Sonntag, 22. April – Die Kunst der Fuge<br />
www.christianvorbeck.de<br />
St. Joh. Baptist, Nehe<strong>im</strong><br />
Sonntag, 14. Januar 2007, 16.30 Uhr<br />
„Der Morgenstern ist aufgegangen“<br />
Orgelkonzert mit Tobias Wittmann, Stuttgart<br />
Sonntag, 25. Februar 2007, 16.00 Uhr<br />
Sinfonisches Konzert<br />
Sinfonieorchester HSK, Leitung Georg Scheuerlein,<br />
Kantor Hartwig Diehl, Orgel<br />
Werke von A. Guilmant u. a.<br />
Sonntag, 18. März 2007, 17.00 Uhr<br />
Orgelkonzert zur Passionszeit<br />
DKM Hartwig Diehl, Arnsberg; DKM Mark Ehlert, Meschede;<br />
DKM Werner Komischke, Medebach<br />
Sonntag, 13. Mai 2007, 20.00 Uhr<br />
„LA MUSIQUE DU ROI“<br />
52
Musik am Hofe von Versailles von Marais, Couperin u. a.<br />
Ensemble PASSAGGIATA<br />
Sonntag, 3. Juni 2007, 19.00 Uhr<br />
(in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena, Arnsberg-Bruchhausen)<br />
„THE MESSIAH“<br />
Oratorium von Georg Friedrich Händel in englischer Sprache und historischer<br />
Aufführungspraxis<br />
Gerburg Krapf-Lumpe, Sopran; Franziska Orendi, Alt; Thomas Iwe, Tenor; Thomas<br />
Peter, Bass<br />
Le Nuove Musici, Detmold<br />
Der Neue Chor, Nehe<strong>im</strong>; Ensemble „Kontrapunkt“, Bonn<br />
Leitung: Kantor Hartwig Diehl<br />
Alle Konzerttermine sind <strong>im</strong> Jahresprogramm RESONANZ 2007 ausgedruckt.<br />
Aktuell informiert Sie auch das Internet: www.st-johannes-nehe<strong>im</strong>.de<br />
St. Peter und Paul, Medebach<br />
Sonntag, 11. Februar 2007, 18.00 Uhr<br />
Orgelkonzert<br />
Werner Komischke spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude,<br />
Charles-Marie Widor, Louis Vierne und Olivier Messiaen.<br />
Sonntag, 29. April 2007, 18.00 Uhr<br />
Orgelkonzert<br />
Es spielen Schüler des C-Kurses<br />
Liebfrauenkirche Hamm<br />
Sonntag, 28. Januar 2007, 19.00 Uhr<br />
Orgelmesse<br />
An der Orgel: DKM Georg Hellebrandt (Hagen)<br />
53<br />
Termine
Termine<br />
Sonntag, 25. Februar 2007, 19.00 Uhr<br />
Orgelmesse zum 1. Fastensonntag<br />
An der Orgel: Tobias Lehmenkühler (Hamm)<br />
Sonntag, 25. März 2007, 19.00 Uhr<br />
Orgelmesse zum 5. Fastensonntag<br />
An der Orgel: DKM Roland Krane (Soest)<br />
Donnerstag, 5. April 2007, 22.00 Uhr<br />
Tenebrae zum Gründonnerstag<br />
Dietrich Buxtehude: „Membra Jesu nostri“<br />
Cappella vocale Liebfrauen, Ensemble „La Finetta“<br />
Leitung: Johannes Krutmann<br />
Samstag, 7. April 2007, 21.00 Uhr<br />
Osternacht<br />
Doppelchörige Motetten<br />
und geistliche Konzerte des 17. und 18. Jahrhunderts<br />
Kirchenchor Liebfrauen und Solisten<br />
Sonntag, 29. April 2007, 17.00 Uhr<br />
Missa Salisburgensis<br />
Messe zu 53 St<strong>im</strong>men in 8 Chören<br />
Veronika Winter (Sopran), Franz Vitzthum, Beat Duddeck, Wolfgang S<strong>im</strong>ons (Altus),<br />
Nils Giebelshausen, Ra<strong>im</strong>und Fürst (Tenor), Bach-Chor Hagen, Mendener Kantorei<br />
Barockorchester Münster<br />
Leitung: Johannes Krutmann<br />
Sonntag, 27. Mai 2007, 19.00 Uhr<br />
Orgelmesse zum Pfingstfest<br />
Orgel: DKM Johannes Krutmann (Hamm)<br />
54
Neue Orgeln<br />
Liebfrauenkirche Hamm<br />
Die neue Orgel der Liebfrauenkirche Hamm wurde am 1. Oktober 2006 durch<br />
Weihbischof Wiesemann geweiht. Die Disposition umfasst 52 Register auf drei<br />
Manualen und Pedal. Die Prospektgestaltung des Instrumentes ist geprägt<br />
durch schlichte, klare Formen, die sich an den architektonischen Vorgaben des<br />
Kirchenraums orientieren. Dem schlichten Äußeren steht eine aufwändige und<br />
subtile Detailgestaltung gegenüber. Durch die Ganzglasbrüstung der Empore<br />
ist die Prospektfront komplett sichtbar, in seinen Abmessungen wirkt das große<br />
Instrument nicht überd<strong>im</strong>ensioniert, sondern bildet einen überzeugenden<br />
Raumabschluss.<br />
Das klangliche Konzept sah von Beginn der Planungen folgende Grundanforderungen<br />
vor:<br />
– In allen Manualwerken sollen labiale 16'-Register vorhanden sein; <strong>im</strong> Hauptwerk<br />
als Principal, <strong>im</strong> Positiv als Gedackt, <strong>im</strong> Schwellwerk als Streicher.<br />
– Im Pedal sollen die o. a. 16'-Bauformen als eigene Register auftreten; als tiefstes<br />
Register zusätzlich ein 32'.<br />
– In allen Werken sollen in der 8' Lage ein offenes Register, ein Gedackt und ein<br />
Streicher zur Verfügung stehen; <strong>im</strong> Hauptwerk und Schwellwerk zusätzlich<br />
Soloflöten unterschiedlicher Bauart.<br />
– In allen drei Manualwerken sollen Kornettmischungen vorhanden sein; <strong>im</strong><br />
Hauptwerk als hochgebänktes Solokornett, <strong>im</strong> Positiv als geteiltes Kornett, <strong>im</strong><br />
Schwellwerk als gebundenes Echokornett.<br />
– In den Manualwerken sind Mixturen zu konzipieren; hier sollen die Mixturen<br />
des Hauptwerkes und des Positivs miteinander korrespondieren, während die<br />
Schwellwerksmixtur tiefer liegt und eine andere Charakteristik erhält.<br />
– Im Schwellwerk sind überblasende Flöten 8', 4', 2', Streicherst<strong>im</strong>men 16', 8', 4',<br />
eine Schwebung und die gesamte Palette der Zungenst<strong>im</strong>men erforderlich.<br />
– Jedes Manualwerk erhält einen Tremulanten; das Schwellwerk wird mit einer<br />
Subkoppel ausgestattet.<br />
Damit entstand ein Grundkonzept für eine große Orgel, das in seiner Vollständigkeit<br />
kaum noch Wünsche offen lässt.<br />
55<br />
Orgeln
Orgeln<br />
Der Klang ist geprägt durch große Deutlichkeit, die auch in der üppigen Raumakustik<br />
nie undurchsichtig wird. Eine klare, natürliche Ansprache der Pfeifen<br />
und die Möglichkeiten der <strong>im</strong> besten Sinne sensiblen Traktur (alle Trakturen einschließlich<br />
der durchkoppelnden Subkoppel sind mechanisch) ermöglichen eine<br />
modulationsreiche und expressive Anschlagkultur.<br />
Bereits in den zahlreichen Einweihungskonzerten zeigte sich die große stilistische<br />
Vielfalt des Instrumentes, die in ihrer starken Charakteristik jedoch keineswegs<br />
beliebig wirkt, sondern vielmehr an das Originäre historischer Instrumente<br />
erinnert.<br />
In allen Werken sind u. a. Die labialen 16'-Register gravitätische Grundst<strong>im</strong>men<br />
vorhanden, die Palette der Zungenst<strong>im</strong>men ist vollständig und klangkräftig, die<br />
Mixturen bilden in ihrer Stärke und Helligkeit überzeugende Klangkronen <strong>im</strong><br />
Hauptwerk und Positiv, während die Schwellwerksmixtur zurückhaltender und<br />
progressiv (2-5f) ausgerichtet ist. Die dynamische Wirkung des Schwellwerkes<br />
ist äußerst effektiv und ermöglicht eine enorme dynamische Skala.<br />
Im gesamten Bereich der Klanggestaltung wurde Wert gelegt auf angemessene<br />
und überzeugende, aber dennoch individuelle Lösungen. Dies betrifft sowohl<br />
die Gestaltung von Mensuren, Intonation, Windversorgung und Temperierung<br />
des Instrumentes.<br />
Nach den bekannten Instrumenten der Fa. Goll in Memmingen oder Luzern<br />
setzt die neue Orgel der Liebfrauenkirche Hamm nun <strong>im</strong> <strong>Erzbistum</strong> <strong>Paderborn</strong><br />
neue Maßstäbe.<br />
Disposition der Orgel:<br />
I. HAUPTWERK (C-A’’’): II. POSITIV:<br />
1. Principal 16' 15. Bordun 16'<br />
2. Praestant 8' 16. Principal 8'<br />
3. Doppelflöte 8' 17.Gedackt 8'<br />
4. Rohrflöte 8' 18. Salicional 8'<br />
56
5. Viola da gamba 8' 19. Oktave 4'<br />
6. Octave 4' 20. Koppelflöte 4'<br />
7. Spitzflöte 4' 21. Nasard 2 2 /3'<br />
8. Grosse Terz 3 1 /5' 22. Quarte de Nasar 2'<br />
9. Quinte 2 2 /3' 23. Terz 1 3 /5'<br />
10. Octave 2' 24. Larigot 1 1 /3'<br />
11. Mixtur IV 1 1 /3' 25. Mixtur IV 1'<br />
12. Cornett V 8' 26. Cromorne 8'<br />
13. Fagott 16'<br />
14. Trompete 8' Tremulant<br />
Tremulant<br />
SCHWELLWERK: PEDAL (C-F’):<br />
27. Viola pomposa 16' 42. Contrabass 32'<br />
28. Flûte harmonique 8' 43. Principal 16'<br />
29. Bourdon 8' 44. Violonbass 16'<br />
30. Gambe 8' 45. Subbass 16'<br />
31. Voix céleste 8' 46. Octavbass 8'<br />
32. Flûte octaviante 4' 47. Gedacktbass 8'<br />
33. Viole d’armour 4' 48. Violoncello 8'<br />
34. Echocornett III 2 2 /3' 49. Octave 4'<br />
35. Octavin 2' 50. Posaune 16'<br />
36. Plein jeu II-V 2' 51. Trompete 8'<br />
37. Bombarde 16' 52. Clairon 4'<br />
38. Trompette harm. 8'<br />
39. Basson-Hautbois 8'<br />
40. Voix humaine 8'<br />
41. Clairon harm. 4'<br />
Tremulant<br />
57<br />
Orgeln
Orgeln<br />
Koppeln (mechanisch):<br />
II-I, III-I, III-II<br />
Sub III-III (durchkoppelnd),<br />
I-Ped., II-Ped., III-Ped.<br />
Mechanische Schleifladen,<br />
Registertraktur als mechanisch/elektrische Doppeltraktur mit Setzerkombination<br />
Erbaut 2006 von der Fa. Goll, Luzern<br />
Disposition und Sachbearbeitung:<br />
DKM Johannes Krutmann (Hamm)<br />
Beauftragter für den Orgelbau <strong>im</strong> <strong>Erzbistum</strong> <strong>Paderborn</strong><br />
(Die Festschrift zur Orgelweihe ist zum Preis von 8,– € <strong>im</strong> Pfarrbüro der Kirchengemeinde<br />
Liebfrauen, Liebfrauenweg 2, 59063 Hamm oder bei Johannes<br />
Krutmann erhältlich.)<br />
St. Nikolaus, Arnsberg-Rumbeck<br />
Bereits vor dem Jahr 1191 wurde an der Stelle der heutigen Pfarrkirche ein Stift<br />
der Praemonstratenserinnen gegründet. Die 1205 vollendete Kirche enthält eine<br />
in ihrer Einheitlichkeit außergewöhnliche barocke Innenausstattung, zu der<br />
auch die Orgel zählt, die <strong>im</strong> Jahre 1700 von Hinrich Klausing aus Herford errichtet<br />
wurde.<br />
Es handelt sich um eine über die Jahrhunderte veränderte, in ihrer Grundsubstanz<br />
aber aus dem 17. Jahrhundert stammende Orgel, wie sie für viele kleinere<br />
Kloster- und Stadtkirchen in Westfalen typisch war. Gerade die Orgelbauerfamilie<br />
Klausing hat diesen Typus einer einmanualigen Orgel mit 4'-Prospekt<br />
und etwa 10 Registern bis Mitte des 18. Jahrhunderts in großer Anzahl gebaut.<br />
Da nur noch sehr wenige dieser Instrumente erhalten sind, muss der<br />
Rumbecker Orgel ein besonderer Denkmalwert zugesprochen werden.<br />
58
Laut Inschrift <strong>im</strong> Prospekt wurde die Orgel <strong>im</strong> Jahre 1700 vollendet. Trotz umfangreicher<br />
Bemühungen konnten bislang keine schriftlichen Quellen aus der<br />
Erbauungszeit der Orgel gefunden werden. Hinrich Klausing, der aufgrund der<br />
Signaturen als Orgelbauer gesichert ist, hat bei seinem Neubau umfangreiches<br />
Material einer Vorgängerorgel übernommen. Ein Großteil der Pfeifen des jetzt<br />
wieder neu folierten Praestant 4' entstammt einem spätgotischen Prospekt und<br />
kann anhand von Bauweise und Material bis in die Mitte des 15. Jh. zurück datiert<br />
werden. Auch die Register Gedact 8' und Quinta 3' sind älter und könnten<br />
auf den <strong>im</strong> frühen 17. Jh. <strong>im</strong> Raum Arnsberg tätigen Meister Johann Busse zurückgehen.<br />
Klausing hat <strong>im</strong> Jahre 1700 die fehlenden Töne der kurzen Baßoktave<br />
ergänzt und hinter den Prospektpfeifen aufgestellt. Die Orgel wurde 1830 von<br />
Engelbert Ahmer um ein II. Manualwerk und ein selbständiges Pedal erweitert.<br />
Auch Ahmer hat bei dieser Erweiterung älteres Material aus anderen Orgeln<br />
wieder verwendet. Die Becher der in voller Länge aus Eichenholz gebauten Posaune<br />
16' sind Mitte des 18. Jh. oder sogar noch eher entstanden. Bei der in den<br />
50iger Jahren des letzten Jahrhunderts durchgeführten Restaurierung wurde<br />
das Werk um einige Register erweitert und <strong>im</strong> II. Manualwerk eine neobarocke<br />
Disposition angelegt.<br />
Nach mehrjährigen intensiven Überlegungen konnte die Orgel <strong>im</strong> Zeitraum von<br />
Januar 2005 – Oktober 2006 umfassend restauriert werden, wobei folgende<br />
Aspekte maßgebend waren:<br />
1. Wiederherstellung der ursprünglichen Hinrich Klausing-Orgel von 1700 mit<br />
solistischer Aufstellung des Gehäuses und Rekonstruktion einer anhand vergleichbarer<br />
Instrumente abgeleiteten Disposition. Austausch von 1955 ergänzten<br />
Fremdpfeifen durch material- und mensurgetreue Kopien analog<br />
den historischen Vorbildern. Getrennte Schleifen für Sesquialtera und Trompete,<br />
um ein authentisches Spiel der ursprünglich einmanualigen Orgel zu<br />
ermöglichen.<br />
2. Beibehaltung der <strong>im</strong> 19. Jh. ergänzten Werke und Rückführung auf die nachgewiesene<br />
Disposition. Aufstellung dieser Werke möglichst unauffällig und<br />
räumlich getrennt hinter dem Hauptwerk von 1700.<br />
59<br />
Orgeln
Orgeln<br />
3. Neubau aller drei Windladen als Schleifladen in historischer Bauweise.<br />
Hauptwerkslade mit angeschwänzten Ventilen.<br />
4. Bei den historischen Pfeifen Wiederherstellung der ursprünglichen Aufschnitthöhe<br />
unter weitestgehender Schonung des alten Materials und<br />
Anlängung in einer dem Original nahe kommenden Legierung.<br />
5. Rekonstruktion von Spielanlage und Trakturen in historischer Bauweise und<br />
soweit vorhanden nach historischen Vorbildern.<br />
6. Rekonstruktion einer dreifachen Keilbalganlage nach gegebenem Vorbild<br />
von Hinrich Klausing aus dem Jahre 1699.<br />
HAUPTWERK C, D – C3<br />
Praestant 4' */#/o<br />
Gedact 8' #/o<br />
Duesflaut 4 o<br />
Quint 3' #/o/r<br />
Octav 2' o<br />
Sesquialtera 2fach B+D r<br />
Mixtur 4fach o/r<br />
Trompett 8' B+D r<br />
POSITIV C, D – C3<br />
Gamba 8' r<br />
Bordun 8' f<br />
Holzflöte 4' +<br />
Spitzflöte 2' +<br />
PEDAL C – D1<br />
Subbass 16' +/r<br />
Octav 8' +/r<br />
Posaune 16' +/r<br />
60
NEBENREGISTER<br />
Schiebekoppel II/I r<br />
Pedalkoppel r<br />
Tremulant r<br />
Cymbel r<br />
Windladen r<br />
Gehäuse o<br />
3 Keilbälge r<br />
Temperatur: modifiziert mitteltönige 1 /4 phytagoräische Komma-St<strong>im</strong>mung<br />
Tonhöhe: a1=466 Hz<br />
Winddruck: 71 mm<br />
* älteste Substanz (15. Jh.)<br />
# aus einer früheren Orgel des 16./17. Jh.<br />
o Hinrich Klausing 1700<br />
f fremdes Register 18. Jh., eingebaut 1955<br />
+ Engelbert Ahmer 1830<br />
r Rekonstruktion Gebr. Hillebrand<br />
Sachberatung: DKM Jörg Krämer, Borgentreich<br />
Dipl.-Ing. Thomas Niemand, Arnsberg<br />
(Organist an St. Nikolaus Rumbeck)<br />
Dr. Roswitha Kaiser (Westf. Amt für Denkmalpflege)<br />
Ausführung: Gebr. Hillebrand GmbH, Orgelbau KG,<br />
Altwarmbüchen/Hannover<br />
Ars Colendi, <strong>Paderborn</strong> (Farbfassung)<br />
Monika Voss-Raker, Werl (Restaurierung der Schmuckelemente)<br />
In einer Festschrift zur Wiedereinweihung werden die Geschichte und Restaurierung<br />
der Orgel ausführlich beschrieben. Sie ist bei der kath. Kirchengemeinde<br />
St. Nikolaus Rumbeck erhältlich.<br />
61<br />
Orgeln
Orgeln<br />
St. Magnus, Marsberg-Niedermarsberg<br />
I. MANUAL-HAUPTWERK<br />
Bourdon * 16'<br />
Principal 8'<br />
Gedeckt * 8'<br />
Harmonieflöte 8'<br />
Octave 4'<br />
Blockflöte 4'<br />
Quinte 2 2 /3'<br />
Superoctave 2'<br />
Cornet 5f 8'<br />
Mixtur 4f 1 1 /3'<br />
Trompete 8'<br />
Trompete 4'<br />
PEDAL<br />
Principal 16'<br />
Subbaß * 16'<br />
Octavbaß 8'<br />
Violon 8'<br />
Choralbaß 4'<br />
Posaune 16'<br />
Trompete 8'<br />
Koppeln: I/P, II/P, II/I<br />
kursiv: vakante Register<br />
* Register aus der Vorgängerorgel<br />
62<br />
II. MANUALWERK<br />
Flaut Major * 8'<br />
Gambe 8'<br />
Vox coelistis 8'<br />
Principal 4'<br />
Querflöte 4'<br />
Nasat 2 2 /3'<br />
Waldflöte 2'<br />
Terz 1 3 /5'<br />
Quinte 1 1 /3'<br />
Mixtur 4-5f 2'<br />
Fagott 16'<br />
Trompete 8'<br />
Oboe 8'<br />
Tremulant<br />
Disposition und Sachberatung:<br />
DKM Jörg Krämer, Borgentreich<br />
Gesamtplanung und Ausführung:<br />
Fischer + Krämer, Orgelbau GmbH,<br />
Endingen am Kaiserstuhl
Die Barockorgel in Borgentreich III. Teil<br />
1836 hatte der Orgelbauer Figgemeyer aus Delbrück einen detaillierten Kostenanschlag<br />
zum Wiederaufbau der Dalhe<strong>im</strong>er Klosterorgel in die nunmehr neue<br />
Kirche in Borgentreich vorgelegt (siehe KMM 2/2006). Mit diesem Kostenangebot<br />
überliefert er uns die erste Aufzeichnung einer Disposition, die heute jedoch<br />
nicht in allen Punkten einer sachlichen Überprüfung standhält.<br />
Figgemeyer gibt den St<strong>im</strong>mton der Orgel mit „zwischen Kammer und Chorton“<br />
sowie den Umfang der Töne „vom tiefen C, D, Dis bis c“ an. Völlig einverstanden<br />
zeigt er sich mit dem Plan der Gemeinde, das Rückpositiv aufzugeben und die<br />
Windladen mitsamt dem Pfeifenwerk als Hinterwerk zwischen Turmwand und<br />
Hauptmanual aufzustellen.<br />
Eine noch die heutigen Restauratoren (2006) viel beschäftigende zusätzliche<br />
Veränderung wurde am 5. September 1836 zwischen Figgemeier und der<br />
Kirchenbaukommission verhandelt: die Verbreiterung des Hauptwerkprospektes.<br />
„Der Orgelbauer Herrn Figgemeier, der die Aufstellung der hiesigen Kirchenorgel<br />
übernommen hat, proponierte, wie der Prospekt derselben sehr gewinnen würde,<br />
wenn das Gehäuse der Orgel auf beiden Seiten zwischen dem Manuale und Pedale<br />
um 2 Fuß an jeder Seite erweitert würde, somit das Mittelschiff der Kirche gefüllt<br />
würde. Dieser Zwischenbau müßte dann in dem selben Style wie das übrige Gehäuse<br />
mit Ges<strong>im</strong>se und Prospektpfeifen angefertigt werden. Übrigens müßten zu<br />
diesem Zwischenbaue das nothwendige Holz, als Riegel und einige etwa 3 bis 4 gar<br />
neue 40ger Dielen von Seiten der Bau-Commißion gestellt werden, wobei natürlich<br />
das Ueberlegen dieser Prospektpfeifen mit Staniol von Seiten des Hr.<br />
Figgemeier geschehen muß. Die Kirchenbau-Commißion acceptierte diesen Vortrag<br />
des Herrn Übernehmers.“<br />
Wir erinnern uns, dass der Prospekt anlässlich der Translocierung von Dalhe<strong>im</strong><br />
in die wesentlich kleinere Borgentreicher Kirche geschmälert worden sein muss.<br />
Ohne sich dessen bewusst zu sein, näherte Figgemeyer die Abmessungen der<br />
Orgel in der Breite nun den ursprünglichen alten Ausmaßen in Dalhe<strong>im</strong> wieder<br />
63<br />
Orgeln
Orgeln<br />
an. Die besagten Zwischenfelder neben den Pedaltürmen wurden als Spitztürme<br />
mit Holzattrappen ausgeführt, wobei die ebenfalls zu verbreiternde<br />
Ständerkonstruktion der Rückwand mittels alter westfälischer Hausbalken konstruiert<br />
wurde, dessen Holz bereits Mitte des 17. Jahrhunderts geschlagen worden<br />
war. In dieser äußeren Gestalt überdauerte die Orgel bis 1950! Bei allen<br />
langwierigen und schwierigen Überlegungen, heute ein schlüssiges<br />
Restaurierungskonzept für das Hauptgehäuse zu finden, hat sich nach umfangreichen<br />
Diskussionen die Einsicht durchgesetzt, dass diese 1836 von Figgemeyer<br />
geschaffene Form des Hauptgehäuses der Orgel als eigentliche Borgentreicher<br />
Fassung der Dalhe<strong>im</strong>er Klosterorgel in der jetzigen Kirche anzusehen ist. Da dieser<br />
Zustand darüber hinaus vergleichsweise gut fotografisch belegt ist, sehen<br />
die Planungen zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen (Herbst 2006) als<br />
denkmalpflegerisch kaum angreifbare Lösung hinsichtlich des Hauptgehäuses<br />
die Wiederherstellung des Zustandes 1836 vor.<br />
Nachdem Figgemeyer in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Disposition<br />
der Orgel noch unverändert erhalten hatte, zollte sie 1872 dem sich ändernden<br />
musikalischen Geschmack ihren Tribut. Unter anderem war zu dieser Zeit der<br />
Silberglanz der barocken Orgeln nicht mehr gefragt. Statt farbiger Klangkontraste<br />
von Zungenst<strong>im</strong>men erlebten eher dunkel, grundtönige Füll- und Solost<strong>im</strong>men,<br />
mit denen feinste dynamische Schattierungen möglich sind, ihre<br />
Blüte. Da derartige Klänge mit einer barocken Orgel nicht zu erreichen sind, verschwanden<br />
an Orten, wo die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden waren,<br />
barocke Instrumente gänzlich. In Borgentreich konnte sich der <strong>Paderborn</strong>er Orgelbauer<br />
Randebrock, aus dessen Schaffen u. a. Orgeln in Marsberg-<br />
Heddinghausen, Büren-Weiberg und <strong>Paderborn</strong>-Dahl mehr oder weniger vollständig<br />
erhalten sind, zumindest mit einigen klanglichen Veränderungen<br />
durchsetzen.<br />
Sein Kostenvoranschlag aus dem Jahre 1872 konnte bislang in den <strong>im</strong> Pfarrarchiv<br />
enthaltenen Unterlagen nicht aufgefunden werden. Aus einem Gutachten des<br />
<strong>Paderborn</strong>er Domorganisten Henkemeyer zu Randebrocks Konstenanschlag<br />
hingegen wird ersichtlich, wie die Orgel seinerzeit technisch und musikalischkünstlerisch<br />
beurteilt wurde:<br />
64
„Revisionsprotokoll über den Kostenanschlag des Orgelbauers Herrn Randebrock<br />
einer Reparatur der Kirchenorgel zu Borgentreich betreffend.<br />
Die Disposition der Orgel zu Borgentreich ist, wie aus vorliegendem Plan zu ersehen<br />
ist, ganz in der Weise gehalten, wie man überhaupt die größeren Werke aus<br />
jener Zeit findet. Viel Gutes und auch manches Nutzlose. In der Orgel zu Borgentreich<br />
sind zu viel schreiende und unnütze Zungenregister und es ist gut, wenn dieselben<br />
durch einige Füll- und Solost<strong>im</strong>men ersetzt werden. So halte ich es für<br />
zweckmäßig, daß auf dem Hauptmanual ein weit mensuriertes 4 chöriges Cornett<br />
und ebenfalls ein Gedackt 4' neu, wenn nicht ein solcher 4' <strong>im</strong> zweiten Manual<br />
überflüssig gemacht werden kann, angebracht werde. Die alte Disposition der Orgel<br />
ist insoweit eigenthümlich, als das Hauptmanual weniger Register enthält als<br />
das zweite Manual, und deshalb sind die beiden St<strong>im</strong>men an ihrem Platze, da sie<br />
die Fülle und Kraft des Hauptwerkes heben werden. Die Disposition des zweiten<br />
Werkes ist deshalb mangelhaft, weil darin Fülle fehlt und würde Bordun 16' passen,<br />
wenn des Platzes wegen auch nur Diskant vom kleinen g an für ein anderes<br />
Register placiert würde.<br />
Die beiden anzulegenden neuen St<strong>im</strong>men, Geigenprincipal 8' und Flaute traverso<br />
8' geben dem ganzen auch noch eine angenehme Fülle und sind zugleich gute<br />
Soloregister, die man sonst auf diesem Werke entbehrt. Im dritten Klavier und Pedal<br />
wird man des Raumes wegen keine St<strong>im</strong>men neu anbringen können und werden<br />
dieselben, wieder gut in Stand gesetzt, für das ganze Werk ausreichen. Von<br />
dem Gebläse ist die Größe nicht angegeben; dasselbe muss groß genug gemacht<br />
werden, um das ganze Werk, selbst bei Koppelung, speisen zu können. Über die<br />
Preise kann hier nichts gesagt werden, weil man nicht weiß, in welchem Zustande<br />
die Orgel vorhanden ist, und muss man sich auf die Gewissenhaftigkeit des Orgelbauers<br />
verlassen. Wenn nun auch die neuen Register für die Kirche zu Borgentreich<br />
nicht absoluth notwendig sind, so ist ganz gewiß, daß das Werk bei dem guten<br />
Alten mit dem guten Neuen so bedeutend wird, daß man ein zweites solches Orgelwerk<br />
so nahe nicht finden wird.<br />
<strong>Paderborn</strong>, den 27. Februar 1872<br />
gez. Henkemeyer<br />
Domorganist“<br />
Fortsetzung folgt!<br />
Besuchen Sie uns auch <strong>im</strong> Internet:<br />
www.barockorgel-borgentreich.de<br />
65<br />
Orgeln
Orgeln<br />
Christian Vorbeck<br />
Der Orgelbaumeister Willibald Siemann –<br />
Ein Beitrag zum Orgelbau in der Zeit der deutschen Spätromantik 1<br />
1. Vorwort und Einführung<br />
Mit der deutschen Orgelbewegung begann eine Abwendung vom Orgelbau des<br />
19. Jahrhunderts. Es fand eine allgemeine Rückbesinnung auf die Zeit des Barock<br />
statt, mit den Idealtypen Schnitger und Silbermann. So nahm man nun Umbauten<br />
romantischer Orgeln <strong>im</strong> Sinne des neuen Zeitgeistes vor und nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg setzte eine regelrechte Vernichtungswelle insbesondere bei<br />
rein pneumatisch gesteuerten Instrumenten aus der Zeit zwischen 1890 und<br />
1930 ein, die bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts anhielt.<br />
Erst in den letzten beiden Jahrzehnten begann man, nicht nur den historischen,<br />
sondern auch den klanglich-ästhetischen Wert dieser Instrumente wiederzuentdecken.<br />
Doch besteht heute die leider weitverbreitete Meinung, die Fülle der qualitativ<br />
hochstehenden Orgelbauanstalten aus der Zeit der Romantik erschöpfe sich in<br />
den Namen Wilhelm Sauer, Walcker und Steinmeyer. In dieser Hinsicht gibt es<br />
eine durchaus beklagenswerte Lücke zu schließen und gerade auch die unbekannten<br />
Firmen, die oft so eigentümlich reizvolle Instrumente konzipierten, aus<br />
der dunklen Abstellkammer der Vergangenheit wieder heraus zu holen.<br />
Eine dieser Firmen ist die Orgelbauanstalt Willibald Siemann & Co., Gründer einer<br />
der größten und führenden Orgelbaubetriebe in Süddeutschland, mit einem<br />
Opus von über 500 Orgeln in gut 50 Jahren.<br />
2. Biographisches<br />
Der Orgelbaumeister Willibald Siemann wurde am 20.05.1864 <strong>im</strong> bayrischen<br />
1 Der vorliegende Artikel ist ein Exzerpt aus einer Examensarbeit an der Hochschule für Musik in Köln mit dem<br />
Titel „Die Werke des Orgelbaumeisters Willibald Siemann in der Diözese Würzburg mit detaillierter Betrachtung<br />
und Tonaufnahmen der Orgeln in Waldzell und Johannesberg“. Diese Arbeit wurde <strong>im</strong> Fach Orgelgeschichte<br />
bei Prof. Dr. Hermann J. Busch vorgelegt.<br />
66
Streithe<strong>im</strong> geboren. Schon mit 22 Jahren avancierte er 1886 zum Teilhaber der<br />
Orgelbauanstalt seines Onkels Martin Binder2 in Pfaffenhofen.<br />
Im Jahre 1890 gründete Siemann seinen eigenen Betrieb in München. Bis 1893<br />
baute er noch mechanische Kegelladen, danach ausschließlich pneumatische.<br />
Nach dem Tode Binders vereinigte Siemann beide Werkstätten zu einem Großbetrieb<br />
namens Martin Binder & Sohn, Inh. Willibald Siemann, später nur noch<br />
Willibald Siemann & Co., München und Regensburg. Die neue Orgelbauanstalt<br />
entwickelte sich zu einer der führenden in Süddeutschland.<br />
Mit dem Tode Siemanns am 28.02.1932 in München übernahm sein Schwiegersohn<br />
G. Prell die Geschäftsleitung. 1944 wurde die Münchener Filiale des Betriebes<br />
durch einen Bombenangriff zerstört. Die Werkstatt in Regensburg wurde<br />
1945 verpachtet und bis 1950 genutzt.<br />
Die Orgelbauanstalt Siemann war ein typischer Großbetrieb der Gründerzeit.<br />
Alle Orgelteile, auch das Pfeifenwerk, wurden mit damals neuesten Maschinen<br />
eigenständig angefertigt. Die Produktion erfolgte fließbandmäßig und ermöglichte<br />
dadurch eine außergewöhnlich hohe quantitative Effizienz.<br />
Im Zuge der Orgelbewegung gerieten diese Werke als sogenannte Fabrikorgeln<br />
zu Unrecht in Verruf. Nicht zuletzt weil die Produktionsphilosophie von<br />
Orgelbaufirmen wie Walcker, Steinmeyer, Wilhelm Sauer oder sogar Cavaillé-<br />
Coll3 in ganz ähnliche Richtungen weisen, ist die Qualität und Individualität der<br />
Orgelwerke Willibald Siemanns hoch zu schätzen.<br />
3. Aus einem Werbekatalog der Orgelbauanstalt Willibald Siemann & Co.<br />
Die wichtigste Quelle über den Orgelbaumeister Willibald Siemann ist ein<br />
Werbekatalog seiner Firma an den Würzburger Diözesanklerus aus dem Jahre<br />
1936, der aus dem Privatbesitz des Aschaffenburger Organologen Hermann Fischer<br />
stammt. Im anliegenden Schreiben bittet Siemann „die Kirche oder den<br />
2 Orgelbaumeister, *17.10.1849 in Ilmmünster +1.8.1904 in Regensburg, gründete 1875 eine Orgelbauwerkstatt in<br />
Pfaffenhofen und verlegte sie 1890 nach Regensburg. Bis 1904 wurden etwa 140 Orgelwerke in Altbayern<br />
erbaut. Werke u. a. 1895 Regensburg/Niedermünster, II/28; Regensburg/St. Emmeram, II/30.<br />
3 Aristide Cavaillé-Coll, 1811-1899, französischer Orgelbauer<br />
67<br />
Orgeln
Orgeln<br />
Raum für welchen das Werk gebaut werden soll, vom Orgelbauer besichtigen zu<br />
lassen.“ Dies stützt die These einer individuellen Konzeption jeder neu zu errichtenden<br />
Orgel und entkräftet den Vorwurf einer Serienfertigung mit Einheitsmensuren<br />
und knalliger Intonation.<br />
Im Katalog folgen nun Prospektansichten, Dispositionen und Gutachten der<br />
Orgelneubauten in der katholischen Pfarrkirche zu Sünzhausen bei Freising (Op.<br />
209, erbaut 1908, II/10), in der Kirche der Heil- und Pflegeanstalt Haar bei München<br />
(Op. 280, erbaut 1912, II/19) und in Pfarrkirche zu Übersee/Obb. (Op. 309,<br />
erbaut 1914, II/26). Letzteres Werkt ist besonders interessant konzipiert: Neben<br />
dem eigentlichen Schwellwerk auf dem II. Manual setzt Siemann fünf der zehn<br />
Hauptwerksst<strong>im</strong>men in einen eigenen Schwellkasten.<br />
Eine detaillierte wissenschaftliche Auswertung der Materialien würde an dieser<br />
Stelle zu weit führen. Alle Gutachter stellen Siemann ein hervorragendes Zeugnis<br />
über handwerkliche Ausarbeitung und klangliche Ästhetik aus.<br />
In einer beigefügten Bestätigung des Würzburger Domkapitulars Joh. Strubel<br />
vom 20. November 1925 wird zum einen der hohe Qualtitätsanspruch Siemanns<br />
<strong>im</strong> Bezug auf Material, Konstruktion und Intonation hervorgehoben und zum<br />
anderen der Meister selbst als „guter Katholik“ und „persönlich unantastbar“<br />
bezeichnet.<br />
Im Katalog folgt eine von Siemann eigenhändig unterzeichnete Liste mit den bis<br />
1930 erbauten 65 Orgelwerken in der Diözese Würzburg. Eine weitere von G.<br />
Prell unterzeichnete Liste beschreibt 17 Orgelneubauten nach dem Tode Siemanns<br />
bis 1936.<br />
Der Werbekatalog schließt mit einem Adressblatt, auf welchem die Anschriften<br />
der Firmenfilialen in Regensburg und München aufgeführt werden.<br />
4. Das Gesamtwerk – ein Überblick<br />
Die Orgelbauanstalt Willibald Siemann & Co. Baute in der Zeit von 1890-1944<br />
etwa 500 Instrumente, überwiegend mit pneumatischer Kegellade und meistens<br />
mit 10 bis 25 Registern auf zwei Manualen und Pedal, selten mehr als 30<br />
St<strong>im</strong>men auf drei Manualen. Das Schaffensgebiet umfasste Oberbayern, Nie-<br />
68
derbayern, die Oberpfalz, Schwaben, Unterfranken und in einigen Fällen Oberschlesien.<br />
Mit Hilfe der beiden Listen <strong>im</strong> o. g. Werbekatalog und durch eigene Forschungen<br />
konnten alle Orgelwerke der Firma Willibald Siemann in der Diözese Würzburg<br />
ermittelt werden. Es handelt sich um insgesamt 74 Instrumente mit fünf bis 34<br />
St<strong>im</strong>men auf ein bis zwei Manualen und Pedal, erbaut in den Jahren 1897 bis<br />
1936. Heute sind von diesen Orgeln elf original erhalten oder restauriert, d. h. in<br />
den Urzustand zurückversetzt. Die übrigen Werke wurden <strong>im</strong> Zuge der Orgelbewegung<br />
v. a. in den 60er und 70er Jahren entweder umgebaut, d. h. meistens<br />
mit elektrischer Traktur versehen und „aufgehellt“ oder demontiert.<br />
Außerhalb der Diözese Würzburg konnten bis jetzt 25 Orgeln ermittelt werden,<br />
u. a. <strong>im</strong> Regensburger Dom (1905, II/25), in der Klosterkirche Waldsassen (1914, II/<br />
43), in der Stadtpfarrkirche Traunstein (1929, II/35) und in Freising, St. Georg<br />
(1938, III/43). Für alle Hinweise auf weitere Werke der Orgelbauanstalt Willibald<br />
Siemann wäre der Verfasser sehr dankbar.<br />
Eine Ausnahme <strong>im</strong> Schaffen Siemanns und wohl auch das „Opus Max<strong>im</strong>um“<br />
war die 1921 erbaute Orgel der Heilig-Geist-Kirche in München, die 1945 einem<br />
Luftangriff zum Opfer fiel. Darin wurde die Vorgängerinstrument von Franz<br />
Borgias Maerz 4 von 1886 mit 24 Registern auf zwei Manualen übernommen.<br />
Das neue Werk hatte 79 Register auf vier Manualen und folgende Disposition5 :<br />
I. MANUAL, C-A’’’ (58 TÖNE):<br />
Großgedackt 16'<br />
Principal 8'<br />
Keraulophon 8'<br />
Gedeckt 8'<br />
Dolce 8'<br />
Flute harmonique 8'<br />
4 Kgl. Bayer. Hoforgelbauer, *30.7.1848 in München †23.3.1910 ebenda; Er führte Orgelbauanstalt Maerz/München<br />
in dritter Generation. Werke u. a. 1904 Augsburg/Dom, II/32; München/St. Paul, III/50.<br />
5 Aus: Alfred Reichling (Hrsg.): Acta Organologica, Band 10, Berlin 1976, S. 75-81: Georg Brenninger: Die Orgeln<br />
der Münchener Heilig-Geist-Pfarrkirche<br />
69<br />
Orgeln
Orgeln<br />
Oktav 4'<br />
Flute octaviante 4'<br />
Quinte 2 2 /3'<br />
Superoctav 2'<br />
Cornett 8'<br />
Mixtur 2 2 /3'<br />
Basson 16'<br />
Trompete 8'<br />
Clairon 4'<br />
II. MANUAL, C-A’’’ (70 TÖNE):<br />
Rohrgedeckt 16'<br />
Principal 8'<br />
Echogamba 8'<br />
Aeoline 8'<br />
Lieblich Gedeckt 8'<br />
Traversflöte 8'<br />
Undamaris 8'<br />
Geigenprincipal 4'<br />
Dulciana 4'<br />
Wienerflöte 4'<br />
Flautino 2'<br />
Sesquialtera 2 2 /3'<br />
Echomixtur 2 2 /3'<br />
Trompete harmonique 8'<br />
Clarinette 8'<br />
III. MANUAL. C-A ‚‘’ (70 TÖNE):<br />
-Schwellwerk-<br />
Bourdon 16'<br />
Principal 8'<br />
Fugara 8'<br />
70<br />
Gedeckt 8'<br />
Doppelflöte 8'<br />
Salicional 8'<br />
Vox coelestis 8'<br />
Quintatön 8'<br />
Prästant 4'<br />
Rohrflöte 4'<br />
Gemshorn 4'<br />
Piccolo 2'<br />
Plein Jeu 2 2 /3'<br />
C<strong>im</strong>bel 1'<br />
Bombarde 16'<br />
Tuba 8'<br />
Oboe 8'<br />
Vox humana 8'<br />
Schalmei 4'<br />
IV. MANUAL, C-A’’’ (70 TÖNE):<br />
-Fernwerk-<br />
Stillgedeckt 16'<br />
Alphorn 8'<br />
Zartgedeckt 8'<br />
Flöte 8'<br />
Fugara 4'<br />
Aeolsharfe 4'<br />
Larigot 2'<br />
Progressiv harmonique 2 2 /3'<br />
Englisch Horn 8'<br />
Euphone 8'<br />
Solotrompete 8'<br />
Nachthorn 4'<br />
Glockenspiel
PEDAL, C-F’ (30 TÖNE):<br />
Principalbaß 16'<br />
Violonbaß 16'<br />
Subbaß 16'<br />
Bourdonbaß 16'<br />
Quintatönbaß 16'<br />
Quintbaß 10 2 /3'<br />
Octavbaß 8'<br />
Cellobaß 8'<br />
Flötbaß 8'<br />
Baßflöte 4'<br />
Contra Tuba 32'<br />
Posaune 16'<br />
Fagottbaß 16'<br />
Trompetenbaß 8'<br />
Koppelungen:<br />
Manualkoppeln II-I, III-I, IV-I, III-II<br />
Oberoctavkoppeln II, III, IV; II-I, III-I, IV-I<br />
Unteroctavkoppeln II, III, IV; II-I, III-I, IV-I<br />
Pedalkoppeln I, II, III, IV<br />
Pedaloberkoppel III<br />
Weitere Spielhilfen<br />
FERNWERKPEDAL:<br />
Subbaß 16'<br />
Zartbaß 16'<br />
Violon 8'<br />
Das Werk ist auf vier Manualen angelegt, mit Hauptwerk, Nebenwerk,<br />
Schwellwerk, Pedalwerk und einem für die Spätromantik typischen Fernwerk<br />
mit einem dazugehörigen Fernwerkpedal auf einer separaten Windlade, das<br />
sich wahrscheinlich auf dem Dachboden befand und elektrisch traktiert wurde.<br />
Bemerkenswert ist zunächst, daß bei einer solchen großen Orgel das Hauptwerk<br />
auf der Basis des Prinzipal 8' steht. Die 16füssigen Labialst<strong>im</strong>men sind nur durch<br />
Gedackte vertreten.<br />
71<br />
Orgeln
Orgeln<br />
Typische spätromantische Register sind zum Beispiel Keraulophon 8‘ 6 <strong>im</strong> Hauptwerk,<br />
die Clarinette 8' auf dem II. Manual, oder Euphone 8‘ 7 , Alphorn 8‘ 8 , Englisch<br />
Horn 8‘ 9 und Progressiv harmonique 2 2 2 /3‘ 10 <strong>im</strong> Fernwerk.<br />
Die ganze Orgel ist mit einem überaus reichen Zungenchor ausgestattet, besonders<br />
das Schwellwerk. Auch der große Klaviaturumfang bis a’’’ war um diese Zeit<br />
nicht selbstverständlich.<br />
Zwei Werke sind mit einer Schwebung ausgestattet, das Nebenwerk die<br />
Undamaris 8' (wahrscheinlich eine Flötenschwebung) und das Schwellwerk mit<br />
der Streicherschwebung Vox coelestis 8' (vielleicht als einfache St<strong>im</strong>me in Kombination<br />
mit Salicional 8').<br />
In der Disposition sind auch Zungenst<strong>im</strong>men französischer Bauart zu finden,<br />
wie Basson 16' und Clairon 4' (I. Manual), Trompette harmonique 8' (II. Manual)<br />
und Bombarde 16' (III. Manual). Außerdem stehen neben den üblichen Mixturen<br />
auf 2 2 /3'-Basis für die damalige Zeit relativ selten gebaute gemischte<br />
Farbregister zur Verfügung (Sesquialtera 2 2 /3' auf II und C<strong>im</strong>bel 1' auf III), sowie<br />
eine eigenständige Superoctave 2' <strong>im</strong> Hauptwerk, auf die man gewöhnlich verzichtete.<br />
Dies alles deutet auf eine Beeinflussung Siemanns durch die elsässisch-neudeutsche<br />
Orgelreform 11 hin, die sich jedoch nicht belegen lässt.<br />
Am wenigsten vermutet man ein barockes Glockenspiel in einer solchen Orgel,<br />
doch war der Klangeffekt <strong>im</strong> Fernwerk mit Sicherheit sehr interessant.<br />
6 griech.: der Hornbläser; geigenprinzipalähnliche St<strong>im</strong>me mit feiner, hornähnlicher Intonation<br />
7 griech.: Wohlklang; sehr charakteristisches, clarinettähnliches Zungenregister, meist durchschlagend<br />
8 wahrscheinlich ähnliche einem Keraulophon<br />
9 Zungenst<strong>im</strong>me mit trichterförmigem Becher und Doppelkegel am oberen Ende<br />
10 Progressio harmonica, Prinzipalmixtur mit zum Diskant zunehmender Chorzahl<br />
1 Die Wortführer der elsässisch-neudeutschen Orgelreform (1906-1909) waren Albert Schweitzer (1875-1965)<br />
und Emile RuppRupp (1872-1948). Es wurde eine Orientierung an den Orgeln Silbermanns und Cavaille-Colls<br />
gefordert, sowie der Ausbau des Prinzipalchores in hohen Lagen und die Disposition gemischter Farbregister.<br />
72
5. Die Siemann-Orgel in Waldzell<br />
Der etwa 500 Einwohner zählende Ort Waldzell liegt inmitten einer dörflich<br />
strukturierten Gegend in sehr reizvoller Landschaft am Rande des Spessarts, ca.<br />
10 km von der unterfränkischen Kleinstadt Lohr am Main entfernt.<br />
Die 1854 als einschiffiger neogotischer Bau errichtete katholische Kirche ist dem<br />
fränkischen Heiligen St. Vitus geweiht und gehört zur Pfarrei Steinfeld.<br />
1929 erbaute die Firma Willibald Siemann & Co. Eine Orgel als Opus 453, von der<br />
eine Endrechnung über ca. 8000 Mark vorliegt. Restauriert wurde das Werk<br />
durch die Orgelbaufirma Weiss/Zelingen am Main 12 <strong>im</strong> Jahre 1993.<br />
Disposition:<br />
Willibald Siemann 1929, op. 453<br />
I. MANUAL C-F’’’ (HAUPTWERK):<br />
Dolce 8' (C-fs’’ Zink, g’’-f’’’ Sn; offen, leicht trichterförmig; mit Expression;<br />
olivgrün emailliert)<br />
Rohrflöte 8' (C-H Zink gedeckt, c-h Zink mit Röhrchen, c+-f’’’ Sn mit<br />
Röhrchen; zylindrisch)<br />
Prinzipal 8' (C-Ds Holz, innen, mit Rollbart, E-ais’ Zink, Prospekt z. T.<br />
Mit Rollbart, silbern bronziert, h’-f’’’Sn, innen; offen, zylindrisch)<br />
Oktav 4' (C-h’ Zink, c’’-f’’’Sn; offen, zylindrisch; mit Expression)<br />
II. MANUAL C-F’’’ (NEBENWERK)<br />
Lieblich Gedeckt 8' /C-h’ Holz gedeckt mit gewölbtem Oberlabium, c’’-h’’ Sn<br />
gedeckt, c’’’-f’’’’ SN offen; zylindrisch)<br />
12 Lothar (*11.1.1941 in Aachen) und Rolf (*4.9.1943 in Grafenried) Weiss, Orgelbaumeister; Werke u. a. 1974<br />
Aschaffenburg, St. Michael (III/35); 1983 Karlstadt/Main, Stadtkirche (IV/61)<br />
73<br />
Orgeln
Orgeln<br />
Viola die Gamba 8' (C-h’ Zink, c’’-f’’’’ Sn; offen, zylindrisch; mit Expression und<br />
frein harmonique)<br />
Nachthorn 4' (C-h’ Zink, c’’-f’’’’ Sn mit gewölbtem Oberlabium; offen,<br />
konisch; z. T. Olivgrün emailliert)<br />
Mixtur 2 2 /3' (Sn; offen, zylindrisch; mit Expression; Repetition; C-f’’<br />
2 2 /3'+2', fs’’-f’’’4'+2 2 /3', fs’’’-f’’’’2')<br />
PEDAL C-D’:<br />
Subbass 16' (Holz mit rundem Aufschnitt; gedeckt, zylindrisch)<br />
Zartbass 16' (Windabschwächung aus Subbass 16')<br />
Koppeln:<br />
Manualkoppel II-I<br />
PedalkoppelI<br />
PedalkoppelII<br />
Suboctavkoppel II-I<br />
Superoctavkoppel II-I (ausgebaut bis f’’’’)<br />
Spielhilfen:<br />
Auslöser<br />
MF (Rohrflöte 8', Dolce 8', Lieblich Gedackt 8', Viola die Gamba 8',<br />
Zartbass 16', Manualkoppel II-I, Pedalkoppel II)<br />
F (= MF + Prinzipal 8' / Nachthorn 4' / Subbass 16')<br />
Tutti<br />
Pianopedal automatisch<br />
System: rein pneumatisch gesteuerte Kegellade<br />
Um mehr Kombinationsmöglichkeiten zu ermöglichen wurden die nur zehn Register<br />
auf zwei Manuale und Pedal verteilt. Das Hauptwerk steht auch bei dieser<br />
kleinen Orgel auf der Basis des Prinzipal 8'. Von der Dolce 8' bis zum Vollen Werk<br />
ist ein stufenloses Crescendo möglich.<br />
74
Intoniert wurde durchweg mit Kernstichen. Die Füße der Metallpfeifen sind<br />
eingekulpt. Die olivgrünen Emaillierungen sind wohl als besonderes Markenzeichen<br />
Siemanns zu deuten.<br />
Der freistehende Spieltisch ist aus Fichtenholz gefertigt und steht auf einem<br />
etwa 20 cm hohen Podest. Die Spielanlage ist sehr übersichtlich gestaltet, mit je<br />
nach Werkzugehörigkeit unterschiedlich gefärbten Registerwippen mit runden<br />
Porzellanschildchen. Die festen Kombinationen können mittels Druckknöpfen<br />
unterhalb des I. Manuals betätigt werden.<br />
Die Windversorgung erfolgt über ein 0,8 PS starkes Centrifugal-Orgelgebläse,<br />
das einen ca. 1,50 mal 0,75 m breiten und 0,75 m hohen Magazinbalg speist. Zusätzlich<br />
stattete Siemann den Balg mit einer Schöpfanlage aus, die heute noch<br />
funktionstüchtig ist.<br />
Gehäuse und Prospekt stammen wahrscheinlich von der Vorgängerorgel des<br />
Schweinfurter Orgelbauers Beyer 13 . Bemerkenswert sind die vielen Verzierungen,<br />
wie die aus Holz geschnitzten kleinen Spitzbögen auf den Verschalungen und<br />
die vergoldeten Intarsien.<br />
6. Die Siemann-Orgel in Johannesberg<br />
Die Johannesberger Pfarrkirche mit dem seltenen Patrozinium „St. Johannes<br />
Enthauptung“ liegt 373 m. ü. NN. Auf der tertiären Hochebene am Rande von<br />
Aschaffenburg am Main. Sie wurde 1769 als einfacher, aber doch ansprechender<br />
Barockbau errichtet.<br />
Der Preis für die 1924 fertiggestellte Orgel von Siemann belief sich inflationsbedingt<br />
650 Billionen Mark, der mit gut 6000 Goldmark bezahlt wurde. Die<br />
Vorgängerorgel des Aschaffenburger Orgelbauers Bruno Müller 14 von 1896 wurde<br />
teilweise in das neue Werk integriert.<br />
13 Wilhelm Friedrich Beyer (um 1850/60), Orgelmacher in Kitzingen und Schweinfurt; nur kleine Werke in Dörfern<br />
bekannt<br />
75<br />
Orgeln
Orgeln<br />
Im Laufe der Zeit wurden von verschiedenen Firmen insgesamt vier größere<br />
Umbaumaßnahmen <strong>im</strong> Sinne der Orgelbewegung vorgenommen. Die Restauration<br />
erfolgte schließlich in den Jahre 1997/98 durch die Orgelbaufirma Andreas<br />
Schmidt/Gelnhausen 15 .<br />
Disposition:<br />
Willibald Siemann 1924, op. ?<br />
I. MANUAL C-F’’’ (HAUPTWERK):<br />
Bourdon 16' (Fichte, Rekonstruktion von Andreas Schmidt nach einzelnen<br />
erhaltenen Pfeifen und Fußlöchern; gedeckt, zylindrisch)<br />
Dolce 8'(Sn, Rekonstruktion von Andreas Schmidt nach vorhandenen<br />
Fußlöchern und Rasterbrettern; offen, zylindrisch; mit<br />
Expression)<br />
Flöte 8' (C-h’ Zink, c’’-f’’’ Sn mit gewölbtem Oberlabium; Rohrflöte,<br />
zylindrisch)<br />
Gamba 8' (C-h Zink mit Rollbart, c’-f’’’ Sn mit frein harmonique; offen,<br />
zylindrisch)<br />
Prinzipal 8' (C-Fs Holz innen, G-ds’ Zink Prospekt, silbern bronziert, mit<br />
Rollbart, e’-f’’’ Sn, mit Hand bezeichnete Pfeifen von Müller;<br />
offen, zylindrisch)<br />
Oktav 4' (Sn, Pfeifen von Müller; offen, zylindrisch)<br />
Mixtur 2 2 /3' (C-f Zink, fs-f’’’ Sn, z. T. Von Müller; offen, zylindrisch)<br />
Repetition: C-f 2 2 /3'+2'+1 1 /3'+1', fs-e’ 4'+2 2 /3'+2'+1 1 /3', f’-f’’’ 5 1 /3'+4'+2 2 3'+2')<br />
14 Bruno Müller (*29.10.1839 in Zündersdorf † 28.6.1907 in Aschaffenburg), Orgelbauer in Aschaffenburg; Werke<br />
u. a. 1879 Aschaffenburg, Zu Unserer Lieben Frau II/23<br />
15 1921 übernahm dessen Großvater Richard das verwaiste Geschäft Ratzmann. Über dessen Sohn Bernhard<br />
ging es schließlich an dessen Sohn Andreas. Werke von letzterem u. a. 2000 Marborn, Unbefleckte Empfängnis<br />
Mariens (II/17)<br />
76
II. MANUAL C-F’’’ (SCHWELLWERK):<br />
Aeoline 8' (C-h Zink, ab c’ Ng; offen, zylindrisch; mit Expression und<br />
frein harmonique)<br />
Vox coelistis 8' (c-h Zink, ab c’ Ng; offen, zylindrisch, mit Expression und<br />
frein harmonique; gekoppelt mit Aeoline 8')<br />
Salicional 8' (C-H Holz gedeckt, c-h Zink offen, ab c’ Sn offen; zylindrisch;<br />
Pfeifen von Müller; Expression von Siemann)<br />
Lieblich Gedackt 8' (C-e’’ Fichte, Vorschlag Obstholz, gedeckt, f’’-f’’’’ Sn offen;<br />
zylindrisch; Pfeifen von Müller<br />
Geigenprinzipal 8' (C-H Holz, c-f’ Zink, Pfeifen von Müller, fs’-f’’’’ Ng mit gewölbtem<br />
Oberlabium, Pfeifen von Siemann; offen, zylindrisch;<br />
z. T. mit Rollbart)<br />
Traversflöte 4'(C-h Fichte, Vorschlag Buche, gedeckt, c’-f’ Zink, Pfeifen von<br />
Müller, offen, überblasend, fs’-f’’’’ Ng mit gewölbtem<br />
Oberlabium, Pfeifen von Siemann, offen, überblasend; zylindrisch;<br />
z. T. mit Rollbart)<br />
Praestant 4' (C-f’ Zink, fs’-f’’’’ Sn; offen, zylindrisch; z. T. mit Rollbart)<br />
Harmonica aetherca 2 2 /3' (C-h Sn, Rekonstruktion von Andreas Schmidt nach<br />
Originalpfeifen, c’-f’’’’ Sn, Pfeifen von Siemann; offen, zylindrisch;<br />
ohne Repetition; Chöre: 2 2 /3'+2'+1' 3 /5')<br />
Trompete 8' (Becher und Füße Zink, olivgrün emailliert, deutsche Bauart,<br />
Becher mit Expressionen; offen, trichterförmig)<br />
PEDAL C-D’:<br />
Subbaß 16' (Fichte, Vorschlag Eiche; runder Aufschnitt; C gekröpft;<br />
gedeckt, zylindrisch; Pfeifen von Müller<br />
Zartbaß 16' (Windabschwächung aus Subbass 16')<br />
Violon 16' (Fichte, Vorschlag Eiche; C-F gedeckt, Fs-d’ offen; Fs-Gs<br />
gekröpft; zylindrisch; mit Rollbart)<br />
Octavbaß 8' (Fichte, Vorschlag Eiche; C-F Pfeifen von Siemann, Fs-d’<br />
Pfeifen von Müller; gerader Aufschnitt; offen, zylindrisch;<br />
mit Rollbart)<br />
77<br />
Orgeln
Orgeln<br />
Manualkoppel II-I<br />
Pedalkoppel I<br />
Pedalkoppel II<br />
Suboctavkoppel II-I<br />
Superoctavkoppel II-I (ausgebaut bis f’’’’)<br />
Pedalsuperkoppel II-P<br />
Spielhilfen:<br />
Auslöser<br />
P<br />
MF<br />
F<br />
Tutti<br />
(Originaleinstellungen verschollen)<br />
Registerschweller an<br />
(Originaleinstellung verschollen)<br />
Handregister zum Schwellwerk<br />
Balanciertritt zur Steuerung des Jalousieschwellers<br />
Balanciertritt zur Steuerung des Registerschwellers<br />
Pianopedal automatisch<br />
System: pneumatisch gesteuerte Kegellade<br />
Das reich ausgestattete und sehr farbige Schwellwerk ist grundsätzlich als dynamische<br />
Abstufung zum Hauptwerk konzipiert. Die kräftige Trompete 8' <strong>im</strong><br />
Schwellwerk bietet einerseits die Möglichkeit der dynamischen Differenzierung,<br />
andererseits die eines Zungenchors 16‘8‘4' mittels Sub- und Superoctavkoppeln.<br />
Natürlich ist auch bei dieser Orgel ein stufenloses Crescendo von der sehr leisen<br />
Aeoline 8' bis zum Tutti möglich.<br />
78
Intoniert wurde mit vielen Kernstichen, die metallen Pfeifenfüße sind eingekulpt.<br />
Der Spieltisch entspricht in Form und Anordnung der Spielanlage dem der Orgel<br />
in Waldzell.<br />
Nicht erhalten werden konnte der originale Windmotor, die Schöpfanlage von<br />
Siemann wurde bei einer der o. g. Umbauten entfernt. Beeindruckend ist der<br />
Magazinbalg, ca. 2,00 m mal 1,20 m breit und 1,20 m hoch.<br />
Der Prospekt stammt vom Vorgängerinstrument Müllers, die seitlichen<br />
Gehäuseteile wurden von Siemann durch einfache und nach oben offene Holzwände<br />
mit Füllungen ersetzt.<br />
7. Zur Konzeption der Orgel bei Siemann<br />
Bei beiden beschriebenen Instrumenten handelt es sich eher um sogenannte<br />
„Dorforgeln“ als um Konzertorgeln. Dennoch ist das Literaturspiel auf beiden<br />
Werken möglich, und zwar in nicht unterschätzender Bandbreite. Geradezu wie<br />
geschaffen sind diese Orgeln für <strong>im</strong>provisatorisches Spiel innerhalb der katholischen<br />
Liturgie, geschaffen ursprünglich für den tridentinischen Ritus und dessen<br />
mystische Handlungen.<br />
8. Hinweis auf Tonaufnahmen<br />
Das letztlich entscheidende Kriterium über eine gute Orgel ist das klangliche<br />
Ergebnis. Um nicht bei allen noch so wichtigen technischen Daten, praktischer<br />
Ausführung und schön abzulesenden Dispositionen stehen zu bleiben, wurde<br />
eine Compact-Disc mit den Orgeln in Waldzell und Johannesberg eingespielt.<br />
Die Platte mit Werken von Bach, Mendelssohn, Reger und Vierne ist auf Anfrage<br />
be<strong>im</strong> Autor gegen Erstattung der Materialkosten erhältlich.<br />
Als Schlussbemerkung sei gestattet, dass der Verfasser für alle Hinweise und<br />
Materialien <strong>im</strong> Zusammenhang mit der Orgelbauanstalt Willibald Siemann<br />
sehr dankbar wäre.<br />
79<br />
Orgeln
Orgeln<br />
9. Literaturhinweise:<br />
1) Zu allen biographischen Angaben über Willibald Siemann und andere Orgelbauer<br />
vgl. Hermann Fischer: 100 Jahre Bund deutscher Orgelbaumeister,<br />
Lauffen am Neckar (Rensch) 1991 und Hermann Fischer/Theodor Wohnhaas:<br />
Lexikon süddeutscher Orgelbauer, Wilhelmshaven (Florian Noetzel) 1994<br />
2) Zu Orgelmusik, Orgelbau und Orgelspiel in der Zeit der deutschen Spätromantik<br />
allgemein vgl. Hermann J. Busch und Michael Heinemann (Hrsg.): Zur<br />
deutschen Orgelmusik des 19. Jahrhunderts, Sinzig (Studio) 1998 und Friedrich<br />
W. Riedel: Die Orgel als sakrales Kunstwerk, Neues Jahrbuch für das Bistum<br />
Mainz, 1991/92, Band I; Mainz (Verlag des bischöflichen Stuhles) 1992<br />
3) Zu allen Angaben über diverse Orgelregister vgl. Karl Locher: Die Orgelregister<br />
und ihre Klangfarben, Bern (Emil Baumgart) 1904<br />
80
Erzbischöfliches Generalvikariat<br />
Referat <strong>Kirchenmusik</strong><br />
Domplatz 3, 33098 <strong>Paderborn</strong><br />
Leiter: Dr. Paul Thissen<br />
Telefon: 0 52 51/125-13 55<br />
Sekretariat: Rita Kramer<br />
Telefon: 0 52 51/125-14 55<br />
Web: www.kirchenmusik-erzbistumpaderborn.de<br />
paul.thissen@erzbistum-paderborn.de<br />
rita.kramer@erzbistum-paderborn.de<br />
Dekanat <strong>Paderborn</strong><br />
DKM Daniel Beckmann<br />
Bruchgarten 25<br />
33106 <strong>Paderborn</strong><br />
Tel.: 0 52 51/8 71 96 13<br />
info@danielbeckmann.de<br />
Dekanat Büren-Delbrück<br />
vak.<br />
Dekanat Höxter<br />
DKM Jörg Kraemer<br />
Holtrupper Weg 20<br />
34434 Borgentreich<br />
Tel.: 0 56 43/339; Fax: 0 56 43/637<br />
Kraemer-Borgentreich@t-online.de<br />
Dekanat Rietberg - Wiedenbrück<br />
DKM Harald Gokus<br />
Glatzerstraße 10<br />
33378 Rheda-Wiedenbrück<br />
Tel. 0 52 42/40 88 43;<br />
Fax: 0 52 42/40 88 45<br />
Harald.Gokus@web.de<br />
Dekanat Bielefeld – Lippe<br />
DKM Georg Gusia<br />
Georgstr. 13<br />
33649 Bielefeld<br />
Tel. 05 21/45 29 49; Fax. 05 21/17 23 91<br />
gusia@jodokus.de<br />
DKM Gregor Schwarz<br />
Hardisser Straße 8<br />
32791 Lage<br />
Tel. 0 52 32/92 18 99;<br />
Fax: 0 52 32/92 19 62<br />
GregorSchwarz@gmx.de<br />
Dekanat Herford – Minden<br />
DKM Peter Wagner<br />
Besselstr. 15<br />
32427 Minden<br />
Tel. 05 71/4 04 15 97<br />
Kontakt@PeterWagner.com<br />
Dekanat Hellweg<br />
DKM Johannes Krutmann<br />
Wichernstr. 1<br />
59063 Hamm 1<br />
Tel. und Fax: 0 23 81/5 35 40<br />
Krutmann@web.de<br />
DKM Roland Krane<br />
Lindenhof 1<br />
81<br />
Anschriften
Anschriften<br />
59505 Bad Sassendorf<br />
Tel. 0 29 27/10 39;<br />
Fax: 0 12 12-5-01 96 23 15<br />
rolandkrane@gmx.de<br />
Dekanat Lippstadt – Rüthen<br />
DKM Johannes Tusch<br />
Nußbaumallee 29<br />
59557 Lippstadt<br />
Tel. und Fax: 0 29 41/ 132 93<br />
joeltusch@aol.com<br />
Dekanat Hochsauerland –West<br />
DKM Hartwig Diehl<br />
Allensteinweg 29a<br />
59755 Arnsberg 1<br />
Tel. 0 29 32/73 34 o. 0 29 32/44 58 30<br />
Fax: 0 29 32/44 58 29<br />
diehlmusic@t-online.de<br />
Dekanat Hochsauerland-Mitte<br />
DKM Mark Ehlert<br />
Freiligrathstraße 3<br />
59872 Meschede<br />
Tel.: 02 91/9 5 2 84 61<br />
markehlert@web.de<br />
Dekanat Hochsauerland-Ost<br />
DKM Werner Komischke<br />
Am Krämershagen 1<br />
59964 Medebach<br />
Tel. 0 29 82/92 17 87<br />
m<strong>im</strong>i@franzlundber.de<br />
82<br />
Dekanat Südsauerland<br />
DKM Helga Lange<br />
Münchener Str. 92<br />
57439 Attendorn<br />
Tel. und Fax: 0 27 22/47 29<br />
Helga.Maria.Lange@t-online.de<br />
DKM Dieter Moers<br />
Maria-Theresia-Str. 9<br />
57462 Olpe<br />
Tel. 0 27 61/46 95<br />
Fax: 0 27 61/82 53 56<br />
dieter.moers@gmx.de<br />
Dekanat Siegen<br />
DKM Franz-Josef Breuer<br />
Stormstr. 19 b<br />
57078 Siegen<br />
Tel. 02 71/8 47 24<br />
Fax: 02 71/2 38 74 99<br />
breuer-siegen@t-online.de<br />
Dekanat Dortmund<br />
DKM Wolfgang Hohmann<br />
Varziner Str. 5<br />
44369 Dortmund<br />
Tel. und Fax:02 31/31 23 81<br />
W.Hohmann.Orgue@gmx.de
Dekanat Unna<br />
DKM Michael Störmer<br />
Sigridstr. 21<br />
58239 Schwerte<br />
Tel. 0 23 04/89 81 20<br />
stoermer@schwerterkirchen.de<br />
Dekanat Emschertal<br />
DKM Markus Breker<br />
Haldenstr. 12<br />
44629 Herne<br />
Tel. 0 23 23/5 15 85<br />
Dekanat Hagen – Witten<br />
DKM Georg Hellebrandt<br />
Hoffnungstaler Straße 37<br />
58091 Hagen<br />
Tel. 0 23 37/47 45 19<br />
ghellebrandt@t-online.de<br />
DKM Christian Vorbeck<br />
Körnerstr. 4<br />
58452 Witten<br />
Tel. 0 23 02/2 77 82 50<br />
webmaster@christianvorbeck.de<br />
Dommusik<br />
Domorganist Gereon Krahforst<br />
Erzbischöfliches Generalvikariat<br />
Domplatz 3<br />
33098 <strong>Paderborn</strong><br />
Tel. (Büro) 0 52 51/125 - 16 58;<br />
privat: 0 52 51/8 76 97 00<br />
Faxnr.: 0 52 51/8 76 97 01<br />
mailto@gereonkrahforst.com<br />
Domkapellmeister Thomas Berning<br />
Erzbischöfliches Generalvikariat<br />
Domplatz 3<br />
33098 <strong>Paderborn</strong><br />
Tel.: (Büro) 0 52 51/125 – 13 46;<br />
83<br />
Anschriften
NOTIZEN<br />
84