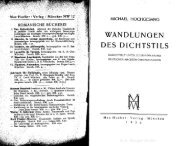Rufmord klassisch - Leben und Werk des Dichters Gottfried August ...
Rufmord klassisch - Leben und Werk des Dichters Gottfried August ...
Rufmord klassisch - Leben und Werk des Dichters Gottfried August ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Folgen der Schillerschen Rezension<br />
Die Reduzierung Bürgers auf seine Lenore in vielen Literaturgeschichten ist ein<br />
Resultat der Klassik <strong>und</strong> beruht letztlich auf der Rezension Schillers in der Jenaer<br />
Allgemeinen Literatur-Zeitung von 1791. Was war passiert? Ein junger Schriftsteller<br />
von einiger lokaler Berühmtheit, dem Drama zugeneigt, vertieft sich in die<br />
Philosophie <strong>und</strong> macht es sich zur Aufgabe, die verderbte Welt - die zerrissene<br />
Gesellschaft - zu einen, nicht durch einen realen Umsturz, sondern durch Lyrik zu<br />
retten. Wie diese Lyrik auszusehen hätte, formuliert er im Tone eines universell<br />
gültigen Gesetzes in einer Rezension über die Bürgersche Gedichtausgabe von 1789.<br />
Und er kommt, wen w<strong>und</strong>ert es, zu dem Resultat, dass der zur Zeit berühmteste<br />
Dichter nicht diesen Anforderungen genügt.<br />
Diese Rezension wurde später ganz unterschiedlich bewertet – für die einen ein<br />
unantastbares Regelwerk für die zukünftige Literatur, für andere eine verschlüsselte<br />
Selbstkritik auf Kosten Bürgers, wie für Julian Schmidt: „Wenn Fiesco, als er sein Weib<br />
umgebracht, ´viehisch um sich haut´ <strong>und</strong> ´mit frechem Zähneblöken gen Himmel´ den<br />
Wunsch ausspricht, ´den Weltbau Gottes zwischen den Zähnen zu haben <strong>und</strong> die ganze<br />
Natur in ein grinsen<strong>des</strong> Scheusal zu zerkratzen; bis sie aussehe, wie sein Schmerz;´ - wenn<br />
Verrina ´bei allen Schaudern der Ewigkeit´ ihm zuschwört, ´einen Strick wolle er drehen aus<br />
seinen eigenen Gedärmen <strong>und</strong> sich erdrosseln, daß seine fliehende Seele in gichtrischen<br />
Schaumblasen ihm zuspritzen solle´: - so empfindet man wohl, daß jene bittere Anklage<br />
gegen Bürger zugleich ein reuiges Bekenntniß enthält.“ 76 Zur Rezension selbst meint<br />
Schmidt: „Die Vorwürfe waren sehr aus der Oberfläche geschöpft, <strong>und</strong> was etwa davon<br />
gegründet sein mochte, traf Schiller´s eigne Gedichte doppelt <strong>und</strong> dreifach. Bürger's Talent<br />
war er in keiner Weise gerecht geworden: die Pfarrerstochter von Taubenhain, der wilde<br />
Jäger, Kaiser <strong>und</strong> Abt, die Kuh, das Lied von der Treue — sämmtliche Balladen aus der Zeit<br />
von 1781—1788, waren fast gar nicht, oder nur in Bezug auf den häßlichen Stoff erwähnt,<br />
da doch die künstlerische Behandlung das Höchste war, was die Deutschen überhaupt in<br />
diesem Fach geleistet haben..“<br />
In seiner Tragischen Literaturgeschichte von 1948 empfindet Walter Muschg mit<br />
drastischen Worten die Rezension sogar als Mittel zum Zweck: „In der Kunst bedeutet<br />
dieses Vollkommenheitsbewußtsein unfruchtbare Erstarrung, auch wenn es nicht in<br />
pharisäischen Dünkel ausartet. Jeder seherische Dichter, der sich auf eine Offenbarung beruft,<br />
läuft Gefahr, auf die Dauer so zu versteinern. Deutschland, das Land <strong>des</strong> Theologenhochmuts<br />
<strong>und</strong> <strong>des</strong> Kirchenstreits, hat diesen Typus auch in der Literatur besonders erfolgreich<br />
am <strong>Werk</strong> gesehen. Alle Macht ist böse <strong>und</strong> entsteht durch Schuld. Auch die Machtstellung,<br />
die Goethe <strong>und</strong> Schiller für sich eroberten, machte davon keine Ausnahme. Nachdem<br />
sie sich einmal verstanden, erwies sich der priesterliche Schiller als der geniale Hüter <strong>und</strong><br />
Mehrer ihres Reiches. Er hatte den strategischen Blick <strong>und</strong> die unermüdliche Freude am<br />
Kampf. Schon auf dem Weg zu Goethe war er vor keiner geistigen Gewalttat zurückgeschreckt.<br />
Eine der schlimmsten war die Rezension, mit der er Bürger, den Dichter der<br />
Lenore, als ein Goethe wohlgefälliges Opfer abschlachtete. Es war die eigene revolutionäre<br />
Vergangenheit, von der er sich mit diesem Meisterwerk an Scharfsinn <strong>und</strong> Bosheit lossagte,<br />
aber Bürger blieb dabei mit seiner Person <strong>und</strong> seinem Ruhm auf der Strecke. So gewaltsam<br />
ging es in Schillers ganzem <strong>Leben</strong> zu.“ 77<br />
27<br />
G.A. Bürger-Archiv




![ERNSTEN BALIADE DIIR(]H G. A. BÃRGnR. - Leben und Werk des ...](https://img.yumpu.com/50237579/1/190x146/ernsten-baliade-diirh-g-a-bargnr-leben-und-werk-des-.jpg?quality=85)