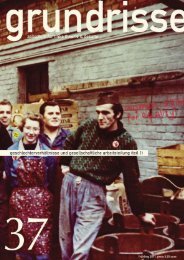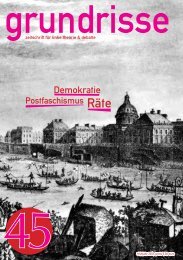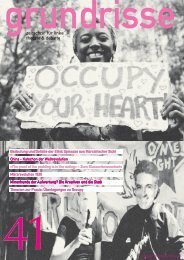kritik der wertkritik kritik der kritik der wertkritik herrschaft, befreiung ...
kritik der wertkritik kritik der kritik der wertkritik herrschaft, befreiung ...
kritik der wertkritik kritik der kritik der wertkritik herrschaft, befreiung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Gewohnheiten gibt, bereitet aber auch darauf vor,<br />
solche anzunehmen, sie ist <strong>der</strong>en Matrix. In <strong>der</strong><br />
gegenwärtigen Situation wird dieses vorbereitende<br />
Stadium jedoch in gewisser Weise zur permanenten<br />
Bedingung. Die Erfahrung verbleibt im Stadium <strong>der</strong><br />
Wie<strong>der</strong>holung, sie verwandelt sich nicht in<br />
Gewohnheit. Die Matrix verschwindet nicht unter<br />
<strong>der</strong> Aufhäufung ihrer Ausgestaltungen, son<strong>der</strong>n<br />
verharrt als solche stets sichtbar im Vor<strong>der</strong>grund.<br />
Unter dieser Voraussetzung verkehrt sich die<br />
Analogie zwischen Kindheit und technischer<br />
Reproduzierbarkeit in einen unlösbaren Konflikt.<br />
Wenn ein Kind das gleiche Märchen noch einmal<br />
zu hören verlangt o<strong>der</strong> dasselbe Spiel noch einmal<br />
spielt, nimmt es jedes Mal das Gleiche als einzigartig<br />
wahr. Jede Wie<strong>der</strong>holung hat den Wert eines<br />
Prototypen, eines Meilensteins. Mit <strong>der</strong> Instanz des<br />
„noch einmal“ ist stets das „ein für alle Male“ verbunden:<br />
In je<strong>der</strong> einzelnen Wie<strong>der</strong>holung wird eine<br />
Art von Vollkommenheit gesucht. Umgekehrt spielt<br />
die technische Reproduzierbarkeit, indem sie die<br />
Gleichheit sogar im Einzigartigen geltend macht,<br />
das „noch einmal“ gegen das „ein für alle Male“ aus.<br />
Der Wie<strong>der</strong>holung im Spiel setzt sie den Wie<strong>der</strong>holungszwang<br />
<strong>der</strong> Warenwelt und <strong>der</strong> Lohnarbeit<br />
entgegen. Während die Kindheit dem Fehlen von<br />
Gewohnheiten über eine beson<strong>der</strong>e Form <strong>der</strong> „ewigen<br />
Wie<strong>der</strong>kehr“ beizukommen versucht, stellt die<br />
Kulturindustrie die nackte Wie<strong>der</strong>holung als<br />
Surrogat <strong>der</strong> Gewohnheit dar, sie äfft das Verlorengegangene<br />
nach und konstruiert falsche, aber scheinbar<br />
verbindliche „Traditionen“.<br />
Die Gesellschaft des reifen Kapitalismus ist bloß<br />
pueril: Es gilt, gegen sie die Kräfte <strong>der</strong> Kindheit zu<br />
mobilisieren, aus denen sie auf beliebige Weise<br />
schöpft, diese jedoch zu einem alptraumhaften<br />
Kin<strong>der</strong>garten verkommen lässt.<br />
Die Entgegensetzung von stets aktueller<br />
Erfahrung <strong>der</strong> Kindheit und ihrer Karikatur, die wir<br />
„pueril“ genannt haben, zeigt sich auf Schritt und<br />
Tritt. Dies gilt in beson<strong>der</strong>em Maße für die so genannte<br />
Freizeit, <strong>der</strong>en Anwachsen die westlichen<br />
Gesellschaften auf ambivalente Weise prägt. Sobald<br />
die Ethik <strong>der</strong> Arbeit, die so viel zur Definition <strong>der</strong><br />
„Erwachsenen“ beigetragen hat, an Einfluss verliert,<br />
passt sich die Gestaltung <strong>der</strong> überschüssigen Zeit<br />
entwe<strong>der</strong> einem zerstreuten und „puerilen“ Modell<br />
an (dies entspräche <strong>der</strong> Perspektive <strong>der</strong> erwachsenen<br />
ArbeiterInnen auf die Kin<strong>der</strong>), o<strong>der</strong> es wird versucht,<br />
an die Ernsthaftigkeit <strong>der</strong> Kindheit anzuschließen.<br />
Eine Kritik <strong>der</strong> Freizeit muss sich an diese<br />
Alternative halten: Für diejenigen, die im Namen<br />
<strong>der</strong> Arbeit auf pedantische und besserwisserische<br />
Weise die eigene „Reife“ ins Treffen führen, gibt es<br />
indessen nichts zu holen.<br />
Auch und vor allem in einer Notsituation hat <strong>der</strong><br />
Schrecken etwas „Pueriles“ an sich und verlangt<br />
nach einem „kindlichen“ Gegenmittel. Die<br />
Gefängniszelle zum Beispiel stellt eine gewohnte<br />
menschliche Umgebung dar: ein Zimmer, das mit<br />
dem Notwendigsten ausgestattet ist, das jedoch einer<br />
leicht parodistischen Verän<strong>der</strong>ung unterzogen<br />
wurde. Es handelt sich um die „puerile“ Version <strong>der</strong><br />
gewohnten Dinge und Verrichtungen. Das am<br />
Fußboden festgenagelte Bett lässt an eine alte Wiege<br />
auf einem Bauernhof denken. Wenn es einen Eimer<br />
gibt, dann erinnert dieser an einen Nachttopf, wenn<br />
auch auf bedrückende und fast boshafte Weise. Die<br />
Hocker sind zu klein und meist aus Plastik. Das zu<br />
hohe Fenster flößt jenes Gefühl <strong>der</strong> Einschüchterung<br />
ein, das die Kin<strong>der</strong> so gut kennen. Die<br />
Einrichtung ist lilliputanisch, sie besteht aus an die<br />
Wand gehängten Zigarettenschachteln, Gegenständen<br />
aus Altpapier und Kartons o<strong>der</strong> kleinen<br />
Holzstücken. Die Zelle hat etwas von einem unheimlichen,<br />
aus wie<strong>der</strong> verwendeten Materialen zusammengebauten<br />
Puppenhaus. Und sie macht allen<br />
Umständen zum Trotz einen vollgerammelten Eindruck.<br />
Der erfahrenen Häftlinge, die den Betrieb kennen,<br />
wissen, dass es sinnlos ist, <strong>der</strong> Albernheit des<br />
Gefängnisses eine eingebildete erwachsene „Autonomie“<br />
entgegen zu setzen, son<strong>der</strong>n dass sie sich in<br />
jedem Augenblick den kindlichen Sinn für das<br />
Unbehagen und die Prekarität lebendig erhalten<br />
müssen, um sich <strong>der</strong> Gewöhnung an die Umstände<br />
zu wi<strong>der</strong>setzen. Deshalb muss die Zelle so karg wie<br />
möglich ausgestattet sein, damit sie immer ungewohnt<br />
erscheint.<br />
In seinem bedeutenden Buch über Kindheit und<br />
Geschichte 3 bemerkt Giorgio Agamben, dass, würden<br />
wir mit einer perfekt ausgebildeten Sprache zur Welt<br />
kommen, diese die gleiche Funktion hätte wie etwa<br />
<strong>der</strong> Geruchssinn bei den Tieren. Sie wäre also wie ein<br />
Orientierungsorgan in einer Umwelt, in die wir eingetaucht<br />
wären wie in eine Art Fruchtwasser, ohne<br />
dass wir die Möglichkeit hätten, daraus auszubrechen<br />
o<strong>der</strong> sie zu verän<strong>der</strong>n. Umgekehrt ausgedrückt, bedeutet<br />
eine Kindheit zu haben und die Erfahrung des<br />
Zugangs zur Sprache durchzumachen, einen dauerhaften<br />
Bruch zwischen dem menschlichen Wesen<br />
und jeglicher bestimmten Umwelt. Besser gesagt, haben<br />
wir dank des schrittweise vollzogenen Übergangs<br />
von <strong>der</strong> Stummheit des sinnlichen Lebens zur<br />
artikulierten Rede keine „Umwelt“, son<strong>der</strong>n eine<br />
Welt. Eine Welt, <strong>der</strong> wir zugehören, wobei mannigfache<br />
Wi<strong>der</strong>stände und die Unvollkommenheit <strong>der</strong><br />
wechselseitigen Durchdringung weiter bestehen bleiben.<br />
Eine historische Welt, die zu verän<strong>der</strong>n ist. Die<br />
Kindheit, die einen <strong>der</strong> Umwelt entreißt, öffnet die<br />
Möglichkeit <strong>der</strong> Geschichte.<br />
Anmerkungen zur Grammatik <strong>der</strong> Multitude<br />
Paolo Virno<br />
grundrisse_16_2005 seite_55<br />
9