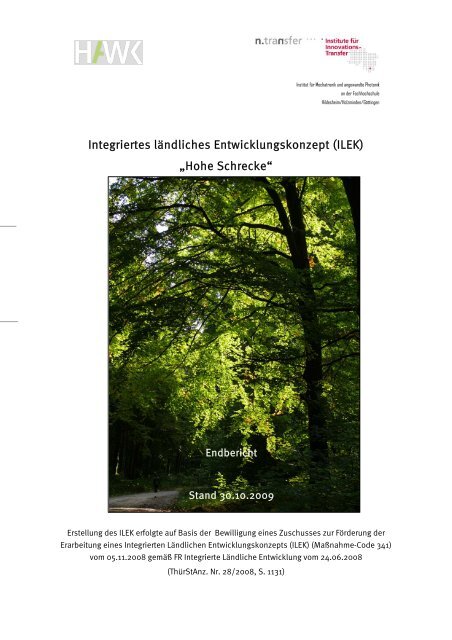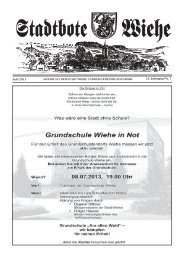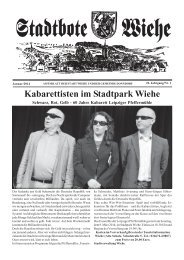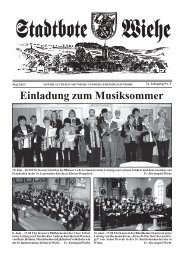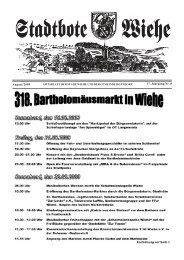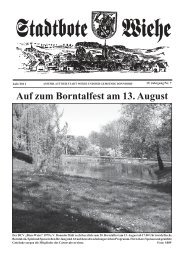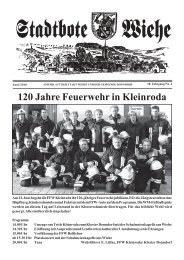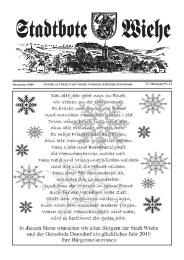Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK ... - Stadt Wiehe
Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK ... - Stadt Wiehe
Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK ... - Stadt Wiehe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Integriertes</strong> <strong>ländliches</strong> <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>)<br />
„Hohe Schrecke“<br />
Endbericht<br />
Stand 30.10.2009<br />
Institut für Mechatronik und angewandte Photonik<br />
an der Fachhochschule<br />
Hildesheim/Holzminden/Göttingen<br />
Erstellung des <strong>ILEK</strong> erfolgte auf Basis der Bewilligung eines Zuschusses zur Förderung der<br />
Erarbeitung eines Integrierten Ländlichen <strong>Entwicklungskonzept</strong>s (<strong>ILEK</strong>) (Maßnahme-Code 341)<br />
vom 05.11.2008 gemäß FR Integrierte Ländliche Entwicklung vom 24.06.2008<br />
(ThürStAnz. Nr. 28/2008, S. 1131)
Auftraggeber:<br />
Kommunale Arbeitsgemeinschaft „Hohe Schrecke“ und <strong>Stadt</strong> Rastenberg,<br />
vertreten durch: Frau Dittmer, Bürgermeisterin der <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong><br />
Auftragnehmer:<br />
N-Transfer GmbH<br />
IMAPH an der Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen<br />
Von-Ossietzky-Straße 99<br />
37085 Göttingen<br />
Bearbeiter:<br />
Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst Göttingen (HAWK)<br />
Fakultät Ressourcenmanagement<br />
Büsgenweg 1a<br />
37077 Göttingen<br />
Prof. Dr. Ulrich Harteisen<br />
Dipl.-Geogr. Sebastian Tränkner<br />
Dipl.-Ing. Susanne Schlagbauer<br />
Dipl. Umweltwiss. Stephanie Lübke
Inhalt<br />
1 Einführung ........................................................................................................................1<br />
1.1 Planungsauftrag ...............................................................................................................1<br />
1.2 Methodik und Ablauf des <strong>ILEK</strong>-Prozesses..................................................................... 2<br />
1.3 Berücksichtigung vorhandener Planungen ................................................................... 3<br />
2 Beschreibung des Planungsgebiets ................................................................................. 6<br />
2.1 Lage und Abgrenzung .................................................................................................. 6<br />
2.2 Natur und Landschaft .................................................................................................. 8<br />
2.2.1 Naturräumliche Gliederung ...................................................................................... 9<br />
2.2.2 Geologie und Boden ................................................................................................ 9<br />
2.2.3 Wasser....................................................................................................................10<br />
2.2.4 Klima ......................................................................................................................10<br />
2.2.5 Vegetation und Biotope .......................................................................................... 11<br />
2.3 Wirtschaft und Bevölkerung ........................................................................................13<br />
3 Ziele der überörtlichen Raumordnung und -planung .......................................................17<br />
3.1 Raumstruktur..............................................................................................................17<br />
3.2 Freiraumstruktur / Natur und Landschaft ....................................................................19<br />
3.3 Fremdenverkehr und Erholung ................................................................................... 22<br />
3.4 Weitere Flächennutzungen......................................................................................... 25<br />
3.4.1 Windenergie .......................................................................................................... 25<br />
3.4.2 Rohstoffe ............................................................................................................... 27<br />
3.4.3 Großflächige Industrieansiedlungen ...................................................................... 27<br />
4 Stärken-Schwächen-Analyse.......................................................................................... 28<br />
4.1 Tourismus, Erholung und Landschaft ......................................................................... 28<br />
4.1.1 Verkehrsanbindung ............................................................................................... 28<br />
II
4.1.2 Touristische Infrastruktur....................................................................................... 30<br />
4.1.3 Touristische Anlaufpunkte in der Region ................................................................ 33<br />
4.1.4 Angebote für naturverbundene Aktivitäten............................................................. 36<br />
4.1.5 Touristische Anlaufpunkte im Umfeld der Region ................................................... 37<br />
4.1.6 Touristisches Marketing......................................................................................... 38<br />
4.1.7 Landschaft............................................................................................................. 43<br />
4.1.8 Zusammenfassung Stärken/Schwächen ................................................................ 44<br />
4.2 Land- und Forstwirtschaft........................................................................................... 45<br />
4.2.1 Forstwirtschaft ....................................................................................................... 45<br />
4.2.2 Zusammenfassung Stärken und Schwächen.......................................................... 50<br />
4.3 Siedlungsbau und Breitband-Infrastruktur ..................................................................51<br />
4.3.1 Siedlungsstruktur ...................................................................................................51<br />
4.3.2 Leerstand (historischer) Bausubstanz.................................................................... 52<br />
4.3.3 Industrie- und Gewerbebrachflächen ..................................................................... 54<br />
4.3.4 Breitband-Infrastruktur .......................................................................................... 56<br />
4.3.5 Zusammenfassung Stärken und Schwächen.......................................................... 56<br />
4.4 Bildung und Kultur..................................................................................................... 59<br />
4.4.1 Umweltbildung ...................................................................................................... 59<br />
4.4.2 Berufliche Aus- und Weiterbildung..........................................................................61<br />
4.4.3 Zusammenfassung Stärken und Schwächen.......................................................... 63<br />
4.5 Vernetzung ................................................................................................................ 63<br />
5 Regionale Entwicklungsstrategie.................................................................................... 64<br />
5.1 Leitbild der Region „Hohe Schrecke“ ......................................................................... 64<br />
5.2 Entwicklungsziele ...................................................................................................... 65<br />
5.2.1 Leitziel................................................................................................................... 65<br />
III
5.2.2 Handlungsfeldübergreifende strategische Leitlinien .............................................. 66<br />
5.3 Übersicht der Handlungsfelder und Leitthemen ......................................................... 67<br />
5.4 Handlungsfeld „Tourismus, Erholung und Landschaft“ .............................................. 68<br />
5.4.1 Entwicklungsziel.................................................................................................... 68<br />
5.4.2 Leitthema Touristische Infrastruktur und Angebote................................................ 69<br />
5.4.3 Leitthema Touristische Routen und Themenwege................................................... 80<br />
5.4.4 Leitthema Informationsmanagement und Marketing.............................................. 82<br />
5.4.5 Leitthema Landschaftsentwicklung........................................................................ 87<br />
5.5 Handlungsfeld „Land- und Forstwirtschaft“................................................................ 88<br />
5.5.1 Entwicklungsziel.................................................................................................... 88<br />
5.5.2 Leitthema Regionale Produktvermarktung.............................................................. 88<br />
5.5.3 Leitthema Regionale Energienutzung ..................................................................... 92<br />
5.5.4 Leitthema Soziale und naturnahe Land- und Forstwirtschaft .................................. 94<br />
5.6 Handlungsfeld „Siedlungsbau und IT-Infrastruktur“................................................... 96<br />
5.6.1 Entwicklungsziel.................................................................................................... 96<br />
5.6.2 Leitthema Erhaltung historischer Bausubstanz ...................................................... 96<br />
5.6.3 Leitthema Brachflächenrevitalisierung................................................................. 100<br />
5.6.4 Leitthema Ausbau der Breitbandtechnologie ........................................................102<br />
5.7 Handlungsfeld „Bildung und Kultur“........................................................................ 106<br />
5.7.1 Entwicklungsziel.................................................................................................. 106<br />
5.7.2 Leitthema Angebote in der Umweltbildung............................................................107<br />
5.7.3 Leitthema Angebote in der beruflichen Aus- und Weiterbildung ............................ 110<br />
6 Zusammenfassung und Perspektiven ........................................................................... 113<br />
7 Literatur und Quellen .................................................................................................... 114<br />
8 Anhang – Maßnahmenblätter und Maßnahmentabelle ................................................. 117<br />
IV
Tabellenverzeichnis<br />
Tabelle 1: Klimacharakteristik des Landkreises Sömmerda (TLUG, 2009) .................................... 11<br />
Tabelle 2: Klimacharakteristik des Kyffhäuserkreises (TLUG, 2009)............................................. 11<br />
Tabelle 3: Übernachtungsangebote, Art und Bettenanzahl in der Region (e. D., Stand 2008;<br />
Quelle: Internetseiten der Städte, Gemeinden und Anbieter) ..................................................... 30<br />
Tabelle 4: Gastronomische Angebote in der Region (e. D., 2009; Quelle: Internetseiten der Städte<br />
und Gemeinden sowie www.gelbeseiten.de )............................................................................. 32<br />
Tabelle 5: Rad-, Wander- und Themenwege (e. D., 2009; Quelle: Rad- und Wanderkarte<br />
Kyffhäuserkreis mit Geopark Kyffhäuser).................................................................................... 33<br />
Tabelle 6: Touristische Anlaufpunkte und Sehenswürdigkeiten in der Region (e. D., 2009; Quelle:<br />
Internetseiten der Städte, Gemeinden und Anbieter) ................................................................. 35<br />
Tabelle 7: Touristische Anlaufpunkte in der Umgebung (e. D., 2009; Quelle: Internetseiten der<br />
Tourismusverbände) .................................................................................................................. 37<br />
Tabelle 8: Auswahl von Veranstaltungen in der Region 2009 (e. D., Quellen: Internetseiten der<br />
Gemeinden)............................................................................................................................... 40<br />
Tabelle 9: Baumartenverteilung Tabelle 10: Waldbesitzverteilung.......................................... 45<br />
Tabelle 11: AZ, GZ, LVZ und Grünlandanteil in den beiden Landkreisen ...................................... 47<br />
Tabelle 12: Verteilung der Größenklassen in den Erwerbsformen Haupt- und Nebenerwerb........ 48<br />
Tabelle 13 Landwirtschaftliche Betriebe der Region (2007)......................................................... 49<br />
Tabelle 14: Übersicht über die leerstehenden Gebäude in der Planungsregion........................... 52<br />
Tabelle 15: Industrie- und Gewerbebrachen ................................................................................55<br />
Tabelle 16: Institutionen im Bereich Umweltbildung................................................................... 59<br />
Tabelle 17: Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung.................................................................61<br />
Tabelle 18: Übersicht über Handlungsfelder und Leitthemen ..................................................... 68<br />
Tabelle 19: Finanzierungsmöglichkeiten für die Revitalisierung................................................. 101<br />
V
Abbildungsverzeichnis<br />
Abbildung 1: Die Organisation des <strong>ILEK</strong>-Prozesses ....................................................................... 5<br />
Abbildung 2: Die Planungsregion .................................................................................................8<br />
Abbildung 3: Waldbesitzverteilung (Naturstiftung DAVID, 2008) ................................................ 46<br />
Abbildung 4: Das System der Entwicklungsziele in der Region „Hohe Schrecke“........................ 65<br />
Abbildung 5: Touristische Schwerpunkte der Projektregion Hohe Schrecke. (e. D., 2009 ).......... 70<br />
Abbildung 7: Der Eggeturm im Teutoburger Wald ........................................................................77<br />
Abbildung 8: Logo „Hohe Schrecke“ .......................................................................................... 84<br />
Abbildung 10: Verschiedene Formen der Holzbearbeitung, dargestellt auf dem ersten regionalen<br />
Holzmarkt .................................................................................................................................. 90<br />
Diagrammverzeichnis<br />
Diagramm 1: Bevölkerungsentwicklung in der <strong>ILEK</strong>-Region..........................................................15<br />
Diagramm 2: Entwicklung der Bevölkerung von 2006 bis 2020 in der Planungsregion nach<br />
Altersgruppen .............................................................................................................................16<br />
Diagramm 3: Betriebsgrößenverteilung in der Planungsregion (Anzahl der Betriebe,<br />
Größengruppen in ha; e. D. 2009).............................................................................................. 47<br />
Diagramm 4: Haupt- und nebenerwerbliche Betriebe der Planungsregion im Kyffhäuserkreis (e.D.,<br />
2009)......................................................................................................................................... 48<br />
VI
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
1 Einführung<br />
1.1 Planungsauftrag<br />
Die Kommunen der Region „Hohe Schrecke“ haben im November 2008 die N-Transfer GmbH,<br />
IMAPH an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst<br />
Hildesheim/Holzminden/Göttingen (HAWK), mit der Erarbeitung des Integrierten Ländlichen<br />
<strong>Entwicklungskonzept</strong>s (kurz „<strong>ILEK</strong>“) im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der integrierten<br />
ländlichen Entwicklung beauftragt.<br />
Das <strong>ILEK</strong> ist ein teilräumlich und fachspezifisch konkretisiertes <strong>Entwicklungskonzept</strong> für die<br />
Region „Hohe Schrecke“. Es hat zum einen die strategische Aufgabe, aktuelle<br />
Entwicklungsdefizite aufzuzeigen, Potentiale für die zukünftige Regionalentwicklung zu<br />
bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Erreichung von Entwicklungszielen aufzuzeigen.<br />
Wesentliches Merkmal der Erarbeitung eines <strong>ILEK</strong>s ist die Gestaltung als Bottom-up-Prozess – ein<br />
Prozess also, der vor allem von den Menschen aus der Region heraus getragen wird.<br />
Auf Arbeitsgruppen-Workshops wurden zusammen mit Akteuren der Region in verschiedenen<br />
Handlungsfeldern Stärken und Schwächen konkretisiert, Entwicklungsziele formuliert, Lösungen<br />
für bestehende Problemlagen diskutiert und Projektideen entwickelt. Die zahlreich eingebrachten<br />
Projektvorschläge stehen dabei für eine engagierte Beteiligung der Akteure.<br />
Das <strong>ILEK</strong> baut auf die bestehende Vision „Hohe Schrecke - Alter Wald mit Zukunft“ auf. Die<br />
Erweiterung dieser Vision für das gesamte Planungsgebiet über das Waldgebiet hinaus war eine<br />
zentrale Aufgabe für den <strong>ILEK</strong>-Prozess. Das Oberziel für die Regionalentwicklung soll zukünftig<br />
die Entwicklung eines naturnahen Tourismus, die Entwicklung und Stärkung von<br />
Wertschöpfungsketten in der Land-und Forstwirtschaft sowie der Erhalt und die Pflege der<br />
naturräumlichen Besonderheiten und des kulturellen Erbes sein.<br />
Es dient weiterhin als strategische Grundlage für den effektiven Einsatz staatlicher Maßnahmen<br />
und Förderungen, die auf die regionsspezifischen Entwicklungsdefizite und<br />
Entwicklungspotentiale abgestimmt sind (siehe auch LEP 2004 B 2.3.8). Das <strong>ILEK</strong> soll das Wissen<br />
und die Entwicklungsvorstellungen eines breiten Spektrums regionaler Akteure und<br />
verschiedener Interessengruppen aufgreifen und damit als integratives Konzept eine<br />
Entscheidungsgrundlage für die Entwicklung der Region sein.<br />
Zentrale Maßgabe für die Erarbeitung des <strong>ILEK</strong>s „Hohe Schrecke“ war die Flankierung des<br />
erfolgreich bestrittenen Wettbewerbbeitrags der Region zum Bundeswettbewerb idee.natur,<br />
welcher erstmalig Fördermöglichkeiten aus dem Naturschutzbereich mit Förderungen der<br />
Regionalentwicklung kombiniert und so eine integrierte Entwicklung gewährleisten soll.<br />
Der abschließende Bericht enthält alle für ein <strong>ILEK</strong> wesentlichen Inhalte: die Analyse der<br />
relevanten Strukturen und Ausgangsbedingungen, eine Stärken-Schwächen-Analyse, eine<br />
regionale Entwicklungsstrategie, Projektideen und Maßnahmen sowie Empfehlungen für die<br />
weitere Projektentwicklung und -finanzierung.<br />
1
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
1.2 Methodik und Ablauf des <strong>ILEK</strong>-Prozesses<br />
Maßgabe für die Erstellung des <strong>ILEK</strong> war die Einbeziehung eines breiten Akteursspektrums, um<br />
Leitlinien zu entwickeln und umsetzungsfähige Maßnahmen zu beschließen. Die bereits<br />
umfangreich vorliegenden Entwicklungsplanungen zur Region „Hohe Schrecke“ dienen hierbei<br />
als in der Region akzeptierte Grundlage, um aufwendige und ermüdende Doppelarbeiten zu<br />
minimieren. Die Schwerpunkte der <strong>ILEK</strong>-Erstellung lagen daher in der Zusammenführung<br />
vorhandener Planungen und Projektideen sowie in der Erarbeitung neuer Maßnahmen.<br />
Die Erarbeitung des <strong>ILEK</strong> „Hohe Schrecke“ erfolgte auf zwei Ebenen:<br />
1. fachliche Bearbeitung durch das beauftragte Bearbeiterteam – Erfassung, Auswertung und<br />
Interpretation vorhandener statistischer Daten und planerischer Aussagen<br />
2. Einbeziehung regionaler Akteure – Expertengespräche, moderierte Workshops und öffentliche<br />
Diskussionsforen<br />
Das <strong>ILEK</strong> „Hohe Schrecke“ dokumentiert folglich sowohl die Ergebnisse der fachlichen Bewertung<br />
als auch die Ergebnisse des Abstimmungsprozesses regionaler Akteure. Als analytisch<br />
konzeptionelle Grundlage bildet es die Grundlage für ein sich anschließendes<br />
Regionalmanagement.<br />
Breite Beteiligung von Akteuren und Interessengruppen<br />
Sollen Entwicklungsziele und Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden, ist die Akzeptanz und<br />
freiwillige Unterstützung durch verschieden betroffene Akteure und Interessengruppen nötig. Von<br />
Beginn an wurde mit der Durchführung von Regionalkonferenzen, Arbeitsgruppentreffen und<br />
Gesprächen mit Fachexperten einer Vielzahl von Akteuren die Möglichkeit gegeben, sich in den<br />
Prozess einzubringen. Mit Pressemitteilungen wurde die Öffentlichkeit regelmäßig über den<br />
Fortgang des Prozesses informiert. Das <strong>ILEK</strong> wurde über die gesamte Laufzeit der Erarbeitung in<br />
enger Abstimmung mit den Auftraggebern (die beteiligten Thüringer Gemeinden der KAG „Hohe<br />
Schrecke“ und der <strong>Stadt</strong> Rastenberg), dem Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Gotha,<br />
den Regionalen Aktionsgruppen Sömmerda-Erfurt und Kyffhäuser und Akteuren der Region<br />
erarbeitet. Es wurden über verschiedene Workshops zahlreiche Einzelgespräche und<br />
Projektbereisungen durchgeführt. Eine Tabelle hierzu befindet sich im Anhang.<br />
Zeitlicher Ablauf des <strong>ILEK</strong>-Prozesses<br />
01.12.2008 Bestandsaufnahme 1. Teil<br />
15. Januar 2009 Bestandsaufnahme 2. Teil<br />
22.01.2009 Auftraggebergespräch<br />
26. Februar 2009 Regionalforum – Auftaktveranstaltung zum <strong>ILEK</strong><br />
07./08. und 23. April 2009 1. Phase Workshops und Projekttreffen<br />
30. Mai 2009 Abgabe des Zwischenberichts<br />
25. Juni 2009 Strategie-Workshop<br />
2
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
25. September 2009 Vorlage der Korrekturfassung des Abschlussberichts<br />
13. Oktober 2009 Abgabe der Endfassung des Abschlussberichts<br />
22. Oktober 2009 Regionalforum – Präsentation des <strong>ILEK</strong><br />
1.3 Berücksichtigung vorhandener Planungen<br />
Die Abgrenzung der Region „Hohe Schrecke“ ist durch einen gemeinsamen Bezug der<br />
Gemeinden zu einem homogenen Landschaftsraum geprägt und deckt anteilig folgende<br />
administrativen Gebietseinheiten ab:<br />
� den Landkreis Kyffhäuserkreis in der Planungsregion Nordthüringen<br />
� den Landkreis Sömmerda in der Planungsregion Mittelthüringen<br />
Für die Abstimmung des <strong>ILEK</strong> mit übergeordneten raumplanerischen Vorgaben sind daher<br />
folgende Planungen und Vorhaben zu beachten:<br />
� Landesentwicklungsplan Thüringen 2004,<br />
� Regionaler Raumordnungsplan Nordthüringen 1999 für den Teil des Landkreises Kyffhäuser<br />
(Hohe Schrecke) und<br />
� Regionaler Raumordnungsplan Mittelthüringen 1999 für den Teil des Landkreises Sömmerda<br />
(Hohe Schrecke / Schmücke / Finne).<br />
Zusätzlich werden die aktuelleren und in Zukunft für die regionale Entwicklungsstrategie<br />
rechtsverbindlichen Aussagen der im Entwurf vorliegenden Fortschreibungen der Regionalen<br />
Raumordnungspläne (Regionalpläne Nordthüringen und Mittelthüringen) in die Analyse<br />
einbezogen.<br />
Auftragsgemäß soll das <strong>ILEK</strong> „Hohe Schrecke“ mit Planungen der ländlichen Entwicklung<br />
(Regionales <strong>Entwicklungskonzept</strong>, LEADER+ und ILE-Instrumente wie Agrarstrukturelle<br />
Entwicklungsplanung und Dorferneuerung) und insbesondere mit den vorliegenden regionalen<br />
Entwicklungsstrategien der regionalen Arbeitsgruppen Kyffhäuser und Sömmerda-Erfurt<br />
abgestimmt werden. Hierdurch sollen Mehrfachplanungen vermieden, und Synergieeffekte erzielt<br />
werden. Folgende Planungen mit ihren Entwicklungszielen und Vorhaben wurden berücksichtigt:<br />
� Regionales <strong>Entwicklungskonzept</strong> Unstrut-Helme (1998/2000),<br />
� Regionale Entwicklungsstrategie der Regionalen Aktionsgruppe Kyffhäuser (2008),<br />
� Regionale Entwicklungsstrategie der Regionalen Aktionsgruppe Sömmerda – Erfurt (2007),<br />
� Agrarstrukturelle Entwicklungsplanungen/Integrierte ländliche <strong>Entwicklungskonzept</strong>e,<br />
� Flurbereinigungs- bzw. Bodenordnungsverfahren und Dorferneuerungen,<br />
Die Verknüpfung des <strong>ILEK</strong> mit dem Wettbewerbsbeitrag zum Bundeswettbewerb idee.natur<br />
3
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Ziele für den Natur- und Landschaftsschutz sind für das Planungsgebiet überwiegend im Rahmen<br />
des Antrags zum Bundeswettbewerb idee.natur formuliert. Es werden hier insbesondere<br />
naturschutzfachliche Belange gefördert, die gleichzeitig regionale Entwicklungschancen in<br />
Verbindung mit dem Waldgebiet “Hohe Schrecke“ aufzeigen. Daher wurden Ziele und<br />
Maßnahmen auch für die Wirtschaftssektoren sanfter Tourismus, Holzwirtschaft und regenerative<br />
Energien auf der Basis von Holz vorgeschlagen. Sie wurden mit dem <strong>ILEK</strong> abgeglichen, sofern<br />
dies entweder ausdrücklich im Projektantrag empfohlen oder im Rahmen der<br />
Arbeitsgruppentreffen von den regionalen Akteuren gewünscht wurde. Weiterhin wurde bei der<br />
Zielfindung für das <strong>ILEK</strong> darauf geachtet, dass sie die naturschutzfachlichen Ziele des<br />
Projektantrags unterstützen (z. B. Umweltbildung) oder diesen zumindest nicht entgegenstehen.<br />
Eine erste Abstimmung der Ziele und Maßnahmen erfolgte Anfang April 2009 durch einen<br />
persönlichen Termin mit dem Antragsteller Naturstiftung DAVID. Weitere intensive Abstimmungen<br />
wurden im Verlauf der Bearbeitungen durchgeführt.<br />
4
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Abbildung 1: Die Organisation des <strong>ILEK</strong>-Prozesses<br />
5
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
2 Beschreibung des Planungsgebiets<br />
2.1 Lage und Abgrenzung<br />
Die „Hohe Schrecke“ und die sich ihr anschließenden „Finne“ und „Schmücke“ sind ein dem<br />
Harz südlich vorgelagerter Höhenzug am Nordostrand des Thüringer Beckens. Das Waldgebiet<br />
der „Hohen Schrecke“ umfasst in diesem Landschaftsraum dabei rund 5.500 ha, von denen sich<br />
ca. 5.000 ha in Thüringen befinden. 1 Besonders ist, dass diese Flächen bis heute nahezu<br />
undurchschnitten blieben und kaum Verkehrswege aufweisen. Das Planungsgebiet des <strong>ILEK</strong>s<br />
erstreckt sich auf einer Gesamtfläche von ca. 19.200 ha. Das Planungsgebiet „Hohe Schrecke“<br />
liegt im Nordosten des Freistaates Thüringen und grenzt im Osten direkt an das Bundesland<br />
Sachsen-Anhalt an.<br />
Das Planungsgebiet ist ca. 150 km östlich von Göttingen, ca. 40 km nördlich von Weimar bzw.<br />
rund 60 km nordöstlich von Erfurt sowie in östlicher Richtung ca. 70 km (Halle) bis ca. 100 km<br />
(Leipzig) von der Metropolregion Halle-Leipzig Sachsendreieck entfernt. 2 Die Gemeinden und<br />
Städte der Planungsregion liegen in den aneinander angrenzenden Thüringischen Landkreisen<br />
Kyffhäuserkreis und Sömmerda.<br />
Rund 11.250 Einwohner 3 leben in der Entwicklungsregion „Hohe Schrecke“:<br />
Landkreis Kyffhäuserkreis<br />
� Gemeinde Donndorf (856 EW; erfüllende Gemeinde <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>),<br />
� Gemeinde Gehofen (724 EW; VG 4 „Mittelzentrum Artern“; ),<br />
� <strong>Stadt</strong> Heldrungen (2.239 EW; VG „An der Schmücke“),<br />
� Gemeinde Hauteroda (606 EW; VG „An der Schmücke“),<br />
� Gemeinde Nausitz (181 EW; VG „Mittelzentrum Artern“),<br />
� Gemeinde Oberheldrungen (921 EW; VG „An der Schmücke“),<br />
� Gemeinde Reinsdorf (858; VG „Mittelzentrum Artern“),<br />
� <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> (2.108 EW; Erfüllende Gemeinde <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>),<br />
1<br />
Johst, Adrian (Naturstiftung DAVID, Erfurt) schriftliche Mitteilung vom 15.07.2008<br />
2<br />
Die Entfernungsangaben beziehen sich auf die durchschnittlichen Fahrkilometer ausgehend von der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Wiehe</strong>.<br />
3<br />
Die angegebene Einwohnerzahl ergibt sich aus der Summe der ermittelten Einwohnerzahlen der Städte<br />
und Gemeinden nach Informationen des Thüringer Landesamtes für Statistik, Gebietsstand 30.06.2008,<br />
veröffentlicht am 11.11.2008 (http://www.tls.thueringen.de/seite.asp?aktiv=dat01<br />
&startbei=datenbank/default2.asp). Die Angabe zur Einwohnerzahl des <strong>Stadt</strong>teils Bachra (<strong>Stadt</strong><br />
Rastenberg) beruhen auf einer mündlichen Mitteilung des Bürgerbüros der VG Kölleda vom 09.10.2008.<br />
4 VG = Abk. f. Verwaltungsgemeinschaft<br />
6
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Landkreis Sömmerda<br />
� Gemeinde Beichlingen (570 EW; VG „Kölleda“),<br />
� Gemeinde Großmonra (969 EW; VG „Kölleda“),<br />
� Gemeinde Ostramondra (578 EW; VG „Kölleda“),<br />
� OT Bachra (inkl. Schafau), <strong>Stadt</strong> Rastenberg (558 EW; VG „Kölleda“).<br />
Beide Landkreise weisen in kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht einige Merkmale auf, die sich<br />
durch eine ähnliche Entwicklung gebildet haben. Hierzu sind beispielsweise die historisch<br />
gewachsenen ländlichen Gemeinden und ihre lange Tradition in der Land- und Forstwirtschaft zu<br />
nennen. Auch der sozio-ökonomische Strukturwandel trifft beide Kreise in Nord- und<br />
Mittelthüringen gleichermaßen stark, die demographischen Entwicklungen sind in beiden<br />
Landkreis-Teilen ähnlich.<br />
7
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Abbildung 2: Die Planungsregion<br />
2.2 Natur und Landschaft<br />
Die „Hohe Schrecke“ ist ein Höhenzug, der dem Harz südlich vorgelagert ist und zusammen mit<br />
den Höhenzügen „Schmücke“, „Finne“ und „Hainleite“ das nördliche Thüringer Becken begrenzt.<br />
Die größtenteils undurchschnittenen Waldflächen der „Hohen Schrecke“ sowie die<br />
angrenzenden Höhenzüge „Schmücke“ und „Finne“ bilden einen Landschaftsraum mit einer<br />
Gesamtausdehnung von ca. 6800 ha, wovon sich über 5700 ha in Thüringen und ca. 1000 ha in<br />
Sachsen-Anhalt befinden. Das Waldgebiet der „Hohen Schrecke“ im engeren Sinn umfasst<br />
8
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
innerhalb dieses Landschaftsraums dabei rund 5.500 ha, wovon rund 5.000 ha durch die<br />
Planungsregion des <strong>ILEK</strong> abgedeckt werden und die übrigen 500 ha im Bundesland Sachsen-<br />
Anhalt liegen. 5<br />
Der Höhenzug „Hohe Schrecke“ stellt ein Buntsandsteingebirge mit einer Höhe von ca. 350 m ü.<br />
NN dar. Einzelne Berge wie der Wetzelhain erreichen Höhen von 370 m ü. NN. Für das Thüringer<br />
Becken sind besonders die in der Trias entstandenen Gesteinsschichten aus Buntsandstein,<br />
Muschelkalk und Keuper typisch. Diese falteten sich bei der alpidischen Gebirgsbildung in der<br />
Tertiärzeit vor ca. 60 Mio. Jahren durch tektonische Verlagerungen. „Hohe Schrecke“,<br />
„Schmücke“ und „Finne“ stellen hier eine Störung der typischen Gebirgsbildung dar. Der unter<br />
den Keupersteinen liegende harte Muschelkalk bildet in einem Band von weniger als 1 km den<br />
Finnenrand, der sich deutlich vom Inneren des Thüringer Beckens abhebt. Durch Unstrut und<br />
andere Nebenbäche wurden die weichen Keuperschichten ausgeräumt, während die schräg<br />
gestellten Muschelkalkbänke bestehen blieben. Geprägt ist das Gebiet heute durch Sand- und<br />
Sandlößböden, die als gering sauer einzustufen sind. Nur in einem kleinen Südostteil auf der<br />
Finne finden sich Kalkböden.<br />
2.2.1 Naturräumliche Gliederung<br />
Naturräumlich wird die Hohe Schrecke den Buntsandsteinhügelländern zugeordnet. Der<br />
überwiegend mit Buchen und Eichen bewaldete Sandstein-Höhenrücken von Hohe Schrecke-<br />
Finne ist durch lang gestreckte Höhenrücken mit randlich tief eingeschnittenen Tälern<br />
charakterisiert. Der südliche Teil des <strong>ILEK</strong>-Fördergebiets gehört zum innerthüringischen<br />
Ackerhügelland, dem so genannten Thüringer Becken, einer vorwiegend ackerbaulich genutzten,<br />
hügeligen Landschaft. Die höchste Erhebung im Planungsgebiet ist mit 380m der Künzelsberg<br />
nordöstlich von Beichlingen. Nördlich des Naturraums Hohe Schrecke – Finne schließt die<br />
Helme-Unstrut-Niederung an, die, ebenfalls ackerbaulich genutzt, Teile der Hohen Schrecke<br />
überdeckt. (TLUG, 2009)<br />
2.2.2 Geologie und Boden<br />
Die <strong>ILEK</strong>-Region „Hohe Schrecke“ befindet sich am Nordrand des Thüringer Beckens. Für das<br />
Thüringer Becken sind besonders die in der Trias entstandenen Gesteinsschichten<br />
Buntsandstein, Muschelkalk und Keuper typisch. Diese falteten sich bei der alpidischen<br />
Gebirgsbildung in der Tertiärzeit vor ca. 60 Mio. Jahren durch tektonische Verlagerungen. „Hohe<br />
Schrecke“, „Schmücke“ und „Finne“ stellen hier jeweils Höhenzüge aus Muschelkalk in<br />
herzynischer Streichrichtung (NW-SO) dar. Unter dem Muschelkalk bildet der Buntsandstein und<br />
Rogensandstein den Sockel (Meynen & Schmithüsen, 1962).<br />
Durch Unstrut und andere Nebenbäche wurden die weichen Keuperschichten ausgeräumt,<br />
während die schräg gestellten und morphologisch härteren Muschelkalkbänke bestehen blieben<br />
und heute als Höhenzüge landschaftsprägend sind. In der <strong>ILEK</strong>-Region dominieren Sand- und<br />
5 Johst, Adrian (Naturstiftung DAVID, Erfurt) schriftliche Mitteilung vom 15.07.2008<br />
9
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Sandlößböden, die als gering sauer einzustufen sind. In einem kleinen Südostteil auf der Finne<br />
finden sich Kalkböden.<br />
2.2.3 Wasser<br />
Die hydrogeologischen Einheiten der „Hohen Schrecke“ bilden Sandsteine (gering bis stark<br />
mineralisiert) sowie im Norden Löß und Lößderivate und im Süden Kalkgestein und vorwiegend<br />
Schluff- und Tonsteine (TLUG, 2009).<br />
Durch das Planungsgebiet fließen ausschließlich Gewässer 2. Ordnung, z.B. Hirschbach,<br />
Schafau, Helderbach und <strong>Wiehe</strong>scher Bach; das gesamte Fließgewässersystem der Hohen<br />
Schrecke gehört zum Wassereinzugsgebiet der Elbe (TLUG, 2009).<br />
Über die Gewässergüte wird die Wasserqualität der Fließgewässer beschrieben. Die<br />
Wasserqualität ist eine der Kennzahlen, aus denen ein Sanierungsbedarf abgeleitet werden<br />
kann. Die Thüringische Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) hat 2006 die<br />
Gewässergüte des Hirschbachs der Güteklasse III-IV (stark bis sehr stark verschmutzt) und die<br />
Schafau der Güteklasse II-III (kritisch belastet) zugeordnet. Zu anderen Gewässern der Region<br />
fehlen den Autoren bislang Daten (TLUG, 2009).<br />
Auf den Plateaulagen sind natürliche Feuchtgebiete (Sumpfgebiete) vorhanden, ansonsten sind<br />
im Planungsgebiet vorwiegend künstliche Kleingewässer zu finden. Erwähnenswert ist die<br />
Talsperre Bachra als landschaftsprägendes Element.<br />
2.2.4 Klima<br />
Das regionale Klima Thüringens wird vor allem durch die Mittelgebirge Thüringer Wald, Thüringer<br />
Schiefergebirge, Rhön und Harz aber auch durch kleinere Erhebungen geprägt. Aus den hieraus<br />
resultierenden unterschiedlichen Einflüssen z.B. auf Niederschläge und Temperatur und der<br />
ebenfalls maßgeblich das Klima beeinflussenden Boden- und Landnutzung lassen sich für<br />
Thüringen vier Klimabereiche unterscheiden:<br />
� Zentrales Mittelgebirge und Harz,<br />
� Südostdeutsche Becken und Hügel, Erzgebirge,<br />
� Thüringer und Bayerischer Wald,<br />
� Alb und Nordbayerisches Hügelland.<br />
Der Landkreis Sömmerda gehört zu den Klimabereichen Zentrale Mittelgebirge und Harz sowie<br />
Südostdeutsche Becken und Hügel und lässt sich im langjährigen Mittel wie folgt<br />
charakterisieren:<br />
10
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Tabelle 1: Klimacharakteristik des Landkreises Sömmerda (TLUG, 2009)<br />
Jahresmitteltemperatur 7,9 bis 9,2°C<br />
Jahressumme Niederschlag 455 bis 605 mm<br />
Sonnenscheindauer 1.476 bis 1.554 h/Jahr<br />
Tage mit Schneedeckenhöhe ab 10 cm 3 bis 16<br />
Überwiegend vorherrschende Windrichtung in freien Lagen Westsüdwest<br />
Auch der Kyffhäuserkreis gehört zu den Klimabereichen Zentrales Mittelgebirge und Harz und<br />
Südostdeutsche Becken, unterscheidet sich aber in der Klimacharakteristik wie folgt:<br />
Tabelle 2: Klimacharakteristik des Kyffhäuserkreises (TLUG, 2009)<br />
Jahresmitteltemperatur 6,9 bis 9,2°C<br />
Jahressumme Niederschlag 450 bis 721 mm<br />
Sonnenscheindauer 1.454 bis 1.513 h/Jahr<br />
Tage mit Schneedeckenhöhe ab 10 cm 4 bis 19<br />
Überwiegend vorherrschende Windrichtung in freien Lagen Westsüdwest<br />
Der bewaldete Höhenzug Hohe Schrecke und Finne beeinflusst durch seine nordwest-südöstliche<br />
Streichrichtung wesentlich die Niederschläge der Region. Der östliche Teil des Landkreises<br />
Sömmerda befindet sich in einer lokalen Luvlage, die Niederschläge für die Gemeinden<br />
Beichlingen, Großmonra, Ostramondra und Rastenberg reichen von 650 mm bis ca. 900 mm. Die<br />
Niederschlagsmengen im Kyffhäuserkreis sind hingegen stark von der Unstrut-Helme-Niederung<br />
beeinflusst und Teil des mitteldeutschen Trockengebiets. Die <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>, die Gemeinden<br />
Donndorf, Nausitz, Gehofen, Reinsdorf sowie Heldrungen liegen bezogen auf den Höhenzug in<br />
einer lokalen Leelage, die Niederschläge reichen zwischen ca. 500 mm bis ca. 650 mm.<br />
Oberheldrungen und Hauteroda haben bereits Anteil an der lokalen Luvlage, die Niederschläge<br />
gehen hier zum Teil in Bereiche von 700 bis 800 mm (TLUG, 2009).<br />
2.2.5 Vegetation und Biotope<br />
Potentiell natürliche Vegetation (PnV)<br />
Als potentiell natürliche Vegetation werden jene Pflanzengesellschaften bezeichnet, die sich auf<br />
den derzeitigen Standortbedingungen aufgrund der jetzt vorherrschenden Vegetation einstellen<br />
würden, wenn jegliche menschliche Einflussnahme unterbliebe. Nahezu das gesamte Gebiet der<br />
11
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Hohen Schrecke wäre in diesem Fall vom Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) bedeckt.<br />
Diese auf basenarmen Gesteinsböden vorkommende Pflanzengesellschaft bildet oftmals<br />
hallenwaldartige Strukturen mit langschaftigen Bäumen aus (Ellenberg, 1996). Sie ist<br />
vergleichsweise artenarm und stets mit einigen Säurezeigern ausgeprägt. Die zweite große<br />
Pflanzengesellschaft der pnV bildet der Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum<br />
milietosum), die auf Böden mit höherer Trophie vertreten ist und im Vergleich zum Hainsimsen-<br />
Buchenwald weitaus artenreicher in der Baumschicht ist (Pott, 1995). Neben diesen beiden<br />
Hauptgesellschaften sind auch noch der Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellarioholosteae-Carpinetum<br />
bzw. Galio-sylvatici-Carpinetum), eine auf Grund- und Stauwasserböden in<br />
Lehmgebieten vorkommende Gesellschaft. Dazu bilden auf den Muschelkalkgebieten<br />
Waldgersten-Buchenwald (Hordelymo-Fagetum), der Waldmeister-Buchenwald (Galio-odorati<br />
Fagetum), Orchideen-Buchenwald (Carici-Fagetum) weitere nennenswerte Gesellschaften<br />
(Naturstiftung DAVID et al., 2008).<br />
Pflanzengeographische Einordnung<br />
Die Flora des Planungsgebiets ist pflanzengeographisch durch die Florenscheide Helme-Unstrut-<br />
Land charakterisiert. Hier liegt die Verbreitungsgrenze für viele südliche Florenelemente, wie zum<br />
Beispiel Märzenbecher (Leucojum vernum), verschiedene Orchideen der Gattungen Knabenkraut<br />
(Orchis) und Ragwurz (Ophrys) oder Wolliger Schneeball (Viburnum lantana). Das Helme-Unstrut-<br />
Land bildet ebenfalls die Verbreitungsgrenze für viele östliche und südöstliche, kontinentale<br />
Florenelemente, wie zum Beispiel Buntes Perlgras (Melica picta), Weißes Fingerkraut (Potentilla<br />
alba) oder die Gewöhnliche Kuhschelle (Pulsatilla vulgaris) (ebd.).<br />
Vegetation und Biotoptypen<br />
Das Waldgebiet „Hohe Schrecke“ kann als typischer mitteleuropäischer Wald in teilweise einzigartiger<br />
Ausprägung als edelholzreicher Laubmischwald mit Buchendominanz sowie stellenweise<br />
Schluchtwäldern charakterisiert werden. Nur im östlichen Teil befinden sich Flächen, die bis zum<br />
Abzug der sowjetischen Streitkräfte als Truppenübungsplatz dienten und waldfrei gehalten<br />
wurden. Hier wurden inzwischen alle militärischen Gebäude abgerissen und das Gebiet großteils<br />
entmunitioniert. Besonders in den umliegenden Bereichen entwickelten sich die Flächen in der 2.<br />
Hälfte des 20 Jahrhunderts in weiten Bereichen nahezu ungestört. Es konnten sich sehr<br />
naturnahe großflächige und zum Teil urwaldähnliche Bestände entwickeln. Mehrere hundert<br />
Hektar dieser Bestände werden durch uralte, mächtige Laubbäume (überwiegend Buchen) der<br />
Altersklasse über 150 Jahre geprägt.<br />
Die Waldflächen der Hohen Schrecke sind zu ca. 80% Laubholzmischwälder. Darunter bilden<br />
40% Buchenmischwälder, 19% Eichenmischwälder und 18% andere Laubholzbestände. 2% sind<br />
kulturbestimmte Laubgehölzbestände und 1% bildet ein Laub-Nadel-Mischwald. Innerhalb dieser<br />
Bestände fällt besonders die hohe Zahl von Wildobstarten und Baumarten, wie Elsbeere, Mispel<br />
oder Mehlbeere auf. Lediglich ca. 20% der Waldbestände sind Nadelholzwälder. Um diesen<br />
Waldbestand finden sich Biotope wie Streuobstwiesen, Brachflächen, Hecken, Trockenbüsche<br />
und Magerrasen (Naturstiftung DAVID et al., 2008).<br />
12
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Den größten Teil an Bodenbedeckung der Flächen im Norden des Planungsgebiets stellt nicht<br />
bewässertes Ackerland dar, die Hanglagen sind hier vorwiegend Wiesen und Weiden, während<br />
der Höhenzug selbst überwiegend mit Laubwäldern bestockt ist. Auch in den südlichen<br />
Gemarkungen herrscht nicht bewässertes Ackerland vor (TLUG, 2009). 6<br />
Schutzgebiete<br />
Die Einzigartigkeit des Waldgebiets „Hohe Schrecke“ wird als ein Teil des Nationalen Naturerbes<br />
Deutschlands gesehen. Der überwiegende Teil des Waldgebiets „Hohe Schrecke“ ist daher unter<br />
Schutz gestellt. Umfangreiche Flächen des Gebiets (5.732 ha) sind als FFH-Gebiet „Hohe<br />
Schrecke-Finne“, bzw. als EU-weites Vogelschutzgebiet ausgewiesen. 7 Innerhalb dieses FFH-<br />
Gebiets liegt das Naturschutzgebiet „Hohe Schrecke“ (NSG 375) und das Naturschutzgebiet<br />
„Finnberg“ (NSG 15). 2004 wurde das Naturschutzgebiet „Hohe Schrecke“ als Kern des FFH-<br />
Gebiets per Verordnung mit einer Gesamtfläche von 3437,3 ha festgesetzt (siehe auch Büro<br />
Opus, 2002). In diesem Naturschutzgebiet sollen die großen, unzerschnittenen Laubmischwälder<br />
erhalten werden und auf großen Teilen des Truppenübungsplatzes natürliche Sukzession<br />
zugelassen werden (TLUG, 2009). Das Naturschutzgebiet „Finnberg“ innerhalb des <strong>ILEK</strong>-<br />
Fördergebietes liegt nördlich von Großmonra und hat insgesamt eine Größe von 70,9 ha. In<br />
diesem Naturschutzgebiet sollen die naturnahen Strukturen mit ihren bedeutenden Biotopen<br />
(besonders Trockenrasen, Hangwäldchen und Streuobstbestände) erhalten werden (TLUG,<br />
2009).<br />
2.3 Wirtschaft und Bevölkerung<br />
Die schwierige Situation auf dem regionalen Arbeitsmarkt kennzeichnet die besondere<br />
Strukturschwäche der Region und stellt ein gravierendes regionalökonomisches Problem mit<br />
Auswirkungen auf die demographische Entwicklung dar. Der Kyffhäuserkreis hat mit 19,2 % (April<br />
2008) eine der höchsten Arbeitslosenquoten in Thüringen. Auch der Landkreis Sömmerda liegt<br />
mit 15,5 % deutlich über dem Landesdurchschnitt von 12,6 %.<br />
Ohne das Auspendeln in umliegende Landkreise und die nahe liegenden Oberzentren würde sich<br />
die Anzahl der Arbeitslosen noch wesentlich drastischer darstellen. Von den 27.553<br />
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten des Landkreises Kyffhäuserkreis (31.12.2007)<br />
pendelten 41,9 % aus. Bei einer Einpendlerquote von 19 % ergab sich ein negativer Pendlersaldo<br />
von knapp 7.800 Beschäftigten. Auch für den Landkreis Sömmerda lassen sich ähnliche Zahlen<br />
feststellen. So waren hier von insgesamt 27.304 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten<br />
knapp 50 % Auspendler. Bei einer Einpendlerquote von 28,7 % bedeutet dieses ein Pendlersaldo<br />
von -8.036 Arbeitnehmern.<br />
6<br />
Die Analyse der Vegetation und Biotoptypen relevanter Flächen des Planungsgebiets, die außerhalb des<br />
bewaldeten Kerngebietes der Hohen Schrecke liegen, wird im Rahmen der Folgeberichte weitergeführt.<br />
7<br />
Quelle: Übersicht über die FFH-Gebietsmeldung in Thüringen gemäß Richtlinie 92/43/EWG, Stand<br />
31.01.2005 (http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/030303_th.pdf)<br />
13
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Insgesamt sank die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2006 im Kyffhäuserkreis gegenüber 2000 von<br />
35,6 % auf 29,7 %. Am 30.12.2007 waren 27.553 Erwerbstätige mit Wohnort im Kyffhäuserkreis in<br />
einem sozialversicherungspflichtig gemeldeten Beschäftigungsverhältnis. Im Vergleichszeitraum<br />
von 2000 bis 2007 war der Beschäftigtenabbau im Wirtschaftsbereich des produzierenden<br />
Gewerbes am höchsten. Das betraf insbesondere das Baugewerbe. So sank die Zahl der<br />
Erwerbstätigen insgesamt im produzierenden Gewerbe von 10,2 % auf 8 % und speziell im<br />
Baugewerbe von 5,5 % auf 2,8 %. In den Wirtschaftsbereichen der Land- und Forstwirtschaft,<br />
Fischerei und der Dienstleistungen war eine eher stabile Entwicklung festzustellen. Insgesamt<br />
sank die Anzahl der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft von 1,6 % auf 1,4 %. Etwas<br />
höher lagen die Verluste im Bereich der Dienstleistungen. Hier sank die Beschäftigtenzahl von<br />
23,7 % auf 20,3 %.<br />
Im Landkreis Sömmerda sank die Anzahl der Erwerbstätigen im Vergleichszeitraum nur gering<br />
von 27,7 % auf 26,5 %. Am 30.12.2007 waren 27.304 Erwerbstätige mit Wohnort im Landkreis<br />
Sömmerda in einem sozialversicherungspflichtig gemeldeten Beschäftigungsverhältnis. Auch<br />
hier blieb die Beschäftigtenzahl in den Wirtschaftsbereichen Land- und Forstwirtschaft und<br />
Dienstleistungen fast konstant und hatte nur geringe Verluste zu verzeichnen. Besonders<br />
auffällig ist ebenfalls der Rückgang der Beschäftigten im Baugewerbe. Hier sank der Wert um<br />
annähernd 50 % von insgesamt 3.647 auf 1.904 Arbeitnehmern.<br />
In den 12 Gemeinden des Planungsgebietes leben derzeit etwa 11.150 Einwohner. Die<br />
Bevölkerungsdichte (12/2007) liegt sowohl im Kyffhäuserkreis (82 EW/km²), als auch im Kreis<br />
Sömmerda (94 EW/km²) weit unter dem Landesdurchschnitt in Thüringen (142 EW/km²) und<br />
weist damit auf den ländlichen Charakter der Region hin. Für die Gemeinden des<br />
Kyffhäuserkreises, die zum Gebiet „Hohe Schrecke“ zählen, kann eine durchschnittliche<br />
Bevölkerungsdichte von 70 EW/km² ermittelt werden. Dabei bewegen sich die Werte zwischen 97<br />
EW/km² in der <strong>Stadt</strong> Heldrungen und 48 EW/km² in Hauteroda. Als sehr gering sind auch die<br />
Bevölkerungsdichten der vier Gemeinden im Landkreis Sömmerda einzustufen (Großmonra 25<br />
EW/km²; Beichlingen 30 EW/km²; Ostramondra 32 EW/km², Rastenberg 78 EW/km²). Hier liegen<br />
die Werte weit unter denen des Kreises von 94 EW/km².<br />
Infolge des wendebedingten Strukturbruchs und weggefallener Beschäftigungsmöglichkeiten<br />
zeigt sich auch hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung ein negativer Trend. Der<br />
Kyffhäuserkreis verzeichnete von 1989 bis 2007 einen stark überdurchschnittlichen<br />
Bevölkerungsrückgang von 19,4 %. Diese Werte waren besonders für viele kleinere Gemeinden<br />
festzustellen. Auch die Zahlen der Gemeinden in der Hohen Schrecke zeigen deutlich die<br />
negative Entwicklung. So lag der durchschnittliche Bevölkerungsrückgang bei 19,5 % (<strong>Wiehe</strong> -<br />
17,2 %; Heldrungen - 23,8 %; Nausitz - 31,4 %). Von 1989 bis 2007 ist auch für den Landkreis<br />
Sömmerda ein Bevölkerungsrückgang von 12,1 % festzustellen (Thüringen 14,3 %). Für die<br />
Gemeinden in der Region „Hohe Schrecke“ aus dem Landkreis Sömmerda waren für den<br />
Zeitraum 1994 bis 2007 folgende Werte festzustellen: Großmonra -2,49%, Ostramondra -6,96 %,<br />
Beichlingen - 14,03% und Bachra (inkl. Ortsteil Bachra) -8,55%.<br />
Laut Prognose des Thüringischen Landesamtes für Statistik werden die Bevölkerungszahlen<br />
ausgehend vom Jahr 2006 bis zum Jahr 2020 im Kyffhäuserkreis insgesamt um 16,7 % und im<br />
14
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Landkreis Sömmerda um ca. 13,3 % sinken. 8 Aufgeschlüsselt nach Altersgruppen wird deutlich,<br />
dass die Zahl der Kinder, der Jugendlichen (Altersgruppe 0-15 Jahre) und von Menschen im<br />
Diagramm 1: Bevölkerungsentwicklung in der <strong>ILEK</strong>-Region<br />
16000<br />
14000<br />
12000<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
Bevölkerungsentwicklung in der Planungsregion<br />
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
männlich<br />
weiblich<br />
insgesamt<br />
erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre) überproportional abnehmen wird. Relativ zunehmen wird<br />
dagegen die Zahl der Menschen über 65 Jahren. Ihr Anteil wird von derzeit rund 20 % auf rund<br />
30% anwachsen, wohingegen der Anteil der Menschen im erwerbsfähigen Alter von rund 69%<br />
auf rund 59% sinken wird (siehe nachfolgende Grafik).<br />
8 Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik, Bevölkerung 2006 und 2020 nach ausgewählten Altersgruppen<br />
und Kreisen am 31.12. des jeweiligen Jahres, Ergebnisse der 11. koordinierten<br />
Bevölkerungsvorausberechnung (KBV)<br />
15
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Veränderung in %<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
-30<br />
Entwicklung der Bevölkerung von 2006 bis 2020 nach<br />
Altersgruppen in den Landkreisen Sömmerda und<br />
Kyffhäuserkreis<br />
LK SÖM<br />
LK KYF<br />
alle<br />
Altersgruppen<br />
0 bis 15 15 bis 65 älter als 65<br />
Diagramm 2: Entwicklung der Bevölkerung von 2006 bis 2020 in der Planungsregion nach<br />
Altersgruppen<br />
Die Städte und Gemeinden der Region haben einen deutlichen Bevölkerungsschwund zu<br />
verzeichnen, der laut Prognosen auch zukünftig nicht abzumildern sein wird. Die anhaltende<br />
Abwanderung junger Menschen und qualifizierter Arbeitskräfte aufgrund fehlender<br />
Beschäftigungsmöglichkeiten führt zu negativen Auswirkungen auf die Attraktivität der Region<br />
als Wirtschaftsstandort und Lebensraum. Mit der Abwanderung junger Menschen geht nicht nur<br />
eine Überalterung der Bevölkerung einher – zunehmende Wohnungs- und Geschäftsleerstände<br />
beeinträchtigen die attraktiven historischen Ortskerne.<br />
16
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
3 Ziele der überörtlichen Raumordnung und -planung<br />
3.1 Raumstruktur<br />
Im Landesentwicklungsplan 2004 werden Ober-, und Mittelzentren als Zentrale Orte,<br />
Raumkategorien (Verdichtungsräume sowie <strong>Stadt</strong>- und Umlandräume im Ländlichen Raum,<br />
Ländlicher Raum, Räume mit besonderen Entwicklungsaufgaben) sowie landesbedeutsame<br />
Entwicklungsachsen ausgewiesen. 9<br />
Gemäß LEP 2004 (Z 2.2.12) sind in den Regionalplänen (hier Entwürfe der Regionalpläne Nordund<br />
Mittelthüringen) die Grundzentren und deren Versorgungsbereiche auszuweisen. Bis zum<br />
Inkrafttreten der Regionalpläne gelten die in den jeweiligen Regionalen Raumordnungsplänen<br />
erfolgten Ausweisungen als Klein- und Unterzentren fort (Z 2.2.13).<br />
Zentrale Orte<br />
Das Planungsgebiet befindet sich in weiterer räumlicher Entfernung von einem Oberzentrum.<br />
Oberzentrale Teilfunktionen für Nordthüringen erfüllt das Mittelzentrum Nordhausen mit<br />
Einrichtungen des spezialisierten höheren Bedarfs in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und<br />
Forschung, Gesundheit, Versorgung, Dienstleistung und Kultur (LEP 2004 Z 2.2.10, RROP NT 1999<br />
Z 3.1.2.1).<br />
Die räumlichen Leistungsträger für das Planungsgebiet stellen vor allem die näher gelegenen<br />
Mittelzentren und die Unter-/bzw. Grundzentren dar. Als nächst gelegene Mittelzentren werden<br />
Artern/Unstrut, Sondershausen (LK KYF) und Sömmerda (LK SÖM) ausgewiesen (LEP 2004 Z<br />
2.2.8) Sie sollen umfassende und regional bedeutsame Angebote an Gütern und<br />
Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs bereitstellen.<br />
Den Unterzentren im ländlich geprägten Planungsgebiet kommt dabei vor dem Hintergrund der<br />
prognostizierten negativen demografischen Entwicklung eine besondere Bedeutung zu, da sie<br />
die Grundversorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen sichern und somit zur<br />
Stabilisierung und Entwicklung des ländlichen Raums beitragen sollen (LEP 2004, B 2.2.11).<br />
Eigene Recherchen 10 ergeben, dass die Bevölkerung entgegen den Aussagen des LEP traditionell<br />
das Oberzentrum Erfurt und das Mittelzentrum mit Teilfunktionen eines Oberzentrums Weimar<br />
(jeweils ca. 45 min bis 1 h Fahrzeit mit dem PKW) für die Versorgung mit Gütern und<br />
Dienstleistungen des spezialisierten höheren Bedarfs aufsuchen. Durch den Ausbau der A 71<br />
werden sich die Fahrzeiten weiter deutlich reduzieren. Der zum Kyffhäuserkreis gehörende Teil<br />
9 LEP 2004, Z 2.2.6, 2.2.8, 2.3.3,2.3.4, G 2.3.5, 2.3.8, 2.4.1<br />
10 Fernmündliche Anfrage bei der <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> am 15.09.2009<br />
17
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
des Planungsgebiets lag vor der politischen Wende 1989/90 im Bezirk Halle. 11 Aus Gesprächen<br />
mit Akteuren der Region wird deutlich, dass das Oberzentrum Halle (Sachsen-Anhalt) auch heute<br />
noch für einen Teil der Bevölkerung eine traditionelle Bedeutung als Versorgungszentrum hat.<br />
Die folgenden zentralen Orte des Planungsgebiets „Hohe Schrecke“ nehmen die Funktion eines<br />
Unterzentrums wahr (RROP NT 1999, Z 3.1.3, B 3.1):<br />
� Oldisleben/Heldrungen mit Versorgungsfunktionen für Hauteroda und Oberheldrungen und<br />
� Roßleben/<strong>Wiehe</strong> in Funktionsteilung mit Versorgungsfunktionen für Donndorf, Gehofen und<br />
Nausitz.<br />
Als weitere nächstgelegene Unterzentren übernehmen<br />
� Kölleda für Beichlingen, Großmonra und Ostramondra sowie<br />
� Buttstätt für die <strong>Stadt</strong> Rastenberg, OT Bachra Versorgungsfunktionen für Gemeinden im<br />
Planungsgebiet (RROP MT 1999, Z 3.1.3, B 3.1.5).<br />
Die <strong>Stadt</strong> Rastenberg ist seit 01.01.2007 der VG „Kölleda“ beigetreten und wird dadurch dem<br />
Verflechtungsbereich des Unterzentrums Kölleda zugeordnet. 12<br />
In den Entwürfen der Regionalpläne 2007 werden die Kategorien Unter- und Kleinzentren zu<br />
Grundzentren zusammengefasst. Danach behalten sowohl die Orte Roßleben/<strong>Wiehe</strong> (funktionsteiliges<br />
Grundzentrum), als auch Heldrungen und Kölleda ihre zentralörtliche Bedeutung (RP<br />
2007 NT Z 1-1).<br />
Die „Hohe Schrecke“ - Ländlicher Raum mit besonderen Entwicklungsaufgaben<br />
Gemäß LEP 2004 ist das Planungsgebiet als ländlicher Raum und weiter spezifiziert als „Raum<br />
mit besonderen Entwicklungsaufgaben“ ausgewiesen (siehe LEP 2004, Karte 1: „Raumstruktur<br />
und Funktionales Verkehrsnetz“ sowie LEP 2004 G 2.3.5 ff.). Damit wird der besondere<br />
wirtschaftliche Anpassungsbedarf der Region verdeutlicht, die hinsichtlich der<br />
Bevölkerungsentwicklung, Arbeitsplatzdichte und Kaufkraft unterdurchschnittliche und negative<br />
Entwicklungstendenzen aufweist (B 2.3.1, G und B 2.3.8). Räumen mit besonderen<br />
Entwicklungsaufgaben soll daher bei Planungen und Maßnahmen zur Stärkung des Ländlichen<br />
Raums und zur Angleichung an die übrigen Landesteile der Vorzug eingeräumt werden,<br />
11 Der LK Sömmerda gehörte bis zur Auflösung der Bezirke 1990 zum Bezirk Erfurt<br />
12<br />
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik (http://www.tls.thueringen.de/seite.asp?aktiv=dat01&<br />
startbei=datenbank/gebiet.asp; Zugriff am 15.09.2009)<br />
18
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
insbesondere bei Maßnahmen zur Verbesserung der Infra- und Wirtschaftsstruktur sowie der<br />
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.<br />
Landesbedeutsame Entwicklungsachsen<br />
Landesbedeutsame Entwicklungsachsen sollen länderübergreifend die Standortgunst Thüringens<br />
und seiner Teilräume in Bezug auf den Ausbau der Infrastruktur, die Siedlungsentwicklung und<br />
insbesondere der zentralen Orte stärken (LEP 2004 G 2.4.1.). Entwicklungsachsen sollen<br />
insbesondere in ländlichen Räumen durch Erschließung und Versorgung in den von ihnen<br />
berührten Räumen sowie durch Bündelung von Infrastruktureinrichtungen Standort- und<br />
Lagevorteile vermitteln. Sie sollen strukturelle Entwicklungsimpulse hervorrufen und zur<br />
Sicherung einer wirtschaftlichen und dauerhaft tragfähigen Entwicklung öffentlicher<br />
Infrastrukturen beitragen (LEP 2004 B 2.4.1).<br />
Das Planungsgebiet grenzt im Westen an die zentrale Nord-Süd-Achse Magdeburg-<br />
Sangerhausen-Erfurt-Suhl (RROP NT 1999 Z 3.3.1.3). Als landesweit bedeutsame Entwicklungsachse<br />
Erfurt–Heldrungen–Artern/Unstrut ist es im LEP 2004 ausgewiesen. Insbesondere durch<br />
den fortschreitenden Neubau der europäisch bedeutsamen Verkehrsverbindung A 71 (Erfurt-<br />
Artern) wird sich mit der Anschlussstelle Heldrungen die Erreichbarkeit und die Anbindung des<br />
Planungsgebiets an den Verdichtungsraum Erfurt und über die Anbindung an die A 38 (Südharz-<br />
Achse) bei Sangerhausen an die Verdichtungsräume Göttingen und Halle-Leipzig erheblich<br />
verbessern (siehe auch LEP 2004 Karte 1). Die bessere Erschließung externer Nachfrage lässt bei<br />
gleichzeitiger Entwicklung der regionalen touristischen Angebote Entwicklungspotentiale für den<br />
Tourismus der Region erwarten.<br />
3.2 Freiraumstruktur / Natur und Landschaft<br />
Räume mit ökologisch besonders bedeutsamen Landschaften nach LEP 2004<br />
Im LEP 2004 (Karte 2. „Freiraumstruktur“) ist das Gebiet des Planungsgebiets als Raum mit<br />
ökologisch besonders bedeutsamen Landschaften ausgewiesen. In diesem Landschaftsraum<br />
sollen die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Arten und Lebensräume sowie das<br />
Landschaftsbild gesichert und die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes<br />
erhalten werden. Das Planungsgebiet soll zur Entwicklung des europäischen<br />
Biotopverbundsystems NATURA 2000 beitragen. Große unzerschnittene Räume wie die „Hohe<br />
Schrecke“ sollen in ihrer Bedeutung für die Freiraumfunktion sowie für die landschaftsbezogene<br />
Erholung bewahrt werden (LEP 2004 G 5.1.1.11).<br />
Allgemeine Ziele für Natur und Landschaft nach RROP Nordthüringen 1999 und RROP<br />
Mittelthüringen 1999<br />
19
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Das Planungsgebiet Hohe Schrecke gehört zu den großen, wenig zerschnittenen und<br />
störungsarmen Räumen. Aufgrund ihrer Bedeutung für den Naturschutz und die<br />
Landschaftspflege sowie für eine naturbezogene Erholung soll dieser Landschaftscharakter<br />
erhalten und vor weiterer Zerschneidung durch raumbedeutsame Vorhaben wie Straßen und<br />
oberirdische Leitungen bewahrt werden (RROP NT 1999 Z 6.1.1.2, RROP MT 1999 Z 6.1.1).<br />
Vorhandene und in Zukunft auftretende Belastungen wie durch Auslaugung der kaum mit Vegetation<br />
bedeckten Kalihalden, wie in dem angrenzenden Kaligebiet Roßleben sollen in ihrer<br />
Gesamtheit auf ein Maß, das sich an der Regenerationsfähigkeit der einzelnen Naturgüter<br />
orientiert, minimiert werden (RROP NT 1999 Z 6.1.1.3 und Begründung).<br />
Entwicklung und Gestaltung des Naturraums<br />
Die großflächigen und unzerschnittenen naturnahen Laubmischwälder der Hohen Schrecke<br />
sollen vor Zerschneidung bewahrt und die extensiv genutzten Ackerterrassen sollen geschützt<br />
und weiterentwickelt werden. Der Charakter einer unzerschnittenen Landschaft und die<br />
vorhandene Landschaftsbildqualität sollen durch naturnahe Waldbewirtschaftung erhalten<br />
werden (RROP NT 1999 Z 6.3.3, s. weiterhin B 6.1.1.2 und B 6.3.3). Weiterhin sollen die<br />
trockenwarmen Standorte am Rande der Finne und die vielgliedrige Landschaft erhalten und<br />
entwickelt werden (RROP1999 MT Z 6.3.2).<br />
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft<br />
In Vorranggebieten für Natur und Landschaft sollen die Belange des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege sowie die ökologischen Erfordernisse vor anderen raumbedeutsamen<br />
Nutzungen Vorrang haben. Es sind nur solche Nutzungen möglich, die dieser Vorrangfunktion<br />
nicht entgegenstehen oder sie nicht wesentlich beeinträchtigen.<br />
Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll ermöglicht und Extensivierungen in<br />
Übereinstimmungen mit den Zielstellungen für die folgenden Vorranggebiete angestrebt werden.<br />
Die Nachnutzung militärischer Standortübungsplätze soll für den Naturschutz in Abstimmung mit<br />
land- und forstwirtschaftlichen Belangen erfolgen (RROP NT 1999 Z 6.4).<br />
Übersicht der Abkürzungen für die nachfolgenden relevanten Ziele von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten<br />
in den Gemarkungen der Gemeinden im Planungsgebiet „Hohe Schrecke“<br />
(RROP NT 1999 Z 6.4, RROP MT 1999 Z 6.5.2)13:<br />
(AL) Erhalt der Lebensräume gefährdeter oder vom Aussterben bedrohter Arten,<br />
Biotopverbundstrukturen.<br />
13 Da RROP NT 1999 und RROP MT 1999 im Detail unterschiedliche Wortlaute und Unterziele definieren,<br />
sollen hier lediglich die übereinstimmenden Zielformulierungen benannt werden.<br />
20
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
(Avz) Erhalt der abflussverzögernden Wirkung des Waldes<br />
(Erh) Ermöglichung naturverträglicher Erholungsnutzung<br />
(foS) Beachtung der Zweckbestimmung (RROP NT 1999) und Ausweisung (RROP MT 1999) forstlicher<br />
Schutzwälder<br />
(K) Bewahrung der klimaökologischen Ausgleichsfunktionen<br />
(kK) Erhalt kleinstrukturierter Kulturlandschaften<br />
(Lb) Erhalt der Qualität des Landschaftsbilds<br />
(Ofg) Erhalt und Verbesserung der Naturnähe von Oberflächengewässersystemen, Feuchtgebieten und<br />
Mooren<br />
(Rv) Erhalt des hohen Retentionsvermögens (nur RROP NT 1999)<br />
(SG) Besonderer Schutz vor Schadstoffeinträgen in das Grundwasser (nur RROP NT 1999)<br />
(W) Erhalt und Verbesserung der Grundwasserqualität und Trinkwasserqualität<br />
Folgende Vorranggebiete für Natur und Landschaft sind im Planungsgebiet mit zu beachtenden<br />
konkreten Zielstellungen ausgewiesen: (RROP NT 1999 6.4.1, RROP MT 1999 Z 6.4.3):<br />
� Hohe Schrecke (RROP NT 1999 Nr. 114, RROP MT 1999 Nr. 76):<br />
� AL, Avz, Lb, Erh<br />
� spezifische Ziele nach RROP NT 1999: foS, SG<br />
� spezifische Ziele nach RROP MT 1999: W, die teilweise Entwicklung zum<br />
Totalreservat soll möglich sein. Ermöglichung naturnaher Erholung unter<br />
Beachtung der Schutzziele.<br />
� Schmücke (RROP NT 1999 Nr. 115, RROP MT 1999 Nr. 75)<br />
� AL, Avz, , Erh, Lb<br />
� spezifische Ziele nach RROP NT 1999: kK, Rv, W<br />
� spezifische Ziele nach RROP MT 1999: FoS, naturverträgliche Erholungsformen<br />
sollen zulässig sein<br />
� Sperlingsberg / Heide S Reinsdorf (RROP NT 1999 Nr. 113):<br />
� AL, kK, Lb<br />
In Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft soll den Belangen des Naturschutzes und der<br />
Landschaftspflege sowie den ökologischen Erfordernissen bei der Abwägung mit anderen<br />
Nutzungsansprüchen ein besonderes Gewicht beigemessen werden und vor anderen<br />
raumbedeutsamen Nutzungen Vorrang haben. Die großflächige land- und forstwirtschaftliche<br />
Nutzung in den Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft soll umweltverträglich und<br />
entsprechend den Entwicklungs- und Gestaltungszielen für die Naturräume erfolgen. Auf mit den<br />
landwirtschaftlichen Erfordernissen abgestimmte extensive Bewirtschaftungsformen soll<br />
hingewirkt werden (RROP NT 1999 Z 6.5, RROP MT 1999 Z 6.5.1). Die Ausweisung von<br />
Vorbehaltsgebieten ist größtenteils durch bestehende Landschaftsschutzgebiete und Naturparke<br />
bestimmt. Nach RROP NT 1999 B 6.5 sind zusätzliche LSG-Ausweisungen bzw. -erweiterungen auf<br />
der Hohen Schrecke geplant. Folgende Vorbehaltsgebiete für Natur- und Landschaft sind im<br />
21
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Planungsgebiet ausgewiesen. Die folgenden Ziele für diese Vorbehaltsgebieten sind zu<br />
berücksichtigen: 14<br />
RROP NT 1999 Z 6.5.1:<br />
� Unstrutaue ab Sachsenburg bis Roßleben (Nr. 68):<br />
� AL, Avz, Lb, Ofg, Rv, SG<br />
� Helderbach bei Heldrungen (Nr. 72):<br />
� AL, K, Lb, Ofg, SG<br />
� Hanglagen der Schmücke (Nr. 73):<br />
� AL, kK, Lb, SG<br />
� Hanglagen der Hohen Schrecke (Nr. 74):<br />
� AL, kK, Lb<br />
RROP MT 1999 Z 6.5.3:<br />
� Finne (Nr. 18):<br />
� AL, Avz, Erh, FoS, K, Lb.<br />
3.3 Fremdenverkehr und Erholung<br />
Räume mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung<br />
Der LEP 2004 weist das Planungsgebiet nicht als Raum mit besonderer Bedeutung für Tourismus<br />
und Erholung aus (LEP 2004, G und B 5.4.2)<br />
Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erholung<br />
Das Planungsgebiet der Hohen Schrecke ist nach RROP NT 1999 7.2.2 und RROP MT 1999 7.2.1.2<br />
als Vorbehaltsgebiet für Fremdenverkehr und Erholung ausgewiesen. RROP MT 1999 weist unter Z<br />
7.2.1.2 den südlichen Teil des Planungsgebiets (Hohe Schrecke/Schmücke/Finne) aufgrund ihrer<br />
landschaftlichen Vorzüge und der kulturhistorischen Entwicklung als Fremdenverkehrsgebiet<br />
aus. RROP NT 1999 weist hingegen den nördlichen Teil des Planungsgebiets (Hohe Schrecke)<br />
unter Beachtung des Landschaftscharakters und der gebietstypischen Siedlungsstruktur<br />
lediglich als potentielles Fremdenverkehrsgebiet aus (Z 7.2.2). 15 Die Region verfügt hiernach über<br />
geeignete natürliche und landschaftsbezogene Voraussetzungen, die in Ansätzen vorhandene<br />
14 RROP NT 1999 Z 6.5 nennt hier die Berücksichtigung der Erholungsfunktion nicht.<br />
15 In der Fortschreibung der Regionalpläne Nordthüringen und Mittelthüringen fällt diese Unterscheidung<br />
weg.<br />
22
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Fremdenverkehrsinfrastruktur soll bewahrt und bedarfsgerecht entwickelt werden. In den<br />
Entwürfen der Regionalpläne 2007 werden die Teilräume des Planungsgebiets ohne<br />
Unterscheidung als Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung ausgewiesen.<br />
Die reizvolle, unter Landschaftsschutz gestellte Hohe Schrecke soll gemäß RROP NT 1999, Z<br />
7.2.2.4 schrittweise für die touristische Nutzung – insbesondere aktive Erholung und sanfter<br />
Tourismus – erschlossen werden. Unter Berücksichtigung des Erhalts des natürlichen,<br />
ökologischen Gleichgewichts sollen in diesem Gebiet solche Maßnahmen unterstützt und<br />
gefördert werden, die ruhige Erholungsformen im freien Landschaftsraum ermöglichen. Bereits<br />
vorhandene Wanderwege sollen vervollständigt, Radwege ausgebaut und die Möglichkeit zur<br />
Wahrnehmung des Reitsportes geschaffen werden. In dem ehemaligen militärisch genutzten<br />
WGT-Gelände sollen Korridore geschaffen werden, die eine ungefährdete Erwanderung der bisher<br />
nicht öffentlich zugänglichen Waldgebiete ermöglicht. Im Zusammenhang mit der Entwicklung<br />
des potentiellen Tourismusgebietes “Hohe Schrecke” sollen im nahe gelegenen Unstruttal Rad-,<br />
Wander- und Wasserwanderwege, besonders der länderübergreifende Unstrut-Radwanderweg,<br />
ausgebaut und erhalten werden. In Garnbach, einem Ortsteil von <strong>Wiehe</strong>, soll die Neuanlage von<br />
Parkflächen forciert und das Freizeitangebot erweitert werden.<br />
Im Entwurf zum Regionalplan NT 2007 (Entwurfsfassung v. 11.11.2008 ist die Region weiterhin als<br />
Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erholung ausgewiesen. Hier soll einer natur- und<br />
landschaftsgebundenen Erholung und einer infrastrukturell geprägten Freizeitgestaltung in der<br />
Abwägung besonderes Gewicht beigemessen werden (G 4-25). Die Hohe Schrecke soll dabei<br />
länder- und regionsübergreifend entwickelt und die Voraussetzungen für einen naturnahen<br />
Tourismus erhalten und komplettiert werden. Das großflächige, unzerschnittene Buchenwaldgebiet<br />
bietet hier hervorragende Möglichkeiten für naturnahen Tourismus und Erholung. Das<br />
Unstruttal bietet günstige Voraussetzungen für die „aktive Erholung“ u. a. Wasserwandern,<br />
Rudern (Leistungsstützpunkt Ruderzentrum Roßleben) und Radwandern. Die geplanten<br />
innovativen touristischen Infrastrukturprojekte (z.B. historische Siedlung bei Hauteroda,<br />
Waldinformationszentrum im Schloss <strong>Wiehe</strong>, Erlebniswegenetz mit dezentralen Info-Pavillons<br />
und Urwald-Kletterpfad) bieten Potentiale für höhere Gästezahlen. Die Orte <strong>Wiehe</strong>, Donndorf und<br />
Roßleben haben sich zur engen touristischen Zusammenarbeit positioniert<br />
(Kooperationsvertrag). Dadurch sollen die touristischen Potenziale gebündelt und höhere<br />
wirtschaftliche Effekte erzielt werden (G 4-28).<br />
Um eine Verbindung zwischen dem Vorbehaltsgebiet „Hohe Schrecke“ und dem<br />
Vorbehaltsgebiet „Kyffhäuser“ zu schaffen, wurde die Festsetzung eines Vorbehaltsgebiets<br />
zwischen diesen beiden bestehenden Vorbehaltsgebieten in die Wege geleitet.<br />
Nach RROP MT 1999 Z 7.2.1.5 soll der Bereich Hohe Schrecke / Schmücke / Finne unter<br />
Beachtung des Erhalts seiner landschaftlichen Qualitäten (laubmischwaldreiche Höhenzüge,<br />
bedeutende Biotopstrukturen) und der Nutzung kulturhistorischer Voraussetzungen schrittweise<br />
ebenfalls für den naturnahen und landschaftsbezogenen Tourismus erschlossen und als<br />
Naherholungsbereich weiter ausgebaut werden. Dabei sollen solche Erholungsformen angestrebt<br />
23
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
werden, die dem gebietstypischen Charakter der Region Rechnung tragen und diesen aufwerten<br />
(z. B. Wandern, Reiten, Radfahren, Natur- und Kulturerleben). Das ehemalige Militärgelände<br />
Truppenübungsplatz Lossa (ca. 4000 ha) soll nach erforderlicher Altlastensanierung für die<br />
Erholungsnutzung und im Bereich der Hohen Schrecke als Totalreservat entwickelt werden. Das<br />
bestehende Wanderwegenetz (ca. 300 km) soll erhalten und in Teilbereichen bedarfsgerecht<br />
ausgebaut und durch Naturlehrpfade ergänzt werden. An geeigneten Plätzen sollen Ruhe- und<br />
Parkplätze angelegt werden.<br />
Für den Aufbau effizienter Tourismusstrukturen sollen in der Region Hohe Schrecke / Schmücke /<br />
Finne die regionsübergreifenden Entwicklungspotentiale mit weiteren natur- und<br />
landschaftsbezogenen Tourismusregionen Thüringens 16 sowie länderübergreifend mit dem in<br />
Sachsen-Anhalt liegenden Teil der Finne ausgebaut und räumlich funktionelle Verflechtungsbeziehungen<br />
langfristig entwickelt werden (RROP MT 1999 Z 7.2.1.9).<br />
Nach Entwurf des RP NT 2007 ist die Teilregion Hohe Schrecke – Schmücke – Finne im<br />
Zusammenhang mit der touristischen Entwicklung in Sachsen-Anhalt (Naturpark Saale-Unstrut-<br />
Triasland) und Nordthüringen zu sehen und soll deshalb grenzüberschreitend entwickelt werden.<br />
Das großflächige unzerschnittene und naturnahe Buchenwaldgebiet mit bundesweiter<br />
Bedeutung eignet sich für Aktiv- und Naturtourismus und Umweltbildung. Insbesondere der<br />
Mittelthüringer Teil kann dadurch zur Abrundung des bestehenden und sich entwickelnden<br />
touristischen Angebotes der Gesamtregion (u. a. Weinbau, Kur und Wellness, stein- und<br />
bronzezeitliche Kulturen, Romanik) beitragen (G 4 -21, 24 u. B).<br />
Tourismusorte<br />
Im Planungsgebiet sind nach RROP NT 1999, Z 7.3.1.1 die Städte Heldrungen, <strong>Wiehe</strong> sowie die<br />
angrenzende <strong>Stadt</strong> Artern als Fremdenverkehrsorte ausgewiesen und damit als Schwerpunkte<br />
der touristischen Entwicklung vorgesehen. Sie sollen durch Entwicklung und Bündelung<br />
touristischer Leistungsangebote einen besonderen regionalen Beitrag zur Stärkung der<br />
Wirtschaftskraft leisten. Aufgrund ihrer Lage im Naturraum, ihrer touristischen Ausstattung und<br />
der eingeschlagenen Entwicklungsrichtung sind sie als Schwerpunkte des Aktiv-Tourismus wie<br />
Wandern, Camping, Radfahren usw. auszubauen und zu entwickeln (s.a. RP NT 2007 Z 4-5).<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> soll nach RROP NT 1999, Z 7.3.1.9 das Prädikat „Erholungsort“ anstreben, im<br />
Entwurf des RP NT 2007 sind hierzu keine Aussagen getroffen.<br />
Für den südlichen Teil des Planungsgebiets weist der RROP MT 1999 7.3.1.2 die Gemeinde<br />
Beichlingen als Fremdenverkehrsort aus. Obgleich Rastenberg und seine Ortsteile Finneck und<br />
16 Z. B. Thüringer Wald, Thüringer Schiefergebirge, Mittleres Ilmtal<br />
24
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Haselberg als regional bedeutsamer Fremdenverkehrsort ausgewiesen werden, wird der im<br />
Planungsgebiet liegende OT Bachra hierbei nicht einbezogen.<br />
Gemäß LEP 2004 sind in RP regional bedeutsame Tourismusorte auszuweisen (LEP Z 5.4.8) Die<br />
Entwürfe der Regionalpläne Nordthüringen (Z 4-5) und Mittelthüringen (Z 4-10) weisen in Zukunft<br />
mit <strong>Wiehe</strong>, Heldrungen und Rastenberg (OT Rastenberg) regional bedeutsame Tourismusorte als<br />
Schwerpunkte der Tourismusentwicklung mit der spezifischen touristischen Funktion „Aktiv-<br />
Tourismus“ aus. In den regional bedeutsamen Tourismusorten sollen<br />
� die vorhandenen touristischen Infrastrukturen, besonders unter dem Aspekt einer möglichen<br />
Saisonverlängerung, weiter ausgebaut,<br />
� das Beherbergungs- und Gaststättengewerbe sowie die Freizeitangebote qualitativ und<br />
quantitativ verbessert,<br />
� Touristik-Informationsstellen eingerichtet bzw. deren Angebot erweitert,<br />
� landschaftlich angepasste Freizeit- und Erholungseinrichtungen saniert, modernisiert bzw.<br />
neu geschaffen,<br />
� attraktive Ortsbilder bewahrt,<br />
� technische Infrastrukturen gestärkt und gezielt gefördert,<br />
� erforderliche verkehrsberuhigende Maßnahmen durchgesetzt und<br />
� durch interkommunale Kooperationen Synergieeffekte für die umliegenden Gemeinden und<br />
die gesamte Region erreicht werden (RP NT 2007, G 4-30, RP MT 2007 Z 4-10 und<br />
Begründung).<br />
3.4 Weitere Flächennutzungen<br />
Grundlage sind der kürzlich ins Netz gestellte Entwurf zum Regionalplan Norddthüringen vom<br />
11.11.2008 und der Entwurf zum Regionalplan Mittelthüringen vom 9.10.2008<br />
3.4.1 Windenergie<br />
� LEP Z 4.2.8 Ausweisung von Vorranggebieten, die gleichzeitig Eignungsgebiete sind in<br />
Regionalplänen<br />
� Konflikt insbesondere zu G 5.1.12 Freiraumsicherung Bewahrung der landschaftlichen<br />
Schönheit<br />
� Hohe Schrecke – unzerschnittener störungsarmer Freiraum > 50 km – Kriterium Nähe zu<br />
Freiraum siehe RP MT 2008 G 4-3 und RP NT 2008 Z 3-17<br />
� EG Vogelschutzgebiet s. Karte 4-1 RP MT Freiraumsicherung<br />
� s.a. Umweltbericht zum Entwurf der Regionalpläne<br />
Vorrang Windenergie nach RP NT 2008 Z 3-17<br />
25
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
� Innerhalb Gemarkungen Planungsgebiet<br />
� W8 – Heldrungen/Braunsroda – zwischen A 38 und „Hohe Schrecke“<br />
� Konflikte: mit Vorrang FS 105 Hohe Schrecke und FS 104 Sperlingsberg /<br />
Heide südlich Reinsdorf (RP NT 2008 Z 4-1) und besonders mit fs-39<br />
Hanglagen der Hohen Schrecke (RP NT 2008 G 4-5)<br />
� mögliche Beeinträchtigung der Schutzziele in Gebieten mit<br />
gemeinschaftlicher Bedeutung (NATURA 2000/FFH) � B 3-17, Punkt 4<br />
� mögliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes bzw. der<br />
landschaftsgebundenen Erholung � B 3-17, Punkt 4 –<br />
Gutachten/wichtigste Kriterien: „Eigenart der Landschaft“, Naturnähe“,<br />
„Vielfalt“, „saubere Luft und Ruhe“, „visuelle Empfindlichkeit“,<br />
„Erholungsinfrastruktur“<br />
� siehe insbes. B 3-17 „Restriktive Kriterien / Bereiche“<br />
� Außerhalb Gemarkungen Planungsgebiet:<br />
� W7 – Artern / Kachstedt<br />
Vorrang Windenergie nach RP MT 2008 Z 3-11<br />
� Außerhalb Gemarkungen Planungsgebiet:<br />
� W7 - Roldisleben / Olbersleben südlich Bachra an der L2164<br />
� Konflikte: mit Vorrang Freiraumsicherung – siehe RP MT 2008 4.1.1 FS-135<br />
Hohe Schrecke, FS-134 Finne bei Rastenberg, FS-136 – Schmücke bei<br />
Beichlingen, FS-137 Trockenstrukturen bei Battgendorf (zwischen<br />
Ostramondra und Beichlingen)<br />
� B Z 4-1 Vorranggebiete Freiraumsicherung – Ausgewiesen sind<br />
Landschaftsteile, die eine besondere Erholungswirksamkeit besitzen und<br />
/oder eine strukturreiche Landschaft aufweisen. Es sind vornehmlich die<br />
historisch geprägten Kulturlandschaften bzw. die traditionell genutzten,<br />
naturnahen Landschaften mit großer Vielfalt an ökologisch wirksamen<br />
Kleinstrukturen die einen besonderen Schutz erfahren, weil sie auf Dauer<br />
durch Nutzungsaufgabe bzw. -änderung nicht in der Form existieren<br />
können. In den meisten nicht bewaldeten Bereichen der Vorranggebiete<br />
Freiraumsicherung ist eine landwirtschaftliche Nutzung unabdingbar um die<br />
Freiraumsicherungsfunktionen zu gewährleisten.<br />
� Konflikte mit Vorbehalt Freiraumsicherung fs-68 – Finne, fs-69 – Finne-<br />
Schmücke Übergangslage, fs-70 – Gebiet zwischen Kölleda und der<br />
Schmücke nach RP MT 2008 G 4-5<br />
Vorranggebiete Windenergie nach REP Halle<br />
Keine<br />
26
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
3.4.2 Rohstoffe<br />
Vorrang Rohstoffe nach RP NT 2008 Z 4-4<br />
� Gemarkungen Planungsgebiet<br />
� KIS 14 – <strong>Wiehe</strong> / Feld 2<br />
� KIS 15 – <strong>Wiehe</strong><br />
� KIS 16 – Heldrungen<br />
� KIS 17 – Heldrungen / nordöstlich<br />
� Außerhalb der Gemarkungen Planungsgebiet<br />
� KIS 12 Schönewerda<br />
� KIS 13 Kalbsrieth südlich<br />
Vorbehalt Rohstoffe nach RP NT 2008 G 4 -15<br />
� Außerhalb Gemarkung Planungsgebiet<br />
� kis-3 – Bottendorf<br />
Vorsorgegebiet Rohstoffe nach RP MT 2008<br />
� zwischen Büchel – Schillingstedt – Altenbeichlingen und der Grenze des Gebiets des<br />
Regionalplans Mittelthüringen<br />
Gewinnung von Rohstoffen unter Tage RP NT 2008 G 4-18<br />
� Außerhalb Gemarkung Planungsgebiet<br />
� In der Planungsregion Nordthüringen sollen die Möglichkeiten zur Gewinnung der<br />
vorhandenen mineralischen Rohstoffe unter Tage wie ▪ Kalisalz Roßleben s.a. RP<br />
NT 2008 Z 2-2, erhalten bzw. geschaffen werden. Dazu soll die räumliche<br />
Einordnung der dafür notwendigen Übertageeinrichtungen an geeigneten<br />
Standorten ermöglicht werden.<br />
3.4.3 Großflächige Industrieansiedlungen<br />
Vorrang GI nach RP NT 2008 Z 2-1<br />
� Außerhalb Gemarkungen Planungsgebiet<br />
� GI Artern-Unstrut<br />
Vorrang Regional bedeutsame Industrie- und Gewerbeansiedlungen nach RP NT 2008 Z 2-2<br />
und Begründung<br />
� Außerhalb Gemarkungen Planungsgebiet<br />
� RIG-4 – Roßleben (nur für Betriebsanlagen, die im Zusammenhang mit der<br />
Wiederaufnahme des Kalibergbaues stehen) Der Standort Roßleben wurde wegen<br />
der geplanten Wiederaufnahme der Kaliförderung/- verarbeitung in den<br />
27
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Regionalplan aufgenommen und soll auch ausschließlich für diese Zwecke einer<br />
Umsetzung zugeführt werden.<br />
Vorrang GI nach RP MT 2008 Z 2-1<br />
� Außerhalb Gemarkungen Planungsgebiet<br />
� IG 3 Sömmerda/Kölleda<br />
4 Stärken-Schwächen-Analyse<br />
Zu jedem Leitthema werden in einem Zwischenfazit kurz und knapp die Stärken und Schwächen<br />
zusammengefasst.<br />
Die nachfolgende Stärken-Schwächen-Analyse zeigt für die Leitthemen (s. Kapitel zur Regionalen<br />
Entwicklungsstrategie) sowohl die Problembereiche der Regionalentwicklung als auch die<br />
Entwicklungspotentiale auf. Für jedes Leitthema werden Aussagen zur Ist-Situation und daraus<br />
abgeleitet zu den jeweiligen Stärken und Schwächen getroffen. Die Analysen werden auf<br />
Gemeindeebene durchgeführt und stützen sich auf eine breite Datenbasis. Das Planungsgebiet<br />
ist nicht deckungsgleich mit Landkreisgrenzen. Hieraus resultieren hinsichtlich der<br />
Datenverfügbarkeit und -interpretation Einschränkungen. Sind statistische und andere amtliche<br />
Daten auf Gemeindeebene nicht verfügbar oder ungenau, werden Ergebnisse aus Befragungen<br />
von Behörden, regionalen Akteuren und weitere Informationsquellen wie Homepages<br />
hinzugezogen. Hierbei arbeiten die am <strong>ILEK</strong> beteiligten Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften<br />
und übrigen beteiligten Behörden intensiv zu. Die für das <strong>ILEK</strong> nötigen Daten werden dabei nicht<br />
selten erstmalig erhoben. Da dies häufig mit nicht zu unterschätzendem Aufwand und parallel<br />
zum „Behördenalltag“ geschieht, ist dieser Prozess bisher noch nicht in allen Teilen<br />
abgeschlossen. Entsprechende Lücken sind im Text gekennzeichnet.<br />
4.1 Tourismus, Erholung und Landschaft<br />
4.1.1 Verkehrsanbindung<br />
Eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung des Tourismus in der Region und die<br />
Etablierung der Region als Erholungsraum für umliegende Städte ist die Erreichbarkeit der Region<br />
per Auto oder Bahn.<br />
4.1.1.1 Straßennetz<br />
Die Verkehrsanbindung des Projektgebietes erfolgt nördlich über die A38 aus Richtung<br />
Kassel/Göttingen bzw. Halle/Leipzig und südlich an die A71 aus Richtung Erfurt. Ein<br />
durchgängiger Verkehrsfluss kann aber erst nach Beendigung der Baumaßnahmen an der A71 im<br />
Jahr 2012 gewährleistet werden. Insbesondere durch den Neubau der europäisch bedeutsamen<br />
Verkehrsverbindung A 71 (Erfurt-Artern) wird sich mit der Anschlussstelle Heldrungen die<br />
Erreichbarkeit und die Anbindung des Planungsgebiets an den Verdichtungsraum Erfurt und über<br />
die Anbindung an die A 38 (Südharz-Achse) bei Sangerhausen an die Verdichtungsräume<br />
Göttingen und Halle-Leipzig erheblich verbessern (siehe LEP 2004 Karte 1). Die Ende 2008 fertig<br />
gestellte Anschlussstelle Heldrungen trägt zu einer guten Erreichbarkeit des Projektgebietes bei.<br />
Über die Bundesstraßen kann das Gebiet nördlich von der B 86, westlich von der Bundesstraße<br />
28
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
85 und südlich von der B 176 erreicht werden. Die Städte und Gemeinden östlich der Hohen<br />
Schrecke lassen sich von <strong>Wiehe</strong> im Süden bis Reinsdorf im Norden über die L1215 erreichen.<br />
Parkmöglichkeiten zu Wanderwegen in die Hohe Schrecke / Schmücke sind wie folgt<br />
vorhanden: 17<br />
- Gemeinde Großmonra, Parkplatz am Kammerforst<br />
- Gemeinde Beichlingen, Parkplatz am Schwimmbad<br />
- Gemeinde Donndorf, Parkplatz am Kloster Donndorf<br />
- <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>, Parkplätze in der <strong>Stadt</strong> sowie Freiflächen, die in den OT Langenroda und OT<br />
Garnbach zum Parken genutzt werden. 18<br />
4.1.1.2 Bus- und Schienennetz<br />
Im nördlichen Gebiet der Projektregion ist die Anbindung an das Schienennetz bis Reinsdorf und<br />
Heldrungen gewährleistet. Der Bahnverkehr im gesamten östlichen Gebiet von Reinsdorf über<br />
Donndorf bis nach Roßleben wurde vor einigen Jahren eingestellt. Es gibt konkrete Überlegungen,<br />
den Bahnverkehr wieder zu aktivieren (z.B. im Rahmen der geplanten Wiederaufnahme des<br />
Kalibergbaus in Roßleben) (vgl. Integrierter Projektantrag im Bundeswettbewerb idee-natur, S.<br />
24). Ebenfalls in östlicher Richtung zur Projektregion gelegen verläuft die Strecke der<br />
Unstrutbahn von Naumburg in Sachsen-Anhalt bis nach Artern. Der in Thüringen liegende<br />
Abschnitt wird seit Dezember 2006 nicht mehr von Zügen befahren. Vor der Stilllegung verlief die<br />
Strecke über die Orte Nebra, Wangen, Roßleben, Donndorf, Gehofen und Reinsdorf bis nach<br />
Artern. In Wangen wurde im April 2009 ein vorerst provisorischer Haltepunkt eröffnet, um die<br />
Anbindung zum Fundort der Himmelsscheibe von Nebra zu ermöglichen. Der thüringische<br />
Streckenabschnitt bis Artern wird selten für Sonderfahrten und den touristischen Zugverkehr<br />
genutzt. Für diesen Bereich (Wangen-Artern) wird derzeit ein Konzept zur Nutzung erarbeitet,<br />
welches vom Freistaat Thüringen zu prüfen sein wird (vgl. www.unstrutbahn.de). Die Bahnstrecke<br />
südlich der Hohen Schrecke (Finnebahn zwischen Kölleda – Lossa – Freyburg/Unstrut) ist schon<br />
seit den 1960er Jahren stillgelegt und inzwischen zum Teil als Radwanderweg ausgebaut (vgl.<br />
Integrierter Projektantrag im Bundeswettbewerb idee-natur, S. 24). Am Bahnhof Heldrungen ist<br />
der Bau eines ÖPNV-Verknüpfungspunktes durch die Nahverkehrsservicegesellschaft<br />
einschließlich Park-and-Ride-Parkplatzes vorgesehen. 19<br />
Die Versorgung der Region mit dem Bus erfolgt für den Landkreis Kyffhäuser durch die<br />
Verkehrsgesellschaft Südharz mbH und für den Landkreis Sömmerda durch die<br />
Verwaltungsgesellschaft des ÖPNV Sömmerda GmbH 20 . Sowohl die Linienführung als auch die<br />
17 Nach Auswertung der Rad- und Wanderkarte Kyffhäuserkreis mit GeoPark Kyffhäuser, Maßstab 1:50.000,<br />
Hrsg.: Kartographische Kommunale Verlagsgesellschaft mbH, Nordhausen<br />
18 Auskunft lt. Bauamt <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> vom 13. Oktober 2009<br />
19 lt. Stellungnahme der Regionalen Planungsstelle Nordthüringen vom 23.06.2009<br />
20 www.linienverkehr.de (Landkreis Sömmerda), http://www.vgs-suedharzlinie.de/start.asp<br />
29
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Taktung der verschiedenen Linien ist auf die Anforderungen der örtlichen Bevölkerung abgestellt,<br />
erlaubt aktuell aber keine koordinierte Bereisung rund um die Hohe Schrecke. Häufig ist der<br />
Busbetrieb auf wenige Stunden am Tag reduziert und teilweise am Wochenende ganz eingestellt.<br />
4.1.2 Touristische Infrastruktur<br />
4.1.2.1 Beherbergung<br />
Die Übernachtungsmöglichkeiten in der Region werden vorwiegend von Pensionen und<br />
Ferienwohnungen dominiert, die einfachen bis mittleren Komfortansprüchen genügen.<br />
Ausstattungen auf gehobenen Niveau finden sich im Hotel Schloss Beichlingen und im Gutshaus<br />
von Bismarck in Braunsroda. Das Gutshaus von Bismarck wurde nach der Deutschen<br />
Hotelklassifizierung als „First Class“ eingestuft und verfügt über eine Ferienwohnung und zwei<br />
Apartments sowie eine Gutswirtschaft mit Café und Biergarten. Hier werden den Gästen<br />
überwiegend Produkte aus der Region oder eigene Erzeugnisse aus dem ökologischen Landbau<br />
angeboten (vgl. www.gutshaus-von-bismarck.de). Auf dem Gutshof in Hauteroda ist die Markus-<br />
Gemeinschaft ansässig. Hier haben sich Menschen mit und ohne Behinderungen<br />
zusammengefunden, um ökologisch und sozial ausgerichtete Arbeit zu leisten. Zum Hof gehört<br />
eine biologisch geführte Landwirtschaft mit Molkerei und Mosterei. Diese eigenen Produkte<br />
werden den Übernachtungsgästen der Herberge angeboten. Der Gutshof Hauteroda verfügt<br />
außerdem über sanitäre Anlagen, die rollstuhlgerecht ausgerichtet sind.<br />
Neben diesen Angeboten gibt es einige kleinere Pensionen in der <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>, die über 3 bis<br />
maximal 16 Betten verfügen. Im Ortsteil Garnbach (<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>) gibt es zudem eine Anlage mit<br />
Ferienwohnungen und Bungalows, die 2008 renoviert wurde und maximal 25 Personen<br />
Unterkunft bietet. In der folgenden Abbildung werden alle Angebote im Bereich Übernachtung<br />
aufgeführt. Demnach stehen im gesamten Projektgebiet rund 220 Betten für die touristische<br />
Nutzung zur Verfügung. Diese decken die Preiskategorien von Einfach bis Mittelklasse ab. Hinzu<br />
kommen 319 Betten der Jugendherbergen in Beichlingen und Heldrungen. Diese werden bei dem<br />
weiteren Vorgehen in die Planungen einbezogen, da sie besonders für die Zielgruppen des Aktivund<br />
Bildungstourismus interessant sind.<br />
Da die Region bisher nicht als typisches Tourismusgebiet gilt, sind die Übernachtungsgebote für<br />
den qualitätsorientierten Tourismus nicht ausreichend. Das heißt, dass zu wenige Unterkünfte in<br />
der Region nach den deutschen Klassifizierungssystemen des DEHOGA oder des DTV (Deutscher<br />
Tourismusverband) eingestuft wurden.<br />
Tabelle 3: Übernachtungsangebote, Art und Bettenanzahl in der Region (e. D., Stand 2008; Quelle:<br />
Internetseiten der Städte, Gemeinden und Anbieter)<br />
<strong>Stadt</strong>/Gemeinde Übernachtungsangebote Art & Bettenanzahl<br />
Donndorf Kloster Donndorf 25 Zimmer EZ/DZ/Mehrbettzimmer<br />
Heldrungen Gutshaus von Bismarck in Braunsroda Ferienwohnungen (8)<br />
30
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Jugendherberge „Wasserburg“ Jugendherberge (52)<br />
Ferienhaus Forsthaus Langenthal in<br />
Braunsroda<br />
Ferienwohnungen (18 )<br />
Hauteroda Gutshof Hauteroda Herberge (55)<br />
<strong>Wiehe</strong><br />
Beichlingen<br />
Rastenberg<br />
„Deutscher Hof“ Pension (6)<br />
„Zum Fröhlichen Wanderer“ Ferienwohnungen (15)<br />
„Zur Tanne“ Pension (16)<br />
„Zum Schlossteich“ Pension & Ferienwohnung (12)<br />
Gudrun Brehmer Zimmervermietung (6)<br />
Horns Heuherberge &<br />
Erlebnisgastronomie<br />
Pension (6), Heuherberge (18)<br />
Vermietung Böhme Ferienwohnung & Zimmer (10)<br />
Vermietung Salewski Zimmervermietung (3)<br />
Ferienhaus Andreas Hagemann<br />
Schloss Beichlingen Hotel (34)<br />
Ferienhaus & Ferienwohnungen<br />
(25)<br />
Kinder- und Jugenddorf „Am Windberg“ Jugendherberge (267)<br />
Vermietung R. Greißler Pension (8)<br />
Vermietung R. Henning Ferienhaus/Pension (6)<br />
Vermietung R. Mascher Zimmervermietung (4)<br />
Vermietung U. Vollrath Zimmervermietung (4)<br />
Zimmer/Ferienhaus E. Werner Ferienwohnung (7)<br />
Zimmer/Ferienhaus E. Vöhl Ferienwohnung (6)<br />
Ferienhaus K. Thees Ferienwohnung (3)<br />
Ferienhaus H. Bismarck Ferienwohnung (3)<br />
Orte ohne Übernachtungsmöglichkeiten: Gehofen, Nausitz, Oberheldrungen, Reinsdorf,<br />
Großmonra, Ostramondra<br />
4.1.2.2 Gastronomie<br />
Als Anbieter im Bereich Gastronomie sind beispielhaft das Schloss Beichlingen, der Gutshof von<br />
Bismarck, ein Gasthaus in Garnbach, das Mühlencafé in Altenbeichlingen und ein Café bei<br />
Langenroda zu nennen. Auch im Bereich Gastronomie gibt aktuell es nicht genügend Angebote<br />
für den qualitätsorientierten Tourismus. Zudem fehlt es an ausreichend Einrichtungen, bei denen<br />
der Gast in Abständen von festgelegten Wanderetappen einkehren kann. Die gastronomischen<br />
Angebote in der Region werden ausführlich in Abbildung 3 aufgeführt.<br />
31
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Tabelle 4: Gastronomische Angebote in der Region (e. D., 2009; Quelle: Internetseiten der Städte<br />
und Gemeinden sowie www.gelbeseiten.de )<br />
<strong>Stadt</strong>/Gemeinde Gastronomie<br />
Donndorf<br />
Klosterschenke<br />
Gaststätte Erika Becher<br />
Gehofen „Zur Finne"<br />
Heldrungen<br />
Ratskeller<br />
„Antica Toscana“<br />
„Zur Krone“<br />
„Thüringer Hof“<br />
Gutshof v. Bismarck<br />
Hauteroda<br />
„Zur Anne"<br />
Markus-Gemeinschaft<br />
Nausitz „Dorfkrug"<br />
Oberheldrungen Gaststätte Sportzentrum<br />
Reinsdorf „Zur Grünen Tanne"<br />
<strong>Wiehe</strong><br />
„Zur Modellbahn"<br />
„Zum Fröhlichen Wanderer“ (OT Garnbach)<br />
„Zur Tanne“<br />
„Deutscher Hof“<br />
„Zum Wolfstal“<br />
„Mühlencafé“ Langenroda<br />
Eiscafé<br />
Horn´s Heuherberge & Erlebnisgastronomie (OT Garnbach)<br />
Beichlingen Restaurant Schloss Beichlingen<br />
Großmonra<br />
„Hirschbach-Schänke"<br />
„Zur Schenke"<br />
Ostramondra „Bayerischer Hof"<br />
Rastenberg<br />
Ratskeller<br />
„Zum Henninger"<br />
„Zum <strong>Stadt</strong>tor"<br />
4.1.2.3 Rad- und Wanderwegenetz<br />
Das Gebiet der Hohen Schrecke verfügt über ein ausgebautes, beschildertes Rad- und<br />
Wanderwegenetz und ist derzeit bereits in eine Reihe von Wander- und Radwanderwegen<br />
eingebunden. So verläuft der Unstrut Radwanderweg von Naumburg und Memleben in Sachsen-<br />
Anhalt durch die Städte <strong>Wiehe</strong> und Heldrungen. Außerdem gibt es den Schrecke-Randweg für<br />
Wanderer, der diese von <strong>Wiehe</strong>, zum Kloster Donndorf und nach Heldrungen führt. Auch der<br />
Kammweg Hohe Schrecke führt durch das Projektgebiet nach Braunsroda und Heldrungen. Die<br />
Reitwege in der Region sind in Wanderkarten ausgewiesen, allerdings nicht unter einem<br />
32
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
touristischen Thema erfasst. In der folgenden Abbildung werden alle bedeutenden Rad-, Wanderund<br />
Themenwege in der Region Hohe Schrecke aufgeführt.<br />
Tabelle 5: Rad-, Wander- und Themenwege (e. D., 2009; Quelle: Rad- und Wanderkarte<br />
Kyffhäuserkreis mit Geopark Kyffhäuser)<br />
Radweg Wegeverlauf<br />
Unstrut-Radweg<br />
Finnebahn Radweg<br />
Wanderweg Wegeverlauf<br />
Schmücke-Wanderweg<br />
Unstrut-Saale-Wanderweg<br />
Hohe-Schrecke-Kammweg<br />
Schrecke-Randweg<br />
nördlicher Verlauf an <strong>Wiehe</strong>-Roßleben-Artern-Reinsdorf-Heldrungen<br />
vorbei<br />
südlicher Verlauf durch Kölleda-Großmonra-Bachra-Rastenberg-<br />
Hardisleben-Buttstädt<br />
ab Sachsenburg wird der Hainleite-Wanderweg als Schmücke-<br />
Wanderweg geführt, verläuft östlich an Beichlingen vorbei, Übergang<br />
zum Finne-Wanderweg<br />
Teilabschnitt des Finne-Wanderwegs (Weißenfels – Leißling –<br />
Schönburg – Bad Kösen – Eckartsberga), östlicher Verlauf an<br />
Heldrungen-Beichlingen-Großmonra-Bachra vorbei<br />
Heldrungen-Braunsroda nahe Burgwenden-Lossa-Wohlmirstedt-<br />
Memleben<br />
Memleben/Kloster-Wohlmirstedt-Zeisdorf-<strong>Wiehe</strong>/Markt-Garnbach-<br />
Langenroda-Kloster Donndorf-Heldrungen<br />
Schmücke-Rund-Wanderweg Beichlingen-Harras-Hauteroda-Beichlingen<br />
Themenweg Wegeverlauf<br />
GeoPfad Unstrut / Hohe<br />
Schrecke<br />
Mühlenwanderweg<br />
Wanderung Buntsandstein &<br />
Buchenwald<br />
Radrundweg entlang der Unstrut mit Sehenswürdigkeiten<br />
Wasserschloss Heldrungen, Gutshof Braunsroda, Gutshof Hauteroda,<br />
Städte Roßleben und <strong>Wiehe</strong><br />
Teilabschnitt von Sömmerda nach Buttstädt führt über Altenbeichlingen,<br />
Großmonra, Ostramondra und Bachra<br />
Von Kölleda nach Burgwenden an Beichlingen und Großmonra grenzend<br />
über Donndorf nach <strong>Wiehe</strong><br />
4.1.3 Touristische Anlaufpunkte in der Region<br />
Die Region Hohe Schrecke bietet eine Reihe von kulturhistorisch bedeutsamen Stätten wie<br />
Schlösser, Klöster, Gutshäuser und Mühlen. In der folgenden Tabelle 6 werden die touristischen<br />
Anlaufpunkte in der Region aufgeführt.<br />
Historisch bedeutsame Standorte sind die Schlossanlagen in <strong>Wiehe</strong>, Heldrungen, Nausitz,<br />
Ostramondra und Beichlingen. Auch im Waldgebiet der Hohen Schrecke finden sich Zeugnisse<br />
früherer menschlicher Siedlungen und Hinweise auf alte Nutzungen. Bei der Wüstung<br />
Wetzelshain (Fläche etwa 200x400m) handelt es sich um eine ehemalige Siedlung, die im<br />
33
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Hochmittelalter (12./13. Jh.) errichtet wurde und bereits im 14. Jh. wieder aufgegeben wurde. Trotz<br />
Überwucherungen von Büschen und Bäumen sind die Konturen des damaligen<br />
Befestigungssystems noch heute erkennbar (vgl. Moder 2007). Bedeutende Bodendenkmale<br />
stellen die Burg Rabenswalde bei Garnbach/<strong>Wiehe</strong> und die Monraburg bei Burgwenden dar. In<br />
der Mitte des 13.Jahrhunderts gehörte die Burg Rabenswalde zur Grafschaft <strong>Wiehe</strong>. Von der<br />
Doppelburg sind heute nur noch ein ca. 1,5 m hohes und ca. 6 m langes Mauerstück sowie der 8-<br />
10 m tiefe Wallgraben erhalten (vgl. www.stadt-wiehe.de). Von der Burgruine bei Burgwenden<br />
sind heute nur noch die Wallanlagen/Wallgräben zu sehen (vgl. www.grossmonra.de).<br />
Ein besonderer Magnet im Projektgebiet ist die Modellbahn in <strong>Wiehe</strong>. Es handelt sich um die<br />
weltgrößte Modellbahn-Ganzjahresschau auf rund 12.000 qm. Diese ist auch weit über die<br />
Region hinaus bekannt und zieht jährlich ca. 300.000 Besucher an (Aussage Betreiber<br />
Modellbahn).<br />
Als weiteres Highlight der Region kann der monatlich stattfindende Bauernmarkt auf dem<br />
Gutshof von Bismarck in Braunsroda bezeichnet werden. Jeden Monat kommen zwischen 3000<br />
und 4000 Gäste auf das Gut (Aussage Herr v. Bismarck). Selbsterzeuger aus der Region<br />
Kyffhäuser und Südharz bieten hier ihre Produkte aus Landwirtschaft, Gärtnerei und Handwerk<br />
an. Jeder Markt ist einem jahreszeitlichen Thema, z. B. Erdbeer- und Spargelmarkt oder Land- und<br />
Erntefest, gewidmet.<br />
34
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Tabelle 6: Touristische Anlaufpunkte und Sehenswürdigkeiten in der Region (e. D., 2009; Quelle:<br />
Internetseiten der Städte, Gemeinden und Anbieter)<br />
<strong>Stadt</strong>/Gemeinde Touristische Anlaufpunkte und Sehenswürdigkeiten<br />
Donndorf<br />
Gehofen<br />
Heldrungen<br />
Historisches Kloster mit Klosterkirche<br />
Ländliche Heimvolkshochschule Thüringen<br />
Heimathaus Donndorf<br />
Kirche St. Johann Baptist (19. Jh.)<br />
Ziegelei (19. Jh.)<br />
Gutshof von Bismarck in Braunsroda<br />
Wasserburg mit Jugendherberge und Burgcafé<br />
Bauernkriegsgedenkstätte<br />
Naturschwimmbad<br />
Hauteroda Herberge der Markus-Gemeinschaft im Gutshof<br />
Nausitz Schloss<br />
Oberheldrungen -<br />
Reinsdorf Privatmuseum „Barthelmann’s“<br />
<strong>Wiehe</strong><br />
Beichlingen<br />
Großmonra<br />
Ostramondra<br />
Bachra (<strong>Stadt</strong> Rastenberg)<br />
Weltgrößte Modellbahn-Ganzjahresschau<br />
Rankemuseum (Historiker Leopold von Ranke)<br />
Schloss <strong>Wiehe</strong><br />
Heimathaus mit Heimatmuseum „Alte Schule“<br />
Radfahrerkirche<br />
Rekonstruierte Bockwindmühle mit Mühlencafé Langenroda<br />
Schwimmbad<br />
Tourist-Info<br />
Schloss Beichlingen<br />
Kinder- und Jugenddorf auf dem Windberg<br />
Turmholländerwindmühle in Altenbeichlingen<br />
Waldschwimmbad<br />
Vor- und frühgeschichtliche Fundorte<br />
Berg- und Wiesenmühle<br />
Wasserschloss<br />
Obst-, Guts- und Saalmühle<br />
Schloss der Familie von Werthern<br />
Turmwindmühle<br />
35
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
4.1.4 Angebote für naturverbundene Aktivitäten<br />
4.1.4.1 Aktivtourismus<br />
Neben den kulturhistorischen Anlaufpunkten gibt es Angebote für den landschaftsbezogenen<br />
und umweltverträglichen Aktivtourismus. Die Rad-, Wander- und Reitwege dienen dabei nicht nur<br />
als Verbindung zwischen den Orten, sondern tragen wesentlich zur Erholung, Entspannung und<br />
zum Freizeiterlebnis bei. Das Gebiet der Hohen Schrecke verfügt über ein ausgebautes,<br />
beschildertes Rad- und Wanderwegenetz. Leih- und Servicestationen für Fahrräder befinden sich<br />
in <strong>Wiehe</strong> (Thepra e.V. und Pedalo Fahrradhaus). Eine Vernetzung der Wander- und<br />
Radwanderwege auf regionaler und länderübergreifender Ebene wird im Entwurf des<br />
Regionalplanes Nordthüringen (2007) explizit gefordert und auf die Einbindung geschichtlicher<br />
sowie kultureller Besonderheiten der Region hingewiesen.<br />
Für den Bereich Reittourismus wurde 2004 von den Leistungsträgern in der Region Kyffhäuser ein<br />
Konzept erarbeitet, das ein vernetztes Angebot unter Beteiligung mehrerer Reiterhöfe schaffen<br />
sollte. Beteiligte Reiterhöfe sind u. a. der Gutshof von Bismarck in Braunsroda, die<br />
Wanderreitstation in Heldrungen, die Reitgemeinschaft Schloss Beichlingen und der Reiterhof<br />
Brehmer in <strong>Wiehe</strong>. Ein überregionaler Reitweg durch das Waldgebiet der Hohen Schrecke führt<br />
entlang der Route Schmücke-Wanderweg und Kammweg Hohe Schrecke von Burgwenden über<br />
die <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> oder in Richtung Kloster Donndorf. Die Orte Heldrungen, Braunsroda sowie<br />
Donndorf sind in einen regionalen Reitweg eingebunden, der sich vom Kloster Donndorf in<br />
nördliche Richtung (Artern) fortsetzt.<br />
4.1.4.2 Naturparke<br />
Die Region Hohe Schrecke grenzt an die touristisch gut erschlossenen und angenommenen<br />
Naturparke „Kyffhäuser“ und „Saale-Unstrut-Triasland“. Der Naturpark "Saale-Unstrut-Triasland"<br />
liegt im Süden Sachsen-Anhalts und erstreckt sich über den Burgenlandkreis und den Saalekreis.<br />
Die Städte <strong>Wiehe</strong> und Roßleben sind bereits Mitglieder im Naturpark Saale-Unstrut-Triasland. In<br />
einigen Bereichen, wie bei der Ausweisung von Rad- und Wanderwegen (Unstrut Radweg), der<br />
Vermarktung gemeinsamer Wanderkarten oder bei Projekten zur Nutzung der Unstrut, besteht<br />
eine Zusammenarbeit. Zukünftig spielt ebenfalls die stärkere Anbindung an den Naturpark<br />
Kyffhäuser eine wichtige Rolle.<br />
4.1.4.3 Geopark Kyffhäuser<br />
Die Städte <strong>Wiehe</strong> und Roßleben und viele Akteure aus der Region sowie Mitglieder der<br />
Kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Hohe Schrecke“ sind bisher Mitglieder im Geopark<br />
Kyffhäuser. Weitere Gemeinden in der Projektregion haben ihr Interesse bekundet, sich in naher<br />
Zukunft in diese Organisationsstruktur einzubinden. Die Projektregion ist bereits mit dem 60 km<br />
langen Radweg „GeoPfad Unstrut/Hohe Schrecke“ in die touristischen Angebote des Geoparks<br />
eingebunden. Außerdem wurden ausgewählte Geotope zugänglich gemacht, von denen sich zwei<br />
in der Projektregion befinden (nahe Beichlingen, Bachra). Die Geotope sind mit<br />
Informationstafeln ausgestattet und geben einen Einblick in die Erdgeschichte der Region (vgl.<br />
www.geopark-kyffhaeuser.com).<br />
36
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
4.1.5 Touristische Anlaufpunkte im Umfeld der Region<br />
In unmittelbarer Nähe zum Projektgebiet befinden sich einige kulturhistorisch und landschaftlich<br />
attraktive Anlaufpunkte. Die wichtigsten Standorte werden in Tabelle 7 aufgeführt.<br />
Tabelle 7: Touristische Anlaufpunkte in der Umgebung (e. D., 2009; Quelle: Internetseiten der<br />
Tourismusverbände)<br />
Region Touristische Anlaufpunkte<br />
Saale-Unstrut-Region<br />
Kyffhäuserkreis<br />
Landkreis Sömmerda<br />
Fundort der Himmelsscheibe in Wangen<br />
Besucherzentrum Arche Nebra (nahe Fundort)<br />
Kaiserpfalz in Memleben<br />
Naturpark Saale-Unstrut-Triasland<br />
Geopark Triasland<br />
Barbarossahöhle in Rottleben<br />
Kyffhäuserdenkmal<br />
Funkenburg Westgreußen<br />
Panorama Museum Bad Frankenhausen<br />
Kyffhäusertherme<br />
Regionalmuseum Bad Frankenhausen<br />
Schiefer Kirchturm von Bad Frankenhausen<br />
Schloss Sondershausen<br />
Erlebnisbergwerk Sondershausen<br />
Naturpark Kyffhäuser<br />
GeoPark Kyffhäuser<br />
Runneburg in Weißensee<br />
Leubinger Hügel (Denkmal aus frühen Bronzezeit)<br />
Radfahrerkirche in Frömmstedt<br />
Schillingstedter Mühle<br />
Heimatmuseum Kölleda<br />
Funkwerkmuseum Kölleda<br />
Historisches Technisches Museum in Sömmerda<br />
Ausgrabungsstätte Steinrinne Bilzingsleben<br />
37
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
4.1.6 Touristisches Marketing<br />
4.1.6.1 Innenmarketing<br />
Es gibt bisher kein erkennbares, gemeinsames Marketing der Region Hohe Schrecke. Das heißt,<br />
dass es keine gemeinsame Erfassung, Steuerung und Koordination der touristischen Angebote,<br />
Anbieter und Veranstaltungen gibt. Die Tabelle 8 veranschaulicht beispielhaft eine Auswahl von<br />
Veranstaltungen, die im Jahr 2009 in der Region und in der näheren Umgebung stattfanden oder<br />
noch stattfinden. Diese sind bisher jeweils nur auf den Internetseiten der Städte und Gemeinden<br />
zu finden.<br />
Im Internet sind touristische Informationen zum Gebiet der Hohen Schrecke auf verschiedenen<br />
Internetseiten hinterlegt:<br />
www.hoheschrecke.de: Hier finden sich Informationen zum Aktivtourismus und<br />
kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten in der Region. Bei der Suche nach Übernachtungsmöglichkeiten<br />
wird auf die Seiten der Fremdenverkehrsverbände verwiesen.<br />
Die Homepage wurde im Auftrag der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft eingerichtet und bedarf<br />
einer regelmäßigen Aktualisierung.<br />
www.hohe-schrecke.de: Die Seite eines privaten Akteurs aus Garnbach mit Informationen und<br />
Übernachtungsmöglichkeiten zum Ortsteil Garnbach befindet sich derzeit im Aufbau.<br />
Auf den Seiten der Tourismusverbände Kyffhäuser (www.kyffhaeuser-tourismus.de) und<br />
Sömmerda (www.soemmi.de) lassen sich Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Rad- und<br />
Wanderwegen sowie Übernachtungsmöglichkeiten der Städte und Gemeinden finden. Angebote<br />
aus der Region Hohe Schrecke sind punktuell enthalten (z.B. Modellbahn <strong>Wiehe</strong>). Ein Link, der<br />
auf die Homepage der Hohen Schrecke verweist, ist nicht vorhanden.<br />
Für die Region Hohe Schrecke gibt es eine Tourismusinformation in der <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>, die sich als<br />
„Tourismusinformation-Unstruttal“ bezeichnet. Auch hier werden touristische Informationen zur<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> und zur „Kyffhäuser-Saale-Unstrut-Region“ vermittelt.<br />
4.1.6.2 Außenmarketing<br />
Die touristischen Anbieter der angrenzenden Regionen verweisen überwiegend nicht auf die<br />
Anlaufpunkte in der Projektregion. Touristische Angebote sind häufig unter der Bezeichnung<br />
„Kyffhäuser-Saale-Unstrut-Region“ aufgeführt. Hier wird auf einzelne Städte und Gemeinden<br />
aufmerksam gemacht, aber kein Verweis auf die Homepage Hohe Schrecke gegeben oder diese<br />
erwähnt (vgl. www.unstrut-tourismus.de).<br />
Die Internetseiten des Geoparks Kyffhäuser verweisen auf relevante Geopfade und Geotope in<br />
der Region Hohe Schrecke, enthalten aber keine näheren Informationen zu der Planungsregion<br />
oder Hinweise auf die Homepage Hohe Schrecke (vgl. www.geopark-kyffhaeuser.com).<br />
38
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Auf der Homepage des Naturparks Saale-Unstrut Triasland wird auf die Modellbahn in <strong>Wiehe</strong> und<br />
andere Sehenswürdigkeiten in der <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> verwiesen. Darüber hinaus gibt es aber auf den<br />
Seiten von Naturpark und Geopark Triasland keinen Verweis auf die Region Hohe Schrecke (vgl.<br />
www.naturpark-saale-unstrut.de ; www.triasworld.de).<br />
Die Thüringer Tourismus GmbH verweist auf ihrer Homepage auf einzelne Städte und Gemeinden<br />
in dem Gebiet der Hohen Schrecke mit Informationen zum Unstrut-Radweg oder mit Bezug auf<br />
kulturhistorische Sehenswürdigkeiten. Auch hier wird die Hohe Schrecke nicht explizit erwähnt<br />
und es gibt keinen Link zum gemeinsamen Internetauftritt der Region (vgl. www.thueringentourismus.de).<br />
Die Landkreise Kyffhäuserkreis und Sömmerda werden zum Reisegebiet „übriges<br />
Thüringen“ gezählt und gehören damit keiner definierten Tourismusregion an (z. B. Thüringer<br />
Wald, Südharz).<br />
39
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Tabelle 8: Auswahl von Veranstaltungen in der Region 2009 (e. D., Quellen: Internetseiten der Gemeinden)<br />
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember<br />
29. Ranke-<br />
Lesung im<br />
Rankemuseum<br />
(<strong>Wiehe</strong>)<br />
26. Ranke-<br />
Lesung im<br />
Rankemuseum<br />
(Rathaus<br />
<strong>Wiehe</strong>)<br />
27.<br />
Tanzveranstalt<br />
ung Rockpirat<br />
(<strong>Stadt</strong>park<br />
<strong>Wiehe</strong>)<br />
15. Vernissage<br />
Malerei und<br />
Keramik<br />
(Schloss<br />
Beichlingen)<br />
15. Konzert<br />
zum<br />
Winterausklang<br />
(Schloss<br />
Beichlingen)<br />
18. Buchlesung<br />
"Kyffhäuser"<br />
(Artern)<br />
26. Ranke-<br />
Lesung<br />
(Rathaus<br />
<strong>Wiehe</strong>)<br />
27. Lesung<br />
Galerie Aratora<br />
(Artern)<br />
03. Ostermarkt<br />
im Heimathaus<br />
(Donndorf)<br />
04. Regionaler<br />
Bauernmarkt<br />
(Gutshof<br />
Braunsroda)<br />
05. Loh-<br />
Orchester Sdh.<br />
Festsaal<br />
(<strong>Wiehe</strong>)<br />
13.<br />
Osterspaziergang<br />
Heimathaus<br />
Roßleben<br />
(<strong>Wiehe</strong>)<br />
19.<br />
Frühlingskonzert<br />
(Schloss<br />
Beichlingen)<br />
24. Lesung<br />
(Bibliothek<br />
Kölleda)<br />
02. Regionaler<br />
Bauernmarkt<br />
(Gutshof<br />
Braunsroda)<br />
01. Tanzveranstaltung<br />
Rockpirat<br />
(<strong>Stadt</strong>park<br />
<strong>Wiehe</strong>)<br />
01.<br />
Schlossberglauf<br />
(Beichlingen)<br />
02.<br />
Chorkonzert<br />
(Kirche <strong>Wiehe</strong>)<br />
09. Vernissage<br />
(Schloss<br />
Beichlingen)<br />
09. <strong>Wiehe</strong>r<br />
Opernball<br />
(<strong>Stadt</strong>park<br />
<strong>Wiehe</strong>)<br />
01. Mühlentag<br />
Bockwindmühle<br />
(Langenroda)<br />
03. Konzert<br />
Galerie Aratora<br />
(Artern)<br />
06. Regionaler<br />
Bauernmarkt<br />
(Gutshof<br />
Braunsroda)<br />
6./7. Mix-<br />
Marathon-<br />
Turnier<br />
(Kölleda)<br />
07.<br />
Radwanderung<br />
Unstrutradweg<br />
(<strong>Wiehe</strong>)<br />
11. Konzert<br />
(Kirche <strong>Wiehe</strong>)<br />
02.<br />
Sommertreff<br />
Ranke-Obelisk<br />
(<strong>Wiehe</strong>)<br />
03. Konzert<br />
Galerie Aratora<br />
(Artern)<br />
04. Regionaler<br />
Bauernmarkt<br />
(Gutshof<br />
Braunsroda)<br />
05. Konzert<br />
Thüringer<br />
Sängerknaben<br />
(Kirche <strong>Wiehe</strong>)<br />
06. Kinder-<br />
und<br />
Familienfest<br />
(Kölleda)<br />
08.<br />
Veranstaltung<br />
Museum<br />
(Kölleda)<br />
1./2.<br />
Brunnenfest<br />
(Artern)<br />
01. Beat, Blues<br />
& Rock´n Roll<br />
(Waldschwimmbad<br />
Rastenberg)<br />
01. Regionaler<br />
Bauernmarkt<br />
(Gutshof<br />
Braunsroda)<br />
01.<br />
Sommertreff<br />
(<strong>Stadt</strong>park<br />
<strong>Wiehe</strong>)<br />
02.<br />
Musikalischer<br />
Nachmittag<br />
(Rastenberg)<br />
06. NABUCCO-<br />
Opern-Open-Air<br />
(Wasserburg<br />
Heldrungen)<br />
04.<br />
Thematischer<br />
Abend<br />
(Funkwerkmuseum<br />
Kölleda)<br />
05. Konzert<br />
Beichlinger<br />
Blasmusikanten<br />
(Kölleda)<br />
05. Klassische<br />
Musik<br />
(Turmuhrenmuseum<br />
Kölleda)<br />
05. Regionaler<br />
Bauernmarkt<br />
(Gutshof<br />
Braunsroda)<br />
10. Lesung<br />
Galerie Aratora<br />
(Artern)<br />
13. Schlossfest<br />
(<strong>Wiehe</strong>)<br />
03./04.<br />
Zwiebelmarkt<br />
und<br />
Oktoberfest<br />
(Artern)<br />
03. Regionaler<br />
Bauernmarkt<br />
(Gutshof<br />
Braunsroda)<br />
17. Herbstwanderung<br />
(<strong>Wiehe</strong>)<br />
25.<br />
Kunstherbst<br />
(Rastenberg)<br />
26. Lesung<br />
Schiller<br />
Anekdoten<br />
(Kölleda)<br />
29. Ranke-<br />
Lesung<br />
(Rathaus<br />
<strong>Wiehe</strong>)<br />
07. Regionaler<br />
Bauernmarkt<br />
(Gutshof<br />
Braunsroda)<br />
08. Kabarett<br />
(Schloss<br />
Beichlingen)<br />
26. Ranke-<br />
Lesung<br />
(Rathaus<br />
<strong>Wiehe</strong>)<br />
05. Regionaler<br />
Bauernmarkt<br />
(Gutshof<br />
Braunsroda)<br />
06. Konzert<br />
zum 2. Advent<br />
(Schloss<br />
Beichlingen)<br />
10.<br />
Chorkonzert<br />
(Kirche<br />
Langenroda)<br />
12. Tanzveranstaltung<br />
Rockpirat<br />
(<strong>Wiehe</strong>)<br />
40
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember<br />
30.<br />
Maibaum/Umzug<br />
Markt<br />
(<strong>Wiehe</strong>)<br />
April:<br />
Sonderausstellung<br />
"Verschiedene<br />
Maltechniken"<br />
(Kölleda)<br />
14. Lesung<br />
Galerie Aratora<br />
(Artern)<br />
16.<br />
Frühlingsfest<br />
der CDU<br />
(<strong>Stadt</strong>park<br />
<strong>Wiehe</strong>)<br />
16./17.<br />
Traditionelles<br />
Lindenfest<br />
(Donndorf)<br />
16. Eröffnung<br />
des Museumsgartens<br />
(Kölleda)<br />
23. Konzert<br />
(Kirche <strong>Wiehe</strong>)<br />
21.-24.<br />
Wippertusfest<br />
(Kölleda)<br />
28.<br />
Kindertheater<br />
(Schloss<br />
Beichlingen)<br />
14. Konzert<br />
zum "Tag der<br />
Musik" (Kirche<br />
<strong>Wiehe</strong>)<br />
16. Lesung<br />
Galerie Aratora<br />
(Artern)<br />
17. Lesefest<br />
Museumsgarten<br />
(Kölleda)<br />
19.-21. Festival<br />
Tango<br />
Argentino<br />
(Kloster<br />
Donndorf)<br />
20.<br />
Bibliotheksabend/Kabarett<br />
(Kölleda)<br />
20.-27.<br />
Lichterfest<br />
Museumsgarten<br />
(Kölleda)<br />
21. 5jähriges<br />
Vereinsjubiläum<br />
Fanfaren<br />
(Wasserburg<br />
Heldrungen)<br />
10.-12.<br />
Kirschfest<br />
(Rastenberg)<br />
25. Orgelnacht<br />
(Schlosskapelle<br />
Beichlingen)<br />
31.<br />
Brunnenfest<br />
(Artern)<br />
07. Countryfest<br />
(Schwimmbad<br />
Heldrungen)<br />
08. Countryfest<br />
(Schwimmbad<br />
Heldrungen)<br />
09. Neptunfest<br />
(Waldschwimm<br />
-bad<br />
Rastenberg)<br />
21. Konzert<br />
(Kirche <strong>Wiehe</strong>)<br />
22./23.<br />
Bartholomäusmarkt<br />
(<strong>Wiehe</strong>)<br />
22./23.<br />
Ausstellung<br />
(Heimatmuseum<br />
<strong>Wiehe</strong>)<br />
22. Open-Air<br />
Newcomer<br />
Bands (Waldschwimmbad<br />
Rastenberg)<br />
13.<br />
Ausstellungen<br />
Museum<br />
(Kölleda)<br />
13. Eröffnung<br />
Rastenberger<br />
Kunstherbst<br />
(Rastenberg)<br />
13.<br />
Renaissance<br />
Musik<br />
(Beichlingen)<br />
14. Beichlinger<br />
Chortreffen<br />
(Beichlingen)<br />
20.<br />
Kunstherbst<br />
(Rastenberg)<br />
24. Ranke-<br />
Lesung<br />
(Rathaus<br />
<strong>Wiehe</strong>)<br />
26.<br />
Radwanderung<br />
Heimatfreunde<br />
(<strong>Wiehe</strong>)<br />
41
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember<br />
30.<br />
Weinverkostung<br />
(Mosterei<br />
Großmonra)<br />
31.<br />
Markttreiben<br />
(Großmonra)<br />
Mai:<br />
Sonderausstellung<br />
(Kölleda)<br />
Frühlings- und<br />
Flötenkonzert<br />
(Kölleda)<br />
21.<br />
Chorkonzert<br />
Schlosskapelle<br />
(Beichlingen)<br />
26.<br />
Johannisfeuer<br />
(Heldrungen)<br />
27. Sportfest<br />
und Kinderfest<br />
(Großmonra)<br />
31. EröffnungsveranstaltungKreiskulturwochen<br />
(Rastenberg)<br />
August<br />
"Klassik im<br />
Waldbad"<br />
(Rastenberg)<br />
26./27.<br />
Mittelaltermarkt<br />
(Wasserburg<br />
Heldrungen)<br />
28. Konzert<br />
(Schloss<br />
Beichlingen)<br />
28.<br />
Kunstherbst<br />
Folkloreabend<br />
(Rastenberg)<br />
42
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
4.1.7 Landschaft<br />
Die naturräumlichen Besonderheiten der Region wurden bereits unter Abschnitt 2.2 ausführlich<br />
dargestellt. Das aufgrund dieser Besonderheiten entstehende Potential ist zentrale Grundlage für<br />
die Entwicklung der Region. Naturschutzfachlich wertvolle Flächen, vorwiegend im Waldbereich,<br />
werden über das im Rahmen des Bundeswettbewerbs idee.natur zu etablierende<br />
Naturschutzgroßprojekt gesichert und entwickelt.<br />
43
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
4.1.8 Zusammenfassung Stärken/Schwächen<br />
Verkehrsinfrastruktur<br />
Stärken Schwächen<br />
+ Gute Erreichbarkeit & Anbindung durch neue<br />
Autobahn<br />
Touristische Infrastruktur<br />
Stärken Schwächen<br />
+ Einzelne engagierte Akteure mit qualitativ guten<br />
Angeboten<br />
+ Jugendherbergen mit Angeboten für den Aktivund<br />
Bildungstourismus<br />
+ Gut ausgebautes und ausgeschildertes Radund<br />
Wanderwegenetz<br />
Touristische Anlaufpunkte in der Region<br />
Stärken Schwächen<br />
+ Hohe Anzahl kulturhistorischer<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
+ Großes Potential für themenorientierten<br />
Tourismus und Bildungstourismus<br />
+ Nähe zu touristisch bedeutsamen Regionen<br />
Angebote für naturverbundene Aktivitäten<br />
Stärken Schwächen<br />
+ Hohes Potential für naturnahen Aktivtourismus<br />
und Bildungstourismus<br />
+ Bestehende Kooperationen in den Bereichen<br />
Wandern und Radwandern mit dem Geopark<br />
Kyffhäuser und der Saale-Unstrut Region<br />
Landschaft<br />
Stärken Schwächen<br />
+ Hohes naturräumliches Potential, das als<br />
Ausgangsbasis für die touristische Entwicklung<br />
dient<br />
- Schlechte Anbindung an das Schienennetz der<br />
Deutschen Bahn<br />
- Zeitlich und räumlich fragmentiertes Busnetz<br />
- Mangelnde Qualität und Pflege der Rad- und<br />
Wanderwege<br />
- Unzureichende Angebote in den Bereichen<br />
Gastronomie & Unterkunft<br />
- Mangelnde Qualität der Angebote<br />
- Mangelnde Vernetzung der Unterkünfte<br />
- Ungenügendes Know-how im Bereich<br />
Dienstleistungen<br />
- Fehlende Kooperationsbereitschaft der<br />
touristischen Anbieter<br />
- Fehlendes Marketing auf regionaler Ebene für<br />
die Stärkung der Binnenstrukturen<br />
- Mangelnde Einbindung der Angebote in<br />
Vermarktungsstrukturen der angrenzenden<br />
Tourismusregionen<br />
- Geringer Bekanntheitsgrad der Tourismusregion<br />
Hohe Schrecke<br />
- Nicht ausreichende Vernetzung und<br />
überregionale Einbindung der Reitwege<br />
- Fehlende Vermarktung der Reitwege<br />
44
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
4.2 Land- und Forstwirtschaft<br />
4.2.1 Forstwirtschaft<br />
Die Planungsregion Hohe Schrecke fällt forstlich in den Zuständigkeitsbereich des Forstamts<br />
Oldisleben. Die gesamte Waldfläche des Forstamtes beträgt 17.046 Hektar. Der Wald im<br />
Zuständigkeitsbereich des Forstamts setzt sich wie in Tabelle 9 dargestellt, zusammen. Den<br />
Hauptbestandteil bildet demnach Buche (vgl. hierzu auch Abschnitt 2.2.5).<br />
Tabelle 9: Baumartenverteilung Tabelle 10: Waldbesitzverteilung 21<br />
Baumart Anteil in %<br />
Buche 54<br />
Eiche 16<br />
Fichte 10<br />
Kiefer/Lärche 12<br />
WLbH 22 3<br />
HLbH 23 5<br />
Die Waldbesitzverhältnisse für den Zuständigkeitsbereich des Forstamtes Oldisleben sind in<br />
Tabelle 10 dargestellt. In der Planungsregion befindet sich der Großteil der Flächen in<br />
Landeseigentum, größtenteils im Ressortvermögen der Thüringischen<br />
Landesentwicklungsgesellschaft (LEG).<br />
21 Quelle: http://www.thueringen.de/de/forst/dienststellen/forstaemter/Oldisleben/content.html<br />
22 Weichlaubholz<br />
23 Hartlaubholz<br />
Eigentumsform Anteil in ha an der<br />
Gesamtwaldfläche<br />
Anteil in %<br />
Staatswald 9 011 52,86<br />
Kommunalwald 1 455 8,53<br />
Privatwald 2 271 13,32<br />
Treuhandwald 815 4,78<br />
LEG Wald 3 327 19,51<br />
Bundeswald 167 0,97<br />
45
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Neben der üblichen forstlichen Nutzung des<br />
Waldgebiets der Hohen Schrecke spielt die Nutzung<br />
durch das Militär in der Vergangenheit eine<br />
wesentliche Rolle für die Waldflächen in der Hohen<br />
Schrecke. Von 1950 bis ca. 1990 wurden rund 4.900<br />
Hektar des Waldgebiets militärisch genutzt und<br />
waren für die Bevölkerung nicht zugänglich. Die<br />
innerhalb des Militärgeländes bestehenden<br />
Waldflächen wurden kaum bis gar nicht forstlich<br />
genutzt. Daraus erklärt sich unter anderem auch die<br />
hohe naturschutzfachliche Bedeutung des „Alten<br />
Waldes“, der im Rahmen der Teilnahme am<br />
idee.natur-Wettbewerb<br />
werden soll.<br />
gesichert und erhalten<br />
Desweiteren stellt der Wald für Teile der Bevölkerung<br />
einen wichtigen Energielieferanten dar. Derzeit<br />
werden rund 5000 Festmeter Brennholz jährlich an<br />
private Nutzer abgegeben, die damit ihre<br />
Wärmeversorgung sichern. 24 Die Nachfrage nach<br />
Brennholz kann aktuell noch durch den Staatswald<br />
gedeckt werden, ist jedoch stetig steigend. 25 Teilweise verkaufen Privatwaldbesitzer ihr Holz an<br />
überregionale Biomassekraftwerke, Holzhändler oder Baumärkte. 26 Abbildung 3: Waldbesitzverteilung<br />
(Naturstiftung DAVID, 2008)<br />
Eine koordinierte und<br />
zielorientierte Nutzung des Holzes als nachwachsender Rohstoff zur Energiegewinnung in der<br />
gesamten Region über den privaten Bedarf hinaus findet bislang jedoch nicht statt. Diese<br />
Potentiale, die das vorhandene Waldgebiet bzgl. der Nutzung nachwachsender Rohstoffe bietet,<br />
werden noch nicht ausreichend genutzt.<br />
4.2.1.1 Landwirtschaft<br />
Aufgrund unterschiedlicher Datenlage werden, soweit möglich, die Daten für die Planungsregion<br />
dargestellt. Wo dies nicht möglich ist, muss auf die Ebene der Landkreise zurückgegriffen<br />
werden.<br />
Landwirtschaftliche Standortbedingungen<br />
Um die landwirtschaftlichen Standortbedingungen zu charakterisieren, werden Ackerzahl (AZ),<br />
Grünlandzahl (GZ), landwirtschaftliche Vergleichzahl (LVZ) sowie der Anteil des Grünlandes an<br />
der landwirtschaftlich genutzten Fläche herangezogen. Diese geben eine „Leistungsfähigkeit“<br />
24 Gespräch mit Herrn Klüßendorf (Leiter Forstamt Oldisleben), 07.04.2009, Oldisleben<br />
25 ebd.<br />
26 Gespräch mit Herrn Schenke auf einer Exkursion durch die Region Hohe Schrecke<br />
46
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
der Böden unter natürlichen Ertragsbedingungen (z.B. Boden, Klima, Relief) an. Der<br />
Grünlandanteil ist ein weiteres Indiz für die Standortgüte, da im Regelfall der Grünlandanteil mit<br />
abnehmender Standortgüte zunimmt. Tabelle 11 stellt die Kennzahlen für die beiden Landkreise<br />
dar. In den Gemeinden der Planungsregion herrschen Ackerzahlen von 50 bis unter 70,<br />
Grünlandzahlen von 30 bis unter 60 und landwirtschaftliche Vergleichzahlen von 50 bis unter 70<br />
vor. 27 Insgesamt kann daher die Leistungsfähigkeit der Böden im Planungsgebiet als gut bis sehr<br />
gut bewertet werden. Damit bestehen gute Standortbedingungen für eine großflächige<br />
landwirtschaftliche Produktion.<br />
Tabelle 11: AZ, GZ, LVZ und Grünlandanteil in den beiden Landkreisen 28<br />
Landkreis Ackerzahl Grünlandzahl<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
><br />
1500<br />
1500<br />
-<br />
1000<br />
Landwirte Teil Kyffhäuserkreis<br />
1000-<br />
500<br />
500 -<br />
250<br />
250 -<br />
100<br />
100 -<br />
50<br />
50 -<br />
25<br />
25 -<br />
10<br />
Landwirtschaftliche<br />
Vergleichszahl<br />
Kyffhäuserkreis 59 41 52 10,4<br />
Sömmerda 64 53 57 4,1<br />
Thüringen 47 35 39 22,5<br />
Betriebsstruktur<br />
10 - 1 1 - 0<br />
Diagramm 3: Betriebsgrößenverteilung in der<br />
Planungsregion (Anzahl der Betriebe,<br />
Größengruppen in ha; e. D. 2009) 29<br />
Grünlandanteil 2005 in %<br />
der Landwirtschaftsfläche<br />
Von den 290 im Landkreis Kyffhäuser<br />
ansässigen landwirtschaftlichen Betrieben<br />
befinden sich 2007 46 Betriebe im<br />
nördlichen Teil der Planungsregion.<br />
Hiervon haben wiederum die meisten ihren<br />
Sitz in der VG An der Schmücke. Des<br />
Weiteren befinden ca. 10 % der<br />
landwirtschaftlich genutzten Fläche des<br />
Landkreises Kyffhäuser in der<br />
Planungsregion. Im Landkreis Sömmerda<br />
haben 29 der 262 Betriebe des<br />
Landkreises ihren Sitz in der<br />
Planungsregion. Der Anteil der<br />
landwirtschaftlichen<br />
ebenfalls ca. 10%.<br />
Nutzfläche beträgt<br />
27 Siehe hierzu: www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/soem/index.html?soem06.html und<br />
www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/kyf/index.html?kyf06.html (Stand 05.05.2009)<br />
28 Quelle: www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/kyf/index.html?kyf08.html (Stand 05.05.2009)<br />
29 Die Daten wurden vom Landwirtschaftsamt Bad Frankenhausen für den im Kyffhäuserkreis liegenden Teil<br />
der Projektregion zur Verfügung gestellt. Abgefragt wurde die Anzahl jener Betriebe, die ihren Sitz in der<br />
Projektregion haben. Für den Sömmerdaer Teil wurden diese Informationen leider nicht zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
47
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Die Verteilung der Betriebsgrößen stellt sich für die Betriebe aus dem Kyffhäuserkreis, die ihren<br />
betrieblichen Sitz in der Planungsregion<br />
haben, wie folgt dar: In den Größengruppen<br />
45<br />
über 1500 ha, 1000 ha bis 1500 ha, 500 ha bis<br />
1000 ha und 500 ha bis 250 ha befinden sich<br />
40<br />
35<br />
30<br />
in der Region vergleichsweise wenige Betriebe 25<br />
(alle zusammen sind 5, vgl. Diagramm 3). Die 20<br />
meisten Betriebe haben Größen von 100 – 250 15<br />
ha bzw. unter 10 ha. Damit bestimmen im<br />
10<br />
Wesentlichen diese zwei großen Gruppen an<br />
Betrieben das Bild der Landwirtschaft in der<br />
Hohen Schrecke. Haupt- und Nebenerwerb<br />
5<br />
0<br />
Haupterwerb Nebenerwerb Gesamt<br />
verteilen sich nahezu gleichmäßig in den<br />
Diagramm 4: Haupt- und nebenerwerbliche<br />
betrachteten Betrieben.<br />
Haupterwerbsbetriebe sind insgesamt<br />
Als<br />
23<br />
Betriebe der Planungsregion im Kyffhäuserkreis<br />
(e.D., 2009)<br />
Betriebe vorwiegend in den Größen ab 100 ha aufwärts geführt, während flächenmäßig kleinere<br />
Betriebe vorrangig als Nebenerwerbsbetriebe geführt werden.<br />
Dadurch ergeben sich für die Region im Wesentlichen zwei Gruppen an Betrieben, einerseits<br />
Großunternehmer und im Haupterwerb geführte mittelständische Betriebe und andererseits<br />
kleine im Nebenerwerb geführte Betriebe. In der Region „Hohe Schrecke“ ist ein breites<br />
Spektrum an unterschiedlichen Betriebsstrukturen vorhanden, das sich auch positiv auf die<br />
Regionalentwicklung auswirken kann, da hier in unterschiedlichen Betriebsformen<br />
unterschiedliche Potentiale vorhanden sind, die es entsprechend zu nutzen gilt.<br />
Tabelle 12: Verteilung der Größenklassen in den Erwerbsformen Haupt- und Nebenerwerb<br />
Größenklassen in<br />
ha<br />
> 1500<br />
1500 -<br />
1000<br />
1000-<br />
500<br />
500 -<br />
250<br />
250 -<br />
100<br />
100 - 50 50 - 25 25 - 10 10 - 1 1 - 0<br />
Haupterwerb 1 1 1 2 9 1 3 3 1 1<br />
Nebenerwerb 0 0 0 0 0 0 0 3 16 3<br />
Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lagen keine vergleichbaren Daten für den Teil des<br />
Landkreises Sömmerda vor.<br />
48
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Tabelle 13 Landwirtschaftliche Betriebe der Region (2007) 30<br />
Versorgung und Vermarktung<br />
Betriebe (Anzahl) LNF in ha<br />
Landkreis Kyffhäuserkreis 290 68391<br />
<strong>Wiehe</strong> 4 991<br />
Donndorf 7 2108<br />
Hauteroda 1 .<br />
Heldrungen 13 418<br />
Oberheldrungen 10 2300<br />
Gehofen 6 294<br />
Nausitz - -<br />
Reinsdorf 5 312<br />
Landkreis Sömmerda 262 58407<br />
Beichlingen 7 1732<br />
Großmonra 7 366<br />
Ostramondra 4 190<br />
Rastenberg 11 3119<br />
Die Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse erfolgt großteils über Großabnehmer. Daneben<br />
gibt es Direktvermarkter, die Gemüse, Wurst und Fleischwaren, Milchprodukte aber auch<br />
Getränke und Brotwaren vertreiben. Für das Planungsgebiet konnten jeweils 4 Direktvermarkter<br />
pro Landkreis erfasst werden 31 . Diese Direktvermarkter sind zum Teil ökologisch wirtschaftende<br />
Betriebe, zum Teil vertreiben sie ihre Produkte unter dem Qualitätszeichen „Geprüfte Qualität“ –<br />
Thüringen. Allerdings sind, laut Aussagen von Akteuren auf dem Regionalforum, regional<br />
verankerte Wertschöpfungsketten, die Landwirtschaft und Handel miteinander verknüpfen,<br />
bislang kaum vorhanden.<br />
30 Quelle:http://www.tls.thueringen.de/seite.asp?aktiv=dat01&startbei=datenbank/default2.asp<br />
31 In die Analyse einbezogen wurden ein Flyer zur Direktvermarktung in Sömmerda sowie die Auswertung<br />
der Internetseiten www.agrarmarketing.thueringen.de und www.oekoeinkaufsfuehrer-thueringen.de<br />
49
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
4.2.2 Zusammenfassung Stärken und Schwächen<br />
Forstwirtschaft<br />
Stärken Schwächen<br />
+ Zunehmende private Brennholznutzung<br />
Landwirtschaft<br />
Stärken Schwächen<br />
+ Gute Standortbedingungen für<br />
landwirtschaftliche Produktion<br />
+ Einzelne Direktvermarkter bieten eine Vielfalt<br />
an verschiedenen Produkten<br />
+ Breites Spektrum an unterschiedlichen<br />
Betriebsstrukturen; sowohl sehr große Betriebe<br />
als auch kleinere Betriebe (Kyffhäuser-Teil der<br />
Region)<br />
- Nutzung von regenerativen Energien<br />
ausbaufähig<br />
- Kaum Ansätze von regionalen<br />
Wertschöpfungsketten im Sinne der<br />
Verknüpfung von Landwirtschaft und Handel<br />
50
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
4.3 Siedlungsbau und Breitband-Infrastruktur<br />
4.3.1 Siedlungsstruktur<br />
Die Landkreise Kyffhäuserkreis und Sömmerda sind durch eine historisch gewachsene<br />
dezentrale Siedlungsstruktur geprägt. Auch in der Planungsregion „Hohe Schrecke“ überwiegen<br />
ländliche Ortschaften mit attraktiven Siedlungskernen und historischer Bebauung. Während die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> (hier ohne Gemeinde Donndorf) und die <strong>Stadt</strong> Heldrungen mit jeweils über 2.000 EW<br />
einen eher städtischen Siedlungscharakter aufweisen, sind die übrigen Gemeinden des<br />
Planungsgebietes mit Einwohnerzahlen zwischen 181 EW (Nausitz) und 969 EW (Großmonra) als<br />
typisch ländliche Siedlungen zu charakterisieren. 32 Aufgrund der peripheren Lage der Region und<br />
des Bevölkerungsrückgangs nach der Wende 1989/90 sind keine größeren Wohngebiete an den<br />
Rändern der Siedlungen ausgewiesen worden. Hierdurch haben sich die historisch gewachsenen<br />
Siedlungsstrukturen mit traditionellen Flächennutzungen wie Streuobstwiesen, in ihren<br />
Randlagen erhalten können. Das Orts- und Landschaftsbild prägen teilweise alte Industrie- und<br />
LPG-Flächen aus der Zeit der DDR. Nach der Wende fielen diese Areale häufig brach, eine<br />
Nachnutzung konnte nicht in allen Fällen realisiert werden.<br />
Die nachfolgenden Analysen konzentrieren sich auf die Erhebung des Leerstands der<br />
historischen Bausubstanz und auf die brach liegenden Industrie- und Gewerbeflächen in der<br />
Region.<br />
Die Erhebungen beruhen auf folgenden Datenquellen:<br />
� Auszug aus Brachflächendatenbank des Landratsamts Kyffhäuserkreis (Stand 2007),<br />
� mündliche und schriftliche Mitteilungen der Bauamtsleiter in den Verwaltungsgemeinschaften,<br />
� Auskünfte der unteren Denkmalbehörden,<br />
� Mitteilungen der Superintendatur des Kirchenkreises Sömmerda.<br />
Die Bestandsanalyse ist derzeit noch nicht abgeschlossen. Teilweise liegen Informationen zu<br />
leerstehenden Gebäuden in den Verwaltungsgemeinschaften nicht vor oder müssen aufwendig<br />
aus dezentralen Quellen zusammengefasst werden.<br />
32 Angaben zu den Einwohnerzahlen: Thüringer Landesamt für Statistik, Gebietsstand 30.6.2008,<br />
veröffentlicht am 11.11.2008 (http://www.tls.thueringen.de/seite.asp?aktiv=dat01&startbei=datenbank/<br />
default2.asp).<br />
51
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
4.3.2 Leerstand (historischer) Bausubstanz<br />
Bedingt durch den sozio-ökonomischen Strukturwandel, den Bevölkerungsrückgang und<br />
veränderte Nachfragestrukturen ist bei historischen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden (Baujahr<br />
vor 1918) ein erhöhter Leerstand zu verzeichnen. Dies betrifft alte Bauern- oder<br />
Ackerbürgerhäuser, Gutshöfe und ihre Nebengebäude, die Bahnhöfe in den Gemeinden entlang<br />
der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Nebra und Artern, Pfarrhäuser in nicht mehr besetzten<br />
Pfarreien, alte Industriegebäude und landwirtschaftliche Einrichtungen. Wohnhäuser werden<br />
aufgrund des anhaltenden Wegzugs junger Menschen zunehmend nicht mehr von Familien,<br />
sondern von älteren und allein stehenden Bürgern bewohnt. 33<br />
Aufgrund von Zusammenlegungen der Pfarrämter ist die Mehrzahl der Pfarreien in der Region<br />
nicht mehr besetzt (z.B. Gehofen, Langenroda (vermietet), Hauteroda, Oberheldrungen,<br />
Beichlingen, Altenbeichlingen, Großmonra). 34<br />
In der folgenden Übersicht sind die leer stehenden Gebäude in der Planungsregion<br />
zusammengestellt.<br />
Tabelle 14: Übersicht über die leerstehenden Gebäude in der Planungsregion<br />
Gemeinde Art der Gebäude Quelle<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> Wirtschaftsgebäude am Schloss <strong>Wiehe</strong>,<br />
Einzeldenkmal<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> Gesamtgebäudebestand ohne Ortsteile<br />
761, insg. 15 leerstehende Gebäude,<br />
davon 11 Gebäude mit Wohn- und<br />
Geschäftsnutzung in der Leopold-v.-<br />
Ranke Straße (Denkmalensemble des<br />
förmlich festgelegten Sanierungsgebiets),<br />
darunter 1 Einzeldenkmal<br />
Donndorf Gebäudekomplex Bahnhof Donndorf<br />
(Klinkerbau)<br />
Auskunft Bauamt <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Wiehe</strong><br />
Auskunft Bauamt <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Wiehe</strong><br />
Auszug Brachflächendatenbank<br />
des LK<br />
Kyffhäuserkreis, Stand 2007<br />
Reinsdorf Bahnhof (Klinkerbau) Auszug Brachflächendatenbank<br />
des LK<br />
Kyffhäuserkreis, Stand 2007<br />
Reinsdorf Gesamtgebäudebestand 320, insg. 12<br />
leerstehende Wohngebäude, davon 8 in<br />
der Hauptstraße<br />
Auskunft Bauamt der VG<br />
„Mittelzentrum Artern“<br />
33<br />
Lt. Auskunft Frau Dittmer, Bürgermeisterin <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong><br />
34<br />
Lt. Auskunft Herr Braasch, Rankeverein <strong>Wiehe</strong> e.V., eine Anfrage an die Superintendatur des<br />
Kirchenkreises, Hr. Zaake, bezüglich der aktuellen Nutzung wurde gestellt.<br />
52
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Gehofen Bahnhof (Klinkerbau) Auszug Brachflächendatenbank<br />
des LK<br />
Kyffhäuserkreis, Stand 2007<br />
Gehofen Gesamtgebäudebestand 321, davon 13<br />
leerstehend, überwiegend alter Ortskern,<br />
z.B. Eckhaus Hauptstraße 7, Gebäude<br />
und Grundstück schlechter Zustand, Haus<br />
ehem. Konsum, Turnplatz 4, Grundstück<br />
stark verwildert, Gebäude in schlechtem<br />
Zustand<br />
Gehofen Alte Ziegelei mit erhaltener<br />
Industrietechnik, Wohnhaus und alte<br />
Ziegelei stark sanierungsbedürftig, unter<br />
Denkmalschutz<br />
Nausitz Gesamtgebäudebestand 72, davon 5<br />
leerstehende Wohngebäude in der<br />
Dorfstraße<br />
<strong>Stadt</strong><br />
Heldrungen<br />
<strong>Stadt</strong><br />
Heldrungen, OT<br />
Braunsroda<br />
<strong>Stadt</strong><br />
Heldrungen, OT<br />
Braunsroda<br />
<strong>Stadt</strong><br />
Heldrungen, OT<br />
Braunsroda<br />
14 leerstehende Gebäude im förmlich<br />
festgelegten Sanierungsgebiet, davon 4<br />
Gebäude im Bereich des<br />
Ensembleschutzes an der Hauptstraße<br />
Auskunft Bauamt der VG<br />
„Mittelzentrum Artern“,<br />
Auszug Brachflächendatenbank<br />
des LK Kyffhäuserkreis,<br />
Stand 2007<br />
Auskunft Bauamt der VG<br />
„Mittelzentrum Artern“,<br />
Auszug Brachflächendatenbank<br />
des LK Kyffhäuserkreis,<br />
Stand 2007<br />
Auskunft Bauamt der VG<br />
„Mittelzentrum Artern“<br />
Bestandsaufnahme<br />
leerstehender Gebäude<br />
(Abrissobjekte), Stand<br />
13.03.2007<br />
Alter Futterturm am Gutshof Braunsroda Mitteilung Herr v. Bismarck<br />
Westlicher Seitenflügel des Gutshof<br />
Braunsroda<br />
Mitteilung Herr v. Bismarck<br />
Östlicher Flügel am Gutshof Braunsroda Mitteilung Herr v. Bismarck<br />
Ostramondra Gutshof „Weißbarthaus“, in<br />
Gemeindebesitz, in Teilen Dachsanierung<br />
über Dorferneuerung, Gelände teilweise<br />
verwildert<br />
Gemeinden der<br />
VG Kölleda<br />
Mitteilung Bürgermeister<br />
der Gemeinde Ostramondra<br />
Daten zum Leerstand liegen nicht vor. Auskunft des Bauamts der<br />
VG „Kölleda“<br />
Fazit: Auch wenn zu diesem Zeitpunkt nicht für alle Gemeinden der Planungsregion<br />
Informationen zum Leerstand vorliegen, zeigen sich deutlich folgende Tendenzen:<br />
1. Der Gebäudeleerstand in den betrachteten Gemeinden ist insgesamt noch nicht als gravierend<br />
einzuschätzen (< 5 %). Allerdings ist vor dem Hintergrund der prognostizierten<br />
Bevölkerungsentwicklung davon auszugehen, dass die Leerstandsproblematik bei einem<br />
53
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
anhaltenden Wegzug jüngerer Bevölkerungsschichten und dem Verbleiben der über 65-jährigen<br />
zukünftig an Brisanz zunehmen wird (siehe Kap. 2.4 Wirtschaft und Bevölkerung).<br />
2. Der Wohn- und Geschäftsleerstand konzentriert sich jedoch räumlich insbesondere auf die<br />
historische Bausubstanz in den <strong>Stadt</strong>- und Ortskernen. Vor allem in den Grundzentren <strong>Wiehe</strong> und<br />
Heldrungen betrifft es historische Gebäude mit Wohn- und Geschäftsfunktion in den Ortszentren.<br />
Als Ursache hierfür kann eine Kombination aus demographischem Wandel und der Ansiedlung<br />
von Einkaufszentren auf der „grünen Wiese“ angesehen werden.<br />
Aufgrund des teilweise schlechten baulichen Zustands sind die leerstehenden historischen<br />
Gebäude teilweise vom Abriss bedroht. 35 Die Attraktivität der Ortskerne wird hierdurch insgesamt<br />
beeinträchtigt. Die Gebäude befinden sich überwiegend in Privatbesitz, daher ist der Einfluss<br />
seitens der Gemeinden begrenzt und die Frage der Sanierung vom Engagement und den<br />
finanziellen Möglichkeiten der Eigentümer abhängig. Die Städte Heldrungen und <strong>Wiehe</strong> haben<br />
das jeweilige <strong>Stadt</strong>zentrum als förmlich festgelegtes städtebauliches Sanierungsgebiet<br />
ausgewiesen. Hieraus entstehen bestimmte Fördermöglichkeiten zur denkmalgerechten<br />
Sanierung oder zum Erwerb durch die Kommune, aber auch bestimmte zu erfüllende Auflagen bei<br />
der Sanierung.<br />
4.3.3 Industrie- und Gewerbebrachflächen<br />
Trotz des starken Rückgangs der Bevölkerungszahlen ist in den Landkreisen Sömmerda und<br />
Kyffhäuserkreis v. a. aufgrund des Ausbaus der Autobahnen A 38 und A71 mit angrenzenden<br />
Gewerbegebieten eine Steigerung des Verbrauchs von Siedlungs- und Verkehrsflächen zu<br />
verzeichnen. Im Kyffhäuserkreis betrug der Flächenverbrauch in den Jahren 1992 bis 2007 562<br />
ha, das entspricht einer Steigerung von knapp 7 %. 2007 wurden insgesamt 8.049 ha der<br />
Bodenfläche als Siedlungs- und Verkehrsfläche ausgewiesen. Die Verkehrsfläche nimmt dabei<br />
mit 48 % den größten Anteil der versiegelten Fläche ein, gefolgt von den Gebäude- und<br />
Freiflächen mit 43,9 %. Im Landkreis Sömmerda wurden 2007 insgesamt 6.356 ha als Siedlungsund<br />
Verkehrsfläche ausgewiesen. Auch hier ist ein Anstieg des Verbrauchs von Siedlungs- und<br />
Verkehrsflächen in den Jahren 1992 bis 2007 zu verzeichnen. Der Flächenverbrauch beträgt hier<br />
629 ha, das entspricht einer Steigerung von knapp 10 %. Der Anteil der Verkehrsflächen lag<br />
dabei bei 45,7 %, während 46,9 % den Gebäude- und Freiflächen zugeordnet werden können<br />
(Quelle: Statistisches Landesamt Thüringen). Aufgrund der anhaltend stagnierenden Wirtschaftsund<br />
Bevölkerungsentwicklung ist der Versiegelungsdruck (Baugebiete für Wohnbebauung,<br />
Industrie- oder Gewerbeflächen) in der Planungsregion jedoch insgesamt nicht als gravierend<br />
einzuschätzen. Die Auflassung industrieller und landwirtschaftlicher Betriebe hat vielmehr das<br />
35 Mdl. Mitteilung der befragten Bauamtsleiter<br />
54
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Brachfallen von Flächen und Gebäuden zur Folge. Folgende Industrie- und Gewerbebrachen<br />
befinden sich im Planungsgebiet: 36<br />
Tabelle 15: Industrie- und Gewerbebrachen<br />
Gemeinde Flächenbezeichnung Bemerkung<br />
<strong>Stadt</strong> Heldrungen LPG-Gelände (52.000 m²) Gebäudekomplex einer ehemaligen<br />
LPG, mehrere Gebäude Abriss nötig,<br />
bei mehreren Gebäuden (Stallung,<br />
Halle, technische Anlage Nutzung<br />
mgl.), Altlastenverdachtsfläche,<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> Kiesseen <strong>Wiehe</strong> und Alte<br />
Schuhfabrik (8558 m²)<br />
Gebäudekomplex im Außenbereich<br />
der Gemarkung <strong>Wiehe</strong>, direkt am<br />
Flutkanal, stark verwildert, Abriss der<br />
Gebäude nötig<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> Möbelfabrik „Möbia“ (5395 m²) Gebäudekomplex am Ortsrand der<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>, aktuell 2<br />
Handwerksbetriebe in alten<br />
Produktionsgebäuden ansässig,<br />
Sanierung nötig<br />
Nausitz Keine Brachflächen Auskunft Bauamt VG „Mittelzentrum<br />
Artern“<br />
Gehofen Keine Brachflächen, ehem. LPG-<br />
Gelände in Nutzung<br />
Ostramondra Altes LPG-Gelände außerhalb<br />
des Ortskerns (von Gemeinde<br />
verpachtet, genutzt als<br />
Unterstand); alte<br />
Konsumkaufhalle im Ortskern,<br />
Besitzer Gemeinde<br />
Reinsdorf Keine Brachflächen, ehem. LPG-<br />
Gelände in Nutzung<br />
Auskunft Bauamt VG „Mittelzentrum<br />
Artern“<br />
Auskunft Bürgermeister Ostramondra<br />
Auskunft Bauamt VG „Mittelzentrum<br />
Artern“<br />
In den beteiligten Gemeinden und in deren Ortsteilen aus dem LK Sömmerda befinden sich nach<br />
Aussage der unteren Naturschutzbehörde außer einigen Ruderalstellen (illegale<br />
Müllablagerungen, aufgelassene Sandgrube in Großmonra) keine Industrie- oder sonstige<br />
36 Quelle: Auszug aus Brachflächenkataster des Landratsamtes Kyffhäuserkreis, Stand 2007<br />
55
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Gewerbebrachflächen. 37 Eine weitere Anfrage zum Bestand an Brachflächen wurde beim<br />
Landratssamt Sömmerda gestellt. Für den bestehenden Kalksteinbruch in Ostramondra/OT<br />
Burgwenden, das direkt an das NSG „Finnberg“ angrenzt, liegt ein Abschlussbetriebsplan vor.<br />
Nach Auslaufen des Bergbaus wird hier eine weitere Brachfläche entstehen. Über etwaige<br />
Nutzungen liegen derzeit keine Informationen vor. Nach Informationen des ALF Gotha vom<br />
04.05.2009 hat von den Gemeinden des Planungsgebiets bisher die <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> einen Antrag<br />
auf ein Revitalisierungskonzept für die Gewerbebrache „Kiesseen <strong>Wiehe</strong>“ gestellt. 38<br />
4.3.4 Breitband-Infrastruktur<br />
In Thüringen besteht eine Abdeckung an Internetanschlüssen mit einer Übertragungsrate von<br />
mindestens 128 kBit/s für 95% aller Haushalte. In Thüringen wird geschätzt, dass derzeit ca.<br />
57.000 Haushalte keinen Breitbandanschluss 39 besitzen. Ein hoher Bedarf an schnellen<br />
Internetanschlüssen besteht vor allem in Gemeinden in den ländlichen Räumen, die für<br />
Breitbandanbieter unrentabel sind, so auch in Teilen der Planungsregion.<br />
Derzeit wird im Rahmen der angestoßenen Breitbandinitiative „Thüringen Online“ ein<br />
„Breitbandbedarfsatlas“ erarbeitet, der als Informationsgrundlage dienen soll. Das seit Juli 2009<br />
eingerichtete Breitband-Kompetenzzentrum bei der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen<br />
sowie die bei den Landkreisen ansässigen „Breitbandpaten“ sollen Antragstellern beratend zur<br />
Seite stehen und die Antragsverfahren unterstützen. 40<br />
Von den Vertretern der Gemeinden des Planungsgebiets wird eine Unterversorgung mit schnellen<br />
Internetanschlüssen, insbesondere in den „Taldörfern“ bemängelt. Durch Auswertung des<br />
„Breitbandbedarfsatlas“, durch persönliche Gespräche und in den Arbeitsgruppen wurde<br />
folgender Überblick zur Versorgung mit Internetanschlüssen gewonnen:<br />
Im Planungsgebiet verfügen folgende Gemeinden und Gemeindeteile über Internetanschlüsse<br />
mit > 1000 kBit/s: 41<br />
37<br />
Telefonische Mitteilung Herr Schmidt v. 5.5.2009, Landratsamt Sömmerda, Untere Naturschutzbehörde,<br />
Für die Gemeinden der VG Kölleda wurde eine Brachflächenanfrage beim Bauamt gestellt, Studie wird per<br />
Email geschickt<br />
38<br />
Ein Antrag auf Revitalisierung der Gewerbebrache ehemalige Möbelfabrik „Möbia“ ist vom ALF Gotha<br />
negativ beschieden worden (Auskunft Bauamt der <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> vom 13. Oktober 2009)<br />
39<br />
Von Breitband wird in der Regel ab einer Übertragungsrate von 1 MBit/s gesprochen. Aktuelle<br />
Entwicklungen<br />
40 http://www.thueringen.de/de/tmwta/technologie/breitbandinitiative/ansprechpartner/<br />
41 Informationen beruhen auf fernmdl. Mitteilungen der Bauamtsleiter der beteiligten Städte und<br />
Verwaltungsgemeinschaften vom 06.05.2009, auf Informationen aus der Arbeitsgruppe „Siedlungsbau,<br />
Infrastruktur und Kultur“ vom 23.04.2009 sowie auf der Auswertung des Breitbandbedarfsatlas und des<br />
Breitbandangebotsatlas der Breitband-Initiative „Thüringen Online“<br />
56
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
� <strong>Wiehe</strong> Ortskern, Anbieter DSL/Telekom,<br />
� Heldrungen inkl. OT Braunsroda und Teile von Oberheldrungen, Anbieter Telekom ,<br />
� Nausitz: WLAN-Richtfunktechnik, Anbieter AVACOMM Systems. 42<br />
In folgenden Gemeinden wird das Breitbandnetz derzeit ausgebaut:<br />
� Hauteroda und unterversorgte Teile von Oberheldrungen: Anbieter DSL/Telekom,<br />
Fertigstellung bis September/Oktober 2009 43<br />
� Ostramondra: WLAN-Richtfunktechnik, ausgehend von Kölleda, Anbieter AVACOMM Systems<br />
In folgenden Gemeinden und Ortsteilen wird der Ausbau mit Breitband geplant:<br />
� Gehofen und Reinsdorf: Anbieter DSL/Telekom, Ausbau erfolgt durch bereits verlegte<br />
Leerrohre, Zeitpunkt der Nutzungsbereitstellung nicht bekannt<br />
� Bachra: Weiterleitung des Richtfunksignals von Ostramondra geplant<br />
Folgende Orte und Ortsteile der Region besitzen keinen Breitband-Anschluss:<br />
� Donndorf und OT Kleinroda 44<br />
� <strong>Wiehe</strong> OT Langenroda und Garnbach (Stichwort „Taldörfer“)<br />
� Großmonra und OT Backleben sowie Burgwenden<br />
� Beichlingen und OT Altenbeichlingen<br />
Im Falle der OT Kleinroda und Langenroda hat die Telekom bereits signalisiert, daß der Ausbau<br />
wirtschaftlich nicht tragbar ist. 45<br />
Bezogen auf die Bevölkerung der Planungsregion wird deutlich, dass ca. 50% der Haushalte<br />
aktuell über keinen Breitbandanschluss verfügen. In Teilen ist der Ausbau mit<br />
leitungsgebundenen Technologien aufgrund fehlender Rentabilität auch zukünftig nicht zu<br />
erwarten. Insbesondere im Hinblick auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung ist daher<br />
insgesamt von einem erheblichen Ausbaubedarf bezüglich des Breitbandnetzes auszugehen.<br />
42 http://www.avacomm24.de/index.html<br />
43 Auskunft des Bürgermeisters von Hauteroda<br />
44 Auskunft Bauamt Donndorf vom 25.05.2009<br />
45 Auskunft Leiter des Bauamtes <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong><br />
57
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
4.3.5 Zusammenfassung Stärken und Schwächen<br />
Historische Bausubstanz<br />
Stärken Schwächen<br />
+ Erhalt attraktiver historisch gewachsener<br />
Städte und Dörfer, Möglichkeiten der<br />
Innenentwicklung<br />
+ Förmlich festgelegter innerstädtischer<br />
Sanierungsgebiete in <strong>Wiehe</strong> und Heldrungen<br />
Industrie- und Gewerbebrachflächen<br />
Stärken Schwächen<br />
+ Im Planungsgebiet insgesamt geringe Anzahl<br />
an Gewerbebrachen<br />
+ Bestehende Renaturierungs- und<br />
Umnutzungsansätze<br />
Breitband-Infrastruktur<br />
Stärken Schwächen<br />
+ Einzelne Praxisbeispiele funkbasierter<br />
Lösungen in der Region<br />
- Zunehmender Leerstand von Wohn- und<br />
Wirtschaftsgebäuden und deren Verfall in<br />
historischem Gebäudebestand v.a. der<br />
Ortszentren<br />
- Wenig Engagement der Privateigentümer zur<br />
Erhaltung historischer Bausubstanz<br />
- Bestehende Gewerbebrachen beeinträchtigen<br />
Orts- und Landschaftsbild, besonders in<br />
Randlagen der Grundzentren Heldrungen und<br />
<strong>Wiehe</strong><br />
- Teilweise aufwendige Umstrukturierungen der<br />
Besitzverhältnisse nötig<br />
- Ca. 50% der Haushalte ohne<br />
Breitbandanschluss<br />
- Komplizierte Antragstellung bei der<br />
thüringischen Breitbandinitiative<br />
58
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
4.4 Bildung und Kultur<br />
4.4.1 Umweltbildung<br />
In der Region Hohe Schrecke befassen sich verschiedene Träger mit Umweltbildungsthemen.<br />
Folgende Tabelle zeigt eine Auswahl an Institutionen die im Bereich der Umweltbildung tätig<br />
sind:<br />
Tabelle 16: Institutionen im Bereich Umweltbildung<br />
Institution Ort Profil<br />
Heimatverein Schloss<br />
Heldrungen e. V., Deutscher<br />
Jugendherbergsverband e.V.<br />
Heimatverein <strong>Wiehe</strong> e.V. <strong>Wiehe</strong><br />
Thepra e.V. Begegnungsstätte,<br />
„Naturhaus <strong>Wiehe</strong> Garnbach“<br />
Ländliche Heimvolkshochschule<br />
Donndorf<br />
Heldrungen Jugendherberge Wasserburg,<br />
Programme für Freizeit- und<br />
Familiengruppen, Lernort<br />
Geschichte<br />
<strong>Wiehe</strong> Jugendhilfe, Sozialarbeit,<br />
Frühförderung<br />
Donndorf Naturerfahrung<br />
Verein für Jugendhilfe e.V. Donndorf Arbeitsschwerpunkte<br />
Umweltbildung und Naturschutz<br />
Haus auf dem Berge e. V.<br />
Kinder- und Jugenddorf „Am<br />
Windberg“, Deutscher<br />
Jugendherbergsverband e.V.<br />
Schmücke-Grundschule<br />
Oberheldrungen<br />
Hauteroda Bildungsangebote der<br />
Christengemeinschaft Hauteroda<br />
Beichlingen Jugendherberge, Lernort Natur,<br />
Erlebnispädagogik und<br />
Umweltbildung, internationale<br />
Jugendreisen<br />
Oberheldrungen Umweltbildung im<br />
Grundschulbereich,<br />
Kontaktschule für Umwelt,<br />
Kooperation mit BUND, Naturpark<br />
Kyffhäuser, Forstamt Oldisleben<br />
Markus-Gemeinschaft e.V. Hauteroda Umweltorientierte,<br />
heilpädagogische,<br />
sozialtherapeutische Arbeit und<br />
Ausbildung für Menschen mit<br />
Behinderung<br />
Folgende Naturlehrpfade befinden sich in der Region:<br />
� Naturlehrpfad im Kuckuckswäldchen in <strong>Wiehe</strong> – Zustand: Lehrpfad ist nicht gepflegt,<br />
Informationstafeln fehlend, nicht lesbar oder durch Vandalismus beschädigt<br />
59
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
� Naturlehrpfad in Beichlingen oberhalb der Jugendherberge am Eingang zur Schmücke –<br />
Zustand: Tafeln teilweise verwittert, fehlend oder durch Vandalismus beschädigt,<br />
� Naturlehrpfad am Kloster Donndorf: Zustand nicht bekannt.<br />
Auch an den Grundschulen der Region werden Umweltbildungsthemen angeboten. Eine bisher<br />
nicht beantwortete Anfrage zur Entwicklung der Schülerzahlen und zum Themenspektrum der<br />
Bildungsaktivitäten wurde beim Staatlichen Schulamt in Artern – zuständig für die Landkreise<br />
Sömmerda und Kyffhäuserkreis – gestellt. Aus Gesprächen ist jedoch bisher bekannt, dass die<br />
Grundschulen in <strong>Wiehe</strong> und Oberheldrungen aufgrund der abwandernden Bevölkerung und den<br />
anhaltend niedrigen Geburtenraten in Zukunft mit rückläufigen Schülerzahlen zu rechnen haben.<br />
Obwohl der Betreuungsschlüssel dadurch positiver ausfällt, als beispielsweise in den Zentren<br />
oder in den alten Bundesländern, hat die generelle Abnahme der Schülerzahl eine verstärkte<br />
Konkurrenz der Schulstandorte zur Folge. Die beiden Schulen bieten verschiedene<br />
Umweltbildungsangebote für Schulkinder auch in Kooperation mit weiteren Partnern der Region<br />
an – bspw. Kooperation der Schmücke-Grundschule mit dem Forstamt Oldisleben oder mit dem<br />
Naturpark Kyffhäuser.<br />
In den bisher durchgeführten Arbeitsgruppen wurde wiederholt herausgearbeitet, dass die<br />
Akteure zu wenig Kenntnis von weiteren Umweltbildungsangeboten haben und zu wenig vernetzt<br />
sind. In der Folge würden beispielsweise Schulkinder „nur einmal“ in das Jugenddorf „Am<br />
Windberg“ fahren. Für weitere Besuche sind die derzeitigen Angebote nicht attraktiv genug.<br />
Somit werden hierdurch auch Chancen für eine touristische Stärkung durch längerfristige oder<br />
mehrmalige Besuche für Umweltbildung in der Region nicht genutzt.<br />
Es wurde weiterhin darauf hingewiesen, dass derzeit eine belastbare Informationsbasis zu<br />
bestehenden und geplanten touristischen Angeboten in der Region Hohe Schrecke fehlt.<br />
60
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
4.4.2 Berufliche Aus- und Weiterbildung<br />
In der Planungsregion befinden sich kaum Einrichtungen der beruflichen Aus- und Weiterbildung.<br />
Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl an Einrichtungen im näheren Umkreis. 46<br />
Tabelle 17: Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung<br />
Institution Ort Profil<br />
Aus- und Weiterbildungszentrum<br />
„Am Windberg“<br />
IBKM gemeinnützige Schulträger<br />
GmbH<br />
Markus-Gemeinschaft e. V.<br />
Beichlingen Befindet sich im Aufbau, geplant<br />
sind u.a. Ausbildungen im<br />
Bereich Tourismus<br />
Heldrungen Therapie, Pädagogik, Pflege,<br />
Gesundheit, Soziales, Technik<br />
Hauteroda Heilpädagogische,<br />
sozialtherapeutische Arbeit,<br />
soziale Landwirtschaft<br />
Der Jugend eine Chance! Sondershausen Fortbildung , Talentförderung<br />
ABS - Arbeits -, Bildungs - und<br />
Strukturentwicklungsgesellschaft<br />
mbH Thüringen Nord<br />
Bildungswerk Dortmund e.V.<br />
FIB - Berufsbildungs- und<br />
Informationszentrum<br />
Artern Arbeitsförderung<br />
Artern Weiterbildung,<br />
Erwachsenenbildung,<br />
Frauenbildung<br />
Artern U.a. Weiterbildung Gastronomie<br />
Volkshochschule Kyffhäuserkreis Artern Kaufmännische Lehrgänge,<br />
BfB Berufliche Bildungsstätte<br />
Kölleda GmbH<br />
DGB- Berufsfortbildungswerk<br />
GmbH Berufsbildungsstätten<br />
(bfw)<br />
Kölleda U.a. Aus- und Fortbildungen im<br />
Bereich Garten- und<br />
Landschaftspflege,<br />
Umweltschutz<br />
Sömmerda Dienstleistungen im Bereich Aus-<br />
und Weiterbildung u.a.<br />
Ausbildungsstätte im Bereich<br />
Hotel und Gastronomie<br />
Bildungsangebote im Bereich Gastronomie und Hotellerie – also Ausbildung und Schulung von<br />
Servicekräften sowie kaufmännische Bildungsangebote – sind im weiteren Umfeld der Region<br />
vorhanden.<br />
46 Quellen: verschiedene Homepages der aufgeführten Institutionen<br />
61
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Sowohl in der Planungsregion als auch im näheren Umfeld sind aktuell keine Bildungsangebote<br />
vorhanden, die spezifisch auf die Entwicklungsfelder Natur- und Umweltbildung oder sanften<br />
Tourismus ausgerichtet sind. Das von der Jugendherberge Beichlingen aktuell geplante und im<br />
Aufbau befindliche Aus- und Weiterbildungszentrum „Am Windberg“ könnte jedoch bei<br />
entsprechender Perspektive auch touristische Aspekte mit Bezug zur Hohen Schrecke in der<br />
Ausbildung beinhalten. 47<br />
47 Auskunft des Leiters der Jugendherberge Beichlingen<br />
62
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
4.4.3 Zusammenfassung Stärken und Schwächen<br />
Umweltbildung<br />
Stärken Schwächen<br />
+ Großes naturräumliches und kulturhistorisches<br />
Potential für die Inwertsetzung durch<br />
Umweltbildung<br />
+ Einzelne Anbieter für Umweltbildung vorhanden<br />
+ Grundschulen der Region mit Aktivitäten in der<br />
Umweltbildung<br />
Berufliche Aus- und Weiterbildung<br />
Stärken Schwächen<br />
+ Anbieter für die berufliche Aus- und<br />
Weiterbildung vorhanden<br />
4.5 Vernetzung<br />
- Keine systematische Aufarbeitung möglicher<br />
Orte und Themen für die gesamte Region Hohe<br />
Schrecke<br />
- Nicht ausreichende Vernetzung und<br />
Abstimmung der Anbieter von Umweltbildung<br />
untereinander<br />
- Keine systematische Nutzung der<br />
Umweltbildungspotentiale in der Hohen<br />
Schrecke<br />
- Bisher keine Ausbildungsangebote, die sich auf<br />
regionale Entwicklungsthemen und –potentiale<br />
Tourismus in Verbindung mit Natur und<br />
Landschaft beziehen<br />
Von zentraler Bedeutung für die Regionalentwicklung ist die Zusammenarbeit zwischen den<br />
Akteuren innerhalb des Projektgebietes. Mit der im Jahr 2002 gegründeten Kommunalen<br />
Arbeitsgemeinschaft „Hohe Schrecke“ und im Jahr 2008 gegründeten Verein „Hohe Schrecke –<br />
Alter Wald mit Zukunft“ sind Grundstrukturen der regionalen Kooperation auf der Ebene der<br />
Kommunen, organisierter Interessenvertretungen und einzelner aktiver Unternehmer vorhanden.<br />
Die zahlreichen geführten Gespräche im Rahmen der Bestandsanalyse zeigen aber, dass darüber<br />
hinaus Kooperationsstrukturen der Akteure rund um die Hohe Schrecke nur gering ausgeprägt<br />
sind. „Die Akteure haben die Hohe Schrecke derzeit eher im Rücken“. 48 Dieses Zitat steht<br />
stellvertretend für die in Gesprächen häufiger bemängelte Wahrnehmung sowohl des Naturraums<br />
und seiner Potentiale als auch der Akteure untereinander. Demzufolge sind auch der<br />
Informationsaustausch und die gemeinsame Abstimmung der Akteure auf „beiden Seiten“ der<br />
Hohen Schrecke (gemeint sind hier die beiden Landkreise Sömmerda und Kyffhäuserkreis) als<br />
nicht ausreichend identifiziert worden. Häufig ist bereits die unterste Stufe der Kooperation<br />
„gegenseitige Information“ nicht entwickelt.<br />
48 Aussage einer Gemeindevertreterin<br />
63
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
5 Regionale Entwicklungsstrategie<br />
Aufbauend auf der Analyse vorhandener Planungen, diagnostizierter Stärken und Schwächen<br />
und umfangreicher Gespräche mit regionalen Akteuren wird die folgende integrierte regionale<br />
Entwicklungsstrategie formuliert.<br />
5.1 Leitbild der Region „Hohe Schrecke“<br />
Ausgangspunkte der integrierten Entwicklungsstrategie für die Region „Hohe Schrecke“ sind die<br />
überregional bedeutsame naturräumliche Ausstattung (Hohe Schrecke, Thüringens größtes<br />
Naturschutzgebiet) und die hohe Attraktivität der Kulturlandschaft mit dem Waldgebiet im<br />
Zentrum, ihrem landwirtschaftlich geprägten Umland, den landschaftsästhetischen<br />
Waldrandlagen und attraktiven historisch gewachsenen Städten und Dörfern.<br />
Diese Potentiale gilt es für eine wirtschaftlich tragfähige Zukunft unter Bewahrung der<br />
vorhandenen naturräumlichen und kulturhistorischen Potentiale zu entwickeln. Dies kann nur<br />
gelingen, wenn die beteiligten Akteure der Region, die Kommunen, Unternehmen, Vereine und<br />
Verbände sowie Bürger gemeinsame Entwicklungsziele formulieren und umsetzen.<br />
Im Zuge der Antragstellung zum Bundeswettbewerb idee.natur wurde bereits ein Leitbild für das<br />
Waldgebiet „Hohe Schrecke“ und die umliegenden Gemeinden formuliert:<br />
„Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft“<br />
„Gemeinsam wertschätzen – Gemeinsam wertschöpfen“<br />
Dieses Leitbild wird für das <strong>ILEK</strong> aufgegriffen und weiterentwickelt. Es stellt dabei den alten und<br />
schützenswürdigen Wald in das Zentrum der Strategie. Der alte Wald kann in vielfacher Hinsicht<br />
als Bindeglied zwischen unterschiedlichen Bereichen wirken: als Ausgangspunkt für den sanften<br />
Tourismus, als Namensgeber für eine regionale Produktmarke, Rohstofflieferant, als Ort der<br />
Umweltbildung und Identitätsstifter für die Bevölkerung der Region.<br />
Über dieses Bindeglied wird die Entwicklung der Region „Hohe Schrecke“ weiter vorangebracht,<br />
gemeinsam das vorhandene naturräumliche und kulturelle Potential genutzt und<br />
weiterentwickelt. Ziel ist es, über verschiedene Themen hinweg, den Wald als zentrales Element<br />
der Region in das regionale Bewusstsein zu setzen und eine gemeinsam erarbeitete In-Wert-<br />
Setzung dieser Potentiale zu erreichen.<br />
Dieses Leitbild dient dabei als Orientierung im regionalen Entwicklungsprozess. Aufgabe wird es<br />
dabei sein, sich bei allen auch in der Zukunft zu entwickelnden Projekten abzustimmen und so<br />
das Leitbild Realität werden zu lassen.<br />
64
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
5.2 Entwicklungsziele<br />
Abbildung 4: Das System der Entwicklungsziele in der Region „Hohe Schrecke“<br />
Die obenstehende Abbildung gibt einen Überblick zum Zielsystem der regionalen<br />
Entwicklungsstrategie. Das Zielsystem ist das Ergebnis der Diskussionen im Rahmen<br />
verschiedener Foren und Arbeitsgruppen und wurde auf dem Strategieworkshop am 25.6.2009<br />
bestätigt.<br />
5.2.1 Leitziel<br />
Nachfolgend werden die übergeordneten Entwicklungsziele der regionalen Entwicklungsstrategie<br />
vorgestellt. Die Entwicklungsziele für die einzelnen Handlungsfelder werden zum Zweck der<br />
besseren Lesbarkeit in den entsprechenden Kapiteln formuliert.<br />
Leitziel der regionalen Entwicklungsstrategie:<br />
Schaffung von Voraussetzungen für einen naturnahen Tourismus und die Entwicklung bzw.<br />
Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten in der Land- und Forstwirtschaft unter<br />
Beachtung des Erhalts und der Pflege der naturräumlichen Besonderheiten sowie des<br />
kulturellen Erbes.<br />
65
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Das Leitziel wird aus dem oben dargestellten Leitbild abgeleitet. Es fokussiert dabei stärker auf<br />
die sozio-ökonomischen Aspekte der Regionalentwicklung und flankiert auftragsgemäß den eher<br />
auf Naturschutzziele orientierten Antrag zum Bundeswettbewerb idee.natur. Dem integrativen<br />
Anspruch des <strong>ILEK</strong> folgend sollten die Entwicklungsziele auf der Ebene der einzelnen<br />
Handlungsfelder ihren jeweiligen Beitrag zur Erreichung des Oberziels leisten oder diesem<br />
zumindest nicht entgegenstehen. Beispielsweise könnte die Ausweisung großflächiger<br />
Windenergieparks eine alternative Einkommensquelle für die Landwirtschaft eröffnen. Auf die<br />
Attraktivität des Landschaftsbildes und damit auch auf die touristischen Perspektiven indes<br />
hätte solch ein Vorhaben jedoch eine negative Auswirkung.<br />
5.2.2 Handlungsfeldübergreifende strategische Leitlinien<br />
Um das formulierte Leitbild zu realisieren, bedarf es Leitlinien oder Regeln, die vor allem<br />
handlungsfeldübergreifend das Gemeinsame des Leitbildes stärken. Die nachfolgend<br />
formulierten strategischen Leitlinien - „Stärkung regionaler Kooperationsstrukturen“ und<br />
„Inwertsetzung regionaler Potentiale und Anbindung an überregionale Strukturen“ - sind<br />
unabhängig von einem bestimmten Entwicklungsthema und damit grundsätzlich als<br />
Basisstrategien für alle Handlungsfelder des <strong>ILEK</strong> gültig.<br />
Strategische Leitlinie 1<br />
Stärkung regionaler Kooperationsstrukturen<br />
Sowohl die ehemalige Zugehörigkeit der beiden Landkreise zu unterschiedlichen Bezirken der<br />
DDR, die ehemalige militärische Nutzung der Hohen Schrecke, als auch die aktuelle<br />
Landkreisgrenze wirken trennend auf die Wahrnehmungsstrukturen der Akteure nördlich und<br />
südlich der Hohen Schrecke. Ziel muss daher sein, sich diesem faszinierenden Natur- und<br />
Kulturraum bewusst zuzuwenden, die vorhandenen Entwicklungspotentiale zu erkennen und<br />
zielgerichtet in gemeinsamen Vorhaben zu entwickeln. Hierzu müssen sich grundsätzlich<br />
Wahrnehmungen verändern und der Informationsaustausch zwischen den Akteuren intensiviert<br />
werden. Daher ist eine der wesentlichen strategischen Leitlinien des integrierten ländlichen<br />
<strong>Entwicklungskonzept</strong>s die Stärkung bereits bestehender Kooperationsstrukturen, um den<br />
Austausch weiter zu intensivieren sowie die Förderung neuer Austauschmöglichkeiten. Dies<br />
wurde bereits durch die Arbeit im <strong>ILEK</strong>-Prozess angestoßen und vorangebracht, die so<br />
entstandenen neuen Verbindungen müssen nach Abschluss des <strong>ILEK</strong>s in der Umsetzung weiter<br />
intensiviert werden, um in Zukunft zu tragfähigen Strukturen ausgebaut zu werden.<br />
66
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Strategische Leitlinie 2<br />
Inwertsetzung regionaler Potentiale und Anbindung an überregionale Strukturen<br />
Das Planungsgebiet ist mit ca. 11.150 Einwohnern, einer geringen Gewerbedichte und bisher nur<br />
wenigen aktiven Vorreitern aus der Wirtschaft aus ökonomischer Sicht ein Marktakteur mit einer<br />
vergleichsweise geringen Wirtschaftskraft. Die Stärken-Schwächen-Analyse hat gezeigt, dass in<br />
allen Themenfeldern Potentiale für eine stärkere Abstimmung und Produktentwicklung<br />
vorhanden sind. Aber selbst wenn eine stärkere Vernetzung und ein gebündeltes Vorgehen bspw.<br />
von Anbietern regionaler Produkte und Dienstleistungen erreicht werden sollte, ist sehr kritisch<br />
zu prüfen, ob eine mögliche Produktmarke oder eine Destination „Hohe Schrecke“ die kritische<br />
Masse erreichen wird, um allein wirtschaftlich tragfähig zu sein. Daher muss die Stärkung<br />
endogener Potentiale durch eine Strategie der Anbindung an externe Märkte sowie an<br />
übergeordnete institutionelle Strukturen (z.B. Marketing des Freistaates Thüringen, Einbindung in<br />
Vermarktung benachbarter Destinationen) flankiert werden.<br />
5.3 Übersicht der Handlungsfelder und Leitthemen<br />
Die im Folgenden dargestellten Handlungsfelder, Leitthemen und Maßnahmen sind das Ergebnis<br />
umfangreicher Analysen, Diskussionen und Abstimmungen mit regionalen Akteuren:<br />
� Analyse bestehender Entwicklungsplanungen und Abstimmung von Maßnahmen mit den<br />
Anrainerkommunen,<br />
� Formulierung von Entwicklungsdefiziten und -potentialen im Rahmen der Stärken-<br />
Schwächen-Analyse,<br />
� Ausarbeitung von Leitthemen und Maßnahmen in thematischen Arbeitsgruppen,<br />
� Konkretisierung von Maßnahmenvorschlägen und Abstimmung zu Umsetzungs- und<br />
Fördermöglichkeiten durch zahlreiche Einzelgespräche mit Fachbehörden, Experten und<br />
Projektträgern.<br />
Die Handlungsfelder stehen jeweils für die vordringlichen Entwicklungsthemen der Region. Sie<br />
setzen inhaltliche Schwerpunkte und konzentrieren somit die Aktivitäten zur Umsetzung der<br />
Entwicklungsziele. Die Handlungsfelder sind allerdings nicht isoliert voneinander zu betrachten.<br />
Sowohl zwischen den Handlungsfeldern als auch zwischen Projekten bestehen häufig<br />
Wechselbeziehungen.<br />
67
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Tabelle 18: Übersicht über Handlungsfelder und Leitthemen<br />
Handlungsfeld „Tourismus, Erholung und Landschaft“<br />
� Leitthema Touristische Infrastruktur und Angebote<br />
� Leitthema Routen und Themenwege<br />
� Leitthema Informationsmanagement und Marketing<br />
� Leitthema Landschaftsentwicklung<br />
Handlungsfeld „Land- und Forstwirtschaft“<br />
� Leitthema Regionale Produktvermarktung<br />
� Leitthema Regionale Energienutzung<br />
� Leitthema Soziale und naturnahe Land- und Forstwirtschaft<br />
Handlungsfeld „Siedlungsbau und IT-Infrastruktur“<br />
� Leitthema Erhaltung (leerstehender) historischer Bausubstanz<br />
� Leitthema Ausbau der IT-Breitbandinfrastruktur<br />
� Leitthema Revitalisierung von Brachflächen<br />
Handlungsfeld „Bildung und Kultur“<br />
� Leitthema Angebote in der Umweltbildung<br />
� Leitthema Angebote in der Aus- und Weiterbildung<br />
5.4 Handlungsfeld „Tourismus, Erholung und Landschaft“<br />
5.4.1 Entwicklungsziel<br />
Um den in Abschnitt 4.1 festgestellten Schwächen entgegenzuwirken, wird für das Handlungsfeld<br />
Tourismus, Erholung und Landschaft folgendes Entwicklungsziel formuliert:<br />
Gemeinsame Vermarktung und Produktentwicklung „Hohe Schrecke“<br />
Um dieses Entwicklungsziel zu erreichen, werden in den Leitthemen<br />
� Touristische Infrastruktur und Angebote,<br />
� Routen und Themenwege,<br />
� Informationsmanagement und Marketing und<br />
� Landschaftsentwicklung<br />
verschiedene strategische Ansatzpunkte und Maßnahmen formuliert. So ist der strategische<br />
Ansatzpunkt für das Leitthema „touristische Infrastruktur und Angebote“ die Stärkung der<br />
touristischen Infrastrukturen und Angebote innerhalb der Planungsregion sowie die Einbindung<br />
in überregionale Angebote angrenzender Tourismusregionen. Für das Leitthema „Routen und<br />
Themenwege“ spielt die Abstimmung und Koordinierung bestehender und zukünftiger Routen<br />
68
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
und Themenwege in der Planungsregion eine wesentliche Rolle. Mit dem Leitthema<br />
„Informationsmanagement und Marketing“ sollen wesentliche Schwächen im touristischen<br />
Informationsmanagement verringert werden. Die Ausrichtung auf diese vier Leitthemen<br />
unterstützt die Erreichung des oben formulierten Ziels maßgeblich.<br />
5.4.2 Leitthema Touristische Infrastruktur und Angebote<br />
5.4.2.1 Ziel und Inhalt<br />
In der Stärken-Schwächen-Analyse wurde deutlich, dass sich die Erreichbarkeit und Anbindung<br />
der Projektregion durch den Neubau der europäisch bedeutsamen Verkehrsverbindung A 71 mit<br />
der Anschlussstelle Braunsroda erheblich verbessern wird. Es kann mit einer erhöhten Nachfrage<br />
aus den Verdichtungsräumen Erfurt, Halle-Leipzig sowie aus Richtung Göttingen-Kassel<br />
gerechnet werden. Dieses Potential gilt es durch eine Stärkung der touristischen Infrastrukturen<br />
und Angebote zu erschließen. Auch die Anbindung an das Schienennetz wird im nördlichen<br />
Gebiet mit dem Bahnhof Heldrungen gewährleistet. Es konnte festgestellt werden, dass die<br />
Versorgung in den anderen Teilregionen der Hohen Schrecke schlecht ausgeprägt ist.<br />
Auch das Rad- und Wanderwegenetz weist Defizite hinsichtlich der Wegequalität und der<br />
Beschilderung auf und kann deutlich verbessert werden. Dies beinhaltet eine Überprüfung der<br />
Wegequalität, die Erstellung von Wegekonzepten, den Ausbau vorhandener Wege sowie ihre<br />
organisierte Pflege.<br />
Im Bereich Unterbringung und Gastronomie gibt es nur wenig Angebote, die qualitativ den<br />
Ansprüchen der Gäste genügen. Besonders für den Wandertourismus müssen in erreichbaren<br />
Abständen gastronomische Einrichtungen wie auch Unterkunftsmöglichkeiten vorhanden sein.<br />
Auch das Know-how im Bereich Dienstleistungen ist bisher ungenügend und es besteht nur bei<br />
wenigen Anbietern ein Kooperationsbewusstsein. Das regionale Identitätsgefühl sowie das<br />
Bewusstsein der Bevölkerung, also das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger als touristische<br />
Dienstleister zu agieren, sind zu stärken. Die in der Region vorhandenen touristischen Angebote<br />
müssen als Stärke begriffen und zu einer Stabilisierung im Hotel- und Gastgewerbe genutzt<br />
werden. Dazu ist die Qualität der Angebote, wie auch einzelner Abschnitte von Rad- und<br />
Wanderwegen für eine überregionale gemeinsame Vermarktung zu verbessern. Zukünftig muss<br />
die vorhandene touristische Infrastruktur mit zielgruppenspezifischen Angeboten und<br />
Serviceleistungen verknüpft werden.<br />
Die Region weist aufgrund der kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten (Klöster, Burgen,<br />
Schlösser) sowie der vielfältigen Naturlandschaft gute Voraussetzungen für landschaftsbezogene<br />
und umweltverträgliche Formen von Tourismus und Naherholung auf. Die im Zuge des <strong>ILEK</strong>-<br />
Prozesses angestoßene Entwicklung soll zu einer noch engeren Verzahnung von Kulturlandschaft und<br />
Tourismus führen. Für die Stärkung der inneren Strukturen wird es deshalb von Bedeutung sein,<br />
die Angebote in den Bereichen Kultur & Geschichte, Aktivtourismus sowie Umweltbildung<br />
auszuweiten und gleichzeitig eine Einbindung der Angebote in angrenzende touristische<br />
Strukturen zu erreichen (vlg. Abb. 1).<br />
69
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Umweltbildung<br />
Abbildung 5: Touristische Schwerpunkte der Projektregion Hohe Schrecke. (e. D., 2009 )<br />
5.4.2.2 Projekte und Maßnahmen<br />
Umsetzungsfähige Projekte<br />
Ausbau des Angebots „Ferien auf dem Bauernhof“: Gutshof von Bismarck: Ausbau altes<br />
Feuerwehrhaus zum Tourismusstützpunkt (Maßnahmenblatt M 2)<br />
Das Areal des ehemaligen Feuerwehrhauses soll genutzt werden, um Schritt für Schritt einen<br />
Tourismusstützpunkt in der Region einzurichten.<br />
Die Umsetzung der Maßnahme beinhaltet:<br />
� Die bauliche Instandsetzung des Gebäudes<br />
Aktivtourismus<br />
Kultur & Geschichte<br />
� Die Schaffung touristischer Angebote (Informationsstelle, Verkaufsstelle für regionale<br />
Produkte, Radverleih, Wohnmobilstellplätze)<br />
Für die Entwicklung von Angeboten soll zunächst ein Marketingkonzept entwickelt werden.<br />
Sowohl bauliche Maßnahmen als auch das Marketingkonzept sollen über die Agrartourismus-RL<br />
gefördert werden.<br />
70
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Der Stützpunkt trägt zur Stärkung der touristischen Angebote und zur Stärkung des<br />
Informationsmanagements bei. Er kann u. a. als Ausgangspunkt für den Aktiv- und<br />
Bildungstouristen dienen und auf die Tourismusregion Hohe Schrecke aufmerksam machen.<br />
Projektträger ist die <strong>Stadt</strong> Heldrungen. Als Betreiber steht der Gutshof v. Bismarck zur Verfügung.<br />
Das Vorhaben ist ein Leitprojekt der RAG Kyffhäuser. Planungen und das Votum der RAG<br />
Kyffhäuser liegen für das Projekt vor.<br />
Mühlencafé und Mühlenmuseum Gehofen (Maßnahmenblatt M 4)<br />
Ziel ist die Sanierung der historischen Wassermühle in Gehofen (1528 erstmalig erwähnt, seit<br />
1865 im Besitz der Fam. Gebhardt) und der Ausbau zu einem Mühlenmuseum (Schaumühle) mit<br />
Café. Die Wassermühle ist seit mehreren Jahrzehnten stillgelegt aber technisch vollständig<br />
erhalten. Ob die Mühle als technisches Denkmal geeignet ist, soll geprüft werden. Die Mühle<br />
liegt strategisch günstig am Radweg nach Ritteburg und würde als interessanter touristischer<br />
Punkt die Region an den Unstrutradweg anbinden. Das Gelände bietet darüber hinaus genügend<br />
Platz für Parkmöglichkeiten.<br />
Für die Sanierung ist geplant, regionale Rohstoffe wie Holz aus der Hohen Schrecke zu<br />
verwenden und eine Holzpelletheizung zu installieren. Inhaltlich ist das Projekt damit<br />
anschlussfähig an das Naturschutzgroßprojekt und weitere Initiativen der Region (z.B. regionaler<br />
Holzmarkt). Das Projekt würde insgesamt einen Beitrag zur Verbesserung der touristischen<br />
Angebotsstruktur leisten. Als Mühlenmuseum werden inhaltliche Verbindungen zur<br />
Umweltbildung und zum Agrartourismus deutlich (s.a. Maßnahmeblatt im Anhang).<br />
Wanderherberge Gehofen (Maßnahmenblatt M 3)<br />
Das Kirchspiel <strong>Wiehe</strong> und der Kirchbauverein Gehofen planen vor dem Hintergrund des<br />
Naturschutzgroßprojekts die Errichtung einer Wanderherberge auf dem Pfarrgrundstück in<br />
Gehofen. Ziel ist die Sanierung des alten Pfarrhauses mit erhaltenswerter Bausubstanz, ergänzt<br />
durch einen modernen Anbau. Der Ursprung des Gebäudes liegt vermutlich am Ende des 13.<br />
Jahrhunderts (1298), damals genutzt als Templer-Komturei. Das Erdgeschoss des alten<br />
Pfarrhauses ist bereits teilweise saniert.<br />
Die Wanderherberge soll 24 Schlafräume mit 63 Übernachtungsplätzen bereitstellen. Ideen zu<br />
einem Betreiberkonzept sehen eine gemischte Nutzung als Herberge, Tagungs- und<br />
Veranstaltungszentrum und Ort für die Gemeindearbeit vor. Die Kooperation mit touristischen<br />
Anbietern, z.B. die Vermittlung von Übernachtungsgästen im Fall großer Nachfrage am nahe<br />
gelegenen Unstrutradweg (Ritteburg, Bottendorf) wird angestrebt (s.a. Maßnahmenblatt im<br />
Anhang).<br />
Bildungseinrichtung für Seminare zu Kräutern und gesunder Ernährung inkl. Ferienwohnung<br />
(Langenroda) (Maßnahmenblatt M 21)<br />
Der ehemalige Dorfkonsum in Langenroda soll zu einer Ferienwohung ausgebaut werden, um das<br />
Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten in Langenroda zu erweitern. Zudem werden über den<br />
71
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Ausbau des Dorfkonsums Räumlichkeiten für die Durchführung von Seminaren zu Kräutern und<br />
gesunder Ernährung geschaffen.<br />
Ansprechpartner sind Herr und Frau Bachmann aus Langenroda.<br />
Haus auf dem Berge (Hauteroda)(Maßnahmenblatt M 5)<br />
Das „Haus auf dem Berge“ (Gemarkung Hauteroda) liegt zwischen Oberheldrungen und<br />
Hauteroda am Waldrand an einem Wanderweg zur Hohen Schrecke. Das Schulungs- und<br />
Freizeitheim der Christengemeinschaft bietet 41 Übernachtungsplätze auf dem Niveau einer<br />
Jugendherberge und ist Tätig im Bereich der Umweltbildung und religiösen Bildung für<br />
Jugendliche und Erwachsene (u.a. Feldpraktika, Malkurse, Exkursionen, Klassenfahrten, Mutter-<br />
Kind-Freizeiten). Ab Oktober 2009 wird eine neue Betreibergesellschaft den Betrieb übernehmen.<br />
Enge Kontakte bestehen zu einem Landwirtschaftsbetrieb in Hauteroda für die Versorgung mit<br />
ökologisch angebauten Produkten. Das Haus auf dem Berge verfügt lagebedingt über einen 120<br />
m tiefen Brunnen zur Trinkwasserversorgung. Der Brunnen ist inkl. Pumpe dringend<br />
sanierungsbedürftig, um die Versorgung mit Trinkwasser sicherzustellen.<br />
Weiterhin sind die veralteten Gemeinschaftswaschräume im Kellergeschoss zu sanieren, um<br />
modernen Ansprüchen an sanitäre Anlagen auf dem Niveau einer Jugendherberge zu genügen.<br />
Die thematische Ausrichtung und die Lage am Waldgebiet bieten in Zukunft weitere<br />
Anknüpfungspunkte zum Naturschutzgroßprojekt. Das Projekt leistet sowohl einen Beitrag zur<br />
Stärkung der touristischen Angebote für eine religiöse und naturorientierte Klientel und trägt zur<br />
Stärkung des Angebots für das Leitthema Umweltbildung in der Hohen Schrecke bei. (s.a.<br />
Maßnahmenblatt im Anhang)<br />
Wegeprojekte<br />
Ziel ist, in der Hohen Schrecke und rund um das Waldgebiet ein qualitativ ausreichendes Netz<br />
von multifunktional genutzten landwirtschaftlichen Wegen für Landwirte, die lokale Bevölkerung<br />
und Erholungssuchende zu schaffen. Dieses Wegenetz soll an überregionale Wanderwege<br />
angebunden sein, sowohl die Umfahrung entlang der „Schrecke-Gemeinden“ als auch die<br />
Durchquerung der Hohen Schrecke ermöglichen und die Erreichbarkeit touristisch interessanter<br />
Punkte gewährleisten. Hierzu wurden folgende Projekte im Rahmen des <strong>ILEK</strong> definiert:<br />
- Ländlicher Wegebau / Radweg „Nordrand Hohe Schrecke“ zwischen Reinsdorf und <strong>Wiehe</strong><br />
(Reinsdorf – Gehofen – Nausitz – Donndorf –<strong>Wiehe</strong>) (Maßnahmenblatt M 8)<br />
- Ländlicher Wegebau / Radweg „Südrand Hohe Schrecke“ – Ausbau „Finnebahndamm“<br />
(Großmonra – Bachra – Rastenberg –(Lossa, in Sachsen-Anhalt) mit Anbindung sowohl an<br />
den Ilm Radwanderweg als auch an den Radweg vom Fürstengrab in Leubingen zur Fundstätte<br />
der Himmelsscheibe Nebra (Maßnahmenblatt M 9)<br />
- Ländlicher und forstlicher Wegebau / Radweg von Burgwenden nach Langenroda als Nord-<br />
Süd-Verbindung durch das Waldgebiet der Hohen Schrecke (Maßnahmenblatt M 10)<br />
72
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Über die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung, Förderbereich ländliche Infrastruktur,<br />
ist der Ausbau von Feld- und Verbindungswegen „zur Erschließung der landwirtschaftlichen und<br />
touristischen Entwicklungspotentiale“ (Thür. Staatsanzeiger 28/2008, S. 1134) möglich.<br />
Ländlicher Wegebau / Weg „Nordrand Hohe Schrecke“ zwischen Reinsdorf und <strong>Wiehe</strong><br />
(Maßnahmenblatt M8)<br />
Um die Verbindung von Reinsdorf nach <strong>Wiehe</strong> sowohl entsprechend der Ansprüche der<br />
Landwirtschaft als auch für eine Nutzung mit dem Fahrrad attraktiv zu machen, soll ein<br />
durchgehender Weg zwischen Reinsdorf und <strong>Wiehe</strong> geschaffen werden. Bestehende Feld- und<br />
Verbindungswege werden ausgebaut, so dass eine Nutzung durch die Landwirtschaft und durch<br />
Radfahrer möglich wird. In eine gesondert zu beschildernde Route können touristisch attraktive<br />
Punkte eingebunden werden, um die Attraktivität der Region für Touristen weiter zu erhöhen.<br />
Abbildung 6: Feldweg von Gehofen. Im Hintergrund die Alte Ziegelei, ein<br />
möglicher touristisch interessanter Punkt<br />
Sowohl Reinsdorf als auch <strong>Wiehe</strong> sind bereits an den Unstrut-Radweg angebunden. Der neu<br />
geschaffene Weg würde damit für Radtouristen eine weitere interessante Variante zum Unstrut-<br />
Radweg bieten. In das entstehende Beschilderungskonzept für den Unstrut-Radweg sollten daher<br />
auch bereits Beschilderungen für die Hohe Schrecke vorgesehen und eingebunden werden.<br />
Zudem können über Feldwege, die in das Waldgebiet der Hohen Schrecke führen, Anschlüsse an<br />
den Kammweg, die südlichen Gemeinden der Region sowie zu den überregionalen, südl. der<br />
Hohen Schrecke verlaufenden Radwanderwege geschaffen werden.<br />
Dem Maßnahmenblatt im Anhang sind Karten beigefügt, die mögliche, gesondert auszuweisende<br />
Routen aufzeigen. Dabei wird unterschieden in<br />
73
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
� Radweg geplant: Feldwege, die aktuell noch nicht in Radwanderkarten und Wanderkarten 49<br />
als Radwege ausgewiesen sind<br />
� Radweg nicht ausgebaut: Feldwege, die als Radwege in Karten ausgewiesen sind, aber noch<br />
nicht ausgebaut wurden<br />
� Radweg ausgebaut: bereits über die Förderung des ländlichen Wegebaus ausgebaute<br />
Feldwege, die auch als Radwege genutzt werden<br />
� Radweg auf Straße: Teilstücke von ausgewiesenen Radwegen, die auf meist wenig<br />
befahrenen Straßen verlaufen.<br />
Zudem sind in den Karten einzelne touristisch interessante Punkte aufgeführt sowie mögliche<br />
Anschlüsse in die Hohe Schrecke benannt. Diese Vorschläge sind nicht abschließend und geben<br />
zunächst den Stand der durch die Gemeinden angestoßene Diskussion wider.<br />
Für die Qualifizierung dieser ersten Überlegungen sind zukünftig weitere Beteiligte und<br />
Betroffene einzubinden. Der Verein „Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft“ wird als<br />
Projektträger gemeinsam mit den Gemeinden das Projekt weiter verfolgen und vorantreiben<br />
(weitere Informationen, siehe Maßnahmenblatt im Anhang).<br />
Das Projekt kann in Verbindung mit dem geplanten Start des Unstrut-Radel-Express (siehe weiter<br />
unten), der parallel zum Radwanderweg einen Transport von Radwanderern von Artern nach<br />
Nebra ermöglichen würde, eine hohe regionale Bedeutung erlangen.<br />
Ländlicher Wegebau / Weg „Südrand Hohe Schrecke“ – Ausbau des Finnebahndamms im<br />
Rahmen der Entwicklung eines Erlebnisradwegs ("Wege in die Bronzezeit" vom Fürstengrab<br />
Leubingen zur Fundstätte Himmelsscheibe Nebra) (Maßnahmenblatt M9)<br />
In der Regionalen Entwicklungsstrategie Sömmerda/Erfurt wird die Entwicklung eines<br />
Erlebnisradwegs „Wege in die Bronzezeit“ vom Fürstengrab Leubingen zur Fundstätte<br />
Himmelsscheibe Nebra als ein touristisches Leitprojekt benannt. Der Verlauf soll über den<br />
Radweg Leubingen – Rastenberg – Tauhardt – Memleben – Wangen erfolgen. Ziel des Ausbaus<br />
eines Radweges entlang der Finnebahn ist die Verbesserung der touristischen Infrastruktur in der<br />
Region. Der Finnebahnradweg ist derzeit nicht asphaltiert, teilweise zugewachsen und nicht<br />
gepflegt.<br />
Die Umsetzung der Maßnahme beinhaltet die Instandsetzung des Radweges entlang der<br />
Gemeinden Großmonra, Bachra und Rastenberg. Maßnahmenträger ist das Landratsamt<br />
Sömmerda. Ein Antrag im Rahmen des Konjunkturpakets II wurde gestellt.<br />
Dieses Teilprojekt ergänzt dabei die Vorhaben zum geplanten Erlebnisradweg und eine<br />
thematische Anknüpfung der Region Hohe Schrecke ist möglich. Das Projekt kann als ein<br />
49 Zur Analyse herangezogen wurden die Radwanderkarte 344 „Unstrutradweg mit Ausflugszielen, Einkehr<br />
und Freizeittipps“ sowie die Topographische Karte 1:25.000 „Hohe Schrecke. Schmücke, Finne“<br />
74
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Baustein zur stärkeren räumlichen und thematischen Anbindung an angrenzende touristische<br />
Regionen eingestuft werden.<br />
Ländlicher und forstlicher Wegebau / Weg von Burgwenden nach Langenroda als Nord-Süd-<br />
Verbindung durch das Waldgebiet der Hohen Schrecke (Maßnahmenblatt M 10)<br />
Die Maßnahme ländlicher und forstlicher Wegebau „Waldweg von Burgwenden nach<br />
Langenroda“ beinhaltet die Verbesserung der Befahrbarkeit des vorhandenen Weges zwischen<br />
Burgwenden und Langenroda, in der Gemarkung Großmonra, OT Burgwenden.<br />
Der Weg führt überwiegend durch forstlich genutztes Gelände, einige Abschnitte auch über<br />
landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Maßnahme unterstützt damit die Erschließung der<br />
Infrastruktur an der „Hohen Schrecke“ für die kombinierte Nutzung für Landwirtschaft oder<br />
Forstwirtschaft sowie für Radfahrer/Wanderer.<br />
Mit der geplanten Verbesserung bzw. durch Ausbau des vorhandenen Waldweges werden die<br />
Voraussetzungen geschaffen, um mit dem Rad oder zu Fuß, von Burgwenden über die<br />
Gemarkung Burgwenden, nach Langenroda, zu den Ausläufern der Hohen Schrecke zu gelangen<br />
und somit die Nord- mit der Südregion miteinander zu verbinden.<br />
Für die Förderung ist hier zu unterscheiden in die Richtlinie zur „Förderung der integrierten<br />
ländlichen Entwicklung“, Förderbereich Ländliche Infrastruktur für die Förderung<br />
landwirtschaftlicher Wege und in die Richtlinie zur „Förderung forstwirtschaftlicher<br />
Maßnahmen“ 50 für die Förderung forstlicher Wege.<br />
Weg „Weg an der Schafau“ (Maßnahmenblatt M 11)<br />
Als weiteres Projekt wurde der Ausbau eines Feldweges zwischen Ostramondra nach Battgendorf<br />
mittels ländlichen Wegebaus benannt. Dieser Weg ist Bestandteil des Mühlenwanderwegs.<br />
Dieses Projekt ist jedoch mit dem Ausbau des Finnebahndamms abzustimmen. (s.a.<br />
Maßnahmenblatt im Anhang). Die Maßnahmen zum Ausbau von Radwegen sind mit dem<br />
Wegekonzept aus dem zu erstellenden Pflege- und Entwicklungsplan des<br />
Naturschutzgroßprojekts abzustimmen.<br />
„Unstrut-Radel-Express“ (Maßnahmenblatt M 6)<br />
Mit der Inbetriebnahme des Unstrut-Radel-Express zwischen Artern und Nebra soll dieser bisher<br />
wenig besuchte Teil des Unstruttals für Touristen attraktiver werden und der Unstrut-Radweg<br />
ergänzt werden. Das Projekt kann in Verbindung mit dem parallel zum Gleisbett verlaufenden<br />
geplanten Radweg Reinsdorf – <strong>Wiehe</strong> eine hohe regionale Bedeutung erlangen.<br />
Die Maßnahme beinhaltet die Förderung<br />
50 v. 04.04.2008, ThürSTAnz. Nr. 16/2008<br />
75
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
� der Betriebskosten für die Inbetriebnahme der Unstrutbahn zwischen Artern und Nebra für<br />
die touristische Nutzung,<br />
� der Werbekosten für Vermarktung des Unstrut-Radel-Express: neben der eigenständigen<br />
Werbung der IG Unstrutbahn e. V. über Prospekte und Internet auch Aufnahme in die<br />
Werbemaßnahmen der Fremdenverkehrsförderung auf Landes- und Kreisebene.<br />
Ziel ist es, die Eisenbahn-Infrastruktur der Unstrutbahn zwischen Artern und Nebra zu erhalten.<br />
Der Betrieb der Eisenbahn trägt zu einem umweltgerechten Tourismus in der Region Hohe<br />
Schrecke bei und bildet ein zusätzliches Highlight. Für die weitere Entwicklung des Radtourismus<br />
kann die Unstrutbahn ein wichtiges Zugpferd darstellen und weitere Radler in die Region holen.<br />
Es wird eine direkte Verbindung zu den Besuchermagneten in angrenzenden Regionen<br />
geschaffen und damit eine stärkere Anknüpfung unterstützt.<br />
Maßnahmenträger ist der Verein der Interessensgemeinschaft Unstrutbahn.<br />
76
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Projekte mit Grobkonzeption<br />
Kinder- und Jugenddorf „Am Windberg“ – Urlaubsangebote im ländlichen Raum<br />
Die Jugendherberge in Beichlingen kann aufgrund hoher Übernachtungszahlen (14.000<br />
Übernachtungen für 2009 bereits gebucht, Auskunft des Leiters der Jugendherberge) als<br />
Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten dienen. Ziel ist es, neue Ferienwohnungen zu errichten<br />
um so eine Aufwertung der Bausubstanz zu erreichen. Die Jugendherberge kann als „Radmotel“<br />
Unterkünfte für Radtouristen bieten. Die Jugendherberge würde einen Bungalow als Infostelle<br />
bereitstellen. Die Gemeinde hat bereits erste Absprachen mit der Jugendherberge getroffen.<br />
Weitere Inhalte: Eine Ausstellung über die Geologie der Hohen Schrecke (Verbindung zum<br />
Geopfad) und eine Ausstellung zur Tierwelt im Waldgebiet. Hierzu gibt es Absprachen mit der<br />
Kreisjägerschaft.<br />
Hier sollen touristische Informationen für Wander-, Reit- und Radtouristen bereitgestellt werden.<br />
Vorstellbar ist auch, in diese Arbeit Auszubildende der Jugendherberge einzubeziehen. Das<br />
Kinder- und Jugenddorf kann eine wichtige Funktion für den Ausbau der Angebote im Bereich<br />
Aktiv- und Bildungstourismus einnehmen.<br />
Aussichtsplattform in Gestalt eines Hochstands an zentraler Wegekreuzung in der Hohen<br />
Schrecke<br />
Mit dieser Maßnahme soll ein zentrales Ziel im Waldgebiet der Hohen Schrecke geschaffen<br />
werden, das sich in die Natur einfügt. Es bestehen bereits erste Ideen, die sich auf die Gestalt<br />
und den Ort der Aussichtsplattform beziehen. Der ca. 20 bis 25 m hohe Hochsitz sollte in der<br />
Nähe der Wüstung Wetzelshain errichtet werden, um einen Blick ins Helderbachtal, zum<br />
Kyffhäusergebirge, zum Mittelberg und zum Thüringer Becken zu ermöglichen. Außerdem ist<br />
dieser Ort für Radtouristen<br />
erreichbar und es sind Rundwege<br />
möglich. Auf dem Weg zu dieser<br />
Aussichtsplattform gibt es ebenfalls<br />
eine Reihe von Raststellen für<br />
Radfahrer und Wanderer.<br />
Abbildung 7: Der Eggeturm im Teutoburger Wald<br />
Die Aussichtsplattform trägt zur<br />
Stärkung der touristischen<br />
Angebote bei und schafft eine<br />
Verknüpfung zu den bedeutsamen<br />
touristischen Anlaufpunkten in der<br />
Umgebung.<br />
Beispielhaft wird hier der Eggeturm auf der Velmerstot (468 m) bei Feldrom angeführt. Der<br />
Eggeturm ist ein bekanntes Ausflugsziel im Teutoburger Wald/Eggegebirge bei Feldrom, der im<br />
77
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Jahr 2003 vom ehemaligen Forstamt Paderborn (heute integriert in Regionalforstamt Hochstift)<br />
auf dem höchsten Punkt des Eggegebirges aufgestellt wurde.<br />
Für die Weiterentwicklung dieser Idee muss geklärt werden, wer als Maßnahmenträger in Frage<br />
kommt. Auch die Förderfähigkeit dieses Projektes ist bisher nicht geklärt.<br />
Agrartourismus - Fortbildung und Wissensvermittlung durch landwirtschaftliche Fachexkursionen<br />
Über die Entwicklung von Angeboten zum „Urlaub auf dem Lande“ hinaus, können<br />
Fachexkursionen und Fortbildungsreisen für fachlich interessierte Reisegruppen zum Thema<br />
Landwirtschaft und <strong>ländliches</strong> Leben gerichtet an Akteure aus dem landwirtschaftlichen<br />
Berufsfeld die touristischen Angebote in der Region sinnvoll ergänzen. 51 Ziel ist es, Einblicke in<br />
die ländliche Lebensweise und vor allem in die unterschiedlichen Formen der<br />
Landbewirtschaftung zu geben sowie fachliches Wissen zu vermitteln. Hierbei können<br />
landwirtschaftliche Betriebe besucht, Produktionsabläufe, Techniken und Managementkonzepte<br />
vorgestellt werden.<br />
Angesetzt werden kann hier an den vielfältigen Strukturen der Region, die von historischen<br />
Beispielen der Landbewirtschaftung über ökologische Landwirtschaft, den Anbau von<br />
Spezialkulturen bis zu landwirtschaftlichen Großbetrieben und Genossenschaften reichen:<br />
� konventionell wirtschaftende Agrarbetriebe als Anschauungsobjekte für wettbewerbsfähige<br />
landwirtschaftliche Großbetriebe,<br />
� ökologisch und sozial orientierte wirtschaftende Betriebe (Markus-Gemeinschaft Hauteroda,<br />
Gutshof von Bismarck),<br />
� Anbau von Spezialkulturen (Kräuter, Zwiebeln)<br />
� Führungen zum Thema „Ländliches Leben und Wirtschaften vor 1900“ – z.B. geplantes<br />
Heimatmuseum in Ostramondra mit historischen Druck- und Landmaschinen und einer<br />
traditionell eingerichteten Bauernwohnung.<br />
Teilnehmende Betriebe und Höfe wären als „Schaubetriebe“ eine tragende Komponente dieses<br />
touristischen Zweigs, die durch Führungen und den Verkauf eigener Produkte weitere<br />
Einkommensquellen erschließen können. Durch dieses Vorhaben könnten weitere Effekte erzielt<br />
werden: Steigerung des Bekanntheitsgrads der Region, Vernetzung von landwirtschaftlichen<br />
Akteuren als touristische Leistungsträger, Ergänzung des touristischen Profils der Region.<br />
Ziel sollte sein, mehrtägige Veranstaltungen und Pauschalangebote zu etablieren. Hierzu ist zum<br />
einen aus fachlicher Sicht ein ausreichendes Angebot zu schaffen, Übernachtungsmöglichkeiten<br />
51 Erfahrungen aus anderen Regionen zeigen, dass insbesondere Mitglieder von Bauernverbänden,<br />
Landfrauen oder Vereine solche Angebote nachfragen (s.a. http://www.regionalewertschöpfung.de/index.php?tpl=project&id=63&lng=de&red=projectlist<br />
Hohenlohe<br />
78
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
bereitzustellen, einen Pool von Partnern zu gewinnen und ein ergänzendes kulturellkulinarisches<br />
Begleitprogramm zu erstellen.<br />
Träger des Projektes: Heimvolkshochschule Donndorf, Vorgespräche mit dem<br />
Landesbauernverband seien bereits erfolgt. Das Projekt ist weiterhin mit dem zuständigen<br />
Landwirtschaftsamt Bad Frankenhausen abzustimmen. 52<br />
Weitere Projektideen<br />
� Organisation weiterer Events für die Hohe Schrecke (wie z.B. regionaler Holzmarkt <strong>Wiehe</strong>,<br />
regionaler Bauernmarkt Gutshof Braunsroda, Sommerfest des Vereins „Hohe Schrecke – Alter<br />
Wald mit Zukunft“)<br />
� Geschichte des Weinbaus an der Unstrut – Ursprung in <strong>Wiehe</strong><br />
� Vermarktung der <strong>Stadt</strong> Heldrungen als „Zwiebelstadt“<br />
� Entwicklung Gesamtkonzept zum Thema „Bildungstourismus“<br />
� Nausitz: Einrichtung eines „Wiegental – Urwald – Erlebnispfads“ (Urwald-Kletterpfad)<br />
� Instandsetzung des Naturlehrpfads in Beichlingen (siehe auch Leitthema Umweltbildung)<br />
� Beichlingen: bessere touristische Einbeziehung der Monraburg, gelegen am Wanderweg von<br />
Beichlingen in die Hohe Schrecke<br />
� Beichlingen: Infopunkt am zu verlängernden Geopfad zum Thema Geologischer Aufschluss<br />
� Ostramondra: Sanierung und Nachnutzung der alten Konsumhalle zu einer Sport- und<br />
Begegnungsstätte (z.B. Kegelbahn, Wanderertreff)<br />
� Ausbau touristischer Parkplätze zu Rastplätzen (südlich von <strong>Wiehe</strong> auf Plateau,<br />
Aussichtsplattform am Hochwasserbehälter an der L 217 Richtung Lossa))<br />
� Ausbau des Radwegs Roßleben-<strong>Wiehe</strong> (L 1217), Maßnahmeträger: Freistaat Thüringen,<br />
Dringlichkeitsklasse nach Radverkehrskarte Kyffhäuserkreis, Stand Mai 2008<br />
� Transfersystem (Kleinbus) zur touristischen Anbindung von <strong>Wiehe</strong> an die „Unstrut-Bahn“<br />
� Einrichtung von Wanderparkplätzen mit Infotafeln, Eingang Hohe Schrecke in <strong>Wiehe</strong>, OT<br />
Langenroda und Garnbach<br />
� Schloss mit Schlosspark <strong>Wiehe</strong>: Einrichtung eines Umweltinformationszentrums (siehe auch<br />
Leitthema: Erhaltung historischer Bausubstanz)<br />
� <strong>Stadt</strong>park <strong>Wiehe</strong> (ehemaliges Schützenhaus): Weiterentwicklung des Kultur- und<br />
Tourismuszentrums<br />
52 s.a. Broschüre „Grüne Berufe sind voller Leben“ des Freistaats Thüringen unter:<br />
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/lwa-bfh/aus-undweiterbildung/pubdownload158.pdf<br />
79
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
� Modellbahn <strong>Wiehe</strong>: Anpassung und Erweiterung der Ausstellung, u. a. Gestaltung des<br />
Freigeländes für technikgeschichtliche Freilandausstellung<br />
� Ausbau von Übernachtungskapazitäten in der <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>: z.B. Ausbau von Urlaub auf dem<br />
Bauernhof in <strong>Wiehe</strong> OT Garnbach, Hechendorf und Langenroda, Herausforderung:<br />
Mobilisierung von Investoren; weitere Übernachtungskapazitäten geplant im Schloss <strong>Wiehe</strong><br />
� Touristische Inwertsetzung von Handwerksbetrieben, z.B. Gläserne Böttcherei in <strong>Wiehe</strong><br />
� Thematische Infopavillons an den Eingangswegen der Hohen Schrecke werden im Antrag zum<br />
Wettbewerb idee.natur benannt, sollten in ein Gesamtkonzept zur Entwicklung des<br />
Tourismus eingebunden werden<br />
� Turm der Zeitreisenden: Projektidee aus dem Antrag zum Wettbewerb idee.natur. Ziel:<br />
Schaffung eines Besuchermagneten im Waldgebiet der Hohen Schrecke. Aussichts- und<br />
Informationsturm mit Sichtbeziehungen zu geschichtsträchtigen Highlights der Region (Arche<br />
Nebra, Kyffhäuser, usw.) In einer Ausstellung könnte über multimedial abrufbare<br />
Darstellungen die historischen, prähistorischen und naturkundlichen Besonderheiten der<br />
Region und des „Alten Waldes“ vorgestellt werden. Eine unabhängige Energieversorgung<br />
über Solarmodule sowie der Einsatz heimischer Rohstoffe würden den Naturschutzgedanken<br />
der Hohen Schrecke unterstreichen. Projektträger und Finanzierung des Turms sind nicht<br />
geklärt, der Einbezug eines Sponsors aus der Industrie (innovative Energieversorgung) ist zu<br />
prüfen.<br />
5.4.3 Leitthema Touristische Routen und Themenwege<br />
5.4.3.1 Ziel und Inhalt<br />
Die Region Hohe Schrecke weist ein hohes Potential für den naturnahen Aktiv- und<br />
Bildungstourismus auf. In der Stärken-Schwächen-Analyse wurde deutlich, dass die<br />
Projektregion bereits in eine Reihe von Rad-, Wander- und Themenwegen eingebunden ist. In den<br />
Bereichen Wandern und Radwandern bestehen bereits Kooperationen mit der Saale-Unstrut-<br />
Region und dem Geopark Kyffhäuser. Zukünftig ist eine stärkere thematische Einbindung in<br />
überregionale Rad- und Wanderwege von großer Bedeutung, um eine Anbindung an angrenzende<br />
Tourismusregionen zu erreichen. Besonders im Hinblick auf die kulturhistorischen und<br />
naturräumlichen Besonderheiten der Region Hohe Schrecke bietet sich eine stärkere Einbindung<br />
an. Dabei steht besonders die Qualität der Wege im Mittelpunkt. Eine organisierte Pflege und<br />
Qualitätskontrolle ist zwingend erforderlich. Derzeit wird in der Projektregion die Konzeption der<br />
in den 90 Jahren ausgewiesenen Radwege überprüft. Auch der Rückbau von Wegen, die eine<br />
nicht ausreichende Qualität aufweisen, wird angestrebt (Ergebnisse der Gespräche und<br />
Workshops).<br />
Einen wichtigen Beitrag zu einer stärkeren Verknüpfung der Tourismusregionen soll das Projekt<br />
Radweg "Auf den Spuren der Ur-Ilm" schaffen. In der Regionalen Entwicklungsstrategie<br />
Sömmerda/Erfurt wird hier eine Verbindung zwischen Ilm-Radwanderweg/Städteketteradweg<br />
und Unstrut-Radweg/GeoPark Kyffhäuser angestrebt. Als „Spange“ zwischen Hoher<br />
Schrecke/Geopark und der Region Weimar, Erfurt sowie dem Naturpark Saale-Unstrut-Triasland<br />
80
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
kann hier eine Einbindung erfolgen, die die touristischen Angebote und die Infrastruktur der<br />
Projektregion stärkt.<br />
Auch weitere Ausweisungen von Themenwegen tragen zu einem individuellen Angebot und einer<br />
Stärkung der Infrastruktur bei. Besonders Themenwege können den Besuchern<br />
standortspezifische Besonderheiten auf ansprechende Art näher bringen. Authentische Themen<br />
aus der Region in der Angebotsgestaltung nehmen an Bedeutung zu. Dabei tragen sie gleichzeitig<br />
zu einer stärkeren Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Region bei. Auch die Bevölkerung und<br />
besonders Kinder lernen so ihre Heimat und die kulturhistorischen sowie naturräumlichen<br />
Besonderheiten kennen. Durch dieses Wissen wird eine stärkere Wahrnehmung der Projektregion<br />
geschaffen und es kann ein positives Bild nach außen transportiert werden.<br />
Nach dem erfolgreichen Start des Naturschutzgroßprojekts wird in einer ca. 2-jährigen<br />
Planungsphase ein Wegekonzept erstellt. Mögliche Strategien und Maßnahmen sollten daher mit<br />
dem Naturschutzgroßprojekt abgestimmt werden.<br />
5.4.3.2 Projekte und Maßnahmen<br />
Projekte mit Grobkonzept<br />
Projekt „Mystic Garden – Skulpturenwege – Naturschutz und Kunst“<br />
In Verbindung mit der Hohen Schrecke gibt es zahlreiche Sagen, Geschichten und mythische<br />
Erzählungen. Die Idee dieses Projekts ist es, dieses thematisch in Form von Holzskulpturen und<br />
Reliefs aufzubereiten. Es soll ein Skulpturenweg geschaffen werden, der durch das Areal der<br />
Hohen Schrecke verläuft. Die Kunstwerke können den Besuchern so auf ihren Wanderungen<br />
erlebbar gemacht werden. Mit Seminaren über künstlerische Holzgestaltung können<br />
Schulklassen und andere Gruppen im Rahmen von Projekten dafür gewonnen werden,<br />
gemeinsam mit den Anrainerkommunen Pflege, Instandhaltung, Sicherheit und Erweiterung der<br />
Werke zu gewährleisten.<br />
Bei dem Projekt Mystic Garden handelt es sich um eine innovative Idee, die zur Stärkung der<br />
touristischen Angebote im Gebiet der Hohen Schrecke beitragen kann. Besonders für den Aktivund<br />
Bildungstouristen bietet dieser Themenweg eine besondere Möglichkeit, das Waldgebiet der<br />
Hohen Schrecke zu erkunden.<br />
Förderfähigkeit und Maßnahmenträger sind bisher nicht geklärt.<br />
Sichtbarmachung alter Wüstungen (z.B. Wetzelshain, Burg Rabenswald)<br />
Bei der Wüstung Wetzelshain (Fläche etwa 200x400m) handelt es sich um eine ehemalige<br />
Siedlung, die im Hochmittelalter (12./13. Jh.) errichtet wurde und bereits im 14. Jh. wieder<br />
aufgegeben wurde. Trotz Überwucherungen von Büschen und Bäumen sind die Konturen des<br />
damaligen Befestigungssystems noch heute recht deutlich erkennbar. Ein weiteres interessantes<br />
Bodendenkmal, das einer Aufarbeitung bedarf, ist die Burg Rabenswald bei Garnbach/<strong>Wiehe</strong>.<br />
Ausgrabungen machen Geschichte lebendig und erlebbar für alle Sinne. Die Arbeit weckt bei<br />
Jedermann Interesse für die Geschichte der Region und schafft eine Verbundenheit zur Heimat.<br />
81
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Neben dem pädagogischen Aspekt gilt es, eine bedeutende Landmarke der Region wieder<br />
erlebbar werden zu lassen und damit ein neues spannendes Ausflugsziel zu gestalten.<br />
Die Förderfähigkeit dieses Vorhabens ist bisher nicht geklärt.<br />
Weitere Projektideen<br />
� Etablierung des Wildobstlehrpfades in Langenroda mit Beschilderung<br />
� „Das gelbe Band der Hohen Schrecke“: Einheitliche Bepflanzung von Ackerrändern zur<br />
Gestaltung einer temporären Route<br />
� Einrichtung Themenweg: Kirchen und Klöster unter Einbindung der Pfarrhäuser<br />
� Vernetzung und Ausbau der Reitwege<br />
� Ausweitung des Geopfad Unstrut-Hohe Schrecke (Beichlingen)<br />
� Naturempfinden: Geomantie Pfad zur Wahrnehmung von Erdenergien<br />
� Konzept zur innerörtlichen Besucherlenkung, <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong><br />
� Kräuterwegeprojekt (Maßnahmenblatt M 20)<br />
� Urwald-Kletterpfad (vgl. hierzu die Ideen im Naturschutzgroßprojekt „Hohe Schrecke“)<br />
Strategisch berücksichtigen<br />
� Kooperationsprojekt „<strong>Integriertes</strong> Wegekonzept“<br />
� Bewertung der Wegequalität<br />
� Projekt Radweg "Auf den Spuren der Ur-Ilm", Schaffung einer Verbindung zwischen Ilm-<br />
Radwanderweg/Städteketteradweg und Unstrut-Radweg/GeoPark Kyffhäuser)<br />
5.4.4 Leitthema Informationsmanagement und Marketing<br />
5.4.4.1 Ziel und Inhalt<br />
Eine zentrale Schwäche des Projektgebietes ist, dass es lange Zeit wenig Zusammenarbeit mit<br />
den vorhandenen Tourismusorganisationen und kein koordiniertes Vorgehen im Bereich<br />
touristischer Profilierung und des Außenmarketings gab. In der Stärken-Schwächen-Analyse<br />
wurde deutlich, dass es bisher kein erkennbares gemeinsames Erscheinungsbild der Region<br />
Hohe Schrecke oder ein Logo für die Vermarktung regionaler Produkte gibt. Ein weiteres Defizit<br />
ist, dass sich nur wenig touristische Informationen zum Gebiet der Hohen Schrecke im Internet<br />
finden lassen.<br />
Für die Stärkung der Binnenstrukturen wird es von großer Bedeutung sein, ein gemeinsames<br />
Marketing aufzubauen. Dieses beinhaltet eine ansprechende Aufbereitung und Aktualisierung<br />
der Homepage Hohe Schrecke. Auch die Entwicklung eines Produktlogos für regional und<br />
landwirtschaftlich erzeugte Produkte trägt zur Identifikation der Menschen mit ihrer Region bei.<br />
Das Bewusstsein der eigenen Herkunft stärkt das Entstehen eines regionalen Identitäts- und Wir-<br />
Gefühls. Wer sich mit seiner Region und seinen Wurzeln identifiziert, wird sich eher dazu<br />
82
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
entscheiden, dauerhaft in der Region zu bleiben. Wichtig ist außerdem, mit der Einführung eines<br />
Produktlogos eine Vernetzung der regionalen Leistungsträger zu erreichen.<br />
In der Bestandsanalyse wurde zudem festgestellt, dass es bisher eine Tourismusinformation in<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> gibt. Ein großes Defizit ist, dass sich diese als „Tourismusinformation-<br />
Unstruttal“ bezeichnet. Die Bezeichnung „Region Hohe Schrecke“ muss eingebunden werden,<br />
um auch so eine Stärkung der inneren Strukturen zu erreichen. Mit Hinblick auf die<br />
verschiedenen kulturellen und naturräumlichen Besonderheiten, die das Gebiet der Hohen<br />
Schrecke seinen Gästen bietet, sollten mehrere dezentrale Tourismusinformationen eingerichtet<br />
werden. Da z. B. viele Aktivtouristen die Region über den Bahnhof Heldrungen erreichen, wären<br />
dieser Ort bzw. die Strukturen des Gutshofes in Braunsroda geeignet.<br />
Vor allem durch die Stärkung der Binnenstrukturen in einem ersten Schritt kann die Basis gelegt<br />
werden, den auch außerhalb der Region geringen Bekanntheitsgrad der Tourismusregion Hohe<br />
Schrecke zum Positiven zu verändern.<br />
Da das Projektgebiet als zu kleinteilig für eine eigenständige touristische Vermarktung eingestuft<br />
werden kann, wird in einem zweiten Schritt zukünftig eine Anbindung an vorhandene<br />
Vermarktungsstrukturen von großer Bedeutung sein. In der Stärken-Schwächen-Analyse wurde<br />
deutlich, dass es bisher eine nur mangelnde Einbindung der Angebote in Strukturen der<br />
angrenzenden Tourismusregionen gibt. Da die Region an die touristisch gut erschlossenen und<br />
angenommenen Naturparke „Kyffhäuser“ und „Saale-Unstrut-Triasland“ grenzt und die<br />
touristische Attraktivität des Projektgebietes besonders in seiner Naturausstattung begründet ist,<br />
muss hier eine Anbindung angestrebt werden. Eine stärkere Orientierung in Richtung der<br />
Tourismusregion Saale-Unstrut-Triasland ist aus fachlichen Gesichtspunkten sinnvoll.<br />
Naturräumlich, geologisch, archäologisch und historisch ist hier eine Vernetzung gegeben, denn<br />
die Hohe Schrecke ist Bestandteil des geologischen Grundgebirges der Triasformation. In einigen<br />
Bereichen, wie bei der Ausweisung von Rad- und Wanderwegen (Unstrut Radweg), der<br />
Vermarktung gemeinsamer Wanderkarten oder bei Projekten zur Nutzung der Unstrut, besteht<br />
bereits eine Zusammenarbeit. Trotz der guten Erfahrungen muss berücksichtigt werden, dass<br />
sich eine engere länderübergreifende Kooperation als schwierig erweisen wird. Eine stärkere<br />
Kooperation bei bestimmten Projekten mit den Nachbarlandkreisen in Sachsen-Anhalt wird<br />
dennoch als sehr sinnvoll erachtet (Ergebnisse der Gespräche und Workshops).<br />
Besonders im Bezug zum Naturschutzgroßprojekt Hohe Schrecke muss geprüft werden, ob eine<br />
Anbindung an einen Naturpark möglich ist. Zunächst wird eine stärkere Verknüpfung zum<br />
Geopark Kyffhäuser für sinnvoll erachtet. 53 Der Geopark hat eine relativ hohe Akzeptanz in der<br />
Region und auch über die Kreisgrenzen sowie Ländergrenzen (Sachsen-Anhalt) hinweg ist diese<br />
53 Die Verlinkung der bestehenden Homepages z.B. www.geopark-kyffhaeuser.com und<br />
www.hoheschrecke.de wird angeregt, es wird angemerkt, dass der Geopark nicht die Organisationsstruktur<br />
für die Vermarktung der Hohen Schrecke sein kann. (Stellungnahme der Regionalen Planungsstelle<br />
Nordthüringen vom 23.06.2009)<br />
83
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
gut. Eine Anbindung an die relativ neuen und noch nicht gefestigten Organisationsstrukturen<br />
kann als unkompliziert eingestuft werden (Ergebnisse der Gespräche und Workshops). Die Städte<br />
<strong>Wiehe</strong> und Roßleben und viele Akteure aus der Region sowie Mitglieder der Kommunalen<br />
Arbeitsgemeinschaft sind bereits in die Strukturen des Geoparks integriert. Von anderen<br />
Gemeinden in der Projektregion wurde Interesse bekundet, sich in naher Zukunft in diese<br />
Struktur einbinden zu wollen (Ergebnisse der Gespräche und Workshops). Die genaue<br />
Ausgestaltung ist aber noch weiter zu klären.<br />
5.4.4.2 Projekte und Maßnahmen<br />
Umsetzungsfähige Projekte<br />
Marketingkonzept Tourismus für die Hohe Schrecke (Maßnahmenblatt M 1)<br />
Grundlage der zukünftigen Tourismusentwicklung sollte ein strategisches Konzept sein.<br />
Abgeleitet aus den bestehenden Konzepten <strong>ILEK</strong> und dem Antrag des Naturschutzgroßprojekts<br />
soll es als Basis für die koordinierte Entwicklung, Außendarstellung und die Kommunikation<br />
touristischer Angebote dienen. Neben einer detaillierten Informationsgrundlage kann hierdurch<br />
wirksame Innen- und Außenkommunikation für die Region initiiert und ein<br />
zielgruppenorientiertes Set an Pauschalangeboten im Tourismus entwickelt werden. Die<br />
Förderung dieser Maßnahme ist kurzfristig durch das Naturschutzgroßprojekt möglich (s.a.<br />
Maßnahmeblatt im Anhang).<br />
Logo Hohe Schrecke (Produktlogo)<br />
Für die zukünftige Vermarktung der regional und landwirtschaftlich erzeugten Produkte der<br />
Region wird es für wichtig erachtet, ein Produktlogo zu entwickeln. Dieses trägt entscheidend zur<br />
stärkeren Kooperation und Vernetzung der regionalen Anbieter bei. Besonders für die<br />
Innenwirkung ist ein Logo wichtig, um die Identifikation der Bevölkerung mit der Region Hohe<br />
Schrecke zu stärken. Eine mögliche erste Idee für ein Logo „Hohe Schrecke“ wurde aus der<br />
Gestalt der Hohen Schrecke, wie sie sich in der Draufsicht darstellt, konzipiert (vgl. Abb. 2).<br />
Abbildung 8: Logo „Hohe Schrecke“ Entwurf Dieter Krüger, Garnbach<br />
84
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Alle in der Region erzeugten Produkte könnten mit diesem Logo versehen werden und es ließe<br />
sich somit gut mit den Überlegungen im Handlungsfeld Land- und Forstwirtschaft verknüpfen.<br />
Darüber hinaus kann das Logo auch auf Fahrzeugen angebracht werden und den<br />
Bekanntheitsgrad der Projektregion erhöhen.<br />
Förderfähigkeit und Maßnahmenträger sind zu prüfen.<br />
Projekte mit Grobkonzept<br />
Wanderbroschüre "Hohe Schrecke-Finne-Schmücke"<br />
Zur Gestaltung einer Wanderbroschüre „Hohe Schrecke-Finne-Schmücke“ liegen bereits erste<br />
Projektskizzen vor. So können markierte und beschilderte Fußwanderwege, Radwanderwege,<br />
Reitwanderwege, zugelassene Kremserwege und thematische Wegeempfehlungen in die<br />
Broschüre aufgenommen werden. Für die Aufnahme neuer Themenwege liegt eine Reihe von<br />
Ideen vor. Ein Beispiel ist die Route „von Museum zu Museum“ (Wohlmirstedt, heimatkundliche<br />
Sammlung / <strong>Wiehe</strong>, Rankemuseum, Heimatmuseum, Modelleisenbahn / Langenroda,<br />
Bockwindmühle und technisches Denkmal / Donndorf, Heimathaus). Für die Wanderbroschüre<br />
sind weitere Themenwege wie „von Kirche zu Kirche“ oder „von Reitstall zu Reitstall“ vorgesehen.<br />
Ziel ist es, die Projektregion stärker in umliegende Tourismusregionen einzubinden und den<br />
Bekanntheitsgrad zu erhöhen.<br />
Die Förderfähigkeit ist zu prüfen und ein Projektträger zu benennen, da der Verein Heimatfreunde<br />
<strong>Wiehe</strong> nicht als Projektträger eintreten kann. Um Doppelarbeiten zu vermeiden sind zunächst die<br />
Routen festzulegen und Abstimmungen mit den Planungen des Naturschutzgroßprojektes<br />
(Stichwort Pflege- und <strong>Entwicklungskonzept</strong>) vorzunehmen.<br />
Digitaler Regionaler Wanderführer<br />
Das Lenkungs- und Informationssystem soll auf dem vor einigen Jahren entwickelten Projekt<br />
„HörErlebnis Kyffhäuser“ aufbauen und dieses weiterentwickeln. Um störungssensible Teilräume<br />
der Hohen Schrecke nicht übermäßig zu frequentieren, sollen die Besucher mit einem GPSgesteuerten<br />
Informationssystem gelenkt werden. Die moderne Technik bietet neben der digitalen<br />
Kartengrundlage zur Orientierung die Möglichkeit, für bestimmte touristisch attraktive Orte<br />
(points of interest, POI) Informationen zu Kultur und Geschichte, zum Naturraum, zur<br />
Waldgeschichte usw. zu stellen. Darüber hinaus können gebietsüberschreitende Rad- und<br />
Wanderrouten erarbeitet und so eine Vernetzung mit den angrenzenden Regionen hergestellt<br />
werden. Für die Projektregion soll das bestehende Routennetz GPS-sicher aufbereitet und so<br />
Wanderern, Radfahrern und Reitern als gedruckte Karte oder auch digital in Form eines Web-GIS<br />
zur Verfügung gestellt werden.<br />
Weiterhin könnte der digitale regionale Wanderführer mit „geocaching“ verbunden werden.<br />
Geocaching ist eine moderne Form einer Schatzsuche bzw. Schnitzeljagd.<br />
Ausgestattet mit einem GPS-Empfänger und den Koordinaten eines "Schatzes" aus dem Internet<br />
85
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
kann man die Schätze finden, die jemand anderes an ungewöhnlichen Plätzen versteckt hat. 54<br />
Geocaching kann also für die Hohe Schrecke als einen Baustein für die Gewinnung von<br />
Besuchern gesehen werden.<br />
Es handelt sich hierbei um ein innovatives Projekt, das ein hohes Vernetzungspotential aufweist.<br />
Förderfähigkeit und Maßnahmenträger müssen überprüft werden. In ähnlicher Form sind bereits<br />
Ideen im Rahmen des Wettbewerbbeitrags zu idee.natur entstanden. Hier wird eine enge<br />
Abstimmung und Verknüpfung beider, aktuell getrennt geplanter Maßnahmen notwendig.<br />
Vermarktung der Mühlenroute<br />
Die Orte Altenbeichlingen, Ostramondra und Bachra sind in den Mühlenwanderweg<br />
eingebunden, der an rund 20 Mühlen in Thüringen vorbei führt. Die Regionale<br />
Entwicklungsstrategie Kyffhäuser benennt die stärkere Vermarktung der Mühlenroute als<br />
Einzelmaßnahme zur Entwicklung von touristischen Wegen. Die Vermarktung der Mühlenroute<br />
wird auch von den Akteuren im <strong>ILEK</strong> Prozess als wichtige Maßnahme angesehen.<br />
Die Vermarktung trägt zu einer verstärkten Anbindung an angrenzende Tourismusregionen bei<br />
und stärkt die inneren Strukturen. Infrastrukturell würde das Vorhaben von den im <strong>ILEK</strong><br />
benannten Radwegeprojekten „Ausbau des Finnebahndamms“ und Radweg zwischen<br />
Ostramondra und Battgendorf unterstützt werden (s. entsprechendes Maßnahmeblatt).<br />
Weitere Projektideen:<br />
� Teilnahme / Bewerbung beim Thüringer Wandertag<br />
� Zusammenarbeit mit Medien - auf Region aufmerksam machen, z.B. MDR Wandertage,<br />
Plattformen aller Partner für Marketing nutzen (Internet)<br />
� Besucherlenkung mittels Internet<br />
� Erstellung eines regionalen Veranstaltungskalenders "Hohe Schrecke" (Faltblatt,<br />
gegenseitige Veröffentlichungen in den Amtsblättern)<br />
� Ausbau der Konzertreihe im Kulturzentrum <strong>Wiehe</strong><br />
� Thematische Schwerpunkte „Schlösser und Burgen“ sowie „Persönlichkeiten der Region“ als<br />
Grundlage für regionale Marketingkonzepte<br />
� Verbesserung der Werbung bezüglich Service- und Ausleihstellen für Fahrräder und Kanus<br />
� Verbesserung der Tourismusinformation <strong>Wiehe</strong> (z.B. Vernetzung mit Pensionen,<br />
Aktualisierung der Ausschilderungen) sowie Entwicklung eines Gesamtkonzepts für das<br />
<strong>Stadt</strong>marketing<br />
54 S.a www.geocaching.de<br />
86
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
5.4.5 Leitthema Landschaftsentwicklung<br />
5.4.5.1 Ziel und Inhalt<br />
Für dieses Leitthema gilt in ganz besonderem Maße die enge Abstimmung zwischen dem<br />
Konzept zum Bundeswettbewerb idee.natur und dem <strong>ILEK</strong>. Für die Waldbereiche der „Hohen<br />
Schrecke“ sind durch das idee.natur-Konzept bereits vorwiegend naturschutzfachliche Ziele mit<br />
einem gewissen Vorrang vor anderen Zielen formuliert. Außerhalb des Planungsbereichs des<br />
Naturschutzgroßprojekts wird eine Entwicklung angestrebt, die möglichst sanft die bestehenden<br />
Strukturen in der Landschaft weiterentwickelt und so die bestehenden landschaftlichen<br />
Potentiale für ökonomische Wertschöpfungsketten erhält. Für den Waldbereich sind<br />
voraussichtlich folgende Ziele im Pflege- und Entwicklungsplan des Naturschutzgroßprojekts<br />
angedacht (Aufzählung nicht abschließend):<br />
� Überführung von 1.000 ha „alten“ Waldes in eine forstliche Nullnutzung,<br />
� im größten Teil des Waldgebiets der „Hohen Schrecke“ gilt das Prinzip „Schutz durch<br />
Nutzung“,<br />
� die Entwicklung eines Netzes aus Altholzinseln mit Trittsteinfunktion,<br />
� die Erhaltung von essentiellen Sonderstrukturen und Mikrohabitaten,<br />
� FFH-relevante Flächen werden in einen Erhaltungszustand im Sinne der FFH-Richtlinie<br />
überführt,<br />
� Waldumbau in Richtung potentiell natürlicher Vegetation,<br />
� Wiederbelebung aufgegebener Waldbauverfahren.<br />
Die konkrete Formulierung der Ziele für das Naturschutzgroßprojekt wird erst mit Erarbeitung des<br />
Pflege- und Entwicklungsplans vorgenommen. Dieser wird in der ersten Phase nach Start des<br />
Naturschutzgroßprojekts im Juli 2009 erarbeitet. Für den Landschaftsraum außerhalb des<br />
Waldgebiets gilt das Prinzip der Bewahrung und Entwicklung von Eigenart und Identität der<br />
Kulturlandschaft, wie es auch die Regionale Entwicklungsstrategie der RAG Kyffhäuserkreis<br />
formuliert.<br />
5.4.5.2 Projekte und Maßnahmen<br />
Projektideen<br />
� Pflege von Streuobstwiesen, z.B. die Streuobstwiese am Schloss Beichlingen mit alten<br />
Kirschsorten,<br />
� Reinsdorf: Pflege der seit mehreren Jahrzehnten nicht genutzten Hohlwege „Vittelweg“,<br />
„Holzweg“ und „Kummerweg“, Wege sind vernachlässigt und zum Teil zugewachsen. Wege<br />
sind in Gemeindeeigentum, Wege führen in den Wald und könnten in das Wanderwegenetz<br />
eingebunden werden, Attraktionen: Stubensandhöhle (40 m tief) und Jägerhütte,<br />
� <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>: Förderung der Entwicklung des Grünlandes zu extensiv genutzten Feuchtwiesen<br />
87
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
5.5 Handlungsfeld „Land- und Forstwirtschaft“<br />
5.5.1 Entwicklungsziel<br />
Die landwirtschaftlichen Betriebe der Region sind, wie unter Abschnitt 4.2 dargestellt, gut<br />
aufgestellt. Um aber den festgestellten Schwächen entgegenzuwirken, wurde in der<br />
Arbeitsgruppe für dieses Handlungsfeld folgendes Ziel formuliert:<br />
Die Entwicklung einer regionalen Produktmarke und Strategie „Hohe Schrecke“<br />
Mit der Realisierung dieses Ziels soll erreicht werden, regionale Potentiale in den Bereichen der<br />
Vermarktung land- und forstwirtschaftlicher Produkte zu nutzen, einzelne Bereiche, wie die<br />
Nutzung alternativer Energien vertieft auszubauen und die Landwirtschaft als Wirtschaftzweig<br />
auch für die ansässige junge Bevölkerung wieder attraktiv zu machen und so den negativen<br />
Folgen des demographischen Wandels entgegenzuwirken.<br />
5.5.2 Leitthema Regionale Produktvermarktung 55<br />
5.5.2.1 Ziel und Inhalt<br />
Dieses Leitthema dient vorwiegend der Etablierung und Bekanntmachung regionaler land- und<br />
forstwirtschaftlicher Produkte sowie der Vernetzung von Erzeugung und Vertrieb, um so regionale<br />
Wertschöpfungsketten für diese Produkte zu schaffen. Das Leitthema baut auf bereits<br />
bestehenden Strukturen auf, die weiter ausgebaut werden sollen, vor allem die intensivere<br />
Einbindung der Handwerker sowie die gleichwertige Vermarktung von forst- und<br />
landwirtschaftlichen Produkten soll forciert werden. Dabei geht es<br />
nicht ausschließlich um die klassische Direktvermarktung von<br />
landwirtschaftlichen Produkten, sondern auch Möglichkeiten der<br />
Vermarktung über den Handel sollen eröffnet werden.<br />
Da aber die Region zu klein ist, um sich eigenständig zu etablieren,<br />
wird überprüft, an welchen bereits bestehenden Strategien und<br />
Marken die Marke „Hohe Schrecke“ anknüpfen kann.<br />
Die „’Geprüfte Qualität’ – Thüringen“ ist eine etablierte Marke<br />
Thüringens, die im Rahmen eines Gemeinschaftsmarketings zur Abbildung 9: Das<br />
Absatzförderung von Produkten der Landwirtschaft, des Zeichen „Geprüfte<br />
Ernährungsgewerbes und des Ernährungshandwerks beitragen soll.<br />
Lizenznehmer kann dabei jeder thüringische Betrieb der Agrar- und<br />
Qualität“ - Thüringen<br />
Ernährungswirtschaft und des Ernährungshandwerks sein. Einige Direktvermarkter der Region<br />
„Hohe Schrecke“ sind bereits für einen Teil ihrer Produkte Lizenznehmer. Das Zeichen bietet<br />
außerdem die Möglichkeit, einen Hinweis auf die Region einzufügen. Zum Erwerb der Lizenz sind<br />
55 Dieses Leitthema wird zum Zeitpunkt der Berichtserstellung in der Region noch kontrovers diskutiert.<br />
88
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Kriterien zum Produktionsstandort, zu bestimmten Verhältnissen der Ausgangsstoffe sowie<br />
bestimmte Qualitätsanforderungen zu erfüllen.<br />
Ein Logo „Hohe Schrecke“ kann als weitere Maßnahme dienen, die vorhandenen Produkte der<br />
Region als solche zu kennzeichnen. Dies dient im ersten Schritt vorwiegend dem Innenmarketing<br />
und kann später auch einem Außenmarketing dienen. Das Logo „Hohe Schrecke“ steht in enger<br />
Verbindung mit anderen Handlungsfeldern, allen voran dem Handlungsfeld Tourismus und<br />
Erholung. Die entwickelten Ideen werden dort näher vorgestellt (siehe Abschnitt 5.4). Um die<br />
Produkte überregional gewinnbringend zu vermarkten, müsste mit diesem Logo eine bestimmte<br />
„Qualitätssicherung“ einhergehen, so dass der Verbraucher eine bestimmte Qualität mit dieser<br />
Marke verbindet und die Produkte deshalb für ihn attraktiv werden. Allerdings bleibt kritisch<br />
anzumerken, dass diese Qualitätssicherung einerseits einer Einigung über zu erfüllende<br />
Qualitätskriterien zwischen allen Beteiligten bedarf und andererseits mit erheblichen Kosten für<br />
die Etablierung verbunden ist. Ohne diese Qualitätssicherung aber ist es unwahrscheinlich, dass<br />
die Marke sich überregional etablieren wird.<br />
Neben der Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte können zum Beispiel<br />
Wertschöpfungsketten in Verknüpfung mit dem touristischen Bereich, wie dem weiteren Auf- und<br />
Ausbau von regionalen Märkten zu touristischen Attraktionspunkten weiter entwickelt werden.<br />
Allerdings kann die Entwicklung von Wertschöpfungsketten nur gelingen, wenn einzelne Bürger<br />
der Region als „Zugpferde“ beginnen, solche Wertschöpfungsketten und Netzwerke über<br />
verschiedene Bereiche hinweg aufzubauen, voranzutreiben und für den langfristigen Erfolg<br />
einstehen. Ist dies nicht gewährleistet, werden die Entwicklung und der spätere Erfolg der<br />
Vermarktung regionaler Produkte nicht im Sinne einer regionalen Marke „Hohe Schrecke“<br />
gelingen.<br />
Dieses Leitthema verknüpft sich gut mit der Regionalen Entwicklungsstrategie der RAG<br />
Kyffhäuserkreis, da hier der Ausbau der Verarbeitung und Vermarktung regionaler Produkte als<br />
Leitprojekt benannt ist. Um das Leitthema zielorientiert voranzubringen, wäre ein intensiver<br />
Austausch von Interessierten notwendig, die sich beispielsweise in einem ersten Schritt<br />
regelmäßig treffen und sich über ihre Vorstellungen und Möglichkeiten austauschen. In einem<br />
zweiten Schritt sollten sich Interessierte zusammenfinden und überlegen mit welchem Produkt in<br />
welcher Form sie sich etablieren wollen, beispielsweise in Form einer Erzeugergemeinschaft. Im<br />
dritten Schritt muss dann ein Projekt konzipiert werden, das die Entwicklung der<br />
Wertschöpfungskette zielorientiert vorantreibt.<br />
Im Rahmen der Arbeitsgruppen wurde diskutiert, ob sich die „Hohe Schrecke“ als<br />
„gentechnikfreie Region“ etablieren soll. Die Abstimmungsprozesse zu diesem Thema sind zum<br />
Zeitpunkt des Endberichts noch nicht abgeschlossen und sollten im Rahmen der weiteren<br />
Regionalentwicklung fortgeführt werden.<br />
89
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
5.5.2.2 Projekte und Maßnahmen<br />
Umsetzungsfähige Maßnahmen<br />
Regionaler Holzmarkt (Maßnahmenblatt M 7)<br />
Ziel ist, einen Holzmarkt zu etablieren, der als wesentliche Grundlage für die Vermarktung des<br />
nachwachsenden Rohstoffes Holz in seiner Vielfalt nicht nur für Kunden, sondern auch als<br />
Touristenmagnet fungiert. In einem halbjährlichen Turnus werden auf dem Holzmarkt neben<br />
Brennholz auch andere weiter verarbeitete Produkte des Rohstoffes Holz angeboten. Zudem wird<br />
mit Aufklärungs- und Bildungsarbeit darauf hingewirkt, die Attraktivität von heimischem Holz z.B.<br />
gegenüber Tropenholz zu erhöhen. Handwerker der Region zeigen die vielfältigen<br />
Einsatzmöglichkeiten von Holz. Zu diesem Zweck werden regional ansässige Unternehmer,<br />
Handwerker, Waldbesitzer aber auch Künstler als Teilnehmer am Holzmarkt geworben. Der erste<br />
regionale Holzmarkt fand bereits im August 2009 statt. Neben verschiedenen Formen der<br />
Holzbearbeitung, vom Handwerk bis zur künstlerischen Bearbeitung, waren auch Experten vor<br />
Ort, die über die unterschiedlichsten Hölzer der Region informierten. Der Holzmarkt fand regen<br />
Anklang in der Bevölkerung und soll in einem halben Jahr wiederholt werden.<br />
Abbildung 10: Verschiedene Formen der Holzbearbeitung, dargestellt auf dem ersten regionalen<br />
Holzmarkt. Bilder R. Kruspe<br />
Ansprechpartner und Organisator des Holzmarkts ist Reinhard Kruspe, Holzhandel Kruspe.<br />
90
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Logo „Hohe Schrecke“<br />
Ein zu entwickelndes Logo soll der Innen- und Außenwerbung dienen. Hier bestehen enge<br />
Verbindungen zu allen anderen Handlungsfeldern, da dieses Logo produktunabhängig für die<br />
Region verwendet werden kann. Erste konkretere Vorschläge zu einem Logo entstanden im<br />
Handlungsfeld Tourismus und Erholung und werden auch dort beschrieben (siehe Abschnitt 5.4).<br />
Weitere Projektideen<br />
� <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>, OT Hechendorf: Einrichtung von Verarbeitungsbetrieben, insbes.<br />
Obstverwertung, für landwirtschaftliche Produkte wie Saft unter Nutzung ehemaliger LPG-<br />
Gebäude.<br />
� Furnierwerk mit Biomasse-BHKW an der „Hohen Schrecke“ (Siehe Maßnahmenblatt M 22)<br />
5.5.2.3 Fördermöglichkeiten<br />
Richtlinie Innovationsförderung in der Land- und Forstwirtschaft 56<br />
Für die Entwicklung von innovativen Produkten in der Land- und Ernährungswirtschaft sind<br />
Vorhaben zur Grundlagenforschung, industrielle Forschung und technische<br />
Durchführbarkeitsstudien bis zu 60% förderfähig. Vorwettbewerbliche Vorhaben sind zu 35%<br />
förderfähig.<br />
Zwischen dieser Richtlinie und den Fördermöglichkeiten im Rahmen des Wettbewerbs<br />
„chance.natur“ kann es zu Überschneidungen kommen. Daher ist eine enge Abstimmung<br />
zwischen den Managements der Regionalen Aktionsgruppen und dem Management des<br />
Naturschutzgroßprojekts nötig.<br />
Nähere Informationen hierzu bietet die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (Hr. Knape,<br />
Tel: 03641 - 683 403) sowie das TMLNU.<br />
Weitere Informationen im Internet:<br />
http://www.agrarmarketing.thueringen.de/uploads/media/pressemitteilung__tll__280709.pdf<br />
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (FILET)<br />
Gefördert werden Investitionen, die<br />
� die Qualität der Produkte erhöhen,<br />
� neue Produkte verarbeiten helfen,<br />
� zur Rationalisierung beitragen,<br />
56 Diese Richtlinie gilt bis 31. Dezember 2015, nachzulesen im Thüringer Staatsanzeiger Nr. 29/2009<br />
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/thueringenagrar/tmlnu_frank/<br />
fr_innovationsf__rderung.pdf<br />
91
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
� die Verarbeitung von ökologischen und regionalen Produkten, Qualitätsprodukten fördern.<br />
Dabei werden Erzeugergemeinschaften mit bis zu 35% gefördert, kleinere und mittlere<br />
Unternehmen mit bis zu 25%, größere Unternehmen mit weniger als 750 Beschäftigten bzw.<br />
einem Jahresumsatz von weniger als 200 Mio. Euro mit bis zu 20%.<br />
Wesentliche Voraussetzung ist, dass der Antragsteller nachweisen kann, dass eine Nachfrage<br />
nach dem Produkt besteht, die Rentabilität überprüft wurde und bereits Vereinbarungen mit<br />
Zulieferern bzw. Abnehmern (z.B. Supermärkten) getroffen wurden. Zuständig für diese Förderung<br />
ist die Thüringer Aufbaubank.<br />
weitere Informationen im Internet:<br />
www.aufbaubank.de<br />
Vermarktungskonzeptionen<br />
Die Förderrichtlinie zur Marktstrukturverbesserung fördert die Erarbeitung und Durchführung von<br />
Vermarktungskonzeptionen. Gefördert werden Marktanalysen, Entwicklungsstudien, Beratungsund<br />
Planungsmaßnahmen, Durchführbarkeits- und Konzeptstudien, Marktforschung sowie<br />
Produktentwürfe. Zuwendungsempfänger können Erzeugergemeinschaften sein, die ökologische<br />
oder regionale Produkte erzeugen, oder landwirtschaftliche Unternehmen, aus den Bereichen<br />
Verarbeitung und Vermarktung, die weniger als 750 Beschäftigte umfassen oder weniger als 200<br />
Mio. Euro Jahresumsatz erzielen. Es können 50% der Ausgaben gefördert werden, maximal<br />
jedoch 100.000 Euro in drei Jahren. Ansprechpartner in der Landesanstalt für Landwirtschaft ist<br />
Frau Klein (Tel: 03641 - 683 640).<br />
Weitere Informationen im Internet:<br />
http://www.thueringen.de/de/tll/foerderung_formulare/lw_fw_markt/<br />
5.5.3 Leitthema Regionale Energienutzung<br />
5.5.3.1 Ziel und Inhalt<br />
Um die regionalen Potentiale, vor allem die Potentiale des „alten Waldes“ aber auch andere<br />
Bereiche der Energiegewinnung durch alternative Energien noch stärker in Wert zu setzen, soll<br />
das Thema „regionale Energienutzung“ weiter ausgebaut werden. Die bereits jetzt bestehende<br />
Brennholznutzung kann dabei noch energieeffizienter ausgestaltet werden. Neben der aktuellen<br />
Brennholznutzung soll geprüft werden, welche Möglichkeiten in der Region an alternativer<br />
Energienutzung bestehen. Damit wird auf eine Vision der „energieautarken Region“<br />
hingearbeitet. Auf die weitere Nutzung von Windkraft wird zugunsten der Erhaltung des<br />
Landschaftsbildes dabei jedoch von Beginn an verzichtet. Klar ist dabei, dass diese Entwicklung<br />
ein sehr langwieriger Prozess ist, der viel Engagement und Durchhaltevermögen bedarf. Die<br />
langfristige Etablierung der Landwirte als „Energiewirte“, die durch die Anwendung neuartiger<br />
Techniken eine alternative Stromversorgung aufbauen können, besitzt aber das Potential zu<br />
einem Alleinstellungsmerkmal. Im Zusammenhang mit diesem Leitthema plant die Gemeinde<br />
Hauteroda in Zusammenarbeit mit der Markus-Gemeinschaft die Erarbeitung eines<br />
Bioenergiekonzepts, um Hauteroda als Bioenergiedorf zu etablieren.<br />
92
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Der Projektbeitrag der Region im Rahmen des Bundeswettbewerbs idee.natur enthält bereits<br />
einige Projektideen zum Thema Energiegewinnung durch Holznutzung, die realisiert werden<br />
können. Eine enge Abstimmung zwischen den dort erarbeiteten Ideen und weiteren Projektideen<br />
ist zielführend.<br />
5.5.3.2 Projekte und Maßnahmen<br />
Umsetzungsfähige Projekte<br />
Regionaler Holzmarkt<br />
Der regionale Holzmarkt soll neben der Vermarktung von Holz als regionales Produkt (s.o.) die<br />
Etablierung von Holz als Energielieferant weiter vorantreiben).<br />
Furnierwerk mit Biomasse-BHKW (siehe Maßnahmenblatt M 22)<br />
Im Umkreis von ca. 400 km ist kein Furnier herstellender Betrieb vorhanden. Die Baumarten der<br />
Hohen Schrecke eignen sich aufgrund der Standortverhältnisse für Furnierholz. Es soll daher ein<br />
Furnierwerk errichtet werden, das regionalspezifische Echtholz Furniere erzeugt. Dieses<br />
Furnierwerk wird mit einem Biomasse-Blickheizkraftwerk gekoppelt, um mit den Resthölzern der<br />
Furnierproduktion sowie Energiehölzern der Hohen Schrecke Wärmeenergie zu erzeugen.<br />
Weitere Projektideen<br />
� Ausbildung regionaler Energieberater (vgl. hierzu Projektbeitrag zum Bundeswettbewerb<br />
idee.natur),<br />
� die Erarbeitung innovativer Konzepte zur Energieversorgung der Zukunft,<br />
� Bioenergiedorf Hauteroda: Eine Zusammenarbeit der Markus-Gemeinschaft und der<br />
Kommune,<br />
� Entwicklung eines regionalen Zentrums für die Forstwirtschaft: „Kompetenzzentrum Holz“.<br />
5.5.3.3 Fördermöglichkeiten<br />
In dem Themenkomplex „Erneuerbare Energien – Biomasse – Nachwachsende Rohstoffe“ gibt es<br />
eine Vielzahl von unterschiedlichen Förderprogrammen. Da es ein noch vergleichsweise „junges“<br />
Thema ist, sind viele der Programme auf Forschung und Entwicklung ausgerichtet. Die hier<br />
vorgestellten Fördermöglichkeiten nehmen Bezug auf diskutierte Maßnahmen. Bei einer<br />
Weiterentwicklung des Leitthemas wird dieses Kapitel noch ergänzt.<br />
Marktanreizprogramm (BMU)<br />
Das BMU hat 2007 ein Förderprogramm vorgelegt, das Privatpersonen und kleineren und<br />
mittleren Unternehmen die Nutzung alternativer Energiequellen ermöglicht. So sind<br />
beispielsweise Scheitholzvergaserkessel im Rahmen einer Basisförderung förderfähig. Dazu<br />
können noch weitere, sogenannte Bonusförderungen in Anspruch genommen werden. So ist zum<br />
Beispiel ein Kombinationsbonus möglich, bei dem beispielsweise die Errichtung von<br />
Solarkollektoren in Verbindung mit Scheitholzvergaserkesseln förderfähig ist. Das Bundesamt für<br />
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) bietet hierzu umfangreiche Informationen.<br />
93
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Weitere Informationen im Internet:<br />
http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/biomasse/index.html<br />
Klimaschutzkonzepte<br />
Neben dem Marktanreizprogramm hat das BMU im Rahmen der Klimaschutzinitiative eine<br />
„Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzmaßnahmen in sozialen, kulturellen und öffentlichen<br />
Einrichtungen“. Im Rahmen dieser Richtlinie können Kommunen die Förderung von integrierten<br />
Klimaschutzkonzepten sowie eine beratende Begleitung für die Umsetzung beantragen.<br />
Weitere Informationen unter: http://www.fz-juelich.de/ptj/klimaschutzinitiative<br />
5.5.4 Leitthema Soziale und naturnahe Land- und Forstwirtschaft<br />
5.5.4.1 Ziel und Inhalt<br />
Im ursprünglichen Sinne umfasst das Thema „soziale Landwirtschaft“ die Erweiterung des<br />
Berufsfeldes um Themen aus dem sozialen Bereich, wie Alten-, Behinderten- oder<br />
Kinderbetreuung sowie Drogentherapie. Menschen mit unterschiedlichem Hilfebedarf oder<br />
Bedürfnissen werden in sogenannte „Grüne Bereiche“, wie Landwirtschaft, Naturschutz,<br />
Landschaftspflege oder Gartenbau eingebunden. „Ziele dieser Integration können Beschäftigung,<br />
Therapie und/oder Pädagogik sein.“ 57<br />
Ein wesentliches handlungsfelderübergreifendes Thema in der Region ist der demographische<br />
Wandel. Vor dem Hintergrund betont auch die Studie zum Integrierten Gesamtkonzept zur<br />
Entwicklung der ländlichen Räume Thüringens (2009) 58 , dass eine Sicherung des<br />
Berufsnachwuchses zu gewährleisten sei. Im Rahmen des <strong>ILEK</strong>s wird daher der Schwerpunkt des<br />
Leitthemas auf die Bildung und Ausbildung von Jugendlichen gelegt. Ziel ist es, Kindern und<br />
Jugendlichen der Region „Hohe Schrecke“ und umliegender Regionen grüne Berufe im Bereich<br />
Land- und Forstwirtschaft näher zu bringen. Den Kindern und Jugendlichen der Region sollen die<br />
aktuellen und historischen Techniken und Praktiken der Landnutzung erlebbar gemacht werden.<br />
Damit lässt sich eine enge Verknüpfung zum Handlungsfeld „Bildung und Kultur“ herstellen.<br />
Neben Projekten mit jungen Menschen der Region steht auch das Thema Integration von<br />
Menschen mit geistiger, seelischer oder körperlicher Beeinträchtigung in Blickpunkt. Über<br />
Projekte gemeinsam mit Schulen und Kindergärten kann dieses Leitthema über das bestehende<br />
Angebot weiter intensiviert und ausgebaut werden.<br />
57<br />
http://www.sofar-d.de/?sofar_dt, Stand 25.05.2009<br />
58<br />
Auweck GmbH (2008): Studie zum Integrierten Gesamtkonzept zur Entwicklung der ländlichen Räume<br />
Thüringens. Dezember 2008<br />
94
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Da das Thema der sozialen Landwirtschaft sich in Deutschland derzeit in einem sehr frühen<br />
Entwicklungsstadium befindet, kann überlegt werden, ob bereits in der Region bestehende<br />
Potentiale weiter ausgebaut werden können. In der Planungsregion ist für diesen Bereich mit der<br />
Markus-Gemeinschaft Hauteroda ein Best-practice-Beispiel vorhanden, an dem weiter<br />
angeknüpft werden kann.<br />
5.5.4.2 Projekte und Maßnahmen<br />
Projekte mit Grobkonzept<br />
„Lehrpfad Landwirtschaft“<br />
Auf den Feldern werden die aktuellen Fruchtarten mit Schildern gekennzeichnet und mit dem<br />
Hinweis versehen, wo Produkte daraus in der Region zu erwerben sind. Hier besteht eine enge<br />
Verknüpfung zum Leitthema „Regionale Produktvermarktung“. Die nächsten Schritte des Projekts<br />
sind einen Ansprechpartner und Koordinator zu finden, Landwirte zu werben, Schilder auf ihren<br />
Feldern aufzustellen sowie den Lehrpfad entsprechend bekannt zu machen und gemeinsam mit<br />
Schulklassen Touren durchzuführen. Dieses Projekt lässt sich gut in die gestartete Initiative<br />
„Umweltbildung in der Hohen Schrecke“ einfügen.<br />
Weitere Projektideen<br />
� verstärktes Angebot von (Sozial-)Praktika,<br />
� die „Mosterei vor Ort“,<br />
� historische Land- und Forstwirtschaft: ein Bildungsprojekt mit Kindern,<br />
� Verstärkung der Umweltbildung im Bereich der Forstwirtschaft.<br />
5.5.4.3 Fördermöglichkeiten<br />
Im Rahmen der „Förderung von unterrichtsbegleitenden und außerunterrichtlichen schulischen<br />
Maßnahmen an Thüringer Schulen“ durch das Kultusministerium können Umweltprojekte,<br />
Berufswahlprojekte sowie Projekte zur Integration und Toleranzförderung durchgeführt werden.<br />
Weitere Informationen im Internet:<br />
http://www.thueringen.de/de/tkm/bildung/foerderung/ausserschulischevorhaben/<br />
content.html<br />
95
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
5.6 Handlungsfeld „Siedlungsbau und IT-Infrastruktur“<br />
5.6.1 Entwicklungsziel<br />
Die gut erhaltenen, historisch gewachsenen und in die Landschaft eingebetteten<br />
Siedlungsstrukturen prägen entscheidend das attraktive Landschaftsbild im Umfeld der Hohen<br />
Schrecke. Die anhaltend negative demographische Entwicklung führt jedoch zunehmend zu<br />
Leerstand und Verfall gerade der historischen Bausubstanz in den Ortszentren. Brachflächen<br />
ehemaliger industriell-gewerblicher und landschaftlicher Betriebe schränken die Attraktivität des<br />
Landschaftsbildes ebenso ein. Aus dieser Problematik heraus wird folgendes Entwicklungsziel<br />
formuliert:<br />
Erhalt kompakter Siedlungen und Nutzung vorhandener Strukturen<br />
Im Hinblick auf die Erhaltung der Attraktivität und Funktionalität der Städte und Dörfer ist die<br />
Entwicklung der Innenbereiche sowie der Erhalt und die Nachnutzung der leerstehenden<br />
historischen Bausubstanz in den Ortszentren einer Neuausweisung von Wohngebieten am Rand<br />
der Siedlungen vorzuziehen. Vorhandene Strukturen sollten damit bei zukünftigen Planungen<br />
und Projekten genutzt und ortsuntypische Bebauungen wenn möglich vermieden werden.<br />
Industrie- und Gewerbebrachen am Rand der Siedlungen sollten entsiegelt, renaturiert und im<br />
Sinne der Aufwertung des Landschaftsbilds oder entsprechend der Ziele des <strong>ILEK</strong>s gestaltet<br />
und/oder je nach Bedarf nachgenutzt werden.<br />
5.6.2 Leitthema Erhaltung historischer Bausubstanz<br />
5.6.2.1 Ziel und Inhalt<br />
Die hohe Attraktivität und die Lebensfähigkeit der Städte und Dörfer kann nur durch behutsame<br />
Innenentwicklung erhalten werden. Hierzu ist die historische Bausubstanz unter Wahrung<br />
regionaler architektonischer Gegebenheiten zu sanieren und die Umnutzung historischer<br />
Gewerbegebäude wie Bahnhöfe, Gutshöfe anzustreben. Die Bewahrung der historischen<br />
Bausubstanz und die damit verbundene spezifische Attraktivität ist damit in engem Bezug zum<br />
Handlungsfeld Tourismus zu sehen.<br />
Vermarktung leer stehender Gebäude der Region<br />
Mit dem Autobahnanschluss Braunsroda erhält die Region besseren Anschluss an die Zentren<br />
Mittelthüringens und liegt damit im Pendlereinzugsgebiet von Weimar/Erfurt. Ziel sollte es sein,<br />
leerstehende Wohngebäude der Region zu vermarkten. Folgende Maßnahmen wurden hierzu<br />
benannt:<br />
� Einrichtung eines Immobilienportals „Hohe Schrecke“ als ein Baustein eines Internetauftritts<br />
„Hohe Schrecke“,<br />
� Gewinnung von Agenten für die Vermarktung von Gebäuden der Region.<br />
96
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
5.6.2.2 Projekte und Maßnahmen<br />
Die Themen Klimaschutz und Energieeffizienz haben eine Scharnierfunktion zwischen<br />
Naturschutz und Regionalentwicklung im Naturschutzgroßprojekt. Eine anteilige Förderung bei<br />
der energieeffzienten Sanierung bzw. Neubau von Gebäuden durch das Naturschutzgroßprojekt<br />
ist daher möglich.<br />
Die Förderung von Projekten zur Erhaltung historischer Bausubstanz kann auch über die RAG<br />
erfolgen. Hierzu ist die regionale Bedeutsamkeit des Vorhabens herauszuarbeiten und ggf. eine<br />
Bündelung von Einzelprojekten sinnvoll.<br />
Umsetzungsfähige Maßnahmen<br />
Sanierung des Pfarrhauses Altenbeichlingen (Maßnahmenblatt M 18)<br />
Ziel ist die Entwicklung eines Dorfgemeindezentrums in Verbindung mit der Wiederherstellung<br />
bzw. baulichen Neukonzeption des ehemaligen Pfarrhauses und der Umgestaltung des<br />
dazugehörigen Grundstückes zu einer öffentlich genutzten Gesamtanlage. Die Maßnahme<br />
gliedert sich ein in das Leitprojekt 5 der RAG Kyffhäuser: „Sanierung und Nachnutzung zentraler<br />
Gebäude im Innenbereich gewachsener Siedlungen“, Unterpunkt: „Sanierung von Pfarrhäusern<br />
in der Superintendatur“ (s.a. Maßnahmeblatt im Anhang)<br />
� Weitere Maßnahmen, die das Leitthema Erhalt historischer Bausubstanz unterstützen, aber<br />
aufgrund der thematischen Ausrichtung in das folgenden Handlungsfelder/Leitthemen<br />
eingeordnet sind:<br />
� Handlungsfeld Tourismus/Erholung/Landschaft, Leitthema Touristische Infrastruktur und<br />
Angebote<br />
� Wanderherberge und Mühlencafé Gehofen (siehe Maßnahmenblatt im Anhang)<br />
� Tourismusstützpunkt Gutshof Braunsroda (siehe Maßnahmenblatt im Anhang)<br />
� Handlungsfeld Bildung und Kultur, Leitthema Angebote in der Umweltbildung<br />
� Haus auf dem Berge (siehe Maßnahmenblatt im Anhang)<br />
� Naturhaus Garnbach – Thepra Umweltbildungsstätte (siehe Maßnahmenblatt im<br />
Anhang)<br />
Weitere Projektideen<br />
� Bahnhof Donndorf: Erhaltung und Umnutzung des denkmalgeschützten Bahnhofgebäudes<br />
Donndorf<br />
� Ostramondra: Entwicklung des Gebäudeensembles Schloss, Schlossteich, Landgut,<br />
Paulsteich und St. Marien Kirche; Maßnahmen: Sanierung der Teiche, Sanierung und<br />
Nachnutzung des Schlosses, Sanierung von Teilen des Gutshofes. Ostramondra ist aktuell<br />
Schwerpunkt der Dorferneuerung, Förderung des Vorhabens wäre über DE – „naturnaher<br />
Umbau“ möglich; Antragstellung bei der RAG ist möglich.<br />
97
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
� Ostramondra: Sanierung und Nachnutzung des Gutshofes „Weißbarthaus“, teilw. DE-<br />
Maßnahmen (Dacherneuerung), geplant ist die Einrichtung eines Heimatmuseums durch den<br />
Heimatverein mit dem Thema „ Ländliches Leben um 1900“ (traditionell eingerichtetes<br />
Wohnhaus, alte Druck- und Landmaschinen), Veranstaltungen: Waschfest, Dreschfest.<br />
Partner z.B. im Bereich Umweltbildung in der Region werden gesucht!<br />
� Beichlingen: Sanierung des Dorfteiches<br />
� Bonifatius-Kirche Altenbeichlingen: Sicherung und Dachsanierung. Projektträger:<br />
Kirchgemeinde Kölleda, Ansprechpartner: Fr. Ute Wagner (ev. Kirchgemeinde<br />
Altenbeichlingen),<br />
� Erhalt der alten Ziegelei Gehofen. Ziele: Sanierung der alten Ziegelei und Einbindung in<br />
touristisches Angebot (Industriekultur) der Region, Ansprechpartner: Bürgermeister der<br />
Gemeinde Gehofen,<br />
� Umbau des alten Kulturhauses in Hauteroda, Umnutzung des großen Saals zu Einzel- und<br />
Gruppenzimmern mit DU/WC auf den Fluren, Frühstücks- und Begegnungsraum. Ziele:<br />
Erhaltung eines ehemaligen das Ortsbild prägenden historischen Schulgebäudes,<br />
Erweiterung des Angebots an Übernachtungsmöglichkeiten für Aktivtouristen,<br />
� Sanierung der alten Holländermühle im Norden von Hauteroda, Einrichtung eines Museums<br />
zur Geschichte des Helderbachtals und der Gemeinde Hauteroda sowie als Wanderer- und<br />
Bikertreff. Ziele: Erhaltung historischer Bausubstanz, Vermittlung von Heimatgeschichte,<br />
Verbesserung der touristischen Infrastruktur für Wanderer an der Südseite der Hohen<br />
Schrecke<br />
� Gutshof Braunsroda: Sicherung des „Futterturms“, Nutzung als Ferienwohnung geplant<br />
� Gutshof Braunsroda: Sanierung des östlichen Wohnflügels in Fachwerkbauweise,<br />
Nachnutzung als Ferienwohnungen möglich<br />
� Gutshof Braunsroda: Ausbau der Kapelle zu einer Autobahnkirche<br />
� Bürgerwerkstatt und Bürgercafé <strong>Wiehe</strong> – Nachnutzung eines leerstehenden Gebäudes,<br />
Umsetzung im Rahmen des Leitprojekts 6 der RAG Kyffhäuser: „ Anpassung der sozialen und<br />
technischen Infrastruktur an die Bedingungen des demographischen Wandels“<br />
� Umsetzung der Dorferneuerungsmaßnahme in <strong>Wiehe</strong> OT Garnbach ab 2010<br />
� <strong>Stadt</strong>- und Dorfentwicklung zur Beseitigung städtebaulicher Missstände in <strong>Wiehe</strong>:<br />
Verbesserung innerörtlicher Verkehrsverhältnisse, Sanierung örtlicher Gewässer, Begrünung,<br />
Gestaltung der innerörtlichen Plätze und des Wohnumfelds, Umnutzung/Beräumung<br />
leerstehender und funktionsloser Gebäude sowie Sanierung, Modernisierung und Gestaltung<br />
von innerörtlichen Baustrukturen; Erhaltung und Sanierung des historischen Ortskerns für die<br />
touristische Entwicklung, touristische Umnutzung vorhandener Gebäude<br />
� Schloss mit Schlosspark <strong>Wiehe</strong>: Fortführung der Sicherungsmaßnahmen, der etappenweise<br />
Ausbau des Schlossgebäudes mit dem Ziel der Einrichtung eines<br />
Umweltinformationszentrums, <strong>Entwicklungskonzept</strong> zum Schloss und Planung zur Sanierung<br />
98
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
und Gestaltung der Teichanlagen besteht (siehe auch Leitthema: Touristische Infrastruktur<br />
und Angebote)<br />
� <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>, OT Langenroda: Nutzung von Gebäuden in historischer Ortslage für<br />
Übernachtungen, Ziel: Erhalt des historischen Ortsbilds und Reduzierung des Ausbaus einer<br />
Bungalowanlage<br />
5.6.2.3 Fördermöglichkeiten<br />
� Städtebauförderung in förmlich festgelegten innerstädtischen Sanierungsgebieten in <strong>Wiehe</strong><br />
und Heldrungen<br />
� Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung, Förderbereiche Dorferneuerung und<br />
ländliche Infrastruktur<br />
� Mittel der Denkmalpflege<br />
99
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
5.6.3 Leitthema Brachflächenrevitalisierung<br />
5.6.3.1 Ziele und Inhalt<br />
Der wirtschaftliche Schrumpfungsprozess hat dazu geführt, dass in der Planungsregion für einige<br />
der festgestellten Brachflächen eine bauliche Nachnutzung nicht mehr bedarfsgerecht ist.<br />
Gerade vor dem Hintergrund der Entwicklung der Region Hohe Schrecke als Erholungs- und<br />
Tourismusregion können durch eine Renaturierung der Brachflächen das Orts- und<br />
Landschaftsbild erheblich aufgewertet und Nachnutzungspotentiale für den Tourismus<br />
erschlossen werden. Hierzu müssen für bestehende Brachflächen Revitalisierungskonzepte<br />
erstellt, Flächen entsiegelt und nicht mehr nutzbare Gebäude abgerissen werden. Sollen die<br />
Flächen nachgenutzt werden oder befinden sie sich in Bereichen, die für das Orts- oder<br />
Landschaftsbild sensibel sind, sind für diese Flächen Gestaltungs- und Nachnutzungskonzepte<br />
zu erstellen.<br />
Vorteile bei der Brachflächenrevitalisierung könnten für Vorhabenträger und Kommunen<br />
entstehen, wenn die Förderung über die Revitalisierungsrichtlinie mit Ausgleichs- und<br />
Ersatzmaßnahmen kombiniert würden. Hierdurch könnten sowohl die Kosten als auch die<br />
benötigten Eigenmittel für den privaten Vorhabenträger reduziert werden. Weiterhin könnten<br />
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eingriffsnah erfolgen. Hierzu bedarf es aber einer klaren<br />
Trennung der geförderten Flächen und einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Kommunen<br />
und Privatakteuren. Daher sollten von Beginn an die Maßnahmen formal strikt voneinander<br />
getrennt sein. 59<br />
5.6.3.2 Projekte und Maßnahmen<br />
Umsetzungsfähige Maßnahmen<br />
� Revitalisierungskonzept Kiesseen <strong>Wiehe</strong> – (Maßnahmenblatt M 12)<br />
� Revitalisierung des Geländes alte Möbelfabrik „Möbia“ – (Maßnahmenblatt M 13)<br />
Weitere Projektideen<br />
� Abriss und Rekultivierung der alten Schuhfabrik an den Kiesseen in <strong>Wiehe</strong> als Teilprojekt des<br />
"Renaturierungskonzeptes Kiesseen <strong>Wiehe</strong>“, Projektträger <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>, Antragstellung über<br />
RAG Kyffhäuser möglich, Förderung über „FR Revitalisierung“ möglich,<br />
� Förderung von Kleingewerbe und Handwerk auf Nutzungsbrachen oder in ungenutzten<br />
Gebäuden.<br />
5.6.3.3 Fördermöglichkeiten<br />
Der Freistaat Thüringen fördert über die „FR Revitalisierung“ (gültig bis 31.12.2013) die<br />
Bereitstellung brach gefallener Flächen zur Nachnutzung. Ziele sind die Verbesserung der<br />
59 Auskunft ALF Gotha<br />
100
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Umweltqualität, die Nachnutzung brach liegender Flächen im Siedlungszusammenhang und die<br />
Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vorrangig in ländlichen Regionen und<br />
Gemeinden, die durch Umweltschäden geprägt sind.<br />
Antragsteller können kommunale Gebietskörperschaften oder deren Zusammenschlüsse sein, in<br />
erheblichem öffentlichen Interesse aber auch natürliche Personen, Personengesellschaften und<br />
juristische Personen des privaten Rechts. Gefördert werden u. a. Maßnahmen wie: Rückbau,<br />
Abriss und Entsorgung, Bauausgaben und investive Ausgaben und Aufwendungen nach HOAI.<br />
Anträge werden beim Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung gestellt. Die Antragstellung<br />
zur Revitalisierung von Brachflächen erfolgt hierbei zwingend über die jeweilige RAG.<br />
Grundsätzlich können für die Revitalisierung auch folgende Finanzierungsmöglichkeiten in<br />
Betracht gezogen werden:<br />
Tabelle 19: Finanzierungsmöglichkeiten für die Revitalisierung<br />
TMBV Thüringer Städtebauförderrichtlinie<br />
TMBV Wohnungsbauförderung<br />
TMK Denkmalförderrichtlinie<br />
TMWTA Richtlinie strukturwirksame Beschäftigungsprojekte<br />
TMWTA GA-Richtlinie „Verbesserung der regionalen<br />
Wirtschaftsstruktur“ (GRW)<br />
TMWTA Landesprogramm Fremdenverkehr<br />
TMLNU Richtlinie Revitalisierung<br />
TMLNU Richtlinie integrierte ländliche Entwicklung,<br />
Förderbereich Dorferneuerung<br />
Darüber hinaus können folgende Mittel eingesetzt werden:<br />
� Thüringer Umweltstiftung, Kreditinstitute, Unternehmen und Stiftungen,<br />
� Renaturierung über Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,<br />
� Eigenleistung durch Nutzer,<br />
� Verwertung über Auktionen oder Ausschreibungen,<br />
� Verkauf von Brachflächen an Investoren.<br />
Eine kurze und prägnante Übersicht zu diesen Verfahren liefert auch die Broschüre:<br />
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (2008): Brachflächen? Revitalisiert! Erfurt.<br />
101
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
5.6.4 Leitthema Ausbau der Breitbandtechnologie<br />
5.6.4.1 Ziel und Inhalt<br />
Als Entwicklungsziel für dieses Leitthema wurde eine Versorgung aller Gemeinden im<br />
Planungsgebiet mit schnellen Internetanschlüssen (Breitband) formuliert. Ein schneller<br />
Internetanschluss ist für viele Branchen eine Voraussetzung zur Abwicklung ihrer<br />
Geschäftsprozesse. Aber auch vor dem Hintergrund der negativen Bevölkerungsentwicklung<br />
stellt die Versorgung der Haushalte einen wichtigen Attraktivitätsfaktor für jüngere und<br />
berufstätige Bevölkerungsschichten dar, die das Internet alltäglich nutzen. 60<br />
Eine flächendeckende Versorgung mit Breitband-Infrastruktur bildet auch die Grundlage für die<br />
Realisierung weiterer Ziele des <strong>ILEK</strong>, wie z.B. die Einrichtung einer regionalen<br />
Informationsplattform im Internet oder die Einrichtung einer regionalen Immobilienbörse.<br />
In Gesprächen und den Arbeitsgruppen wurde der Bedarf an grundlegenden Informationen zu<br />
diesem Leitthema geäußert. Das <strong>ILEK</strong> setzt daher zunächst an diesem Punkt an.<br />
Informationsbedarf wurde insbesondere geäußert zu:<br />
� Modalitäten der Antragstellung und Förderung,<br />
� Beratung durch Experten,<br />
� Wissen zu technischen Aspekten,<br />
� Ansprechpartner auf Ebenen der Politik, Verwaltung und der Versorger.<br />
5.6.4.2 Informations-, Beratungs- und Fördermöglichkeiten<br />
Breitbandinitiative „Thüringen Online“ 61<br />
Die Thüringer Landesregierung hat unter Führung des Thüringer Wirtschaftsministeriums<br />
gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft, Verbänden und Infrastrukturanbietern im Jahr 2008 die<br />
Breitbandinitiative „Thüringen Online“ ins Leben gerufen. Das Ziel ist eine möglichst<br />
flächendeckende Versorgung von Gemeinden, deren Ausbau sich für den Markt langfristig als<br />
nicht rentabel herausstellt. Ziel ist u. a. die Vermittlung zwischen den Anbietern für<br />
Breitbandtechnologien und den Nachfragegruppen.<br />
Leistungen:<br />
60 Das Leitthema gliedert sich damit ein in das Leitprojekt 6 der RAG Kyffhäuser: „Anpassung der sozialen<br />
und technischen Infrastruktur an die Bedingungen des demographischen Wandels“<br />
61 http://www.thueringen.de/de/tmwta/technologie/breitbandinitiative/<br />
102
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
� Information über Breitbandtechnologien u.a. zu DSL, UMTS, Funk, Glasfaser und deren<br />
Realisierungsmöglichkeiten,<br />
� Erhebung und Zusammenführung von Angebot und Nachfrage in Zusammenarbeit mit<br />
kommunalen Spitzenverbänden, Kammern und Verbänden der Wirtschaft,<br />
� Beratung und Hilfestellung für Kommunen,<br />
� Kommunikation von Best-Practice-Beispielen,<br />
� Förderung des Breitband-Ausbaus in den Fällen, in denen keine wirtschaftliche Erschließung<br />
möglich ist,<br />
� Vermittlung von Ansprechpartnern.<br />
Breitbandbedarfsatlas 62<br />
Im Jahr 2008 wurden zwei Befragungen zur Erstellung eines aussagekräftigen<br />
Breitbandbedarfsatlas vom Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit<br />
gemeinsam mit dem Thüringer Gemeinde- und Städtebund bei allen Thüringer<br />
Gebietskörperschaften initiiert, die den Bedarf an Breitband-Anschlüssen in den einzelnen<br />
Städten und Gemeinden erfassen sollte.<br />
Der Breitbandbedarfsatlas soll die Anbieter dabei unterstützen, auf den jeweiligen Bedarf in den<br />
Gemeinden konkrete Angebote zu entwickeln. Dabei sind die Städte und Gemeinden auf die<br />
Mitarbeit aller Bürger angewiesen, die einen Breitbandanschluss oder für einen vorhandenen<br />
Anschluss eine höhere Bandbreite benötigen.<br />
62<br />
http://www.thueringen.de/de/tmwta/technologie/breitbandinitiative/angebot%5Fnachfrage/erhebung%5<br />
Fbedarf/<br />
103
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Breitbandangebotsatlas: 63<br />
In einem sogenannten Breitbandangebotsatlas sind alle Breitbandanbieter mit verschiedenen<br />
technischen Lösungen und ihrer jeweiligen Netzabdeckung kartographisch hinterlegt.<br />
Ansprechpartner für Information und Beratung:<br />
Hr. Kaßbohm<br />
Referatsleiter Technologiestiftungen, Telekommunikation, Post und Medien<br />
Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit<br />
Tel. 0361/3797541<br />
Email: breitbandinitiative@thueringen-online.de<br />
Breitbandkompetenzzentrum Thüringen und Breitbandpaten 64<br />
Das Breitbandkompetenzzentrum Thüringen, ist eine Projektgruppe, die seit Juli 2009 bei der<br />
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen angesiedelt ist. Das Breitbandkompetenzzentrum hat<br />
eine Hotline eingerichtet: [0361] 5 603-306.<br />
Fragen an das Breitbandkompetenzzentrum Thüringen können auch per e-Mail gesendet werden:<br />
breitbandkompetenzzentrum@thueringen-online.de<br />
Das Breitbandkompetenzzentrum richtet derzeit gemeinsam mit den Landkreisen die<br />
"Breitbandpaten" bei allen Landkreisen des Freistaats ein. Die "Breitbandpaten" werden die<br />
zentralen Ansprechpartner für Investoren und Kommunen bzgl. aller Fragen rund um den<br />
Breitbandinfrastrukturausbau sein. Sie werden die Städte und Gemeinden auch organisatorisch<br />
unterstützen, indem sie z. B. die Interessenbekundungsverfahren zentral bündeln.<br />
Für die Gemeinden des Landkreises Kyffhäuserkreis ist der Ansprechpartner: Herr Lippold, Amt<br />
für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kreisentwicklung, Tel. 03632741-625.<br />
Für die Gemeinden des Landkreises Sömmerda ist lt. Homepage der Breitbandinitiative<br />
„Thüringen Online“ noch kein Breitbandpate als Ansprechpartner vorhanden.<br />
63<br />
http://www.thueringen.de/de/tmwta/technologie/breitbandinitiative/angebot%5Fnachfrage/erhebung%5<br />
Fangebot/<br />
64 http://www.thueringen.de/de/tmwta/technologie/breitbandinitiative/ansprechpartner/<br />
104
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Praxisbeispiel Ausbau mit WLAN-Richtfunktechnik in Ostramondra und Bachra<br />
Ostramondra und OT Bachra (<strong>Stadt</strong> Rastenberg): WLAN-Richtfunktechnik von AVACOMM<br />
Systems 65<br />
Die Versorgung von Bachra und Ostramondra erfolgt über den Masten in Ostramondra. Die<br />
Kirchen werden vorerst nicht belegt. Die Fa. Erhard Schmidt Elektroanlagen wird beim Aufbau<br />
unentgeltlich mitwirken und wird später die Wartung des Netzes und den Kundensupport<br />
übernehmen. Mit Hilfe der Gemeinde werden die Masten an den Wasserbehältern Ostramondra<br />
und Backleben montiert und gesetzt. Für den Einspeisestandort ist noch die Genehmigung des<br />
Denkmalschutzes einzuholen. Sobald die technischen und organisatorischen Voraussetzungen<br />
geschaffen sind und genügend Bestellungen vorliegen wird die AVACOMM mit dem Aufbau<br />
beginnen. Der eigentliche Netzaufbau dauert ca. 6 Tage.<br />
Für die Aufschaltung eines WLAN-Richtfunkmoduls sind mind. 20 Anmeldungen potentieller<br />
Nutzer nötig.<br />
5.6.4.3 Fördermöglichkeiten<br />
Richtlinie „FR Breitbandversorgung ländlicher Räume“<br />
Die Förderung des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur ist in Thüringen nach der Richtlinie<br />
„Förderung der Breitbandversorgung ländlicher Räume“ (v. 07.09.2009) bis 31.12.2010 möglich. 66<br />
Zuwendungszweck: Schaffung einer Breitbandinfrastruktur in unterversorgten ländlichen<br />
Gebieten ermöglichen um damit insbesondere land- und forstwirtschaftliche Unternehmen in<br />
ihrer Wettbewerbsfähigkeit (Agrarstrukturbezug) zu stärken.<br />
Förderfähig sind Zuschüsse der Zuwendungsempfänger (Gemeinden und Gemeindeverbände bis<br />
10.000 EW) an private oder kommunale Netzbetreiber zur Schließung der<br />
Wirtschaftlichkeitslücke – also der Fehlbetrag zwischen Investitionskosten und<br />
Wirtschaftlichkeitsschwelle – bei Investitionen in leitungsgebundene (Verlegung oder<br />
Verbesserung der erforderlichen Einrichtungen einschließlich der Verteilereinrichtungen) oder<br />
funkbasierte (Errichtung der technischen Netzinfrastrukturelemente einschl. des Sendemastes)<br />
Breitbandnetze. Förderfähig sind auch die Verlegung von Leerrohren,<br />
Machbarkeitsuntersuchungen, die der Vorbereitung der oben genannten Maßnahmen dienen.<br />
Die Förderung erfolgt über das TMLNU. Gemeinden und Gemeindeverbände bis 10.000 Einwohner<br />
können Anträge bei den Ämtern für Landentwicklung und Flurneuordnung (Antrags- und<br />
65<br />
http://www.avacomm24.de/pageID_6965702.html, Stand 22.4.2009, weitere Ausbauprojekte finden in<br />
Vaterstetten und Irschenberg statt.<br />
66 http://www.thueringen.de/de/landentwicklung/aufgaben/entwicklung/breitbandversorgung/<br />
105
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Bewilligungsstelle, förmliche Prüfung der Anträge und des Agrarstrukturbezugs) stellen.<br />
Technische Prüfbehörde ist das MWTA.<br />
Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Der Eigenanteil<br />
der Gemeinden beträgt mindestens 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Zuwendungen<br />
werden zwischen 10.000 € und über 75.000 € für Investitionen und zwischen 1.000 € und<br />
50.000 € für Machbarkeitsstudien gewährt.<br />
Die Zuwendungsvoraussetzungen beinhalten u. a. folgende Aspekte:<br />
� Nachweis der fehlenden oder unzureichenden Breitbandversorgung in der Gemarkung der<br />
Gemeinde:<br />
� Erfassung der gewerblichen, kommunalen und privaten Breitbandanschlüsse,<br />
Achtung Agrarstrukturbezug muss deutlich sein!<br />
� Abfrage relevanter Versorger im und in den angrenzenden Landkreisen, ob<br />
Gemeinde in der mittelfristigen Ausbauplanung der Telekom sind (wenn ja, dann<br />
keine Förderung),<br />
� Bedarfsermittlung: Darstellung des ermittelten und prognostizierten Bedarfs an<br />
Breitbandanschlüssen unter Beachtung der Ausbaupläne der Netzbetreiber,<br />
� Interessenbekundungs-/Bieterermittlungsverfahren: Durchführung eines offenen und<br />
transparenten Verfahrens zur Auswahl des Netzbetreibers.<br />
Ansprechpartner für die Förderung:<br />
Herr Dr. A. Lötsch<br />
Referatsleiter Integrierte Ländliche Entwicklung<br />
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Natur und Umweltschutz<br />
Tel.: 0361/3799736<br />
Email: breitbandfoerderung@thueringen-online.de<br />
Herr Köppe<br />
Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Gotha<br />
Tel.: 03621 /358289<br />
5.7 Handlungsfeld „Bildung und Kultur“<br />
5.7.1 Entwicklungsziel<br />
Das ursprünglich im Rahmen des Regionalforums formulierte Entwicklungsziel „Dezentrale<br />
Konzentration der Versorgungseinrichtungen und Funktionsteilung der Gemeinden“ wurde als<br />
Ergebnis der Diskussionen in den Arbeitsgruppen nicht weitergeführt. Das Leitthema „Integrierte<br />
106
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Dorfgemeinschaftseinrichtungen“ wurde aufgrund der erkannten geringen Relevanz im Zuge der<br />
Arbeitsgruppe im April 2009 seitens der Akteure gestrichen. In der Folge verlagert sich der<br />
Schwerpunkt dieses Handlungsfelds auf das Thema „Entwicklung und Abstimmung von<br />
Bildungsangeboten“ im Bereich Umweltbildung sowie der beruflichen Aus- und Weiterbildung.<br />
Für das Handlungsfeld wurde daher das folgende Entwicklungsziel erarbeitet.<br />
Vorläufiges Entwicklungsziel: Entwicklung und Abstimmung von Bildungsangeboten<br />
5.7.2 Leitthema Angebote in der Umweltbildung<br />
5.7.2.1 Ziel und Inhalt<br />
Die Qualität an Bildungsangeboten ist ein wichtiger Faktor für die Entscheidung von Familien und<br />
Unternehmen bei der Wahl ihres Lebensmittelpunktes oder Unternehmensstandorts. Die<br />
schulischen und außerschulischen Anbieter von Umweltbildung in der Region „Hohe Schrecke“<br />
können mit der hervorragenden naturräumlichen Ausstattung, der vorhandenen<br />
kulturhistorischen Objekte, geschichtsträchtigen Themen auf entwicklungsfähige Potentiale der<br />
Region zurückgreifen. Durch den Ausbau und die Vernetzung von Angeboten in der<br />
Umweltbildung für Kinder und Jugendliche ließe sich eine Steigerung der Qualität des<br />
schulischen und außerschulischen Bildungsangebots, ein stärkerer Regionsbezug der Bildung<br />
und eine Profilierung der Region innerhalb der „Thüringer Bildungslandschaft“ erreichen.<br />
Aufgrund der prognostizierten schrumpfenden Schülerzahlen ist eine verstärkte Konkurrenz der<br />
Schulstandorte zu erwarten. Vor dem Hintergrund der fertig gestellten Autobahnanbindung der A<br />
71 könnte mit einer entsprechenden Profilierung des schulischen Bildungsangebots im Bereich<br />
der Umweltbildung auch die Attraktivität der Region als Wohnort für Familien aus den städtischen<br />
Zentren gesteigert werden. Umweltbildungsangebote mit regionalem Bezug können die<br />
Verbundenheit mit der Region und das Verständnis für ländliche Lebensweise stärken. Der<br />
Einbezug land- und forstwirtschaftlicher Themen zeigt Schulkindern bereits berufliche<br />
Perspektiven auf. Die bestehenden Angebote im schulischen Bereich gilt es somit zu sichern und<br />
im Bereich der Umweltbildung zu erweitern.<br />
Die Bestandsanalyse hat gezeigt, dass die Bildungsanbieter (Schulen), Behörden (z.B. Forstamt)<br />
und Unternehmen (z.B. landwirtschaftliche Betriebe) beiderseits der Hohen Schrecke noch wenig<br />
miteinander vernetzt sind. Umweltbildung erfolgt somit meistens mit lokalem Bezug. Eine<br />
gegenseitige Information und Vernetzung bestehender Anbieter kann jedoch zu neuen und sich<br />
ergänzenden Angeboten führen. Gespräche mit Akteuren zeigen, dass hierzu aktuell<br />
Vernetzungsbedarf besteht.<br />
Dabei sollten die Jugendherbergen in Heldrungen und Beichlingen mit jeweils mehreren 10.000<br />
Übernachtungen pro Jahr als etablierte Lernorte „Geschichte“ und „Natur“ als Partner für die<br />
Entwicklung von Angeboten gewonnen werden. Die Jugendherberge in Beichlingen gestaltet<br />
derzeit ihr Konzept als Lernort „Natur“ aus. Hier bestehen konkrete Anknüpfungspunkte für eine<br />
107
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
gezielte Ausrichtung der Umweltbildungsaktivitäten der Hohen Schrecke, die in Kooperation mit<br />
weiteren Partnern durchgeführt werden könnten.<br />
5.7.2.2 Projekte und Maßnahmen<br />
Umsetzungsfähige Maßnahmen<br />
Netzwerkinitiative Umweltbildung in der Hohen Schrecke (Maßnahmenblatt M 14)<br />
Als zukunftsträchtiges Vorhaben hat sich Mitte August 2009 aus der begonnenen Diskussion im<br />
Rahmen des <strong>ILEK</strong> heraus die Netzwerkinitiative „Umweltbildung in der Hohen Schrecke“<br />
gegründet. Akteure aus verschiedenen Handlungsbereichen wie Forstwirtschaft, Landwirtschaft,<br />
schulische Bildung, Erwachsenenbildung oder Großschutzgebiet haben sich erstmalig<br />
zusammengefunden, um Potentiale für Umweltbildungsprojekte mit Bezug zur Hohen Schrecke<br />
zu bestimmen. Insbesondere in Verknüpfung mit dem Naturschutzgroßprojekt wird<br />
Umweltbildung zu einem relevanten Thema der Regionalentwicklung werden. In Verbindung mit<br />
der Entwicklung eines naturbezogenen Tourismus erschließen sich weitere Potentiale für einen<br />
„Umweltbildungstourismus“.<br />
Ziele der Netzwerkinitiative sind daher:<br />
� Zusammenbringen<br />
Handlungsebenen<br />
von Akteuren unterschiedlichster Handlungsbereiche und<br />
� konzeptionelle Entwicklung einer integrierten Umweltbildung im Sinne des Leitbilds „Hohe<br />
Schrecke – Alter Wald mit Zukunft“<br />
� Entwicklung und Austausch von Projektideen über Sektorengrenzen hinaus (z. B.<br />
Verknüpfung mit Landwirtschaft, Tourismus und Geschichte)<br />
� Knüpfen von Kontakten und Initiierung von Kooperationen<br />
� Gemeinsame Aktivierung personeller und finanzieller Ressourcen für<br />
Umweltbildungsvorhaben.<br />
Weitere Informationen zum Netzwerk enthält das Maßnahmenblatt im Anhang.<br />
Weitere umsetzungsfähige Maßnahmen im Bereich Umweltbildung sind:<br />
� Neubau der Grund- und Regelschule zwischen Oberheldrungen und Oldisleben<br />
(Maßnahmenblatt M 16),<br />
� Naturhaus Garnbach, Thepra e.V. (Maßnahmenblatt M 17)<br />
� Grünes Klassenzimmer auf dem Kirschberg Oberheldrungen (Maßnahmenblatt M 15)<br />
Weitere Projektideen<br />
� Sanierung des Naturlehrpfades am Kloster Donndorf,<br />
� Neue St.-Peter- und Pauls-Kirche in Donndorf – Informationen zur Geschichte,<br />
108
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
� Sanierung des Naturlehrpfads im Kuckuckswäldchen (Projektträger <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> und<br />
möglicher Kooperationspartner Forstamt Oldisleben, Ansprechpartner Revierleiter Herr<br />
Schenke),<br />
� Entwicklung von Maßnahmen zur Umweltbildung, Einrichtung einer Projektstelle zur Planung<br />
und Organisation von Umweltbildungsmaßnahmen, Projektträger: Ländliche<br />
Heimvollkshochschule Donndorf, Ansprechpartner: Hr. Brombacher (Leiter der Ländlichen<br />
Heimvolkshochschule Donndorf),<br />
� ehemaliger Steinbruch Garnbach: Entwicklung von Bildungs- und Ausbildungsangeboten im<br />
Bereich Kunst und Natur,<br />
� Einrichtung eines Waldinformationsszentrums im Schloss <strong>Wiehe</strong> (siehe Maßnahmenblatt M<br />
19).<br />
� Kräuterseminare in Langenroda (siehe Maßnahmenblatt M 21)<br />
5.7.2.3 Fördermöglichkeiten<br />
Richtlinie zur Förderung der Nachhaltigen Entwicklung in Thüringen, in Kraft seit 01.11.2007<br />
bis 31.12.2015.<br />
Es werden Maßnahmen im Sinne der Agenda 21 in folgenden Bereichen gefördert:<br />
� nachhaltiges Wirtschaften, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Lokale Agenda 21,<br />
Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sowie Energieeffizienz und<br />
Ressourcenschonung.<br />
Richtlinie zur Förderung von Projekten und Maßnahmen zur Bildung für Nachhaltigkeit und<br />
handlungsorientierte Umweltbildung im Freistaat Thüringen, in Kraft seit 01.01.2003.<br />
Gefördert werden Projekte und Maßnahmen:<br />
� zur Vermittlung von Wissen über Nachhaltigkeit unter Einbeziehung breiter<br />
Bevölkerungsschichten,<br />
� zur praktischen Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung,<br />
� Stärkung der örtlichen oder regionalen Entwicklung im Rahmen von Kooperationen von<br />
Umweltverbänden/-vereinen und/oder Kommunen,<br />
� zur Qualifizierung haupt- oder ehrenamtlich Tätiger in der Umweltbildung,<br />
� zur Qualitätssicherung der Arbeit in Umweltbildungseinrichtungen sowie von gemeinnützigen<br />
Vereinen und Verbänden in der Bildung für Nachhaltigkeit.<br />
Vorrangig werden Projekte und Maßnahmen im außerschulischen und nichtberuflichen Bereich<br />
gefördert. Zuwendungsempfänger können sein: gemeinnützige Verbände und Vereine, kirchliche<br />
Einrichtungen, Gebietskörperschaften und deren Zusammenschlüsse mit Sitz in Thüringen. Der<br />
Fördersatz beträgt in der Regel 50% der zuwendungsfähigen Ausgaben, in Ausnahmen bis 80%.<br />
Förderfähig sind:<br />
109
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
� Ausgaben für Beschaffung oder Einsatz von Arbeitsmitteln oder Material zur praktischen<br />
Umsetzung von Bildungsprojekten zur Nachhaltigkeit und der handlungsorientierten<br />
Umweltbildung (z.B. Geräte, Pflanzgut),<br />
� Ausgaben, die für die Durchführung von Bildungsmaßnahmen erforderlich sind (z.B.<br />
Materialien zur Anfertigung von Informationsträgern, Publikationen, Unterrichts- und<br />
Anschauungsmaterial, für Errichtung und Gestaltung von Anschauungsobjekten),<br />
� Ausgaben für Mieten, Pachten oder Versicherungen,<br />
� Ausgaben für Honorare von Referenten, Moderatoren, für Reisekosten, Tage- und<br />
Übernachtungsgelder, sächliche Verwaltungsausgaben.<br />
Das Thema Klimaschutz und Energieeffizienz hat darüber hinaus eine Scharnierfunktion<br />
zwischen Naturschutz und Regionalentwicklung im Naturschutzgroßprojekt. Eine anteilige<br />
Förderung bei der energieeffzienten Sanierung bzw. Neubau von Gebäuden durch das<br />
Naturschutzgroßprojekt ist daher möglich.<br />
5.7.3 Leitthema Angebote in der beruflichen Aus- und Weiterbildung<br />
5.7.3.1 Ziele und Inhalt<br />
Das Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die auf die Bedarfe der regionalen<br />
Wirtschaft abgestimmt sind und potentielle Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen, ist ein<br />
wichtiger Faktor für die Wahl des Lebensmittelpunktes. Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wie<br />
zertifizierte Natur- und Landschaftsführer oder Servicekräfte im Tourismus setzen direkt an den<br />
regionalen Entwicklungszielen an, schaffen die Voraussetzungen für einen qualitativ<br />
hochwertigen sanften Tourismus und qualifiziert Menschen in der Region auf eine zukünftige<br />
Tätigkeit in diesen Bereichen. Damit wird ein Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels und<br />
zur Erreichung des Leitziels der regionalen Entwicklungsstrategie geleistet.<br />
110
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
5.7.3.2 Projekte und Maßnahmen<br />
Maßnahmen mit Grobkonzept<br />
Zertifizierter Natur- und Landschaftsführer (ZNL) für die Region Hohe Schrecke<br />
Die Ausbildung von Natur- und Landschaftsführern dient vorwiegend der Qualifizierung der<br />
Akteure und der Vernetzung mit den benachbarten Naturparken sowie dem Ausbau der Angebote<br />
in der Umweltbildung und der touristischen Dienstleistungsangebote in der Region. Nach den<br />
Vorgaben des „Bundesweiten Arbeitskreises der staatlich getragenen Umweltbildungsstätten“<br />
(BANU) kann eine Ausbildung in den Bereichen Naturkundliche Grundlagen, Kommunikation und<br />
Führungsdidaktik, sowie Recht und Marketing erfolgen.<br />
Der BANU schreibt hierfür eine Kurswoche sowie zwei Wochenenden vor. Ein Kontakt zur<br />
Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie besteht seitens der Naturstiftung David. Die<br />
TLUG kann die Fortbildung und Hospitanz der zertifizierten Natur- und Landschaftsführer<br />
gewährleisten.<br />
Neben der Grundausbildung zum ZNL ist die Integration weiterer regional spezifischer Bausteine<br />
nötig, um die Attraktivität des Ausbildungsganges zu erhöhen, die Besonderheiten der Region zu<br />
den Gästen zu transportieren, und kompetente Führer und Ansprechpartner mit Kenntnis der<br />
regionalen Strukturen vor Ort bereitzustellen:<br />
� Waldentwicklung und in die besondere Bedeutung des Waldgebiets Hohe Schrecke,<br />
� Kenntnisse der historischen, prähistorischen und naturkundlichen Besonderheiten der<br />
Waldregion, des Gebietes und der angrenzenden Regionen,<br />
� Kenntnisse der vorhandenen und geplanten touristischen Infrastruktur,<br />
� Entwicklung regionsspezifischer Wander- und Exkursionsangebote zu Fuß, zu Rad und zu<br />
Pferd (z.B. Themenexkursionen an spezielle Waldstandorte zu den Themen Biodiversität und<br />
Waldbau oder Wälder und Klimawandel).<br />
Für die Vermittlung dieser weitergehenden Lehrinhalte werden 5 weitere Tage – insgesamt also<br />
14 Tage veranschlagt. Als Träger des Projekts ist die Heimvolkshochschule Donndorf vorgesehen.<br />
Diese Maßnahme wurde bereits im Antrag zum Wettbewerbsantrag idee.natur formuliert und<br />
steht in inhaltlichem Bezug zur Maßnahme „Ausbau der Umweltbildung im ‚Geopark Kyffhäuser’“<br />
der RES Kyffhäuser.<br />
Weitere Projektideen<br />
Aus- und Weiterbildungszentrum am Windberg Beichlingen<br />
Die Jugendherberge Beichlingen plant, ein Informationszentrum für die Zielgruppe Aktivtouristen<br />
einzurichten. In diesem Zusammenhang stehen Überlegungen, Ausbildung für Dienstleistungen<br />
im Bereich sanfter Tourismus anzubieten (z. B. Ausbildung von Naturrangern, Servicepersonal)<br />
Projektträger: Jugendherberge Beichlingen<br />
111
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Unterstützung durch Experten zur Qualifizierung für naturnahen Tourismus<br />
In Zeiten gesättigter Reisemärkte und starker Konkurrenz auch im Bereich sanfter Tourismus<br />
kommt es entscheidend darauf an, mit intelligenten Marketingkonzepten und einer hohen<br />
Qualität touristischer Angebote Wettbewerbsvorteile zu generieren.<br />
In Zusammenarbeit mit Experten sollten daher Qualifizierungsmaßnahmen der touristischen<br />
Leistungsanbieter durchgeführt und touristische Pauschalen entwickelt werden. Hierfür sind<br />
besonders bestehende Betriebe zu gewinnen sowie potentielle Anbieter von Pauschalen und<br />
Übernachtungsmöglichkeiten einzuwerben. Neben der Inwertsetzung regionaler Besonderheiten<br />
hat die gemeinsame Entwicklung von Pauschalen den Effekt, dass die gewünschte stärkere<br />
Koordinierung in der touristischen Profilierung erreicht wird. Gäste können sich somit einfach<br />
und individuell über Angebote der Region informieren. Darüber hinaus können so Angebote<br />
entwickelt werden, die es der Region ermöglichen, an unterschiedlichen Stellen an Angeboten<br />
der angrenzenden Regionen anzudocken. So können beispielsweise touristische Pauschalen im<br />
Bereich Naturerleben entwickelt werden, welche die Region mit den Naturparken Kyffhäuser und<br />
Saale-Unstrut-Triasland verbinden. Schließlich kann die Qualifizierung vorbereitend für eine<br />
marketingwirksame Lizensierung der Region, bspw. durch Viabono, dienen. Ziel ist,<br />
Wettbewerbsvorteile zu erzielen und die zukünftigen Angebote der Hohen Schrecke erfolgreich<br />
am Markt zu platzieren<br />
Als mögliche Träger der Maßnahme können die Fremdenverkehrsverbände Kyffhäuserkreis und<br />
Sömmerda in Betracht gezogen werden.<br />
112
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
6 Zusammenfassung und Perspektiven<br />
Mit dem Integrierten Ländlichen <strong>Entwicklungskonzept</strong> „Hohe Schrecke“ liegt ein teilräumlich und<br />
fachspezifisch konkretisiertes <strong>Entwicklungskonzept</strong> für die Region vor. Es zeigt aktuelle<br />
Entwicklungsdefizite auf, bestimmt Potentiale für die zukünftige Regionalentwicklung und<br />
formuliert geeignete Maßnahmen zur Erreichung von Entwicklungszielen. Wesentliches Merkmal<br />
der Erarbeitung eines <strong>ILEK</strong>s war die Gestaltung eines Bottom-up-Prozesses – ein Prozess also,<br />
der vor allem von den Menschen aus der Region heraus getragen wird.<br />
Das vorliegende <strong>ILEK</strong> „Hohe Schrecke“ dokumentiert damit einen mehrere Monate dauernden<br />
Prozess der Datenanalyse, der Ideenfindung, der Strategieentwicklung und der Abstimmung<br />
zwischen vielen Beteiligten. Im Rahmen regionaler Foren und Workshops haben die Menschen<br />
der Region intensiv daran mitgearbeitet, bestehende Visionen für das Waldgebiet zu einem<br />
abgestimmten Zielsystem für die gesamte Region weiterzuentwickeln. Die Fülle an formulierten<br />
Projektideen zeigt für die Zukunft ein enormes Potential für die Entwicklung der Region. Dennoch<br />
darf nicht über die drängenden Probleme – Abwanderung, Überalterung, Arbeitslosigkeit und<br />
Finanzschwäche der Kommunen – hinweg gesehen werden. Das <strong>ILEK</strong> bietet Lösungsansätze und<br />
Strategien, wie diese Probleme in der Zukunft gemildert werden könnten. Grundlegende<br />
Voraussetzungen dafür sind jedoch eine handlungsfeldübergreifende Ausrichtung zukünftiger<br />
Initiativen und ein kooperatives Miteinander der Akteure.<br />
Mit der Fertigstellung des <strong>ILEK</strong> „Hohe Schrecke“ ist der begonnene regionale<br />
Entwicklungsprozess nicht abgeschlossen. Vielmehr zeigen die angestoßenen Initiativen und<br />
Projekte, dass mit dem <strong>ILEK</strong> wichtige Impulse für die Entwicklung der Region Hohe Schrecke<br />
angeregt wurden. Da aus dem <strong>ILEK</strong> selbst keine weitere Begleitung der Projekte resultiert,<br />
müssen zukünftig alternative Strukturen für die Umsetzung genutzt werden.<br />
Ein Teil der Projekte – z.B. ländlicher Wegebau, Revitalisierung von Brachflächen, Sanierung<br />
historischer Gebäude oder der Ausbau von Urlaub auf dem Bauernhof – kann zum Beispiel im<br />
Rahmen der LEADER-Initiativen Kyffhäuser und Sömmerda-Erfurt weitergeführt werden.<br />
Ansprechpartner sind hierfür die jeweiligen Regionalmanager.<br />
Für einen anderen Teil der Projekte – z. B. Maßnahmen im Naturschutz, Erstellung von<br />
Machbarkeitsstudien in den Bereichen Tourismus oder regenerativer Energien – können<br />
Fördermöglichkeiten des Naturschutzgroßprojekts genutzt werden. Der im vergangenen Jahr<br />
gegründete Verein „Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft e.V.“ und die Naturstiftung DAVID<br />
sind für diese Projekte die richtigen Ansprechpartner.<br />
Darüber hinaus wird es im Rahmen des Naturschutzgroßprojekts ab dem Jahr 2010 für 5 Jahre<br />
einen Regionalmanager geben, der die Fäden der Regionalentwicklung in der Hohen Schrecke in<br />
der Hand halten wird.<br />
113
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
7 Literatur und Quellen<br />
Büro Opus (2002): Projektantrag an die Bundesstiftung Umwelt für ein „<strong>Entwicklungskonzept</strong><br />
Hohe Schrecke“. Unveröff. Projektantrag.<br />
Ellenberg, H. (1996): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen : in ökologischer, dynamischer und<br />
historischer Sicht. 5.Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart. 1095 S.<br />
auweck GmbH (2008): Studie zum Integrierten Gesamtkonzept zur Entwicklung der ländlichen<br />
Räume Thüringens. Im Auftrag des Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und<br />
Umwelt (TMLNU) Erfurt<br />
Freistaat Thüringen, Landesamt für Vermessung und Geoinformation (2007): Topographische<br />
Karte 25 000. Hohe Schrecke, Schmücke, Finne<br />
Kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) „Hohe Schrecke“ und Naturstiftung David (2008):<br />
Ideenskizze Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft.<br />
Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen (2008): Brachflächen? Revitalisiert! Erfurt.<br />
[LEP 2004] Freistaat Thüringen, Ministerium für Bau und Verkehr (2004):<br />
Landesentwicklungsplan 2004. Erfurt.<br />
Meynen, E. & Schmithüsen, J. (1962): Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands.<br />
Band 2. Bundesamt für Landeskunde und Raumordnung, Bad Godesberg<br />
MODER, F. (2002): Projektantrag an die Bundesstiftung Umwelt für ein „<strong>Entwicklungskonzept</strong><br />
Hohe Schrecke“.<br />
Naturstiftung David, Verein „Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft“ (2008): Hohe Schrecke –<br />
Alter Wald mit Zukunft. Integrierter Projektantrag im Rahmen des Bundeswettbewerbes<br />
idee.natur – Naturschutzgroßprojekte und ländliche Entwicklung. Unveröff. Projektantrag.<br />
Pott, R. (1995): Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. 2. Auflage. Ulmer Verlag, Stuttgart. 622<br />
S.<br />
Publicpress (o.J.): Radwanderkarte 344. Unstrut-Radweg. Mit Ausflugszielen, Einkehr- und<br />
Freizeittipps<br />
[RP MT 2008] Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (2008): Regionalplan<br />
Mittelthüringen. Anhörung / öffentliche Auslegung des überarbeiteten Entwurfes zum<br />
Regionalplan Mittelthüringen. Beschluss Nr. RPV 23/04/08 vom 09.10.2008.<br />
114
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
[RP NT 2007] Regionale Planungsgemeinschaft Nordthüringen (2007): Regionalentwicklung in<br />
Nordthüringen. Teil II Regionalplan Nordthüringen. Entwurf zur Anhörung / Offenlegung des<br />
Regionalplanes. PV-Beschluss Nr. 10/01/2007 vom 13.06.2007.<br />
[RROP MT 1999] Thüringer Innenministerium (Hrsg.) (1999): Regionaler Raumordnungsplan<br />
Mittelthüringen. Sonderdruck Nr. 2 / 1999 des Thüringer Staatsanzeigers. Beilage zu Nr. 40 /<br />
1999. Erfurt.<br />
[RROP NT 1999] Thüringer Innenministerium (Hrsg.) (1999): Regionaler Raumordnungsplan<br />
Nordthüringen. Sonderdruck Nr. 2 / 1999 des Thüringer Staatsanzeigers. Beilage zu Nr. 40 /<br />
1999. Erfurt.<br />
Thüringer Innenministerium (Hrsg.) (2008): Thür. Staatsanzeiger 28/2008. Amtlicher Teil.<br />
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung. S. 1131 - 1137<br />
[TLUG] Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (2009): Umwelt regional. Internetportal<br />
zu Umweltthemen und Daten der Regionen Thüringens: http://www.tlugjena.de/uw_raum/umweltregional/index.html<br />
(letzter Zugriff am 13.01.2009)<br />
[TMLNU] Freistaat Thüringen, Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (2008):<br />
Förderfibel 2008/2009. o.O.<br />
Internetquellen<br />
Bevölkerungsdaten:<br />
http://www.tls.thueringen.de/seite.asp?aktiv=dat01&startbei=datenbank/oertlich.asp<br />
(Stand Oktober 2008)<br />
Wirtschaft:<br />
http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/detail/a.html (Stand Oktober 2008)<br />
Siedlungswesen:<br />
http://www.tls.thueringen.de/seite.asp?aktiv=dat01&startbei=datenbank/oertlich.asp<br />
(Stand November 2008)<br />
Tourismus:<br />
http://www.tls.thueringen.de/seite.asp?aktiv=dat01&startbei=datenbank/oertlich.asp<br />
(Stand November 2008)<br />
http://www.stadt-wiehe.de/Wandern.35.0.html (Stand November 2008)<br />
http://www.kyffhaeuser-tourismus.de/de/a-z/reiten.asp (Stand November 2008)<br />
http://www.gelbeseiten.de (Stand Mai 2009)<br />
115
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
Städte- und Gemeindeseiten (Stand November 2008):<br />
Kyffhäuserkreis:<br />
http://www.stadt-wiehe.de<br />
http://www.gehofen.de/<br />
http://www.stadt-heldrungen.de/<br />
http://www.nausitz.de/<br />
http://www.gemeinde-reinsdorf.de/<br />
http://www.hauteroda.de<br />
http://www.oberheldrungen.de<br />
http://www.vgem-schmuecke.de/ (Verwaltungsgemeinschaft “An der Schmücke”<br />
http://www.vgmzartern.de/ (Verwaltungsgemeinschaft Mittelzentrum Artern)<br />
Landkreis Sömmerda:<br />
http://www.rastenberg.de/<br />
http://www.großmonra.de/<br />
http://www.gstb-thueringen.de/<br />
116
<strong>Integriertes</strong> Ländliches <strong>Entwicklungskonzept</strong> (<strong>ILEK</strong>) „Hohe Schrecke“ Endbericht<br />
8 Anhang – Maßnahmenblätter und Maßnahmentabelle<br />
117
Titel des Projekts<br />
Handlungsfeld/<br />
Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
Planungsstand<br />
Marketingkonzept Tourismus für die Region Hohe Schrecke<br />
(Kap. 5.4.4.2)<br />
Tourismus, Erholung und Landschaft/ Informationsmanagement<br />
und Marketing<br />
M 1<br />
Ziel: Erstellung eines Marketingkonzepts mit zeitnaher Umsetzung<br />
erster Maßnahmen<br />
Inhalte und Ziele:<br />
- Potentialanalyse bestehender touristischer Angebote und<br />
Bestimmung touristischer Entwicklungsperspektiven<br />
- Entwicklung einer Marketingstrategie als Grundlage für die<br />
koordinierte Schaffung, Außendarstellung und Kommunikation<br />
touristischer Maßnahmen im Bereich Tourismus.<br />
- Abstimmung der Einzelmaßnahmen mit inhaltlichen und zeitlichen<br />
Anforderungen des Naturschutzgroßprojekts<br />
Zu erwartende Effekte:<br />
- Wissenszuwachs durch detaillierte Informations- und<br />
Datengrundlage<br />
- Initiierung der Innen- und Außenkommunikation für die Hohe<br />
Schrecke mit hohem Wiedererkennungswert<br />
- Definierung von Pauschalangeboten für eine zielgruppenorientierte<br />
Bewerbung<br />
Verein „Hohe Schrecke – alter Wald mit Zukunft e.V.“ / u. o.<br />
Naturstiftung DAVID<br />
Erstellung des Marketingkonzepts ist kurzfristig zu veranlassen,<br />
zeitnahe Förderung für kurzfristig umsetzbare Maßnahmen lt.<br />
Naturstiftung David über Modellvorhaben chance.natur möglich<br />
Geschätzte Kosten Erstellung des Marketingkonzepts: 30.000 – 50.000 €<br />
Finanzierung/Förderung Naturschutzgroßprojekt<br />
Umsetzungshorizont<br />
Folgende Maßnahmen sollten im Marketingkonzept berücksichtigt<br />
werden: (in Klammern: Ursprung der Projektidee)<br />
Kurzfristig (1-2 Jahre):<br />
- (Produkt)Logo und Corporate Design „Hohe Schrecke“<br />
(<strong>ILEK</strong>/chance.natur)<br />
- Internetauftritt inkl. WebGIS für die Region (<strong>ILEK</strong>/chance.natur)<br />
- Flyer / Faltblatt (<strong>ILEK</strong>/chance.natur)<br />
- regionaler Veranstaltungskalender (<strong>ILEK</strong>)<br />
Mittelfristig (3-5 Jahre): mit Planung des PEPL zu koordinieren!<br />
- Wanderbroschüre/ Natur- und Landschaftsführer „Hohe Schrecke-<br />
Finne-Schmücke“ (<strong>ILEK</strong>) oder als Flyer (chance.natur)<br />
- Digitaler regionaler Wanderführer (<strong>ILEK</strong>)<br />
- Thematische Infopavillons an den Wanderwegen in die Hohe<br />
Schrecke (<strong>ILEK</strong>/chance.natur)<br />
- Vernetzung mit umliegenden Tourismusregionen (<strong>ILEK</strong>)<br />
- Einheitlich gestaltete Ausschilderung in der Region Hohe Schrecke<br />
(Wanderwege, interessante Punkte) (<strong>ILEK</strong>)<br />
Langfristig (5-10 Jahre):<br />
- Etablierung einer Tourismusregion/-marke „Hohe Schrecke“<br />
M 1
Titel des Projekts<br />
Handlungsfeld/<br />
Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
Planungsstand<br />
M 2<br />
Gutshof von Bismarck (Heldrungen/OT Braunsroda): Ausbau<br />
altes Feuerwehrhaus zum Tourismusstützpunkt<br />
(Kap. 5.4.2.2)<br />
Tourismus und Erholung<br />
Der Gutshof von Bismarck in Braunsroda ist seit vielen Jahren<br />
bestrebt, einen Beitrag zur touristischen Entwicklung der<br />
Projektregion zu leisten (z. B. Regionaler Bauermarkt, Hoffeste,<br />
Ferien auf dem Bauernhof usw.). Die Familie v. Bismarck hat sich<br />
in der Vergangenheit erfolgreich für die Erhaltung der historischen<br />
Bausubstanz auf dem Gut eingesetzt. Mit der räumlich günstigen<br />
Lage zwischen der Autobahnanschlussstelle Sömmerda an der<br />
A71 und dem Gebiet der Hohen Schrecke nimmt der Gutshof eine<br />
Scharnierfunktion wahr und bietet so gute Voraussetzungen als<br />
Tourismusstützpunkt zu fungieren. Die Umsetzung der Maßnahme<br />
beinhaltet:<br />
� Die bauliche Instandsetzung des Gebäudes<br />
sowie<br />
� Die Schaffung touristischer Angebote (Informationsstelle,<br />
Verkaufsstelle für regionale Produkte, Radverleih,<br />
Wohnmobilstellplätze).<br />
Für die Entwicklung von Angeboten soll zunächst ein Marketingkonzept<br />
entwickelt werden. Sowohl bauliche Maßnahmen als<br />
auch das Marketingkonzept können über die Agrartourismus-<br />
Richtlinie gefördert werden.<br />
Der Tourismusstützpunkt trägt zur Stärkung der touristischen<br />
Angebote und zur Stärkung des Informationsmanagements bei. Er<br />
kann u. a. als Ausgangspunkt für den Aktiv- und Bildungstouristen<br />
dienen und auf die Tourismusregion Hohe Schrecke<br />
aufmerksam machen.<br />
Geschätzte Kosten Noch nicht kalkuliert<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont /<br />
Bemerkung<br />
Projektträger:<br />
<strong>Stadt</strong> Heldrungen<br />
Rathaus<br />
06577 Heldrungen<br />
Tel 034673-70910<br />
In Abstimmung mit Kristin u. Georg v. Bismarck<br />
Tel 034673-97974<br />
Die <strong>Stadt</strong> Heldrungen ist Eigentümer des Objekts, Maßnahme hat<br />
hohe Priorität der RAG Kyffhäuser<br />
Richtlinie „Förderung des Agrartourismus“<br />
mittelfristig<br />
M 2
Titel<br />
Handlungsfeld / Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
M 3<br />
Wanderherberge an der „Hohen Schrecke“ – Altes Pfarrhaus<br />
Gehofen<br />
(Kap. 5.4.2.2)<br />
Tourismus, Erholung und Landschaft / Touristische Infrastruktur<br />
und Angebote<br />
(Siedlungsbau und IT-Infrastruktur / Erhaltung historischer<br />
Bausubstanz)<br />
Das Kirchspiel <strong>Wiehe</strong> und der Kirchbauverein Gehofen planen vor<br />
dem Hintergrund des Naturschutzgroßprojekts die Errichtung einer<br />
Wanderherberge auf dem Pfarrgrundstück in Gehofen.<br />
Ziel ist die Sanierung des alten Pfarrhauses mit erhaltenswerter<br />
Bausubstanz, ergänzt durch einen modernen Anbau. Der Ursprung<br />
des Gebäudes liegt vermutlich am Ende des 13. Jahrhunderts<br />
(1298), damals genutzt als Templer-Komturei. Das Erdgeschoss<br />
des alten Pfarrhauses ist bereits teilweise saniert.<br />
Die Wanderherberge soll 24 Schlafräume mit 63<br />
Übernachtungsplätzen bereitstellen. Ideen zu einem<br />
Betreiberkonzept sehen eine gemischte Nutzung als Herberge,<br />
Tagungs- und Veranstaltungszentrum und Ort für die<br />
Gemeindearbeit vor.<br />
Die Kooperation mit touristischen Anbietern, z.B. die Vermittlung<br />
von Übernachtungsgästen im Fall großer Nachfrage am nahe<br />
gelegenen Unstrutradweg (Ritteburg, Bottendorf) wird angestrebt.<br />
Projektträger: n.n.<br />
Ansprechpartner:<br />
Die Bauhütte<br />
Herr Danz<br />
Flechtaer Straße 28<br />
99974 Mühlhausen<br />
Tel.: 03601/816575<br />
Geschätzte Kosten Ca. 1.4 Mio. €<br />
Planungsstand Planungsstudie der Bauhütte Mühlhausen liegt vor<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont /<br />
Bemerkung<br />
Eine Förderung über die RAG Kyffhäuser und Dorferneuerung ist<br />
grundsätzlich möglich, Antrag kann immer bis 31.10. eines Jahres<br />
gestellt werden<br />
Mittelfristig / eine anteilige Förderung durch das Naturschutzgroßprojekt<br />
bei einer energieeffzienten Sanierung bzw. bei<br />
energieeffizientem Neubau ist möglich, Voraussetzung ist ein<br />
tragfähiges Betreiberkonzept.<br />
M 3
Titel<br />
Handlungsfeld / Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
Geschätzte Kosten<br />
Planungsstand<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont/Bemerkung<br />
Mühlencafé und Mühlenmuseum – Alte Mühle Gehofen<br />
(Kap. 5.4.2.2)<br />
Tourismus, Erholung und Landschaft / Touristische Infrastruktur<br />
und Angebote<br />
Ziel ist die Sanierung der historischen Wassermühle in Gehofen<br />
(1528 erstmalig erwähnt, seit 1865 im Besitz der Fam. Gebhardt)<br />
und der Ausbau zu einem Mühlenmuseum (Schaumühle) mit<br />
Café. Die Wassermühle ist seit mehreren Jahrzehnten stillgelegt<br />
aber technisch vollständig erhalten. Ob die Mühle als<br />
technisches Denkmal geeignet ist, soll geprüft werden.<br />
Die Mühle liegt räumlich günstig am Radweg nach Ritteburg und<br />
würde damit als interessanter touristischer Punkt die Region an<br />
den Unstrutradweg anbinden. Das Gelände bietet darüber<br />
genügend Platz für Parkmöglichkeiten.<br />
Für die Sanierung ist geplant, regionale Rohstoffe wie Holz aus<br />
der Hohen Schrecke zu verwenden und eine Holzpelletheizung<br />
zu installieren. Inhaltlich ist das Projekt damit anschlussfähig<br />
an das Leitthema Regionale Energienutzung, an das<br />
Naturschutzgroßprojekt und weitere Initiativen der Region (z.B.<br />
regionaler Holzmarkt).<br />
Das Projekt würde insgesamt einen Beitrag zur Verbesserung der<br />
touristischen Angebotsstruktur leisten. Das Mühlenmuseum<br />
steht weiterhin in Verbindung zu den Themen Umweltbildung<br />
und Agrartourismus.<br />
Herr Gebhardt<br />
Mühlgasse 12<br />
06571 Gehofen<br />
Tel.: 01520/4554632<br />
Kosten für Sanierung des Gebäudes,<br />
Restaurierung/Instandsetzung der Wassermühle und Ausbau<br />
des Cafés sind noch nicht bekannt.<br />
Ideenskizze vorhanden, Planungsstudie der Bauhütte ist in<br />
Vorbereitung.<br />
Existenzgründerprogramme<br />
Mittel der Denkmalpflege für technisches Denkmal<br />
Mittel der Dorferneuerung<br />
Langfristig / Voraussetzung für die Umsetzung des Projekts ist<br />
ein tragfähiges Betreiberkonzept, eine anteilige Förderung<br />
durch das Naturschutzgroßprojekt bei einer energieeffzienten<br />
Sanierung ist möglich.<br />
M4<br />
M 4
Titel<br />
M 5<br />
„Haus auf dem Berge“ Hauteroda – Sanierung des Brunnens<br />
und der Kellerräume<br />
(Kap. 5.4.2.2)<br />
Handlungsfeld / Leitthema Bildung und Kultur / Angebote in der Umweltbildung<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
Geschätzte Kosten<br />
Das „Haus auf dem Berge“ (Gemarkung Hauteroda) liegt<br />
zwischen Oberheldrungen und Hauteroda am Waldrand an<br />
einem Wanderweg zur Hohen Schrecke. Das Schulungs- und<br />
Freizeitheim der Christengemeinschaft bietet 41<br />
Übernachtungsplätze auf dem Niveau einer Jugendherberge und<br />
ist tätig im Bereich der Umweltbildung und religiösen Bildung für<br />
Jugendliche und Erwachsene (u. a. Feldpraktika, Malkurse,<br />
Exkursionen, Klassenfahrten, Mutter-Kind-Freizeiten). Ab<br />
Oktober 2009 wird eine neue Betreibergesellschaft den Betrieb<br />
übernehmen. Enge Kontakte bestehen zu einem<br />
Landwirtschaftsbetrieb in Hauteroda für die Versorgung mit<br />
ökologisch angebauten Produkten.<br />
Das Haus auf dem Berge verfügt lagebedingt über einen 120 m<br />
tiefen Brunnen zur Trinkwasserversorgung. Der Brunnen ist inkl.<br />
Pumpe dringend sanierungsbedürftig, um die Versorgung mit<br />
Trinkwasser sicherzustellen.<br />
Weiterhin sind die veralteten Gemeinschaftswaschräume im<br />
Kellergeschoss zu sanieren, um modernen Ansprüchen an<br />
sanitäre Anlagen auf dem Niveau einer Jugendherberge zu<br />
genügen.<br />
Die thematische Ausrichtung und die Lage am Waldgebiet<br />
bieten in Zukunft weitere Anknüpfungspunkte zum<br />
Naturschutzgroßprojekt. Das Projekt leistet sowohl einen<br />
Beitrag zur Stärkung der touristischen Angebote für eine<br />
religiöse und naturorientierte Klientel und trägt zur Stärkung des<br />
Angebots für das Leitthema Umweltbildung in der Hohen<br />
Schrecke bei.<br />
Tobias Knabe<br />
Haus auf dem Berge<br />
06577 Hauteroda<br />
Tobias.knabe@hadb.de<br />
Sanierung des Brunnens: ca. 30.000 €<br />
Sanierung der Gemeinschaftswaschräume: ca. 120.000 €<br />
Planungsstand Kostenvoranschlag für die Sanierung der Kellerräume liegt vor.<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont/Bemerkung Mittelfristig<br />
Eine Unterstützung durch das Naturschutzgroßprojekt ist<br />
denkbar bei der Weiterentwicklung des<br />
Umweltbildungsangebots und der auf Energieeffizienz<br />
orientierten Sanierung von Gebäuden<br />
M 5
Titel<br />
Handlungsfeld / Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
M 6<br />
Inbetriebnahme des Unstrut-Radel-Express zwischen Wangen<br />
und Nebra<br />
(Kap. 5.4.2.2)<br />
Tourismus und Erholung / Touristische Infrastruktur und<br />
Angebote<br />
Die Eisenbahnlinie Artern – Naumburg (Unstrutbahn) hat bis vor<br />
wenigen Jahren eine wichtige Infrastrukturaufgabe für die Region<br />
erfüllt. Sowohl Güter- wie auch Personenverkehr sind als Folge des<br />
Strukturwandels erheblich zurückgegangen. Ende 2006 wurde im<br />
Streckenabschnitt zwischen Artern und Nebra der<br />
Personenverkehr eingestellt. Ziel ist es, die Eisenbahn-<br />
Infrastruktur der Unstrutbahn zwischen Artern und Nebra zu<br />
erhalten.<br />
Die Maßnahme beinhaltet die Förderung<br />
� Der Betriebskosten für die Inbetriebnahme der<br />
Unstrutbahn zwischen Artern und Nebra für die<br />
touristische Nutzung,<br />
� Der Werbekosten für Vermarktung des Unstrut-Radel-<br />
Express: neben der eigenständigen Werbung der IG<br />
Unstrutbahn e. V. über Prospekte und Internet auch<br />
Aufnahme in die Werbemaßnahmen der<br />
Fremdenverkehrsförderung auf Landes- und Kreisebene.<br />
Von April bis Oktober 2010 sollen an Sonn- und Feiertagen<br />
insgesamt 33 Fahrtage angeboten werden. Der Betrieb der<br />
Eisenbahn trägt zu einem umweltgerechten Tourismus in der<br />
Region Hohe Schrecke bei und bildet ein zusätzliches Highlight.<br />
Für die weitere Entwicklung des Radtourismus kann die<br />
Unstrutbahn ein wichtiges Zugpferd darstellen und weitere Radler<br />
in die Region holen. Es wird eine direkte Verbindung zu den<br />
Besuchermagneten in angrenzenden Regionen geschaffen und<br />
damit eine stärkere Anknüpfung unterstützt.<br />
Herr Christof Rommel<br />
IG Unstrutbahn e. V.<br />
<strong>Wiehe</strong>sche Straße 1<br />
06571 Donndorf<br />
kontakt@unstrutbahn.de<br />
Geschätzte Kosten 83.715,51 Euro<br />
Planungsstand<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont /<br />
Bemerkung<br />
Konzeption ist vorhanden, Kontaktaufnahme zur Thüringer<br />
Aufbaubank (TAB) seitens Projektträger ist erfolgt,<br />
Empfehlungsschreiben der RAG Kyffhäuser liegt der TAB vor.<br />
Offen, Maßnahmen für Marketing über das<br />
Naturschutzgroßprojekt nur förderfähig, wenn Bezug zur Hohen<br />
Schrecke deutlich weitere radtouristische Angebote vorhanden.<br />
Ab 2011, abh. von Radwegeprojekt „Nordrand Hohe Schrecke„ und<br />
Wegekonzept des Naturschutzgroßprojekts<br />
M 6
Titel<br />
Regionaler Holzmarkt „Hohe Schrecke“<br />
(Kap. 5.5.2.2)<br />
Handlungsfeld / Leitthema Land- und Forstwirtschaft / Regionale Produktvermarktung<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
M 7<br />
Ziel ist, einen Holzmarkt zu etablieren, der als wesentliche<br />
Grundlage für die Vermarktung des nachwachsenden Rohstoffes<br />
Holz in seiner Vielfalt nicht nur für Kunden, sondern auch als<br />
Touristenmagnet fungiert.<br />
Ein erster Holzmarkt wurde bereits durchgeführt. Daraus ergeben<br />
sich folgende Kenntnisse:<br />
� Der Holzmarkt der Hohen Schrecke soll halbjährig<br />
stattfinden<br />
� Für die Bereitstellung des Holzes konnten Waldbesitzer<br />
gewonnen werden<br />
� Das Einzugsgebiet der Kunden könnte sich bis in Zentren<br />
wie Erfurt, Weimar, Jena u.s.w. beziehen<br />
� Teilnehmen können alle die Holz aus der Hohen Schrecke in<br />
irgendeiner Form verarbeiten und vermarkten, vom<br />
Brennholz bis zu Fertigprodukten, einschließlich<br />
künstlerischer Gestaltungen.<br />
� Für die Versorgung werden ortsansässige Vereine<br />
geworben.<br />
� Der erste Holzmarkt, im August 2009 in <strong>Wiehe</strong> veranstaltet,<br />
fand regen Zuspruch bei der Bevölkerung und wird deshalb<br />
wiederholt.<br />
� Zukünftig wird das Forstamt Oldisleben noch aktiver<br />
eingebunden.<br />
Reinhard Kruspe<br />
Roßlebener Str. 27<br />
06571 <strong>Wiehe</strong><br />
Planungsstand Oben beschriebener Stand zum 09.09.2009<br />
Geschätzte Kosten<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont /<br />
Bemerkung<br />
Pro Veranstaltung ca. 2.000 Euro<br />
Gesamtkosten ca. 20.000 Euro<br />
(Kosten gerechnet auf 5 Jahre. Kosten für ein erweitertes Konzept<br />
und die Unterstützung für das Marketing sind mit dem<br />
Projektträger abzustimmen)<br />
Eine Förderung über das Naturschutzgroßprojekt für Konzeption<br />
und Marketing ist möglich.<br />
Kurzfristig / die Abstimmung des Projektes mit dem<br />
Naturschutzgroßprojekt ist kurzfristig möglich<br />
M 7
Titel<br />
Handlungsfeld / Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
Ländlicher Wegebau / Weg „Nordrand Hohe Schrecke“<br />
zwischen Reinsdorf und <strong>Wiehe</strong><br />
(Länge ca. 12 km)<br />
(Kap. 5.4.2.2)<br />
Landwirtschaft/ Tourismus, Erholung und Landschaft /<br />
Touristische Infrastruktur und Angebote<br />
Um den Zustand der landwirtschaftlichen Wege am Nordrand<br />
der Hohen Schrecke zu verbessern, sollen einzelne Wege<br />
zwischen Reinsdorf und <strong>Wiehe</strong> ausgebaut werden. Ziel ist, ein<br />
multifunktionales Wegesystem zu schaffen, das sowohl den<br />
Landwirten dient, als auch der Bevölkerung und den Touristen.<br />
M 8<br />
Bereits bestehende Feld- und Verbindungswege zwischen<br />
Reinsdorf – Gehofen – Nausitz – Donndorf und <strong>Wiehe</strong>, befinden<br />
sich aktuell in unterschiedlichem Zustand. Größtenteils wird ein<br />
Ausbau der Wege notwendig. Für die weitere Planung muss der<br />
Zustand jedes Teilstücks erfasst und die genauen notwendigen<br />
baulichen Maßnahmen ermittelt werden.<br />
Einzelne Feldwege sind bereits als Radwege in Radwanderkarten<br />
gekennzeichnet. Zwischen Gehofen und Nausitz fehlt<br />
aktuell noch eine Kennzeichnung. Zudem müssen einige<br />
Feldwege als Radwege kenntlich gemacht werden. In ein<br />
Radwegekonzept, das auf landwirtschaftlich bestehenden<br />
Wegen aufsetzt, sind touristisch interessante Punkte<br />
einzubinden, einzelne mögliche Punkte sind als Vorschläge in<br />
den beigefügten Karten bereits genannt. Welche touristisch<br />
interessanten Punkte eingebunden werden, ist bei der<br />
Realisierung des Weges zu bestimmen.<br />
Soweit bekannt, sind die Wege Eigentum der jeweiligen<br />
Gemeinden. Nächste Schritte:<br />
• Grundlagenermittlung und Vorplanung<br />
• Beteiligung der betroffenen Akteure<br />
• Antrag bei der RAG Kyffhäuserkreis für ein positives Votum<br />
• Stellungnahme der Kommunalaufsichtsbehörde<br />
• Stellungnahme der Naturschutzbehörde<br />
• Antrag beim Amt für ländliche Entwicklung<br />
Verein „Hohe Schrecke – Alter Wald mit Zukunft“<br />
Planungsstand Erste Überlegungen finden sich in den zugehörigen Karten<br />
Geschätzte Kosten Ca. 1,2 Mio.<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont/Bemerkung<br />
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung,<br />
Förderbereich Investive Maßnahmen, ländliche Infrastruktur<br />
Ab 2011 / Maßnahme ist mit dem Wegekonzept aus dem Pflege-<br />
und Entwicklungsplan des Naturschutzgroßprojekts<br />
abzustimmen, eine Anbindung nach Lossa (Sachsen-Anhalt)<br />
und damit an den Finnebahndamm ist anzustreben<br />
M 8
Titel des Projekts<br />
Handlungsfeld/<br />
Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
(Name, Adresse, Telefonnr.,<br />
Email-Adresse)<br />
Ländlicher Wegebau / Weg „Südrand Hohe Schrecke“<br />
Ausbau des Finnebahndamms zwischen Großmonra und<br />
Rastenberg<br />
(Kap. 5.4.2.2)<br />
Tourismus, Erholung und Landschaft / Touristische<br />
Infrastruktur und Angebote<br />
Die Finnebahn südlich der Hohen Schrecke ist seit den 1960er<br />
Jahren stillgelegt und heute zum Teil als Radwanderweg<br />
ausgebaut. Der ehemalige Bahnverlauf im Projektgebiet wird<br />
jedoch wenig gepflegt und zunehmend für Radtouristen<br />
unattraktiv.<br />
Die Umsetzung der Maßnahme beinhaltet die Instandsetzung<br />
des Radweges entlang der Gemeinden Großmonra, Bachra und<br />
Rastenberg.<br />
M 9<br />
In der Regionalen Entwicklungsstrategie Sömmerda/Erfurt wird<br />
die Entwicklung eines Erlebnisradwegs „Wege in die Bronzezeit“<br />
vom Fürstengrab Leubingen zur Fundstätte Himmelsscheibe<br />
Nebra als ein touristisches Leitprojekt benannt. Der Verlauf soll<br />
über den Radweg Leubingen – Rastenberg – Tauhardt –<br />
Memleben – Wangen erfolgen.<br />
Ziel des Ausbaus eines Radweges entlang der Finnebahn ist die<br />
Verbesserung der touristischen Infrastruktur in der Region.<br />
Dieses Teilprojekt ergänzt dabei die Vorhaben zum geplanten<br />
Erlebnisradweg und eine thematische Anknüpfung der Region<br />
Hohe Schrecke ist möglich. Das Projekt wird als ein Baustein zur<br />
stärkeren räumlichen und thematischen Anbindung an<br />
angrenzende touristische Regionen eingestuft.<br />
Frau Christiane Schmidt<br />
Landratsamt Sömmerda<br />
Postfach 12 15<br />
99601 Sömmerda<br />
03634/354219<br />
soemmi@lra-soemmerda.de<br />
Planungsstand In Planung, Leitprojekt der RAG Sömmerda/Erfurt<br />
Geschätzte Kosten 250.000 Euro (brutto) Finnebahndamm<br />
Finanzierung/Förderung Konjunkturpaket II und Förderung der integrierten ländlichen<br />
Entwicklung, Förderbereich Investive Maßnahmen, ländliche<br />
Umsetzungshorizont/Bemerkung<br />
Infrastruktur<br />
Ab 2010 / Die Maßnahme ist mit dem Wegekonzept des<br />
Naturschutzgroßprojekts abzustimmen, eine Anbindung des<br />
Wegs nach Lossa (Sachsen-Anhalt) sollte gewährleistet werden.<br />
M 9
Titel<br />
Handlungsfeld / Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
M 10<br />
Ländlicher und forstlicher Wegebau Großmonra „Waldweg<br />
von Burgwenden nach Langenroda“ (Länge ca. 9 km)<br />
(Kap. 5.4.2.2)<br />
Tourismus, Erholung und Landschaft / Touristische Infrastruktur<br />
und Angebote<br />
Die Maßnahme ländlicher Wegebau „Waldweg von Burgwenden<br />
nach Langenroda“ beinhaltet die Verbesserung der<br />
Befahrbarkeit des vorhandenen Weges (Waldweg) zwischen<br />
Burgwenden und Langenroda, in der Gemarkung Großmonra, OT<br />
Burgwenden. Die Maßnahme unterstützt die Erschließung der<br />
Infrastruktur an der „Hohen Schrecke“ für die kombinierte<br />
Nutzung für Land-/Forstwirtschaft sowie für<br />
Radfahrer/Wanderer.<br />
Mittels bituminöser Tragdeckschicht soll eine ebene<br />
Waldwegoberfläche hergestellt werden. Mit der geplanten<br />
Verbesserung, bzw. des Ausbau des Weges werden Voraussetzungen<br />
geschaffen, um mit dem Rad oder zu Fuß, von<br />
Burgwenden über die Gemarkung Burgwenden, nach<br />
Langenroda, zu den Ausläufern der Hohen Schrecke zu<br />
gelangen.<br />
Im vorderen Bereich kann die LW ebenfalls den auszubauenden<br />
Weg benutzen. Eine geplante Bepflanzung des offenen<br />
Wegebereiches vor der Bewaldung rundet das Projekt ab und<br />
erzeugt zukünftig Schatten für Radfahrer und Wanderer.<br />
Die Wegeflächen befinden sich im Eigentum:<br />
1. Teilbereich : Landratsamt Sömmerda<br />
2. Teilbereich : Freistaat Thüringen<br />
Projektträger :<br />
Gemeinde Großmonra unter Einbezug des Landratsamtes<br />
Sömmerda, sowie des Freistaates Thüringen<br />
Bürgermeister : Herr Hoffmann<br />
Ansprechpartner: VG Kölleda, Herr Wolf<br />
Tel. 03635 450 107, Fax: 450 125<br />
E-Mail : poststelle@vgem-koelleda<br />
Planungsstand Lp 1…2 , Kostenermittlung liegt vor<br />
Geschätzte Kosten<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont/Bemerkung<br />
Los 1 Wegebau : 935.865,98 €<br />
Los 2 Bepflanzung : 52.473,05 €<br />
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung,<br />
Förderbereich Investive Maßnahmen, ländliche Infrastruktur<br />
(Antrag über die RAG Sömmerda-Erfurt); Richtlinie zur Förderung<br />
forstwirtschaftlicher Maßnahmen; Anteilige Förderung über<br />
Naturschutzgroßprojekt ist zu prüfen.<br />
2012-2014/Planung ist mit dem Wegekonzept im Rahmen des<br />
Naturschutzgroßprojekts abzustimmen, die Verträglichkeit einer<br />
bituminösen Deckschicht mit naturschutzfachlichen Zielen im<br />
Waldgebiet ist zu prüfen.<br />
M 10
Titel<br />
Handlungsfeld / Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
Planungsstand<br />
Geschätzte Kosten<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont/Bemerkung<br />
Ländlicher Wegebau Großmonra „Weg an der Schafau“<br />
(Länge ca. 3 km)<br />
(Kap. 5.4.2.2)<br />
M 11<br />
Tourismus, Erholung und Landschaft / Touristische Infrastruktur<br />
und Angebote<br />
Die Maßnahme Ländlicher Wegebau „Weg an der Schafau“<br />
beinhaltet die Verbesserung der Befahrbarkeit des vorhandenen<br />
Verbindungswegs (Feldweg) zwischen Battgendorf und<br />
Ostramondra, in der Gemarkung Großmonra, OT Backleben.<br />
Die Maßnahme unterstützt die Erschließung der „Hohen<br />
Schrecke“ für die kombinierte Nutzung für Landwirtschaft sowie<br />
Radfahrer/ Wanderer auf dem Mühlenwanderweg.<br />
Mittels bituminöser Tragdeckschicht soll eine ebene Wegoberfläche<br />
hergestellt werden. Mit dem geplanten Ausbau des<br />
Weges werden Voraussetzungen geschaffen, um mit dem Rad<br />
oder zu Fuß, von Battgendorf über die Gemarkung Backleben,<br />
nach Ostramondra, zu den Ausläufern der Hohen Schrecke zu<br />
gelangen. Eine Nutzung durch die Landwirtschaft ist ebenfalls<br />
Möglich. Eine geplante Bepflanzung des Weges rundet das<br />
Projekt ab und erzeugt zu-künftig Schatten für Radfahrer und<br />
Wanderer.<br />
Die Wegeflächen befinden sich im Eigentum der Gemeinde<br />
Großmonra.<br />
Die Länge des Weges beträgt ca. 3 Km<br />
Projektträger: Gemeinde Großmonra<br />
Bürgermeister: Herr Hoffmann<br />
Ansprechpartner: VG Kölleda, Herr Wolf<br />
Tel. 03635 450 107, Fax: 450 125<br />
E-Mail : poststelle@vgem-koelleda<br />
Kostenermittlung und Grobplanungen eines Planungsbüros<br />
liegen vor.<br />
Los 1 Wegebau : 353.720,12 €<br />
Los 2 Bepflanzung : 23.434,67 €<br />
Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung,<br />
Förderbereich Investive Maßnahmen, ländliche Infrastruktur;<br />
Die Maßnahme befindet sich außerhalb des Projektgebietes des<br />
Naturschutzgroßprojekts. Eine Förderung ist hierüber nicht<br />
möglich.<br />
2010 – 1012 / Die Maßnahme muss mit dem Projekt „Ausbau<br />
des Finnebahndamms…“ abgestimmt werden.<br />
M 11
Titel<br />
Handlungsfeld / Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
M 12<br />
Revitalisierungskonzept ehemaliges Kiesabbaugebiet und<br />
ehemalige Schuhfabrik in der Gemarkung <strong>Wiehe</strong><br />
(Kap. 5.6.3.2)<br />
Siedlungsbau und Breitband-Infrastruktur / Revitalisierung von<br />
Brachflächen<br />
Ehemaliges Kiesabbaugebiet und benachbarte Schuhfabrik liegen<br />
seit Jahren brach. Versuche zur Nachnutzung der Gebäude und<br />
Grundstücke schlugen bisher fehl, die Gebäude verfallen,<br />
Grundstücke verwildern.<br />
Die Erstellung eines fachlichen Gesamtkonzepts zur Nachnutzung<br />
aller Grundstücke rund um die ehemaligen Kiesseen <strong>Wiehe</strong> bildet<br />
die Grundlage für die Beantragung weiterer öffentlicher und<br />
privater Maßnahmen.<br />
Angestrebte Wirkungen bei Umsetzung des<br />
Revitalisierungskonzepts:<br />
� Verbesserung der Umwelt und des ländlichen Lebensraums<br />
� Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum<br />
� Reduzierung der Flächeninanspruchnahme<br />
� Verbesserung der touristischen Infrastruktur und Angebote<br />
im Bereich Aktivtourismus<br />
Geplant ist eine touristische Nachnutzung des renaturierten<br />
Geländes als Naherholungseinrichtung mit Beherbergung und<br />
gastronomischer Versorgung (Radfahrer- und Paddlerherberge in<br />
Bungalows sowie Zelten). Die gute Lage am Schnittpunkt<br />
touristischer Wege (Rad- u. Wasserwanderweg, Reitweg, Geopfad)<br />
bietet dabei Potentiale zur Vernetzung touristischer Angebote.<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong><br />
Bürgermeisterin Dagmar Dittmer<br />
Bauamtsleiter Bernhard Kammel<br />
Leopold-von-Ranke-Straße 33, 06571 <strong>Wiehe</strong><br />
quaas-stadtplaner<br />
Schillerstr. 20, 99423 Weimar<br />
Telefon: 03643-494921<br />
Geschätzte Kosten 14.310 € (lt. Projektantrag der RAG Kyffhäuser v. 26.11.2008)<br />
Planungsstand<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont/<br />
Bemerkung<br />
Positives Votum der RAG Kyffhäuser zur Umsetzung der<br />
Maßnahme liegt vor (Priorität 1), Förderantrag beim ALF gestellt<br />
Richtlinie „Revitalisierung“, ENL (Förderung von Maßnahmen zur<br />
Entwicklung von Natur und Landschaft)<br />
Realisierungszeitraum ist Februar bis Juli 2009<br />
M 12
Titel<br />
Handlungsfeld / Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
Geschätzte Kosten Ca. 250.000,00 €<br />
Planungsstand<br />
M 13<br />
Erarbeitung eines Revitalisierungskonzeptes - Industriebrache<br />
„Ehemalige Möbelfabrik Möbia“ in <strong>Wiehe</strong>. Durchführung ist<br />
2011 vorgesehen.<br />
(Kap. 5.6.3.2)<br />
Siedlungsbau und Breitband-Infrastruktur / Revitalisierung von<br />
Brachflächen<br />
Begründung der Maßnahme: das Gelände der ehemaligen<br />
Möbelfabrik „Möbia“ (Gesamtfläche von 5395m²) liegt seit ihrer<br />
Schließung überwiegend brach. Leerstehende Gebäude verfallen,<br />
Freiflächen verwildern. Die alte Fabrikantenvilla weist eine<br />
erhaltenswerte Bausubstanz auf, verfällt aber zunehmend.<br />
Gewerbliche Nachnutzungen für das gesamte Areal konnten<br />
bisher nicht erzielt werden. Lediglich zwei Teilbereiche wurden<br />
veräußert und werden gewerblich genutzt (Dachdeckerbetrieb und<br />
Tischlerei)<br />
Inhalte der Maßnahme:<br />
� Rückbau leer stehender Gebäude und Anlagen der<br />
ehemaligen Möbelfabrik „Möbia“,<br />
� Erstellung eines Konzepts für die Freiflächengestaltung,<br />
� Sanierung und Umnutzung der Fabrikantenvilla,<br />
� Schaffung einer parkähnlichen Grünfläche.<br />
Auf der Fläche sind bestehende Gewerbebetriebe und die<br />
Fabrikantenvilla in die Gestaltung einzubinden.<br />
Durch Abriss und Rückbau der industriellen Anlagen werden die<br />
Entsiegelung des Geländes und eine Verbesserung der<br />
Umweltsituation auf dem Gelände erreicht. Durch Grünflächengestaltung<br />
wird die Attraktivität des nördlichen Ortseingangs<br />
erhöht. Die Maßnahme unterstützt damit die Entwicklung<br />
touristischer Potentiale in der Region.<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong><br />
Bürgermeisterin Dagmar Dittmer<br />
Bauamtsleiter Bernhard Kammel<br />
Leopold-von-Ranke-Straße 33, 06571 <strong>Wiehe</strong><br />
Beschluss des <strong>Stadt</strong>rats zum Erwerb der Flächen mit dem Ziel der<br />
Durchführung der Revitalisierungsmaßnahme wurde gefasst. Ein<br />
Antrag auf Förderung des Vorhabens wurde seitens des ALF<br />
Gotha/Worbis negativ beschieden.<br />
M 13
Titel<br />
Netzwerkinitiative<br />
„Umweltbildung in der Hohen Schrecke“<br />
(Kap. 5.7.2.2)<br />
Handlungsfeld / Leitthema Bildung und Kultur / Angebote in der Umweltbildung<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger<br />
Ansprechpartner<br />
M 14<br />
Die „Hohe Schrecke“ besitzt viele naturräumliche und<br />
kulturhistorische Potentiale, die bisher zu wenig für die<br />
Umweltbildung erkannt und genutzt werden. Akteure, die in<br />
unterschiedlichsten Kontexten bereits in der Umweltbildung<br />
tätig sind, haben bisher kaum Kenntnis von weiteren Aktivitäten<br />
im Raum Hohe Schrecke. Strategisch aufgebaute und<br />
aufeinander abgestimmte Angebote in der Umweltbildung<br />
bestehen bisher nur punktuell.<br />
Ziele der Netzwerkinitiative sind daher:<br />
- Zusammenbringen von Akteuren unterschiedlichster<br />
Handlungsbereiche und Handlungsebenen<br />
- konzeptionelle Entwicklung einer integrierten<br />
Umweltbildung im Sinne des Leitbilds „Hohe Schrecke –<br />
Alter Wald mit Zukunft“<br />
- Entwicklung und Austausch von Projektideen<br />
- Knüpfen von Kontakten und Initiierung von Kooperationen<br />
- Gemeinsame Aktivierung personeller und finanzieller<br />
Ressourcen für Umweltbildungsvorhaben<br />
Umweltbildung wird insbesondere in Verknüpfung mit dem<br />
Naturschutzgroßprojekt zunehmend zu einem relevanten<br />
Thema der Regionalentwicklung. In Verbindung mit der<br />
Entwicklung eines naturbezogenen Tourismus erschließen sich<br />
weitere Potentiale für einen „Umweltbildungstourismus“.<br />
Das Netzwerk wird von seinen Mitgliedern gleichberechtigt<br />
getragen.<br />
Herr Brombacher<br />
Ländliche Heimvolkshochschule Thüringen e.V.<br />
Kloster Donndorf 6, 06571 Donndorf; Tel.: 034672/851-0<br />
In Zukunft evtl. das Regionalmanagement des Vereins „Hohe<br />
Schrecke – Alter Wald mit Zukunft“<br />
Geschätzte Kosten Umweltbildungskonzept/Netzwerkentwicklung ca. 50.000 €<br />
Planungsstand<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont/Bemerkung<br />
Das Netzwerk hat sich am 14.8.2009 auf einem<br />
Strategieworkshop gegründet und ist offen für weitere<br />
Interessierte.<br />
Eine Förderung durch das Naturschutzgroßprojekt für Konzepte<br />
ist möglich<br />
Langfristig / Projekte der Umweltbildung sollten einen Bezug zur<br />
Hohen Schrecke haben, damit sie im Rahmen des<br />
Naturschutzgroßprojekts förderfähig sind<br />
M 14
Titel<br />
„Grünes Klassenzimmer“ auf dem Kirschberg<br />
(Oberheldrungen)<br />
(Kap. 5.7.2.2)<br />
Handlungsfeld / Leitthema Bildung und Kultur / Angebote in der Umweltbildung<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
Geschätzte Kosten Ca. 6.000 €<br />
Planungsstand<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont /<br />
Bemerkung<br />
M 15<br />
Ziel ist die Einrichtung eines „Grünen Klassenzimmers“ auf dem<br />
Kirschberg in Oberheldrungen. Die Schmücke-Grundschule hat die<br />
Patenschaft über eine Streuobstwiese übernommen.<br />
Folgende Maßahmen sollen im Jahreskreis durchgeführt werden:<br />
� Winter– Pflegemaßnahmen (Januar),<br />
� Frühjahr – Baumpflanzaktion,<br />
� Sommer – Naturfest (Stationsbetrieb mit Themen zum<br />
Arten- und Biotopschutz, gesunde Ernährung, Klimaschutz<br />
usw.),<br />
� Herbst – Herbstprojekte zu Naturthemen (z.B. rund um die<br />
Kartoffel, der Apfel u. a.).<br />
Das Vorhaben soll sowohl visuelle Entdeckungen ermöglichen als<br />
auch motorische Fähigkeiten stärken. Unter anderem sind<br />
folgende Objekte geplant:<br />
� Waldbienenhaus,<br />
� Baumtelefon,<br />
� Wald-Xylophon,<br />
� Futterstellen,<br />
� Brutstätten,<br />
� Anschauungstafeln,<br />
� Naturspielplatz (Balancierbalken, Baumtreppe).<br />
Das „Grüne Klassenzimmer“ soll von Schülern ebenso genutzt<br />
werden wie von Wanderern und Touristen. Das Angebot im Bereich<br />
der Umweltbildung soll somit qualitativ und quantitativ ergänzt<br />
werden.<br />
Gemeinde Oberheldrungen<br />
Bürgermeisterin Oberheldrungen Frau K. Klimek<br />
Schulleiterin der Schmücke-Grundschule Heldrungen Frau C.<br />
Landes<br />
Planung vorhanden, Maßnahme am 14.8.2009 in Workshop zum<br />
Netzwerk Umweltbildung eingebracht.<br />
Evtl. über Nachhaltigkeitszentren in Thüringen, eine Förderung<br />
über das Naturschutzgroßprojekt ist möglich.<br />
Umsetzung bis 2015 / entscheidend für eine Förderung über das<br />
Naturschutzgroßprojekt ist eine langfristige Nutzung und Pflege<br />
der Flächen.<br />
M 15
Titel<br />
Handlungsfeld / Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
Planungsstand<br />
Geschätzte Kosten Ca. 4 Mio. Euro<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont/<br />
Bemerkung<br />
M 16<br />
„Lernen unter einem Dach“ - Schulneubau für die Klassen 1-<br />
10<br />
(Kap. 5.7.2.2)<br />
Bildung und Kultur / Angebote in der Umweltbildung<br />
Ziel ist der Neubau einer Regeschule und Grundschule für die<br />
Klassen 1-10 zwischen Heldrungen und Oldisleben.<br />
Folgende umweltbezogene Maßahmen des Bildungskonzept<br />
sollen umgesetzt werden:<br />
� Gemeinsame Pflege der Streuobstwiesen in Heldrungen und<br />
Oldisleben<br />
� Arbeitsgemeinschaft Junger Naturforscher<br />
� Betreuung eines Amphibienschutzzaunes an der B85<br />
� Anbau alter Kräuter im Schulgartenunterricht<br />
� Bau von Nist- und Bruthilfen im Fach Werken bzw. Natur und<br />
Technik<br />
� Anlage eines Feuchtbiotops<br />
� Nutzung regenerativer Energien<br />
� Nutzung der Räumlichkeiten für Vorträge und<br />
Erwachsenenqualifizierung<br />
Ermöglicht klassenübergreifenden Unterricht, Nutzung auch für<br />
Vereine für Fortbildung und Veranstaltungen, Barrierefreiheit<br />
garantiert auch geistig und körperlich Behinderten eine<br />
Ausbildung am Ort.<br />
Maßnahme leistet damit einen Beitrag zur Erhaltung der<br />
Bildungsqualität im ländlichen Raum, zur Steigerung der<br />
Verbundenheit der Schüler mit ihrer Heimat und schafft<br />
Voraussetzungen für generationenübergreifende Vernetzung.<br />
PT: n.n./ AP: Vorsitzende des Vereins der Freunde und Förderer der<br />
Schmücke-Grundschule Heldrungen. Fr. K. Wolf<br />
Leiterin der Schmücke-Grundschule Heldrungen, Fr. C. Landes<br />
Projektdesign und -kalkulation der Bauhausuniversität Weimar<br />
liegen vor (Stand 13.05.2009)<br />
Schulbauförderrichtlinie des Landes Thüringen<br />
Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Medien<br />
Referat 35, Werner-Seelenbinder-Straße 8 , 99096 Erfurt<br />
Förderung über das Naturschutzgroßprojekt wenn Neubau nach<br />
Niedrigenergiestandards<br />
langfristig<br />
M 16
Titel<br />
„Naturhaus Garnbach“ – Ausbau zur THEPRA -<br />
Umweltbildungsstätte<br />
(Kap. 5.7.2.2)<br />
Handlungsfeld / Leitthema Bildung und Kultur / Angebote in der Umweltbildung<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger<br />
Ansprechpartner<br />
Geschätzte Kosten Ca. 100.000,00 €<br />
M 17<br />
In <strong>Wiehe</strong>, Ortsteil Garnbach wurde Mitte der 1990er Jahre<br />
begonnen, eine Bildungs- und Begegnungsstätte in der alten<br />
Schule einzurichten. Nach Auslaufen der Förderprojekte über den<br />
zweiten Arbeitsmarkt kamen die Angebote zum Erliegen.<br />
Aus der Konkursmasse des HEUREKA e. V. erwarb der THEPRA<br />
Landesverband Thüringen e. V. das Objekt und nutzte es fortan als<br />
generationsübergreifende Begegnungsstätte. Eine weitergehende<br />
und intensivere Nutzung ist beim aktuellen Ausbaus-Stand nicht<br />
möglich.<br />
Ziel ist es, das Objekt zu sanieren und weiter auszubauen sowie in<br />
Abstimmung mit dem Arbeitskreis Umweltbildung Thüringen e. V.<br />
eine Umweltbildungs- und Begegnungsstätte vor allem für Kinder,<br />
Jugendliche und Familien zu etablieren.<br />
Auf der Grundlage des Thüringer Bildungsplanes von 0 – 10 Jahren<br />
werden Bildungsangebote entsprechend den sieben<br />
Bildungsbereichen sowie der Bildung für nachhaltige Entwicklung<br />
(BNE) und entsprechend der örtlichen/regionalen Gegebenheiten<br />
im Naturraum „Hohe Schrecke“ und dem nahegelegenen<br />
Unstruttal konzipiert. Dazu werden auch erlebnispädagogische<br />
und touristische Komponenten einbezogen.<br />
Die Möglichkeiten der vereinseigenen Radausleihstation in <strong>Wiehe</strong><br />
werden dazu mit genutzt.<br />
THEPRA Landesverband Thüringen e. V.<br />
Bahnhofstraße 6, 99947 Bad Langensalza<br />
� 03603 / 8264-0 � 03603 / 82 64 64<br />
� thepra-lv-thueringen@onlinehome.de<br />
Herr Albrecht<br />
� 03603 / 8264-0 � 03603 / 82 64 64<br />
� thepra-lv-thueringen@onlinehome.de<br />
Planungsstand Bauplanung vorhanden, muss aktualisiert und präzisiert werden.<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont /<br />
Bemerkung<br />
Außensanierung ist über die Dorferneuerung förderfähig, hierzu<br />
ist Kontakt zum ALF Gotha und zur RAG Kyffhäuser zu knüpfen;<br />
weitere Förderungen z.B. über das Naturschutzgroßprojekt<br />
chance.natur sind zu prüfen.<br />
Ab 2010 / eine anteilige Förderung durch das Naturschutzgroßprojekt<br />
ist bei einer energieeffzienten Sanierung möglich.<br />
M 17
Titel<br />
Handlungsfeld /<br />
Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger<br />
Geschätzte Kosten n.n.<br />
Planungsstand Ideenskizze vorhanden<br />
Sanierung des Pfarrhauses Altenbeichlingen und<br />
Einrichtung eines Dorfgemeindezentrums<br />
(Kap. 5.6.2.2)<br />
Siedlungsbau und Breitband-Infrastruktur / Erhaltung<br />
historischer Bausubstanz<br />
Entwicklung eines Dorfgemeindezentrums in Verbindung mit<br />
der Wiederherstellung bzw. baulichen Neukonzeption des<br />
ehemaligen Pfarrhauses und der Umgestaltung des<br />
dazugehörigen Grundstückes zu einer öffentlich genutzten<br />
Gesamtanlage<br />
Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden:<br />
� Baulich-funktionelle Neukonzipierung des Pfarrhauses<br />
(Prüfung der Varianten: Sanierung, Abriss, Teilabriss)<br />
� Gestaltung des Pfarrgrundstücks (ca. 1600 m²) und<br />
gestalterische Anbindung an Dorfkern („Edelhof“)<br />
M 18<br />
Zielstellung:<br />
� Pfarrgrundstück und Dorfkern werden gestalterisch und<br />
funktional als Gesamtanlage geplant.<br />
� Infrastrukturelle Ergänzung zur Bonifatiuskirche<br />
(„Musik“-Kirche)<br />
Pfarrhaus in Altenbeichlingen (Foto: K.-H. Stöpel)<br />
Projektträger n.n.<br />
Ansprechpartner:<br />
Karl-Heinz Stöpel, ev. Kirchengemeinde Altenbeichlingen<br />
Finanzierung/Förderung Förderrichtlinie Integrierte Ländliche Entwicklung<br />
Umsetzungshorizont/Bemerkung<br />
Vorhaben befindet sich nicht im Projektgebiet des<br />
Naturschutzgroßprojekts<br />
M 18
Titel<br />
Waldinformationszentrum Schloss <strong>Wiehe</strong><br />
(Kap. 5.7.2.2)<br />
Handlungsfeld / Leitthema Bildung und Kultur / Angebote in der Umweltbildung<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
Planungsstand<br />
Geschätzte Kosten Ca. 700.000 €<br />
Finanzierung/Förderung<br />
Umsetzungshorizont /<br />
Bemerkung<br />
M 19<br />
Das Waldinformationszentrum ist eine Lern- und Bildungsstätte<br />
für die ökologische Funktion und die natürlichen Abläufe im Wald.<br />
Es ergänzt das Lernangebot in der freien Natur und stellt ein<br />
Freizeitangebot an „Schlechtwettertagen“ dar.<br />
Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden:<br />
Aufbau einer musealen Einrichtung zum Greifen und Begreifen mit<br />
Themen zur Landschaft der Hohen Schrecke, dem alten<br />
Wald/Urwald und seiner Geschichte, dem Ökosystem Wald und<br />
den darin vorkommenden Arten, der Waldbewirtschaftung.<br />
Zielstellung:<br />
� Gestaltung eines touristischen Attraktionspunktes,<br />
� Verstärken der Erlebbarkeit des Waldes mit allen Sinnen,<br />
� Erhöhung des Touristischen Angebotes zwecks Einwerbung<br />
von Touristen.<br />
Projektträger:<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong><br />
Leopold -v.-Ranke-Str. 33<br />
06571 <strong>Wiehe</strong><br />
Ansprechpartner:<br />
Bürgermeisterin Dagmar Dittmer<br />
Telefon: 034672/8920<br />
Bauamtsleiter Bernhard Kammel<br />
Telefon: 034672/8922<br />
Projektidee innerhalb der Machbarkeitsstudie<br />
„Regionalentwicklung Hohe Schrecke“<br />
Förderung über das Naturschutzgroßprojekt ist bei<br />
energieeffzienter Sanierung des Gebäudes und Inanspruchnahme<br />
städtebaulicher Förderungen sind zu prüfen, Förderung des<br />
Umweltbildungsangebots über Förderung zur Bildung für<br />
Nachhaltige Entwicklung ist zu prüfen.<br />
Langfristig<br />
M 19
Titel<br />
Handlungsfeld / Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
Planungsstand Projektidee<br />
Geschätzte Kosten unbekannt<br />
Finanzierung/Förderung -<br />
Umsetzungshorizont /<br />
Bemerkung<br />
Kräuterwegeprojekt Langenroda<br />
(Kap. 5.4.3.2)<br />
Tourismus und Erholung / Touristische Routen und<br />
Themenwege<br />
Bildung und Soziales / Angebote zur Umweltbildung<br />
Rund um Langenroda soll ein Kräuterwanderweg eingerichtet<br />
werden. Kräuter sind entsprechend zu beschriften und<br />
Schautafeln aufzustellen, in denen Interessantes und<br />
Unterhaltsames übe einzelne Kräuter berichtet wird<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> in Zusammenarbeit mit Andrea Bachmann<br />
(Dorfstr.38, 06571 Langenroda, 034672/91329,<br />
musa.bachmann@t-online.de)<br />
-<br />
M 20<br />
M 20
Titel<br />
Handlungsfeld / Leitthema<br />
Standort und Inhalte der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
Planungsstand Projektidee<br />
Geschätzte Kosten Ca. 60 TEUR<br />
Finanzierung/Förderung -<br />
Umsetzungshorizont /<br />
Bemerkung<br />
M 21<br />
Bildungseinrichtung für Seminare zu Kräutern und gesunder<br />
Ernährung inkl. Ferienwohnung<br />
(5.4.2.2)<br />
Tourismus und Erholung / Touristische Infrastruktur und<br />
Angebote<br />
Bildung und Soziales / Angebote zur Umweltbildung<br />
Geplant ist der den Ausbau des ehemaligen Dorfkonsums zu einer<br />
Ferienwohnung, die all jenen Übernachtung und<br />
Urlaubsunterkunft sein soll, die in und um Langenroda Erholung<br />
suchen. In dem Zusammenhang muss das Gebäude, das in den<br />
50er Jahren des 20.Jhd. entstanden ist, saniert und modernisiert<br />
werden.<br />
Gleichzeitig soll in den Räumlichkeiten eine Möglichkeit<br />
geschaffen werden, Kräuterseminare und ähnliche<br />
Bildungsveranstaltungen (z.B. zum Thema „Gesunde Ernährung“)<br />
durchzuführen.<br />
Den Teilnehmern sollen dabei Möglichkeiten aufgezeigt werden,<br />
auf welche Weise Pflanzen aus nächster Umgebung zur Steigerung<br />
des Wohlbefindens eingesetzt werden können. Insbesondere<br />
geplant ist die Einbeziehung von Kindern, bei denen der Bedarf<br />
besonders hoch erscheint, die Schätze der Natur näher<br />
kennenzulernen. Langenroda und seine Umgebung bietet den<br />
Interessierten ideale Möglichkeiten, Natur und Umwelt zu<br />
erkunden und am praktischen Beispiel zu erfahren. Ziel ist es<br />
dabei, Teilnehmer in den naheliegenden Ballungsgebieten und<br />
der Region selbst zu finden.<br />
Nicht zuletzt bildet eine Kombination aus Ferienwohnung und<br />
Bildungseinrichtung eine Möglichkeit, die Auslastung des<br />
Gebäudes zu verbessern.<br />
Stefan und Andrea Bachmann (Dorfstr.38, 06571 Langenroda,<br />
034672/91329, musa.bachmann@t-online.de)<br />
Bis ca. Ende 2011<br />
M 21
Titel<br />
Handlungsfeld / Leitthema<br />
Standort und Inhalt der<br />
Maßnahme<br />
Projektträger und<br />
Ansprechpartner<br />
Planungsstand<br />
Geschätzte Kosten<br />
Finanzierung / Förderung<br />
Umsetzungshorizont /<br />
Bemerkung<br />
Furnierwerk mit Biomasse-BHKW an der<br />
„Hohen Schrecke“<br />
(Kap. 5.5.3.2)<br />
Land- und Forstwirtschaft – Regionale<br />
Produktvermarktung/Regionale Energieerzeugung<br />
Im Zuge der umweltpolitischen Ziele und Strategien werden<br />
wirtschaftliche Produktions- und Nutzungseinheiten entwickelt und<br />
vernetzt. Aus der pfleglichen Forstwirtschaft der Hohen Schrecke<br />
werden sowohl High-End-Produkte als auch Biomasse-Energie<br />
geschaffen.<br />
M 22<br />
Folgen Maßnahmen sollen durchgeführt werden<br />
Aufbau und Stärkung energieeffizienter Wertschöpfungsketten<br />
Errichtung eines Furnierwerkes zur Produktion hochwertiger<br />
Holzoberflächen (hochdekorative und regionalspezifische Echtholz-<br />
Furniere) gekoppelt mit hocheffizientem Blockheizkraftwerk<br />
Zielstellung:<br />
� Schaffung von beständigen Arbeitsplätzen in der Region<br />
� Nutzung nachwachsender Rohstoffe der Region zur Herstellung<br />
von Echtholz-Furnieren<br />
� Weiterverarbeitung der Reste zur Bio-Energieerzeugung mit<br />
effizienter Nutzung aller hervorgebrachten Energiearten (Wärme)<br />
� Pilotprojekt mit wiss. Begleitung (TU Dresden)<br />
Holz-Design HARTUNG, Donndorf, Kleinrodaer Str. 2<br />
Tischlerei HEYSER, Donndorf, Bahnhofstraße 13<br />
Ing.-Büro Dr. KÖNIG, Roßleben, Glück-Auf-Str. 6<br />
Projektidee innerhalb der Machbarkeitsstudie<br />
„Regionalentwicklung Hohe Schrecke“<br />
ca. 9.5 Mio. €<br />
Förderung über das Naturschutzgroßprojekt ist bei energie-effizienter<br />
Errichtung von Furnierwerk mit BHKW und Inanspruchnahme<br />
regionaler Förderprogramme zu prüfen,<br />
Förderung der regionalen Wirtschaft / Gewerbes über Förderung<br />
nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung ist zu prüfen.<br />
Mittelfristig<br />
M 22
Nr.<br />
Maßnahmenblatt<br />
Maßnahme<br />
HF Tourismus, Erholung und Landschaft (TEL)<br />
LT 1: Touristische Infrastruktur und Angebote<br />
M2<br />
Ausbau altes Feuerwehrhaus zum<br />
Tourismusstützpunkt<br />
Projektziel/-inhalt<br />
(sofern bereits ausformuliert)<br />
Ausbau des Angebots "Ferien auf dem<br />
Bauernhof".<br />
TEL LF SI BK<br />
Status<br />
UF =<br />
umsetzungsfähig<br />
GK = Grobkonzept<br />
PI = Projektidee<br />
räumlicher<br />
Bezug<br />
Fristigkeit<br />
x x UF Braunsroda mittelfristig<br />
Verbindung zu<br />
anderen<br />
Konzepten<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008,<br />
Leitprojekt 2b<br />
Maßnahmenträger/<br />
Bearbeitung (sofern bereits<br />
bekannt)<br />
<strong>Stadt</strong> Heldrungen und Kristin<br />
u. Georg von Bismarck<br />
M3 Wanderherberge Gehofen<br />
Sanierung des alten Pfarrhauses, Ergänzung mit<br />
modernem Anbau<br />
x x UF Gehofen mittelfristig Die Bauhütte S. 71<br />
M4 Mühlencafé und Mühlenmuseum Gehofen Sanierung der Wassermühle x x UF Gehofen langfristig Herr Gebhardt S. 71<br />
M5 Haus auf dem Berge Sanierung des Brunnens x x UF Hauteroda mittelfristig Tobias Knabe S. 71<br />
M6 "Unstrut-Radel-Express"<br />
M8<br />
M9<br />
M10<br />
Ländlicher Wegebau / Weg „Nordrand Hohe<br />
Schrecke“ zwischen Reinsdorf und <strong>Wiehe</strong><br />
(Reinsdorf – <strong>Wiehe</strong>)<br />
Ländlicher Wegebau / Weg „Südrand Hohe<br />
Schrecke“ – Ausbau „Finnebahndamm“<br />
(Großmonra – Bachra – Rastenberg –(Lossa, in<br />
Sachsen-Anhalt)<br />
Ländlicher und forstlicher Wegebau / Weg von<br />
Burgwenden nach Langenroda als Nord-Süd-<br />
Verbindung durch das Waldgebiet der Hohen<br />
Schrecke<br />
M11 Ländlicher Wegebau "Weg an der Schafau"<br />
Kinder- und Jugenddorf "Am Windberg" -<br />
Urlaubsangebote im ländlichen Raum<br />
Aussichtsplattform in Gestalt eines Hochstands<br />
an zentraler Wegekreuz in der Hohen Schrecke<br />
Agrartourismus - Fortbildung und<br />
Wissensvermittlung durch landwirtschaftliche<br />
Fachexkursionen<br />
M19 Waldinformationszentrum im Schloss <strong>Wiehe</strong><br />
Infrastruktur der Eisenbahn zwischen Artern und<br />
Nebra erhalten<br />
x UF Reinsdorf - Nebra mittelfristig<br />
Ausbau einzelner landwirtschaftlicher Wege x x UF Reinsdorf - <strong>Wiehe</strong> mittelfristig<br />
Instandsetzung des Wegs x x UF<br />
Verbesserung der Befahrbarkeit vorhandener<br />
Wege<br />
Verbesserung der Befahrbarkeit vorhandener<br />
Wege<br />
x x UF<br />
x x UF<br />
Großmonra -<br />
Rastenberg<br />
Burgwenden -<br />
Langenroda<br />
Battgendorf-<br />
Ostramondra<br />
mittelfristig<br />
kurzfristig<br />
Errichtung neuer Ferienwohnungen x GK Beichlingen mittelfristig<br />
Schaffung eines zentralen Ziels im Waldgebiet<br />
der Hohen Schrecke<br />
Fachexkursionen und Fortbildungsreisen für<br />
fachlich interessierte Reisegruppen<br />
Ausbau des Schlosses zu einem<br />
Waldinformationszentrum als Lern- und<br />
Bildungsstätte<br />
x x GK<br />
Donndorf-Nausitzmittelfristig<br />
Gehofen<br />
x x x GK Hohe Schrecke kurzfristig<br />
Organisation von Events für die Hohe Schrecke x PI Hohe Schrecke<br />
Geschichte des Weinbaus an der Unstrut –<br />
Ursprung in <strong>Wiehe</strong><br />
Vermarktung der <strong>Stadt</strong> Heldrungen als<br />
„Zwiebelstadt“<br />
Entwicklung Gesamtkonzept zum Thema<br />
„Bildungstourismus“<br />
Trägt zur<br />
Zielerreichung des<br />
Handlungsfelds…<br />
bei<br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
Seite<br />
<strong>ILEK</strong><br />
S. 70<br />
IG Unstrutbahn e.V. S. 75<br />
Verein "Hohe Schrecke - Alter<br />
Wald mit Zukunft"<br />
S. 73<br />
Landratsamt Sömmerda S. 73<br />
Gemeinde Großmonra und<br />
Landratsamt Sömmerda<br />
S. 73<br />
mittelfristig Gemeinde Großmonra S. 75<br />
RAG Sömmerda-<br />
Jugendherberge Beichlingen S. 77<br />
Erfurt 2007<br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
Verein "Hohe Schrecke - Alter<br />
Wald mit Zukunft"<br />
Ländliche<br />
Heimvolkshochschule<br />
Thüringen e.V.<br />
x x PI <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> langfristig <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> S. 109<br />
Verein "Hohe Schrecke - Alter<br />
Wald mit Zukunft"<br />
x x PI <strong>Wiehe</strong> S. 79<br />
x PI Heldrungen<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008,<br />
Leitprojekt 2d,<br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
x x PI Hohe Schrecke S. 79<br />
S. 77<br />
S. 78<br />
S. 79<br />
S. 79
Nr.<br />
Maßnahmenblatt<br />
Maßnahme<br />
Einrichtung eines „Wiegental – Urwald –<br />
Erlebnispfads“<br />
Projektziel/-inhalt<br />
(sofern bereits ausformuliert)<br />
Trägt zur<br />
Zielerreichung des<br />
Handlungsfelds…<br />
bei<br />
TEL LF SI BK<br />
Status<br />
UF =<br />
umsetzungsfähig<br />
GK = Grobkonzept<br />
PI = Projektidee<br />
räumlicher<br />
Bezug<br />
x x PI Nausitz<br />
Instandsetzung des Naturlehrpfads in Beichlingen x x PI Beichlingen<br />
Bessere touristische Einbeziehung der<br />
Monraburg<br />
Infopunkt am zu verlängernden Geopfad zum<br />
Thema Geologischer Aufschluss<br />
Sanierung und Nachnutzung der alten<br />
Konsumhalle zu einer Sport- und<br />
Begegnungsstätte (z.B. Kegelbahn,<br />
Wanderertreff)<br />
südlich von <strong>Wiehe</strong> auf Plateau,<br />
Ausbau touristischer Parkplätze zu Rastplätzen Aussichtsplattform am Hochwasserbehälter an<br />
der L 217 Richtung Lossa<br />
Ausbau des Radwegs Roßleben-<strong>Wiehe</strong> (L<br />
1217)<br />
Transfersystem (Kleinbus) zur touristischen<br />
Anbindung von <strong>Wiehe</strong> an die „Unstrut-Bahn“<br />
Einrichtung von Wanderparkplätzen mit<br />
Infotafeln, Eingang Hohe Schrecke in <strong>Wiehe</strong>, OT<br />
Langenroda und Garnbach<br />
<strong>Stadt</strong>park <strong>Wiehe</strong>: Weiterentwicklung des Kulturund<br />
Tourismuszentrums<br />
Modellbahn <strong>Wiehe</strong>: Anpassung und Erweiterung<br />
der Ausstellung<br />
Ausbau von Übernachtungskapazitäten in der<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong><br />
Touristische Inwertsetzung von<br />
Handwerksbetrieben, z.B. Gläserne Böttcherei in<br />
<strong>Wiehe</strong><br />
Turm der Zeitreisenden<br />
Thematische Infopavillons an den<br />
Eingangswegen der Hohen Schrecke<br />
LT 2: Routen und Themenwege<br />
Aussichts- und Informationsturm im Waldgebiet<br />
der Hohen Schrecke, Schaffung eines<br />
Besuchermagneten<br />
Fristigkeit<br />
Verbindung zu<br />
anderen<br />
Konzepten<br />
Maßnahmenträger/<br />
Bearbeitung (sofern bereits<br />
bekannt)<br />
Verein "Hohe Schrecke - Alter<br />
Wald mit Zukunft"<br />
Gemeinde Beichlingen,<br />
Jugendherberge Beichlingen<br />
x x PI Beichlingen S. 79<br />
x x PI Beichlingen<br />
Gemeinde Beiichlingen,<br />
Geopark Kyffhäuser e.V.<br />
x PI Ostramondra Gemeinde Ostramondra S. 79<br />
x PI <strong>Wiehe</strong><br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008<br />
Seite<br />
<strong>ILEK</strong><br />
S. 79<br />
S. 79<br />
S. 79<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> S. 79<br />
x PI <strong>Wiehe</strong> Städte <strong>Wiehe</strong> und Roßleben S. 79<br />
x PI <strong>Wiehe</strong><br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
x PI <strong>Wiehe</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> S. 79<br />
x x PI <strong>Wiehe</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> S. 79<br />
x PI <strong>Wiehe</strong> Modellbahn <strong>Wiehe</strong> S. 79<br />
x PI <strong>Wiehe</strong> S. 79<br />
x PI <strong>Wiehe</strong> S. 79<br />
x x PI<br />
Donndorf-Nausitz-<br />
Gehofen<br />
x x PI Hohe Schrecke<br />
M20 Kräuterwegeprojekt Langenroda Errichtung eines Kräuterwanderweges x x UF Langenroda<br />
Projekt "Mystic Garden" - Skulpturenwege -<br />
Naturschutz und Kunst<br />
Sichtbarmachung alter Wüstungen (z.B.<br />
Wetzelshain, Burg Rabenswald)<br />
Wildobstlehrpfad in Langenroda<br />
„Das gelbe Band der Hohen Schrecke“<br />
Darstellung von Sagen und Geschichten als<br />
Holzskulpturen, Schaffung eines Skulpturenwegs<br />
Alte Wüstungen sollen wieder freigestellt und so<br />
erlebbar werden<br />
Etablierung des Wildobstlehrpfades in<br />
Langenroda mit Beschilderung<br />
Einheitliche Bepflanzung von Ackerrändern zur<br />
Gestaltung einer temporären Route<br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
Kommunen der<br />
Planungsregion<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> und A.<br />
Bachmann<br />
x x GK Hohe Schrecke Herr Krüger S. 81<br />
x x GK Hohe Schrecke S. 81<br />
x x PI Langenroda S. 81<br />
x PI Hohe Schrecke S. 82<br />
S. 79<br />
S. 79<br />
S. 79<br />
S. 82
Nr.<br />
Maßnahmenblatt<br />
Maßnahme<br />
Kirchen und Klöster unter Einbindung der<br />
Pfarrhäuser<br />
Projektziel/-inhalt<br />
(sofern bereits ausformuliert)<br />
Trägt zur<br />
Zielerreichung des<br />
Handlungsfelds…<br />
bei<br />
TEL LF SI BK<br />
Status<br />
UF =<br />
umsetzungsfähig<br />
GK = Grobkonzept<br />
PI = Projektidee<br />
räumlicher<br />
Bezug<br />
Fristigkeit<br />
Verbindung zu<br />
anderen<br />
Konzepten<br />
Maßnahmenträger/<br />
Bearbeitung (sofern bereits<br />
bekannt)<br />
Einrichtung Themenweg x x PI Hohe Schrecke S. 82<br />
Vernetzung und Ausbau der Reitwege x PI Hohe Schrecke<br />
Ausweitung des Geopfads Unstrut-Hohe<br />
Schrecke<br />
x x PI Beichlingen<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008,<br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008<br />
Kommunen der<br />
Planungsregion<br />
Gemeinde Beiichlingen,<br />
Geopark Kyffhäuser e.V.<br />
Naturempfinden: Geomantischer Pfad x PI Hohe Schrecke S. 82<br />
Konzept zur innerörtlichen Besucherlenkung x PI <strong>Wiehe</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> S. 82<br />
Projekt Radweg "Auf den Spuren der Ur-Ilm"<br />
Kooperationsprojekt: <strong>Integriertes</strong> Wegekonzept<br />
(iWK)<br />
LT 3: Informationsmanagement und Marketing<br />
M1<br />
Marketingkonzept Tourismus für die Region Hohe<br />
Schrecke<br />
Schaffung einer Verbindung zwischen Ilm-<br />
Radwanderweg/Städteketteradweg und Unstrut-<br />
Radweg/GeoPark Kyffhäuser)<br />
Erstellung eines Marketingkonzepts mit zeitnaher<br />
Umsetzung erster Maßnahmen<br />
x PI Hohe Schrecke<br />
x PI Hohe Schrecke<br />
x UF Hohe Schrecke<br />
nach<br />
Projektbaustein<br />
unterschiedlich<br />
Logo Hohe Schrecke Produktlogo für die zukünftige Vermarktung x x UF Hohe Schrecke kurzfristig<br />
Wanderbroschüre "Hohe Schrecke-Finne-<br />
Schmücke"<br />
Digitaler Regionaler Wanderführer<br />
Gestaltung einer Wanderbroschüre x x GK Hohe Schrecke mittelfristig<br />
Lenkungs- und Informationssystem, Verbindung<br />
mit HörErlebnis Kyffhäuser und geocoaching<br />
x x GK Hohe Schrecke mittelfristig<br />
Seite<br />
<strong>ILEK</strong><br />
S. 82<br />
S. 82<br />
RAG Sömmerda-<br />
RAG Sömmerda-Erfurt S. 82<br />
Erfurt 2007<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008<br />
Leitprojekt 1<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008 Leitprojekt<br />
2<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008,<br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
Verein "Hohe Schrecke - Alter<br />
Wald mit Zukunft"<br />
Verein "Hohe Schrecke - Alter<br />
Wald mit Zukunft"<br />
Verein "Hohe Schrecke - Alter<br />
Wald mit Zukunft"<br />
Verein "Hohe Schrecke - Alter<br />
Wald mit Zukunft"<br />
Vermarktung der Mühlenroute Stärkere Vermarktung des Mühlenwanderwegs x GK Hohe Schrecke mittelfristig S. 86<br />
Teilnahme / Bewerbung beim Thüringer<br />
Wandertag<br />
Zusammenarbeit mit Medien<br />
auf die Region aufmerksam machen, z.B. MDR<br />
Wandertage, Plattformen aller Partner für<br />
Marketing nutzen (Internet)<br />
PI Hohe Schrecke<br />
x PI Hohe Schrecke<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008<br />
Besucherlenkung mittels Internet x x PI Hohe Schrecke S. 86<br />
Erstellung eines regionalen<br />
Veranstaltungskalenders "Hohe Schrecke"<br />
x x PI Hohe Schrecke<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008,<br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
Verein "Hohe Schrecke - Alter<br />
Wald mit Zukunft"<br />
S. 82<br />
S. 84<br />
S. 84<br />
S. 85<br />
S. 85<br />
S. 86<br />
S. 86<br />
S. 86
Nr.<br />
Maßnahmenblatt<br />
Maßnahme<br />
Ausbau der Konzertreihe im Kultur- und<br />
Kunstzentrum <strong>Wiehe</strong><br />
Thematische Schwerpunkte „Schlösser und<br />
Burgen“ sowie „Persönlichkeiten der Region“ als<br />
Grundlage für regionale Marketingkonzepte<br />
Verbesserung der Werbung bezüglich Service-<br />
und Ausleihstellen für Fahrräder und Kanus<br />
Verbesserung der Tourismusinformation <strong>Wiehe</strong><br />
Projektziel/-inhalt<br />
(sofern bereits ausformuliert)<br />
(z.B. Vernetzung mit Pensionen, Aktualisierung<br />
der Ausschilderungen) sowie Entwicklung eines<br />
Gesamtkonzepts für das <strong>Stadt</strong>marketing<br />
LT 4: Landschaftsentwicklung<br />
Pflege von Streuobstwiesen<br />
Pflege der seit mehreren Jahrzehnten nicht<br />
genutzten Hohlwege<br />
Förderung der Entwicklung des Grünlandes zu<br />
extensiv genutzten Feuchtwiesen<br />
HF Land- und Forstwirtschaft (LF)<br />
LT 5: Regionale Produktvermarktung<br />
Pflege z.B. der Wiese am Schloss Beichlingen<br />
mit alten Kirschsorten<br />
M7 Regionaler Holzmarkt<br />
Einrichtung von Verarbeitungsbetrieben, insbes.<br />
Obstverwertung, für landwirtschaftliche Produkte<br />
wie Saft unter Nutzung ehemaliger LPG-Gebäude<br />
Holzmarkt, der als Grundlage für die<br />
Vermarktung dient<br />
LT 6: Regionale Energienutzung<br />
M22<br />
Furnierwerk mit Biomasse-BHKW an der Hohen<br />
Schrecke<br />
Trägt zur<br />
Zielerreichung des<br />
Handlungsfelds…<br />
bei<br />
TEL LF SI BK<br />
Status<br />
UF =<br />
umsetzungsfähig<br />
GK = Grobkonzept<br />
PI = Projektidee<br />
räumlicher<br />
Bezug<br />
Fristigkeit<br />
Verbindung zu<br />
anderen<br />
Konzepten<br />
Maßnahmenträger/<br />
Bearbeitung (sofern bereits<br />
bekannt)<br />
x x PI <strong>Wiehe</strong> S. 86<br />
x PI Hohe Schrecke S. 86<br />
x PI Hohe Schrecke S. 86<br />
x PI <strong>Wiehe</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> S. 86<br />
x PI Beichlingen S. 87<br />
Hohlwege Vittelweg, Holzweg, Kummerweg x PI Reinsdorf Gemeinde Reinsdorf S. 87<br />
Nutzung des Holzes der Hohen Schrecke als<br />
High-End-Produkte und zur Gewinnung von<br />
Biomasse-Energie<br />
x x PI <strong>Wiehe</strong> S. 87<br />
x x UF Hohe Schrecke kurzfristig<br />
x x PI<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>, OT<br />
Hechendorf:<br />
x PI Donndorf mittelfristig<br />
Ausbildung regionaler Energieberater x x PI Hohe Schrecke<br />
Erarbeitung innovativer Konzepte zur<br />
Energieversorgung der Zukunft<br />
Bioenergiedorf Hauteroda: Eine Zusammenarbeit<br />
der Markus-Gemeinschaft und der Kommune<br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
Seite<br />
<strong>ILEK</strong><br />
Reinhard Kruspe S. 90<br />
Holz-Design Hartung,<br />
Tischlerei Heyer, Ing.Büro<br />
König<br />
x PI Hohe Schrecke S. 93<br />
x PI Hauteroda<br />
S. 91<br />
S. 93<br />
S. 93<br />
Gemeinde Hauteroda, Markus-<br />
S. 93<br />
Gemeinschaft<br />
„Kompetenzzentrum Holz“<br />
LT 7: Soziale und naturnahe Landwirtschaft<br />
Entwicklung eines regionalen Zentrums für die<br />
Forstwirtschaft<br />
x PI <strong>Wiehe</strong> S. 93<br />
„Lehrpfad Landwirtschaft“<br />
Auf den Feldern werden die Fruchtarten mit<br />
Schildern versehen<br />
x x x GK Hohe Schrecke mittelfristig S. 95<br />
Verstärktes Angebot von (Sozial-)Praktika x x PI Hohe Schrecke S. 95<br />
"Mosterei vor Ort" x x PI Hohe Schrecke S. 95<br />
Historische Land- und Forstwirtschaft ein Bildungsprojekt mit Kindern x x PI Hohe Schrecke S. 95<br />
Verstärkung der Umweltbildung im Bereich der<br />
Forstwirtschaft<br />
x x PI Hohe Schrecke S. 95
Nr.<br />
Maßnahmenblatt<br />
M18<br />
Maßnahme<br />
HF Siedlungsbau und IT-Infrastruktur (SI)<br />
LT 8: Erhaltung historischer Bausubstanz<br />
Sicherung/Sanierung des Pfarrhauses in<br />
Altenbeichlingen<br />
Erhaltung und Nutzung des denkmalgeschützten<br />
Bahnhofsgebäudes Donndorf<br />
Entwicklung des Gebäudeensembles Schoss,<br />
Schlossteich, Landgut, Paulsteich und St. Marien<br />
Kirche<br />
Sanierung und Nachnutzung des Gutshofes<br />
„Weißbarthaus“<br />
Projektziel/-inhalt<br />
(sofern bereits ausformuliert)<br />
Trägt zur<br />
Zielerreichung des<br />
Handlungsfelds…<br />
bei<br />
TEL LF SI BK<br />
Status<br />
UF =<br />
umsetzungsfähig<br />
GK = Grobkonzept<br />
PI = Projektidee<br />
räumlicher<br />
Bezug<br />
Fristigkeit<br />
Entwicklung eines Dorfgemeindezentrums x x UF Beichlingen langfristig<br />
Verbindung zu<br />
anderen<br />
Konzepten<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008,<br />
Leitprojekt 5c,<br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
Maßnahmenträger/<br />
Bearbeitung (sofern bereits<br />
bekannt)<br />
Kirchgemeinde Kölleda<br />
(Altenbeichlingen)<br />
x x PI Donndorf IG Unstrutbahn e.V. S. 97<br />
x x PI Ostramondra<br />
Seite<br />
<strong>ILEK</strong><br />
S. 97<br />
RAG Sömmerda-<br />
Gemeinde Ostramondra S. 97<br />
Erfurt 2007<br />
x x x PI Ostramondra Gemeinde Ostramondra S. 98<br />
Sanierung des Dorfteiches x x PI Beichlingen Gemeinde Beichlingen S. 98<br />
Bonifatius-Kirche Altenbeichlingen Sicherung und Dachsanierung x x PI Beichlingen<br />
Kirchgemeinde Kölleda<br />
(Altenbeichlingen)<br />
S. 98<br />
Erhaltung der alten Ziegelei (um 1900) x x PI Gehofen Gemeinde Gehofen S. 98<br />
Umbau des alten Kulturhauses in Hauteroda x x PI Hauteroda Gemeinde Hauteroda S. 98<br />
Sanierung der alten Holländermühle im Norden<br />
von Hauteroda<br />
x x PI Hauteroda S. 98<br />
Gutshof v. Bismarck - Alter Futterturm x x PI Braunsroda Kristin u. Georg von Bismarck S. 98<br />
Gutshof v. Bismarck - Ausbau der Kapelle zu<br />
einer Autobahnkirche<br />
Gutshof v. Bismarck: Sanierung östlicher<br />
Wohnflügel in Fachbauweise<br />
Bürgerwerkstatt <strong>Wiehe</strong><br />
Umsetzung der Dorferneuerungsmaßnahme in<br />
<strong>Wiehe</strong> OT Garnbach ab 2010<br />
<strong>Stadt</strong>- und Dorfentwicklung zur Beseitigung<br />
städtebaulicher Missstände in <strong>Wiehe</strong><br />
Schloss mit Schlosspark <strong>Wiehe</strong>:<br />
Sicherungsmaßnahmen, Ausbau des<br />
Schlossgebäudes<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong>, OT Langenroda: Nutzung von<br />
Gebäuden in historischer Ortslage für<br />
Übernachtungen<br />
LT 9: Brachflächenrevitalisierung<br />
Revitalisierungskonzept ehemaliges<br />
M12<br />
Kiesabbaugebiet und ehemalige Schuhfabrik<br />
Revitalisierung Gewerbebrache ehemalige<br />
M13<br />
Möbelfabrik "Möbia"<br />
x x PI Braunsroda Kristin u. Georg von Bismarck S. 98<br />
Nachnutzung zu Ferienwohnungen x x PI Braunsroda Kristin u. Georg von Bismarck S. 98<br />
Nachnutzung eines Leerstehenden Gebäudes -<br />
Bürgercafé am Marktplatz<br />
x x PI <strong>Wiehe</strong><br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008<br />
Leitprojekt 6<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> S. 98<br />
x x PI Garnbach Gemeinde Garnbach S. 98<br />
x x PI <strong>Wiehe</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> S. 98<br />
x x PI <strong>Wiehe</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> S. 98<br />
x x PI Langenroda S. 98<br />
Nachnutzung zu touristischen Zwecken x x UF <strong>Wiehe</strong> kurzfristig <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> S: 100<br />
Rückbau leer stehender Gebäude x x UF <strong>Wiehe</strong> langfristig <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> S. 100
Nr.<br />
Maßnahmenblatt<br />
Maßnahme<br />
Abriss und Rekultivierung der alten Schuhfabrik<br />
an Kiesseen in <strong>Wiehe</strong> als 2. Teilprojekt der<br />
"Renaturierung" von Kiesseen <strong>Wiehe</strong><br />
Förderung von Kleingewerbe und Handwerk auf<br />
Nutzungsbrachen und ungenutzten Gebäuden<br />
LT 10: Breitband-Technologie<br />
Ausbau der Breitband-Technologie<br />
HF Bildung und Kultur (BK)<br />
LT 11: Umweltbildung<br />
M14<br />
M15<br />
M16<br />
Netzwerkinitiative Umweltbildung in der Hohen<br />
Schrecke<br />
Grünes Klassenzimmer auf dem Kirschberg<br />
Oberheldrungen<br />
"Lernen unter einem Dach" - Schulneubau für die<br />
Klassen 1-10<br />
Projektziel/-inhalt<br />
(sofern bereits ausformuliert)<br />
Strategisches Ziel, kein konkretes Vorhaben im<br />
Rahmen des <strong>ILEK</strong> geplant<br />
Aufbau eines Netzwerks zum Austausch und zur<br />
Zusammenarbeit<br />
Einrichtung eines "Grünen Klassenzimmers" auf<br />
dem Kirschberg<br />
Neubau einer Grund- und Regelschule für die<br />
Klassen 1-10<br />
Trägt zur<br />
Zielerreichung des<br />
Handlungsfelds…<br />
bei<br />
TEL LF SI BK<br />
Status<br />
UF =<br />
umsetzungsfähig<br />
GK = Grobkonzept<br />
PI = Projektidee<br />
räumlicher<br />
Bezug<br />
Fristigkeit<br />
Verbindung zu<br />
anderen<br />
Konzepten<br />
Maßnahmenträger/<br />
Bearbeitung (sofern bereits<br />
bekannt)<br />
x x PI <strong>Wiehe</strong> S: 100<br />
Seite<br />
<strong>ILEK</strong><br />
x PI Hohe Schrecke S. 100<br />
x x PI Hohe Schrecke<br />
x UF Hohe Schrecke langfristig<br />
M17 Naturhaus Garnbach, Thepra e.V. Sanierung des Objekts und weiterer Ausbau x x UF Garnbach mittelfristig<br />
Sanierung des Naturlehrpfades am Kloster<br />
Donndorf<br />
Neue St.-Peter- und Pauls-Kirche in Donndorf –<br />
Informationen zur Geschichte<br />
Sanierung des Naturlehrpfads im<br />
Kuckuckswäldchen<br />
Entwicklung von Maßnahmen zur Umweltbildung<br />
ehemaliger Steinbruch Garnbach: Nutzung für<br />
Holzskulpturen oder Bildungs- und<br />
Ausbildungsangebote im Bereich Kunst und<br />
Natur<br />
M19 Waldinformationszentrum im Schloss <strong>Wiehe</strong><br />
M21<br />
Bildungseinrichtung für Seminare zu Kräutern<br />
und gesunder Ernährung, inkl. Ferienwohnung<br />
LT 12: Angebote in der beruflichen Aus- und Weiterbildung<br />
Ausbildung von zertifizierten Natur- und<br />
Landschaftsführern für die Region "Hohe<br />
Schrecke"<br />
Einrichtung einer Projektstelle, Entwicklung von<br />
Maßnahmen<br />
Ausbau des Schlosses zu einem<br />
Waldinformationszentrum als Lern- und<br />
Bildungsstätte<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008<br />
Leitprojekt 6<br />
Kommunen der<br />
Planungsregion<br />
Ländliche<br />
Heimvolkshochschule<br />
Thüringen e.V.<br />
S. 102<br />
S. 108<br />
x UF Oberheldrungen mittelfristig Gemeinde Oberheldrungen S. 108<br />
x UF Heldrungen langfristig Frau K. Wolf S. 108<br />
THEPRA Landesverband<br />
Thüringen e.V.<br />
x x PI Donndorf Gemeinde Donndorf S. 108<br />
x x PI Donndorf S. 108<br />
x x PI <strong>Wiehe</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> S. 108<br />
x PI Donndorf<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008<br />
Heimvolkshochschule<br />
Donndorf<br />
S. 108<br />
S. 108<br />
x PI Garnbach Herr Krüger S. 109<br />
x x PI <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> langfristig <strong>Stadt</strong> <strong>Wiehe</strong> S. 109<br />
Ausbau des ehem. Dorfkonsums x x PI Langenroda kurzfristig A. Bachmann S. 109<br />
Ausbildung regionaler Akteure zu zertifizierten<br />
Natur- und Landschaftsführern (ZNL)<br />
x x GK Hohe Schrecke mittelfristig<br />
RAG Kyffhäuser<br />
2008,<br />
Projektantrag<br />
idee.natur<br />
Verein "Hohe Schrecke - Alter<br />
Wald mit Zukunft"<br />
S. 111
Nr.<br />
Maßnahmenblatt<br />
Maßnahme<br />
Entwicklung eines Aus- und<br />
Weiterbildungszentrums "Windberg"<br />
Unterstützung durch Experten zur Qualifizierung<br />
für naturnahen Tourismus<br />
Projektziel/-inhalt<br />
(sofern bereits ausformuliert)<br />
Ausbildungen für Dienstleistungen im Bereich<br />
sanfter Tourismus<br />
Qualifizierungsmaßnahmen für touristische<br />
Leistungsanbieter<br />
Trägt zur<br />
Zielerreichung des<br />
Handlungsfelds…<br />
bei<br />
TEL LF SI BK<br />
Status<br />
UF =<br />
umsetzungsfähig<br />
GK = Grobkonzept<br />
PI = Projektidee<br />
räumlicher<br />
Bezug<br />
x x PI Beichlingen<br />
Fristigkeit<br />
Verbindung zu<br />
anderen<br />
Konzepten<br />
Maßnahmenträger/<br />
Bearbeitung (sofern bereits<br />
bekannt)<br />
Seite<br />
<strong>ILEK</strong><br />
RAG Sömmerda-<br />
Erfurt 2007,<br />
Leitprojekt 5<br />
Jugendherberge Beichlingen S. 111<br />
x x PI Hohe Schrecke S. 112