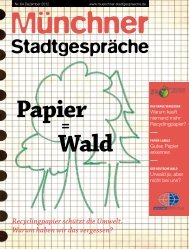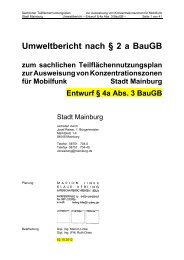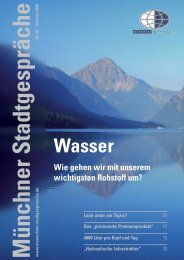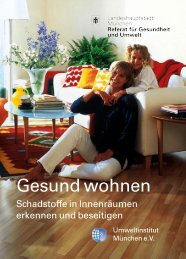Münchner Stadtgespräche - Umweltinstitut München e.V.
Münchner Stadtgespräche - Umweltinstitut München e.V.
Münchner Stadtgespräche - Umweltinstitut München e.V.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
einer Gesellschaft, die Zugriff auf die Autodatenbanken<br />
elf westeuropäischer Staaten<br />
hat. Die Maut beträgt acht Pfund, ungeachtet<br />
der Verweildauer in der Zone, der<br />
zurückgelegten Entfernung und des Fahrzeugtyps.<br />
Daran gibt es Kritik, und wir untersuchen<br />
jetzt verschiedene Möglichkeiten,<br />
um das zu ändern und so die Effekte<br />
verschiedener Fahrten und Fahrzeuge besser<br />
widerzuspiegeln.<br />
<strong>München</strong> setzt in erster Linie auf Parklizenzgebiete,<br />
um den innerstädtischen Verkehr<br />
zu reduzieren: Anwohner haben Ausweise,<br />
alle anderen müssen bezahlen,<br />
wenn sie parken wollen. Hatten Sie Ähnliches<br />
für London auch mal angedacht, bevor<br />
die Entscheidung für die Maut fiel?<br />
Es gibt in London ein ähnliches System, bei<br />
dem die tägliche Parkgebühr für die von<br />
außerhalb kommenden Autofahrer viel höher<br />
ist als die jährliche für die Anwohner.<br />
Dieses System hat schon einige Jahre vor<br />
Einführung der Maut existiert. Es hat aber<br />
nach unserer Meinung nicht ausgereicht,<br />
um die Pendler zu entmutigen, mit dem<br />
Auto in das Stadtzentrum zu fahren. Und es<br />
hat den Verkehr nicht reduziert, der nur<br />
durchfährt. Nach unserer Schätzung sind<br />
es 2003 20 Prozent gewesen, die weder<br />
Start noch Ziel im Zentrum hatten.<br />
Haben sich schon potenzielle Nachahmer<br />
erkundigt, wie es bei Ihnen in London funktioniert?<br />
Fünf große US-amerikanische Städte wie<br />
zum Beispiel New York und San Francisco<br />
haben Geld von der Regierung bekommen,<br />
um Projekte zur Vermeidung von Verkehrsstaus<br />
zu entwickeln. Wir haben in letzter<br />
Zeit intensive Diskussionen mit Vertretern<br />
dieser Städte gehabt. Es gibt weltweit Interesse<br />
an der Maut. Meine Kollegen und<br />
ich haben Informationen an asiatische,<br />
afrikanische, südamerikanische und europäische<br />
Großstädte weitergegeben.<br />
Ist <strong>München</strong> auch dabei gewesen?<br />
Soweit ich weiß, nein.<br />
E-Mail-Interview: Thomas Rath<br />
Fotos: pixelio.de / sixtine (unten), TfL<br />
Angst vor der Freiheit<br />
In Deutschland wird gerne und heftig über<br />
Schule diskutiert. Aber selten darüber, wie<br />
Kinder am besten lernen.<br />
Es hat erstaunlich lange gedauert, bis<br />
die Eltern aufgewacht sind. Doch<br />
jetzt scheint es so weit zu sein.<br />
Immer mehr Menschen sagen laut und<br />
vernehmlich, was bislang eher privat geäußert<br />
wurde: Das „G8“, das achtjährige<br />
Gymnasium, überfordert die meisten<br />
Schüler und deren Familien. Selten sind<br />
sich die Kommentatoren der großen Tages-<br />
und Wochenzeitungen so einig wie<br />
bei diesem Thema. Unisono kritisieren sie,<br />
wie wenig Zeit die Stofffülle den Schülern<br />
lässt – Zeit für Musik, Sport, Spiel,<br />
Lebenszeit.<br />
So berechtigt diese Kritik ist, so sehr erstaunt<br />
das verklärte Bild vom Gymnasium,<br />
das damit transportiert wird. Als sei die<br />
Welt vor der Einführung des G8 noch in<br />
Ordnung gewesen; als sei die Kindheit<br />
bislang vollkommen unbeschwert und<br />
Schule ein Hort von Kreativität und umfassender<br />
Bildung gewesen. Wenn sich auf<br />
einmal so viele Lehrinhalte als anscheinend<br />
entbehrlich herausstellen – warum<br />
hat sich vorher niemand beschwert? Wenn<br />
Chemie in der achten Klasse oder Erdkunde<br />
in der siebten auf einmal doch nicht so<br />
furchtbar wichtig sein soll – wieso haben<br />
sich die Eltern so lange damit abgefunden,<br />
dass ihre Kinder dies alles lernen mussten?<br />
In Wahrheit geht es bei der ganzen Diskussion<br />
nicht um „Bildung“ oder darum, was<br />
junge Menschen vernünftigerweise wissen,<br />
können und kennen lernen müssen,<br />
um in einem zivilisierten Land selbstständig<br />
und menschenwürdig leben zu können.<br />
Es geht darum, Zugangsberechtigungen zu<br />
erteilen: Wer darf studieren? Wer bekommt<br />
die gutbezahlten Jobs? Wer wird<br />
später Erfolg und Einfluss haben?<br />
Das Gymnasium galt solange als erfolgreiche<br />
Schulform, wie nur die Kinder der anderen<br />
versagt haben. Kinder ausländischer<br />
Herkunft, Kinder sozial schwacher Eltern,<br />
Kinder, die zu schüchtern, zu langsam, zu<br />
zappelig oder zu unangepasst waren, wurden<br />
schon immer aussortiert, querversetzt,<br />
abgestuft. Das war in Ordnung und wurde<br />
gesellschaftlich akzeptiert. Doch auf einmal<br />
sind stabile Familienverhältnisse,<br />
Wohlstand und bürgerliche Herkunft kein<br />
Garant mehr, bis zum Abitur durchzuhalten.<br />
Auf einmal sind die Versagensängste in<br />
der Mitte der Gesellschaft angekommen –<br />
das geht dann doch zu weit.<br />
An einer echten Bildungsreform, an einer<br />
Schule, die wirklich kindgerecht und lebensdienlich<br />
wäre, sind allerdings nur we-<br />
<strong>Münchner</strong> <strong>Stadtgespräche</strong> Nr. 48/49 05/2008<br />
11