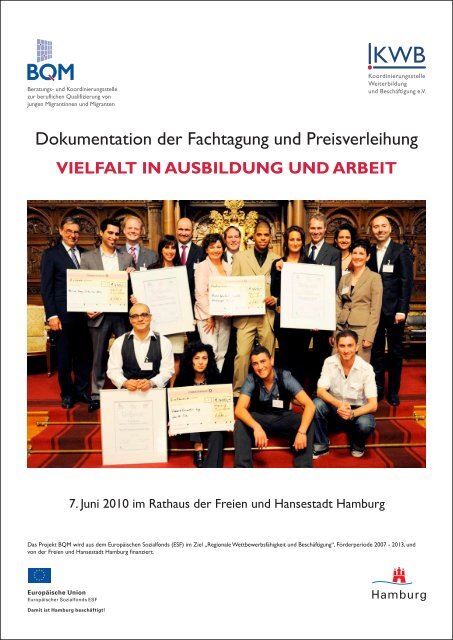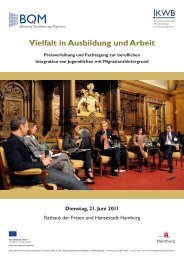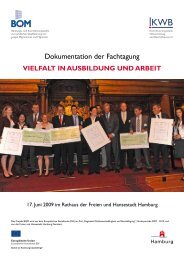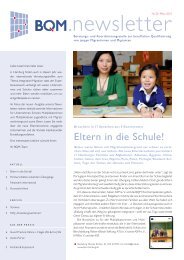Fachtagung 2010 - BQM
Fachtagung 2010 - BQM
Fachtagung 2010 - BQM
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Dokumentation der <strong>Fachtagung</strong> und Preisverleihung<br />
Vielfalt in ausbildung und arbeit<br />
7. Juni <strong>2010</strong> im Rathaus der Freien und Hansestadt Hamburg<br />
Das Projekt <strong>BQM</strong> wird aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) im Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“, Förderperiode 2007 - 2013, und<br />
von der Freien und Hansestadt Hamburg finanziert.
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Impressum<br />
Titel Dokumentation der <strong>Fachtagung</strong> „Vielfalt in Ausbildung und Arbeit“ –<br />
7. Juni <strong>2010</strong> im Hamburger Rathaus<br />
Herausgeber KWB – Koordinierungsstelle Weiterbildung und Beschäftigung e. V.<br />
Haus der Wirtschaft<br />
Kapstadtring 10<br />
22297 Hamburg<br />
Tel. 040 637855-00<br />
Fax 040 637855-99<br />
www.kwb.de<br />
info@kwb.de<br />
Projekt <strong>BQM</strong> – Beratungs- und Koordinierungsstellezur beruflichen<br />
Qualifizierung von jungen Migrantinnen und Migranten<br />
www.bqm-hamburg.de<br />
Fotos © Jörg Müller<br />
Redaktion Funda Erler<br />
Lektorat Monika Ehmke<br />
eralp@kwb.de, ehmke@kwb.de<br />
2
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Inhalt<br />
Vorwort 5<br />
Tagungsprogramm 7<br />
Begrüßung Christa Goetsch – Zweite Bürgermeisterin der Freien und<br />
Hansestadt Hamburg 8<br />
Anmoderation Hansjörg Lüttke – Geschäftsführender Vorstand KWB e. V. 13<br />
Keynote I<br />
Dr. Thomas Liebig – OECD 16<br />
Preisverleihung<br />
Grußwort Uli Wachholtz – Präsident UVNord Vereinigung der Unternehmensverbände<br />
in Hamburg und Schleswig-Holstein e. V. 26<br />
Laudationes <strong>BQM</strong>-Vertreter/-innen 30<br />
Keynote II<br />
Monika Rühl – Leiterin Change Management und Diversity, Deutsche Lufthansa AG 36<br />
Podiumsdiskussion<br />
„Regionales Übergangsmanagement und Migration“ 45<br />
Thematische Foren<br />
Forum 1 „Eine glückliche Beziehung“<br />
Partnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen 49<br />
Forum 2 „Gute Besserung und Alhamdulillah“<br />
Interkulturelle Öffnung im Gesundheitsbereich 58<br />
Forum 3 „Den Abschluss im Gepäck“<br />
Zur Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse 67<br />
3
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Forum 4 „Wissen wie es weitergeht“<br />
Interkulturell sensible Beratung in Schule, Berufsorientierung und<br />
Arbeitsvermittlung 74<br />
Forum 5 „Starke Tandems“<br />
Mentoring in Öffentlicher Verwaltung und Privatwirtschaft als Beitrag 80<br />
zur Chancengleichheit<br />
Zusammenfassung und Ausblick 92<br />
Danksagung 94<br />
4
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Christa Goetsch – Zweite Bürgermeisterin der Freien und<br />
Hansestadt Hamburg<br />
„Exzellente Fachkräfte tragen ent-<br />
scheidend zu wirtschaftlichem Wohlstand<br />
und gesellschaftlicher Entwicklung bei. Wir<br />
brauchen in Deutschland gut ausgebildete<br />
junge Leute, die die Herausforderungen in<br />
Wirtschaft, Gewerbe, Handwerk und<br />
Handel meistern können. Es gilt deshalb<br />
alle Talente zu fördern, Vorbehalte zu<br />
überwinden und Jugendliche mit<br />
Migrationshintergrund einzuladen, ihre<br />
Arbeitskraft und ihren Erfahrungsschatz in<br />
Unternehmen einzubringen.“<br />
„Migrantinnen und Migranten besitzen<br />
Kompetenzen, die sehr wertvoll sind:<br />
Mehrsprachigkeit und Kenntnis der ver-<br />
schiedenen Kulturen. Hamburg braucht<br />
diese Talente. Deshalb möchten wir allen<br />
Jugendlichen gute Chancen in Bildung und<br />
Ausbildung ermöglichen. Entscheidend ist,<br />
ihre individuellen Fähigkeiten zu erkennen<br />
und alles zu tun, damit sie diese in Beruf<br />
und Arbeit einbringen können.“<br />
Ole von Beust – Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt<br />
Hamburg<br />
5
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Vorwort<br />
Die zum sechsten Mal stattfindende Preis-<br />
verleihung und <strong>Fachtagung</strong> „Vielfalt in<br />
Ausbildung und Arbeit“ machte <strong>2010</strong><br />
innovative Praxisbeispiele der gelungenen<br />
beruflichen Integration einem breiten<br />
Fachpublikum sichtbar. Sie ermöglichte<br />
den Teilnehmer/-innen sich über Good<br />
Practices im Bereich Diversity<br />
Management auszutauschen, migrations-<br />
spezifische Themen zu diskutieren und<br />
innovative Ansätze in der Förderung von<br />
Auszubildenden mit Migrationshintergrund<br />
kennenzulernen.<br />
In einer feierlichen Zeremonie wurden<br />
Unternehmen ausgezeichnet, die sich vor-<br />
bildlich für Jugendliche mit Migrations-<br />
hintergrund einsetzen.<br />
Die diesjährigen Preisträger sind:<br />
• Kühne + Nagel (AG & Co.) KG,<br />
• Auto Wichert GmbH Ulzburger<br />
Straße und<br />
• Haar & Cosmetic by Mister No.<br />
Die Veranstaltung ist Teil des „Aktions-<br />
plans zur Bildungs- und Ausbildungs-<br />
förderung junger Menschen mit<br />
Migrationshintergrund“ und wird von der<br />
<strong>BQM</strong> gemeinsam mit der Vereinigung der<br />
Unternehmensverbände in Hamburg und<br />
Schleswig-Holstein e. V. (UVNord) durch-<br />
geführt.<br />
Zweite Bürgermeisterin Christa Goetsch mit den<br />
Preisträgern <strong>2010</strong><br />
6
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Tagungsprogramm<br />
09:30 – 10:00 Ankunft und Begrüßungskaffee<br />
10:00 – 10:15 Begrüßung und Eröffnungsrede<br />
Christa Goetsch – Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg<br />
10:15 – 10:20 Anmoderation<br />
10:20 – 10:40 Keynote 1<br />
Hansjörg Lüttke – Geschäftsführender Vorstand KWB e. V.<br />
Dr. Thomas Liebig – OECD<br />
10:40 – 11:05 Preisverleihung<br />
11:05 – 11:20 Keynote 1I<br />
Uli Wachholtz – Präsident UVNord – Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg<br />
und Schleswig-Holstein e. V.<br />
Monika Rühl – Leiterin Change Management und Diversity, Deutsche Lufthansa AG<br />
11:20 – 11:30 Musikalisches Intermezzo<br />
�����������������<br />
11:30 – 12:30 Podiumsdiskussion<br />
Karl Gernandt – Delegierter des Verwaltungsrates Kühne + Nagel<br />
International AG<br />
Mely Kiyak – Freie Journalistin und Autorin<br />
Dr. Thomas Liebig – OECD<br />
12:30 – 14:00 Mittagspause<br />
Monika Rühl – Leiterin Change Management und Diversity, Lufthansa<br />
Mark Terkessidis – Freier Autor und Journalist<br />
Moderation: Julia-Niharika Sen – NDR<br />
14:00 – 16:00 Thematische Foren<br />
7
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation<br />
Begrüßung Christa Goetsch -<br />
Zweite Bürgermeisterin der Freien und<br />
Hansestadt Hamburg<br />
Sehr geehrter Herr Wachholtz,<br />
sehr geehrter Herr Dr. Liebig,<br />
sehr geehrter Herr Lüttke,<br />
meine sehr verehrten Damen und Herren,<br />
ich darf Sie ganz herzlich hier im Rathaus<br />
im Namen des Senats der Freien und<br />
Hansestadt begrüßen und freue mich, dass<br />
heute wieder dieser wunderbare Preis<br />
„Vielfalt in Ausbildung und Arbeit“ ver-<br />
liehen wird.<br />
Im Aktionsplan zur „Bildungs- und Aus-<br />
bildungsförderung junger Menschen mit<br />
Migrationshintergrund“, der 2006 vom<br />
Ersten Bürgermeister gestartet wurde,<br />
ziehen alle an einem Strang: private und<br />
öffentliche Unternehmen, die Arbeits-<br />
agentur und die team.arbeit.hamburg, die<br />
<strong>BQM</strong>, der Unternehmensverband Nord,<br />
Gewerkschaften, die Handels- und die<br />
Handwerkskammer und Behörden.<br />
Das ist schon ein beachtlicher Zu-<br />
sammenschluss, den man nicht oft genug<br />
hervorheben kann. Unser gemeinsames<br />
Ziel war und ist es, auf die Potenziale und<br />
Chancen aufmerksam zu machen, die wir<br />
in Hamburg, in den vielen jungen<br />
Menschen mit Migrationshintergrund, mit<br />
Einwanderungsgeschichte, haben.<br />
Begrüßungsrede von der Zweiten Bürgermeisterin<br />
Christa Goetsch<br />
Wir wollen alle gemeinsam die Ausgangs-<br />
bedingungen für diese Jugendlichen ver-<br />
bessern, damit sie ihr Können in Schule<br />
und in der Berufsausbildung voll entfalten<br />
können. Wenn sie zeigen können, was in<br />
ihnen steckt, wenn sie merken, dass ihnen<br />
jemand etwas zutraut und ihre Leistungen<br />
anerkennt, wachsen diese Jugendlichen oft<br />
regelrecht über sich hinaus und sind<br />
dadurch wieder Vorbilder für andere. Ich<br />
glaube dieser Bewusstseinswandel ist das,<br />
was wir dringend brauchen:<br />
8
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Denn es gilt heute, – auch vor dem<br />
Hintergrund der demografischen Ent-<br />
wicklung – umso mehr: Hamburg braucht<br />
alle Talente!<br />
In der ersten Phase des Aktionsplans ging<br />
es darum, möglichst viele Ausbildungs-<br />
plätze für Jugendliche mit Migrations-<br />
hintergrund bereitzustellen. Mittlerweile<br />
haben wir die Ziele wesentlich aus-<br />
geweitet.<br />
Einen besonderen Schwerpunkt bilden<br />
Partnerschaften zwischen Schulen und<br />
Unternehmen. Diese Partnerschaften<br />
unterstützen viele Jugendliche sehr erfolg-<br />
reich, den Übergang von Schule in die<br />
Ausbildung oder das Studium gut zu<br />
meistern. Es gibt mittlerweile ein wunder-<br />
bares, sehr anschauliches Handbuch, das<br />
ich allen interessierten Schulen und<br />
Unternehmen, allen „Anfängern“ und<br />
„Fortgeschrittenen“ dieser Partner-<br />
schaften nur wärmstens empfehlen kann!<br />
Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen hier, wie<br />
solche Partnerschaften aufgebaut und gut<br />
geführt werden können.<br />
Ein weiterer Schwerpunkt des aktuellen<br />
Aktionsplans ist die interkulturelle Eltern-<br />
arbeit. Eltern werden als Multiplikator/-<br />
innen geschult, um andere Eltern in einer<br />
Art Schneeballsystem für die Chancen<br />
dualer Ausbildung zu sensibilisieren. Die<br />
Zusammenarbeit, das Vertrauen zwischen<br />
Elternhaus und Schule ist eine ganz<br />
wichtige Basis für den Erfolg der Kinder<br />
und Jugendlichen, das kann ich als ehe-<br />
malige Lehrerin nur bestätigen.<br />
Auch die Workshops, in denen<br />
Hamburger/-innen mit Migrationshinter-<br />
grund, die in Schule oder Beruf erfolgreich<br />
sind, als Vorbilder fungieren und<br />
Schülerinnen und Schüler motivieren und<br />
stärken, laufen weiterhin sehr erfolgreich.<br />
Und zukünftig sollen auch – diesen Bereich<br />
finde ich persönlich sehr wichtig - jugend-<br />
liche und erwachsene Flüchtlinge im<br />
Rahmen unseres Aktionsplanes in ver-<br />
schiedene Projekten integriert und beruf-<br />
lich qualifiziert werden, um auch bei einer<br />
eventuellen Rückkehr in ihr Heimatland<br />
etwas mitzunehmen. Man muss es so deut-<br />
lich sagen: Es ist ein Drama der letzten<br />
Jahrzehnte, dass junge Leute nicht nur<br />
über Monate, sondern über Jahre hier sind<br />
und nichts lernen dürfen und nicht aus-<br />
gebildet werden dürfen.<br />
9
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Sechs Jahre ist es nun her, dass die <strong>BQM</strong>,<br />
gemeinsam mit den Unternehmensver-<br />
bänden Hamburg und Schleswig-Holstein<br />
(UVNord) diesen Förderpreis das erste<br />
Mal engagierten Unternehmen verliehen<br />
hat. Die Unternehmen, die sich inter-<br />
kulturell geöffnet haben, geben den<br />
Jugendlichen die Chance, ihre Potenziale<br />
voll zu entfalten und selbstbewusst und<br />
gestärkt mit einer beruflichen Qualifikation<br />
ihren eigenen Weg zu gehen. Und davon<br />
profitieren nicht nur die Jugendlichen und<br />
ihre Familien, sondern wir alle. Denn der<br />
Zugang zum Arbeitsmarkt und die Teil-<br />
nahme am Erwerbsleben sind wesentliche<br />
Voraussetzungen einer gerechten und<br />
stabilen Gesellschaft. Der Arbeitsplatz als<br />
Ort sozialer Beziehungen ermöglicht<br />
leichter Kontakte zu Menschen der Auf-<br />
nahmegesellschaft zu knüpfen. Die An-<br />
erkennung beruflicher Leistungen ver-<br />
mittelt auch Wertschätzung und das Ge-<br />
fühl, gebraucht zu werden. Und das ist für<br />
jeden Menschen wichtig!<br />
Jugendliche sind unsere Zukunft. Das ist ja<br />
ein Slogan, den jeder und jede mal gern in<br />
den Mund nimmt. Ich glaube aber, dass es<br />
in der Realität hier in Hamburg wirklich in<br />
den letzten Jahren Schritt für Schritt ge-<br />
lungen ist und weiter gelingen wird und<br />
auch gelingen muss, Ausbildungsplätze zu<br />
geben, Arbeitsplätze zu schaffen und sich<br />
auf ganz persönliche Weise für die Gesell-<br />
schaft einzusetzen. Alles, was wir als Ge-<br />
sellschaft für die Bildung und Ausbildung<br />
unserer Kinder und Jugendlichen tun, ist<br />
wichtig für unsere gemeinsame Zukunft.<br />
Und es ist auch etwas, was den sozialen<br />
Frieden bewahrt. Das ist nicht zu unter-<br />
schätzen.<br />
An dieser Stelle möchte ich ganz be-<br />
sonders denen danken, die das Aus-<br />
bildungsnetzwerk so erfolgreich machen.<br />
Ohne diese Zusammenarbeit, die Ko-<br />
operation der verschiedenen Träger, der<br />
Behörden, der Migrantenorganisationen,<br />
der Unternehmen wäre das alles nicht<br />
möglich gewesen. Und ich habe aus der<br />
Erfahrung der letzten zwei Jahren auch<br />
gesehen, was sich für eine Kultur des Mit-<br />
einanders durch diese Initiative entwickelt<br />
hat. Und das ist so viel.<br />
Die <strong>BQM</strong> macht es uns möglich, einmal im<br />
Jahr in diesen wunderschönen Räumen<br />
dieses Thema auch umfangreich zu dis-<br />
kutieren. Ich sage der <strong>BQM</strong> ganz be-<br />
sonders herzlichen Dank.<br />
10
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Trotz vieler Erfolge, die wir in Hamburg in<br />
den vergangenen Jahren erreicht haben,<br />
dürfen wir uns nicht zurücklehnen.<br />
Obwohl inzwischen viele Unternehmen<br />
erkannt haben, dass Auszubildende und<br />
Mitarbeiter mit einer Einwanderungs-<br />
geschichte auf dem internationalen Markt<br />
ein großer Vorteil sind und obwohl sich<br />
schon viele Unternehmen interkulturell<br />
ausrichten, werden immer noch Jugend-<br />
liche mit Migrationshintergrund dis-<br />
kriminiert. Sie werden benachteiligt, weil<br />
sie Serkan, Gül oder Fatih heißen, wie die<br />
jüngste Studie aus Konstanz belegt hat.<br />
Und das dürfen wir nicht hinnehmen. Wir<br />
müssen alles in unserer Macht stehende<br />
tun, um diese Jugendlichen zu unter-<br />
stützen. Zum einen um ihrer selbst willen,<br />
denn so geht man einfach nicht mit<br />
Menschen um, aber auch für alle anderen.<br />
Denn, ich betone es noch einmal, keine<br />
Gesellschaft kann es sich leisten,<br />
die Fähigkeiten seiner Jugendlichen zu ver-<br />
geuden. Keine Gesellschaft kann es sich<br />
leisten, auch nur ein Kind aufzugeben.<br />
Ganz im Gegenteil: Wir müssen uns noch<br />
mehr anstrengen, kritisch zu schauen, was<br />
in unseren Schulen, in Unternehmen oder<br />
im Stadtteil verbessert werden muss.<br />
Wir sind in einem großen Kooperations-<br />
netz und Aktionsbündnis dabei, den Über-<br />
gang von der Schule in den Beruf zu ver-<br />
bessern. Die Berufs- und Studien-<br />
orientierung wird verstärkt, die Stadtteil-<br />
schulen arbeiten verbindlich und<br />
systematisch mit den beruflichen Schulen<br />
zusammen. Und vor allem auch für die<br />
sogenannten Risikoschüler/-innen – ein<br />
ganz fürchterlicher Begriff, weil die<br />
Schüler/-innen ja selbst das Risiken haben,<br />
keine berufliche Perspektive zu finden –<br />
gerade für sie werden die Programme<br />
kontinuierlich aufgebaut.<br />
Aus diesem Grund haben Senat und<br />
Bürgerschaft beschlossen, 500 Plätze an<br />
Produktionsschulen - in jedem Bezirk<br />
mindestens eine - einzurichten.<br />
Damit soll gerade für Jugendliche mit<br />
schlechten Startchancen, zu denen leider<br />
immer noch viele Jugendliche mit<br />
Migrationshintergrund zählen, der Über-<br />
gang in Ausbildung verbessert werden.<br />
Und nicht nur die Schulen, auch die<br />
Unternehmen sind in der Pflicht. Jede<br />
Ausbilderin und jeder Ausbilder muss<br />
schauen, wie der eine oder andere angeb-<br />
11
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
lich nicht „ausbildungsfähige“ Jugendliche<br />
doch ausgebildet werden kann. Denn es ist<br />
leicht zu beklagen, nicht genügend Fach-<br />
kräfte zu haben. Das bringt uns aber nicht<br />
weiter. Die Lösung ist, dass jeder seinen<br />
Beitrag leistet, damit uns niemand verloren<br />
geht. Sowohl die Jugendlichen als auch die<br />
Politik und die Unternehmen sind hier in<br />
der Pflicht.<br />
Wir haben uns als Senat dieser Aufgabe<br />
angenommen und wollen im Bereich der<br />
Integration und Chancengleichheit vorbild-<br />
lich sein. Wir haben zum Beispiel auch den<br />
Anteil junger Menschen mit Migrations-<br />
hintergrund, die die Freie und Hansestadt<br />
Hamburg und ihre Firmen als Arbeitgeber<br />
ausbilden, steigern können. Inzwischen<br />
liegt er bei ca. 15 Prozent. Aber unser Ziel<br />
ist es 20 Prozent zu erreichen.<br />
Unsere Hamburger Bildungsoffensive, die<br />
Schulreform, die ja auch in aller Munde ist,<br />
hat das Ziel, von unten mit einem starken<br />
Fundament die Kinder schon früher zu<br />
fördern. Mit kleineren Klassen, mit mehr<br />
Lehrern und vor allem mit besser aus-<br />
gebildeten Lehrern, um den Kindern früh<br />
schon die Möglichkeit zu geben, sich zu<br />
entwickeln und nicht erst zu reparieren,<br />
wenn das berühmte Kind in den Brunnen<br />
gefallen ist.<br />
Wir sind überzeugt, wir können es<br />
schaffen, dass sich Unternehmen langfristig<br />
nicht mehr, über „nicht ausbildungsfähige<br />
Jugendliche“ beklagen müssen. Und dann<br />
haben Ali, Natalja und Zorana die Chance,<br />
ihren Weg zu finden. Und dann wird unser<br />
Schulsystem wirklich gerechter und<br />
leistungsstärker sein.<br />
Also in diesem Sinne, denke ich, dass wir<br />
alle unseren Beitrag leisten – die Stadt und<br />
der Staat auf der einen Seite, die Unter-<br />
nehmen und die jungen Leute und ihre<br />
Familien auf der anderen Seite. Keiner darf<br />
sagen, „mir doch egal“ oder „Ausbildung<br />
interessiert mich nicht“. Alle müssen mit-<br />
machen, ich bin überzeugt, dass das der<br />
Weg ist. Lassen Sie uns dranbleiben und<br />
nicht aufgeben. Und ich darf an dieser<br />
Stelle schon im Vorwege allen Preisträgern<br />
herzlich gratulieren: Sie sind die Vorbilder!<br />
Ich wünsche uns nun eine interessante<br />
Veranstaltung. Vielen Dank.<br />
12
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Begrüßung Hansjörg Lüttke –<br />
Geschäftsführender Vorstand KWB e. V.<br />
Verehrte Frau Bürgermeisterin, meine<br />
sehr geehrten Damen und Herren Ab-<br />
geordnete der Hamburgischen Bürger-<br />
schaft und Vertreter des konsularischen<br />
Corps, verehrter Herr Wachholtz, liebe<br />
Ehrengäste, meine Damen und Herren,<br />
liebe Kolleginnen und Kollegen,<br />
es ist für mich eine ganz besondere<br />
Freude, Sie heute auf unserer <strong>Fachtagung</strong><br />
und Preisverleihung „Vielfalt in Ausbildung<br />
und Arbeit“, die – wie Sie bereits sagten,<br />
Frau Bürgermeisterin – zum insgesamt<br />
sechsten Mal und zum dritten Mal hier im<br />
Rathaus stattfindet, zu begrüßen. Frau<br />
Goetsch, Sie haben die Leistungen der<br />
<strong>BQM</strong>, sie haben auch die Leistungen, die<br />
auf Initiative der <strong>BQM</strong> von der Hamburger<br />
Wirtschaft, von den Hamburger Ver-<br />
bündeten der <strong>BQM</strong> erbracht wurden,<br />
schon so hinreichend, so exzellent dar-<br />
gestellt, dass ich jetzt in der glücklichen<br />
Lage war, mein Manuskript um die Hälfte<br />
zu streichen. Bessere PR kann man nicht<br />
haben, vielen Dank. Ich möchte aber<br />
trotzdem einige Aspekte noch hervor-<br />
heben, die, glaube ich, hervorhebenswert<br />
sind.<br />
Anmoderation von Hansjörg Lüttke – Geschäftsführender<br />
Vorstand der KWB e. V.<br />
Die <strong>BQM</strong> hat eine Vielzahl von An-<br />
geboten, wie Sie sie angedeutet hatten,<br />
und in der letzten Zeit haben sich die An-<br />
gebote vor allem auch sehr stark<br />
konzentriert auf die Arbeit mit Eltern von<br />
Jugendlichen mit Migrationshintergrund.<br />
Wir haben hier ein außerordentliches<br />
Engagement vieler ehrenamtlich tätiger<br />
Eltern für die Ausbildung von Jugendlichen<br />
im Rahmen ihrer täglichen Arbeit, die so<br />
in dieser Form nicht wahrgenommen wird.<br />
Wir werden diese Arbeit von Eltern am<br />
29.6. hier im Rathaus an gleicher Stelle<br />
besonders prämieren. Und wir werden<br />
diese Arbeit auch entsprechend würdigen.<br />
Und ich bin ganz besonders glücklich<br />
darüber, dass Sie, liebe Bürgermeisterin,<br />
auch diese Prämierung, diese Hervor-<br />
hebung der Leistungen, vornehmen<br />
13
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
werden. Das besondere Engagement der<br />
Eltern mit Zuwanderungsgeschichte haben<br />
wir auch in einer Broschüre dokumentiert,<br />
die auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft<br />
selbstständiger Migranten gemeinsam mit<br />
der <strong>BQM</strong> entstand. Wir würden uns<br />
freuen, wenn Sie zur Verbreitung der<br />
Broschüre beitragen und auch zu unserer<br />
Veranstaltung am 29.6. kommen. Es lohnt<br />
sich wirklich.<br />
Meine Damen und Herren, wir werden<br />
heute Nachmittag in einem Workshop<br />
auch über die Frage der Anerkennung aus-<br />
ländischer Abschlüsse diskutieren. Gerade<br />
die Anerkennung von im Heimatland er-<br />
worbenen Abschlüssen ist für viele Zu-<br />
wanderer insbesondere auch eine Frage<br />
der Wertschätzung einer einmal er-<br />
brachten Leistung und ihrer Person, wie<br />
ich in vielen Gesprächen und Diskussionen<br />
gerade in den letzten Monaten erfahren<br />
habe. Ich würde mir wünschen, dass wir es<br />
besonders unter diesem Aspekt in Zukunft<br />
leichter machen mit der Anerkennung von<br />
Abschlüssen, die im Ausland erworben<br />
wurden.<br />
Ohne finanzielle Förderung aus Mitteln der<br />
Behörde für Schule und Berufsbildung, der<br />
Behörde für Wirtschaft und Arbeit sowie<br />
des Europäischen Sozialfonds wäre die<br />
Arbeit der <strong>BQM</strong> nicht möglich.<br />
Im Namen aller, die von der Förderung<br />
profitiert haben und noch profitieren<br />
werden, darf ich mich dafür herzlichst be-<br />
danken und gleichzeitig zusichern, weiter-<br />
hin alle Kraft in die erfolgreiche Um-<br />
setzung unser Zielsetzungen zu stecken.<br />
Ein großer Dank geht auch an alle Ver-<br />
bündeten: Betriebe, Träger, Institutionen,<br />
öffentlichen Einrichtungen und Multi-<br />
plikatoren für die Kooperationsbereit-<br />
schaft, die erfolgreiche Zusammenarbeit<br />
und den inspirierenden Austausch.<br />
Die tägliche Arbeit der <strong>BQM</strong> zeigt er-<br />
freulicherweise, und Sie haben darauf eben<br />
auch schon hingewiesen Frau Goetsch,<br />
dass sich immer mehr Unternehmen und<br />
der Öffentliche Dienst für die berufliche<br />
Zukunft von Jugendlichen mit Migrations-<br />
hintergrund einsetzen und deren be-<br />
sondere Potenziale nutzen.<br />
Engagement und hervorragende Arbeit<br />
sollen sich natürlich auch auszahlen und<br />
entsprechende Würdigung finden. Deshalb<br />
werden wir gleich drei Hamburger Unter-<br />
nehmen auszeichnen, die Vorbildliches in<br />
beruflichen Integration von Jugendlichen<br />
14
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
mit Migrationshintergrund geleistet haben.<br />
Das Preisgeld, das ausgelobte, ist eher eine<br />
Anerkennungsprämie, ist zweckgebunden<br />
für Ausbildungsprojekte bestimmt. Wir<br />
hoffen ganz stark, dass den Preisträgern<br />
nachgeeifert wird und werden besonderes<br />
Engagement auch im nächsten Jahr wieder<br />
würdigen. Sie dürfen sich schon jetzt bei<br />
uns bewerben. Nur Mut!<br />
Sie dürfen sich aber auch an uns wenden,<br />
wenn Sie noch unbesetzte Ausbildungs-<br />
plätze haben. Der doppelte Abiturienten-<br />
jahrgang kommt ja so nicht in den Unter-<br />
nehmen an, wie ich gelesen habe. Wenden<br />
Sie sich also an uns, wenn Sie noch un-<br />
besetzte Ausbildungsplätze haben.<br />
Wir haben die Möglichkeit, Ihnen passende<br />
Jugendliche zu vermitteln und zwar mit<br />
unserer Ausbildungsagentur Hanseaten<br />
bilden aus. Die Kolleginnen würden sich<br />
freuen, wenn sie ihre Dienstleistungen<br />
Ihnen zur Verfügung stellen könnten.<br />
Ich bin froh und glücklich, dass wir sowohl<br />
in den Foren am Nachmittag, die in be-<br />
währter Form von Moderatorinnen und<br />
Moderatoren aus der Hamburger Ver-<br />
waltung und der <strong>BQM</strong> geleitet werden, als<br />
auch in den Keynotes des heutigen Vor-<br />
mittags und in der Podiumsdiskussion<br />
hochrangige Expertinnen und Experten<br />
gewinnen konnten.<br />
Ihnen allen herzlichen Dank, dass Sie die<br />
Tagung mit Ihren Beiträgen aus unter-<br />
schiedlichen Perspektiven bereichern und<br />
sicherlich zu einer lebhaften und in-<br />
spirierenden Auseinandersetzung mit der<br />
Thematik „Vielfalt in Ausbildung und<br />
Arbeit“ beitragen.<br />
Vielen Dank natürlich auch an alle<br />
Kolleginnen und Kollegen aus der KWB<br />
für ihr wieder einmal sehr engagiertes und<br />
professionelles Arbeiten in der Vor-<br />
bereitung und der Durchführung dieser<br />
Tagung.<br />
Meine Damen und Herren, ich wünsche<br />
Ihnen einen kurzweiligen, einen erkennt-<br />
nisreichen Tag und freue mich jetzt ganz<br />
besonders, den Staffelstab an Julia Sen<br />
übergeben zu können, die sie wieder<br />
exzellent durch den Vormittag führen<br />
wird. Und ich bedanke mich noch einmal<br />
ganz, ganz herzlich, dass Sie wieder dabei<br />
sind. Hoffe natürlich auch auf nächstes<br />
Jahr, aber erstmal haben wir jetzt den<br />
heutigen Vormittag vor uns.<br />
Frau Sen.<br />
15
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Keynote Dr. Thomas Liebig –<br />
OECD International Migration Division<br />
Directorate for Employment, Labour<br />
and Social Affairs OECD 2<br />
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr<br />
geehrte Frau Bürgermeisterin Goetsch,<br />
sehr geehrter Herr Lüttke,<br />
Herr Wachholtz,<br />
herzlichen Dank für die freundliche Ein-<br />
ladung nach Hamburg. Ich freue mich<br />
wieder hier zu sein. Besonders erfreut es<br />
mich, dass so viele Unternehmensver-<br />
treter zu dieser Tagung gekommen sind,<br />
die von der <strong>BQM</strong> gemeinsam mit dem<br />
UVNord durchgeführt wird. Mit dem<br />
Fokus auf Berufsausbildung und Be-<br />
schäftigung machen sie deutlich, dass zu-<br />
nächst einmal das Finden einer Aus-<br />
bildungsstelle und darüber hinaus dann der<br />
Zugang zur Beschäftigung der Schlüssel zur<br />
Integration ist und das ist eine Ansicht, die<br />
wir teilen. Ich bin mir ganz sicher, dass<br />
vieles von dem, was im vergangenen Jahr<br />
diskutiert worden ist – nicht nur in<br />
Deutschland, sondern auch anderswo –<br />
unter den Titeln „Segregation“, also räum-<br />
liche Abschottung, „Parallelgesellschaften“,<br />
„Integrationsverweigerung“ bis hin zur<br />
Ganzkörperverschleierung – eigentlich<br />
kein Thema wäre in der öffentlichen<br />
Debatte, wenn Jugendliche mit Migrations-<br />
hintergrund und die Zuwandere selbst<br />
auch so gut in den Arbeitsmarkt integriert<br />
wären wie Personen ohne Migrations-<br />
hintergrund.<br />
Keynote: Dr. Thomas Liebig - OECD International Migration<br />
Division Directorate for Employment, Labour and Social Affairs<br />
OECD 2<br />
Dass bei der heutigen Tagung die Unter-<br />
nehmen ein Stück weit im Mittelpunkt<br />
stehen, begrüßen wir als OECD ganz be-<br />
sonders, denn wenn der Arbeitsmarkt der<br />
Schlüssel zur Integration ist, dann sind es<br />
die Unternehmen, die diesen Schlüssel in<br />
der Hand haben und letztendlich herum-<br />
drehen, damit die Tür dann geöffnet ist.<br />
Denn sie sind es ja, die die Arbeitsmarkt-<br />
integration letztendlich leisten, indem sie<br />
Zuwanderern und deren Kindern eine<br />
Beschäftigung geben.<br />
Vor vier Jahren hatte ich schon einmal die<br />
Gelegenheit hier vorzutragen. Damals war<br />
16
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
der Rahmen noch etwas kleiner. Es freut<br />
mich, dass das Thema auch rein optisch an<br />
Gewicht gewinnt. Einige Ergebnisse<br />
unserer OECD-Studie zur Arbeitsmarkt-<br />
integration von Zuwanderern und deren<br />
Kindern in Deutschland hatte ich vor-<br />
gestellt. Heute möchte ich Ihnen darlegen,<br />
was wir im Rahmen unseres Projekts, das<br />
ich leite, in den letzten vier Jahren hinzu-<br />
gelernt haben, gerade im Hinblick auf die<br />
Integration der Kinder von Zuwanderern.<br />
Bei uns druckfrisch ist gerade eine<br />
Publikation zu dem Thema „Equal<br />
Opportunities – the labour market<br />
integration of the children of immigrants“.<br />
Die wird morgen erscheinen. Die Ergeb-<br />
nisse haben wir schon teilweise im letzten<br />
Jahr in einer Vorabveröffentlichung<br />
präsentiert. Die möchte ich auch gern<br />
heute nochmal mit Ihnen teilen.<br />
Es gibt viele Gründe, warum Personen, die<br />
als Erwachsene zugewandert sind, häufig<br />
Schwierigkeiten haben, eine angemessene<br />
Arbeitsstelle zu finden. Herr Lüttke hat es<br />
erwähnt: Beispielsweise die Anerkennung<br />
ausländischer Abschlüsse ist ein ganz<br />
großes Thema, nicht nur in Deutschland.<br />
Das Anerkennungsgesetz ist ja hier in<br />
Vorbereitung , das ist auch dringend not-<br />
wendig. Wobei auch hier darf man<br />
vielleicht nicht allzu viel erwarten. Denn<br />
auch hier sind es wiederum die Arbeit-<br />
geber, die dann diesen anerkannten oder<br />
auch nicht anerkannten Abschluss letzt-<br />
endlich als gleichwertig anerkennen<br />
müssen, indem sie sagen: „Ich sage ja, das<br />
akzeptiere ich, und ich stelle die Person<br />
ein.“ Und da kann auch das beste Gesetz<br />
natürlich nicht viel bringen, wenn diese<br />
Bereitschaft fehlt.<br />
Wenn Zuwanderer als Erwachsene zu-<br />
gewandert sind, sind ihre Abschlüsse aus<br />
einem anderen Bildungssystem eventuell<br />
schwierig vergleichbar. Möglicherweise<br />
haben sie auch bereits erste Erfahrungen<br />
in ganz anderen Arbeitsmarktkontexten<br />
gewonnen. Und das ist dann sehr, sehr<br />
schwierig für die Unternehmen, einzu-<br />
schätzen, wie sie diese Qualifikationen, die<br />
aus dem Ausland stammen, häufig in einer<br />
ganz anderen Sprache erworben worden<br />
sind, dann letztendlich einzuschätzen<br />
haben. Das ist bei den Kindern von Zu-<br />
wanderern natürlich nicht mehr der Fall.<br />
Deshalb sind wir der Meinung, dass die<br />
Kinder von Zuwanderern und deren<br />
Arbeitsmarktergebnisse eigentlich wirklich<br />
der Lackmustest für die Integration sind.<br />
17
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Um gut und dauerhaft in den Arbeitsmarkt<br />
integriert zu sein, ist Bildung eine Grund-<br />
voraussetzung. Eine Zahl aus der PISA-<br />
Studie möchte ich mal nennen. Die PISA-<br />
Studie wird ja bei uns immer wieder sehr,<br />
sehr stark in den Vordergrund gehoben.<br />
Wir freuen uns auch, dass unser Arbeits-<br />
marktbereich hier Erwähnung findet. Also<br />
hier eine Zahl, die für mich die Lage in<br />
Deutschland am besten zusammenfasst:<br />
V.l.n.r.: Christa Goetsch (Zweite Bürgermeisterin), Uli<br />
Wachholtz (UV Nord), Hansjörg Lüttke (KWB e. V.)<br />
Julia-Niharika Sen (NDR), Karl Gernandt (Kühne + Nagel)<br />
Rund 50 Prozent der Kinder in PISA-Alter,<br />
also 15 Jahre, mit Migrationshintergrund,<br />
haben eine Mutter, die maximal eine<br />
Grundschulausbildung oder in vielen Fällen<br />
gar keine Schulausbildung hat. Bei den<br />
Kindern ohne Migrationshintergrund ist es<br />
gerade mal bei zwei Prozent der Fall. Also,<br />
wenn sie solche gravierenden Unter-<br />
schiede haben, dann stellt sich die Frage,<br />
inwiefern kann ich denn die Bildungs-<br />
ergebnisse überhaupt fair vergleichen. Das<br />
ist im Übrigen eine Diskussion, die wir<br />
gerade auch führen. Wir analysieren ja<br />
gerade auch die PISA 2009 Ergebnisse und<br />
da wird es auch wieder eine spezielle<br />
Studie – das kann ich hier gleich an-<br />
kündigen – zu den Nachkommen von Zu-<br />
wanderern geben, die sich vielleicht noch<br />
mal ganz systematisch auf die Ergebnisse<br />
der PISA-Studien in diesem Bereich<br />
konzentriert.<br />
Genauso bedeutend wie die klassische<br />
Schulausbildung – also von der Grund-<br />
schule über die weiterführende Schule bis<br />
hin zur Berufsausbildung – ist der vor-<br />
schulische Bereich. Wir wissen, dass ein<br />
großer Teil des Bildungsnachteils – das<br />
hängt von den Ländern ab – bereits beim<br />
Eintritt in die Grundschule besteht. Wir<br />
wissen aus Studien aus Frankreich und<br />
anderen Ländern, wo diese Forschung<br />
schon bereits sehr fortgeschritten ist, dass<br />
das Alter von drei bis vier eigentlich das<br />
zentrale Alter ist. Wenn in diesem Alter<br />
die Kinder in einer vorschulischen Ein-<br />
richtung sind, dann haben sie Kontakt mit<br />
der Sprache und dann haben sie auch<br />
wesentlich bessere Bildungsergebnisse.<br />
Also das Alter von drei bis vier Jahren ist<br />
eigentlich das Alter, in dem der beste Er-<br />
trag zu erwarten ist. Erstens kostet es<br />
18
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
nicht ganz so viel wie später in der Schule<br />
möglicherweise und zum Zweiten hat es<br />
den besten Bildungsertrag in der langen<br />
Frist. Leider ist es gerade so, das hier in<br />
Deutschland gerade in diesem Alter natür-<br />
lich noch die stärkste Lücke klafft<br />
zwischen Kindern mit und ohne<br />
Migrationshintergrund. Investitionen ver-<br />
sprechen gerade hier den besten Ertrag.<br />
Natürlich ist es da immer auch so, wenn<br />
Sie Frau Goetsch, heute etwas hier ein-<br />
führen in Hamburg, dann hat vielleicht<br />
nicht mal ihre Nachfolgerin, sondern der<br />
Übernächste letztendlich den Ertrag von<br />
dieser Investition.<br />
Gerade weil Bildung eine zentrale Heraus-<br />
forderung ist, ist es natürlich umso<br />
wichtiger, dass diejenigen Jugendlichen, die<br />
in Bildung investiert haben, die erfolgreich<br />
sind im Schulsystem – und von denen gibt<br />
es ja eine ganze Menge – auch dann letzt-<br />
endlich die Entlohnung, die Belohnung<br />
dafür im Arbeitsmarkt finden, indem sie<br />
eine angemessene Beschäftigung finden.<br />
Wir haben im vergangenen Jahr – das ist<br />
die Studie, die wir morgen in Buchform<br />
herausbringen – in 15 OECD-Ländern die<br />
Integration nach Bildungsniveau getrennt<br />
untersucht – der Kinder von Zu-<br />
wanderern verglichen mit Kindern ohne<br />
Zuwanderungshintergrund. Und für<br />
Deutschland hatten wir den besonders<br />
alarmierenden Befund, dass es gerade die<br />
hoch qualifizierten Kinder mit Migrations-<br />
hintergrund sind, die im Vergleich zu ihren<br />
gleich qualifizierten Altersgenossen die<br />
größten Schwierigkeiten haben, eine an-<br />
gemessene Arbeitsstelle zu finden. Und<br />
das ist ja nun eine Gruppe, bei der wir<br />
hier kaum beispielsweise mit Sprach-<br />
problemen argumentieren können, wenn<br />
die Personen einen höheren Abschluss<br />
haben. Was also kann dann diese<br />
Schwierigkeiten erklären?<br />
Drei Faktoren spielen offensichtlich eine<br />
ganz zentrale Rolle. Zum Ersten sind es<br />
Netzwerke. In Deutschland – wie auch in<br />
vielen anderen OECD Ländern – wird<br />
rund ein Drittel aller Stellen über persön-<br />
liche Kontakte besetzt. Bei Klein- und<br />
Mittelunternehmen sind es sogar noch<br />
etwas mehr. Und wenn wir jetzt den Be-<br />
griff Kontakt noch etwas weiter fassen und<br />
auch einfache Hinweise wie beispielsweise<br />
„Bewirb dich mal dort, da ist ein<br />
interessanter Arbeitgeber“ oder „Ich habe<br />
gehört, die haben Ausbildungsplätze“, also<br />
solche einfachen Hinweise von Bekannten<br />
mit hinzunehmen, dann glaube ich<br />
kommen wir dazu, dass über die Hälfte<br />
19
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
der Stellenbesetzungen, die in irgendeiner<br />
Weise mit persönlichen Kontakten ver-<br />
bunden sind; und das ist natürlich gerade<br />
auch bei Ausbildungsplätzen der Fall, weil<br />
da die Kinder, die Jugendlichen häufig<br />
wenig Ahnung haben, wo sie sich da zu-<br />
nächst einmal melden sollen. Und diese<br />
Kontakte werden über die Eltern vielfach<br />
vermittelt oder Bekannte von Eltern. Und<br />
hier sind natürlich Kinder von Migranten<br />
in einem strukturellen Nachteil, weil ihnen<br />
die Eltern diese Kontakte nicht vermitteln<br />
können. Sogenannte Mentorenprogramme<br />
sind ein Ansatz, der immer häufiger auf-<br />
tritt in den OECD-Ländern, um das zu<br />
korrigieren. Das gibt es sowohl für die<br />
Zuwanderer als auch deren Kinder. Die<br />
Person bekommt einen Mentor, der in<br />
dem Fachbereich, der vielleicht in Frage<br />
kommt, Erfahrungen hat, der weiß, wer<br />
ein interessanter Arbeitgeber ist, und auch<br />
seine persönlichen Kontakte bereitstellt.<br />
Und natürlich müssen die Unternehmen<br />
auch versuchen, auf die Jugendlichen mit<br />
Migrationshintergrund stärker zuzugehen,<br />
indem sie ihre Rekrutierungskanäle di-<br />
versifizieren. Eben weg vielleicht von<br />
persönlichen Kontakten, mehr in Zu-<br />
sammenarbeit mit den Schulen und hier<br />
beispielsweise sich auch bei der <strong>BQM</strong> zu<br />
melden, dass hier noch Stellen frei sind.<br />
Hier gibt es ganz interessante Ansätze,<br />
beispielsweise aus dem flämischen Teil<br />
Belgiens, wo der Arbeitsmarktdienst<br />
spezielle Diversitätsberater den Unter-<br />
nehmen zu Verfügung gestellt hat, um zu<br />
gucken: „Wie könnt ihr euch denn, di-<br />
versifizieren? Können wir dabei euch<br />
helfen?“ Und wenn sie dann einen Plan<br />
aufgestellt haben, dann gab es noch kleine<br />
Finanzprämien, um diesen vor allem<br />
kleinen und mittelständischen Unter-<br />
nehmen, wo das Problem am größten ist,<br />
dabei zu helfen, sich zu diversifizieren.<br />
Der zweite zentrale Faktor ist das Wissen<br />
über die Funktionsweise des Arbeits-<br />
marktes. Wie schreibe ich einen Lebens-<br />
lauf? Was muss rein in eine Bewerbung?<br />
Wie wird das Motivationsschreiben ver-<br />
fasst? Wie stelle ich mich in einem Inter-<br />
view vor? Das ist ein sehr weites Feld. Ich<br />
möchte Ihnen nur ein kleines Beispiel aus<br />
meinem persönlichen Umfeld nennen. Ich<br />
weiß nicht, wie es hier in Hamburg ist,<br />
aber wer sich in meiner Heimat bewirbt<br />
und nicht in seinem Lebenslauf unter<br />
außerschulisches Engagement weder die<br />
Feuerwehr noch den Sportverein noch<br />
den Musikverein erwähnt, der macht sich<br />
20
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
schon fast der Integrationsverweigerung<br />
verdächtig. In anderen Ländern ist es voll-<br />
kommen unüblich, solche Dinge, die<br />
eigentlich mit der Bewerbung nichts direkt<br />
zu tun haben, überhaupt im Lebenslauf zu<br />
erwähnen. Das ist sehr stark kulturell ver-<br />
bunden und da brauchen wir gar nicht so<br />
weit zu gehen. Selbst in der Schweiz oder<br />
in Frankreich, zwei Länder, die ich jetzt<br />
relativ gut kenne, selbst da merken sie<br />
riesen Unterschiede, in der Art und Weise<br />
wie eine Bewerbung verfasst wird. Und<br />
wenn sie dann von noch wesentlich<br />
weiteren Hintergründen kommen und<br />
auch vielleicht die Eltern ihnen dieses<br />
Wissen nicht zur Verfügung stellen<br />
können, haben sie natürlich ganz, ganz<br />
große Schwierigkeiten, hier sich richtig zu<br />
verkaufen. Weil das Wissen um das, was<br />
es für eine erfolgreiche Bewerbung<br />
braucht, wird eben sehr, sehr stark auch<br />
über das Elternhaus vermittelt. Hier also<br />
wiederum ein struktureller Nachteil.<br />
Hier sind also die Schulen in Zusammen-<br />
arbeit mit den Arbeitsämtern gefragt, das<br />
systematisch als zentralen Bestandteil des<br />
Lehrplans zu vermitteln. Das wird ja zum<br />
Teil auch bereits gemacht.<br />
Und natürlich können auch hier die<br />
Mentoren wiederum sehr, sehr viel leisten,<br />
weil sie dieses Wissen letztendlich auch<br />
den Jugendlichen vermitteln können.<br />
Der dritte Faktor – auch heute bereits<br />
schon mehrfach angesprochen worden,<br />
von Ihnen Frau Bürgermeisterin beispiels-<br />
weise – ist die Diskriminierung. Und das<br />
ist der Bereich, der mich persönlich in den<br />
letzten vier Jahren am stärksten über-<br />
rascht hat. Als wir unsere Länderstudie<br />
vor fünf Jahren zu Deutschland zum ersten<br />
Mal durchgeführt haben, da hieß es immer<br />
Bildung, Bildung, Bildung. Und Dis-<br />
kriminierung wurde auch nicht so als<br />
Problem wahrgenommen. Im Übrigen<br />
noch nicht mal von den Zuwanderern<br />
damals in den Gesprächen, die wir geführt<br />
hatten mit den Zuwanderern selbst und<br />
den verschiedenen Assoziationen, die hier<br />
tätig sind. Ich habe das dann auch so in<br />
den Bericht übernommen: Ja, also Dis-<br />
kriminierung wird nicht so als Problem<br />
wahrgenommen. Es gibt auch keine Studie<br />
dazu. Im Übrigen ist hier nach wie vor<br />
eine große Forschungslücke hier in<br />
Deutschland. Die Studie aus Konstanz<br />
zeigt eigentlich eher auf, unter welchen<br />
Voraussetzung keine Diskriminierung be-<br />
steht als unter welchen Voraussetzungen<br />
Diskriminierung besteht.<br />
21
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Wir wissen aber aus Frankreich und<br />
Schweden, dass Jugendliche mit<br />
Migrationshintergrund mit gleicher Quali-<br />
fikation drei- bis viermal mehr Be-<br />
werbungen schreiben müssen wie ein<br />
gleichqualifizierter Jugendlicher ohne<br />
Migrationshintergrund bis sie zu einem<br />
Bewerbungsgespräch eingeladen werden.<br />
Und wie kann man diese Diskriminierung<br />
feststellen? Mittels fiktiver, aber an sich<br />
gleichwertiger Bewerbungen wird das<br />
nachgewiesen. Der Name ist dann einmal<br />
Mohammed und ein andermal beispiels-<br />
weise in Frankreich Jean-Pierre. Einmal ist<br />
es die Universität Bordeaux und einmal ist<br />
es die Universität Toulouse. Und dann<br />
sind es letztendlich gleichwertige Lebens-<br />
läufe. Und dann kann man das, wenn man<br />
das mit ein paar Tausend Leuten macht,<br />
letztendlich eindeutig nachweisen. Drei bis<br />
vier mal so viele Bewerbungen. Bei ge-<br />
wissen Berufsfeldern und gewissen<br />
Kombinationen, also gerade bei Be-<br />
werbern mit nordafrikanischen Namen,<br />
teilweise so gar bis zu 15 mal so viele<br />
Bewerbungen. Diskriminierung ist also ein<br />
wesentlich stärkerer Faktor als häufig<br />
vermutet. Wenn Sie sich den Bericht der<br />
Antidiskriminierungsstelle des Bundes an-<br />
schauen, wie viele Fälle da an Dis-<br />
kriminierung zur Sprache kommen, das ist<br />
ja nur die Spitze des Eisberges.<br />
Diskriminierung ist ja nicht nur ein<br />
Problem, bei dem sich die Jugendlichen<br />
noch viel mehr anstrengen müssen, um<br />
letztendlich eine Ausbildungsstelle zu<br />
finden. Im Übrigen, wenn wir mal davon<br />
ausgehen, dass es in Deutschland ungefähr<br />
so ähnlich ist wie in den anderen Ländern,<br />
also drei bis viermal so viele, dann müsste<br />
die Arbeitslosigkeit nicht doppelt so hoch<br />
sein wie sie ungefähr so ist in Deutschland,<br />
sondern müsste sie drei bis viermal so<br />
hoch sein. Das heißt, die Jugendlichen<br />
kompensieren das bereits, indem sie viel<br />
mehr Bewerbungen schreiben. Das ist also<br />
eine Leistung, die bereits erbracht wird<br />
und die es vielleicht auch anzuerkennen<br />
gilt. Und wenn sie dann keinen Erfolg<br />
haben, dann führt es zu Frustration und<br />
natürlich auch zur einer innerlichen Ent-<br />
fernung vom Empfangsland. Und das ist<br />
22
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
natürlich ein ganz problematischer<br />
Prozess.<br />
Ganz wichtig ist dabei, die Diskriminierung<br />
zu trennen von Rassismus. Das wird häufig<br />
vermengt in der öffentlichen Debatte. Dis-<br />
kriminierung beruht häufig nicht auf<br />
rassistischen Einstellung, sondern auf Vor-<br />
urteilen, auf Unkenntnis. Und das ist<br />
natürlich keinesfalls das gleiche. Auch hier<br />
wiederum ganz interessante Studien aus<br />
Schweden. Dort wissen, dass Zuwanderer,<br />
die die schwedische Staatsangehörigkeit<br />
angenommen haben, oder die ihren<br />
Namen von Ali auf Sören geändert haben,<br />
dann auf einmal wesentlich bessere<br />
Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.<br />
Und diese Chancen können nur durch den<br />
Wechsel erklärt werden. Sie hatten vor-<br />
her die gleichen Integrationsleistungen und<br />
in dem Moment, in dem der Wechsel<br />
erfolgte, gingen die Chancen rapide berg-<br />
auf. Das ist natürlich eine Diskriminierung,<br />
ganz klar: Der Sören wird gegenüber dem<br />
Ali bevorzugt. Aber es ist kein Rassismus,<br />
denn die Herkunft hat sich ja nicht ver-<br />
ändert, in dem Ali seinen Namen in Sören<br />
geändert hat. Aber offensichtlich hat sich<br />
in der Wahrnehmung der Unternehmen<br />
etwas geändert: die Personen sind in der<br />
Wahrnehmung offensichtlich vertrauter<br />
mit dem Land und dadurch möglicher-<br />
weise produktiver, haben weniger Sprach-<br />
probleme oder was auch immer. Und<br />
dadurch sind die Unternehmen dann auch<br />
auf einmal bereit, diese Person einzu-<br />
stellen. Sie haben also diesen Wechsel der<br />
Staatsangehörigkeit – übrigens gerade im<br />
hoch qualifizierten Bereich sehr, sehr,<br />
wichtig, die Staatsangehörigkeit – oder des<br />
Namens als Signal für Integration inter-<br />
pretiert. Und Integration heisst in diesem<br />
Sinne bessere Produktivität im Arbeits-<br />
markt, denn das ist das, was die Unter-<br />
nehmen letztendlich interessiert. Es ist<br />
deshalb auch nicht verwunderlich, dass die<br />
Studien in der Regel zeigen, dass es die<br />
Klein- und Mittelunternehmungen sind, die<br />
besonders stark diskriminieren. Denn die<br />
können es sich einfach nicht erlauben, Un-<br />
kenntnis über die Qualität der Bewerber<br />
zu haben. Wenn sie ein oder zwei un-<br />
produktive Leute in ihrem Betrieb haben,<br />
kann es für ein Unternehmen lebens-<br />
bedrohlich sein. Wenn also Arbeitgeber<br />
hauptsächlich Vorurteile haben und Un-<br />
sicherheit besteht, dann ist auch klar, wie<br />
man die Jugendlichen mit Migrations-<br />
hintergrund am besten in den Arbeits-<br />
markt integrieren kann, nämlich in dem<br />
man beide Seiten zusammenführt . In dem<br />
23
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
man den Arbeitgebern eine Chancen gibt,<br />
diese Vorurteile abzubauen und gleich-<br />
zeitig den Jugendlichen eine Chance gibt,<br />
sich zu beweisen. Beispielsweise über<br />
Firmenmessen einfach in Kontakt bringen,<br />
über Praktika und so weiter. Aber auch<br />
Aufklärung und Vorbilder – und damit sind<br />
wir wieder bei der heutigen Veranstaltung<br />
– können natürlich helfen, Vorurteile ab-<br />
zubauen und zu zeigen, wie breit eigentlich<br />
die Zuwanderer und deren Kinder<br />
mittlerweile hier in Deutschland auch<br />
integriert sind und wie viele sehr, sehr<br />
gute Beispiele es mittlerweile schon gibt.<br />
Auch der Öffentliche Dienst hat hier<br />
natürlich eine ganz zentrale Funktion, denn<br />
wenn sie es schaffen, dass die Kinder mit<br />
Migrationshintergrund im Öffentlichen<br />
Dienst gut integriert sind, dann ist natür-<br />
lich die Visibilität von Zuwanderung im<br />
Alltagsleben auch für Personen, die sonst<br />
wenig mit Zuwanderern Kontakt haben,<br />
viel, viel stärker. Wenn sie auf der Finanz-<br />
verwaltung mal einem Zuwander als Sach-<br />
bearbeiter am Schalter begegnen, dann<br />
ändert sich natürlich auf der Kundenseite<br />
auch etwas. Deswegen ist es sehr, sehr<br />
wichtig, dass die Migranten auch in der<br />
Breite des Öffentlichen Dienstes viel<br />
stärker sind. Deshalb hat es uns natürlich<br />
besonders gefreut, dass hier in Hamburg<br />
Herr von Beust einen Schwerpunkt<br />
gesetzt hat, denn das ist gerade für uns ein<br />
ganz, ganz wichtiger Bereich. Und auch da<br />
ein Bereich, wo Deutschland noch ein sehr<br />
großes Nachholpotenzial hat im inter-<br />
nationalen Vergleich . Es gibt nur zwei<br />
Länder, in denen die Kinder mit<br />
Migrationshintergrund deutlich unter-<br />
repräsentiert sind im öffentlichen Dienst.<br />
Das sind Deutschland und Frankreich und<br />
deshalb ist es besonders schön, dass hier<br />
Hamburg sehr, sehr viel getan hat. Bei<br />
allen Diskussionen über Probleme und<br />
Benachteiligungen dürfen wir nicht ver-<br />
gessen, dass die überwiegende Mehrzahl<br />
der Jugendlichen mit Migrationshinter-<br />
grund gut integriert ist. Und ich glaube, es<br />
ist immer ganz wichtig, auch darauf hinzu-<br />
weisen, dass es sehr, sehr viele erfolg-<br />
reiche Beispiele gibt. Und wenn wir die<br />
Kinder mit Migrationshintergrund als Ein-<br />
heit betrachten, sind natürlich Lücken da,<br />
aber es sieht doch relativ gut aus. Das<br />
Glas ist mehr voll als leer. Und es ist ganz<br />
wichtig, darauf hinzuweisen, damit die<br />
Vorurteile abgebaut werden können. Aber<br />
natürlich steckt noch viel mehr Potenzial<br />
in den Kindern von Zuwanderern. Ich<br />
24
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
glaube die häutige Veranstaltung trägt dazu<br />
bei, dieses ein Stückchen besser zu nutzen.<br />
Vielen Dank.<br />
25
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Preisverleihung<br />
Vorwort Uli Wachholtz –<br />
Präsident UVNord Vereinigung der<br />
Unternehmensverbände in Hamburg<br />
und Schleswig-Holstein e. V.<br />
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,<br />
Sehr geehrte Frau Rühl<br />
Sehr geehrter Herr Dr. Liebig,<br />
und sehr geehrter Herr Lüttke,<br />
meine sehr geehrten Damen und Herren,<br />
ich möchte Sie auch im Namen von<br />
UVNord ganz herzlich begrüßen. Die<br />
Bürgermeisterin erwähnte es bereits: Zum<br />
sechsten Mal veranstalten wir gemeinsam<br />
mit der <strong>BQM</strong> diese Tagung, um über<br />
Jugendliche mit Migrationshintergrund zu<br />
sprechen. Über die Probleme, mit denen<br />
sie auf dem Ausbildungsmarkt konfrontiert<br />
sind, über die Verantwortung von Gesell-<br />
schaft, Politik und Wirtschaft, aber auch<br />
über das Potenzial dieser Zielgruppe. Wir<br />
haben gesprochen über ihre Talente, ihre<br />
Sprachkenntnisse, ihre interkulturelle<br />
Kompetenz, also über all das, was gerade<br />
in einer so international ausgerichteten<br />
Region wie Hamburg für den wirtschaft-<br />
lichen und beruflichen Erfolg von Be-<br />
deutung ist. Und ja, wir haben viel dazu<br />
gelernt in den vergangenen Jahren. Wir<br />
haben uns geöffnet als Gesellschaft und als<br />
Unternehmen. Und auch die Politik hat<br />
viel dazu gelernt, wenn es darum geht,<br />
Jugendliche mit Migrationshintergrund als<br />
einen wichtigen Teil von uns zu begreifen.<br />
Uli Wachholtz – Präsiden UVNord<br />
Aber wir alle wissen auch ganz genau, dass<br />
noch viel mehr geschehen kann und vor<br />
allem viel mehr geschehen muss, damit wir<br />
von Chancengleichheit für Jugendliche mit<br />
Migrationshintergrund als Normalzustand<br />
bekommen. Deshalb möchte ich mich bei<br />
Ihnen, meine sehr geehrten Damen und<br />
Herren, herzlich dafür bedanken, dass Sie<br />
auch in diesem Jahr so zahlreich er-<br />
schienen sind. Das zeigt, dass sie das<br />
Potenzial dieser Jugendlichen sehen und<br />
dass Sie sich für junge Menschen<br />
engagieren und sie auf diesem Weg unter-<br />
stützen.<br />
26
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Und das wird auch weiterhin nötig sein.<br />
Denn über das Begreifen der gesellschaft-<br />
lichen Chancen hinaus, sind wir mit einem<br />
zunehmendem Fachkräftemangel<br />
konfrontiert. Und dieser Druck wird, das<br />
wissen Sie, noch zunehmen. Einerseits gibt<br />
es viele Jugendliche, die es schwer haben,<br />
einen Ausbildungsplatz zu bekommen.<br />
Andererseits gibt es viele Unternehmen,<br />
die ihre Ausbildungsplätze nicht besetzen<br />
können. Das muss sich in unser aller<br />
Interesse ändern. Und deshalb möchten<br />
wir, dass noch mehr Hamburger Unter-<br />
nehmen in Ihrem Engagement bestärkt<br />
werden, Jugendliche mit Migrationshinter-<br />
grund auszubilden.<br />
UVNord hat gemeinsam mit der <strong>BQM</strong><br />
auch in diesem Jahr den Förderpreis Viel-<br />
falt in Ausbildung und Arbeit aus-<br />
gelobt. Und es ist eine besondere Ehre,<br />
dass die Zweite Bürgermeisterin den Preis<br />
persönlich überreichen wird. Dafür vielen<br />
Dank Ihnen, sehr geehrte Frau Bürger-<br />
meisterin Goetsch.<br />
Mein Dank gilt aber auch der Jury, denn<br />
für sie war es wahrlich keine leichte Auf-<br />
gabe unter den zahlreichen vorbildlichen<br />
Bewerbungen drei Preisträger auszu-<br />
wählen.<br />
Deshalb möchte ich an dieser Stelle<br />
betonen: Die ausgewählten Preisträger<br />
stehen mit Ihrem Einsatz stellvertretend<br />
für viele weitere Konzepte, die bei der<br />
<strong>BQM</strong> eingereicht wurden. Allen Betrieben,<br />
die sich beworben haben, egal ob groß<br />
oder klein, gebührt Dank und die An-<br />
erkennung. Ihr Engagement gibt wichtige<br />
Impulse für eine verbesserte berufliche<br />
Integration und soll vor allem andere zum<br />
Nachahmen anregen.<br />
Bevor unsere Laudator/-innen der <strong>BQM</strong><br />
die Preisträger im Einzelnen vorstellen,<br />
möchte ich nun diejenigen Unternehmen<br />
lobend erwähnen, die Jugendliche mit<br />
Migrationshintergrund ebenfalls mit<br />
großem Engagement beruflich integrieren<br />
und die sich hier beworben haben. Das<br />
sind:<br />
• Aurubis AG<br />
• Iwan Budnikowsky GmbH & Co. KG<br />
• Çelik Döner und Fleischgroßhandel<br />
GmbH<br />
• Der Haarlekin<br />
• DHL Freight GmbH<br />
• E.On Hanse AG – Standort Aus-<br />
schläger Elbdeich<br />
• Globetrotter Ausrüstung/Denart &<br />
Lechhart GmbH<br />
27
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
• HCCR Hamburger Container- und<br />
Chassis-Reparatur-Gesellschaft<br />
• Heinz-Sander-Bau-GmbH<br />
• Oliver Bayer SG Stellingen e. K.<br />
• Randstad Deutschland<br />
• UniCredit Bank AG<br />
• Vaino Hair Connection GmbH<br />
Außerdem sei allen Unternehmen gedankt,<br />
die den Aktionsplan des Senats zur<br />
Bildungs- und Ausbildungsförderung junger<br />
Menschen mit Migrationshintergrund ge-<br />
meinsam mit dem Unternehmensverband<br />
Nord und der <strong>BQM</strong> tatkräftig unter-<br />
stützen.<br />
Ich freue mich, dass in den vergangenen<br />
Jahren viel im Bereich beruflicher Quali-<br />
fizierung und Integration von Jugendlichen<br />
mit Migrationshintergrund getan wurde.<br />
Mehr als 2.000 von ihnen konnten in Aus-<br />
bildung vermittelt werden, mehr als 120<br />
Unternehmen arbeiten inzwischen mit der<br />
<strong>BQM</strong> zusammen und haben sich für diese<br />
Ziel- und Mitarbeitergruppe geöffnet. Es<br />
ist deutlich geworden, dass wir die jungen<br />
Menschen mit unterschiedlichen Er-<br />
fahrungshintergründen und inter-<br />
kulturellen Kompetenzen brauchen.<br />
In diesem Zusammenhang appelliere ich an<br />
die Politik und Verwaltung, das<br />
Engagement für Integration und Diversity<br />
Management auch zukünftig ganz oben auf<br />
die Agenda zu setzen. Es ist schön zu<br />
wissen, dass inzwischen rund 17 Prozent<br />
der Auszubildenden in der Verwaltung<br />
einen Migrationshintergrund haben. Ich<br />
hoffe, dass wir im nächsten Jahr schon die<br />
Zielmarke von 20 Prozent erreicht haben<br />
werden, und zwar nicht nur in der Ver-<br />
waltung sondern möglichst auch in vielen,<br />
vielen Hamburger Unternehmen.<br />
Zum Schluss möchte ich auch in diesem<br />
Jahr betonen, dass jedes Unternehmen,<br />
das sich für junge Menschen mit<br />
Migrationshintergrund stark macht, An-<br />
erkennung verdient und ich darf Sie bitten,<br />
dieses mit einem Applaus zu würdigen.<br />
28
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Meine Damen und Herren,<br />
ich darf Ihnen nun die diesjährigen Preis-<br />
träger vorstellen. Dies sind:<br />
• Kühne + Nagel (AG & CO.) KG in der<br />
Kategorie der Großunternehmen<br />
• Auto Wichert in der Ulzburger Straße<br />
in der Kategorie Kleinunternehmen<br />
• Haar und Cosmetik by Mister No in<br />
der Kategorie Kleinstunternehmen<br />
Die Laudator/-innen der <strong>BQM</strong> werden die<br />
Preisträger mit Ihrem besonderen<br />
Engagement gleich vorstellen. Vorher<br />
möchte ich aber meine ganz besondere<br />
Anerkennung der Iwan Budnikowsky<br />
GmbH & Co. KG aussprechen.<br />
Budnikowsky hat in einer hervorragenden<br />
Bewerbung deutlich gemacht, dass es sein<br />
Engagement für Jugendliche mit<br />
Migrationshintergrund seit 2005, als das<br />
Unternehmen den Preis „Vielfalt in Aus-<br />
bildung“ gewann, deutlich ausgeweitet hat.<br />
So wurde die Quote der Auszubildenden<br />
mit Migrationshintergrund seit 2005 von<br />
21 Prozent auf 34 Prozent erhöht.<br />
Budnikowsky hat außerdem gemeinsam<br />
mit der <strong>BQM</strong> ein interkulturelles Ein-<br />
stellungsverfahren entwickelt und dieses<br />
auch umgesetzt. Ich denke, dass kann für<br />
uns alle vorbildlich sein! Machen Sie weiter<br />
so, wir freuen uns auf Ihre Bewerbung im<br />
kommenden Jahr.<br />
Ich gratuliere nun den Gewinnern und<br />
hoffe, dass wir uns alle im kommenden<br />
Jahr wieder sehen, wenn andere Unter-<br />
nehmen für ihr Engagement für Vielfalt in<br />
Ausbildung und Arbeit ausgezeichnet<br />
werden.<br />
Vielen Dank.<br />
29
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Preisverleihung: Laudatio<br />
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG<br />
Elisabeth Wazinski und<br />
Dr. Alexei Medvedev –<br />
KWB e. V. / <strong>BQM</strong><br />
Elizabeth Wazinski: Sehr geehrte<br />
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und<br />
Kollegen,<br />
wir freuen uns, Ihnen den Preisträger in<br />
der Kategorie Großunternehmen des<br />
Förderpreises „Vielfalt in Ausbildung<br />
<strong>2010</strong>“ vorzustellen, die Kühne + Nagel<br />
(AG & Co.) KG.<br />
Dr. Alexei Medvedev: Kühne + Nagel<br />
feiert in diesem Jahr sein 120-jähriges Be-<br />
stehen. Das Traditionsunternehmen be-<br />
schäftigt mittlerweile ca. 55.000 Mit-<br />
arbeiter an 900 Standorten in mehr als<br />
100 Ländern. Mit 1.273 Mitarbeitern und<br />
71 Auszubildenden in Hamburg ist das<br />
Unternehmen ein wichtiger Arbeitgeber<br />
und Ausbilder für unsere Stadt.<br />
Elizabeth Wazinski: Ein Viertel der<br />
Auszubildenden des Unternehmens hat<br />
einen Migrationshintergrund und sie<br />
werden ausgebildet zu Kaufleuten für<br />
Spedition und Logistikdienstleistungen,<br />
Fachkräften für Lagerlogistik und Fach-<br />
informatik. Außerdem bietet das Unter-<br />
nehmen ein duales Studium im Bereich<br />
Logistik an. Bei der Azubi-Auswahl geht<br />
der Ausbildungsleiter Michel Rothgaenger<br />
auch unkonventionelle Wege: nicht die<br />
Zeugnisnoten sind allein ausschlaggebend,<br />
Jugendliche können auch mit Persönlich-<br />
keit und Engagement überzeugen. Sein<br />
Glaube an die Potenziale junger Menschen<br />
mit Migrationshintergrund ist nicht nur ein<br />
Lippenbekenntnis.<br />
Laudatores Elisabeth Wazinski und Dr. Alexei Medvedev (<strong>BQM</strong>)<br />
Dr. Alexei Medvedev : Kühne + Nagel<br />
hat eine beeindruckend geringe Ab-<br />
brecherquote in der Ausbildung, und um<br />
diesen Trend fortzuführen, setzt man auch<br />
auf einen guten Kontakt zu den Eltern.<br />
Eltern werden zu Beginn des Ausbildungs-<br />
jahres zu einem Elternabend in das Unter-<br />
nehmen eingeladen und erhalten einen<br />
30
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
detaillierten und plastischen Einblick in den<br />
Ablauf der Ausbildung.<br />
Elisabeth Wazinski: Gerade für<br />
migrantische Eltern, die die duale Aus-<br />
bildung als Konzept weniger gut kennen,<br />
sondern eher studienorientiert sind, ist<br />
das eine optimale Herangehensweise.<br />
Darüber hinaus ist Kühne + Nagel einer<br />
der Mitbegründer des von der <strong>BQM</strong> ins<br />
Leben gerufenen Arbeitskreises „Betrieb-<br />
liche Elternarbeit“, in dem weitere neue<br />
Formate der Elternkooperation entwickelt<br />
werden.<br />
Dr. Alexei Medvedev: Zur Ehrung<br />
dieses Engagements dürfen wir nun bitten<br />
Dirk Blesius – Mitglied der Geschäfts-<br />
leitung, Leiter Personal und Qualitäts-<br />
management, Michel Rothgaenger – Aus-<br />
bildungsleiter Hamburg und die Auszu-<br />
bildenden Anna Bartholomaiou und Jawad<br />
Zargarpur.<br />
Verleihung des Förderpreises (v.l.n.r.): Uli Wachholtz, Elisabeth<br />
Wazinski Christa Goetsch, Jawad Zargarpur, Anna<br />
Bartholomaiou, Michel Rothgaenger, Dirk Blesius, Dr. Alexei<br />
Medvedev<br />
31
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Preisverleihung: Laudatio<br />
Auto Wichert GmbH,<br />
Ulzburger Straße<br />
Hülya Eralp –<br />
KWB e. V. / <strong>BQM</strong><br />
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe<br />
Kolleginnen und Kollegen,<br />
ich begrüße Sie herzlich und freue mich,<br />
Ihnen den Gewinner des Förderpreises<br />
„Vielfalt in Ausbildung <strong>2010</strong>“ in der Kate-<br />
gorie Kleinunternehmen vorstellen zu<br />
dürfen. Gewonnen hat der Automobil-<br />
handel und Reparaturbetrieb der Auto<br />
Wichert GmbH in der Ulzburger Straße.<br />
Die Gruppe der Auto Wichert GmbH<br />
besteht aus 11 Betrieben, mit 650 Mit-<br />
arbeitern und 127 Auszubildenden. Einer<br />
dieser Betriebe – Auto Wichert,<br />
Ulzburger Straße, hat sich für den Förder-<br />
preis „Vielfalt in Ausbildung <strong>2010</strong>„ be-<br />
worben.<br />
Die Werkstatt beschäftigt 27 Mitarbeiter/-<br />
innen und bildet 10 Jugendliche aus. 4<br />
dieser Auszubildenden haben einen<br />
Migrationshintergrund. Also eine<br />
beindruckende Quote von 40 Prozent!<br />
Der Werkstattleiter Martin Peetz hat sich<br />
immer mehr Vielfalt zum Ziel gesetzt. Bei<br />
der Besetzung der Ausbildungsplätze<br />
achtet er deshalb darauf, Aspekte wie<br />
„gender“ und unterschiedliche soziale /<br />
ethnische Herkunft zu berücksichtigen.<br />
Herr Peetz gibt auch schwächeren<br />
Schülern durch Langzeitpraktika eine<br />
Chance und führt Partnerschaften mit<br />
zwei Schulen. Darüber hinaus hat er einige<br />
Teile des interkulturellen Einstellungsver-<br />
fahrens der <strong>BQM</strong> in sein Auswahltest ein-<br />
fließen lassen.<br />
Laudator Hülya Eralp (<strong>BQM</strong>)<br />
Herr Peetz nimmt an Fortbildungen zu den<br />
Themen „Diversity Management, inter-<br />
kulturelle Kommunikation u. ä teil, weil<br />
für ihn die Zufriedenheit der Mitarbeiter/-<br />
innen sowie Kunden oberste Priorität hat.<br />
Nicht nur dies, er will alle begeistern und<br />
mit Rat und Tat allen kompetent zur Seite<br />
stehen.<br />
Auf der Homepage der Firma Auto<br />
Wichert kann man folgendes lesen:<br />
32
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
„Unser Appetit auf Auszeichnungen ist so<br />
unstillbar groß, dass Sie sich auch künftig<br />
auf unseren ausgezeichneten Einsatz für<br />
Sie verlassen können.<br />
Den unstillbar großen Appetit auf Aus-<br />
zeichnungen des Unternehmens möchten<br />
wir heute entgegen kommen.<br />
Zur Ehrung des Engagements darf ich nun<br />
auf die Bühne bitten: Werkstattleiter<br />
Ulzburger Straße – Herrn Martin Peetz,<br />
Serviceleiter der Betriebe Ulzburger<br />
Straße und Audi Stockflethweg – Herrn<br />
Oliver Ladwig, Vertreter Werbeagentur<br />
Inconn für die Auto Wichert GmbH -<br />
Herr Anan Pinitvetchagan und die Auszu-<br />
bildenden Frau Christiane Köroglu und<br />
Herrn Ali Djisar.<br />
Verleihung des Förderpreises (v.l.n.r.): Christa Goetsch, Oliver<br />
Ladwig, Anan Pinitvetchagan, Christiane Köroglu, Martin Peetz,<br />
Hülya Eralp, Uli Wachholtz<br />
33
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Preisverleihung: Laudatio<br />
Haar und Cosmetik by<br />
Mister No<br />
Dr. Rita Panesar –<br />
KWB e. V. / <strong>BQM</strong><br />
Sehr geehrte Damen und Herren,<br />
man muss kein großes Unternehmen<br />
führen, um sich interkulturell zu öffnen<br />
oder sich für Jugendliche mit Migrations-<br />
hintergrund einzusetzen.<br />
Ich freue mich Ihnen als dritten Preisträger<br />
ein Unternehmen vorstellen zu dürfen, das<br />
zu den Kleinstunternehmen gehört:<br />
Haar und Cosmetic by Mister No.<br />
Das Unternehmen besteht aus 3 Mit-<br />
arbeiter/-innen und zwei Auszubildenden.<br />
Einer dieser Azubis hat Migrationshinter-<br />
grund. Eine Quote also von 50 Prozent!<br />
Das Unternehmen kooperiert sehr eng<br />
mit zwei Schulen, der Schule Hegholt in<br />
Bramfeld und der Integrierten Gesamt-<br />
schule in Barsbüttel, nach den Sommer-<br />
ferien kommen wegen des großen Erfolgs<br />
noch weitere Schulen hinzu. Vielleicht<br />
auch wegen des genialen Projekttitels.<br />
„Friseur und Schule nur für Coole!“<br />
�����������������������������������������<br />
des Friseursalons, hat ein innovatives<br />
Konzept erarbeitet: Er hat Unterrichts-<br />
module entwickelt, die gerade auch lern-<br />
schwache Schülerinnen und Schüler auf die<br />
Anforderungen der Berufswelt vor-<br />
bereiten: Einmal in der Woche kommen<br />
sie in seinen Salon und lernen dort<br />
praktische Grundlagen des Friseurhand-<br />
werks. Ein besonderer Erfolg: Der<br />
praktische Unterricht wird zum Teil sogar<br />
als Wahlpflichtkurs benotet und durch ein<br />
Zertifikat der Handwerkskammer be-<br />
scheinigt. Für Schüler/-innen mit<br />
schwierigen Startbedingungen eine ganz<br />
wichtige Unterstützung in der beruflichen<br />
Orientierung und ein hervorragendes Bei-<br />
spiel für die Kooperation von Schulen und<br />
Unternehmen!<br />
Laudator Dr. Rita Panesar (<strong>BQM</strong>)<br />
Motiviert ist das Team und insbesondere<br />
��������takar, nicht zuletzt durch eigene<br />
Erfahrungen. Der Leiter des Friseursalons<br />
kam mit 9 Jahren aus der Türkei nach<br />
Deutschland und hatte damals auch über<br />
34
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
ein Praktikum seine Liebe zum Friseur-<br />
beruf entdeckt. Längst ist er Meister und<br />
hat sich als Fachkosmetiker und Visagist<br />
weitergebildet. Das in seiner persönlichen<br />
Lebensgeschichte generierte Know How<br />
möchte er als Vorbild anderen Jugend-<br />
lichen mit Migrationshintergrund zu Gute<br />
kommen lassen. Ihnen und ihren Eltern<br />
zeigen: Es ist möglich, seinen Platz und<br />
seine Aufgabe hier zu finden und eine<br />
Ausbildung im Handwerk bietet da sehr<br />
große Chancen.<br />
Kunden schätzen nicht nur das<br />
Engagement des Friseursalons, sondern<br />
vor allem die handwerklich sehr ge-<br />
schickten Mitarbeiter. So heißt es in einer<br />
Bewertung aus dem Internet: „ Es ist ein<br />
Wohlfühltempel, die Zeit, die man dort<br />
verbringt, genießt man einfach nur als<br />
KÖNIG KUNDE!“<br />
��������������������������������������������<br />
�������������������������������f die<br />
Bühne sowie die Azubis Fatih Arslan und<br />
Suayip Azizoğlu.<br />
���������������������������������������������������������������<br />
����������, Suayip Azizoğlu, Fatih Arslan, Christa Goetsch,<br />
Dr. Rita Panesar, Uli Wachholtz<br />
35
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Keynote Monika Rühl –<br />
Leiterin Change Management und<br />
Diversity, Deutsche Lufthansa AG<br />
Sehr gehrte Frau Bürgermeisterin,<br />
sehr geehrter Herr Lüttke,<br />
sehr geehrter Herr Wachholtz,<br />
liebe Ehrengäste, liebe Preisträger und<br />
Preisträgerinnen und sehr geehrte Damen<br />
und Herren,<br />
ich möchte ihnen ganz kurz etwas über<br />
das, was wir unter Diversity verstehen,<br />
was wir machen und was wir uns davon<br />
versprechen, erzählen. Ob das für Sie ge-<br />
eignet ist, ähnlich zu betreiben, das<br />
müssen sie dann selber entscheiden. Ich<br />
kenne ihre spezifische Unternehmens-<br />
situation nicht. Alleine die Definition für<br />
Diversity ist so unterschiedlich von<br />
Unternehmen zu Unternehmen und hängt<br />
natürlich immer ganz stark von dem<br />
Unternehmensziel, von der Unter-<br />
nehmensstrategie ab. Und da sind wir<br />
dann gleich bei unserer Definition. Wir<br />
haben die Situation, dass wir viele Airlines<br />
inzwischen unter dem Dach haben, also<br />
nicht nur eine Swiss, sondern auch eine<br />
Air Dolomiti, eine German Wings und<br />
natürlich die Lufthansa Cityline und so<br />
weiter. Das heißt, wir haben schon mal<br />
ganz verschiedene Produkte, ganz ver-<br />
schiedene Airlines. Wir haben auch von<br />
einem super Premium First-Class Produkt<br />
bis zur Low Cost Airline, die sich vor allen<br />
Dingen natürlich im Bereich German<br />
Wings abspielt, auch sehr viele ver-<br />
schiedene Produkte und damit auch sehr<br />
viele verschiedene Märkte. Die Märkte<br />
beziehen sich auch auf unser interna-<br />
tonales Geschäft, also an den ver-<br />
schiedenen Standorten. Und wir haben<br />
dann natürlich mit den verschiedenen<br />
Standorten auch die verschiedenen so-<br />
genannten Hubs.<br />
Keynote: Monika Rühl, Leiterin Change Management und<br />
Diversity, Deutsche Lufthansa AG<br />
Die Multi-Hub, die Multi-Brands, Multi-<br />
Airlines und die Multi-Products. Aufgrund<br />
der Marktvielfalt ergibt sich natürlich dann<br />
auch eine Kundenvielfalt. Und weil wir<br />
eine Kundenvielfalt haben und glauben,<br />
dass wir unsere Kunden nur damit zu-<br />
36
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
frieden stellen können, dass wir ihre Be-<br />
dürfnisse so gut wie möglich treffen – wir<br />
sind ein Dienstleistungsunternehmen –<br />
haben wir die Mitarbeitervielfalt. Das ist<br />
kein neues Thema. Das Thema Diversity<br />
Management unter dem Heading, das gibt<br />
es seit 2001, aber die Inhalte, die sind<br />
nicht neu. Lufthansa ist seit 1955, seit dem<br />
das Unternehmen nach dem Zweiten<br />
Weltkrieg wieder gestartet ist, sehr inter-<br />
national ausgerichtet. Und wir haben<br />
natürlich schon immer Frauen, Männer<br />
und Mitarbeiter unterschiedlicher Alters-<br />
strukturen gehabt.<br />
Welche Dimensionen fassen wir unter<br />
dem Dach von Diversity Management und<br />
Diversity zusammen? Das sind auch die<br />
Dimensionen, die im Jahr 2006 im AGG<br />
definiert wurden. Nämlich Geschlecht,<br />
Alter, Herkunft. Bei uns spielt Nationalität<br />
eine größere Rolle als Rasse oder Ethnie,<br />
weil wir nach Rasse oder Ethnie nicht<br />
zählen. Allenfalls in Amerika können sie<br />
danach fragen, in Deutschland nicht. In<br />
Amerika können sie interessanter Weise<br />
wieder nicht nach Nationalitäten fragen,<br />
dort geben sie den Pass nicht ab. Ganz<br />
unterschiedliche kulturelle Approaches.<br />
Das ist das Thema Menschen mit Be-<br />
hinderungen und das Thema sexuelle<br />
Identität. Also die acht Dimensionen.<br />
Warum setzen wir uns damit auseinander?<br />
Es ist für uns keine Sozialromantik,<br />
sondern ein ganz klares Thema des Wett-<br />
bewerbsvorteils, der Produktivität, der<br />
Nutzung der vorhandenen Ressourcen.<br />
Eine Kultur, eine Unternehmenskultur, die<br />
erwartet, dass sich alle an die Mainstream-<br />
kultur – und das ist bei uns im Arbeits-<br />
bereich in Mitteleuropa immer noch<br />
männlich, mittelalt und mitteleuropäisch<br />
von der Abkunft her – die von den<br />
Menschen das erwartet, wird all die<br />
Menschen, die abweichen von dieser so-<br />
genannten Mainstreamkultur dazu bringen,<br />
dass sie sich anpassen und ihre Kraft in<br />
diesen Anpassungsaufwand zu investieren,<br />
anstatt in die Arbeit zu investieren. Und<br />
wir sagen, dass wir das nicht wollen, wir<br />
möchten Produktivität. Wir müssen<br />
Produktivitätsreserven mobilisieren. Wir<br />
haben aber auch gerade was unser<br />
Produkt und unser Geschäft angeht einen<br />
ganz, ganz großen Vorteil, wenn wir eben<br />
unterschiedliche Perspektiven auf eine<br />
Herausforderung haben. Und wenn nicht<br />
alle das selbe sagen, weil sie womöglich<br />
auch noch den selben Abschluss an der<br />
selben Hochschule, womöglich in einem<br />
37
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
ähnlichen Zeitraum absolviert haben.<br />
Nein, aus der Vielfalt, aus der Breite, aus<br />
der Buntheit kriegen wir eben ganz, ganz<br />
unterschied-liche Problemlösungsansätze.<br />
Und das halten wir für einen sehr großen<br />
Vorteil für das Unternehmen und deshalb<br />
ist Diversity Management bei uns auch ein<br />
wichtiges Thema und wird auch weiterhin<br />
betrieben.<br />
Ganz kurz zwei, drei allgemeine Zahlen.<br />
Also, wir haben im letzten Jahr 22<br />
Milliarden Umsatz gemacht. Wir haben<br />
400 Konzerngesellschaften. Das heißt wir<br />
sind sowohl Kleinstunternehmer als auch<br />
Kleinunternehmer als auch mittel-<br />
ständisches Unternehmen, und wenn Sie<br />
die Lufthansa Passage Fluggeschäft<br />
nehmen, dann sind wir natürlich auch<br />
Großunternehmen. Also 400 Unter-<br />
nehmen unter dem Konzerndach der<br />
Deutschen Lufthansa. Wir fliegen auch<br />
genau so viele Orte an, 400 Zielorte in<br />
100 Ländern und wir haben über 500 Flug-<br />
zeuge in der Zwischenzeit. Das kommt<br />
natürlich vor allen Dingen durch unsere<br />
sogenannten Acquisitions, also durch die<br />
Neuzugänge von verschiedenen Fluggesell-<br />
schaften und bis zu der großen Krise sind<br />
wir natürlich auch in Deutschland noch<br />
sehr stark gewachsen. Das ist im Augen-<br />
blick gerade etwas reduziert. Mitarbeiter<br />
wie gesagt 117.521, von denen 55,1 Pro-<br />
zent in Deutschland arbeiten und von<br />
denen – das nehme ich schon mal vorweg<br />
– haben 11,3 Prozent keinen deutschen<br />
Pass. Wir haben aber garantiert ganz viele<br />
Menschen, die einen anderen kulturellen<br />
Hintergrund haben als einen deutschen<br />
Hintergrund. Die dann vielleicht zwei<br />
Pässe haben oder sogar einen deutschen<br />
Pass haben, wenn sie hier geboren sind.<br />
Die zählen wir nicht, die erfassen wir<br />
nicht. Da das für uns kein neues Thema ist<br />
und wir nicht bei der Stunde Null an-<br />
fangen, sondern das ein langer Prozess ist,<br />
gehen wir jetzt auch nicht rum und fragen<br />
alle Mitarbeiter, ob sie Migrationshinter-<br />
grund haben. Was ist ein Migrations-<br />
hintergrund? Ist ein Migrationshintergrund<br />
nur ein solcher Wanderungshintergrund<br />
aus einem wirtschaftlich nicht ganz so<br />
potenten Land wie der Bundesrepublik<br />
Deutschland? Unser Vorstandsvor-<br />
sitzender ist Österreicher, also wir haben<br />
25 Prozent Ausländeranteil im Vorstand.<br />
Ist das ein Migrationshintergrund? Würden<br />
wir wahrscheinlich jetzt alle mit den<br />
Definitionen, die wir so im Hinterkopf<br />
haben, wahrscheinlich eher nein sagen.<br />
38
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Warum ist das Thema sinnvoll? Sie haben<br />
eine ganze Reihe neben wirtschaftlichen<br />
Kriterien, auf die ich gleich auch noch zu<br />
sprechen komme, eine ganze Reihe an<br />
Auslösern. Sie können natürlich sagen<br />
rechtliche Gründe. AGG wäre in Deutsch-<br />
land ein Grund. Grundgesetz hat einige<br />
Vorschriften, BGB hat Vorschriften und so<br />
weiter. Das wäre ein sogenannter<br />
Compliance-Ansatz. Sie können auch die<br />
Nachhaltigkeitsindizes nennen – und dort<br />
gelistet zu sein, ist für Lufthansa sehr, sehr<br />
wichtig, weil wir darüber auch eben<br />
Kapital beschaffen. Die wichtigsten sind für<br />
uns der Dow-Jones-Index und der<br />
FTSE4Good. Die fragen immer stärker<br />
nach nicht Diskriminierungsthemen, also<br />
Pro-Aktiv dann Gestaltungsthemen Di-<br />
versity Management Themen. Wir können<br />
sagen, dass wenn wir nur darauf reagieren<br />
würden, wäre das auch wieder ein<br />
Compliance-Ansatz, aber auch das wäre<br />
legitim, wenn man das betreiben würde.<br />
Natürlich der demografische Wandel,<br />
natürlich die Globalisierung, natürlich die<br />
weiter zunehmende Individualisierung. Das<br />
sind auch alles wichtige Faktoren. Und<br />
dann natürlich als verantwortungsvoll<br />
handelndes Unternehmen, das ganze<br />
Thema Wirtschaftsethik oder Nachhaltig-<br />
keit, Sustainability. Das sind für uns auch<br />
ganz wichtige Themen. Beim Thema<br />
wirtschaftliche Gründe – und last not least<br />
wir sind ein Wirtschaftsunternehmen – ist<br />
natürlich das Thema Produktivitäts-<br />
reserven, das habe ich schon ganz kurz<br />
angesprochen. Die Heterogenität der<br />
Märkte sind für uns ganz wichtige Gründe.<br />
Wenn man miteinander arbeitet, und da<br />
sind wir jetzt beim Thema Diversity<br />
Management – eine Vielfalt zu betrachten<br />
ist ein statischer Ansatz. Da zählt man, wie<br />
viel Frauen hat man, wie ist das Durch-<br />
schnittsalter und wie viele Ausländer hat<br />
man im Unternehmen. Wichtiger ist dann<br />
aber, diese Vielfalt zu managen. Und dafür<br />
muss jeder Mensch die Differenzierungs-<br />
kriterien kennen, jeder Mitarbeiter im<br />
Unternehmen. Nämlich Kultur, die<br />
kulturellen Unterschiede. Sie haben die<br />
drei verschiedenen Kulturtypen im Unter-<br />
nehmen. Lineare, reaktive, multiaktive<br />
Kulturen. Die Deutschen sind sehr<br />
arbeitsbezogene, lineare Kulturmenschen.<br />
Die Spanier und die ganzen Latinos sind<br />
dann eher multiaktive, sehr aktive und<br />
nicht so sehr nach Plänen arbeitende und<br />
nicht so pünktlich, personenbezogene<br />
Kulturen, während die linearen Kulturen<br />
39
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
eher nicht personenbezogen sind. Und<br />
reaktive Kulturen wären alle die<br />
asiatischen Kulturen, die sehr indirekt,<br />
sehr personenbezogen zwar sind, aber<br />
sehr wage auch in den Zusagen sind und<br />
sehr auf Beziehungen aufbauend arbeiten,<br />
weshalb ja Geschäfte in asiatischen<br />
Ländern auch wesentlich länger dauern.<br />
Dann kann man die zweite Dimension<br />
Alter drauf packen. Das ist das zweite<br />
Unterscheidungsmerkmal. Und die dritte<br />
Dimension – man glaubt es nicht – ist<br />
Männlein und Weiblein. Das sind zwei<br />
verschiedene Kulturen, nicht besser und<br />
schlechter, sondern einfach noch unter-<br />
schiedliche Kulturen, so dass jeder einen<br />
Punkt – ich bin Mathematikerin, deshalb<br />
darf ich das sagen – jeder einen Punkt im<br />
dreidimensionalen Raum darstellt und sich<br />
selber als Null setzt und immer, bei jeder<br />
Kommunikation meint, der andere ist auch<br />
da und da geht das Missverständnis in aller<br />
Regel schon los. Deshalb schulen wir auch<br />
sehr viel interkulturelle Kompetenz, wir<br />
schulen natürlich auch das Gender-Thema.<br />
Und es ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir<br />
möglichst missverständnisfrei miteinander<br />
kommunizieren – auch da natürlich mit<br />
dem Fernziel, dass wir möglichst produktiv<br />
arbeiten.<br />
Aus Mitarbeiterperspektive ist es natürlich<br />
ganz klar, dass Mitarbeiter mit einer Di-<br />
versität oder einem Diversitätsfaktor<br />
Respekt erwarten, dass sie gleich be-<br />
handelt werden wollen, wie andere Mit-<br />
arbeiter auch. Es gibt auch keine guten<br />
Gründe, das anders zu handhaben. Und<br />
das wirkt sich dann natürlich positiv auch<br />
auf ihre Motivation aus. Wobei wir dann<br />
wieder beim Thema der Produktivität sind.<br />
Insgesamt zielen wir auf Inklusion und ich<br />
sagte es ja schon, dass wir seit 55 eigent-<br />
lich schon sehr international sind und auch<br />
sehr heterogene Mitarbeiterstrukturen<br />
haben, weshalb wir uns da nicht relativ<br />
neu auf die Reise machen. Der Herr Laue,<br />
unser Personalvorstand, hat unser ganzes<br />
Ziel mal genannt: Wertschöpfung durch<br />
Wertschätzung. Und da haben sie den<br />
sozialpolitischen Aspekt dabei, was die<br />
Mitarbeiter erwartet. Und sie haben auf<br />
der anderen Seite die Unternehmens-<br />
betrachtung, die kollektive Betrachtung auf<br />
der Unternehmensseite.<br />
Vielleicht noch ein paar Zahlen. Von den<br />
117.000 Mitarbeitern sind 45 Prozent<br />
Frauen. Dann haben wir zwei Führungs-<br />
begriffe, einmal Vorgesetztenfunktion.<br />
40
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Dazu gehören auch Meister, Teamleiter,<br />
Gruppenleiter, auch die Kapitäne, alle<br />
möglichen anderen Funktionen, Purser in<br />
der Kabine zum Beispiel. Da beträgt der<br />
Frauenanteil 41,5 Prozent. Da sind wir<br />
sehr dicht bei den 45 Prozent. Dann die<br />
Leitenden, das sind die oberen 830<br />
Führungskräfte des Unternehmens. Da ist<br />
der Frauenanteil wie in jedem guten<br />
anderen deutschen Unternehmen auch<br />
eben nur bei 14,7 Prozent. Wir sind ein<br />
bisschen besser als der bundesdeutsche<br />
Durchschnitt, aber eben auch noch nicht<br />
so furchtbar weit. Und auch das Cockpit<br />
scheint noch immer eine Männerdomäne<br />
zu sein. 4,7 Prozent aller Piloten sind<br />
weiblich. Der Altersdurchschnitt ist 40,3<br />
Jahre. Wir sind ein bisschen jünger als der<br />
bundesdeutsche Durchschnitt. Das liegt<br />
sehr stark uns unseren operativen Auf-<br />
gaben, wo wir eben doch meistens sehr<br />
jung einstellen. Wir haben insgesamt 149<br />
Nationalitäten im Unternehmen. Ich sagte<br />
bereits, dass wir Migrationshintergründe<br />
leider nicht messen. Und in Deutschland<br />
sind es immerhin noch 117 Nationalitäten,<br />
von solchen Mitarbeitern, die wie gesagt<br />
keinen deutschen Pass haben. 11,4 Prozent<br />
haben in Deutschland keine deutsche<br />
Staatsangehörigkeit. 3,3 Prozent eine Be-<br />
hinderung. Und 27 Prozent unserer Mit-<br />
arbeit insgesamt weltweit haben Teilzeit<br />
und davon sind 28 Prozent Männer. Teil-<br />
zeit ist bei uns immer ein Tool gewesen,<br />
mit dem wir unsere Kapazitäts-<br />
schwankungen wunderbar austarieren<br />
können. Und das haben wir Anfang der<br />
90’er Jahre, als es uns mal sehr schlecht<br />
ging, dann massiv erhöht. Und es haben<br />
auch sehr viele hoch qualifizierte Männer<br />
ohne Angabe von Gründen Teilzeit ge-<br />
nommen. Und seit dem ist bei uns Teilzeit<br />
neutralisiert, also nicht mehr nur für<br />
Wahrnehmung von Erziehungspflichten,<br />
sondern eben auch für uns ein<br />
Flexibilisierungstool.<br />
Ich könnte Ihnen jetzt zu jedem Feld einige<br />
Maßnahmen ausführen, mache ich jetzt<br />
aber nicht, bisschen mit Blick auf die Zeit.<br />
Wir haben natürlich interkulturelle<br />
Trainings, fast alle Sprachen können Sie bei<br />
uns lernen. Sie können auch Deutsch für<br />
nicht Muttersprachler bei Lufthansa in der<br />
Freizeit lernen. Die interkulturellen<br />
Trainings sind für Führungskräfte ver-<br />
pflichtend, für Flugbegleiter verpflichtend<br />
und für alle Mitarbeiter in der freiwilligen<br />
Weiterbildung im Angebot und da auch<br />
wieder in der Freizeit. Das ganze Ent-<br />
41
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
sendungsgeschäft, also Entsendung ins<br />
Ausland, Entsendung aus dem Ausland<br />
hierher und die Drittlandentsendungen,<br />
also die Rotation im Ausland, tragen auch<br />
dazu bei, dieses kulturelle Verständnis zu<br />
vergrößern und durch den Kontakt mit<br />
den jeweiligen Kulturen eben ein größeres<br />
Verständnis zu entwicklen, was wiederum<br />
auch unseren Sprachen zugute kommt.<br />
Ganz wichtig ist unser E-Recruiting, was<br />
wir nun auch schon fast zehn Jahre be-<br />
treiben. www.belufthansa.com. Das ist ein<br />
neutrales Auswahlsystem. Aufgrund der<br />
Diversität des Unternehmens glauben Sie<br />
mir hoffentlich, dass wir nicht be-<br />
nachteiligen nach irgend welchen<br />
Dimensionen. Dieses E-Recruiting ist<br />
natürlich ein Verfahren, mit denen Sie<br />
noch weitere Möglichkeiten haben, neutral<br />
heranzugehen. Natürlich gibt der Be-<br />
werber, die Bewerberin Namen ein, natür-<br />
lich gibt man auch ein Alter ein, weil wir<br />
bei einigen Berufen Altersgrenzen haben<br />
müssen. Aber bis zum Online-Test ist alles<br />
elektronisch. Da sieht sie noch keiner, da<br />
guckt sich auch keiner Namen an. Die<br />
Namen kommen dann erst in Sicht, wenn<br />
Sie es bis zum Auswahlgespräch geschafft<br />
haben. Das sind dann noch ungefähr – je<br />
nach Beruf – höchstens noch zehn Pro-<br />
zent, wie gesagt, je nach Berufsgruppe,<br />
wofür die Bewerbungen sind. Also absolut<br />
neutral. Es gibt Bestrebungen – ich weiß<br />
jetzt nicht, wo die kommen, die BDA hat<br />
uns das neulich vorgelegt.<br />
V.l.n.r.: Christa Goetsch, Uli Wachholtz<br />
Aus der OECD-Studie, die man in Frank-<br />
reich durchgeführt hat, hat man erfahren,<br />
dass die Bewerbungen erfolgreicher sind,<br />
wenn die Namen neutral sind, oder gar<br />
keine Namen da sind. Wenn Sie Vielfalt so<br />
positiv leben und wenn Sie sagen, aus der<br />
Vielfalt haben Sie eine Gestaltungschance,<br />
aus der Vielfalt haben Sie eine Lösungs-<br />
kompetenz für die Herausforderung des<br />
Unternehmens – wir hatten vor wenigen<br />
Jahren noch 80 Prozent deutsche Mit-<br />
arbeiter, heute sind wir auf 55 Prozent<br />
runter. Das heißt die Internationalität, die<br />
interkulturelle Kompetenz und auch in den<br />
Backoffices von administrativen Tätig-<br />
keiten sind enorm gestiegen. Auch die<br />
42
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
sprachlichen Kompetenzen sind gestiegen.<br />
Das heißt, wir wollen ausdrücklich Vielfalt<br />
im Unternehmen haben. Und wenn Sie es<br />
jetzt neutralisieren, dann haben Sie gar<br />
nicht mehr die Chance, das zu steuern,<br />
wenn Sie es denn steuern können.<br />
Deshalb glaube ich, dass unser neutrales<br />
Auswahlverfahren für unser Unternehmen<br />
– das mag bei Ihnen anders sein – einfach<br />
der bessere Weg ist.<br />
Darüber hinaus starten wir jetzt gerade<br />
eine Kooperation mit der Boston<br />
Consulting Group. Die machen ein<br />
weiteres CSR-Projekt. Die haben das<br />
Business at School eingeführt – eine Ko-<br />
operation von Schule und Wirtschaft. Im<br />
11. beziehungsweise 12. Schuljahr, um<br />
Brücken zwischen diesen beiden Lebens-<br />
bereichen zu bauen. Und die haben ein<br />
neues Produkt, das nennt sich Joblinge.<br />
Das gibt es seit zwei Jahren, ist in<br />
München angefangen, und die gehen jetzt<br />
auch deutschlandweit. Und das soll Haupt-<br />
schülern, meistens mit Migrationshinter-<br />
grund, nicht nur, dazu verhelfen, dass sie<br />
ausbildungsfähig gemacht werden und dass<br />
sie den Ausbildungsplatz wirklich durch-<br />
führen können. Denn wenn man sich das<br />
genauer betrachtet aus Unternehmens-<br />
perspektive, dann haben sie oftmals nicht<br />
die Chance, die Sorge, die Pflege oder den<br />
zeitlichen Aufwand zu investieren, den<br />
vielleicht jemand braucht, der nicht das<br />
Ausbildungsniveau hat, den Sie aber gern<br />
ausbilden würden. In dieser Kombination<br />
nimmt diese Begleitung einerseits BCG<br />
wahr und zum anderen eben auch<br />
Mentoren, die diese Schüler eben noch<br />
parallel erhalten. Ein wunderbares zweites<br />
Produkt von dem Unternehmen, und wie<br />
gesagt, wir steigen ein. Und soweit ich<br />
gehört habe, fangen die in Hamburg<br />
demnächst auch irgendwann ein. Genauen<br />
Zeitpunkt kann ich Ihnen aber noch nicht<br />
nennen, aber das finden Sie sicher bei der<br />
BCG auf der Homepage.<br />
Ja, welche Erfahrungen haben wir gemacht<br />
mit dem Thema Diversity und Unter-<br />
nehmenserfolg. Also, Diversity ist im<br />
Unternehmen verankert. Es ist intern gar<br />
nicht mehr so ein riesen Thema. Die<br />
einzelnen Dimensionen schon, also<br />
Geschlecht: Frauen in Führungspositionen,<br />
mehr Frauen in die Technik. Das sind<br />
Themen, die tauchen immer mal wieder<br />
auf. Oder auch Demografie Management,<br />
ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das über-<br />
geordnete Thema scheint verankert zu<br />
43
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
sein. Wir haben allerdings auch eine Philo-<br />
sophie der Dezentralität, so dass das vor<br />
Ort nach den Bedürfnissen in den<br />
jeweiligen Konzerngesellschaften in Ab-<br />
hängigkeit von den auch rechtlichen Ge-<br />
gebenheiten der jeweiligen Länder um-<br />
gesetzt wird, und wir sozusagen allenfalls<br />
Steuerungsimpulse geben, falls das ge-<br />
wünscht wird.<br />
Ein Highlight wäre sicherlich, dass wir das<br />
Cross-Mentoring-Programm, das unter-<br />
nehmensübergreifende Mentoring für<br />
Frauen 1998 initiiert haben, damals mit<br />
drei anderen Unternehmen. Das läuft jetzt<br />
in der zwölften Generation mit weiteren<br />
Unternehmen. Wir machen inzwischen<br />
Mentoring-Programme eben auch für viele<br />
andere Zielgruppen. Das ist etwas, das<br />
sich gut verankert hat, und was wir als<br />
wunderbares Highlight sehen würden.<br />
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.<br />
44
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Musikalisches Intermezzo<br />
Orhan �������- Saz<br />
Podiumsdiskussion<br />
Podiumsdiskussion (v.l.n.r.): Mark Terkessidis, Monika Rühl,<br />
Julia-Niharika Sen, Karl Gernandt, Mely Kiyak, Dr. Thomas<br />
Liebig<br />
Die Moderatorin Julia Sen stieg mit einer<br />
sehr persönlichen Frage in die Diskussion<br />
ein und bat die Podiumsteilnehmer/-innen,<br />
ihre eigenen Gedanken zum Thema Dis-<br />
kriminierung bzw. eigene Dis-<br />
kriminierungserlebnisse zu schildern.<br />
Während Karl Gernandt, Delegierter des<br />
Verwaltungsrates Kühne + Nagel Inter-<br />
national AG, beschrieb, wie er als<br />
Diplomatenkind in Lateinamerika aufwuchs<br />
und sich dann nach der Rückkehr nach<br />
Deutschland in einen deutschen Freundes-<br />
kreis integrieren musste, beschrieb Mark<br />
Terkessidis, wie Taxifahrer ihm, als in<br />
Deutschland aufgewachsener Akademiker<br />
Komplimente für sein gutes Deutsch<br />
machten.<br />
Deutlich wurde, dass jedem die Möglich-<br />
keit gegeben ist, sich auf der Basis eigener<br />
Erfahrungen in die Situation Jugendlicher<br />
mit Migrationshintergrund einzufühlen, die<br />
auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle<br />
etwa an den Hürden fehlender Netz-<br />
werke, geringem Bewusstseins hinsichtlich<br />
45
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
eigener Potenziale oder Vorurteile der<br />
Personalverantwortlichen scheitern.<br />
Die Probleme sind offensichtlich und<br />
dennoch kann es Situationen geben, so die<br />
These von Mark Terkessidis, in denen es<br />
nicht hilfreich ist, die Gruppe der<br />
Migranten als Extragruppe zu konstruieren<br />
und damit quasi auszusondern. Für ihn<br />
müsste die Zeit, in denen Migranten als<br />
„defizitäre Wesen“ behandelt werden, bei<br />
denen man etwa durch Sprachkurse am<br />
Nachmittag kompensatorisch tätig werden<br />
sollte, längst vorbei sein: „Wir müssen den<br />
Bildungsbereich reformieren, nicht eine<br />
bestimmte Gruppe“, so seine These seines<br />
jüngsten Buches „Interkultur“.<br />
Karl Gernandt, Kühne + Nagel, wider-<br />
sprach insofern, als dass er es für wichtig<br />
hielt, durch Veranstaltungen wie die Fach-<br />
tagung eine Gruppe sichtbar zu machen,<br />
die sonst vielleicht übersehen wird. Im<br />
Moment seien wir in einer Übergangs-<br />
phase, in der es Sondermaßnahmen be-<br />
dürfe. Mark Terkessidis antwortet mit<br />
einem starken Appell an die Institutionen:<br />
In England etwa gäbe es Englisch als<br />
Zweitsprache im Regelunterricht, dort sei<br />
die individuelle Ansprache bereits fester<br />
Bestandteil. Statt von Normkindern auszu-<br />
gehen müssten sich auch deutsche Schulen<br />
stärker auf die Vielfalt ihrer Schüler/-<br />
innenschaft einstellen.<br />
Mely Kiyak bestätigte die Wahrnehmung,<br />
dass wir von der „Vielfalt als Normalität“<br />
noch weit entfernt seien, dass es noch<br />
einige Schritte zur Verwirklichung dieser<br />
positiven Utopie zu gehen gäbe.<br />
Mely Kiyak, Autorin und freie Journalistin<br />
Es sei eben nicht so, dass sich Menschen<br />
mit Migrationshintergrund automatisch in<br />
alle gesellschaftlichen Bereiche gleicher-<br />
maßen „ergössen“, wenn die Türen ge-<br />
öffnet würden, sondern eher am unteren<br />
Ende der sozialen Skala anzutreffen seien.<br />
In der Judikative, exekutive, den Be-<br />
reichen, die die Gesellschaft maßgeblich<br />
prägen, gäbe es nach wie vor sehr wenige<br />
Migranten. Einige Firmen holten zwar aus<br />
utilitaristischen Motiven Migranten in ihr<br />
Unternehmen, aber es sei eben keine<br />
Selbstverständlichkeit, Migranten überall<br />
46
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
anzutreffen. Die Frage, was Institutionen<br />
eigentlich tun müssten, um sich inter-<br />
kulturell zu öffnen, sei noch relativ neu. In<br />
deutschen Tageszeitungen hätten nur<br />
1 Prozent der Redakteure Migrations-<br />
hintergrund, ergänzte Terkessidis.<br />
Mark Terkessidis –Autor und freier Journalist<br />
Herr Gernandt verwies darauf, dass die<br />
Luftfahrtbranche sowie die Logistik-<br />
branche als international arbeitende<br />
Branchen ohnehin auf eine International<br />
denkende Mitarbeiterschaft angewiesen<br />
seien. Dazu gehöre auch, Arbeitsgruppen<br />
in unterschiedlichen Sprachen zuzulassen<br />
und nicht die Unternehmenssprache<br />
Englisch zu verordnen.<br />
Monika Rühl, Leiterin Change Management und Diversity,<br />
Lufthansa<br />
Frau Rühl ergänzte, dass die Deutsche<br />
Lufthansa Flugbegleiter aus den Ländern<br />
einsetzen, in die die Maschinen fliegen -<br />
um kulturelle Missverständnisse zu ver-<br />
meiden und den Passagieren eine mög-<br />
lichst vertraute Form des Services und der<br />
Zuwendung zukommen zu lassen. Mely<br />
Kiyak forderte daraufhin, Migranten auch<br />
dort einzustellen, wo es nicht um Sprache<br />
und Kultur ginge und fragte provokativ,<br />
„ob der Migrationshintergrund immer<br />
etwas nützen müsse“.<br />
Karl Gernandt, Delegierter des Verwaltungsrates Kühne +<br />
Nagel International AG<br />
47
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Im weiteren Teil der Diskussion ging es<br />
um konkrete Tools, die Unternehmen<br />
anwenden können, um sich interkulturell<br />
zu öffnen. Die Deutsche Lufthansa arbeitet<br />
etwa mit einem neutralen Bewerbungs-<br />
verfahren, dass Frau Rühl ausführlich be-<br />
schrieb. Die ersten Bewerbungsschritte<br />
laufen entsprechend formalisierten Ver-<br />
fahren online, erst nach der Überwindung<br />
mehrerer, die fachlicher Qualifikation<br />
messender Hürden, käme es zu einem<br />
persönlichen Gespräch. Karl Gernandt<br />
ergänzte weitere sinnvolle Strategien, etwa<br />
das vielfältige Kantinenessen, das eine<br />
Wertschätzung gegenüber den unter-<br />
schiedlichen Lebensgewohnheiten der Mit-<br />
arbeiter zum Ausdruck brächte, sowie die<br />
interkulturelle Elternarbeit, mit der sich<br />
Ausbildungsabbrüche vermeiden ließen.<br />
Zudem setze das Unternehmen bei Aus-<br />
zubildenden auf Toleranz, Offenheit in der<br />
Kommunikation und charakterliche Stärke.<br />
Schulnoten seien nicht das einzige aus-<br />
schlaggebende Moment.<br />
Abschließend bat Julia Sen die Podiums-<br />
teilnehmer/-innen zu einer Position in der<br />
heiß diskutierten Hamburger Schulreform.<br />
So richtig konkret wollte sich keiner der<br />
Teilnehmer positionieren. Herr<br />
Terkessidis verwies auf sehr gute Er-<br />
fahrungen mit dem sechsjährigen ge-<br />
meinsamen Lernen in Berlin und Frau<br />
Kiyak schilderte sehr eindrücklich, wie sie<br />
am Übergang von der Grundschule in eine<br />
weiterführende Schule trotz bester Schul-<br />
noten auf eine Hauptschule geschickt<br />
werden sollte. Ihr Lehrer begründete das<br />
den Eltern gegenüber mit den Worten:<br />
„Tun sie es ihr doch nicht an, sie wird<br />
doch ohnehin heiraten“. Da sich die Eltern<br />
durchsetzen konnten, war sie die erste<br />
„Gastarbeitertochter“, die in ihrem<br />
Herkunftsort auf das Gymnasium geschickt<br />
wurde. Herr Dr. Liebig, Frau Rühl und<br />
Herr Gernandt verwiesen auf die Not-<br />
wendigkeit, die Lehrkräfte zu<br />
sensibilisieren, den Unterricht qualitativ zu<br />
verbessern und auch für die Eliten etwas<br />
zu tun. Die Veränderung des Schulsystems<br />
alleine würde die Probleme nicht be-<br />
seitigen.<br />
Zwei Statements aus dem Publikum, in<br />
denen unter anderem auf positive Er-<br />
fahrungen in anderen europäischen<br />
Ländern verwiesen wurde, ergänzten die<br />
Podiumsdiskussion. Frau Sen dankte allen<br />
Anwesenden und lud zum Mittagsbuffet im<br />
Restaurant Parlament.<br />
48
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Forum I<br />
Eine glückliche Beziehung<br />
Partnerschaften zwischen Schulen<br />
und Unternehmen<br />
Moderation:<br />
Dr. Alfred Lumpe – Behörde für Schule und<br />
Berufsbildung / Amt für Schule, Hamburg<br />
Jörg Matern – Landesarbeitsgemeinschaft<br />
SCHULEWIRTSCHAFT, Berlin/Brandenburg<br />
Yvonne Kohlmann – Bundesarbeitsgemein-<br />
schaft SCHULEWIRTSCHAFT, Berlin<br />
Für Jugendliche hängt es von vielen<br />
Faktoren ab, ob sie den Übergang von der<br />
Schule in den Beruf schaffen. Schlechte<br />
Noten, Fehlstunden im Abschlusszeugnis<br />
oder auch mangelnde Kenntnisse über die<br />
Ausbildungsmöglichkeiten gehören dazu.<br />
Bei Jugendlichen mit Migrationshinter-<br />
grund spielen noch andere Gründe eine<br />
Rolle. Viele fühlen sich nicht erwünscht in<br />
deutschen Unternehmen, weil sie in ihrem<br />
Alltag Diskriminierung erfahren haben.<br />
Andere denken möglichwerweise „Warum<br />
soll man mir einen Ausbildungsplatz geben,<br />
wenn deutsche Jugendliche sich auch be-<br />
werben“. Sie sind unsicher oder zögerlich.<br />
Partnerschaften zwischen Schulen und<br />
Unternehmen können solche Ängste ab-<br />
bauen. Sie tragen wesentlich dazu bei,<br />
Hürden und Vorbehalte, wie sie auf beiden<br />
Seiten existieren, zu überwinden und Ver-<br />
trauen zu schaffen. Sie ermöglichen<br />
Jugendlichen, Kontakte zu Ausbildungsver-<br />
antwortlichen zu knüpfen, Praktika anzu-<br />
bahnen, Unternehmenskulturen kennenzu-<br />
lernen und sich Netzwerke zu erschließen.<br />
Im Forum wurden Erfolgsfaktoren und<br />
Praxisbeispiele von zwei Partnerschaften<br />
dargestellt, Unterstützungsnetzwerke be-<br />
kannt gemacht und Materialien wie das<br />
praxisorientierte Handbuch „Partner-<br />
schaften zwischen Schulen und Unter-<br />
nehmen“ vorgestellt.<br />
V.l.n.r.: Hülya Eralp, Yvonne Kohlmann, Jörg Mattern, Dr. Alfred<br />
Lumpe, Doris Wenzel-O´Connor<br />
49
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Impulsreferat I<br />
Hülya Eralp – Referentin KWB e. V. /<br />
<strong>BQM</strong>, Hamburg<br />
In ihrem Eingangsreferat thematisierte<br />
Hülya Eralp die Bedeutung nachhaltiger<br />
Partnerschaften zwischen Schulen und<br />
Unternehmen speziell für Jugendliche mit<br />
Migrationshintergrund. Beginnend<br />
definierte Hülya Eralp dem Plenum<br />
Personen mit Migrationshintergrund nach<br />
dem Statistischen Bundesamt: Personen,<br />
die eine ausländische Staatsangehörigkeit<br />
besitzen, die die deutsche Staats-<br />
angehörigkeit durch Einbürgerung er-<br />
hielten oder bei denen mindestens ein<br />
Elternteil nicht in Deutschland geboren ist.<br />
Damit ist klar, so Hülya Eralp, dass die<br />
Gruppe der Jugendlichen mit Migrations-<br />
hintergrund in Deutschland sehr hetero-<br />
gen ist.<br />
Für Jugendliche mit Migrationshintergrund<br />
bestimmen verschiedene Faktoren, ob sie<br />
den Übergang von der Schule in den Beruf<br />
nahtlos schaffen. Mögliche Hindernisse<br />
sind zum Beispiel mangelnde Kenntnisse<br />
über die Vielfalt der Berufsbilder und Aus-<br />
bildungsmöglichkeiten oder unrealistische<br />
Vorstellungen über ihre beruflichen<br />
Möglichkeiten. Aber auch schlechte Schul-<br />
noten und/oder unentschuldigte Fehl-<br />
stunden im Abschlusszeugnis sowie Un-<br />
sicherheiten, Ängste und Vorbehalte durch<br />
Diskriminierungserfahrungen tragen zu<br />
dieser Situation bei. Darüber hinaus fehlt<br />
es den Jugendlichen mit Migrationshinter-<br />
grund oftmals an Unternehmenskontakten<br />
sowie an Unterstützung der Eltern in der<br />
Berufsorientierung aufgrund deren Un-<br />
kenntnis über das Berufsbildungssystem in<br />
Deutschland.<br />
Nach wie vor gibt es Vorbehalte und Vor-<br />
urteile gegenüber Jugendlichen mit<br />
Migrationshintergrund in Unternehmen.<br />
Dies beweisen jüngste Studien der Uni-<br />
versität Konstanz, des BiBB und der<br />
OECD. Viele Unternehmen haben ihre<br />
Strukturen häufig noch nicht auf die viel-<br />
fältigen Kunden- und Mitarbeiter-<br />
strukturen ausgerichtet. Das heißt, sie<br />
haben keine kultursensiblen Einstellungs-<br />
verfahren und sehen das Potenzial inter-<br />
50
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
kultureller Kompetenzen nicht. Hier be-<br />
steht viel Handlungsbedarf.<br />
Anschließend wies Hülya Eralp auf die er-<br />
fahrungsgemäßen Vorteile hin, die nach-<br />
haltige Partnerschaften für die Jugend-<br />
lichen mit Migrationshintergrund mit sich<br />
bringen. Hürden und Vorbehalte, wie sie<br />
auf beiden Seiten existieren, werden<br />
überwunden und Vertrauen wird ge-<br />
schaffen. Jugendlichen knüpfen Kontakte<br />
zu Ausbildungsverantwortlichen und<br />
können auf diese Weise Praktika an-<br />
bahnen. Des Weiteren lernen sie Unter-<br />
nehmenskulturen kennen und erschließen<br />
sich neue Netzwerke. Durch Praktika<br />
können die Jugendlichen in Unternehmen<br />
ihre eigenen Stärken entdecken und<br />
soziale Kompetenzen weiterentwickeln.<br />
Zudem lernen sie die Vielfalt der Berufe<br />
und Anforderungsprofile kennen. Über<br />
den Dialog mit ihren Eltern tragen die<br />
Jugendlichen dann dazu bei, dass auch die<br />
Mütter und Väter mehr über die beruf-<br />
liche Möglichkeiten in Deutschland er-<br />
fahren.<br />
Beide Seiten profitieren von einer guten<br />
und partnerschaftlichen Zusammenarbeit.<br />
Für Unternehmen ist es natürlich ebenso<br />
von Vorteil, wenn sie bereits in den<br />
Schulen die Nachwuchskräfte von morgen<br />
kennenlernen und sie über Möglichkeiten<br />
aufklären, die ihr Betrieb ihnen bietet, so<br />
Hülya Eralp.<br />
Impulsreferat II<br />
Doris Wenzel-O‘Connor – Geschäfts-<br />
führerin der Landesarbeitsgemein-<br />
schaft SCHULEWIRTSCHAFT<br />
Hamburg<br />
Im Anschluss stellte Doris Wenzel-<br />
O’Connor dem Plenum die vor über 50<br />
Jahren gegründete Landesarbeitsgemein-<br />
schaft SCHULEWIRTSCHAFT vor. Sie<br />
organisiert und fördert die Zusammen-<br />
arbeit zwischen Schule und Wirtschaft.<br />
Zielsetzung ist hierbei die Stärkung einer<br />
ökonomischen Grundbildung, die optimale<br />
Gestaltung der Berufsorientierung von<br />
Schülerinnen und Schülern für den<br />
reibungslosen Übergang von Schule in<br />
Ausbildung oder Studium sowie die<br />
Initiierung auf Dauer angelegter Partner-<br />
schaften zwischen Schule und Unter-<br />
nehmen mit Hilfe unterschiedlicher<br />
Instrumente.<br />
Seit den 90er Jahren haben die Partner-<br />
schaften zwischen Schulen und Unter-<br />
nehmen an besonderer Bedeutung ge-<br />
wonnen. Da insbesondere Jugendliche mit<br />
Migrationshintergrund von diesen Partner-<br />
51
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
schaften profitieren, so Doris Wenzel-<br />
O’Connor, setzt sich die Hansestadt<br />
Hamburg im Rahmen des „Aktionsplans<br />
zur Bildungs- und Ausbildungsförderung<br />
junger Menschen mit Migrationshinter-<br />
grund“ für die Gründung weiterer guter<br />
Partnerschaften ein. Gerade mittlere und<br />
kleinere Unternehmen sind stärker einzu-<br />
binden, um die Integration weiter voranzu-<br />
treiben.<br />
Um dieses Ziel zu fördern, haben die Be-<br />
hörde für Schule und Berufsbildung, die<br />
<strong>BQM</strong>, die Handwerkskammer Hamburg,<br />
das Landesinstitut für Lehrerbildung und<br />
Schulentwicklung, die Senatskanzlei sowie<br />
die gegründete Landesarbeitsgemeinschaft<br />
SCHULEWIRTSCHAFT gemeinsam ein<br />
Handbuch mit dem Titel „Partnerschaften<br />
zwischen Schulen und Unternehmen“<br />
herausgegeben. Doris Wenzel-O’Connor<br />
erläuterte, dass das Handbuch den ver-<br />
schiedenen Akteuren aus Schule und<br />
Unternehmen, aber auch Schülerinnen und<br />
Schülern sowie Ihren Eltern Anregungen<br />
und viele praktische Tipps für eine nach-<br />
haltige Zusammenarbeit gibt und dazu<br />
ermuntern soll, derartige Partnerschaften<br />
einzugehen. Darüber hinaus wird im<br />
Handbuch beschrieben, wie Schulen als<br />
auch Unternehmen von einer ge-<br />
meinsamen Zusammenarbeit profitieren<br />
und es werden wichtige Informationen zur<br />
Planung und Umsetzung einer erfolg-<br />
reichen Kooperation aufgezeigt, wobei<br />
hier die „Beziehungspflege“ ein not-<br />
wendiger Bestandteil ist. Ebenso beinhaltet<br />
das Handbuch praktische Beispiele für<br />
Einsteiger, Fortgeschrittene und Profis und<br />
zeigt auf, wie facettenreich derartige<br />
Partnerschaften sein können. Dabei<br />
kommt es nicht auf das Engagement<br />
Einzelner an, sondern auf die Verankerung<br />
in den jeweiligen Institutionen.<br />
Doris Wenzel-O’Connor erwähnte noch<br />
einmal die Wichtigkeit der Themen<br />
Partnerschaften, Integration und Berufs-<br />
orientierung und dass die Stadtstaaten<br />
Bremen, Berlin und Hamburg vor ähn-<br />
lichen Herausforderungen stehen. Es muss<br />
stärker als bisher gelingen, die Potenziale<br />
Jugendlicher mit Migrationshintergrund<br />
besser zu erkennen und zu fördern, ihre<br />
Kompetenzen stärker zu nutzen und sie<br />
52
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
besser als bisher beruflich zu integrieren.<br />
Denn der Arbeitsmarkt ist der Schlüssel<br />
zur Integration.<br />
Best Practice –Beispiel I<br />
Norbert Giesen – Siemens AG, Be-<br />
reich Professional Education, Berlin<br />
Norbert Heinrich – Moses-<br />
Mendelssohn-Schule, Berlin<br />
Katrin Thierfeld – Netzwerk Berufs-<br />
praxis, Berlin<br />
Norbert Giesen, Norbert Heinrich und<br />
Katrin Thierfeld präsentierten im An-<br />
schluss Ihre gemeinsame Zusammenarbeit<br />
bestehend aus der Kooperation des<br />
Unternehmens Siemens, der Moses-<br />
Mendelssohn-Schule sowie dem Netzwerk<br />
Berufspraxis Berlin. Dabei betonte Herr<br />
Giesen von der Firma Siemens, dass die<br />
Basis einer guten Zusammenarbeit immer<br />
eine Win-Win Situationen von Seiten des<br />
Unternehmens als auch von Seiten der<br />
Schule sein sollte.<br />
Die Siemens AG stellt deutschlandweit<br />
etwa 250 benachteiligte Auszubildende<br />
ein, davon allein 40 Altbewerber als auch<br />
junge Menschen mit Migrationshintergrund<br />
in Berlin. Ein Teil dieser Plätze wird von<br />
Schülerinnen und Schülern der Moses-<br />
Mendelssohn-Schule besetzt und ein<br />
enormer Vorteil dieser Zusammenarbeit<br />
ist, dass man sich durch die Rücksprache<br />
mit den Lehrerinnen und Lehrer ein um-<br />
fangreiches und genaueres Bild über die<br />
Bewerber machen kann. Der dritte Ko-<br />
operationspartner, das Netzwerk Berufs-<br />
praxis Berlin, unterstützt zusätzlich in<br />
Form von vorheriger Berufsorientierung.<br />
So können sich die Schülerinnen und<br />
Schüler im Vorwege in praktischen<br />
Berufserprobungen in derzeit 27 ver-<br />
schiedenen handwerklichen Berufen aus-<br />
probieren. Das Netzwerk Berufspraxis<br />
Berlin kann als professionelle Einrichtung<br />
über Berufsmöglichkeiten informieren, das<br />
Kennenlernen verschiedener Ausbildungs-<br />
zentren ermöglichen und organisiert<br />
Feriencamps und Talentförderungs-<br />
programme. Durch die Teilnahme am<br />
Netzwerk Berufspraxis<br />
• erfahren die Schülerinnen und Schüler<br />
Interessantes über die Handwerks-<br />
berufe,<br />
• wissen die Schülerinnen und Schüler<br />
besser, wo ihre Stärken und<br />
Schwächen liegen,<br />
• erhalten die Schülerinnen und Schüler<br />
Selbständigkeit,<br />
53
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
• erlernen die Schülerinnen und Schüler<br />
den selbstsicheren Umgang mit<br />
fremden Menschen,<br />
• erlernen die Schülerinnen und Schüler,<br />
worauf es bei der Bewerbung an-<br />
kommt,<br />
• erkennen die Schülerinnen und<br />
Schüler, in welchen Fächern sie sich<br />
verbessern müssen,<br />
• wissen die die Schülerinnen und<br />
Schüler, wie wichtig das vorherige<br />
Informieren über Beruf ist.<br />
Die Aufteilung der praktischen Zu-<br />
sammenarbeit zwischen den Ko-<br />
operationspartner ist wie folgt:<br />
Netzwerk Berufspraxis Berlin<br />
• stellt Kontakte zu Lehrern her,<br />
• organisiert „handverlesene Schüler-<br />
gruppen“,<br />
• vermittelt den Schule Auswahl-<br />
kriterien,<br />
• Einbindung berufskundlicher Elemente<br />
•<br />
in die Schulentwicklung.<br />
Siemens Professional Education<br />
• Organisation von Infoveranstaltungen<br />
mit berufsgruppenorientierten Be-<br />
werbern,<br />
• informiert über regelmäßige Aus-<br />
bildungsaktivitäten,<br />
• führt Onlinebewerbungsverfahren mit<br />
den Schüler/-innen im Beisein der<br />
Lehrer durch,<br />
• führt Lehrerfortbildungen durch.<br />
Moses-Mendelssohn-Schule<br />
• bindet Siemens und Netzwerk Berufs-<br />
praxis in das Gesamtkonzept Berufs-<br />
orientierung ein,<br />
• Einrichtung einer AG „Schule-Beruf“,<br />
• entsendet „handverlesene“ Schüler-<br />
gruppen mit ihren Lehrern,<br />
• Projektdurchführungen und<br />
Präsentationserarbeitung,<br />
• stellt Lehrerinnen und Lehrer für<br />
Fortbildungen frei.<br />
Norbert Heinrich berichtete, dass ein<br />
regelmäßiger Informationsaustausch<br />
zwischen den Kooperationspartnern statt-<br />
findet und betonte, dass nie außer Acht<br />
gelassen werden soll, dass der Schüler<br />
bzw. die Schülerin im Vordergrund steht.<br />
Als Resultat dieser glücklichen Beziehung<br />
konnten nicht nur positive Praxis-<br />
erfahrungen und Übergänge in Ausbildung<br />
beobachtet werden, sondern auch die<br />
Verbesserung der Kompetenzen Team-<br />
54
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
fähigkeit, Präsentationsfähigkeit und<br />
Kommunikationsfähigkeit.<br />
Best-Practice-Beispiel II<br />
Gerd Menkens – Schulzentrum an der<br />
Koblenzer Straße, Bremen<br />
Frederike Steinhaus - Schulzentrum<br />
an der Koblenzer Straße, Bremen<br />
Ursula Brunhorn – DB Fahrzeug-<br />
instandhaltung GmbH, Werk Bremen<br />
Die zweite Partnerschaft zwischen Schule<br />
und Unternehmen, bestehend aus dem<br />
Schulzentrum an der Koblenzer Straße in<br />
Bremen und der DB Fahrzeuginstand-<br />
haltung GmbH Werk Bremen, wurde von<br />
Gerd Menkens, Frederike Steinhaus und<br />
Ursula Brunhorn vorgestellt. Das Schul-<br />
zentrum an der Koblenzer Straße befindet<br />
sich in einem multikulturellen Stadtteil, so<br />
dass die Schüler einen Migrationshinter-<br />
grund von insgesamt 80 Prozent auf-<br />
weisen. Gesellschaftliche und schulische<br />
Herausforderungen seien vor allem, so<br />
Herr Menkens, eine mangelnde<br />
Orientierung und fehlende gesellschaft-<br />
liche Vorbilder für die Jugendlichen, die zu<br />
starke Orientierung, auf eine weiter-<br />
führende Schule zu gehen, trotz<br />
mangelnder Kompetenzen vor allem in<br />
Deutsch und Mathematik der Jugendlichen<br />
sowie die geringe Akzeptanz von Aus-<br />
bildungsberufen im Bereich Produktion<br />
und Gewerbe.<br />
Um diesen Problemen entgegenzuwirken<br />
arbeitet das Schulzentrum an der<br />
Koblenzer Straße mit Führungskräften aus<br />
der Wirtschaft zusammen und gewinnt<br />
diese als Kooperationspartner. So wurde<br />
eine Schülerfirma gegründet, wo die<br />
Schülerinnen und Schüler in sechs Ab-<br />
teilungen Tätigkeiten des Arbeitslebens<br />
kennenlernen, eine Kooperation mit der<br />
Handelskammer hergestellt sowie die<br />
Gründung eines Beirates aus Mitgliedern<br />
von namhaften wie der DB Fahrzeug-<br />
instandhaltung GmbH. Auf Schülerebene<br />
ermöglichen die DB Fahrzeuginstand-<br />
haltung GmbH und das Schulzentrum<br />
folgende Projekte für eine gezielte<br />
Orientierung:<br />
• Projekt „Mobilität im Alltag“ – Jahr-<br />
gangsprojekt, bei dem die Schülerinnen<br />
und Schüler den Betrieb erkunden,<br />
• Bewerbungstrainingstage<br />
(Bewerbungsmappencheck, Simulation<br />
eines Assessment Centers, Erprobung<br />
von Bewerbungsgesprächen in der 9.<br />
Klasse),<br />
• Girls’Day,<br />
• Metallwerkstatt,<br />
55
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
• Praktikum,<br />
• Anit-Gewalt-Projekt (DB Azubis mit<br />
einer Schulklasse).<br />
Auf der Leitungsebene tauschen sich in<br />
regelmäßigen Treffen Lehrer und<br />
Personalverantwortliche kritisch über die<br />
Themen Veränderungen, Strukturen, Ge-<br />
meinsamkeiten (z. B. Mitarbeiter-<br />
motivation), critical friends aus und<br />
arbeiten ständig an der Intensivierung der<br />
guten Zusammenarbeit.<br />
Diskussion<br />
In der anschließenden Diskussion kamen<br />
vor allem Fragen auf, wie eine Ko-<br />
operationen genau zustande kommt – vor<br />
allem Partnerschaften zwischen Schulen<br />
und kleineren Betrieben. Für Schulen er-<br />
scheint es schwierig, Unternehmen zu<br />
gewinnen, da sie den Unternehmen nichts<br />
zurückgeben können. Daraufhin betonte<br />
Herr Giessen von Siemens noch einmal,<br />
dass der Schlüssel einer guten Zusammen-<br />
arbeit vor allem engagierte Lehrer sind,<br />
eine Vertrauensperson für das Unter-<br />
nehmen, die sich für die Kooperation ver-<br />
antwortlich fühlt, als Ansprechpartner zur<br />
Verfügung steht und beispielsweise E-Mails<br />
beantwortet. Darüber hinaus müssten<br />
große Unternehmen unterstützen und<br />
über ihre Kontakte die kleinen Betriebe in<br />
ihre Arbeit einbeziehen.<br />
Frau Eralp berichtete, dass <strong>BQM</strong> bereits<br />
erfolgreich große Unternehmen mit<br />
Schulen zusammengebracht hat, aber<br />
gerade kleinere Unternehmen Mittler be-<br />
nötigen. Zum einen kann hier das Hand-<br />
buch „Partnerschaften zwischen Schulen<br />
und Unternehmen“ helfen, aber auch die<br />
Kontaktaufnahme gegründete Landes-<br />
arbeitsgemeinschaft SCHULEWIRT-<br />
SCHAFT, die beratend allen Unternehmen<br />
zur Seite steht. So können sehr gute Ko-<br />
operationen auch in kleinen Schritten ent-<br />
stehen. Es gibt viele Möglichkeiten. Oft<br />
suchen Schulen nach großen Namen, aber<br />
auch kleinere Betriebe können gute<br />
Partner sein, so eine Podiumsteilnehmerin.<br />
In diesem Zusammenhang wurde ebenso<br />
darauf aufmerksam gemacht, dass ein<br />
wichtiger Kooperationspartner oft ver-<br />
nachlässigt würde: die Eltern. Sie müssen<br />
in die Berufsorientierung einbezogen<br />
werden, da sie einen starken Einfluss auf<br />
die Entwicklung und Berufsorientierung<br />
ihrer Kinder nehmen.<br />
Im Schlusswort fasste Dr. Lumpe zu-<br />
sammen, dass die Eltern unbedingt von<br />
beiden Kooperationspartnern eingebunden<br />
werden müssen. Sie müssen aufgeklärt<br />
56
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
werden, da sie oft nicht über das nötige<br />
Wissen verfügen. Darüber hinaus muss in<br />
einer guten Zusammenarbeit von Schule<br />
und Unternehmen Vertrauen bestehen<br />
und ein roter zielorientierter Faden er-<br />
kennbar sein.<br />
57
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
FORUM 2 Gesundheitsprojekte für Migranten/- RAUM: 151<br />
Gute Besserung und Alhamdulillah<br />
Interkulturelle Öffnung im Gesund-<br />
heitsbereich<br />
Moderation:<br />
Staatsrat Dr. Michael Voges – Behörde für<br />
Soziales, Familie, Gesundheit und Vebraucher-<br />
schutz<br />
Dr. Rita Panesar – KWB e. V. / <strong>BQM</strong><br />
Eine erfolgreiche Integration ist auch<br />
davon abhängig, ob Menschen mit<br />
Migrationshintergrund adäquate Zu-<br />
gangsmöglichkeiten zum deutschen<br />
Gesundheitssystem erhalten. Jugendliche,<br />
die über Mehrsprachigkeit, inter-<br />
kulturelle Kompetenzen und Einfühlungs-<br />
vermögen verfügen, können als Ärzte,<br />
Pfleger oder Gesundheitsmanager für die<br />
emotionalen Herausforderungen von<br />
Migration sensibilisieren, Diagnosen<br />
übersetzen, unterschiedliche Vor-<br />
stellungen von „Schweigepflicht“ er-<br />
klären, oder durch den oftmals nur<br />
schwer verständlichen Dschungel von<br />
Krankenkassen- und Abrechnungs-<br />
systemen führen. In dem Forum wurden<br />
erfolgreiche Ausbildungsmodelle und<br />
innen vorgestellt. Im Zentrum stand die<br />
Frage, welche Ansätze und Strukturen<br />
geeignet sind, um den Gesundheits-<br />
bereich interkulturell zu öffnen und<br />
interkulturelle Kompetenzen von Auszu-<br />
bildenden und Praktizierenden adäquat<br />
zu wertschätzen.<br />
V.l.n.r.: Dr. Rita Panesar, Dr. Michael Voges, Matthias<br />
Wetzlaff-Eggebert, Stéphanie Berrut<br />
Impulsreferat 1<br />
Dr. Rita Panesar – Referentin<br />
KWB e. V. / <strong>BQM</strong>, Hamburg<br />
Bei ihrem Engagement, die Chancen von<br />
Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu<br />
verbessern, ist die <strong>BQM</strong> in den ver-<br />
gangenen Jahren immer wieder auf den<br />
Gesundheitsbereich gestoßen. Frau Dr.<br />
Rita Panesar nannte in ihren einleitenden<br />
Worten die Gründe, dieser Thematik ein<br />
Forum zu widmen:<br />
58
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
1. Der Gesundheitsbereich bietet zahl-<br />
reiche Ausbildungsmöglichkeiten für<br />
Jugendliche mit Migrationshintergrund,<br />
2. der Erfolg von Auszubildenden hängt<br />
auch davon ab, wie gesund sie sind,<br />
wie sie sich in Gesundheitsversorgung<br />
und Familienplanungsfragen auskennen<br />
und<br />
3. der Gesundheitsbereich wird in den<br />
kommenden Jahren auf qualifizierte<br />
Fachkräfte angewiesen sein und muss<br />
dementsprechend Anstrengungen zur<br />
interkulturellen Öffnung unternehmen.<br />
Impulsreferat II<br />
Staatsrat Dr. Michael Voges – Be-<br />
hörde für Soziales, Familie, Gesundheit<br />
und Vebraucherschutz, Hamburg<br />
Herr Staatsrat Dr. Voges betonte in seiner<br />
Begrüßung, wie wichtig es sei, dass nicht<br />
gesunde Menschen mit Migrations-<br />
hintergrund in ihrer ohnehin hoch-<br />
sensiblen Situation von interkulturell<br />
sensiblem Personal betreut werden. Mehr-<br />
sprachigkeit und ein eigener Migrations-<br />
hintergrund seien dabei von Vorteil. Ein<br />
Fokus sollte deshalb auf der Ausbildung<br />
von Jugendlichen mit Migrationshinter-<br />
grund in diesem Bereich liegen.<br />
Expertenrunde<br />
Frau Dr. Christine Tuschinsky gab einen<br />
Überblick über Motivation, Strategien und<br />
Themenfelder der „interkulturellen<br />
Öffnung“ im Gesundheitsbereich. Sie<br />
nutzte dabei ihre langjährige Erfahrung aus<br />
interkulturellen Fortbildungen für Unter-<br />
nehmen sowie für das Fachpersonal des<br />
öffentlichen Dienstes, der Gesundheitsver-<br />
sorgung, der Kranken- und Altenpflege<br />
und der sozialen Arbeit in Hamburg.<br />
Zunächst definierte sie den Begriff „inter-<br />
kulturelle Öffnung“ als eine (sozialpolitisch<br />
begründete) Strategie in Organisationen,<br />
die Menschen aller kulturellen Hinter-<br />
gründe eine gleichberechtigte Teilhabe<br />
ermöglicht und damit integrativ wirkt.<br />
Durch entsprechende Personal-,<br />
Organisations- und Arbeitsstrukturen und<br />
Produkte schließt sie die Vielfalt innerhalb<br />
59
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
(Mitarbeiterschaft) und außerhalb<br />
(Klientel) der Organisation ein.<br />
Frau Dr. Tuschinsky beschrieb zunächst,<br />
was Organisationen im Gesundheits-<br />
bereich zur interkulturellen Öffnung<br />
motiviert:<br />
• Effektivere und angenehmere Arbeit in<br />
(interkulturellen) Teams,<br />
• Gewinnung von Fachkräften,<br />
• adäquate Kundenorientierung in einer<br />
von Migration geprägten Gesellschaft,<br />
• eine integrationspolitische Perspektive,<br />
• Gewinnung von ausländischen Kunden,<br />
• Entwicklung von speziellen, an kulturell<br />
vielfältigen Kundengruppen<br />
orientierten Produkten,<br />
• Bearbeitung kommunikativer Probleme<br />
mit der Klientel,<br />
• Kenntnis von interkulturellen<br />
Aspekten in der Gesundheitsver-<br />
sorgung,<br />
• Kenntnis von medizinethnologischen<br />
Aspekten.<br />
Daraufhin zeigte sie mögliche Strategien<br />
zur interkulturellen Öffnung auf:<br />
NI<br />
T<br />
E<br />
R<br />
Dr. Christine Tuschinsky<br />
K<br />
U<br />
L<br />
T<br />
U<br />
R<br />
E<br />
L<br />
L<br />
E<br />
O<br />
R<br />
NEI<br />
T<br />
I<br />
E<br />
R<br />
U<br />
N<br />
G<br />
U<br />
N<br />
D<br />
D<br />
VI<br />
E<br />
R<br />
S<br />
I<br />
T<br />
Y<br />
M<br />
A<br />
N<br />
A<br />
G<br />
E<br />
M<br />
NE<br />
T<br />
Mögliche Strategien interkultureller Öffnung<br />
– je nach Motivation und Zielen<br />
� Leitbilder in Gesundheitsämtern, Kliniken, Krankenkassen,<br />
Arztpraxen, Institutionen der Pflege, usw., die interkulturelle<br />
Öffnung strukturell verankern<br />
� Etablierung interkulturell orientierter Organisationsstrukturen<br />
� Einbezug und Förderung der personellen interkulturellen<br />
Ressourcen der medizinisch, therapeutisch, pflegerisch und<br />
verwaltend Tätigen<br />
� Einstellung von Menschen mit Migrationshintergrund auf<br />
allen beruflichen Ebenen<br />
� Anerkennung von im Ausland erworbenen beruflichen<br />
Qualifikationen bzw. gezielte Nachqualifizierung<br />
� Mehrsprachigkeit und Einsatz von DolmetscherInnen<br />
� Interkulturelle Fortbildungen aller MitarbeiterInnen<br />
� Regelhafter Einbezug interkultureller Themen in die<br />
Ausbildungen<br />
Frau Dr. Tuschinsky machte deutlich, dass<br />
die interkulturelle Öffnung des Gesund-<br />
heitsbereiches in großen Städten wie<br />
Hamburg besonders relevant sei: hier<br />
hätten aktuell 26 Prozent der Bevölkerung<br />
einen Migrationshintergrund haben und die<br />
Quote bei den Heranwachsenden im Alter<br />
zwischen 6 und 18 Jahren liege bei<br />
45 Prozent.<br />
Die nach wie vor existierenden kulturellen<br />
Unterschiede sind z. B. zu finden in einer<br />
Vielfalt (ethno-)medizinischer Traditionen,<br />
in unterschiedlichen Kommunikationsstilen<br />
und Sprachen sowie unterschiedlichem<br />
Krankheitsverhalte. Während es in einigen<br />
Kulturen etwa üblich sei, sich im Krank-<br />
heitsfall alleine zurückzuziehen, genössen<br />
es andere, im Kreise ihrer Familie Zeit zu<br />
verbringen. Dies könnte zu Konflikten<br />
etwa im Krankenhaus führen. Der Kultur-<br />
begriff sei jedoch nicht an Nationalitäten<br />
gekoppelt. Alleine in Deutschland gäbe es<br />
60
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
schon sehr unterschiedliche medizinische<br />
Kulturen:<br />
NI<br />
T<br />
E<br />
Dr. Christine Tuschinsky<br />
R<br />
K<br />
U<br />
L<br />
T<br />
U<br />
R<br />
E<br />
L<br />
L<br />
E<br />
O<br />
R<br />
NEI<br />
T<br />
I<br />
E<br />
R<br />
U<br />
N<br />
G<br />
U<br />
N<br />
D<br />
D<br />
VI<br />
E<br />
R<br />
S<br />
I<br />
T<br />
Y<br />
M<br />
A<br />
N<br />
A<br />
G<br />
ME<br />
NE<br />
T<br />
Blick auf die kulturell plurale medizinische<br />
Gesundheitsbereich in Deutschland<br />
Anthroposophie<br />
Homöopathie<br />
Allgemeine<br />
Gesundheitsversorgung<br />
�im sozialstaatlichen Auftrag<br />
�an eine medizinische Schule<br />
gebunden (Schul- /Biomedizin)<br />
�weitgehend an gesetzliche<br />
Krankenkassen gebunden<br />
„Importierte“<br />
medizinische<br />
Verfahren<br />
chines./ayurved.<br />
u.a.<br />
Naturheilkunde<br />
Frau Stéphanie Berrut, Diplom-<br />
Laiensektor<br />
+ als esoterisch<br />
ausgegrenzte<br />
Ansätze<br />
Psychologin und systemische Therapeutin,<br />
zeigte am Beispiel von pro familia Bonn<br />
wie migrationssensible Öffnung aussehen<br />
kann. Sie arbeitet dort als Partnerschafts-<br />
und Sexualberaterin sowie Leiterin des<br />
Angebots „Gesundheitsförderung für<br />
Migrant/-innen“.<br />
Pro familia e. V. ist eine Institution für<br />
Familienplanung, Sexualpädagogik und<br />
Sexualberatung, die sich seit 1952 in den<br />
Bereichen Sexualpädagogik, soziale Be-<br />
ratung, psychologische Begleitung junger<br />
Familien und Schwangerschafts-<br />
konfliktberatung tätig ist. Diese Angebote<br />
werden von Migrant/-innen wie folgt<br />
wahrgenommen:<br />
• Paar- und Sexualberatung: ¼<br />
• Psychosoziale Schwangerenberatung:<br />
⅓<br />
• Schwangerschaftskonfliktberatung: ¾<br />
• Begleitung durch Familienhebammen:<br />
½<br />
• Sexualpädagogik: fast ½<br />
• Kinderwunschberatung: ⅓<br />
Der Anteil der Migranten/-innen ist ge-<br />
messen am Gesamtanteil der Bonner Be-<br />
völkerung, von der ca. 30 Prozent einen<br />
Migrationshintergrund haben, vergleichs-<br />
weise hoch. Insbesondere die<br />
Problematiken der Vereinbarkeit von Aus-<br />
bildung, Beruf und Familie sowie die wahr-<br />
genommene Perspektivlosigkeit werden<br />
immer wieder von jugendlichen Migrant/-<br />
innen thematisiert. Ein spezielles Angebot<br />
von pro familia Bonn ist deshalb die<br />
„Gesundheitsförderung für MigrantInnen“.<br />
Allgemein, so machte Frau Berrut deutlich,<br />
können zwischen Beratungsangeboten und<br />
Zielgruppen sprachliche, kulturelle und<br />
andere mit der Migrationserfahrung ver-<br />
bundene Barrieren liegen z. B. Dis-<br />
kriminierung.<br />
Eine Analyse dieser Barrieren liefert An-<br />
satzpunkte für den Handlungsbedarf im<br />
Rahmen einer migrationssensiblen<br />
Öffnung. pro familia Bonn hat zahlreiche<br />
Ansatzpunkte zu der Frage gefunden, wie<br />
61
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Angebote so gestaltet werden können,<br />
dass sich alle Menschen in ihrer Diversität<br />
von ihnen angesprochen fühlen.<br />
Zunächst gilt es, aktiv auf Menschen mit<br />
Migrationshintergrund zuzugehen. Fremd-<br />
sprachige Beratung kann bei pro familia<br />
Bonn bereits in mehreren Sprachen an-<br />
geboten werden und auch der<br />
Dolmetscher-Pool der Stadt Bonn wird<br />
genutzt. Material und Hinweisschilder<br />
innerhalb der Räumlichkeiten sind mehr-<br />
sprachig und es wird darauf geachtet, dass<br />
die Beratungsstelle ansprechend und zum<br />
Wohlfühlen gestaltet ist.<br />
Sprachliche Barrieren<br />
• Zurechtfinden in den Räumlichkeiten<br />
Kulturelle und andere Barrieren<br />
• Einstellung von Menschen mit Migrationshintergrund<br />
• Fortbildungen<br />
- FGC Landesverband ‘08<br />
- Sexualpädagogik ‘06, ‘10<br />
• Schulung in interkultureller<br />
Kompetenz -<br />
Anmeldung ‘03<br />
- Gesamtteam ‘08<br />
► Top-Down-Prozess!<br />
Bei pro familia wird zudem in einem Top-<br />
Down-Prozess darauf geachtet, Menschen<br />
mit Migrationshintergrund einzustellen,<br />
und für das Personal Schulungen zum Er-<br />
lernen interkultureller Kompetenz durch-<br />
zuführen, die zu mehr Geduld, Toleranz<br />
und Haltungsänderungen führen.<br />
Im letzten Referat gab Herr Matthias<br />
Wetzlaff-Eggebert vom Ethno-<br />
Medizinischen Zentrum e. V. aus<br />
Hannover Einblick in das MiMi-Projekt,<br />
kurz für „Mit Migranten für Migranten“.<br />
Das Projekt ist ein Beitrag zur inter-<br />
kulturellen Gesundheitsförderung und zur<br />
interkulturellen Öffnung der<br />
Organisationen im Gesundheitswesen.<br />
Obwohl Migranten/-innen nicht häufiger<br />
krank sind als Deutsche, so gibt es doch<br />
migrationsspezifische Probleme (z. B.<br />
genetische Erkrankungen wie<br />
Sichelzellenanämie), bestimmte an-<br />
steckende Krankheiten wie Tuberkulose,<br />
wenn sie im Ursprungsland weit verbreitet<br />
waren) und Gesundheitsrisiken (z. B.<br />
Rauchen, Übergewicht).<br />
62
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Im Krankheitsfall kann es dann zu einer<br />
Unter- und Fehlversorgung aus folgenden<br />
Gründen kommen:<br />
• Sprachbarrieren,<br />
• kulturelle Hintergründe / Einstellungen,<br />
• Belastungsfaktoren in der Migration,<br />
• komplizierter Aufbau des deutschen<br />
Gesundheitswesens,<br />
• Angebote sind auf die Mehrheitsgesell-<br />
schaft ausgerichtet,<br />
• Misstrauen,<br />
An diesem Punkt setzt MiMi an.<br />
Dazu werden bereits erfolgreich<br />
integrierte und engagierte Migrant/-innen,<br />
die über sehr gute Deutschkenntnisse und<br />
ein hohes Bildungsniveau verfügen, zu<br />
interkulturellen Gesundheitslotsen aus-<br />
gebildet und führen dann selbstständig<br />
Informationsveranstaltungen durch, in dem<br />
sie ihre Landsleute in deren jeweiligen<br />
Lebensräumen aufsuchen und<br />
Informationen zu Gesundheitsförderung<br />
und Prävention kultursensibel und in der<br />
jeweiligen Muttersprache vermitteln.<br />
Die Erfolge sprechen für sich: MiMi wurde<br />
bereits mehrfach ausgezeichnet und ist<br />
heute an 51 Standorten in Deutschland,<br />
unter anderem auch in Hamburg, aktiv.<br />
Über 1.000 Mediator/-innen haben seit<br />
2004 in 2.500 (evaluierten) Informations-<br />
veranstaltungen mehr als 32.000 Migrant/-<br />
innen aus 132 Herkunftsländern erreicht.<br />
Und MiMi erreicht noch mehr: Durch die<br />
Zusammenarbeit von Migrant/-innen und<br />
Experten aus den Bereichen Gesundheit<br />
und Soziales zu den Themen Gesundheits-<br />
förderung und Integration werde der<br />
gegenseitige Austausch gefördert sowie<br />
Barrieren ab- und Netzwerke aufgebaut<br />
(lokal, landesweit, bundesweit). Zusätzlich<br />
wird dadurch die Chancengleichheit von<br />
63
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Migranten/-innen gefördert durch<br />
Empowerment zur Selbst- und Mit-<br />
bestimmung (gesellschaftliche Teilhabe,<br />
Einfluss in der Politik) und Prävention (Zu-<br />
gang zu Informationen und Diensten,<br />
Schutz gegen Diskriminierung).<br />
Diskussion<br />
Staatsrat Dr. Voges zeigte sich sehr an-<br />
getan von den bereits vorhandenen<br />
Projekten und dem Engagement in diesem<br />
Bereich, fragte sich jedoch, wie man<br />
herausfinden kann, ob die Zielgruppe in<br />
ausreichendem Maße erreicht wird. Herr<br />
Wetzlaff-Eggebert verwies dazu auf die<br />
Feedbackbögen aus den von den<br />
Mediator/-nnen durchgeführten Infover-<br />
anstaltungen, die zeigen, dass über<br />
80 Prozent der Teilnehmer/-innen die er-<br />
haltenen Informationen als für sich neu<br />
bewertet hatten. Frau Berrut verwies auf<br />
360 Frauen mit Migrationshintergrund, die<br />
pro Jahr von pro familia Bonn erfolgreich<br />
intensiv beraten werden konnten und den<br />
regen Austausch von 10 - 25 Frauen pro<br />
Veranstaltung, auch wenn diese Zahlen<br />
objektiv nur einen kleinen Anteil der Be-<br />
völkerung mit Migrationshintergrund aus-<br />
machen.<br />
Frau Robben von MiMi Hamburg hatte im<br />
Laufe des Projekts Erfolgsstrategien in der<br />
Erreichung der Zielgruppe ausgemacht. So<br />
werden gezielt Lebensräume der Migrant/-<br />
innen aufgesucht, um Informationen zu<br />
verbreiten z. B. auf Stadtteilfesten,<br />
Wochenmärkten oder beim Friseur.<br />
Wiederkehrende muttersprachliche Ge-<br />
sprächsgruppen zu Gesundheitsthemen<br />
haben sich dabei als geeignet und kosten-<br />
günstig erwiesen. Aber auch Themen wie<br />
„kultursensible Pflege“, Pflegegeld, Pflege-<br />
stufe etc. werden verstärkt nachgefragt.<br />
Frau Dr. Tuschinsky lobte ebenfalls die<br />
vielen bereits bestehenden erfolgreichen<br />
Projekte, machte in dem Zusammenhang<br />
jedoch nochmals aufmerksam auf den<br />
Unterschied zwischen einzelnen Projekten<br />
und der interkulturellen Öffnung von<br />
Regelinstitutionen, die sich als schwieriger<br />
und langwieriger herausstellt. Hinzu<br />
komme, dass jede Institution den Begriff<br />
der interkulturellen Öffnung für sich selbst<br />
64
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
definieren und den Weg zur Änderung der<br />
Haltung bestimmen müsste.<br />
Frau Dr. Panesar fragte, wie die inter-<br />
kulturelle Öffnung zu bewerkstelligen sei<br />
und ob man auf Widerstände stieße. Aus<br />
eigener Erfahrung erzählte Frau Berrut,<br />
dass bei der Frage, ob man eine/-n<br />
Migranten/-in einstellt, Reibung vor-<br />
programmiert sei. Diese führe im besten<br />
Fall zu einem organisationalen Lernen, im<br />
schlechtesten Fall zum Scheitern der<br />
interkulturellen Öffnung. In der Stadt<br />
Hamburg laufe dieser Prozess bisher recht<br />
erfolgreich, so eine Mitarbeiterin der<br />
Personalabteilung der Stadt Hamburg. Mit<br />
der Kampagne „Wir sind Hamburg! Bist<br />
Du dabei?“, strebe die Stadt die Erhöhung<br />
des Anteils Auszubildender mit<br />
Migrationshintergrund auf 20 Prozent bis<br />
2011 an.<br />
Staatsrat Dr. Voges fragte nach Hebeln,<br />
die es im Regelsystem gibt bzw. geben<br />
sollte, um die interkulturelle Öffnung in<br />
Krankenhäusern und Arztpraxen voran-<br />
treiben zu können. Eine Forumsteil-<br />
nehmerin wünschte für den Gesundheits-<br />
bereich einen von der Stadt finanzierten<br />
Dolmetscher-Pool, wie er in Groß-<br />
britannien üblich ist und wie er hierzu-<br />
lande bereits bei Gerichten und Behörden<br />
genutzt wird. Frau Wessel-Neb, Fachab-<br />
teilung Gesundheitsberichterstattung und<br />
Gesundheitsförderung in der Behörde für<br />
Soziales, Familie, Gesundheit und Ver-<br />
braucherschutz, Hamburg, merkte an, dass<br />
sich das Bewusstsein in diesem Bereich in<br />
Krankenhäusern sehr wohl bereits zum<br />
Positiven verändert hat. Vielerorts sei man<br />
bereits zu der Erkenntnis gekommen, dass<br />
eine gute Kommunikation zwischen Arzt<br />
und Patient mit Migrationshintergrund<br />
sehr wichtig sei und langfristig sogar zu<br />
Einsparungen führe, da Missverständnisse<br />
und somit mögliche Fehlbehandlungen<br />
vermieden würden. Einige Krankenhäuser,<br />
wie z. B. das Universitätskrankenhaus<br />
Eppendorf, arbeiten daher bereits mit<br />
Dolmetschern zusammen. Frau Berrut<br />
merkte an, dass es hervorragende Check-<br />
listen zur interkulturellen Öffnung im<br />
Gesundheitsbereich gäbe (s. Links).<br />
Als Antwort auf den demografischen<br />
Wandel und der damit anstehenden<br />
Pflegebedürftigkeit bei immer mehr<br />
Migranten/-innen nannten Forumsteil-<br />
nehmer/-innen z. B. das Krankenhaus<br />
Tabea, das eine Einrichtung für türkische<br />
Senior/-innen betreibe. Außerdem wurde<br />
die Planung einer interkulturellen Pflege-<br />
65
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
einrichtung im Rahmen der internationalen<br />
Bauausstellung www.iba-hamburg.de ge-<br />
nannt. In Billstedt gebe es ein Projekt, bei<br />
dem Jugendliche mit Migrations-<br />
hintergrund die Möglichkeit einer an-<br />
erkannten, begleiteten Ausbildung im Be-<br />
reich der Altenpflege, mit dem Schwer-<br />
punkt kultursensible Pflege, erhielten. Frau<br />
Berrut verwies auf den Newsletter von<br />
IKoM mit vielen nützlichen Infos:<br />
http://www.aktioncourage.org/IKoM<br />
Ebenso gebe es das Forum für<br />
kultursensible Altenhilfe:<br />
http://www.kultursensible-altenhilfe.de/<br />
In ihrem Schlusswort wünschte sich Frau<br />
Berrut mehr Lust auf Menschen mit<br />
anderem Hintergrund und die Nutzung<br />
von interkulturellen Fortbildungen, um<br />
Haltungen und Einstellungen zu ändern.<br />
Frau Dr. Tuschinsky wünschte sich für die<br />
Ausbildung im Pflegebereich, das inter-<br />
kulturelle Kompetenz nicht wie bisher nur<br />
freiwillig, sondern verpflichtend erlernt<br />
werden sollte. Menschen mit Migrations-<br />
hintergrund, so Herr Wetzlaff-Eggebert<br />
schließlich, haben nicht nur Probleme,<br />
sondern bringen die Lösung auch gleich<br />
mit.<br />
Staatsrat Dr. Voges würdigte abschließend,<br />
dass bereits viel auf den Weg gebracht<br />
worden sei, es aber auch noch viel zu tun<br />
gäbe, insbesondere in der Änderung der<br />
Regelsysteme und dass dabei die Frage der<br />
Finanzierung eine entscheidende sei. Die<br />
Ausbildung im Gesundheits- und Pflege-<br />
bereich sei ein wichtiger Schlüssel, bei<br />
dem interkulturelle Kompetenz und<br />
Kommunikation integriert werden sollte.<br />
Weiterführende Links<br />
Gesundheitsförderung für MigrantInnen (pro<br />
familia Bonn):<br />
http://www.profamilia.de/getpic/5291.pdf<br />
MiMi Hannover: www.ethno-medizinischeszentrum.de/<br />
MiMi Hamburg: http://www.mimi-hamburg.de/<br />
Pflege im Quartier! Hamburg-Billstedt:<br />
http://www.biwaq.de/nn_343982/DE/Projekte/Proj<br />
ekte/576__Jumbo.html<br />
Forum für eine kultursensible Altenhilfe:<br />
www.kultursensible-altenhilfe.de<br />
Informations- und Kontaktstelle für die Arbeit mit<br />
älteren Migratinnen und Migraten (IKOM):<br />
www.ikom-bund.de (Newsletter empfehlenswert)<br />
Checkliste: Interkulturelle soziale Arbeit:<br />
http://www.ida-nrw.de/projekte-interkulturellnrw/such_ja/12down_1/pdf/hinz_rom.pdf<br />
Migrationsgerechte Prävention und Gesundheitsförderung<br />
in der Schweiz:<br />
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik<br />
/07685/07695/index.html?lang=de<br />
66
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
FORUM 3<br />
Den Abschluss im Gepäck<br />
Zur Anerkennung im Ausland er-<br />
worbener Abschlüsse<br />
Moderation:<br />
Rainer Schulz – Hamburger Institut für<br />
Berufliche Bildung (HIBB), Hamburg<br />
Dr. Alexei Medvedev – KWB e. V. / <strong>BQM</strong><br />
Eine mangelnde Anerkennung im Ausland<br />
erworbener Abschlüsse stellt heute für<br />
Migrantinnen und Migranten die zentrale<br />
Hürde zur Integration da. Statt als<br />
Akademiker/-in arbeiten zu können oder<br />
bisher absolvierte Ausbildungs- und<br />
Studienjahre anerkannt zu bekommen,<br />
arbeiten viele von ihnen in niedrig quali-<br />
fizierten Berufen und können ihr mit-<br />
gebrachtes Potenzial als Fachkraft nicht<br />
entfalten. Auf der anderen Seite fehlen<br />
Unternehmen qualifizierte Mitarbeiter.<br />
Um deren Ressourcen nutzen zu können<br />
brauchen Arbeitgeber eine Einschätzung<br />
mitgebrachter Qualifikationen und<br />
Zeugnisse. Bundesweit wie auch in<br />
Hamburg gibt es daher zahlreiche<br />
Initiativen zur Anerkennung im Ausland<br />
erworbener Abschlüsse. Nach wie vor<br />
sind jedoch zahlreiche Fragen ungeklärt:<br />
Wie kann sichergestellt werden, dass alle<br />
Migrant/-innen Zugang zu Anerkennungs-<br />
verfahren bekommen? Wie können<br />
Kompetenzen festgestellt werden? Wie<br />
können Maßnahmen beruflicher Weiter-<br />
qualifizierung gestaltet werden? Das<br />
Forum bietet die Möglichkeit diese und<br />
andere Fragen mit ausgesuchten<br />
Expertinnen und Experten zu dis-<br />
kutieren.<br />
V.l.n.r.:<br />
Impulsvortrag I<br />
Katharina Koch, Bundesamt für<br />
Migration und Flüchtlinge (BAMF),<br />
Nürnberg<br />
Frau Koch berichtete als Referentin des<br />
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge<br />
in Nürnberg über den Stand der Arbeit<br />
des Bundesamtes zum Thema An-<br />
erkennung ausländischer Qualifikationen<br />
67
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
sowie Anpassungsqualifizierung. Zunächst<br />
zeigte sie aber auf, welche Faktoren die<br />
zentralen Barrieren für Migranten/-innen<br />
bei der Arbeitsmarktintegration darstellen:<br />
Dazu gehören zum einen eine erschwerte<br />
Informationssuche, die sich durch eine<br />
Vielzahl von verschiedenen, zu wenig mit-<br />
einander vernetzten Beratungsstellen als<br />
unübersichtlich darstellt und von Frau<br />
Koch als „Anerkennungsdschungel“ be-<br />
zeichnet wurde. Zudem kritisierte sie die<br />
mangelnde Transparenz der An-<br />
erkennungsverfahren. So sei für die<br />
Migranten/-innen kaum zu recherchieren,<br />
welche Unterlagen einzureichen seien,<br />
welche Kriterien bei der Entscheidungs-<br />
findung gelten bzw. wie die Erfolgsaus-<br />
sichten der Antragsteller/innen aussehen.<br />
Dies könne zu einer Verzögerung im<br />
Prozess führen, da häufig fehlende<br />
Dokumente nachgereicht werden<br />
müssten. Als dritten Faktor führte Frau<br />
Koch auf, dass für unreglementierte Be-<br />
rufe wie beispielsweise Künstler/-in oder<br />
Unternehmensberater/-in Bewertungs-<br />
grundlagen fehlten, was häufig automatisch<br />
zu einer Ablehnung im Rekrutierungs-<br />
prozess führe. Schließlich seien die ver-<br />
schiedenen Angebote noch immer zu<br />
wenig miteinander verzahnt, wie z. B. das<br />
eigentliche Anerkennungsverfahren mit<br />
einer ggf. erforderlichen Anpassungsquali-<br />
fizierung. An deutschen Universitäten sei<br />
der individuelle Qualifizierungsbedarf für<br />
die Aufnahme eines Studiums meist Ver-<br />
handlungssache und nicht einheitlich ge-<br />
regelt.<br />
Anschließend stellte Frau Koch die<br />
Initiativen des Bundesamtes, der Bundes-<br />
regierung sowie der Bundesländer zum<br />
Thema Anerkennung ausländischer Quali-<br />
fizierungen vor, wie beispielsweise das<br />
Eckpunktepapier der Bundesregierung<br />
vom 9. Dezember 2009. Als bereits<br />
konkret festgelegte Ziele des Eckpunkte-<br />
papiers nannte Frau Koch die folgenden<br />
Punkte:<br />
1) Anspruch aller Migranten/-innen un-<br />
geachtet ihrer Herkunft auf ein An-<br />
erkennungsverfahren,<br />
2) Entwicklung von Bewertungsverfahren<br />
auch für unreglementierte Berufe,<br />
3) Ausweitung von Kompetenzfest-<br />
stellungsverfahren,<br />
4) bundesweite Vereinheitlichung der<br />
angewandten Kriterien,<br />
5) Begrenzung der Verfahrensdauer auf<br />
maximal 6 Monate,<br />
6) Aufbau einer Datenbank der betrieb-<br />
lichen Bildung.<br />
68
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Daneben gibt es eine Reihe von Zielen, die<br />
bezüglich ihrer Umsetzung noch nicht<br />
konkretisiert worden sind. Dazu zählt,<br />
dass Migranten/-innen auch schon aus dem<br />
Ausland Informationen über das An-<br />
erkennungsverfahren gewinnen können,<br />
Erstanlaufstellen zur Beratung von Zu-<br />
wanderern/-innen eingerichtet werden<br />
sowie das Angebot zur Anpassungs- und<br />
Weiterqualifizierung ausgeweitet wird.<br />
Außerdem sei eine statistische Daten-<br />
erfassung in gebündelter Form anzu-<br />
streben.<br />
Frau Koch ging dann auf die aktuellen<br />
untergesetzlichen Aktivitäten des Bundes-<br />
amtes ein. So laufen derzeit zwei Modell-<br />
projekte in München und im Saarland, wo<br />
Servicestellen zur Beratung von<br />
Migranten/-innen sowie zum Schnitt-<br />
stellenmanagement zwischen den ver-<br />
schiedenen Stellen eingerichtet wurden.<br />
Ein weiteres Modellprojekt in Regensburg<br />
zur einheitlichen universitären Einstufung<br />
von Anpassungsqualifizierungen wird<br />
voraussichtlich in ein bis zwei Jahren ab-<br />
geschlossen sein. Außerdem wird zurzeit<br />
ein Konzept zur Kompetenzfeststellung<br />
entwickelt, dessen Veröffentlichung noch<br />
für den Sommer <strong>2010</strong> geplant sei.<br />
Impulsvortrag II<br />
Farzaneh Vagdy-Voß, Agentur zur<br />
Förderung der Bildungs- und Berufs-<br />
zugänge für Flüchtlinge und<br />
Migranten/-innen in Schleswig-Holstein<br />
(access), Kiel<br />
Frau Vagdy-Voß referierte als Leiterin des<br />
Projekts access des Flüchtlingsrates<br />
Schleswig-Holstein über Heraus-<br />
forderungen bei der Anerkennung von<br />
ausländischen Abschlüssen aus Sicht der<br />
betroffenen Migranten/-innen und sprach<br />
Empfehlungen zur Verbesserung der<br />
Situation aus.<br />
Auch sie betonte, dass die Informations-<br />
lage über Zuständigkeiten und Kriterien<br />
einer Anerkennung zu unübersichtlich und<br />
wenig transparent seien. Nicht nur<br />
Migranten/-innen seien hiervon mitunter<br />
überfordert, sondern auch manche Be-<br />
rater/-innen hätten keinen Überblick<br />
mehr. Zudem würden Migranten/-innen je<br />
69
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
nach Herkunftsland unterschiedlich be-<br />
handelt, was häufig als wenig gerecht<br />
empfunden wird. Die Schwierigkeiten<br />
vieler Migranten/-innen entstehen ihr zu-<br />
folge auch nicht erst im Zuge der An-<br />
erkennung von beruflichen<br />
Qualifikationen, sondern bereits bei der<br />
Anerkennung schulischer Abschlüsse.<br />
Bei der Zusammenfassung der gesetzlichen<br />
Grundlagen bezog sich Frau Vagdy-Voss<br />
auf das Bundesvertriebenengesetz, die EU-<br />
Richtlinie 2005/36/EG, die Lissaboner An-<br />
erkennungskonvention für Hochschul-<br />
abschlüsse sowie das bereits von Frau<br />
Koch erwähnte Eckpunktepapier des<br />
Bundeskabinetts vom Dezember 2009.<br />
Die Referentin sprach eine Reihe von<br />
Empfehlungen aus, die die allgemeine Lage<br />
der Migranten/-innen in Bezug auf die An-<br />
erkennung von ausländischen<br />
Qualifikationen verbessern könnte. So<br />
forderte sie einen Rechtsanspruch aller<br />
Migranten/-innen nicht nur auf ein An-<br />
erkennungsverfahren, sondern auch auf<br />
eine Anpassungs- bzw. Nachqualifizierung.<br />
Zudem schlug Frau Vagdy-Voss vor, zu-<br />
sätzlich zu den bislang bestehenden An-<br />
erkennungsinstrumenten informelle Gut-<br />
achten bzw. Einstufungen für alle<br />
Migrantengruppen einzusetzen. Auch<br />
müssten die Berater gezielter im Hinblick<br />
auf ihre Aufgabe geschult werden, um das<br />
Beratungsangebot zu verbessern, was auch<br />
durch das vermehrte Einbeziehen von<br />
Arbeitgebern gelingen könnte. Zudem sei<br />
es sehr wichtig, die Beratung auch in ver-<br />
schiedenen Sprachen anzubieten. All diese<br />
Maßnahmen erforderten selbstverständlich<br />
ein höheres Ausmaß an personeller und<br />
finanzieller Ausstattung. Frau Vagdy-Voss<br />
hob abschließend noch einmal hervor, dass<br />
trotz des neuen Gesetzes die Situation in<br />
Deutschland noch nicht vollkommen zu-<br />
friedenstellend sei, da das Recht auf ein<br />
Anerkennungsverfahren noch lange kein<br />
Recht auf Anerkennung bedeutet.<br />
Impulsvortrag III<br />
Wolfgang Völker, Diakonie Hamburg,<br />
Fachbereich Migration und Existenz-<br />
sicherung<br />
Anschließend sprach auch Wolfgang<br />
Völker von der Diakonie Hamburg einige<br />
Empfehlungen und Zielsetzungen aus, was<br />
aus seiner Sicht bezüglich der An-<br />
erkennung von ausländischen<br />
Qualifikationen getan werden sollte. Für<br />
Herrn Völker sollte das hauptsächliche<br />
Motiv für ein verbessertes Anpassungsver-<br />
fahren nicht primär im Fachkräftemangel<br />
70
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
begründet liegen, denn für ihn ist dies eher<br />
unter dem Aspekt der Gleichbehandlung<br />
aller Menschen zu betrachten.<br />
Auch für ihn sei von großer Bedeutung,<br />
dass für jede/-n Migrant/-in rechtliche<br />
Klarheit über den Anspruch auf ein An-<br />
erkennungsverfahren besteht und alle Zu-<br />
wanderer/-innen eine gleiche Chance auf<br />
Anerkennung bekommen. Dies würde<br />
auch viele Verwaltungsverfahren er-<br />
leichtern. Herausfordernd sei an dieser<br />
Stelle das föderale System in Deutschland,<br />
das ein einheitliches Verfahren erschwere.<br />
Auch wies er noch einmal auf die Be-<br />
deutung von Weiterbildungsmöglichkeiten<br />
hin, die in verschiedenen Formen wie etwa<br />
durch Praktika, „Training on the job“ oder<br />
als Vorbereitung auf externe Prüfungen<br />
denkbar sind. Dazu sei eine Analyse über<br />
Ausmaß und Art des Bedarfs an Quali-<br />
fizierungsmaßnahmen erforderlich. Fraglich<br />
bleibt, laut Herrn Völker, an dieser Stelle<br />
jedoch die Art der Finanzierung eines<br />
solchen Angebotes, insbesondere in<br />
Zeiten von Sparprogrammen der Bundes-<br />
regierung auch im arbeitspolitischen Be-<br />
reich. Auch Kompetenzfeststellungsver-<br />
fahren sollten in einheitlicher Form<br />
implementiert werden. Dabei gibt es zwei<br />
mögliche Arten von Kompetenzfest-<br />
stellungsverfahren: Zum einen kann eine<br />
Prüfung anhand von berufsfachlichen<br />
Kenntnissen erfolgen. Zum anderen ist es<br />
aber auch möglich, vorhandene<br />
Kompetenzen durch praktische Arbeit<br />
gegenüber einer zertifizierten, über-<br />
geordneten Stelle nachzuweisen. Hierbei<br />
sei es sehr wichtig, dass die Antragsteller/-<br />
innen gut auf das Verfahren und dessen<br />
Verlauf vorbereitet werden. Neben der<br />
Umsetzung des Anerkennungsverfahrens<br />
sei es von großer Bedeutung, dass dieses<br />
kontrolliert wird und wichtige Kennzahlen<br />
in regelmäßigen Abständen ausgewertet<br />
werden.<br />
Herr Völker wies darauf hin, dass ab<br />
Herbst <strong>2010</strong> unter der Trägerschaft der<br />
Diakonie eine zentrale, durch den ESF<br />
geförderte Anlaufstelle zur Anerkennung<br />
von ausländischen Qualifikationen ein-<br />
gerichtet werden soll.<br />
Eine Workshopteilnehmerin brachte<br />
daraufhin die Frage auf, was eine Anlauf-<br />
stelle leisten könnte, ohne dass ein ver-<br />
71
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
bindliches Gesetz beschlossen sei. Frau<br />
Koch betonte in diesem Zusammenhang,<br />
dass betroffene Personen, ihrer Meinung<br />
nach, nicht auf einen solchen Gesetz-<br />
beschluss warten, sondern schon jetzt<br />
aktiv nach Lösungswegen für ihre eigene<br />
Situation suchen sollten. Das Gesetz<br />
würde nicht für alle Antragsteller/-innen<br />
eine zwangsläufige Verbesserung mit sich<br />
bringen, möglicherweise könnten die Be-<br />
scheide zukünftig sogar häufiger negativ<br />
ausfallen.<br />
Diskussion<br />
Im Anschluss an die Vorträge der<br />
Experten/-innen wurden im Rahmen der<br />
Diskussion die Fragen thematisiert, welche<br />
Erfahrungen die Teilnehmer/-innen bislang<br />
in ihrem Umfeld mit Anerkennungs-<br />
verfahren gemacht haben, ob ein Ansturm<br />
auf das Anerkennungsverfahren erwartet<br />
wird und wie ein Erwartungsmanagement<br />
aussehen könnte.<br />
Frau Koch erwartet eine relativ große<br />
Nachfrage nach Anerkennungsverfahren,<br />
dies würde schon der hohe Bedarf an Be-<br />
ratung zur Thematik zeigen. Sie glaubt<br />
jedoch, dass der überwiegende Teil der<br />
Antragstellenden Akademiker/-innen sein<br />
würden.<br />
Eine Mitarbeiterin der Bundesagentur für<br />
Arbeit hält die Einrichtung von Beratungs-<br />
stellen für sinnvoll, da sie einen hohen<br />
Bedarf an Information zur Thematik er-<br />
fahren habe. Ein türkischer Lehrer merkte<br />
an, dass seiner Meinung nach bei den<br />
Lehrern/-innen nicht nur die Anerkennung<br />
von Abschlüssen thematisiert werden<br />
sollte, sondern auch die unterschiedliche<br />
Besoldung zwischen deutschen und aus-<br />
ländischen Lehrkräften angeglichen<br />
werden sollte. Dies sei in anderen Bundes-<br />
ländern bereits teilweise erfolgt. Auch<br />
Frau Vagdy-Voss unterstrich die Not-<br />
wendigkeit von einheitlichen Regelungen in<br />
diesem Punkt.<br />
Dr. Thomas Liebig (OECD) relativierte die<br />
Erwartungen, die Migranten/-innen an ein<br />
Verfahren haben könnten. So führte er<br />
eine Studie an, laut der mit vielen aus-<br />
ländischen Abschlüssen tatsächlich<br />
geringere Kompetenzen verbunden seien.<br />
Zudem vermutete er keinen großen An-<br />
sturm auf Anerkennungsverfahren.<br />
Dieser Position schloss sich auch Frau<br />
Vagdy-Voss an. So sei aus ihrer Sicht kein<br />
sehr großer Ansturm auf das An-<br />
erkennungsverfahren zu erwarten, da eine<br />
Anerkennung auch vom hiesigen Arbeits-<br />
markt abhängig sei. Viele Berufs-<br />
qualifikationen aus dem Ausland seien in<br />
72
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Deutschland nicht einsetzbar. Dazu<br />
komme, dass der Zeitraum zwischen<br />
einem möglichen Antrag und dem Ab-<br />
schluss bei bestimmten Bevölkerungs-<br />
gruppen wie etwa Flüchtlingen, teilweise<br />
sehr lang sein würde.<br />
Eine Teilnehmerin merkte an, dass für<br />
viele Migranten ein häufiges Problem die<br />
mangelnde Beherrschung der Berufsfach-<br />
sprache darstelle. In den Jobcentern<br />
würden die Migranten zu wenig in Bezug<br />
darauf vorbereitet werden. Auf diese<br />
Weise ginge oftmals zu viel wertvolle Zeit<br />
und damit Fachwissen verloren.<br />
Ein weiterer Diskussionspunkt war die<br />
noch nicht immer zufriedenstellende Ko-<br />
operation mit den Kammern bzw. der<br />
Wirtschaft. Es wurde herausgestellt, dass<br />
diese noch verbessert werden müsste und<br />
Kammern häufig zu sehr an ihren<br />
Standards festhielten. Eine Workshopteil-<br />
nehmerin regte hierbei an, man müsse<br />
auch vermehrt Teilqualifikationen an-<br />
erkennen.<br />
Eine Mitarbeiterin der Bundesagentur für<br />
Arbeit berichtete aus ihrer eigenen Er-<br />
fahrung, dass für viele Arbeitgeber bei der<br />
Personalrekrutierung nicht der Abschluss<br />
der Bewerber/-innen, sondern deren<br />
Persönlichkeit sowie die Deutschkennt-<br />
nisse ausschlaggebend seien. Dies wurde<br />
von Dr. Alexei Medvedev aus seiner beruf-<br />
lichen Erfahrung bestätigt.<br />
Die Moderatoren bedankten sich und ver-<br />
abschiedeten die Teilnehmer/-innen des<br />
Forums.<br />
73
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
FORUM 4<br />
Wissen wie es weitergeht -<br />
Interkulturell sensible Beratung in<br />
Schule, Berufsorientierung und<br />
Arbeitsvermittlung<br />
Moderation:<br />
Peter Daschner – Direktor des Landes-<br />
instituts für Lehrerbildung und Schulent-<br />
wicklung<br />
Elisabeth Wazinski – KWB e. V. / <strong>BQM</strong><br />
Um Schülerinnen und Schüler adäquat<br />
auf das Berufsleben vorzubereiten, wird<br />
derzeit bereits ab Klasse 7 mit der<br />
Berufsorientierung begonnen. Kontakte<br />
zu Unternehmen, Praxistage und<br />
Projekte ermöglichen Schülern, in ver-<br />
schiedene Bereiche hinein zu<br />
schnuppern. Viele Jugendliche nehmen<br />
auch nach der Schule Angebote der<br />
beruflichen Orientierung in Anspruch.<br />
Eine ganz wesentliche Aufgabe kommt<br />
dabei den Beratern/-innen zu – sei es in<br />
Schule, in Ausbildungsagenturen oder bei<br />
Trägern. Gefragt sind Menschen, die<br />
Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft<br />
Mut machen und Unterstützung bieten,<br />
sich selbst und ihre besonderen<br />
Potenziale zu entdecken. Pädagogen/-<br />
innen innerhalb und außerhalb der Schule<br />
sind heute Moderator/-innen, die<br />
Gruppen anregen und in Austausch<br />
bringen, Räume für Forschungen und<br />
Expeditionen zur Verfügung stellen und<br />
motivieren, lernbereit und kreativ auf<br />
Menschen mit anderen Vorstellungen<br />
von „Normalität“ zuzugehen. Im Forum<br />
wird danach gefragt, wie Akteure am<br />
Übergang Schule - Beruf ausgebildet sein<br />
müssen, um schülerzentriert und inter-<br />
kulturell sensibel beraten und begleiten<br />
zu können.<br />
V. l. n. r.: Elisabeth Wazinski, Peter Daschner, Rolf Steil, Rolf<br />
Deutschmann, Javier Carnicer, Hatice Akkermann<br />
Impulsvortrag I<br />
Javier Carnicer – Universität Hamburg<br />
In seinem Vortrag thematisierte Javier<br />
Carnicer die Bildungskarrieren und die<br />
adoleszenten Ablösungsprozesse von<br />
jungen Menschen mit Migrationshinter-<br />
grund mit dem Ziel, Denkanstöße für eine<br />
interkulturell sensible Beratung zu liefern.<br />
74
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Er berief sich in seinen Ausführungen auf<br />
sein Forschungsprojekt, das auf den Er-<br />
gebnissen biografischer Interviews von<br />
jungen Männern mit türkischem<br />
Migrationshintergrund und deren Eltern<br />
basiert.<br />
Zunächst erläuterte er die Chancen,<br />
Herausforderungen und Erwartungen, die<br />
in unserer Gesellschaft mit der<br />
Adoleszenz verbunden sind. Aufgrund der<br />
Kultur, aber vor allem auch aufgrund<br />
sozialer und ökonomischer Bedingungen,<br />
sind die Möglichkeiten adoleszenter<br />
Bildungsprozesse unterschiedlich, so<br />
Carnicer. Besonders junge Männer<br />
niedriger Bildungsschichten und gerade<br />
solche mit Migrationshintergrund ver-<br />
lassen häufig die Schule bereits im Alter<br />
von 16 Jahren, um eine Ausbildung zu<br />
beginnen. Somit haben sie eine kürzere<br />
Adoleszenz als Jugendliche, die bis zu<br />
einem höheren Alter in der Schule ver-<br />
bleiben.<br />
Gerade Eltern von Jugendlichen mit<br />
Migrationshintergrund haben allerdings<br />
häufig hohe Erwartungen an die Schullauf-<br />
bahn ihrer Kinder, zeigen die Unter-<br />
suchungen Carnicers, und projizieren die<br />
Erwartungen und Wünsche, die sie mit<br />
ihrer Migration verbinden auf ihre Kinder.<br />
Sie möchten, dass ihre Kinder durch eine<br />
erfolgreiche Bildungskarriere ihre erlebten<br />
negativen Erfahrungen und Enttäuschungen<br />
kompensieren und somit die Migration zu<br />
einem erfolgreichen Abschluss führen.<br />
Zum Abschluss seines Vortrags machte<br />
Carnicer noch einmal deutlich, wie eng die<br />
Adoleszenz und die schulischen und beruf-<br />
lichen Wege junger Menschen mit<br />
Migrationshintergrund von den Er-<br />
wartungen und der Migrationsgeschichte<br />
der Eltern beeinflusst werden, weshalb die<br />
Jugendlichen nicht nur ihren eigenen Weg<br />
finden müssen. So plädierte er dafür,<br />
dieses Wissen in eine interkulturell<br />
sensible Beratung einzubeziehen. Das be-<br />
deutet konkret, sich nicht nur auf die<br />
Berufswahl und –vermittlung zu be-<br />
schränken, sondern auch die durch die<br />
Migration bedingte soziale und öko-<br />
nomische Situation zu berücksichtigen.<br />
Außerdem hält er eine frühe Intervention<br />
und die Einbindung der Familie in den Be-<br />
ratungsprozess für sinnvoll.<br />
Impulsvortrag II<br />
Hatice Akkerman – AIZAN, Hamburg<br />
Im Anschlussreferat berichtete Hatice<br />
Akkerman aus ihrer praktischen Erfahrung<br />
als Übergangsmanagerin bei AIZAN an<br />
75
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
einer beruflichen Schule. Sie arbeitet mit<br />
benachteiligten Jugendlichen zusammen<br />
von denen ca. 60 Prozent einen<br />
Migrationshintergrund haben.<br />
Nachdem sie ihren Vortrag mit einem<br />
Negativbeispiel in Bezug auf Sonder-<br />
behandlung von jungen Menschen mit<br />
Migrationshintergrund begann, leitete sie<br />
daraus ab, dass interkulturelle Arbeit nicht<br />
nur einen bestimmten Personenkreis in<br />
der Gesellschaft als Zielgruppe hat.<br />
Vielmehr gälten interkulturellen Ansätze<br />
der gesamten Gesellschaft, da alle Unter-<br />
schiede relevant sind (Geschlecht, Milieu,<br />
Bildung).<br />
Aus diesem Grund formulierte sie die<br />
Handlungsmaxime ihrer Arbeit wie folgt:<br />
Die Kompetenzen von Jugendlichen mit<br />
und ohne Migrationshintergrund sollten<br />
gleich erfasst werden. Dazu hat Hatice<br />
Akkerman ein Interview entwickelt, in<br />
dem sie den Jugendlichen zwar „kultur-<br />
spezifische“ Fragen stellt, dabei aber<br />
keinen Unterschied macht zwischen<br />
Jugendlichen mit und ohne Migrations-<br />
hintergrund. So sei beispielsweise auch die<br />
Frage, ob die Jugendlichen ihre Eltern zu<br />
Behördengängen begleiten, nicht nur für<br />
junge Menschen mit Migrationshintergrund<br />
relevant, denn es ginge vielmehr darum,<br />
das Individuum in den Blick zu nehmen<br />
und die Jugendlichen nicht auf ihren<br />
kulturellen Hintergrund zu reduzieren.<br />
Laut Akkerman sollten die Berater und die<br />
Ratsuchenden ein Team bilden mit dem<br />
Ziel, gemeinsam ein Problem zu lösen.<br />
So warnte sie weiterhin vor kulturspezi-<br />
fischem Wissen und Zuweisungen:<br />
dadurch würde eine Bestätigung oder<br />
sogar Verstärkung von Vorurteilen ent-<br />
stehen wie zum Beispiel die Annahme:<br />
„Die Türken verstehen die Türken.“ Ak-<br />
kerman formulierte ihre Devise, ein<br />
offenes Angebot für alle zu schaffen, da<br />
jeder einzelne Fall ein Recht darauf hat,<br />
Einzelfall sein zu können.<br />
Impulsvortrag III<br />
Rolf Deutschmann – Behörde für<br />
Schule und Berufsbildung, Hamburg<br />
Rolf Deutschmann schilderte in seinem<br />
Beitrag das Konzept für die Schulreform<br />
und die damit einhergehenden Ver-<br />
änderungen. Als zentrales Anliegen, auf<br />
76
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
der die Schulreform basiert, nannte er die<br />
Förderung aller Talente. So sind die<br />
Hauptziele der Schulreform längeres ge-<br />
meinsames Lernen, ein gerechteres Schul-<br />
system, eine Erhöhung der Bildungs-<br />
beteiligung, die Hebung des Bildungs-<br />
niveaus sowie Ausbildungs- und Studien-<br />
reife für alle Schulabgänger.<br />
Anschließend erläuterte er die vier Säulen<br />
der neuen Schulreform, die zu mehr<br />
Bildungsgerechtigkeit beitragen sollen. Die<br />
erste Säule besagt, dass die Schulstruktur<br />
verändert wird, so dass es ab dem Schul-<br />
jahr <strong>2010</strong>/11 eine sechsjährige Primar-<br />
schule statt einer vierjährigen Grundschule<br />
für alle Schüler geben soll. So werde das<br />
längere gemeinsame Lernen gefördert und<br />
gerade Kinder mit Migrationshintergrund<br />
profitierten von dieser Neuerung. Des<br />
Weiteren sieht das Konzept neue Unter-<br />
richtsskripte vor, die zur Förderung des<br />
individualisierten Lernens Beitragen sollen.<br />
An den Lehrerfortbildungen soll sich<br />
sowohl in qualitativer als auch in<br />
quantitativer Hinsicht etwas ändern. Nicht<br />
zuletzt werden die Rahmenbedingungen<br />
verbessert, was mit kleineren Klassen,<br />
mehr Ganztagsschulen sowie Beratungs-<br />
und Unterstützungsstrukturen einhergeht.<br />
Ziel seien außerdem mehr Kooperationen<br />
mit außerschulischen Einrichtungen und<br />
eine Vernetzung der Schulen unter-<br />
einander, was, laut Daschner, eine hoch-<br />
präventive Wirkung erziele.<br />
Als fünfte Säule der neuen Schulreform<br />
nannte er die Reform des Übergangs-<br />
systems Schule-Beruf. Eine individuelle<br />
Beratung sowie eine nachhaltige Berufs-<br />
und Studienorientierung an allen weiter-<br />
führenden Hamburger Schulen sollen<br />
direkte Übergänge und Anschlüsse in ein<br />
Studium oder eine duale Ausbildung für<br />
Schulabgänger garantieren. In diesem Zu-<br />
sammenhang sprach Daschner von einer<br />
interkulturell sensiblen Berufs- und<br />
Studienorientierung, die nicht nur für<br />
Jugendliche mit Migrationshintergrund zur<br />
Verfügung stehen soll. Weiterhin soll das<br />
Lernen an außerschulischen Lernorten<br />
integriert werden, Kooperationen mit<br />
berufsbildenden Schulen und Betrieben<br />
werden im Unterrichtskonzept integriert.<br />
Die Schulreform verbindet sich so mit der<br />
Reform des Übergangsmanagements<br />
Schule – Beruf.<br />
77
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Impulsvortrag IV<br />
Rolf Steil – Agentur für Arbeit,<br />
Hamburg<br />
In seinem Eingangsstatement thematisierte<br />
Rolf Steil die interkulturelle Ausrichtung<br />
der Agentur für Arbeit und die damit ein-<br />
hergehenden Maßnahmen und Heraus-<br />
forderungen. Der Vortrag begann mit der<br />
provokativen These, wie und ob inter-<br />
kulturell sensible Beratung mit der<br />
Agentur für Arbeit zusammen passten. In<br />
den folgenden Ausführungen erklärte er,<br />
weshalb das der Fall sei und stellte das<br />
Leitbild der Agentur für Arbeit vor: Erfolg<br />
durch Vielfalt.<br />
Im Anschluss erläuterte er die Umsetzung<br />
des Konzeptes, das unter anderem auch<br />
auf kultureller Vielfalt bei den Be-<br />
schäftigten der Agentur für Arbeit basiert.<br />
Außerdem wird die interkulturelle<br />
Öffnung der Arbeitsagentur als Leitungs-<br />
aufgabe angesehen und wahrgenommen.<br />
Die interkulturelle Kompetenz bei<br />
Arbeitsberatern und –vermittlern spielt<br />
dabei eine besonders wichtige Rolle, so<br />
Steil. Folgende Punkte fasste er als be-<br />
achtenswert zusammen:<br />
1. Im Umgang mit den Kunden sind<br />
personelle Kompetenzen wie bei-<br />
spielsweise kultursensible Empathie<br />
und Vorurteilsfreiheit von zentraler<br />
Bedeutung. Des Weiteren erfordert<br />
die Beratung unterschiedlichster<br />
Kunden eine besondere Sensibilität im<br />
Umgang mit den eigenen sowie den<br />
fremden kulturellen Prägungen.<br />
2. Neben den personellen Kompetenzen<br />
erfordert eine interkulturell sensible<br />
Beratung auch Aktivitäts- und Um-<br />
setzungskompetenz, wozu die<br />
Handlungsfähigkeit in verschiedenen<br />
kulturellen Situationen zählt. Rolf Steil<br />
betonte weiterhin, dass die ver-<br />
schiedenen kulturellen Hintergründe<br />
bei den Handlungen berücksichtigt<br />
werden müssen, so dass eine<br />
konstruktive Interaktion stattfinden<br />
kann.<br />
3. Dies setzt außerdem Kommunikations-<br />
fähigkeit in den verschiedenen<br />
kulturellen Situationen voraus. Aber<br />
auch die Fach- und Methoden-<br />
kompetenz sind im Beratungsprozess<br />
78
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
von Bedeutung. Im Vergleich zu Frau<br />
Akkerman hielt er das kulturbezogene<br />
Wissen als Voraussetzung für selbst-<br />
organisiertes Handeln von Bedeutung.<br />
Zudem seien seit vier Jahren An-<br />
sprechpartner für Migranten in jeder<br />
Geschäftsstelle implementiert.<br />
79
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
FORUM 5<br />
Starke Tandems<br />
Mentoring in öffentlicher Ver-<br />
waltung und Privatwirtschaft als<br />
Beitrag zur Chancengleichheit<br />
Moderation:<br />
Petra Lotzkat – Geschäftsführerin des<br />
Zentrum für Aus- und Fortbildung, Hamburg,<br />
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg –<br />
Personalamt<br />
Funda Erler – KWB e. V. / <strong>BQM</strong><br />
Mentoring hat sich als wirkungsvolles<br />
Instrument der Personalentwicklung er-<br />
wiesen. Zahlreiche öffentliche wie<br />
private Unternehmen nutzen es, um ihre<br />
Mitarbeiterschaft auf allen Ebenen viel-<br />
fältig aufzustellen und somit den ver-<br />
änderten Kundenstrukturen gerecht zu<br />
werden. Erfolgreiche Mentoringprojekte,<br />
bei denen erfahrene Mitarbeiter/-innen<br />
ihre Mentees „an die Hand nehmen“,<br />
diese begleiten und aus dem Job heraus<br />
beraten, tragen zu einer stärkeren<br />
Durchlässigkeit und einer höheren Mit-<br />
arbeiterzufriedenheit im Unternehmen<br />
bei. Mentees berichten von Karriere-<br />
schritten, die sie ohne die Netzwerke<br />
ihrer Mentoren so nicht gemacht hätten.<br />
Jugendliche mit Migrationshintergrund,<br />
so zeigen die Erfahrungen und Ergebnisse<br />
von Mentoringprojekten, profitieren in<br />
besonderem Maße von einer<br />
individuellen Begleitung. Im Forum<br />
wurden Beispiele erfolgreicher<br />
Mentoringprozesse präsentiert und dis-<br />
kutiert.<br />
V. l. n. r.: Funda Erler, Petra Lotzkat, Marion Wartumjahn, Karin<br />
Detert, Stefan Knoll<br />
Impulsreferat 1:<br />
Stefan Knoll – Deutsche Bank Privat-<br />
und Geschäftskunden AG für die<br />
Region Hamburg und Schleswig-<br />
Holstein<br />
Als erster Referent stellte Stefan Knoll,<br />
Vorsitzender der Geschäftsleitung der<br />
Deutschen Bank Region<br />
Hamburg/Schleswig-Holstein, drei ver-<br />
schiedene unternehmensinterne<br />
Mentoring-Programme vor, die sich<br />
80
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
thematisch in zwei Bereiche unterteilen<br />
lassen.<br />
1. Mentoring und Cross-Mentoring für<br />
weibliche Nachwuchskräfte,<br />
2. Mentoring für Studenten/-innen der<br />
Hamburger School of Business.<br />
Für die weiblichen Nachwuchskräfte bietet<br />
die Deutsch Bank zum einen ein<br />
Divisionen übergreifendes Programm<br />
im Unternehmen an, das 2004 gegründet<br />
wurde und bei dem potenzialstarke Mit-<br />
arbeiterinnen gefördert werden. Dabei<br />
schließen sich jährlich mehr als 50<br />
Tandems zusammen, deren Mentees und<br />
Metoren/-innen in unterschiedlichen Fach-<br />
bereichen im Unternehmen tätig sind und<br />
somit in keinem direkten Arbeitsverhältnis<br />
zueinander stehen. Ziel des Programms ist<br />
es, die Mentees auf erste Führungsauf-<br />
gaben vorzubereiten. Unter dem Motto<br />
„One Bank – One Team“ führt die<br />
Deutsche Bank das Programm unter Be-<br />
teiligung aller Bereiche durch.<br />
Auch das Cross-Mentoring Programm<br />
richtet sich an potenzialstarke weibliche<br />
Nachwuchsführungskräfte. 1998 ins Leben<br />
gerufen, befindet sich das Cross-<br />
Mentoring bereits im elften Durchlauf. Im<br />
Gegensatz zum Divisionen über-<br />
greifenden Programm, finden hier<br />
Mentees und Mentoren/-innen zusammen,<br />
die aus unterschiedlichen Unternehmen<br />
kommen. An dem branchenübergreifenden<br />
Networking beteiligen sich unter anderem<br />
Unternehmen wie die Lufthansa, Bosch,<br />
Fraport und HP. Ziel ist es, sich durch das<br />
Gegenüberstellen verschiedener Unter-<br />
nehmenskulturen von der internen Be-<br />
trachtung zu lösen und gesamtwirtschaft-<br />
liches Denken und Handeln zu fördern.<br />
Zwölf Frauen nehmen an dem Cross-<br />
Mentoring teil. Die weiblichen Führungs-<br />
kräfte von morgen durchlaufen das<br />
Programm jeweils ein Jahr lang.<br />
Am Mentoren-Programm für<br />
Studenten/-innen der Hamburg<br />
School of Business Administration<br />
(HSBA) nehmen jährlich acht Studenten/-<br />
innen teil, die das duale Studium bei der<br />
Deutschen Bank absolvieren. Die<br />
Deutsche Bank rief das Mentoring-Projekt<br />
zwei Jahre nach Gründung der HSBA im<br />
Jahr 2004 ins Leben, da sich die Ab-<br />
solventen/-innen trotz des dualen<br />
Studiums bei der Deutschen Bank und<br />
einer qualitativ hochwertigen Ausbildung<br />
nur bedingt mit dem Unternehmen identi-<br />
fizierten und so kurz nach dem Studium<br />
das Unternehmen verließen. Die<br />
81
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Studenten/-innen der HSBA durchlaufen<br />
das Programm zwei Jahre.<br />
Das Programm für die Studenten/-innen<br />
• unterstützt die jungen Erwachsenen<br />
bereits zu Beginn des Studiums dabei,<br />
ein eigenes Netzwerk aufzubauen,<br />
• sich beruflich zu orientieren,<br />
• integriert und bindet die Nachwuchs-<br />
kräfte an die Private and Business<br />
Clients (PBC),<br />
• vermittelt die Werte der Bank sowie<br />
die strategischen Zusammenhänge.<br />
Die Mentor/-innen des Programms sind<br />
• neutrale Bezugspersonen für die<br />
Studenten/-innen,<br />
• zusätzliche Ansprechpartner/-innen<br />
für Belange, die sich in der Praxis<br />
ergeben und<br />
• Ratgeber/-innen für den weiteren<br />
Karriereweg des Mentees und<br />
stellen in diesem Kontext ihren<br />
eigenen Karriereweg vor.<br />
Es findet somit ein Austausch zwischen<br />
Mentee und Mentor/-in statt, der sich bis<br />
hin zur Vermittlung von Kontakten im<br />
PBC Bereich erstreckt.<br />
Die Personalabteilung setzt die Tandems<br />
aus Mentee und Mentor/-in zusammen und<br />
berücksichtigt dabei, dass beide Seiten<br />
nicht in der gleichen Abteilung tätig waren,<br />
sind und in absehbarer Zeit auch nicht sein<br />
werden. Mentee und Mentor/-in können<br />
nach der Tandembildung aufgrund persön-<br />
licher Differenzen noch Einspruch ein-<br />
legen. Wie das Mentoren-Programm im<br />
Detail abläuft, welche Inhalte zur Dis-<br />
kussion stehen und in welcher Frequenz<br />
Treffen zwischen Mentee und Mentor/-in<br />
stattfinden, entscheidet jedes Paar selber.<br />
Mentees, die dieses Mentoren-Programm<br />
durchlaufen möchten, sollten für An-<br />
regungen und Feedback offen sein, das<br />
Mentoring aktiv mitgestalten und den ent-<br />
stehenden Mehrwert durch das Programm<br />
für sich nutzen. Sie haben die Möglichkeit,<br />
ein besseres Verständnis für<br />
organisatorische Zusammenhänge zu be-<br />
kommen, Deutsche Bank-spezifische Spiel-<br />
regeln zu erfahren und Ideen für die<br />
82
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
eigene berufliche Laufbahn zu entwickeln<br />
sowie zu konkretisieren.<br />
Themen des Programms sollten sein:<br />
• Personalführung,<br />
• Ansprüche an die Führung von Mit-<br />
arbeitern/-innen,<br />
• Führungsgrundsätze,<br />
• Vermittlung der Unternehmenskultur.<br />
Grundsätzlich gilt:<br />
Ein vertrauensvolles Miteinander von<br />
Mentee und Mentor/-in ist Grundvoraus-<br />
setzung eines funktionierenden und<br />
effizienten Mentoring-Teams. Die<br />
Mentoren/-innen durchlaufen keine<br />
spezielle Ausbildung, um sich für diese<br />
Aufgabe zu qualifizieren, sondern füllen die<br />
Inhalte mit persönlichen Erfahrungen aus<br />
dem Berufsalltag.<br />
Impulsreferat II:<br />
Marion Wartumjan – Regionale<br />
Servicestelle Hamburg der„Aktion zu-<br />
sammen wachsen“<br />
Marion Wartumjan stellte Mentoring-<br />
Projekte vor, welche die Integration von<br />
Menschen mit Migrationshintergrund<br />
voranbringen soll. Das Projekt nimmt<br />
Bürger mit in die Verantwortung und<br />
bietet ihnen die Möglichkeit für Mit-<br />
menschen – in diesem Fall für Jugendliche<br />
mit Migrationshintergrund – Engagement<br />
zu zeigen. Ziel der „Aktion zusammen<br />
wachsen“ ist es, Integration als gesamt-<br />
gesellschaftliche Aufgabe zu verstehen und<br />
Chancengleichheit von Migranten/-innen<br />
zu erreichen. Die Aktion nutzt das bürger-<br />
schaftliche Engagement in Form von<br />
Patenschaften zur Stärkung von<br />
Integration.<br />
Um den Erfolg der Aktion zu sichern und<br />
immer mehr Patenschaften voranzu-<br />
treiben, unterstützt die Initiative unter-<br />
schiedliche Patenschaftsprojekte und kann<br />
so<br />
• die Vorteile der vielfältigen<br />
Projektlandschaft bündeln,<br />
83
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
• auf Bestehendem aufsetzen und<br />
Lücken schließen,<br />
• Evaluation sowie kontinuierliche<br />
Verbesserung gewährleisten.<br />
Zur Vernetzung regionaler Projekte und<br />
um solche Patenschaftsprojekte trans-<br />
parent zu gestalten, existieren mittlerweile<br />
fünf Servicestellen der „Aktion zusammen<br />
wachsen“ auf bundesweiter Ebene:<br />
• Hamburg – Träger: Konsortium um<br />
die Hamburger Stiftung für Migration,<br />
• Metropolregion Rhein-Neckar –<br />
Träger: Der Paritätische Heidelberg<br />
(Freiwilligenbörse),<br />
• Berlin – Träger: Bundesarbeitsgemein-<br />
schaft/Landesarbeitsgemeinschaft der<br />
Freiwilligenagenturen,<br />
• Regierungsbezirk Düsseldorf – Träger:<br />
RAA NRW,<br />
• Nürnberg – Träger: Zentrum aktiver<br />
Bürger.<br />
Regionale Servicestelle Hamburg der<br />
„Aktion zusammen wachsen“<br />
Die Servicestelle Hamburg<br />
• bündelt Informationen und Er-<br />
fahrungen rund um Patenschaften und<br />
stellt diese für Patenschaftsprojekte<br />
und strategische Partner bereit,<br />
• unterstützt den fachlichen Austausch<br />
zwischen den Projekten und fördert<br />
deren fachliche Qualifizierung,<br />
• regt Kooperationen zwischen Paten-<br />
schaftsprojekten untereinander an,<br />
• vermittelt praktisches Wissen durch<br />
ein jährliches Veranstaltungsprogramm,<br />
• erhebt laufend Bedarf und berück-<br />
sichtigt diesen bei der Umsetzung des<br />
regionalen Aktionsplans,<br />
• wirbt zusätzliche Mittel für die Arbeit<br />
ein und betreibt eine intensive<br />
Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Derzeit nehmen in Hamburg etwa 40<br />
Projekte an der „Aktion zusammen<br />
wachsen“ teil. Diese sind teils ehrenamt-<br />
lich organisiert und teils mit öffentlichen<br />
Fördergeldern finanziert.<br />
Beispiel 1: Lotsenprogramm der<br />
Elbstation – Erfahrungen stiften,<br />
Migration als Stärke fördern! –<br />
Elbstation/MPC Capital Stiftung<br />
Projekt: Ehrenamtliche Lotsen/-innen, Mit-<br />
arbeiter/-innen der MPC Capital Gruppe<br />
und anderer Hamburger Unternehmen,<br />
übernehmen ein Schuljahr lang eine Paten-<br />
84
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
schaft für einen Jugendlichen der<br />
Elbstation.<br />
Ziel: Das Projekt ermöglicht Jugendlichen<br />
durch die Patenschaft einen Zugang zu<br />
guter Bildung und Ausbildung. Das Lotsen-<br />
programm ermöglicht es den Jungen und<br />
Mädchen, ihre Potenziale zu fördern und<br />
ihr Engagement sowie ihre Leistungs-<br />
bereitschaft zu wecken.<br />
Treffen: Die Lotsen/-innen treffen sich mit<br />
ihrem Lotsenkind in der Elbstation und<br />
lesen gemeinsam, schreiben Bewerbungen<br />
oder unternehmen beispielsweise einen<br />
Ausflug zu einem Reiterhof und ähnliches.<br />
Lotsenkind: Bei den Lotsenkindern handelt<br />
es sich in der Regel um bildungs-<br />
benachteiligte Jugendliche der Klassen-<br />
stufen sieben bis neun an ausgewählten<br />
Hamburger Schulen.<br />
Lotsen/-innen: Bei den Lotsen/-innen<br />
handelt es sich um Mitarbeiter/-innen bei<br />
spielsweise der MPC Capital Gruppe und<br />
anderer Hamburger Unternehmen bzw.<br />
Institutionen.<br />
Zugewinn: Das Projekt verfolgt das Ziel,<br />
Migration als Stärke glaubwürdig zu ver-<br />
mitteln. Die Lotsen/-innen haben teilweise<br />
selber einen Migrationshintergrund.<br />
Beispiel 2: Azubi-Stammtisch der<br />
Arbeitsgemeinschaft selbstständiger<br />
Migranten e. V.<br />
Projekt: Azubis treffen sich ein Mal im<br />
Monat und helfen sich gegenseitig bei<br />
Problemen und Angelegenheiten, die die<br />
berufliche Ausbildung betreffen.<br />
Ziel: Das Projekt bietet eine Plattform zur<br />
gegenseitigen Unterstützung und zum ge-<br />
meinsamen Lernen in Fragen der beruf-<br />
lichen Ausbildung, von Politik und Gesell-<br />
schaft.<br />
Charakter: Austauschmöglichkeiten und<br />
Seminare des Azubi-Stammtisches finden<br />
in den Räumlichkeiten der Arbeitsgemein-<br />
schaft selbstständiger Migranten e. V. statt.<br />
Aber auch andere Hamburger Bildungs-<br />
stätten stellen Räume zur Verfügung und<br />
bieten ihre Unterstützung an.<br />
Jugendliche: Bei den Jugendlichen, die an<br />
dem Azubi-Stammtisch teilnehmen,<br />
handelt es sich um junge Erwachsene vor,<br />
in und nach der beruflichen Ausbildung.<br />
Mentor/-innen: Auch die Mentoren/-innen<br />
sind Auszubildende, die Erfahrungen mit<br />
85
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
anderen Azubis teilen möchten und<br />
können.<br />
Zugewinn: Jugendliche stärken sich gegen-<br />
seitig in der beruflichen Entwicklung.<br />
Beispiel 3: Interkulturelles<br />
Mentoringprojekt „Neue Wege in<br />
den Beruf – Mentoring für junge<br />
Frauen mit Zuwanderungs<br />
geschichte“ in NWR<br />
Projekt: Das interkulturelle Mentoring-<br />
Projekt begleitet und fördert junge Frauen<br />
mit guten schulischen Leistungen ein Jahr<br />
lang.<br />
Ziele: Jungen Frauen eröffnen sich auf-<br />
grund des Mentoring-Programms im An-<br />
schluss an die Schulausbildung attraktive<br />
berufliche Möglichkeiten, die ihren<br />
Qualifikationen entsprechen. Charakter:<br />
Das Wichtigste ist, dass die Chemie<br />
stimmt, um Vertrauen aufzubauen.<br />
Jugendliche: Das Programm ist für<br />
jungeFrauen mit Zuwanderungsgeschichte<br />
der Klassen neun bis zwölf konzipiert.<br />
Mentor/-innen: Bei den Mentor/-innen<br />
handelt es sich um engagierte Frauen mit<br />
guten Netzwerken.<br />
Zugewinn: Das Projekt macht das Motto<br />
„Leistung lohnt sich und wird anerkannt“<br />
erfahrbar.<br />
Von den Patenschaften zwischen ein-<br />
heimischen Paten und jugendlichen<br />
„Patenkindern“ mit Zuwanderungs-<br />
geschichte können beide Seiten profitieren<br />
und ihre Potenziale entfalten. In Hamburg<br />
gibt es weit mehr als 1.000 Patenschaften.<br />
Allein die Lesehelfer zählen etwa 500<br />
ehrenamtliche Mentoren/-innen.<br />
Impulsreferat III<br />
Karin Detert – Fachbereich Personal<br />
und Organisation der Stadt Osnabrück<br />
Karin Detert stellte im Forum das Projekt<br />
„Starke Teams – I.Q.-Mentoring im<br />
Unternehmen Stadt“ vor und be-<br />
richtete über Erfahrungen und Erkennt-<br />
nisse aus der Stadtverwaltung im Kontext<br />
des Projektes. I.Q. steht für inter-<br />
kulturelle Qualität, was einen gegen-<br />
seitigen Lernprozess widerspiegelt. Ihr<br />
Vortrag begann mit der Wiedergabe eines<br />
kurzen Überblicks zum Konzern Stadt –<br />
einem Unternehmen mit vielschichtigen<br />
bürger- und kundenorientierten An-<br />
geboten.<br />
86
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Hintergrund der interkulturellen Öffnung<br />
sei die gesellschaftliche Entwicklung durch<br />
• den demografischen Wandel im<br />
Kontext einer immer älter<br />
werdenden Bevölkerung,<br />
• den Anstieg des Anteils von<br />
Menschen mit Migrationshinter-<br />
grund auf ein Drittel der Gesamt-<br />
bevölkerung<br />
• die Erhöhung des Anteils weib-<br />
licher Erwerbstätiger.<br />
Die daraus resultierenden Auswirkungen<br />
auf den Arbeitgeber und Dienstleister<br />
Osnabrück lassen sich wie folgt definieren:<br />
• Verknappung von qualifizierten Fach-<br />
kräften, geringere Wettbewerbsfähig-<br />
keit; Rekrutierungsprobleme,<br />
• veränderte Anforderungen an Dienst-<br />
leister/-innen aufgrund der Hetero-<br />
genität der unterschiedlichen Kunden-<br />
segmente,<br />
• Anpassungen der Unternehmens-<br />
strategie sind notwendig.<br />
Mit dem Projekt verfolgt die Stadt Osna-<br />
brück folgende Ziele:<br />
• Die Attraktivität des Arbeitgebers<br />
Stadt Osnabrück steigern: die mono-<br />
kulturell orientierte Unternehmens-<br />
kultur verändern.<br />
• Das Unternehmen Stadt auf inter-<br />
kulturelle Arbeits- und Service-<br />
situationen vorbereiten und<br />
kompetent machen: interkulturelle<br />
Potenziale in der Organisation nutzen.<br />
• Qualifizierte Fachkräfte gewinnen: ver-<br />
stärkt Potenziale von Frauen und<br />
Migranten/-innen für die Stadt er-<br />
schließen.<br />
Detert erklärte, dass die Herausforderung<br />
bei der Initiierung des Projektes darin be-<br />
steht, langjährige Mitarbeiter/-innen (ohne<br />
Migrationshintergrund) davon zu über-<br />
zeugen, interkulturelle Kompetenzen an-<br />
zunehmen und zu nutzen. Personalent-<br />
wicklungsstrategien und die Konzeption<br />
eines Mentoring-Programmes waren die<br />
ersten Schritte in Richtung I.Q.-Mentoring.<br />
Das Besondere an diesem Projekt ist, dass<br />
beide Seiten Potenziale und „Schätze“ in<br />
die Zusammenarbeit mitbringen, ver-<br />
borgene Ressourcen nutzen und eine<br />
gegenseitige Qualifizierung von Mit-<br />
arbeitern/-innen mit und ohne Migrations-<br />
hintergrund stattfinden kann.<br />
87
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Folgende langfristige Ziele des I.Q.-<br />
Metoring definierten die Initiatoren zu<br />
Beginn des Projektes:<br />
• Integration und Erhöhung des An-<br />
teils von Migranten/-innen bei der<br />
Stadtverwaltung Osnabrück,<br />
• Erhöhung der interkulturellen<br />
Kompetenzen der Mitarbeiter/-<br />
innen der Stadtverwaltung,<br />
• Verbesserung der Qualität von<br />
interkulturellen Servicesituationen,<br />
• Schaffung von Rahmenbedingungen,<br />
die es Migranten/-innen ermög-<br />
lichen, in der Zukunft verstärkt<br />
Führungspositionen zu über-<br />
nehmen (z. B. Kooperation mit der<br />
Fachhochschule Osnabrück),<br />
• Vorbildfunktion der Stadt Osna-<br />
brück als Friedenskulturstadt nach<br />
innen und nach außen durch ein<br />
solches Programm.<br />
Folgende kurzfristige Ziele des I.Q.-<br />
Metoring definierten die Initiatoren zu<br />
Beginn des Projektes :<br />
• Frühzeitige Förderung und Integration<br />
von Migranten/-innen in der Stadtver-<br />
waltung Osnabrück,<br />
• Unterstützung der Migranten/-innen in<br />
der selbstbewussten Wahrnehmung<br />
und Einbringung ihres kulturellen<br />
Wissens,<br />
• systematische Weiterentwicklung der<br />
Führungsqualitäten und inter-<br />
kulturellen Kompetenzen der<br />
Mentoren/-innen,<br />
• praxisnahe Vorbereitung von<br />
Migranten/-innen auf berufliche An-<br />
forderungen und gegebenenfalls<br />
spätere Führungspositionen.<br />
2002/2003 ging das Projekt an den Start<br />
und der erste Durchgang brachte<br />
Mentoren/-innen und Mentees zusammen.<br />
Dabei kamen erste Herausforderungen<br />
und Widerstände ans Tageslicht.<br />
Migranten/-innen wollten nicht als solche<br />
„erkannt und gesehen“ werden, wollten<br />
nicht auffallen und erkannten ihre be-<br />
sonderen Kompetenzen nicht an. Mit-<br />
arbeiter/-innen und Vorgesetzte erkannten<br />
die Notwendigkeit und den Nutzen des<br />
Projektes nicht und konnten nicht nach-<br />
vollziehen, worin die Schwierigkeiten der<br />
Anpassung überhaupt liegen sollen. Ein<br />
weiteres Problem bestand darin, die<br />
Qualifizierungsangebote in Arbeitszeit und<br />
Dienstpläne zu integrieren. Spätere<br />
Durchläufe gestalteten sich einfacher und<br />
es meldeten sich immer mehr freiwillige<br />
Mentoren/-innen.<br />
88
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Wie erreicht die Stadt Osnabrück<br />
ihre angestrebten Zielen?<br />
Die Stadt wählt Mitarbeiter/-innen mit<br />
Migrationserfahrungen als Mentees aus –<br />
unter Berücksichtigung ihrer beruflichen<br />
Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung<br />
sowie der Lebens- und Berufszielplanung.<br />
Erfahrene Mitarbeiter/-innen wählt sie als<br />
Mentor/-innen aus, um die inter-<br />
kulturellen Kompetenzen zu verbessern.<br />
Das entstandene Tandem bleibt für zehn<br />
bis zwölf Monate bestehen. Weitere<br />
Inhalte resultieren aus Bedarfsanalysen und<br />
der persönlichen Zielbestimmung des<br />
Mentees.<br />
Methodische Bausteine<br />
• Regelmäßige Treffen von Mentee und<br />
Metor/-in,<br />
• Shadowing,<br />
• Workshops zu Projektmanagement,<br />
Präsentationsfähigkeit, interkulturelles<br />
Management etc.,<br />
• Leitfäden und Checklisten,<br />
• Kommunikationsforum der Mentees,<br />
• Konkrete Aufgaben für die Mentees in<br />
der Praxis,<br />
• kollegiale Supervision der Mentor/-<br />
innen,<br />
• Coaching der Mentor/-innen,<br />
• Informelle interkulturelle Events wie<br />
beispielsweise eine Weihnachtsfeier,<br />
• Auftakt- und Abschlussveranstaltung:<br />
nach außen und nach innen,<br />
• Informationsmanagement in der Stadt,<br />
• Mentoren/-innen bekommen Unter-<br />
stützung dabei, Mentor/-innen zu sein.<br />
Erkenntnisse, Ergebnisse, Ent-<br />
wicklung bei den Mentees:<br />
• Selbstsicherheit im Beruf und im Um-<br />
gang mit Kunden/-innen,<br />
• Verbesserung der beruflichen Fähig-<br />
keiten,<br />
• Bessere Orientierung innerhalb des<br />
Unternehmens,<br />
• Wissenserwerb über kulturelle Unter-<br />
schiede und Gemeinsamkeiten.<br />
Erkenntnisse, Ergebnisse, Ent-<br />
wicklung bei den Mentoren/-innen:<br />
• Verbesserung von Kunden-, Beratungs-<br />
und Führungssituationen durch inter-<br />
kulturelle Kompetenzentwicklung,<br />
• höhere Kompetenz im Umfang mit<br />
Menschen aus anderen Kulturen,<br />
• Verständnis für Lebensumstände von<br />
Kollegen/-innen mit einem Migrations-<br />
hintergrund,<br />
89
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
• Multiplikatorenfunktion innerhalb des<br />
Unternehmens.<br />
Erkenntnisse, Ergebnisse, Ent-<br />
wicklungen innerhalb der<br />
Organisation nach außen:<br />
• „Echte“ Integration der Migranten/-<br />
innen fördert Motivation, Zufrieden-<br />
heit, Engagement und Identifikation mit<br />
dem/der Arbeitgeber/-in; reduziert<br />
Reibungsverluste und Konflikte � er-<br />
höht Produktivität.<br />
• Interkulturelle Teams reagieren<br />
offener auf neue Anforderungen; „Be-<br />
triebsblindheit“ wird reduziert<br />
� erhöht Flexibilität.<br />
• Mentoring erhöht den Informations-<br />
austausch; Unternehmenswissen wird<br />
gegen Kenntnisse über andere<br />
Kulturen und anderes Kulturverhalten<br />
ausgetauscht<br />
� erhöht Wissenstransfer.<br />
• Mentoring fördert den Dialog<br />
zwischen den Kulturen und eine Ver-<br />
trauenskultur; Probleme werden<br />
weniger tabuisiert und können ge-<br />
zielter behoben werden<br />
� verbessert unternehmensinterne<br />
Kommunikation.<br />
• Positives Unternehmensimage gegen-<br />
über Migranten/-innen; Rekrutierungs-<br />
chancen erhöhen sich<br />
� verbessert Personalmarketing.<br />
• Unternehmen, das Mentoring für<br />
Migranten praktiziert, wird als zu-<br />
kunftsorientiert, offen und innovativ im<br />
europäischen (globalen) Kontext<br />
wahrgenommen; erhöht Nachfrage<br />
nach „ungewöhnlichen“ Aufträgen<br />
� verbessert Außenwirkung.<br />
Abschlussworte<br />
Stefan Knoll:<br />
Mentoring ist ein unverzichtbarer Teil-<br />
aspekt in der Personalpolitik. Ein Teil des<br />
Puzzles, das die Weiterentwicklung von<br />
Mitarbeitern/-innen voranbringt und eine<br />
Bereitschaft zu einem partnerschaftlichen<br />
Miteinander im Unternehmen fördert.<br />
Marion Wartumjan:<br />
Mentoring ist zum Erreichen unter-<br />
nehmerischer und gesellschaftlicher Ziele<br />
ein wichtiges Instrument, das nur „Ge-<br />
winner“ hervorbringt: Den/die Mentor/-in,<br />
den Mentees und gegebenenfalls dem<br />
Unternehmen. Dies funktioniert allerdings<br />
nur, wenn eine beidseitige Lernbereit-<br />
90
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
schaft vorhanden ist und eine gemeinsame<br />
Lernumgebung existiert.<br />
Karin Detert:<br />
Im weitesten Sinne ist Normalität das Ziel.<br />
Oft fehlen Migranten/-innen Netzwerke,<br />
sie kennen sich in der Funktionsweise der<br />
deutschen Arbeitswelt nicht aus und/oder<br />
werden diskriminiert. Mentoring-<br />
Programme können diese Kluft über-<br />
winden, wovon Mentoren/-innen, Mentees<br />
und die Stadt Osnabrück profitieren.<br />
91
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Zusammenfassung und Ausblick<br />
Wer sich auf besondere Weise für Jugend-<br />
liche mit Migrationshintergrund einsetzt,<br />
Ausbildungsplätze zu Verfügung stellt und<br />
interkulturell sensibilisiert, verdient An-<br />
erkennung. Das sehen auch Hamburgs<br />
Zweite Bürgermeisterin Christa Goetsch<br />
und der Präsident der Vereinigung der<br />
Unternehmensverbände in Hamburg und<br />
Schleswig Holstein e. V., Uli Wachholtz,<br />
so. Deswegen haben sie drei Hamburger<br />
Unternehmen mit dem Förderpreis "Viel-<br />
falt in Ausbildung <strong>2010</strong>" ausgezeichnet.<br />
"Wir wollen die Ausgangsbedingungen für<br />
diese Jugendlichen verbessern, damit sie ihr<br />
Können in der Schule und in der Berufsaus-<br />
bildung voll entfalten können. Wenn sie<br />
zeigen können, was in ihnen steckt, wenn sie<br />
merken, dass ihnen jemand etwas zutraut<br />
und ihre Leistungen anerkennt, wachsen diese<br />
Jugendlichen nicht selten regelrecht über sich<br />
hinaus", sagte Goetsch am 7. Juni <strong>2010</strong> bei<br />
der Preisverleihung im Hamburger Rat-<br />
haus.<br />
Die diesjährigen Preisträger sind:<br />
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG, die<br />
Filiale der Auto Wichert GmbH in<br />
der Ulzburger Straße und Haar &<br />
Cosmetic by Mister No. Die aus-<br />
gewählten Preisträger stehen mit Ihrem<br />
Einsatz stellvertretend für viele weitere<br />
preiswürdige Konzepte, die zur Aus-<br />
schreibung des Förderpreises bei der<br />
<strong>BQM</strong> eingereicht wurden. Das<br />
Engagement der Unternehmen gibt<br />
wichtige Impulse für die berufliche<br />
Integration von Jugendlichen mit Zu-<br />
wanderungsgeschichte in Hamburg. Der<br />
Förderpreis wurde zum sechsten Mal ge-<br />
meinsam von UVNord und der Beratungs-<br />
und Koordinierungsstelle zur beruflichen<br />
Qualifizierung junger Migrantinnen und<br />
Migranten (<strong>BQM</strong>) ausgelobt.<br />
Bei der begleitenden <strong>Fachtagung</strong> der <strong>BQM</strong><br />
und UVNord berichteten und diskutierten<br />
hochrangige Expertinnen und Experten aus<br />
Wirtschaft, Bildung und Politik über<br />
innovative Praxisbeispiele und aktuelle<br />
Entwicklungen im Bereich der beruflichen<br />
Integration von Jugendlichen mit<br />
Migrationshintergrund. So sagte Dr.<br />
92
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Thomas Liebig von der OECD in seinem<br />
Vortrag, dass gerade die hochqualifizierten<br />
Kinder von Migranten die vergleichsweise<br />
größten Schwierigkeiten hätten, eine an-<br />
gemessene Arbeitsstelle zu finden. "Und<br />
das ist eine Gruppe, bei der man kaum mit<br />
Sprachproblemen argumentieren kann", sagte<br />
er. Gründe für Lücken am Übergang von<br />
der Schule in den Beruf seien viel mehr<br />
fehlende Netzwerke, mangelnde Kennt-<br />
nisse über den Arbeitsmarkt und Dis-<br />
kriminierung. "Zunächst müssen mehr<br />
Kontakte zwischen Jugendlichen mit<br />
Migrationshintergrund und Arbeitgebern her-<br />
gestellt werden – wir wissen, wenn sich die<br />
Jugendlichen beweisen können, dann werden<br />
diese Vorurteile auch ausgeräumt."<br />
Die <strong>Fachtagung</strong> wurde von der <strong>BQM</strong> ge-<br />
meinsam mit UVNord veranstaltet und ist<br />
Teil des "Aktionsplans zur Bildungs- und<br />
Ausbildungsförderung junger Menschen<br />
mit Migrationshintergrund".<br />
93
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
Danksagung<br />
Für die Organisation sowie für die<br />
informativen Präsentationen und Vorträge<br />
hat die <strong>BQM</strong> viel Lob und anerkennende<br />
Rückmeldungen erhalten. Dieses Lob<br />
möchte die <strong>BQM</strong> weitergeben und sich<br />
auch im Namen aller an der Organisation<br />
beteiligten Kolleginnen und Kollegen ganz<br />
herzlich bedanken. Mit anschaulichen und<br />
praxisbezogenen Beiträgen haben die ge-<br />
ladenen Expertinnen und Experten sowie<br />
die Gäste maßgeblich zum Gelingen der<br />
<strong>Fachtagung</strong> beigetragen.<br />
Wir danken insbesondere unserer<br />
Zweiten Bürgermeisterin Christa Goetsch<br />
für ihre engagierte Rede und die persön-<br />
liche Verleihung des Förderpreises.<br />
Uli Wachholtz möchten wir herzlich für<br />
seine ehrende Ansprache zur Verleihung<br />
des diesjährigen Preises „Vielfalt in Aus-<br />
bildung <strong>2010</strong>“ und sein Engagement für die<br />
<strong>BQM</strong> danken.<br />
Ebenso möchten wir uns bei Karl<br />
Gernandt, Mely Kiyak, Dr. Thomas Liebig,<br />
Monika Rühl, Mark Terkessidis für ihre<br />
richtungsweisenden Beiträge bedanken.<br />
Ein großes Dankeschön richten wir auch<br />
Julia-Niharika Sen für die Moderation<br />
sowie an alle Referentinnen und<br />
Referenten für ihr hervorragendes Mit-<br />
wirken an der <strong>Fachtagung</strong>. Sie haben allen<br />
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine<br />
Vielzahl von zukunftweisenden Denk-<br />
anstößen mit auf den Weg gegeben.<br />
Die ausgewählten Preisträger stehen mit<br />
Ihrem Einsatz stellvertretend für viele<br />
weitere preiswürdige Konzepte, die zur<br />
Ausschreibung des Förderpreises bei der<br />
<strong>BQM</strong> eingereicht wurden. Deshalb ge-<br />
bührt auch allen Betrieben, die sich be-<br />
worben haben, Dank und Anerkennung.<br />
Ihr Engagement gibt wichtige Anregungen<br />
für eine verbesserte berufliche Integration<br />
dieser Zielgruppe in Hamburg und soll<br />
zum Nachahmen anregen.<br />
Ein besonderes Dankeschön geht auch an<br />
alle Kolleginnen und Kollegen der<br />
KWB e. V. für ihre tatkräftige Arbeit und<br />
Unterstützung bei der Vorbereitung und<br />
Umsetzung dieser Veranstaltung.<br />
Zu guter Letzt möchten wir Ihnen für das<br />
Vertrauen und Ihre Unterstützung danken,<br />
die Sie und Ihre Partner aus der Wirt-<br />
schaft und die Institutionen der <strong>BQM</strong> bei<br />
94
<strong>Fachtagung</strong>sdokumentation <strong>2010</strong><br />
der Umsetzung der vielfältigen Aufgaben<br />
entgegenbringen.<br />
95