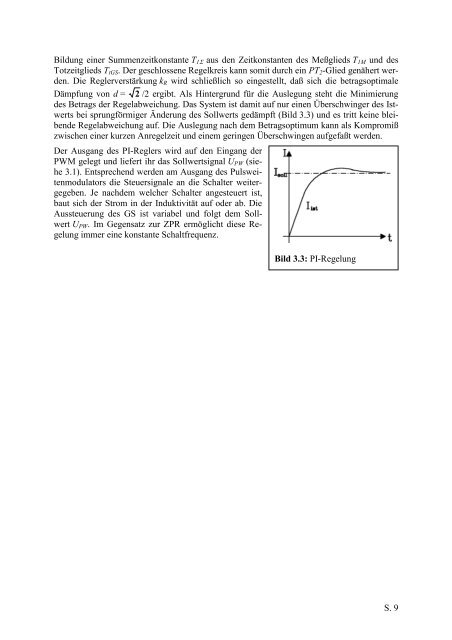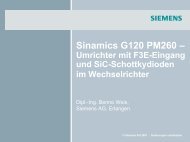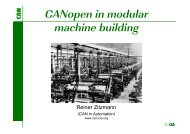ETiT IV-Praktikum Versuch Gleichstromsteller - Institut für ...
ETiT IV-Praktikum Versuch Gleichstromsteller - Institut für ...
ETiT IV-Praktikum Versuch Gleichstromsteller - Institut für ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bildung einer Summenzeitkonstante T1� aus den Zeitkonstanten des Meßglieds T1M und des<br />
Totzeitglieds TtGS. Der geschlossene Regelkreis kann somit durch ein PT2-Glied genähert werden.<br />
Die Reglerverstärkung kR wird schließlich so eingestellt, daß sich die betragsoptimale<br />
Dämpfung von d = 2 /2 ergibt. Als Hintergrund <strong>für</strong> die Auslegung steht die Minimierung<br />
des Betrags der Regelabweichung. Das System ist damit auf nur einen Überschwinger des Istwerts<br />
bei sprungförmiger Änderung des Sollwerts gedämpft (Bild 3.3) und es tritt keine bleibende<br />
Regelabweichung auf. Die Auslegung nach dem Betragsoptimum kann als Kompromiß<br />
zwischen einer kurzen Anregelzeit und einem geringen Überschwingen aufgefaßt werden.<br />
Der Ausgang des PI-Reglers wird auf den Eingang der<br />
PWM gelegt und liefert ihr das Sollwertsignal UPW (siehe<br />
3.1). Entsprechend werden am Ausgang des Pulsweitenmodulators<br />
die Steuersignale an die Schalter weitergegeben.<br />
Je nachdem welcher Schalter angesteuert ist,<br />
baut sich der Strom in der Induktivität auf oder ab. Die<br />
Aussteuerung des GS ist variabel und folgt dem Sollwert<br />
UPW. Im Gegensatz zur ZPR ermöglicht diese Regelung<br />
immer eine konstante Schaltfrequenz.<br />
Bild 3.3: PI-Regelung<br />
S. 9