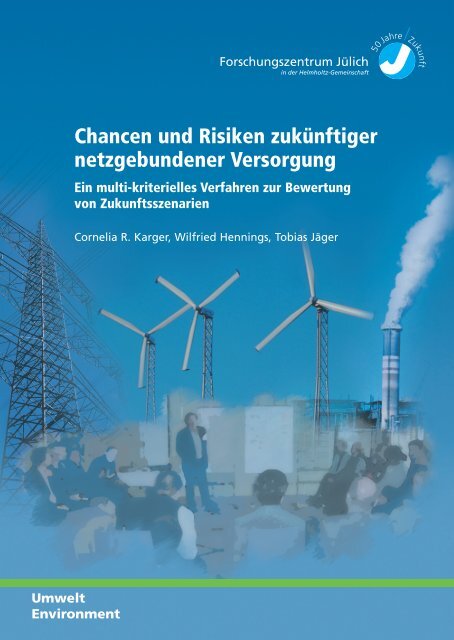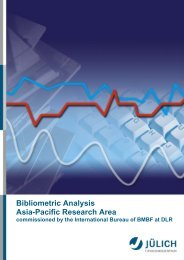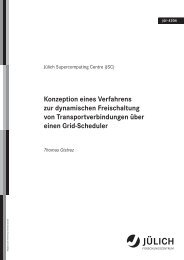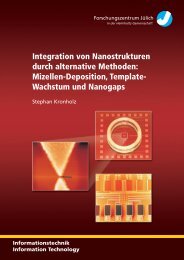netzgebundener Versorgung
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Chancen und Risiken zukünftiger<br />
<strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong><br />
Ein multi-kriterielles Verfahren zur Bewertung<br />
von Zukunftsszenarien<br />
Cornelia R. Karger, Wilfried Hennings, Tobias Jäger<br />
Umwelt<br />
Environment
Schriften des Forschungszentrums Jülich<br />
Reihe Umwelt/Environment Band/Volume 64
Forschungszentrum Jülich GmbH<br />
Programmgruppe Mensch, Umwelt, Technik<br />
Chancen und Risiken zukünftiger<br />
<strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong><br />
Ein multi-kriterielles Verfahren zur Bewertung<br />
von Zukunftsszenarien<br />
Cornelia R. Karger, Wilfried Hennings, Tobias Jäger<br />
Schriften des Forschungszentrums Jülich<br />
Reihe Umwelt/Environment Band/Volume 64<br />
ISSN 1433-5530 ISBN 3-89336-445-5
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek<br />
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen<br />
Nationalbibliografie; detaillierte Bibliografische Daten sind im Internet<br />
über abrufbar.<br />
Herausgeber Forschungszentrum Jülich GmbH<br />
und Vertrieb: Zentralbibliothek, Verlag<br />
D-52425 Jülich<br />
Telefon: 02461 61-5368 • Telefax: 02461 61-6103<br />
e-mail: zb-publikation@fz-juelich.de<br />
Internet: http://www.fz-juelich.de/zb<br />
Umschlaggestaltung: Grafische Betriebe, Forschungszentrum Jülich GmbH<br />
Druck: Grafische Betriebe, Forschungszentrum Jülich GmbH<br />
Copyright: Forschungszentrum Jülich 2006<br />
Schriften des Forschungszentrums Jülich<br />
Reihe Umwelt/Environment Band/Volume 64<br />
ISSN 1433-5530<br />
ISBN-10: 3-89336-445-5<br />
ISBN-13: 978-3-89336-445-9<br />
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder<br />
in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder<br />
unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Einführung<br />
Die Gestaltung zukünftiger Entwicklungen <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong> ist eine schwierige<br />
gesellschaftliche Aufgabe im Rahmen der Zukunftssicherung. Die Strukturen der öffentlichen<br />
Daseinsvorsorge mit den Basisgütern Strom, Gas und Wasser, aber auch Telekommunikationsleistungen<br />
sind Gegenstand öffentlicher Debatten. Die Forderung nach einer nachhaltigen<br />
Zukunft der <strong>Versorgung</strong> ist gestellt: Es werden Maßnahmen zum Klimaschutz angemahnt;<br />
Bürger engagieren sich gegen geplante Kraftwerke, gegen Kohlebergbau, aber auch<br />
gegen Windkraftanlagen; Energieträger wie Kohle, Öl und Erdgas werden knapp oder teuer.<br />
Gleichzeitig müssen <strong>Versorgung</strong>sunternehmen sich den Herausforderungen von Privatisierung,<br />
Marktöffnung und Globalisierung stellen. Der Kostendruck erfordert Einsparungen. Es<br />
stellt sich die Frage, welche Spielräume unter diesen Rahmenbedingungen eröffnet sind.<br />
„Nachhaltigkeit" als Orientierungsrahmen für die Gestaltung der Zukunft der <strong>Versorgung</strong> ist<br />
gesellschaftlich unbestritten. Einzelne Vorschläge zur nachhaltigen Zukunftssicherung werden<br />
auch bereits diskutiert, wie z. B. die <strong>Versorgung</strong>ssysteme mit Hilfe moderner Telekommunikation<br />
effizienter zu gestalten oder als Ausweg aus der CO 2-Problematik stärker auf<br />
dezentrale Energieerzeugung und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen zu setzen.<br />
Unklar ist jedoch, welchen konkreten Anforderungen ein nachhaltiger Weg in die Zukunft<br />
genügen soll. Zum einen besteht das Problem der „Normativität" des Begriffs der Nachhaltigkeit.<br />
Es geht um subjektive Ziel- und Wertvorstellungen einer Gesellschaft, die sich letztlich<br />
einer wissenschaftlichen Entscheidbarkeit entziehen. Somit gibt es unterschiedliche und<br />
häufig kontroverse gesellschaftliche Vorstellungen darüber, was unter einer nachhaltigen<br />
<strong>Versorgung</strong> zu verstehen ist. Zum anderen müssen Entscheidungen unter hoher Unsicherheit<br />
getroffen werden. Wie und wohin sich die <strong>Versorgung</strong>ssektoren weiterentwickeln und<br />
welche ökologischen, ökonomischen und sozialen Wirkungen damit verbunden sein können,<br />
ist offen. Unklar ist auch, wie sich gesellschaftliche Akteure zu verschiedenen Zukunftsoptionen<br />
der <strong>Versorgung</strong> positionieren werden.<br />
Um die Weichenstellung in die Zukunft einer nachhaltigen <strong>Versorgung</strong> zu unterstützen, ist ein<br />
Verfahren erforderlich, das möglichst frühzeitig Chancen und Risiken zukünftiger Entwicklungen<br />
erkennt und zukunftsträchtige Wege auszuloten hilft. Anzustreben sind möglichst transparente<br />
und somit nachvollziehbare und handlungsrelevante Entscheidungsgrundlagen.<br />
Die vorliegende Studie widmet sich vor diesem Hintergrund einem Verfahren, das anhand<br />
konkreter Zukunftsoptionen die Frage „Was wollen wir?" zu beantworten sucht. Es geht nicht<br />
um die abstrakte Diskussion um die Nachhaltigkeit zukünftiger <strong>Versorgung</strong> oder den Beitrag<br />
bestimmter Technologien dazu, sondern um gesamtgesellschaftliche Zukunftsbilder der<br />
<strong>Versorgung</strong>, anhand derer konkrete Zielvorstellungen diskutiert werden, über deren Für und<br />
Wider argumentiert wird sowie zu erwartende Konfliktlinien und Konsenspotentiale bei der<br />
Zukunftsgestaltung ausgelotet werden. Wesentliche Merkmale dieses Verfahrens sind seine<br />
Mehrstufigkeit und die Einbeziehung von Wissenschaft und Gesellschaft. In strukturierte auf<br />
einander aufbauende Arbeitsprozesse werden wissenschaftliche und gesellschaftliche Akteure<br />
eingebunden, um Chancen und Risiken verschiedener Zukunftsoptionen herauszuarbeiten.<br />
Die Studie wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im<br />
Rahmen des Verbundprojektes „Integrierte Mikrosysteme der <strong>Versorgung</strong>" im Förderschwerpunkt<br />
„Sozial-Ökologische Forschung" (SÖF)<br />
1
2
Introduction<br />
Shaping the developments of network-based supply systems is a difficult challenge in the<br />
context of preparing for the future. The structures for supplying the public with the basic<br />
goods electricity, gas and water, and also telecommunication services, have become the<br />
subject of public debates. A sustainable future for the supplies is being sought: measures for<br />
protecting the climate have been requested; citizens have committed themselves to opposing<br />
not only planned power stations, and coal mining, but also wind power plants; energy resources<br />
like coal, oil and natural gas are becoming scarce and expensive. At the same time,<br />
the supply utilities must meet the challenges of privatization, market openings and globalization.<br />
The pressure of high costs necessitates savings. The question is which choices are<br />
open within the framework of these determining factors.<br />
"Sustainability" is an uncontested guideline for shaping the future of supplies. Several proposals<br />
for sustainably securing future supplies have already been discussed, e. g. making<br />
the supply systems more efficient by means of modern telecommunications, or relying more<br />
on decentralized energy generation and the utilization of renewable energy sources as a way<br />
out of the CO 2 problematic. However, what specific requirements will pave the way for a<br />
sustainable path into the future remains unclear. On one hand, there is the problem of "normativity"<br />
of the sustainability concept. lt is a matter of the subjective aims and values in a<br />
society, which in the end evade a scientific decidability. Thus there are different and often<br />
controversial concepts about what is meant by sustainable supplies. On the other hand,<br />
decisions must be made under conditions of great uncertainty. How and in which direction<br />
the supply sectors will develop and which ecological, economical and social effects could be<br />
associated with these directions still remains open. lt is also unclear what positions stakeholders<br />
will take on different future supply options.<br />
Setting the course for a sustainable future supply means that a method is needed for diagnosing<br />
the opportunities and risks of future developments as early as possible and for leveling<br />
out promising paths. The bases upon which decisions are made should be as transparent<br />
as possible and hence be easy to understand and put into action.<br />
lt is against this background that this study looks at specific options for the future and uses<br />
this as a basis for developing a method which tries to answer the question "What is it that we<br />
want?". lt is not about an abstract discussion of the sustainability of future supplies or the<br />
contribution of specific technologies to sustainability, but about views of the future of supplies<br />
with respect to all societal aspects, with reference to which specific objectives are discussed,<br />
the pros and cons of which are weighed up, and regarding which the expected conflicts and<br />
potentials for reaching a consensus are leveled out. The essential features of this method<br />
are the multiple stages involved and the inclusion of science and society. Scientific and societal<br />
actors are involved in structured stages that build upon each other so that the elaborate<br />
opportunities and risks of different options for the future can be hammered out.<br />
The study was funded by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) within the<br />
joint research project "Integrierte Mikrosysteme der <strong>Versorgung</strong>" (Integrated Microsystems<br />
for Supply) within the focal framework of "social-ecological research".<br />
3
Inhaltsverzeichnis<br />
Einführung 1<br />
Introduction 3<br />
Zusammenfassung 10<br />
Überblick über den Bericht 15<br />
Teil I Nachhaltigkeit — Konzepte und Instrumente 17<br />
1. Nachhaltigkeitskonzepte 19<br />
1.1 Thematisierung von Nachhaltigkeit in den jeweiligen Disziplinen 19<br />
1.2 Paradigmen und die verschiedenen Konzepte von Nachhaltigkeit 20<br />
2. Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung 35<br />
2.1 Überblick 35<br />
2.2 Akteursunabhängige Verfahren 37<br />
2.2.1 Kurze Einführung in die Verfahren 37<br />
2.2.2 Diskussion der Verfahren 46<br />
2.3 Akteursabhängige Verfahren 47<br />
2.3.1 Planungszelle 48<br />
2.3.2 Planungswerkstatt 50<br />
2.3.3 Delphi-Methode 51<br />
2.3.4 Nutzwertanalyse 53<br />
Teil II Empirische Untersuchung 57<br />
1. Gegenstand und Ziel 59<br />
1.1 Die Zukunftsszenarien 59<br />
1.1.1 Szenario A 60<br />
1.1.2 Szenario B 61<br />
1.1.3 Szenario C 62<br />
1.1.4 Szenario D 64<br />
1.2 Ziel 67<br />
2. Methode 67<br />
2.1 Hintergrund 67<br />
2.2 Multi-kriterielle Entscheidungsverfahren 68<br />
2.2.1 Klassifikation von multi-kriteriellen Verfahren 68<br />
2.2.2 Anwendungen 69<br />
2.2.3 Grundprinzip der MAUT und des AHP 70<br />
2.3 Methodische Konzeption der Untersuchung 77<br />
2.3.1 Diskursiver Ansatz 77<br />
2.3.2 Verfahrensschritte 82<br />
3. Wertbaumanalyse 84<br />
4<br />
3.1 Durchführung 84<br />
3.1.1 Ansatz 84
3.1.2 Teilnehmer 85<br />
3.1.3 Vorgehen 86<br />
3.2 Auswertung 87<br />
3.3 Ergebnisse 87<br />
4. Gewichtung der Ziele 92<br />
4.1 Durchführung 92<br />
4.1.1 Ansatz 92<br />
4.1.2 Teilnehmer 93<br />
4.1.3 Vorgehen 94<br />
4.2 Auswertung 95<br />
4.3 Ergebnisse 96<br />
4.3.1 Relative Gewichte der Zielkriterien 96<br />
4.3.2 Bewertungsprofile der Befragten 107<br />
5. Impact-Analyse 110<br />
5.1 Durchführung 110<br />
5.1.1 Ansatz 110<br />
5.1.2 Teilnehmer 110<br />
5.1.3 Vorgehen 111<br />
5.2 Auswertung 112<br />
5.3 Ergebnisse 117<br />
5.3.1 Umweltschutz 118<br />
5.3.2 Gesundheitsschutz 136<br />
5.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit 140<br />
5.3.4 Wirtschaftliche Aspekte 157<br />
5.3.5 Soziale Aspekte 172<br />
5.3.6 Zusammenfassung 179<br />
5.3.7 Dezentralisierung und Nachhaltigkeit 185<br />
6. Ergebnisworkshop 187<br />
6.1 Ansatz 187<br />
6.2 Durchführung 187<br />
6.3 Ergebnisse 189<br />
6.3.1 Stärken und Schwächen der Szenarien je Zielbereich 189<br />
6.3.2 Gewichtungen und ihre Begründungen 194<br />
6.3.3 Rangfolge der Stärken und Schwächen der Szenarien 196<br />
6.3.4 Stärken und Schwächen im Ergebnisworkshop im Vergleich zur Impact-<br />
Analyse 198<br />
6.3.5 Präferenzen für die Zukunftsszenarien 204<br />
6.3.6 Stellgrößen der Szenarien zu mehr Nachhaltigkeit 204<br />
7. Diskussion 206<br />
Literatur 214<br />
5
Anhang:<br />
A.1 Tabellarische Darstellung der Szenarien 228<br />
A.2 Beschreibung der Ziele 234<br />
A.2.1 Umweltschutz 234<br />
A.2.2 Gesundheitsschutz 236<br />
A.2.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit 237<br />
A.2.4 Wirtschaftliche Aspekte 238<br />
A.2.5 Soziale Aspekte 240<br />
A.3 Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten) 243<br />
A.3.1 Umweltschutz 243<br />
A.3.2 Gesundheitsschutz 257<br />
A.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit 261<br />
A.3.4 Wirtschaftliche Aspekte 278<br />
A.3.5 Soziale Aspekte 293<br />
6
Verzeichnis der Abbildungen<br />
Abb. 1: Hierarchische Struktur des AHP 72<br />
Abb. 2: Bausteine und Schritte der Nachhaltigkeitsbewertung 82<br />
Abb. 3: Ziele einer zukünftigen nachhaltigen <strong>Versorgung</strong> 88<br />
Abb. 4: Teilbaum „Umweltschutz" 88<br />
Abb. 5: Teilbaum „Gesundheitsschutz" 89<br />
Abb. 6: Teilbaum „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit" 89<br />
Abb. 7: Teilbaum „Wirtschaft" 90<br />
Abb. 8: Teilbaum „Soziales" 91<br />
Abb. 9: Verteilung der Werte für die fünf Oberziele nachhaltiger <strong>Versorgung</strong> (Boxplot) 97<br />
Abb. 10: Verteilung der Werte für die Kriterien des Umweltschutzes (Boxplot) 98<br />
Abb. 11: Verteilung der Werte für die ökologischen Kriterien „Ressourcenschonung" (Boxplot) 99<br />
Abb. 12: Verteilung der Werte für die Kriterien des Gesundheitsschutzes (Boxplot) 100<br />
Abb. 13: Verteilung der Werte für die Kriterien der <strong>Versorgung</strong>ssicherheit (Boxplot) 101<br />
Abb. 14: Verteilung der Werte für die <strong>Versorgung</strong>ssicherheits-Kriterien „Mittel- bis langfristig<br />
gesicherte Verfügbarkeit" (Boxplot) 102<br />
Abb. 15: Verteilung der Werte für die Kriterien der „Wirtschaftlichen Aspekte" (Boxplot) 103<br />
Abb. 16: Verteilung der Werte für die Wirtschaftlichkeits-Kriterien „Vorbeugendes<br />
Wirtschaftshandeln" (Boxplot) 104<br />
Abb. 17: Verteilung der Werte für die Wirtschaftlichkeits-Kriterien „Funktionsfähigkeit des Marktes"<br />
(Boxplot) 105<br />
Abb. 18: Verteilung der Werte für die Kriterien „Soziale Aspekte" (Boxplot) 106<br />
Abb. 19: Verteilung der Werte für die sozialen Kriterien „Soziale Gerechtigkeit" (Boxplot) 107<br />
Abb. 20 bis 38: Mittlere Einschätzung der wissenschaftlichen Experten zu den Kriterien im<br />
Bereich „Umweltschutz" 120 bis 135<br />
Abb. 39 bis 42: Mittlere Einschätzung der wissenschaftlichen Experten zu den Kriterien im<br />
Bereich „Gesundheitsschutz" 137 bis 139<br />
Abb. 43 bis 66: Mittlere Einschätzung der wissenschaftlichen Experten zu den Kriterien im<br />
Bereich „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit" 141 bis 157<br />
Abb. 67 bis 87: Mittlere Einschätzung der wissenschaftlichen Experten zu den Kriterien im<br />
Bereich „Wirtschaftliche Aspekte" 158 bis 172<br />
Abb. 88 bis 102: Mittlere Einschätzung der wissenschaftlichen Experten zu den Kriterien im<br />
Bereich „Soziale Aspekte" 175 bis 179<br />
Verzeichnis der Kästen<br />
Kasten 1: Kategoriensystem zur Analyse von Expertendifferenzen 114<br />
7
Verzeichnis der Tabellen<br />
Tab. 1: Wesentliche Merkmale der vier Zukunftsszenarien 66<br />
Tab. 2: Struktur des Entscheidungsproblems bei multikriteriellen Entscheidungsverfahren 80<br />
Tab. 3: Beispiele für Diskurskonzepte 78<br />
Tab. 4: Beispiele für potentielle Interessengruppen und ihre Betroffenheit von Veränderungen in<br />
den <strong>Versorgung</strong>ssektoren 80<br />
Tab. 5: Liste der Praxispartner bei der Wertbaumanalyse 86<br />
Tab. 6: Liste der Praxispartner bei der Gewichtung des Wertbaumes 94<br />
Tab. 7: Kennwerte der relativen Gewichte der fünf Oberziele sektorübergreifender<br />
Nachhaltigkeit 96<br />
Tab. 8: Kennwerte der relativen Gewichte der Unterkriterien „Umweltschutz" 97<br />
Tab. 9: Kennwerte der relativen Gewichte der Unterkriterien „Ressourcenschonung" 98<br />
Tab. 10: Kennwerte der relativen Gewichte der Unterkriterien „Gesundheitsschutz" 99<br />
Tab. 11: Kennwerte der relativen Gewichte der Unterkriterien „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit" 100<br />
Tab. 12: Kennwerte der relativen Gewichte der <strong>Versorgung</strong>ssicherheits-Kriterien „Mittel- bis<br />
langfristig gesicherte Verfügbarkeit" 101<br />
Tab. 13: Kennwerte der relativen Gewichte der Unterkriterien „Wirtschaftliche Aspekte" 102<br />
Tab. 14: Kennwerte der relativen Gewichte der Wirtschaftlichkeits-Kriterien „Vorbeugendes<br />
Wirtschaftshandeln" 103<br />
Tab. 15: Kennwerte der relativen Gewichte der Wirtschaftlichkeits-Kriterien „Funktionsfähigkeit<br />
des Marktes" 104<br />
Tab. 16: Kennwerte der relativen Gewichte der Unterkriterien „Soziale Aspekte" 105<br />
Tab. 17: Kennwerte der relativen Gewichte des sozialen Kriteriums „Soziale Gerechtigkeit" 106<br />
Tab. 18: Liste der Gutachter 111<br />
Tab. 19: Anzahl der sektorübergreifenden und sektorspezifischen Experteneinschätzungen 116<br />
Tab. 20: Ergebnisse der quantitativen Abschätzung der CO 2-Emissionen aus der<br />
Stromerzeugung (Klimaschutz) 121<br />
Tab. 21: Überblick über die Experten-Einschätzungen im Bereich Umweltschutz 181<br />
Tab. 22: Überblick über die Experten-Einschätzungen im Bereich <strong>Versorgung</strong>ssicherheit 182<br />
Tab. 23: Überblick über die Experten-Einschätzungen im Bereich Wirtschaftliche Aspekte 183<br />
Tab. 24: Überblick über die Experten-Einschätzungen im Bereich Gesundheitsschutz 184<br />
Tab. 25: Überblick über die Experten-Einschätzungen im Bereich Soziale Aspekte 184<br />
Tab. 26: Einfluss von Zentralisierung und Dezentralisierung auf die Ausprägung der Kriterien 186<br />
Tab. 27: Bausteine des Ergebnisworkshops 188<br />
Tab. 28: Stärken der Szenarien aus der Sicht gesellschaftlicher Akteure 196<br />
Tab. 29: Schwächen der Szenarien aus der Sicht gesellschaftlicher Akteure 197<br />
8
Tab. 30: Vergleich der Stärken und Schwächen von Szenario A aus der Impact-Analyse mit<br />
denen aus dem Ergebnis-Workshop 200<br />
Tab. 31: Vergleich der Stärken und Schwächen von Szenario B aus der Impact-Analyse mit<br />
denen aus dem Ergebnis-Workshop 201<br />
Tab. 32: Vergleich der Stärken und Schwächen von Szenario C aus der Impact-Analyse mit<br />
denen aus dem Ergebnis-Workshop 202<br />
Tab. 33: Vergleich der Stärken und Schwächen von Szenario D aus der Impact-Analyse mit<br />
denen aus dem Ergebnis-Workshop 203<br />
Tab. 34: Ergebnis der Abstimmung über die Wünsch- und Machbarkeit der vier<br />
Zukunftsszenarien 204<br />
Tab. 35: Stellgrößen der Szenarien zu mehr Nachhaltigkeit 205<br />
9
10
Zusammenfassung<br />
Die vorliegende Studie geht der Frage nach, wie denkbare zukünftige Entwicklungen <strong>netzgebundener</strong><br />
<strong>Versorgung</strong> mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation hinsichtlich ihrer<br />
ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen zu bewerten sind. Ziel war es, die abstrakte<br />
Diskussion um Nachhaltigkeit in eine konkrete Entscheidungsunterstützung zu überführen,<br />
die der hohen Unsicherheit zukünftiger Entwicklungen gerecht wird.<br />
Im ersten Teil der Untersuchung werden bestehende Nachhaltigkeitskonzepte analysiert<br />
sowie Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung diskutiert.<br />
Im zweiten Teil wird das multi-kriterielle Entscheidungsverfahren AHP (Analytic Hierarchy<br />
Process) für die diskursive Bewertung von Chancen und Risiken von Zukunftsszenarien<br />
<strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong> weiterentwickelt und angewendet.<br />
Untersuchungsobjekt sind vier Zukunftsszenarien <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong> mit Untersuchungsraum<br />
Deutschland und Zeithorizont 2025. Diese wurden in Workshops mit Teilnehmern<br />
aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen entwickelt.<br />
Die Szenarien A und B sind charakterisiert durch einen umweltorientierten Energiemix mit<br />
Anteilen an der Stromerzeugung von 45% Erdgas, 30% erneuerbaren Energien, 24% Kohle<br />
und 0% Kernenergie. Im Bereich der Unternehmen findet eine Dekonzentration statt. Die<br />
Szenarien C und D haben beide einen eher konventionellen Energiemix mit 17% Erdgas,<br />
10% erneuerbaren Energien, 52% Kohle und 20% Kernenergie. Wenige Großunternehmen<br />
beherrschen den Markt<br />
In Szenario A besteht ein gesamtgesellschaftlicher Konsens für das Primat des Umweltschutzes.<br />
Der Anteil dezentraler Anlagen und die Dienstleistungsorientierung sind hoch. Das<br />
Wirtschaftswachstum liegt bei 2%/a. Es findet eine Siedlungsbewegung aufs Land statt.<br />
In Szenario B betreibt der Staat aktiv den Schutz von Klima und Umwelt. Der Anteil dezentraler<br />
Anlagen ist niedriger als in Szenario A, die Dienstleistungsorientierung ist gering. Das<br />
Wirtschaftswachstum liegt bei 1,5°/0/a. In der Siedlungsstruktur werden Randlagen von<br />
Ballungsräumen bevorzugt.<br />
In Szenario C fördert der Staat durch eine massive Innovations- und Technologiepolitik den<br />
Erfolg deutscher Unternehmen. Umwelt- und Gesundheitsziele bleiben moderat und sind<br />
nachrangig. Es wird in die Modernisierung zentraler Anlagen investiert, der Anteil dezentraler<br />
Anlagen ist gering. Das Wirtschaftswachstum liegt bei 2 °/0/a. In der Siedlungsstruktur werden<br />
Randlagen von Ballungsräumen bevorzugt.<br />
In Szenario D zieht der Staat sich zurück. Die Unternehmen handeln nach dem Primat der<br />
Wirtschaftlichkeit, es wird wenig investiert, alte Anlagen werden weiter betrieben. Der Anteil<br />
dezentraler Anlagen ist gering. Die Dienstleistungsorientierung ist mäßig hoch. Das Wirtschaftswachstum<br />
ist gering mit 1 c/o/a. In der Siedlungsstruktur werden die Ballungsräume<br />
bevorzugt.<br />
Das Verfahren zur Bewertung der Zukunftsszenarien besteht aus fünf Schritten, in denen<br />
wissenschaftliche und gesellschaftliche Akteure über den gesamten Zeitraum der Studie in<br />
unterschiedlichen Aufgaben eingebunden sind: In den ersten zwei Schritten wurden die<br />
Bewertungskriterien (im Hinblick auf eine nachhaltige <strong>Versorgung</strong>) erhoben und strukturiert.<br />
Im dritten Schritt wurden für die Kriterien die individuellen Gewichtungen ermittelt. Der vierte<br />
Schritt umfasst die Beurteilung, inwieweit die Szenarien diese Kriterien erfüllen (Impact-<br />
11
Analyse). Die abschließende Gesamtbewertung der Szenarien als fünfter Schritt erfolgte in<br />
einem zweitägigen moderierten Workshop.<br />
Anhand der Wertbaumanalyse wurden die Ziele erhoben, die für die Bewertung der Zukunftsszenarien<br />
herangezogen werden sollen. Im Unterschied zu einer normativen Vorgehensweise<br />
erfolgte die Ermittlung der Nachhaltigkeitskriterien diskursiv. Dazu wurden 10<br />
Vertreter gesellschaftlicher Verbände in strukturierten Einzelinterviews befragt. Um ein möglichst<br />
breites Spektrum gesellschaftlicher Interessen zu repräsentieren, wurden nicht Einzelakteure,<br />
sondern relevante Multiplikatoren, die von Veränderungen in den <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
maßgeblich betroffen sind, eingebunden. Der Kreis der Praxispartner zur Ausgestaltung<br />
des Leitbildes einer nachhaltigen <strong>Versorgung</strong> setzte sich vorwiegend aus solchen Akteuren<br />
zusammen, die sich in ihren Organisationen auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen.<br />
Involviert waren Vertreter auf Verbandsebene von <strong>Versorgung</strong>sunternehmen, der Industrie,<br />
des öffentlichen und privaten Konsums, der Umwelt, der Gewerkschaften, der Politik<br />
sowie von Organisationen zur Förderung sozialer Aspekte der Daseinsvorsorge und von<br />
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten bei der Entwicklung von Ländern der Dritten Welt.<br />
Die jeweiligen Inputs der Akteure wurden von den Forschern im zweiten Schritt zu einer<br />
Gesamthierarchie (Wertbaum) zusammengefasst, mit der die Akteure bereit waren, weiterzuarbeiten.<br />
Der Wertbaum besteht auf der obersten Hierarchieebene aus den fünf Bereichen: „Umweltschutz",<br />
„Gesundheitsschutz", „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit", „wirtschaftliche Aspekte" und „soziale<br />
Aspekte". Diese wurden in zwei untergeordneten Ebenen weiter differenziert und operationalisiert.<br />
Sektorübergreifende wie sektorspezifische Kriterien sind berücksichtigt. Der Wertbaum<br />
wurde von allen Akteuren als äußerst hilfreich für die weitere Debatte um die Zukunft der<br />
<strong>Versorgung</strong> angesehen.<br />
Im dritten Schritt wurde anhand eines Fragebogens sowie in Einzelinterviews erhoben, worauf<br />
es den Akteuren vor ihrem jeweiligen Interessenshintergrund besonders ankommt, d.h.<br />
welche individuellen Gewichtungen die Akteure den einzelnen Kriterien für die Bewertung<br />
der vier Zukunftsszenarien zuordnen. Mit der direkten Methode der Rang- und Punktgewichtung<br />
wurden alle Kriterien des Wertbaumes gewichtet. Neben den 10 Verbänden, die bei der<br />
Erstellung des Wertbaums mitgewirkt haben, nahmen weitere 12 gesellschaftliche Verbände<br />
teil.<br />
Die Ergebnisse zeigen bei den abstrakten Zielen im Mittel nur geringe Unterschiede zwischen<br />
den fünf Zielbereichen nachhaltiger <strong>Versorgung</strong>. Unterschiede zeigen sich auf den<br />
konkreten Ebenen. Auf der zweiten Hierarchieebene waren den Befragten im Mittel im Bereich<br />
„Umweltschutz" der „Klimaschutz" und die „Ressourcenschonung" am wichtigsten.<br />
Beim „Gesundheitsschutz" sollte nach Auffassung der Akteure im Mittel vor allem der „Schutz<br />
vor Belastung des Roh- bzw. Trinkwassers" gewährleistet sein. Hinsichtlich „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit"<br />
wurde die „mittel- bis langfristig gesicherte Verfügbarkeit" als das Wichtigste eingestuft.<br />
Im Bereich „wirtschaftliche Aspekte" maßen die Akteure der „Sicherung und Steigerung<br />
der Beschäftigung" und der „Effizienz der Leistungserstellung" die größte Bedeutung zu; bei<br />
der Gewichtung der „Beschäftigung" gab es jedoch abweichende Meinungen, die diesen<br />
Aspekt im Vergleich zum Durchschnitt weniger wichtig einstuften. Bei den „sozialen Aspekten"<br />
sind es die „soziale Gerechtigkeit" und der „Erhalt sozialer Ressourcen", die im Mittel<br />
das höchste Gewicht erhielten. So einig man sich über die Bedeutung der sozialen Gerechtigkeit<br />
war, so unterschiedlich wurden jedoch die Aspekte beurteilt, die die soziale Gerechtigkeit<br />
ausmachen.<br />
12
Im vierten Schritt des Verfahrens erfolgte die Impact-Analyse. Es wurden 11 wissenschaftliche<br />
Experten beauftragt, die Erfüllung der Nachhaltigkeitskriterien durch die vier Szenarien<br />
einzuschätzen. Die unterschiedlichen Qualifikationen der Experten deckten alle Bereiche des<br />
Wertbaums und die vier Sektoren (Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation) ab. Grundlage<br />
für die Impact-Analyse war das AHP-Verfahren, das mit einer Unsicherheitsanalyse<br />
gekoppelt wurde. Anhand der AHP-Skala waren die Szenarien im Paarvergleich zu bewerten<br />
und darüber hinaus die jeweiligen Einschätzungen zu begründen sowie die Beurteilungs(un)sicherheit<br />
anzugeben.<br />
Die Experten konnten in den meisten Fällen keine quantitativen Einschätzungen der absoluten<br />
Höhe der Ausprägungen abgeben aufgrund der hohen Unsicherheit der Szenarien. Die<br />
AHP-Methode erlaubte aber Paarvergleiche zwischen den Szenarien anhand eines standardisierten<br />
Beurteilungsformates und – bei gleicher Rangfolge – die Aggregation der Einschätzungen<br />
mehrerer Experten für dasselbe Kriterium. Unterschiede zwischen Einschätzungen<br />
mehrerer Experten konnten anhand der Begründungen kategorisiert werden und ermöglichten<br />
so den systematischen Umgang mit Expertendissens.<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass der Sektor Telekommunikation zwar als Enabler für z. B. virtuelle<br />
Kraftwerke und Demand Side Management wichtig ist, davon abgesehen aber in den<br />
Einschätzungen der Experten kaum Einfluss auf die Ausprägung der Nachhaltigkeitskriterien<br />
hat.<br />
Die Szenarien A und B werden bei der Mehrzahl der Kriterien besser eingeschätzt als C und<br />
D, jedoch hat insbesondere Szenario A auch Schwächen.<br />
Im Bereich „Umweltschutz" bestimmt der Sektor Strom und Gas durch den Energiemix und<br />
den Gesamtstromverbrauch die Kriterien „Minderung der CO 2-Emissionen", „Schonung von<br />
Rohstoffen" und (im Bereich „Gesundheitsschutz") „Schutz vor Luftimmissionen". Hier weist<br />
Szenario A eindeutige Stärken aus. Szenario B ist dahingehend etwas weniger positiv bewertet,<br />
während die Szenarien C und D schlecht abschneiden. Bei „Landschaftsschutz", „Artenschutz"<br />
und „Schonung von Flächen" zeigt Szenario A Schwächen wegen der dezentralen<br />
Siedlungsstruktur, ebenfalls beim „Materialverbrauch", der bei kleinen dezentralen Anlagen<br />
höher ist als bei großen zentralen. Bei diesen Kriterien liegt Szenario D vorn.<br />
Bei den Kriterien aus dem Bereich „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit" wurden im Sektor Strom und Gas<br />
entweder nur geringe Unterschiede zwischen den Szenarien festgestellt, oder es gab Differenzen<br />
zwischen den Einschätzungen der Experten. So waren die Experten beispielsweise<br />
unterschiedlicher Auffassung darüber, ob die Kriterien „Sicherheit des Netzes", „Sicherheit<br />
der Anlagen", „Reversibilität innerhalb des <strong>Versorgung</strong>ssystems" und „technologische Diversität"<br />
besser durch kleine, dezentrale Anlagen und erneuerbare Energien oder durch große,<br />
zentrale Anlagen und konventionelle Energieträger zu erfüllen sind. Im Sektor Wasser ist in<br />
Szenario A bei starker Dezentralisierung die „Sicherheit des Netzes" positiv und die „Sicherheit<br />
der Anlagen" negativ, in Szenario C bei geringer Dezentralisierung ist es genau umgekehrt,<br />
in den Szenarien B und D sind beide Kriterien mäßig negativ eingeschätzt. Die „Unabhängigkeit<br />
von knappen Ressourcen" wird im Sektor Strom ebenfalls vom Energiemix bestimmt,<br />
im Sektor Wasser vom Einsatz dezentraler Anlagen, in beiden Sektoren wird Szenario<br />
A am besten und Szenario C am schlechtesten eingeschätzt.<br />
Im Bereich „wirtschaftliche Aspekte" wird die „Sicherung und Steigerung der Beschäftigung"<br />
nach Einschätzung der Experten von hohem Wirtschaftswachstum und vom Einsatz dezentraler<br />
Anlagen begünstigt. Entsprechend wird hier Szenario A am besten eingeschätzt, Sze-<br />
13
nario D am schlechtesten. Allerdings sei der Beitrag der <strong>Versorgung</strong>ssysteme zu den gesamtwirtschaftlichen<br />
Arbeitsplatzzahlen gering. Auch die Einkommensentwicklung ist in<br />
Szenario A am besten, in Szenario D am schlechtesten. Hinsichtlich „pluralistischer Marktstruktur"<br />
werden die Szenarien A und B positiv, C und D negativ eingeschätzt, hinsichtlich<br />
„internationaler Wettbewerbsfähigkeit" sind C und D günstig, A und B ungünstig.<br />
Im Bereich „soziale Aspekte" sind die Szenarien C und D durchweg negativ eingeschätzt.<br />
Szenario A ist bei den meisten Kriterien (sozialverträgliche Preise, internationale Verteilungsgerechtigkeit,<br />
Partizipation, soziale Sicherheit, Erhalt der sozialen Ressourcen) die bessere<br />
Zukunftsoption, Szenario B schnitt am besten ab bei „sozialer Gerechtigkeit", „Gleichheit der<br />
Lebensverhältnisse" und „Transparenz". Außerdem wurde die in Szenario B modellierte<br />
staatliche Regie als besser praktikabel eingeschätzt als der in Szenario A vorausgesetzte<br />
gesamtgesellschaftliche Konsens.<br />
Die Beurteilung der Szenarien aus der Sicht gesellschaftlicher Akteure vor dem Hintergrund<br />
der Experteneinschätzungen fand in einem abschließenden Bewertungsworkshop statt. An<br />
diesem nahmen vier der Experten teil, die Gutachten zur Impact-Analyse erstellt hatten,<br />
sowie 12 der gesellschaftlichen Akteure, die im Vorfeld an der Erstellung des Wertbaumes<br />
bzw. an der Gewichtung der Ziele mitgewirkt hatten. Im Workshop attestierten die Akteure<br />
den Szenarien die aus ihrer Sicht wichtigsten Stärken und Schwächen und diskutierten,<br />
warum sie gerade diese für wichtig halten.<br />
Die Diskussion zeigte, dass es gerade der Klimaschutz ist, der für die Einschätzung der<br />
Chancen und Risiken der Zukunftsszenarien maßgeblich ist. Zukunftspfaden wie Szenario C<br />
oder D, die bezüglich des Klimaschutzes deutlich schlechter abschneiden, wird dies als<br />
bedeutsame Schwäche attestiert. Hingegen wird der bessere Klimaschutz bei Szenario A<br />
und B von allen Beteiligten als Vorteil dieser Zukunftspfade angesehen. Alle Akteure waren<br />
der Auffassung, dass in einer Langfristperspektive die Verletzung des Klimaschutzes<br />
Nachteile auch in anderen Zielbereichen, wie Wirtschaft und Soziales, mit sich bringen wird.<br />
In der Prioritätensetzung zeigten sich aber auch kontroverse Auffassungen. Insbesondere die<br />
Gewichtung des Risikos einer mangelnden kostengünstigen Verfügbarkeit von Rohstoffen<br />
(Brennstoffen) für die Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren als Produzenten sowie von<br />
<strong>Versorgung</strong>sleistungen für deren Kunden stellt eine Konfliktlinie dar. Dieses Risiko, das bei<br />
Szenario A von den wissenschaftlichen Experten nicht einheitlich ausgeschlossen werden<br />
kann, wird von Wirtschaftsvertretern hervorgehoben. Kontoverse Auffassungen bezüglich<br />
dieses Aspektes ließen sich auch durch den Austausch von Argumenten nicht ausräumen.<br />
Darüber hinaus wurde in der Gesamteinschätzung der Szenarien diskutiert, für wie machbar<br />
und für wie wünschenswert die Akteure die Szenarien halten. Szenario A wurde von allen<br />
zwar für das wünschenswerteste, aber auch für das am wenigsten machbare gehalten.<br />
Szenario B liegt hinsichtlich Wünschenswertigkeit an zweiter Stelle und wird am Ende des<br />
Workshops am ehesten für machbar gehalten. Im Ergebnis waren alle gesellschaftlichen<br />
Akteure der Auffassung, dass sie auf der Basis der im Gesamtverfahren vorliegenden sehr<br />
differenziert erarbeiteten Ergebnisse ein konkretes Nachhaltigkeitsprogramm ausarbeiten<br />
könnten und wollten.<br />
14
Überblick über den Bericht<br />
Der nachfolgende Bericht gliedert sich in folgende zwei Teile:<br />
Teil I<br />
Teil I gibt einen Überblick über Nachhaltigkeitskonzepte und bestehende Methoden zur Bewertung<br />
von Nachhaltigkeit.<br />
Im ersten Kapitel werden bestehende Nachhaltigkeitskonzepte analysiert. Dabei werden<br />
insbesondere Grundlinien und differierende Ausgestaltungen des Nachhaltigkeitsverständnisses<br />
anhand von Paradigmen unterschiedlicher Disziplinen herausgearbeitet.<br />
Im zweiten Kapitel werden Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung diskutiert. Dabei wird<br />
aufgrund der projekteigenen Nachhaltigkeitskonzeption ein besonderes Gewicht auf die<br />
Beschreibung akteursabhängiger Verfahren gelegt. Akteursunabhängige Verfahren werden<br />
im Hinblick auf ihre Eignung für die vorliegende Aufgabenstellung der Bewertung von Zukunftsszenarien<br />
dargestellt.<br />
Teil II<br />
Teil II stellt die empirische Untersuchung dar.<br />
Im ersten Kapitel werden Untersuchungsgegenstand, d. h. die vier Zukunftsszenarien, sowie<br />
Ziel und Fragestellung der Untersuchung dargestellt (Kapitel 1).<br />
Schließlich erfolgen die Darstellung der methodischen Grundzüge des in der Untersuchung<br />
gewählten Verfahrens und die Beschreibung der hier vorgeschlagenen Konzeption (Kapitel<br />
2).<br />
In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Bausteine des Verfahrens im Hinblick auf<br />
den gewählten Ansatz, die Durchführung, die Auswertung und die Ergebnisse dargestellt<br />
(Kapitel 3 bis 7).<br />
15
16
Teil I Nachhaltigkeit — Konzepte und Instrumente<br />
17
Teil I Nachhaltigkeit — Konzepte und Instrumente: 1. Nachhaltigkeitskonzepte<br />
18
1.1 Thematisierung von Nachhaltigkeit in den jeweiligen Disziplinen<br />
1. Nachhaltigkeitskonzepte<br />
Bevor die Ausgestaltung der einzelnen konstitutiven Elemente von Nachhaltigkeit aufgrund<br />
der Paradigmen der jeweiligen Disziplin diskutiert werden, soll der Fokus auf den methodischen<br />
Rahmen der jeweiligen Disziplinen gerichtet werden. Interdisziplinarität oder Grad<br />
methodischer Offenheit prädeterminiert, ob die Einführung des Nachhaltigkeitsbegriffs einen<br />
Zusatz an wissenschaftlicher Erkenntnis bedeutet oder nur das „Füllen alten Weins in neue<br />
Schläuche" darstellt.<br />
1.1 Thematisierung von Nachhaltigkeit in den jeweiligen<br />
Disziplinen<br />
Die traditionellen neoklassisch fundierten wohlfahrtstheoretischen Ansätze stellen ein methodisch<br />
geschlossenes Theoriegebäude dar, das menschliches Handeln ausschließlich als<br />
ökonomisches erfasst. Umwelt- und sozio-ökonomische Probleme werden primär als Allokationsproblem<br />
begriffen, also als ein Problem der Disposition des Menschen über knappe<br />
Ressourcen. Gesucht wird z. B. das optimale Umweltschutzniveau, die optimale Ressourcenabbaurate<br />
etc.. Ist die Optimierung gelungen, so ist das angestrebte Ziel der Wohlfahrtssteigerung<br />
erreicht. Allenfalls werden distributive Aspekte in die Analyse mit einbezogen, die<br />
Fragen der Verteilung von beispielsweise Nutzungsrechten an der Umwelt zu beantworten<br />
suchen (Theorie der Gerechtigkeit von Rawls (1999)). Daraus abgeleitete Managementregeln,<br />
die zu Konzepten „schwacher Nachhaltigkeit" (SRU, 2002, Tz. 6 ff.) führen,<br />
bieten aus methodischer Sicht nichts neues, sondern werden im Rahmen neoklassischer<br />
Paradigmen entwickelt. Folglich wird die Einführung des Nachhaltigkeitsbegriffs als überflüssig<br />
angesehen, da das bereits existierende Gedankengebäude der neoklassischen Ökonomie<br />
alle Fragen des menschlichen Handelns zu beantworten in der Lage ist.<br />
Das Theoriegebäude der Ökologischen Ökonomie ist dagegen interdisziplinär sowie theoretisch<br />
und methodisch offen (Rennings, 1994). So betrachten Vertreter der ökologischen<br />
Ökonomie menschliches Handeln nicht nur unter allokativen und distributiven Gesichtspunkten,<br />
sondern sie gehen darüber hinaus und beziehen gewöhnlich Schlüsselbegriffe aus der<br />
Ökologie, wie ökologisches Gleichgewicht (Binswanger et al., 1981), Stabilität und Resilienz<br />
von Ökosystemen (Common & Perrings, 1992), Selbstregulation und Homöostase (Hampicke,<br />
1992) oder naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten, wie z. B. die Entropie (Binswanger,<br />
1993) mit ein. Die Einführung des Nachhaltigkeitsbegriffs erhält seine Berechtigung<br />
durch den Einbezug von Nachhaltigkeitsvorstellungen aus anderen Disziplinen, wie der Ökologie,<br />
in Ergänzung zu Elementen der neoklassischen Ökonomie, die ohne die Einführung<br />
des Nachhaltigkeitsbegriffs auskäme.<br />
In der Ökologie wurde der Begriff Nachhaltigkeit als erster gebraucht. Er wurde in der Forstwirtschaft<br />
angewendet und beschreibt eine Bewirtschaftungsweise des Waldes, die auf „kontinuierliche,<br />
beständige und nachhaltende Nutzung" abzielt (von Carlowitz, 1713, S. 105).<br />
Der Nachhaltigkeitsbegriff erfuhr über die Deutung als eine Bewirtschaftung des Waldes, „in<br />
der nicht mehr Holz geschlagen wird als aus dem Forste für immer genommen werden kann"<br />
(Hartig & Hartig, 1834, S. 523) in neuerer Zeit eine Erweiterung, in dem Nachhaltigkeit auf<br />
sämtliche materielle und immaterielle Waldleistungen ausgedehnt wird (Peters, 1984). Doch<br />
19
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 1. Nachhaltigkeitskonzepte<br />
wurde der Begriff stärker durch andere Disziplinen entlehnt als dass er in weiteren Feldern<br />
der Ökologie selbst Anwendung findet.<br />
Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive bezieht sich Nachhaltigkeit in erster Linie auf gesellschaftliche<br />
Prozesse. Die entscheidende Frage der Nachhaltigkeitsdebatte besteht aus<br />
sozialwissenschaftlicher Sicht darin, wie Gesellschaften die Gestaltung der materiellen Bedingungen<br />
ihrer Reproduktion transformieren können und welche ökonomischen, politischen,<br />
kulturellen und ethischen Grundlagen die Verteilung von Umweltressourcen bestimmen. Der<br />
Fokus richtet sich nicht so sehr wie in der Ökonomie und Ökologie auf die Optimierung der<br />
ökonomischen Inanspruchnahme der Umwelt oder die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen<br />
bzw. auf das Management von Ökosystemen. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive<br />
werden vielmehr Aspekte wie Lebensqualität und die Fähigkeit politischer Institutionen<br />
zur Unterstützung nachhaltigkeitsorientierter Transformationsprozesse betrachtet und<br />
nicht nur die physischen Auswirkungen ökonomischer und ökologischer Aktivitäten. Ebenso<br />
erfährt die Rolle von Wissenschaft aus sozialwissenschaftlicher Sicht im Zusammenhang mit<br />
der Nachhaltigkeitsdebatte erneut eine Veränderung ihres Verständnisses. Über die Aufgabe<br />
der Wissenschaftler eine problembezogene und innerhalb der Wissenschaft interdisziplinär<br />
orientierte Arbeitsweise zu entwickeln, wie sie in der ökologischen Ökonomie hervorgehoben<br />
wird, gewinnt darüber hinaus die Erkenntnis an Bedeutung, dass die Einbeziehung von und<br />
die Auseinandersetzung mit nichtwissenschaftlichen Experten wie Bürgern, Praxisakteuren<br />
aus der Wirtschaft, NGOs, politischen Entscheidungsträgern vorzunehmen ist (Becker &<br />
Jahn, 1999). Denn Erkenntnisse durch Beobachtung von menschlichen Aktivitäten sowie<br />
Tieren und Pflanzen, die zu Nachhaltigkeitsnormen führen, werden nicht mehr nur durch<br />
naturwissenschaftlich abgeleitete Kausalitätsbeziehungen legitimiert, sondern durch einen<br />
partizipativen Prozess gesellschaftlicher Normermittlung.<br />
1.2 Paradigmen und die verschiedenen Konzepte von<br />
Nachhaltigkeit<br />
Unterschiede im methodischen Rahmen der einzelnen Disziplinen wirken sich nicht nur auf<br />
den Grad der Nutzung des Nachhaltigkeitsbegriffs aus, sondern schlagen sich auch in den<br />
einzelnen Paradigmen nieder, die in der jeweiligen Disziplin zu unterschiedlichen Interpretationen<br />
konstitutiver Elemente von Nachhaltigkeit (wie z. B. Inter- und Intragenerative Gerechtigkeit,<br />
Nachhaltigkeitsdimensionen) führen. Im folgenden werden nicht nur die in den jeweiligen<br />
wissenschaftlichen Disziplinen in großer Breite diskutierten Paradigmen aufgezeigt,<br />
sondern auch neuere oder solche, die bislang nicht so häufig explizit angesprochen wurden,<br />
in die Darstellung aufgenommen.<br />
In der Debatte um Nachhaltigkeit wird nachfolgend zunächst mit der Diskussion um Verfahren<br />
zur Ableitung von Nachhaltigkeitsprinzipien begonnen. Anschließend wird in den einzelnen<br />
Disziplinen auf den Zweck eingegangen, dem eine Nachhaltigkeitskonzeption dienen<br />
soll. Soll sie Leitbilder für eine Nachhaltige Entwicklung formulieren oder soll sie einem anderen<br />
Zweck, wie der gesellschaftlichen Regulationsaufgabe, gerecht werden? Bei Nachhaltigkeitskonzepten,<br />
die eine Formulierung von Leitbildern vornehmen, werden des Weiteren<br />
dafür relevante Zieldimensionen diskutiert. Der Einschluss bestimmter Zieldimensionen und<br />
ihr Verhältnis untereinander in den Nachhaltigkeitskonzeptionen der einzelnen Disziplinen<br />
fußt auf weiteren Paradigmen, die die Interaktion der unterschiedlichen Sphären (ökologische,<br />
ökonomische einschließlich sozialer Aspekte) kennzeichnen. Dazu werden verschie-<br />
20
1.2 Paradigmen und die verschiedenen Konzepte von Nachhaltigkeit<br />
dene Elemente der jeweiligen Sphären betrachtet. Bezüglich der ökologischen Sphäre steht<br />
im Mittelpunkt der Betrachtung das Naturverständnis einschließlich der Frage der Substituierbarkeit<br />
sowie die Betrachtung der Natur als Objekt oder Subjekt. Beim Fokus auf die<br />
ökonomische Sphäre werden Interaktionsbeziehungen herausgestellt, indem aus der Makroperspektive<br />
zunächst das in den einzelnen Disziplinen herrschende Verständnis bzgl. des<br />
gesamten Wirtschaftsprozesses verdeutlicht wird und nicht zuletzt der Entwicklungsbegriff<br />
mit der Frage qualitativen/quantitativen Wachstums sowie die Frage nach der Art des Anstoßes<br />
einer Entwicklung (exogen oder endogen) in das Zentrum der Analyse gestellt werden.<br />
In der Mikroperspektive werden Nachhaltigkeitskonzepte der einzelnen Disziplinen im Hinblick<br />
auf deren Priorisierungsgrad von Allokationsproblemen gegenüber Distributionsgesichtspunkten<br />
erörtert und die institutionellen Randbedingungen beleuchtet, die die Allokation<br />
beeinflussen. Schließlich wird herausgestellt, welcher Natur die Entscheidungen sind, die zu<br />
bestimmten Allokations- und Distributionsergebnissen führen, ob sie individuell oder als<br />
kollektive getroffen werden, und ob diese auf rationalem oder intuitivem Verhalten gründen.<br />
Paradigma: Ableitung von Nachhaltigkeitsprinzipien (Quasi-objektiv vs. explizitnormativ)<br />
Ein konstitutives Element von Nachhaltigkeit ist die inter- und intragenerative Verteilungsgerechtigkeit.<br />
Unter anderem werden Umweltnutzungsansprüche einerseits zwischen Industrieländern<br />
und Entwicklungsländern (intragenerative Gerechtigkeit) und andererseits zwischen<br />
gegenwärtigen und zukünftigen Generationen (intergenerative Gerechtigkeit) eingehender<br />
untersucht. Die Bestimmung solcher Ansprüche fußt entweder auf dem Paradigma einer<br />
quasi-objektiven oder auf einer explizit-normativen Herangehensweise.<br />
Argumentationen der ökologischen Ökonomie in Bezug auf inter- oder intragenerative Verteilungsgerechtigkeit,<br />
die sich als quasi-objektiv bezeichnen lassen, gehen davon aus, dass<br />
sich die gerechte Verteilung von Ressourcen, Gütern, Umweltnutzungsrechten etc. aus der<br />
Tragfähigkeit oder den Belastungsgrenzen natürlicher und gesellschaftlicher Systeme ermitteln<br />
lässt. Nachhaltigkeit wird also im funktionalistischen Ansatz negativ definiert. Beispielsweise<br />
werden Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft als unterschiedliche, strukturierte, eigenständige<br />
aber miteinander gekoppelte Subsysteme betrachtet, deren Funktionsfähigkeit und<br />
Störungsresistenz es im Interesse zukünftiger Generationen zu erhalten gilt. Als Ziel einer<br />
nachhaltigen Entwicklung wird der langfristige Systemerhalt von Umwelt, Gesellschaft und<br />
Wirtschaft formuliert (Brandl et al., 2001).<br />
Eine solche Herangehensweise verfolgt beispielsweise der Ansatz des Umweltbundesamtes,<br />
dessen Aussagen über operationalisierte Ziele zur Minderung von Treibhausgasen und von<br />
Schadstoffemissionen in der Studie über „Langfristszenarien für eine nachhaltige Energienutzung<br />
in Deutschland" des Jahres 2002 sich an wissenschaftlichen Aussagen (z. B. vom<br />
IPCC 1 ) zu Belastungsgrenzen der Ökosysteme orientieren (UBA, 2002). Im Wasserbereich<br />
orientiert sich die Studie des Umweltbundesamtes „Nachhaltige Wasserversorgung in<br />
Deutschland" aus dem Jahre 2001 bei der Formulierung von Zielen an gesetzlichen Vorgaben<br />
in den Bereichen Ressourcenschutz (Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetze),<br />
Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung (Trinkwasserverordnung, DIN 2000) sowie Hausinstallation<br />
(z. B. Grenzwerte der Trinkwasserverordnung, DIN 1988). Die Vorgaben stützen<br />
1 Intergovernmental Panel an Climate Change, http://www.ipcc.ch<br />
21
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 1. Nachhaltigkeitskonzepte<br />
sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der menschlichen Gesundheit und der<br />
Belastungsfähigkeiten der heimischen Ökosysteme (UBA, 2001).<br />
Dem gegenüber gehen Nachhaltigkeitskonzepte mit explizit-normativer Überzeugung, wie sie<br />
in den Sozialwissenschaften zu finden sind, im Fall intra- oder intergenerationeller Gerechtigkeit<br />
davon aus, dass sich beispielsweise die Frage, auf welche Hinterlassenschaften<br />
kommende Generationen einen Anspruch haben, nicht durch objektiv angebbare Belastungsgrenzen<br />
natürlicher und gesellschaftlicher Systeme beantworten lässt. Es ist vielmehr<br />
eine normative Bestimmung ökonomischer, sozialer und kultureller Werte zugrunde zu legen.<br />
Nachhaltigkeit wird versucht positiv zu bestimmen, indem Mindestbedingungen eines menschenwürdigen<br />
Lebens heraus gearbeitet werden, auf deren Gewährleistung heutige wie<br />
künftige Generationen moralischen Anspruch haben (Brandl et al., 2001). Dies kann zum<br />
einen durch Ableitung von konkreten Zielen, Regeln und Kriterien aus konstitutiven Elementen<br />
von Nachhaltigkeit (wie inter- und intragenerative Gerechtigkeit, Drei-Säulen-Konzept<br />
etc.) auf wissenschaftlicher Basis erfolgen (z. B. Nitsch & Rösch, 2001) oder zum anderen<br />
mittels diskursiver Prozesse (z. B. Wachlin & Renn, 1999; Renn, 2002).<br />
Wissenschaftlich abgeleitete Regeln sollen dabei verschiedene Funktionen erfüllen. Einerseits<br />
sollen sie als Leitorientierung für weitere Konkretisierungen dienen. Andererseits üben<br />
sie auch die Funktion von Prüfkriterien aus, mit denen nachhaltige und weniger nachhaltige<br />
Zustände und Entwicklungen ermittelt werden können, wobei die Befolgung der Regeln als<br />
Mindeststandards anzusehen sind. Über die Gewährleistung dieser Minimumstandards für<br />
alle Mitglieder der globalen Gesellschaft einschließlich der kommenden Generationen hinaus<br />
kann es vielfältige andere legitime und erstrebenswerte individuelle oder gesellschaftliche<br />
Ziele geben, deren Erfüllung jedoch nicht bestimmend für das Leitbild einer nachhaltigen<br />
Entwicklung anzusehen ist.<br />
Allerdings führt die Aufstellung von Regeln dazu, dass bei der Forderung der gleichzeitigen<br />
Erfüllbarkeit aller Regeln Zielkonflikte auftreten. Diese sind nur zu lösen, indem die Regeln<br />
graduell erfüllt werden, d. h. dass die Begründung von Entscheidungen in Konfliktlagen abgewogen<br />
werden muss mit Begründungen, die einer anderen Regel zuzuordnen sind. Dieser<br />
Abwägungsprozess kann letztendlich im wesentlichen nur aufgrund normativer Werthaltungen<br />
erfolgen, die wiederum Ergebnis gesellschaftlicher Diskurse sind, so dass theoretische<br />
Ableitungen von Zielen einer nachhaltigen Entwicklung auf der konkretesten Ebene ohne<br />
diskursive Verfahren nicht auskommen (Brandl et al., 2001).<br />
Manche Autoren sehen zudem im Rahmen explizit-normativer Ableitungen mit dem erweiterten<br />
Konzept von Nachhaltigkeit, das die beiden Komponenten „Nachhaltigkeit" (als Form des<br />
Bewahrens) und „Entwicklung" (als Form des Wandels und der Dynamik) umfasst und den<br />
Fokus auf alle drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales ausdehnt, die Grenze deduktiver<br />
Konzepte einer stringenten Ableitung aus theoretischen Vorgaben erreicht (Renn, 2002).<br />
So wird in der Nachhaltigkeitskonzeption die Notwendigkeit der Zielbestimmung mit Hilfe von<br />
diskursiven Verfahren gesehen. Begründet wird dieses Vorgehen damit, dass diskursive<br />
Verfahren, die kollektiv verbindliches Handeln im Dialog festlegen, für die Umsetzung von<br />
Nachhaltigkeit deshalb so wichtig sind, da es keine verbindlichen Bewertungsmaßstäbe gibt,<br />
nach denen eine Gesellschaft ohne Irrtum bestimmen könnte, was an Natur, Wirtschaft und<br />
Sozialwesen erhaltenswert, schutzwürdig oder entwicklungsfähig wäre. Als weiteres Argument<br />
für die Anwendung von Diskursen zur Normableitung wird angeführt, dass eine nachhaltige<br />
Politik von den jeweiligen Randbedingungen (z. B. Verbrauch von Ressourcen ist in<br />
Industrieländern 10 mal höher als in Entwicklungsländern) abhängig ist und sich daher keine<br />
22
1.2 Paradigmen und die verschiedenen Konzepte von Nachhaltigkeit<br />
allgemeinen Verhaltensregeln ableiten lassen. Begründung und Bestimmung der Eingriffstiefe<br />
in die Natur sind somit als kulturelle Aufgabe anzusehen. Entscheidungen über Naturerhalt<br />
und Naturnutzung erfordern Prozesse kollektiver Bewertung und Abwägung. Die Gesellschaft<br />
muss sich über Präferenzen und Gewichtungen von Werten verständigen, was noch vielmehr<br />
gilt, wenn über die ökologische Komponente von Nachhaltigkeit hinaus die ökonomische<br />
und soziale in die Betrachtung mit einbezogen werden soll. Außerdem sind die meisten<br />
Individuen nur zu Einschränkungen bereit, wenn sie an der Formulierung und Begründung<br />
von nachhaltigen Zielvorstellungen selbst mitgearbeitet haben. Ferner sind Menschen nur<br />
dann geneigt, ihre Verhaltensweisen zu ändern, wenn sie den Sinn und Zweck im Rahmen<br />
des sozialen Umfeldes erleben und nachempfinden können (Macnaghten & Jacobs, 1997;<br />
Renn, 2002).<br />
Diskursive Formen der Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung sind die „Entscheidungsfindung<br />
nach formalen Entscheidungsregeln", „Entscheidungsfindung durch Verlass auf im<br />
politischen Meinungsprozess gewachsene Minimalkonsense" sowie die „Entscheidungsfindung<br />
durch Diskurs zwischen beteiligten Gruppen" oder eine Mischform aus diesen.<br />
Bei der ersten Variante wird die Legitimation der Entscheidung alleinig als eine Frage des<br />
Verfahrens angesehen (Luhmann, 1983). Es muss daher lediglich ein gesellschaftlicher<br />
Konsens über die Struktur des Verfahrens hergestellt werden. An den Entscheidungen selbst<br />
sind nur diejenigen beteiligt, die im Rahmen des beschlossenen Verfahrens gesellschaftlich<br />
dazu ausdrücklich legitimiert sind. Im zweiten Verfahren besteht der Meinungsprozess in der<br />
Bildung von Minimalkonsensen (Lindbloom, 1965). So werden als legitim nur solche Entscheidungsalternativen<br />
angesehen, die den geringsten Widerstand in der Gesellschaft erwarten<br />
lassen. Die Dritte Variante setzt auf einen Diskurs zwischen beteiligten Gruppen (Habermas,<br />
1989; Habermas, 1991) Die Legitimation von kollektiv verbindlichen Entscheidungen<br />
beruht dabei auf den zwei Bedingungen der Zustimmung aller Beteiligten und der eingehenden<br />
Begründung der im Diskurs gemachten Aussagen (Habermas, 1991). Um den Schwächen<br />
hinsichtlich der Legitimation der jeweiligen Formen diskursiver Verfahren zu begegnen,<br />
erscheint eine Mischung aus all dieser Grundtypen am aussichtsreichsten. Dies ermöglicht,<br />
dass Kriterien bezüglich des Verfahrens der Entscheidungsfindung, wie Existenz eines weitgehenden<br />
Grundkonsenses in der Bevölkerung, Transparenz und Nachvollziehbarkeit, Fairness,<br />
Kompetenz und Effizienz gegenüber Nichtbeteiligten erfüllt werden. Darüber hinaus ist<br />
das Produkt des Entscheidungsprozesses als in seinen Konsequenzen überschaubar, nachvollziehbar<br />
und begründbar anzusehen und es können sich die pluralen Wertvorstellungen<br />
der Betroffenen im Sinne eines fairen Konsenses oder Kompromisses wiederspiegeln (Renn,<br />
2002).<br />
Hinsichtlich der gesellschaftlichen Umsetzbarkeit des Nachhaltigkeits-Leitbildes wird in der<br />
jüngeren sozialwissenschaftlich orientierten Nachhaltigkeitsdiskussion darauf hingewiesen,<br />
dass Aussagen nur möglich sind, wenn ökonomische, ökologische und soziale Zielkonflikte<br />
analysiert und gesellschaftliche Strategien zur Entschärfung derartiger Zielkonflikte aufgezeigt<br />
werden können (Brand, 1997; Huber, 1995 und 2001; Jörissen et al., 2001; Knaus &<br />
Renn, 1998; Kraemer, 1997 und 1998; Münch, 1996; Renn, 1996) (in Kraemer & Metzner,<br />
2002).<br />
23
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 1. Nachhaltigkeitskonzepte<br />
Paradigma: Nachhaltige Entwicklung als Leitbild vs. gesellschaftliche<br />
Regulationsaufgabe<br />
Nachdem Möglichkeiten der methodischen Herangehensweisen zur Ableitung von Inhalten<br />
diskutiert wurden, wendet sich die Analyse als nächstes dem Zweck zu, dem Nachhaltigkeit<br />
dienen soll.<br />
Nachhaltige Entwicklung wird zum einen als normatives Leitbild (Korff, 1995; Knaus & Renn,<br />
1998) aufgefasst. An diesem orientieren sich eine zunehmende Zahl an Politik- und Technikbereichen<br />
(UBA, 2002; Coenen, 2001).<br />
Aus einem institutionentheoretischen Blickwinkel kann Nachhaltigkeit zum anderen als gesellschaftliche<br />
Regulationssaufgabe, die ein Steuerungsproblem zu lösen hat, begriffen<br />
werden. Bei diesem Verständnis bedeutet Nachhaltigkeit verschiedene gesellschaftliche<br />
Handlungen aufeinander zu beziehen, um Interdependenzen wahrzunehmen und langfristige<br />
Folgewirkungen in heutigen Handlungsprozessen zu berücksichtigen (in: Voß et al., 2002).<br />
Paradigma: Monodimensional vs. multi-dimensionale Zieldimensionen in Bezug auf<br />
eine nachhaltige Entwicklung<br />
Konkretisiert werden Leitbilder durch die Formulierung von Zielen. Als weiteres konstitutives<br />
Element von Nachhaltigkeitskonzepten neben der inter- und intragenerationellen Gerechtigkeit<br />
wird die Strukturierung der Ziele je nach Disziplin durch Fokussierung auf eine oder<br />
mehrere Nachhaltigkeitsdimensionen (Ein-Säulen- und Mehr-Säulen-Modelle) und deren<br />
Gewichtung untereinander vorgenommen.<br />
Einige Arbeiten heben die Dimension Umwelt (Brown, Flavin & Postel, 1991; von Weizsäcker,<br />
1995; Birnbacher & Schicha, 1996; Renn, 1996; Jänicke, 1999; Haber, 2001) oder<br />
vereinzelt auch die Kultur (Kruse-Graumann, 1996) als alleinige Säule hervor, auf die der<br />
Blick bei der Erfassung des Grades nachhaltiger Entwicklung ausschließlich gerichtet sein<br />
sollte. Im Ein-Säulen-Modell, in dem die Umwelt ausschließlicher Betrachtungsgegenstand<br />
im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung ist, steht die Frage eines gerechten Umgangs<br />
des Menschen mit seiner natürlichen Umwelt im Mittelpunkt. Ökonomische und soziale Fragen<br />
sind in diesem Ansatz nur als Ursachen und Folgen von Umweltproblemen relevant. Es<br />
wird ihnen jedoch keine eigenständige Bedeutung als Zielkategorien eingeräumt (Brandi et<br />
al., 2001). Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Sicherstellung der natürlichen Grundlagen<br />
(auch für kommende Generationen), die für eine dauerhafte Sicherung der Möglichkeit<br />
eines Lebensstils, den heutige Menschen schätzen, anstreben und erreichen, notwendig<br />
sind (Renn, 1996). Diese Sicherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen kann aus biologischer<br />
Sicht nur durch eine Struktur und Funktion der Biosphäre erfolgen, die sich in langer<br />
Evolution durch „self-sustainability" ausgezeichnet hat. Eine Änderung brachte das Auftreten<br />
des Kulturwesens Mensch, dessen kulturelle Evolution von Anfang an diesem Nachhaltigkeitsverständnis<br />
zuwider lief und daher dem Fortbestand des „self-sustainability" - Prozesses<br />
angepasst werden muss (Haber, 2001).<br />
Für die Vertreter der Fokussierung von Nachhaltigkeit auf kulturelle Aspekte besteht kein<br />
Zweifel, dass im Mittelpunkt dieses Prozesses die sozialverträgliche Veränderung von<br />
Mensch-Umwelt-Beziehungen und damit der Mensch selbst stehen muss. Es gilt, den Menschen<br />
als Kulturwesen zu berücksichtigen, auch wenn es immer noch Stimmen gibt, die das<br />
Ziel einer nachhaltigen, umweltgerechten Entwicklung als eine Aufgabe aus dem Blickwinkel<br />
24
1.2 Paradigmen und die verschiedenen Konzepte von Nachhaltigkeit<br />
der Ökologie und damit eine Aufgabe für Naturwissenschaftler und ökologisch orientierte<br />
Ökonomen sehen (Kruse-Graumann, 1996).<br />
Weitere Konzepte berücksichtigen zwei Dimensionen (Meadows et al., 1993, Umwelt, Soziales;<br />
Pearce et al., 1990; Solow, 1992, Ökonomie, Umwelt). Die Vorstellungen von Meadows<br />
räumen der Umwelt zwar eine Vorrangstellung ein, jedoch wird der Nachhaltigkeitsraum erst<br />
durch eine unerlässliche Verbindung mit der sozialen Sphäre vollständig aufgespannt. Denn<br />
es wird derjenige Zustand eines Systems für wünschenswert gehalten, der es ermöglicht,<br />
dass das System über unbeschränkte Zeit ohne grundsätzliche oder unsteuerbare Veränderungen<br />
im Rahmen der gegebenen Umwelt existenzfähig bleibt und vor allem nicht in den<br />
Zustand der Grenzüberziehung gerät.<br />
Pearce und Solow richten dagegen ihr Augenmerk auf die ökologische Dimension als Ressourcenspender<br />
und dessen Management zur Verwertung in der ökonomischen Sphäre.<br />
Danach ist nachhaltige Entwicklung ein Prinzip, das auf die Anordnung hinauslaufen muss,<br />
die Produktionskapazität für eine unbestimmte Zukunft zu schützen. Dies kann nur durch<br />
Instandhalten bzw. Vergrößern des Kapitalvorrates (als Summe von natürlichem und künstlichem<br />
Kapital) geschehen. Das bedeutet, dass zum einen die Nutzung von nicht-erneuerbaren<br />
Ressourcen nur zu erlauben ist, wenn diese von der Gesellschaft durch etwas anderes<br />
ersetzt werden und zum anderen erneuerbare Ressourcen nicht über ihre Regenerationsrate<br />
verbraucht werden (Solow, 1992).<br />
Die von den meisten Autoren genannten Dimensionen sind allerdings Ökonomie, Soziales<br />
und Umwelt. Einige Vertreter sprechen sich beim Einschluss von diesen drei Nachhaltigkeitsbereichen<br />
für eine Gleichgewichtung aus (Enquete-Kommission, 1994 und 1998; Der<br />
Lissabonner Aktionsplan, 1996; Petschow et al., 1998; Zukunftskommission der Friedrich-<br />
Ebert-Stiftung, 1999). Ökonomie, Ökologie und sozialer Ausgleich müssen zugleich als Einheit<br />
betrachtet werden. Denn den Enquete-Kommissionen von 1994 und 1998 zufolge geht<br />
es nicht darum, die drei Dimensionen gegeneinander auszuspielen, sondern sie müssten<br />
künftig gleichermaßen ins Kalkül gezogen, indem sie miteinander verknüpft werden (Enquete-Kommission,<br />
1994 und 1998).<br />
Begründet wird dieser Einschluss von drei Dimensionen und ihre gleichwertige Behandlung<br />
damit, dass beim begrenzten Fokus auf Naturkapital oft wirtschaftliche Errungenschaften<br />
(menschengemachtes Kapital) als auch soziale Institutionen (wie demokratische Willensbildung,<br />
Schaffung und Ausbau des Wissens etc.) (immaterielle Güter) außerhalb des Blickfeldes<br />
bleiben (Renn, 2002).<br />
Für die Betonung der gleichen Gewichtung aller drei Dimensionen werden politisch pragmatische<br />
und systemtheoretische Argumente angeführt. Aus politisch-pragmatischer Sicht wäre<br />
eine ökologisch dominierte Nachhaltigkeitspolitik im gesellschaftlichen Abwägungsprozess<br />
immer dann unterlegen, wenn sich andere Probleme als dringlicher erweisen. Systemtheoretisch<br />
fundierte Argumentationen führen an, dass die zivilisatorische Entwicklung nicht nur<br />
durch ökologische, sondern auch durch ökonomische und soziale bedroht werden kann.<br />
Denn es können ebenso soziale und ökonomische Belastungsfähigkeitsgrenzen ausgemacht<br />
werden, deren Überschreitung zur Einschränkung der Leistungsfähigkeit bis hin zum Zusammenbruch<br />
des entsprechenden Systems führen kann (Enquete-Kommission, 1998;<br />
Jörissen et al., 2001).<br />
Als Beispiele für solch eine Gleichgewichtung, die einen weitgehenden Einklang der drei<br />
Nachhaltigkeitsdimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales vorsieht, können die Studien<br />
25
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 1. Nachhaltigkeitskonzepte<br />
des UBA Langfristszenarien für eine nachhaltige Entwicklung (2002) und der Enquete-<br />
Kommission Nachhaltige Energieversorgung (2002) im Energiebereich angeführt werden.<br />
Auch im Wassersektor fordert beispielsweise die UBA-Studie Nachhaltige Wasserversorgung<br />
(2001) die ökonomische, ökologische und soziale Dimension nachhaltiger Wasserversorgung<br />
gleichberechtigt nebeneinander zu stellen.<br />
Andere Experten ziehen zwar ebenfalls alle drei Dimensionen zu ihrer Betrachtung heran,<br />
priorisieren jedoch eine der drei Dimensionen. Bei den einen wird die Dimension Umwelt in<br />
den Vordergrund gerückt (SRU, 1994 und 2002; BUND & Misereor, 1996; WBGU, 1996;<br />
Mohr, 1996; Umweltbundesamt (UBA), 1997; Renn et al., 1999; Simonis & Brühl, 1999), bei<br />
anderen stehen soziale Aspekte nachhaltiger Entwicklung im Mittelpunkt (Hans-Böckler-<br />
Stiftung, 2000).<br />
Beispielsweise geht der SRU 2 von Nachhaltigkeit als einem Leitkonzept für die Umweltpolitik<br />
aus, das die dauerhafte Erfüllung menschlicher Grundbedürfnisse (gegenwärtiger und zukünftiger<br />
Generationen) innerhalb der Tragekapazität der natürlichen Umwelt vorsieht (SRU,<br />
1994 und 2002). Die Tragekapazität wird dabei definiert als „die Eigenschaft eines Wirtschaftsraums,<br />
eine bestimme Bevölkerung nachhaltig zu tragen". Als „nachhaltig" gilt, wenn<br />
diese Entwicklung mit den ökologischen, sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen<br />
verträglich ist, also auf Dauer angelegt ist (Mohr, 1996). Die Umwelt gibt nach diesem Verständnis<br />
die Grenze vor, die eine dauerhaft umweltgerechte Entwicklung der Zivilisation nicht<br />
überschreiten darf. Damit setzt die Ökologie nach dieser Nachhaltigkeitsvorstellung einen<br />
Rahmen (SRU, 1994). Nur innerhalb dieser Grenzen sind soziale und ökonomische Aktivitäten<br />
möglich, jedoch ist die Erwähnung der gegenseitigen Abhängigkeiten innerhalb der drei<br />
Dimensionen für die vollständige Nachhaltigkeitsdefinition unerlässlich (UBA, 1997; SRU,<br />
2002). Andere Konzepte fordern, dass die natürliche Umwelt und der damit verbundene<br />
Kapitalstock an natürlichen Ressourcen so weit erhalten werden muss, dass die Lebensqualität<br />
zukünftiger Generationen gewährleistet bleibt (Renn, 1999), Die Betonung des „sozialen<br />
Leitbildes der Nachhaltigkeit" innerhalb der drei Dimensionen bringt zum Ausdruck, dass das<br />
Nachhaltigkeitsparadigma, intragenerativer und intergenerativer Gerechtigkeit, nur erfüllbar<br />
ist, wenn die Realisierung von Zielen im sozialen Bereich, wie „das Recht auf ein menschenwürdiges<br />
Leben für alle", „ein anderer, ressourcenärmerer Wohlstand in den Industrieländern<br />
als Basis für Umverteilungspotentiale" sowie „Beteiligung aller gesellschaftlichen<br />
Akteursgruppen" am Prozess zur nachhaltigen Entwicklung primär angestrebt werden (Hans-<br />
Böckler-Stiftung, 2000).<br />
In manchen Studien erfährt das Drei-Säulen-Modell eine Erweiterung um eine vierte. Angefügt<br />
werden die Dimension Institutionen (CSD, 1996; Jörissen et al., 1999; Spangenberg,<br />
2002) oder auch der Bildung (Döring & Ott, 2002).<br />
Das Drei-Säulen-Konzept wird deshalb um den Bereich Institutionen erweitert, weil neben<br />
der Verfügbarkeit geeigneter Organisationen zur Durchsetzung und Absicherung der Nachhaltigkeitsstrategie<br />
die notwendigen institutionellen Mechanismen und Orientierungen von<br />
größter Bedeutung sind (Spangenberg, 2002).<br />
Neben ökonomischen, sozialen und ökologischen Zielen gerät zunehmend die Beeinflussung<br />
von Einstellungen und Lebensstilen neben der Vermittlung von Wissen zu den Nachhaltig-<br />
2 Rat von Sachverständigen für Umweltfragen<br />
26
1.2 Paradigmen und die verschiedenen Konzepte von Nachhaltigkeit<br />
keitszielsetzungen. Ausrichtung von Bildung und Erziehung erfolgt nach den Wertvorstellungen<br />
und Handlungsprinzipien gemäß der Nachhaltigkeitsparadigmen. Im Zentrum steht die<br />
zielgerichtete Stärkung des Umweltbewusstseins und -engagements sowie die Beeinflussung<br />
von Lebensstilen und Konsummustern (Döring & Ott, 2002).<br />
Einige wenige Ansätze berücksichtigen darüber hinaus gar eine ganze Reihe weiterer Dimensionen,<br />
wie physische, materielle, psychologische und ethische (Bossel, 1998).<br />
Begründet wird dieses umfassende Konzept von Nachhaltigkeit damit, dass selbst wenn alle<br />
ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Ziele als erfüllt anzusehen sind, jedoch<br />
eine kleine Minderheit existiert, die im Luxus teils auf Kosten einer unterprivilegierten<br />
Minderheit lebt, dieser Zustand gesellschaftlich und vor allem ethisch auf Dauer nicht als<br />
nachhaltig zu begreifen wäre. Außerdem wäre eine gerechte, materiell nachhaltige Gesellschaft,<br />
die ihre Umgebung mit dem maximal möglichen nachhaltigen Tempo ausbeutet, aus<br />
psychologischer, kultureller und ethischer Sicht ebenfalls als nicht nachhaltig anzusehen<br />
(Bossel, 1998).<br />
Paradigma: Naturverständnis (Naturbewertung und Verfügung über die Natur)<br />
Das Nachhaltigkeitspostulat unterscheidet sich nicht nur hinsichtlich der Wahl der Zieldimensionen,<br />
sondern auch hinsichtlich des Verständnisses der Natur bzw. bezüglich der Beziehung<br />
zwischen Mensch und Natur.<br />
In der Ökonomie wird das Naturverständnis durch die neoklassische Umwelt- und Ressourcenökonomik<br />
und durch die ökologische Ökonomie vornehmlich geprägt.<br />
Die Neoklassische Ökonomie zeichnet sich in ihrer Grundstruktur dadurch aus, dass Handeln<br />
von Menschen ausschließlich als ökonomisches und nur auf Märkten zwecks Konsum<br />
und Produktion von Gütern erfolgend begriffen wird. Der Mensch wird dabei als Wirtschaftssubjekt<br />
aufgefasst, der nur Allokations- und Distributionsentscheidungen über Produktionsfaktoren<br />
bzw. Güter als Objekte trifft (Jacobs, 1997). Der Natur werden in dieser Richtung der<br />
Ökonomie ausschließlich ökonomische Funktionen zugewiesen. Sie dient als Ressourcenspenderin,<br />
Aufnahmemedium für Schadstoffe sowie als Lieferant öffentlicher Güter. Damit<br />
wird die Natur nur als Objekt betrachtet, das zur Disposition des Menschen steht. Sie erhält<br />
erst durch die Erfüllung von für die ökonomische Disposition notwendigen Funktionen einen<br />
Wert.<br />
Die anthropozentrische Perspektive der Neoklassik im Verhältnis von Mensch zur Natur wird<br />
noch verstärkt, als davon ausgegangen wird, dass der Mensch seine Entscheidungen nur im<br />
Hinblick auf die Auswirkungen auf ihn selbst trifft. So werden natürliche Phänomene ausschließlich<br />
in ihren Wirkungen auf das menschliche Wohlbefinden beurteilt.<br />
Kennzeichnend für dieses Verhältnis von Mensch und Natur ist beim neoklassischen Ansatz<br />
daher auch, dass von einer grundsätzlichen Substituierbarkeit von knappen Gütern durch<br />
andere ausgegangen wird, ohne dass es in Bezug auf individuelle Präferenzen zu einer<br />
Nutzeneinbuße kommen muss (Pearce & Turner, 1990). Die neoklassische Schule weist<br />
somit der Natur eine untergeordnete Rolle zu. Sie geht von der Vorstellung aus, dass die<br />
Abhängigkeit von der Natur durch technische Hilfsmittel reduziert oder langfristig gar ganz<br />
gelöst werden kann.<br />
Als Beispiel einer Studie, die die anthropozentrische Perspektive einnimmt, kann die des<br />
Umweltbundesamtes aus dem Jahre 2002 genannt werden, in denen Langfristszenarien für<br />
27
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 1. Nachhaltigkeitskonzepte<br />
eine nachhaltige Energienutzung erarbeitet wurden. Bei ihr steht im Vordergrund die Befriedigung<br />
der menschlichen Bedürfnisse; die Natur ist nach dem Verständnis der Autoren nicht<br />
um ihrer selbst willen, sondern im Hinblick auf ihre vielfältige Bedeutung für den Menschen<br />
zu schützen (UBA, 2002) Eine anthropozentrische Perspektive liegt auch dem HGF-Projekt<br />
„Perspektiven für die Nutzung regenerativer Energien" aus dem Jahr 2001 zugrunde, dessen<br />
Ziele einer nachhaltigen Entwicklung sich ausschließlich auf den Menschen in Bezug zur<br />
Natur beziehen (Nitsch & Rösch, 2001).<br />
Dagegen besteht die Leitvorstellung bei den ökologischen Ökonomen, dass nicht notwendigerweise<br />
eine Verknüpfung von Natur und den menschlichen Präferenzen besteht. Die Vertreter<br />
dieser wissenschaftlichen Richtung nehmen eine stärker ökozentrische Perspektive<br />
ein. In einigen Arbeiten wird ein „eigenes Daseins- und Entfaltungsrecht der Natur" (Manstetten<br />
& Faber, 1999) zugesprochen. Das bedeutet, dass die Hauptprozesse der Biosphäre als<br />
voneinander abhängige Kreisläufe und ausschließlich von thermodynamischen und biophysikalischen<br />
Gesetzmäßigkeiten abhängig modelliert werden (Gawel, 1996). Zudem wird die<br />
Vorstellung von einzelnen Teilen der Natur als Subjekte hervor gehoben, denn es wird der<br />
Beobachtung Bedeutung beigemessen, dass einzelne Kreaturen der natürlichen Welt in der<br />
Lage sind, wie der Mensch, eine Bewertung und Entscheidung bezüglich einzelner Prozesse<br />
vorzunehmen, wenn auch in reduzierterem Maße (Booth, 1994).<br />
Für die Anhängerschaft der ökologischen Ökonomik ist die ökonomische Sphäre abhängig<br />
von der ökologischen, da sie eine dauerhafte ökonomische Entwicklung als gekoppelt an die<br />
Tragekapazität der ökologischen Systeme und daher als deren Limitierung ansieht, womit<br />
physische und energetische Stoffwechselprozesse mit der Natur zum Gegenstand der ökonomischen<br />
Analyse werden (Gawel, 1996). Auch wird kategorisch bestritten, dass natürliche<br />
Güter durch künstliche vollständig ersetzt werden können. Hierbei wird auf die Lebenserhaltungsfunktionen<br />
der Natur hingewiesen (Daly, 1999). Somit soll sich die Ausrichtung des<br />
wirtschaftlichen Handelns nicht nur an den Bedürfnissen des Menschen, sondern an der<br />
Erhaltung der Natur orientieren.<br />
Die Natur steht auch im Zentrum der Betrachtung in der Ökologie. Daher sind verschiedene<br />
Naturverständnisse ein besonderer Gegenstand der Ökologie. Die Naturverständnisse in der<br />
Ökologie lassen sich in ganzheitliche oder individualistische einteilen. Bei der ganzheitlichen<br />
Sichtweise von Natur wird davon ausgegangen, dass die Natur als Ganzes mehr ist als die<br />
Summe seiner Teile. Die individualistische Perspektive basiert dagegen auf der Annahme,<br />
dass autonome Individuen vorliegen, die lediglich die gleichen Standortansprüche haben und<br />
deshalb gemeinsam an einem Ort vorkommen. Der individualistische Ansatz impliziert ein<br />
Bild der unzerstörbaren Natur, die sich in ständiger Veränderung befindet. Diese Vorstellung<br />
korrespondiert mit dem Gedankengut des Liberalismus, demnach ist alles gut, was sich<br />
durchsetzt (Gloy, 1996).<br />
Eine andere Einteilung in der Ökologie zielt auf eine Unterscheidung zwischen organizistisch-holistischem<br />
und systemisch-funktionalistischem Naturverständnis ab. Der Holismus<br />
versucht mit der Synthese zwischen organismischem und mechanistischem Naturverständnis<br />
das Lebensprinzip biologisch zu erklären. Dabei werden die physischen Funktionsweisen<br />
von Organismen den biologischen untergeordnet (Gloy, 1996).<br />
Im funktionalistischen Naturverständnis werden Ökosysteme ebenfalls als Ganzheiten betrachtet,<br />
jedoch nicht als Organismen, sondern als Systeme. Hier werden die physikalischen<br />
Kriterien als den biologischen übergeordnet angesehen. Lebewesen spielen bei diesem<br />
28
1.2 Paradigmen und die verschiedenen Konzepte von Nachhaltigkeit<br />
Verständnis kaum noch eine Rolle, Ökosysteme werden versucht über Stoff- und Energieströme<br />
zu modellieren. Der Gleichgewichtszustand, der den optimalen Zustand eines Systems<br />
kennzeichnen soll, wird hierbei nun nicht mehr durch aneinander angepasste Organismen,<br />
sondern durch ausgewogene positive und negative Rückkopplungsprozesse charakterisiert.<br />
In der Nachhaltigkeitsdiskussion fand das ganzheitliche Naturverständnis vornehmlich<br />
in der systemischen Sichtweise Eingang. Es wird davon ausgegangen, dass auf der Basis<br />
dieses Verständnisses zu zentralen Funktionsweisen von Ökosystemen Belastungsgrenzen<br />
definiert werden können. Darauf begründet sich der Vorrang der Dimension Ökologie gegenüber<br />
den beiden anderen Dimensionen in der Nachhaltigkeitsdebatte (Rink & Wächter,<br />
2002).<br />
In der Soziologie werden naturalistische Ansätze und wissenssoziologisch orientierte Analysen<br />
„der gesellschaftlichen Konstruktion der Natur" unterschieden. In neuerer Zeit werden<br />
zudem solche Ansätze diskutiert, die sich um ein Verständnis der Interaktion von Natur und<br />
Gesellschaft bemühen.<br />
In den naturalistischen bzw. realistischen Perspektiven wird die ökologische Bedrohung<br />
menschlicher Gesellschaften zum Ausgangspunkt der Interaktion zwischen Mensch bzw.<br />
Gesellschaft und Natur. Dieser Teildisziplin lag das systemische Naturverständnis der Ökologie<br />
zugrunde, das zu Maßstäben herangezogen wurde und daher zur Kritik an gesellschaftlichen<br />
Missständen im Hinblick auf eine gesellschaftlich und ökologisch unverträglichen Organisationsform<br />
der Gesellschaft führte. Zugleich ist Ausdruck dieses Naturverständnisses das<br />
Bild einer von menschlichen Eingriffen freien und gesunden Natur.<br />
Als Reaktion darauf wurden eine Reihe korrigierender wissenssoziologischer Ansätze entwickelt,<br />
die aus sozialkonstruktivistischer Perspektive die soziale Bedingtheit von Naturkonzepten<br />
thematisierten. Sozial-konstruktivistische Ansatze lassen sich nach den Prinzipien unterscheiden,<br />
wie sie die gesellschaftliche Konstruktion von Natur modellieren. Zu nennen sind<br />
eigensinnige, nicht kompatible Codes funktionsspezifischer Teilsysteme (Luhmann, 1986),<br />
die kulturelle Symbolisierung verschiedener „Ways of life" (Cultural Theory), gesellschaftliche<br />
Kontroversen um unterschiedliche Ordnungsmodelle (Soper, 1995) oder unterschiedliche<br />
alltagspraktische Naturbezüge (Macnaghten & Urry, 1998).<br />
In den 1990er Jahren entstanden auch eine Reihe von Arbeiten, die den Dualismus von<br />
Natur und Gesellschaft, der bislang auch noch bei den konstruktivistischen Ansätzen bestand,<br />
aufzulösen suchten (Beck, 1986). Diese Konzepte nehmen zwar realistische, kulturalistische<br />
und konstruktivistische Elemente in ihre Überlegungen mit auf, sie unterscheiden<br />
sich jedoch von diesen durch die Radikalität, mit der sie den Gegensatz von Natur und Gesellschaft<br />
aufzubrechen versuchen, sowie durch die jeweiligen Problemfokussierungen. In<br />
dieser Perspektive wird nicht mehr von der Natur als eine alles übergreifende universelle<br />
Kategorie ausgegangen, sondern stattdessen ist von Vielfalt existierender und möglicher<br />
Naturen, ihrer gleichermaßen gesellschaftlichen und natürlichen Entwicklungsgeschichte und<br />
zugleich von ihrer materiellen und symbolischen Existenz die Rede (Rink & Wächter, 2002).<br />
In den Sozialwissenschaften werden des Weiteren im Hinblick auf inter- und transdisziplinäre<br />
Erkenntnisse in der Nachhaltigkeitsforschung in neuerer Zeit insbesondere sozial-ökologische<br />
Beziehungen und deren Veränderung untersucht. Dabei werden zielorientierte Veränderungen<br />
der Beziehungsmuster zwischen Gesellschaft und Natur als sozial-ökologische<br />
Transformation bezeichnet (Rink & Wächter, 2002).<br />
29
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 1. Nachhaltigkeitskonzepte<br />
Einige Autoren gehen bei der Analyse solcher Transformationsprozesse von einem breit<br />
angelegten Verständnis von Sozial-Ökologie aus. Sie sehen in den vielschichtigen Wechselwirkungen<br />
zwischen individuellen/kollektiven Subjekten und der sie umgebenden Umwelt ein<br />
dynamisches Netz von Abhängigkeiten. Die umgebende Umwelt wird dabei mehr als ein<br />
Ensemble von Umweltmedien gefasst, es schließt darüber hinaus die vom Menschen gestaltete<br />
Umwelt (Städte, <strong>Versorgung</strong>ssysteme), die stets Einfluss auf die Medien besitzen, mit<br />
ein. Die Betrachtung der gegenseitigen Wechselwirkungen der verschiedenen Sphären, die<br />
einer enormen inneren Dynamik unterliegen, unterstützt ein Verständnis nachhaltiger Entwicklung,<br />
das die Resilienz lebender Systeme pointiert, also die Fähigkeit Strukturen und<br />
Verhaltensmuster bei inneren und äußeren Einflüssen aufrechterhalten zu können. Nachhaltige<br />
Entwicklung wird also gerade nicht als ein Pfad zur Erreichung eines stabilen und fixierten<br />
Gleichgewichtes von Interessen und Umweltansprüchen begriffen (Grossmann et al.,<br />
2002).<br />
Paradigma: Natur als Objekt vs. Subjekt<br />
Das Naturverständnis lässt sich in den einzelnen Disziplinen auch dadurch kennzeichnen,<br />
dass die Natur entweder passiv als Objekt betrachtet wird, über das der Mensch seine Disposition<br />
trifft oder zumindest partiell Subjektqualität besitzt und ebenso wie der Mensch in<br />
der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Die Frage, ob Natur als Subjekt oder Objekt zu<br />
betrachten ist, spielt bei der Verfassung von Nachhaltigkeitskonzepten dann eine Rolle, wenn<br />
es darum geht, ausschließlich menschliche Bedürfnisse zu befriedigen oder aber auch solche<br />
von Teilen der Natur zulasten des Menschen.<br />
Notwendige Bedingung für Entscheidungen über Ressourcen bzw. Güter ist die Zumessung<br />
eines Wertes für ein Gut, das auf Äußerungen von Präferenzen und Wertschätzungen beruht.<br />
Die Empfindung und Offenbarung von Präferenzen kann nach neoklassischer Vorstellung<br />
nur durch den Menschen als vernunftbegabtes Wesen erfolgen. Es wird folglich keine<br />
Möglichkeit gesehen, nicht-anthropogen bedingte Bewertungen durchzuführen. Die neoklassische<br />
Perspektive ist anthropozentrisch orientiert; in ihrer Vorstellung gilt der Mensch als<br />
alleinig entscheidungsbefähigtes Wesen. Der Mensch ist als Entscheidungsträger Subjekt<br />
und die Natur ohne Entscheidungsbefähigung Objekt (Weimann, 1990).<br />
In der ökologischen Ökonomie wird hingegen Teilen der Natur (einzelnen Spezies) der Charakter<br />
des Subjektes zu gestanden, die, wenn auch nur in begrenztem Umfang, eine Entscheidungsbefähigung<br />
besitzen.<br />
Paradigma: Verständnis des Wirtschaftsprozesses (Wirtschaftskreislauf vs.<br />
Durchflusswirtschaft)<br />
Nachhaltigkeitskonzepte unterscheiden sich in den einzelnen Disziplinen nicht nur hinsichtlich<br />
des Naturverständnisses bzw. der Stellung von Mensch und Natur, sondern auch durch<br />
die Art, welches Verständnis der Modellierung des gesamtwirtschaftlichen Beziehungsgefüges<br />
zugrundegelegt werden sollte, ob als Durchflusswirtschaft oder als Kreislaufwirtschaft.<br />
Die Vorstellungen auf Basis neoklassischer Ökonomie lässt offen, welches Modell der Ökonomie<br />
als Kreislauf oder Durchflusswirtschaft zu präferieren ist. Denn wirtschaftliche Aktivitäten<br />
werden auf den verschiedenen Märkten bestimmt durch Preise, die Knappheitsrelationen<br />
anzeigen. Die Wahl der Produktionstechnologie, also beispielsweise die Nutzung von erst-<br />
30
1.2 Paradigmen und die verschiedenen Konzepte von Nachhaltigkeit<br />
malig verwendeten oder rezyklierten Ressourcen ist grundsätzlich offen und wird nur durch<br />
Preissignale bestimmt.<br />
Die ökologischen Ökonomen heben dagegen bezüglich intragenerationeller Gerechtigkeitsfragen<br />
das „Scale-Problem" hervor. So sollten die Industrieländer drastisch ihren Konsum<br />
und folglich die Inanspruchnahme der Natur in Form von Ressourcen- und Energieverbrauch<br />
sowie Emissionen senken, um den Entwicklungsländern Raum für vermehrten Umweltverbrauch<br />
und höheren Wohlstand zu gewähren, wenn insgesamt das ökonomische System<br />
die ökologische Sphäre nur innerhalb ihrer ökologischen Grenzen beanspruchen soll.<br />
Die aktuelle Wirtschaftsweise der Industrieländer wird als Durchflusswirtschaft und nicht als<br />
Kreislauf aufgefasst und aufgrund des hohen Maßes der Umweltinanspruchnahme bei<br />
Durchfluss im Vergleich zur Kreislaufführung kritisch gesehen (Jacobs, 1997; Daly, 1999).<br />
Paradigma: quantitatives vs. qualitatives Wachstum<br />
Ein weiterer entscheidender Unterschied zwischen beiden Disziplinen der Ökonomie liegt in<br />
der Interpretation des Begriffs Entwicklung.<br />
Vertreter neoklassischer Grundannahmen sehen eine Notwendigkeit in wirtschaftlichem<br />
quantitativem Wachstum und erkennen Grenzen nur bedingt an oder machen diese nur<br />
vorübergehend fest (Heller, 1971; Ayres, 1996).<br />
Ökologische Ökonomen weisen dagegen vehement auf die natürlichen Grenzen des quantitativen<br />
Wachstums hin. Sie sehen Begrenzungen mit Blick auf den Erhalt lebenswichtiger<br />
Funktionen und der Tragekapazität auf der Basis von Ergebnissen ökosystemarer Forschung.<br />
Nachhaltige Entwicklung sehen sie eher in der Beschreibung als qualitatives Wachstum<br />
realisiert (Constanza, 1991; Daly, 1991 und 1996; Hampicke, 1999).<br />
In letztere Richtung zielt die Formulierung ökonomischer Zielsetzungen der Enquete-<br />
Kommission in der Studie „Nachhaltige Energieversorgung" aus dem Jahre 2002, die einen<br />
Übergang von Mengenwachstum zu qualitativem Wachstum fordert, das auch ökologisch<br />
und sozial verträglich ist. Der ökologische Einklang im Energiebereich soll erzielt werden<br />
durch Abkopplung des Wachstums vom Ressourcenverbrauch für Energieleistungen und der<br />
soziale durch Gewährleistung ausreichender Beschäftigungsmöglichkeiten, so dass jeder der<br />
eine Erwerbsarbeit ausüben möchte, dieses auch tatsächlich tun kann (Enquete-Kommission,<br />
2002).<br />
Paradigma: exogene vs. endogene Anstöße einer Entwicklung<br />
Aussagen der Evolutorischen Ökonomie berücksichtigen über die Frage der Qualität der<br />
Entwicklung hinaus die Entstehung und Ausbreitung von Neuerungen in der Wirtschaft. Die<br />
Evolutorische Ökonomik befasst sich also primär mit dem (selbstorganisierten) Wandel in<br />
ökonomischen Systemen und ist folglich an Übergangsprozessen interessiert. Dabei wird im<br />
Gegensatz zur herkömmlichen dynamischen Analyse der Wirtschaftswissenschaft der Erkenntnisschwerpunkt<br />
in der Evolutorischen Ökonomik auf die Entstehungsbedingungen als<br />
auch auf die Ausbreitung und Auswirkungen der durch das System selbst erzeugten (= endogenen)<br />
Anstöße gelegt. Es geht also nicht nur um die mehr oder weniger komplexe Anpassung<br />
ökonomischer Systeme an exogene Datenänderungen, sondern um das selbstorganisierende<br />
Erzeugen neuer Bedingungen und dessen Auswirkungen auf ergebnis- und<br />
31
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 1. Nachhaltigkeitskonzepte<br />
verlaufsoffene Prozesse innerhalb des untersuchten ökonomischen Systems (Herrmann-<br />
Pillath & Lehmann-Waffenschmidt, 2003).<br />
Zentral für die Erklärung von Ausbreitungen oder aber auch deren Verhinderung von Anstößen<br />
ist der Begriff der Routine. Nelson und Winter (1982) definieren im evolutorischökonomischen<br />
Kontext Routinen als Bündelung des vorhandenen operationalen Wissens.<br />
Dieses Wissen ist nur im spezifischen sozialen und technologisch-organisatorischen Kontext<br />
einer Institution (z. B. Unternehmen oder Branche) sinnvoll und anwendbar; Routinen machen<br />
es für die regelmäßige Anwendung zugänglich. Mit dem Begriff der Routine lässt sich<br />
auch das unternehmerische Innovationsverhalten analysieren. Routinen bilden die Grundlage<br />
für technologische Entwicklungskorridore oder Pfade, auf denen sich Unternehmen und<br />
Branchen bewegen, indem sie Technologien und Organisationsmuster anwenden und im<br />
Rahmen ihrer spezifischen Restriktionen verbessern. Lernprozesse in der jeweiligen Institution<br />
unterliegen nach Ansicht dieses Ansatzes den (wahrgenommenen) ökonomischen<br />
Chancen, die in Innovationen liegen, den Anreizen im Institutionenumfeld, den Fertigkeiten<br />
der Institutionen und den organisatorischen Arrangements und Mechanismen, die die Übernahme<br />
von Innovationen begünstigen (oder erschweren). Aus evolutorisch-organisationstheoretischer<br />
Sicht ist die Aufrechterhaltung der Funktionsbedingungen für Innovationswettbewerb<br />
notwendige Bedingung für den Fortschritt. In Bezug auf Nachhaltigkeit weist die<br />
evolutorische Theorie der Ökonomie jedoch darauf hin, dass politische Steuerungsimpulse<br />
ausreichend stark sein müssen, um einen Pfadwechsel zugunsten beispielsweise umweltfreundlicher<br />
Technologien einzuleiten, sofern zu erwarten ist, dass die bestehenden nichtnachhaltigen<br />
Technologiepfade auch in Zukunft fortgeführt werden. So ist in der evolutorischen<br />
Beurteilung immer ein Kompromiss zwischen freiheitserhaltender Regulierung und<br />
erforderlicher Impulsstärke zu suchen (Linscheidt, Bodo, 1999; Erdmann & Seifert, 2003).<br />
Gerade deshalb ist es sinnvoll, diese Erkenntnisse im Hinblick auf die Förderung von Innovationen<br />
innerhalb der Wirtschaftssphäre als Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung zu<br />
nutzen.<br />
In neuerer Zeit trugen auch erste sozialwissenschaftliche Beiträge zur Institutionenforschung<br />
zum Verständnis sozial-ökologischer Transformation mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung<br />
bei (Constanza et al., 1999; Minsch et al., 1998; von Prittwitz, 2000; Young et al., 1998).<br />
Diese Ansätze verfolgen das Ziel, die sozialen und institutionellen Rahmenbedingungen<br />
einer erfolgreichen Einbettung von Nachhaltigkeitsstrategien in vorhandene gesellschaftliche<br />
Strukturen zur Entschärfung ökonomischer, ökologischer und sozialer Zielkonflikte heraus zu<br />
arbeiten (Jänicke, 1993 und 1996; Jänicke & Weidner, 1997; Minsch et al., 1998). Damit werden<br />
Einflussmöglichkeiten auf die Veränderung gesellschaftlicher Organisationsformen und<br />
Regelsysteme im Hinblick auf ihren Beitrag zur Förderung von Handlungen, die auf nachhaltige<br />
Entwicklung abzielen, thematisiert (in Kraemer & Metzner, 2002). Die sozialwissenschaftliche<br />
Institutionenforschung beschäftigte sich allerdings nur damit, wie Institutionen mit<br />
anderen Strukturdimensionen in der Regulation gesellschaftlicher Naturverhältnisse (Jahn &<br />
Wehling, 1998) zusammenwirken. Sie blendet damit weitestgehend andere Dimensionen der<br />
Regulation aus, entweder durch Einschluss in den Institutionenbegriff oder durch Ignoranz<br />
ihrer Existenz (z. B. von Werten, Technik und Ökologie, wie sie in der ökonomischen Institutionenforschung<br />
vorkommen) (Edeling et al., 1999).<br />
32
1.2 Paradigmen und die verschiedenen Konzepte von Nachhaltigkeit<br />
Paradigma: Priorisierung von Allokationsproblemen vs. Gleichstellung von<br />
Allokations- und Distributionsproblemen<br />
Unterschiede in den Nachhaltigkeitskonzepten zwischen den einzelnen Disziplinen bestehen<br />
nicht nur hinsichtlich der ökonomischen Sphäre auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene (Makroperspektive),<br />
sondern auch in der Betrachtung der Mikroperspektive, bei der ökonomisches<br />
Handeln von Individuen oder von Gruppen Untersuchungsgegenstand ist.<br />
Die Beantwortung der Frage unter der Maßgabe von Nachhaltigkeit, welche Zusammensetzungen<br />
der Güterbündel und deren Verteilung als intragenerationell gerecht anzusehen sind,<br />
ist davon abhängig, ob in den einzelnen Disziplinen Allokations-Fragen Priorität eingeräumt<br />
werden oder ob Allokations- und Distributionsprobleme gleichberechtigt sind.<br />
In der Neoklassik stehen in Bezug auf intragenerationeller Gerechtigkeit primär Allokationsfragen<br />
im Vordergrund, Verteilungsfragen werden nachrangig behandelt. Sie argumentieren:<br />
der Kuchen muss erst einmal gebacken sein, dann wird die Verteilung der Stücke schon kein<br />
Problem sein. Folglich besteht die Optimierung der Produktionsfaktorkombination im Vordergrund,<br />
um den Output zu maximieren. Die Verteilung der Güter auf die gesamte Menschheit<br />
stellt kein Problem dar, wenn möglichst eine hohe Zahl an Gütern produziert worden ist.<br />
In Bezug auf die Fragestellung intergenerationeller Gerechtigkeit werden nach neoklassischem<br />
Verständnis Wirkungen auf die Natur, z. B. in ihrer Funktion als Ressourcenquelle, für<br />
zukünftige Generationen durch Hilfskonstrukte wie Existenz-, Options- oder Vermächtniswerte<br />
in das Entscheidungskalkül der gegenwärtig Lebenden inkorporiert (Feess, 1998). Intertemporale<br />
Verteilungen von Gütern werden zudem in die jeweiligen individuellen Nutzenfunktionen<br />
der einzelnen Wirtschaftssubjekte zur Analyse des Problems intergenerativer Gleichheit<br />
bei unendlichen Zeithorizonten eingeschlossen (Toman, Pezzey & Krautkraemer, 1993).<br />
In der ökologischen Ökonomie werden dagegen inter- und intragenerationellen Verteilungsfragen<br />
einen herausragenden Stellenwert eingeräumt. Denn Vertreter der ökologischen<br />
Ökonomie fordern, dass Allokations- und Verteilungsfragen gleichzeitig zu lösen sind. Damit<br />
wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass die Anfangsverteilung von Rechten bezüglich<br />
des Besitzes von Ressourcen die Allokation zwischen verschiedenen Produktionsfaktoren<br />
zur Herstellung eines bestimmten Güterbündels führt. Infolgedessen wird die Güterausstattung<br />
der einzelnen Konsumenten beeinflusst.<br />
Als Beispiel für die Betonung der Gleichrangigkeit von Allokation und Distribution kann die<br />
Studie des Umweltbundesamtes, in denen Langfristszenarien für eine nachhaltige Energienutzung<br />
erarbeitet wurden, aus dem Jahre 2002 genannt werden. In dieser Studie werden<br />
Ziele in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung formuliert, die auf den Umgang mit Ressourcen<br />
abzielen und gleichzeitig die Verteilungsgerechtigkeit als zu lösende Aufgabe hervorheben<br />
(UBA, 2002). Weitere Studien, in denen das gleichzeitige Anstreben von Allokations-<br />
und Verteilungszielsetzungen betont wird, sind der Bericht der Enquete-Kommission<br />
Nachhaltige Energieversorgung 2002, das HGF-Projekt Perspektiven für die Nutzung regenerativer<br />
Energien (Nitsch & Rösch, 2001), der UBA-Bericht Nachhaltige Wasserversorgung<br />
(2001) sowie ECOPLAN Nachhaltigkeit, Kriterien für den Energiebereich (2001). Alle diese<br />
Arbeiten leiten die Betonung von Gerechtigkeitsfragen neben den klassischen Fragen der<br />
Ressourcennutzung aus dem Brundtlandbericht her, aufgrund dessen der Aspekt der interund<br />
intragenerationellen Gerechtigkeit zur Grundlage der Studienkonzepte wird.<br />
33
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 1. Nachhaltigkeitskonzepte<br />
Paradigma: Marktanalyse mit institutionellen Randbedingungen vs. Analyse ohne<br />
institutionelle Randbedingungen<br />
Allokations- und Distributionsergebnisse innerhalb der Nachhaltigkeitskonzepte werden auch<br />
dadurch beeinflusst, ob die einzelnen Disziplinen institutionelle Randbedingungen berücksichtigen<br />
oder nicht.<br />
Die Transaktionen in der Welt neoklassischer Prägung werden unabhängig von institutionellen<br />
Rahmenbedingungen analysiert. In neuerer Zeit trägt die Neue Institutionelle Ökonomie<br />
als weiterer ökonomiewissenschaftlicher Bereich zur Verbreiterung der Erkenntnisbasis über<br />
diesen Bereich der Nachhaltigkeit bei. Als Institution wird ein System von anerkannten Normen<br />
und Regeln einschließlich Vorkehrungen zu deren Durchsetzung verstanden. Diese<br />
Normen und Regeln kommen durch kodifizierte Gesetze, Sitten, Gebräuche und durch Vereinbarungen<br />
zum Ausdruck. Zweck einer Institution ist es, individuelles Verhalten in bestimmte<br />
Richtungen zu steuern und so Ordnung, Sicherheit und Berechenbarkeit zu etablieren.<br />
Die Neue Institutionelle Ökonomie erweitert im Hinblick nachhaltigkeitsrelevanter Paradigmen<br />
Allokationsüberlegungen bezüglich physisch-stofflich knapper Ressourcen um Handlungsrechtszuweisungen<br />
und Verfügungsbefugnisse (Property Rights) und daher den Tausch<br />
von Gütern um Rahmenbedingungen, die das Ergebnis der Allokation beeinflussen können<br />
(Brösse, 1999).<br />
So bietet die Institutionenökonomie die Erkenntnis, dass bei Vorlage einer Rechtsordnung,<br />
die eine bestimmte Zuweisung an Verfügungsrechten bedeutet, durch Transaktionskosten<br />
(Such-, Informations-, Verhandlungs-, Entscheidungs-, Erzwingungskosten usw.) allokativ<br />
und distributiv nicht-neutrale Wirkungen entstehen, die fundamental die Komposition der<br />
Güterbündel der einzelnen Wirtschaftssubjekte und damit letztlich nach Aggregation aller<br />
Wirtschaftssubjekte den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungspfad in Richtung mehr oder<br />
weniger Nachhaltigkeit beeinflussen (Richter & Furubon, 1996).<br />
Paradigma: Individuelle vs. kollektive Entscheidungen<br />
Inhalte von Nachhaltigkeit werden auch dadurch determiniert, ob Entscheidungen ausschließlich<br />
durch Individuen getroffen werden können, oder ob mehrere Individuen als Kollektiv<br />
zu anderen Entscheidungsergebnissen gelangen.<br />
In der Neoklassik wird bei der Verhaltensannahme der wirtschaftlichen Akteure vom ,methodologischen<br />
Individualismus' ausgegangen. Wirtschaftliches Handeln wird als das Resultat<br />
individueller Kalküle angesehen. Folglich kann es keine Entscheidungen von Kollektiven<br />
geben, die sich nicht aus der Summe der individuellen Kalküle bilden ließen.<br />
Die Richtung der Ökologischen Ökonomie vertritt dagegen die Vorstellung von überindividuellen<br />
Wertquellen, die auch eine anthropozentrisch-kollektive Sichtweise zulässt, denn sie<br />
dient als Erklärungsansatz dafür, dass die Gesellschaft als Ganzes beispielsweise den Wert<br />
der Umweltqualität höher einschätzt als das die Summe der Individuen täte (Gawel, 1996,<br />
Klaasen & Opschoor, 1991).<br />
Paradigma: rationales vs. intuitives Verhalten<br />
Inhalte von Nachhaltigkeit werden nicht nur dadurch bestimmt, ob Einzelentscheidungen<br />
oder gruppenkollektive Entscheidung für möglich gehalten werden, sondern sie werden auch<br />
durch den Entscheidungsvorgang innerhalb des Individuums determiniert, also ob Dispositi-<br />
34
2.1 Überblick<br />
onen auf der Basis des Verstandes durch rationale Abwägung oder eher intuitiv aus dem<br />
Gefühl heraus erfolgen.<br />
Als Prämisse für die Abbildung individuellen Verhaltens in der neoklassisch orientierten<br />
Ökonomie gilt, dass sich Menschen rational verhalten, d. h. dass das menschliche Verhalten<br />
durch die Suche nach einer nutzenmaximalen Güterkombination bei gegebenen Mitteln<br />
beschrieben werden kann.<br />
Die ökologischen Ökonomen lassen in ihren Argumentationen auch Altruismus als menschliches<br />
Verhalten zu. Begründet wird dies zum Teil mit Emotionen, die rationale Komponenten<br />
des Entscheidungsprozesses dominieren. Damit weichen sie vom Menschenbild als rationales<br />
Wesen ab und räumen der anthropologischen Auffassung des Menschen als emotionales<br />
Wesens, das seine Intuition in den menschlichen Entscheidungsprozess einfließen lässt,<br />
eine Stellung ein.<br />
2. Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung<br />
2.1 Überblick<br />
Im folgenden Kapitel erfolgt ein Überblick über wesentliche Verfahren und Methoden zur<br />
Bewertung einer nachhaltigen Entwicklung.<br />
Für eine Bewertung der Nachhaltigkeit muss zunächst festgelegt werden, wie die Nachhaltigkeit<br />
„gemessen" werden soll, d. h. es müssen Kriterien formuliert werden, an Hand derer<br />
beurteilt werden kann, ob die Nachhaltigkeit höher oder geringer, erfüllt oder nicht erfüllt ist.<br />
Wie bereits beschrieben, gibt es verschiedene Konzepte von Nachhaltigkeit, die zu unterschiedlichen<br />
Kriterien führen. Bereits die Auswahl von Kriterien stellt daher eine subjektive<br />
Entscheidung dar, bei der eine Beteiligung von gesellschaftlichen Akteuren sinnvoll ist.<br />
Häufig wird auch der Begriff „Indikatoren" verwendet, meist gleichbedeutend mit den genannten<br />
Kriterien. Der Begriff „Indikator" hat in verschiedenen Fachrichtungen unterschiedliche<br />
Bedeutung. Für die Verwendung in Nachhaltigkeitsuntersuchungen definiert das Umweltgutachten<br />
des SRU (1998) Indikatoren als „Kenngrößen, die zur Abbildung eines bestimmten,<br />
nicht direkt messbaren und oftmals komplexen Sachverhalts (Indikandum) festgelegt werden".<br />
Die Multidimensionalität der Nachhaltigkeit erfordert die gleichzeitige Anwendung vieler<br />
Indikatoren. Solche Indikatoren-Sätze sind bereits in vielen Nachhaltigkeitsprojekten definiert<br />
und verwendet worden (z. B. OECD (2001; 2003; 2004), Grunwald et al. (2001)). Ein Kriterium<br />
oder Indikator kann aber auch aus Einzelbeiträgen aggregiert sein, die man ebenfalls<br />
„Indikatoren" nennt. In diesem Sinne ist beispielsweise die Menge der 50 2-Emissionen ein<br />
Indikator für das Kriterium „Luftqualität", wie im „Umweltbarometer" 3 . Hier zeigt sich bereits<br />
eine hierarchische Struktur von Indikatoren (Kriterien), die im Abschnitt „akteursabhängige<br />
Verfahren" eine wichtige Rolle spielt. Indikatoren sind demnach keine eigenständige Methode<br />
zur Nachhaltigkeitsbewertung, sondern als Kriterien ein wichtiger Teil jeder Methode.<br />
Sind die Kriterien festgelegt, ist im nächsten Schritt zu ermitteln, in wie weit sie erfüllt sind.<br />
Die Aussage „ist erfüllt" beinhaltet den Vergleich eines Ist-Werts mit einem Soll-Wert. Während<br />
die Festlegung von Soll-Werten meist wieder subjektive Entscheidungen erfordert, ist<br />
3 http://www.umweltbundesamt.de/dux/lu-inf.htm (2005-11-29)<br />
35
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 2. Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung<br />
die Bestimmung der Ist-Werte im Prinzip eine Ermittlung von Fakten. So können für einige<br />
der Kriterien bei ausreichender Verfügbarkeit quantitativer Daten die Ist-Werte (Ausprägungen)<br />
quantitativ bestimmt werden, z. B. die Menge des bei der Stromerzeugung emittierten<br />
CO 2 . Dabei sind keine Werturteile und damit kein Einbezug gesellschaftlicher Akteure erforderlich<br />
4 . Häufig reichen aber die Daten für eine quantitative Bestimmung nicht aus, z. B. weil<br />
die benötigten Szenario-Details nur unsicher oder nur qualitativ bekannt sind. In solchen<br />
Fällen sind oft Expertenschätzungen erforderlich, um bei unsicherer oder fehlender Datenlage<br />
die Ausprägungen von Kriterien abzuschätzen. Solche Expertenschätzungen sollten keine<br />
Werturteile enthalten, sind aber dennoch oft Gegenstand kontroverser Diskussionen, daher<br />
ist es empfehlenswert, die Einschätzungen mehrerer Experten einzuholen.<br />
Schließlich ist aus den Erfüllungsgraden der Kriterien zu bestimmen, in wie weit die Nachhaltigkeit<br />
erfüllt ist. Dies erfordert wiederum eine subjektive Bewertung der relativen Wichtigkeit<br />
der Kriterien unter einander. Hier ist wiederum eine Beteiligung von Akteuren sinnvoll.<br />
Da nicht jedes Verfahren alle diese Schritte umfasst, müssen u. U. mehrere Verfahren kombiniert<br />
werden, um die Aufgabe „Bewertung der Nachhaltigkeit" zu lösen.<br />
Je nachdem, ob bei den Bewertungen Akteure beteiligt werden oder nicht, sind „akteursunabhängige"<br />
und „akteursabhängige" Verfahren zu unterscheiden. Akteursunabhängige Verfahren<br />
enthalten meist keine bewertenden Schritte, andererseits benötigen einige akteursabhängige<br />
Verfahren als Entscheidungsgrundlage Daten, die von akteursunabhängigen Verfahren<br />
bereitgestellt werden können; daher stellen diese beiden Gruppen von Verfahren eine<br />
gegenseitige Ergänzung dar. Eine strikte Unterscheidung ist jedoch nicht möglich, da es<br />
Verfahren gibt, die Elemente aus beiden Gruppen enthalten.<br />
In folgenden werden zunächst die „akteursunabhängigen" Bewertungsverfahren anhand von<br />
Kriterien diskutiert. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus den Anforderungen, die an die<br />
Nachhaltigkeitsbewertung von Zukunftsoptionen zu stellen sind:<br />
• Untersuchungszielsetzung: Bewertung von Zukunftsoptionen,<br />
• Untersuchungsraum: Deutschland,<br />
• Komplexitätsgrad: multi-kriteriell, multi-dimensional, multi-sektoral,<br />
• Unsicherheit (bzgl. der Validität der Daten), die mit der Bewertung von Zukunftssituationen<br />
in Zusammenhang steht,<br />
• geringe Datenverfügbarkeit vor allem quantitativer Daten,<br />
• die Fähigkeit, ein eindeutiges Kriterium für die Gesamtbeurteilung zu liefern,<br />
• Transparenz der Bewertung (wird klar zwischen Fakten und Werturteilen unterschieden?)<br />
• die Möglichkeit, auch qualitative Größen (Kriterien) in die Bewertung einzubeziehen.<br />
Im zweiten Abschnitt werden „akteursbezogene" Bewertungsverfahren ausführlich beschrieben.<br />
4 Wenn man allerdings bereits die Wahl eines wissenschaftlichen Modells als „Werturteil" ansieht,<br />
sind auch hier „Werturteile" erforderlich.<br />
36
2.2 Akteursunabhängige Verfahren<br />
2.2 Akteursunabhängige Verfahren<br />
Bei akteursunabhängigen Verfahren sind keine gesellschaftlichen Akteure in das Verfahren<br />
eingebunden. Bei den Verfahren werden physische (z. B. bei der Ökobilanz und der Stoffstromanalyse)<br />
und ökonomische Bilanzierungen angewendet. Die ökonomische Bilanzierung<br />
hat den Nachteil, Stoffe ohne wirtschaftlichen Wert nicht zu erfassen; z. B. haben Abfälle und<br />
Abgase keine Wert, sie tauchen nur dann in den Bilanzen auf, wenn dafür Kosten entstehen<br />
(z. B. Entsorgungskosten oder Abgaben). In einer physischen Bilanzierung können sowohl<br />
ökologisch als auch ökonomisch bedeutende Stoff- und Energieflüsse berücksichtigt werden.<br />
Andererseits haben ökonomische Daten den Vorzug, häufig besser verfügbar zu sein.<br />
2.2.1 Kurze Einführung in die Verfahren<br />
Ökobilanz<br />
Die Ökobilanz ist in den DIN / EN ISO 14040, 14041 und 14042 definiert. Sie bilanziert die<br />
bei der Herstellung, Verwendung und Beseitigung eines Produkts oder einer Dienstleistung<br />
anfallenden energetischen und stofflichen Inputs und Outputs (Sachbilanz) und deren Wirkungen<br />
auf die Umwelt (Wirkungsbilanz). Wird nur die Sachbilanz durchgeführt, nennt die<br />
Norm dies eine „Sach-Ökobilanz-Studie". Die Norm verwendet den Begriff „Ökobilanz" als<br />
Übersetzung des englischen Begriffs „Life Cycle Assessment (LCA)" sowie den Begriff „Wirkungsabschätzung"<br />
für das englische „Life Cycle Impact Assessment".<br />
Charakteristisch für die Ökobilanz ist, dass in den obligatorischen Teilen nur naturwissenschaftliche<br />
und technische Zusammenhänge betrachtet und keine Wertungen vorgenommen<br />
werden, sie sind also streng akteursunabhängig. Die Ergebnisse „sind dem Entscheidungsträger<br />
vorzulegen", die Ökobilanz selbst liefert also nicht die Gesamtbewertung. In der Methode<br />
selbst ist nicht festgelegt, welche Wirkungskategorien bilanziert werden sollen und<br />
welche Sachbilanzen zu erfassen sind. Diese sind anhand der Zielsetzung der jeweiligen<br />
Studie festzulegen.<br />
Eine Anwendung des Verfahrens auf Zukunftsoptionen ist möglich, wenn darin die in der<br />
Ökobilanz benötigten Inputs, Outputs und Randbedingungen spezifiziert sind. Bei der Bilanzierung<br />
werden dann aber für alle Schritte des Produktlebenszyklus die gleichen Randbedingungen<br />
zugrunde gelegt, zeitliche Änderungen der Randbedingungen (z. B. Verbesserungen<br />
der Effizienz) im Verlauf des Produktlebenszyklus werden nicht berücksichtigt.<br />
Das Verfahren ist multikriteriell, die Kriterien beschränken sich aber auf die ökologische<br />
Dimension. Es kann auch multi-sektoral angewendet werden, indem entweder der Untersuchungsgegenstand<br />
sektorübergreifend definiert wird oder für jeden Sektor eine separate<br />
Ökobilanz aufgestellt wird.<br />
Die Anforderung an die Datenverfügbarkeit und -validität sind hoch und werden vom Detaillierungsgrad<br />
und Konsistenzgrad der vorliegenden Zukunftsszenarien nicht gedeckt, dennoch<br />
lassen sich einzelne Aspekte mit geringerer aber noch hinreichender Genauigkeit bilanzieren,<br />
bei denen wenige, hinreichend spezifizierte Daten die Bilanz dominieren, wie z. B.<br />
bei den CO 2-Emissionen der Stromerzeugung.<br />
Ein Kriterium für die Gesamtbeurteilung liefert die Ökobilanz nicht, wohl aber Ergebnisse, die<br />
als Basis für eine Gesamtbeurteilung dienen können.<br />
37
Teil I Nachhaltigkeit — Konzepte und Instrumente: 2. Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung<br />
Die folgende Tabelle fasst zusammen, inwieweit die Methode die Anforderungen erfüllt.<br />
Anforderungen an die Methode<br />
Bewertung von Zukunftsoptionen<br />
Untersuchungsraum Deutschland<br />
multi-kriteriell<br />
multi-dimensional<br />
multi-sektoral<br />
kann mit Unsicherheit u. geringer Validität der Daten umgehen<br />
kann mit geringer Datenverfügbarkeit umgehen<br />
eindeutiges Kriterium für die Gesamtbeurteilung<br />
Transparenz der Bewertung<br />
Einbezug qualitativer Größen (Kriterien)<br />
erfüllt von „Ökobilanz"?<br />
ja (mit Einschränkungen)<br />
ja<br />
ja<br />
nein, nur Umwelt<br />
ja<br />
nein<br />
nein<br />
nein<br />
ja<br />
nein<br />
Es existieren Methoden, die auf den Ergebnissen der Ökobilanz aufsetzen und eine gewichtete<br />
Aggregation in einen einzigen Indikator vornehmen, z. B. Eco-Indicator 99 5; dieser berücksichtigt<br />
die drei Dimensionen Verbrauch von mineralischen und fossilen Ressourcen,<br />
Schäden an Ökosystemen und Schäden an menschlicher Gesundheit, jedoch ohne die<br />
Wirkungskategorien Klimawandel, Eutrophierung, Versauerung und Ozonabbau. Allerdings<br />
sind beim Eco-Indicator 99 die Gewichte in der Methode festgelegt, eine Bewertung durch<br />
Akteure ist allenfalls für die abschließende Gewichtung der drei genannten Dimensionen<br />
vorgesehen. Daher fehlt dieser Methode die im vorliegenden Projekt erforderliche Transparenz<br />
der Bewertung.<br />
Produktlinienanalyse<br />
Eine Methode zur integrierten Analyse von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten<br />
wurde 1987 vom Öko-Institut unter dem Namen „Produktlinienanalyse" in Grundzügen<br />
entwickelt (Öko-lnstitut, Projektgruppe Ökologische Wirtschaft, 1987). Die Methode wird<br />
beim Öko-Institut jetzt nicht mehr weiter entwickelt und wird durch die „PROSA"-Methode<br />
abgelöst. In der Produktlinienanalyse können auch Akteure beteiligt werden, sie ist daher<br />
nicht im strengen Sinne „akteursunabhängig".<br />
Im Unterschied zur Ökobilanz ist die Produktlinienanalyse nicht normiert, der Begriff wird für<br />
unterschiedliche Verfahren angewendet. Beispielsweise sind für Klöpffer (1991) »„Produktlinienanalyse"<br />
und „Ökobilanz" [...] Synonyma«. Nach dem ursprünglichen Ansatz verwendet<br />
die Produktlinienanalyse zur Erstellung der ökologischen Sach- und Wirkungsbilanz die<br />
Ökobilanz, geht aber über die Ökobilanz hinaus, indem erstens vor der Auswahl des zu<br />
analysierenden Produkts die Bedürfnislage hinterfragt wird, und zweitens nicht nur ökologische,<br />
sondern zusätzlich wirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkungen untersucht werden.<br />
In der Produktlinienanalyse (PLA) ist außerdem eine Bewertung vorgesehen, es ist aber<br />
nicht festgelegt, wie diese durchgeführt werden soll: »Ein wichtiges Merkmal des ursprünglichen<br />
Konzepts der PLA war der Umgang mit der Bewertungsfrage. Dabei wurde zunächst<br />
davon ausgegangen, dass bereits die a priori getroffene Entscheidung, gleichgewichtig die<br />
5 http://www.pre.nl/eco-indicator99/default.htm (2005-12-02)<br />
38
2.2 Akteursunabhängige Verfahren<br />
Auswirkungen auf Natur, Gesellschaft und Wirtschaft zu betrachten, eine normative Wertsetzung<br />
darstellt. Eine weitere Anleitung zur Bewertung enthält die Produktlinienanalyse selbst<br />
nicht. Vielmehr wurde eine Bewertungsoffenheit postuliert, um damit den Bearbeiter und<br />
Benutzer einer PLA zu zwingen, sich über seine eigenen Bewertungskriterien und auch<br />
diejenigen seiner Opponenten klar zu werden, sie offen zu legen und sie damit auch für<br />
andere einsehbar zu machen.« (Weinbrenner, 1995).<br />
Bei detaillierter Durchführung stellt die Produktlinienanalyse die gleichen Anforderungen an<br />
Umfang und Qualität ökologisch relevanter Daten wie die Ökobilanz, zusätzlich werden noch<br />
Daten für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Sektor benötigt. Wie zu erwarten, ist<br />
eine Quantifizierung der gesellschaftlichen Aspekte schwierig. So wurden in der „Produktlinienanalyse<br />
Waschen und Waschmittel" als Analyse-Tools eingesetzt: »Ökobilanzen, Lebenszykluskostenrechnung,<br />
statische 6 Erhebungen (Zeitverbrauch der Haushalte), qualitative<br />
Beschreibung sozialer Aspekte ("Fact Finding Report"); Risk Assessment von niederen<br />
Waschtemperaturen« (Öko-lnstitut, 2004).<br />
Die Produktlinienanalyse ist multikriteriell und im Unterschied zur Ökobilanz auch multidimensional.<br />
Eine multi-sektorale Bewertung ist im Konzept der Methode nicht vorgesehen,<br />
die sinngemäße Anwendung der Methode auf mehrere Sektoren ist aber prinzipiell möglich.<br />
Durch die Integration der Bewertung ist eine Gesamtbeurteilung möglich, dabei können auch<br />
akteursabhängige Verfahren eingesetzt werden.<br />
Die Produktlinienanalyse ist nicht so strikt definiert wie die Ökobilanz. Sie beschreibt eher<br />
eine Vorgehensweise als eine eindeutige Methode. Je nach ihrer konkreten Ausgestaltung<br />
können unterschiedliche Merkmale besonderes Gewicht bekommen: Wird der Schwerpunkt<br />
auf eine detaillierte Ökobilanz gelegt, dann treten die Merkmale einer Ökobilanz hervor (hoher<br />
Bedarf an validen Daten); wird der Schwerpunkt auf den Bewertungsprozess gelegt,<br />
dann können auch unsichere und qualitative Größen einbezogen werden.<br />
Eine Übertragung der Vorgehensweise auf die Bewertung von Zukunftsoptionen ist möglich,<br />
man verlässt dabei aber die ursprüngliche Intention der Produktlinienanalyse, insbesondere<br />
die Anknüpfung an die Bedürfnisfrage. Außerdem muss man dann auf detaillierte Ökobilanzen<br />
verzichten und die Ausprägung der Bewertungskriterien auf andere Weise ermitteln.<br />
Die folgende Tabelle fasst zusammen, inwieweit die Methode die Anforderungen erfüllt.<br />
6 (sic) Sollte vermutlich „statistische" lauten.<br />
39
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 2. Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung<br />
Anforderungen an die Methode<br />
Bewertung von Zukunftsoptionen<br />
Untersuchungsraum Deutschland<br />
multi-kriteriell<br />
multi-dimensional<br />
multi-sektoral<br />
kann mit Unsicherheit u. geringer Validität der Daten umgehen<br />
kann mit geringer Datenverfügbarkeit umgehen<br />
eindeutiges Kriterium für die Gesamtbeurteilung<br />
Transparenz der Bewertung<br />
Einbezug qualitativer Größen (Kriterien)<br />
erfüllt von<br />
„Produktlinienanalyse"?<br />
im ursprünglichen Ansatz nicht, die<br />
Übertragung der Vorgehensweise<br />
ist aber möglich<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
im ursprünglichen Ansatz nicht,<br />
aber prinzipiell möglich<br />
bei geeigneter Gestaltung des<br />
Bewertungsprozesses<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
Wie bereits beschrieben, wird beim Öko-lnstitut die Produktlinienanalyse als Methode nicht<br />
mehr weiter entwickelt und durch die „PROSA"-Methode' ersetzt. PROSA ist die Abkürzung<br />
für „Product Sustainability Assessment". Sie ist eine Weiterentwicklung der Produktlinienanalyse<br />
und enthält als Bausteine Methoden zur Szenarien-Findung, zur Bilanzierung (z. B.<br />
Ökobilanz, Lebenszyklus-Kosten, Socio-Analyse) und zur Bewertung. Die Methode befindet<br />
sich noch (Jan. 2006) in Entwicklung, insbesondere die Bausteine „Socio-Analyse" und<br />
„Bewertungs-Modell Nachhaltigkeit".<br />
Stoffstromanalyse<br />
Die Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt" benutzt in ihrem Zwischenbericht<br />
1993 (Bundestags-Drucksache 12/5812) den Begriff „Stoffstromanalyse" nicht<br />
für eine Methode, sondern für die Aufgabenstellung einer »systematischen Bestandsaufnahme<br />
des Wegs eines chemischen Elements (z. B. Chlor, Cadmium), einer Verbindung<br />
(z. B. Benzol) oder eines Materials (z. B. Holz, Kies, PVC) im Naturkreislauf und/oder durch<br />
den Wirtschaftskreislauf«. Daher heißt es dort weiter: »Methodisch stehen für eine derartige<br />
Stoffstromanalyse vielfältige Verfahren zur Verfügung. Sie reichen von den Stücklisten, Inventarlisten<br />
über die „Stoffbuchhaltung", „Stofftabellen" hin zu anderen Erfassungsformen wie<br />
Stoff- und Materialbilanzen, Ablaufdiagramme, Stoffflussschemata, Stoffstromdiagramme<br />
usw.«<br />
Weinbrenner (1995) nennt die Stoffstromanalyse ein »makroökonomisches Informationssystem«<br />
im Gegensatz zu den »mikroökonomischen Informationssystemen der Produkt-Ökobilanz<br />
und der Produktlinienanalyse«.<br />
Während die Ökobilanz sich auf ein Produkt oder eine Dienstleistung konzentriert und alle<br />
damit verbundenen relevanten Stoff- und Energieströme betrachtet, konzentriert sich die<br />
Stoffstromanalyse auf einen Stoff und betrachtet alle Verwendungen und Transporte dieses<br />
Stoffs.<br />
40<br />
http://www.prosa.org (2005-11-29)
2.2 Akteursunabhängige Verfahren<br />
Mit dieser Fokussierung ist die Stoffstromanalyse nicht multikriteriell und damit nicht für die<br />
hier vorliegende Aufgabenstellung geeignet, sie kann aber als Hilfsmethode z. B. in einer<br />
Ökobilanz herangezogen werden.<br />
Die folgende Tabelle fasst zusammen, inwieweit die Methode die Anforderungen erfüllt.<br />
Anforderungen an die Methode<br />
Bewertung von Zukunftsoptionen<br />
Untersuchungsraum Deutschland<br />
multi-kriteriell<br />
multi-dimensional<br />
multi-sektoral<br />
kann mit Unsicherheit u. geringer Validität der Daten umgehen<br />
kann mit geringer Datenverfügbarkeit umgehen<br />
eindeutiges Kriterium für die Gesamtbeurteilung<br />
Transparenz der Bewertung<br />
Einbezug qualitativer Größen (Kriterien)<br />
erfüllt von „Stoffstromanalyse"?<br />
nein<br />
ja<br />
nein<br />
nein<br />
ja<br />
nein<br />
nein<br />
außerhalb der Fragestellung<br />
ja<br />
nein<br />
Umweltökonomische Gesamtrechnung<br />
Die Umweltökonomische Gesamtrechnung ist eine Erweiterung der Volkswirtschaftlichen<br />
Gesamtrechnung um Umweltbelastungen, Umweltzustand und Umweltmaßnahmen. Beide<br />
werden in Deutschland vom Statistischen Bundesamt durchgeführt.<br />
Die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) für Deutschland beschreiben das wirtschaftliche<br />
Geschehen in Produktion, Verteilung und Verwendung in makroökonomischen<br />
Größen. Diese Größen sind einerseits nach verschiedenen Branchen und privaten Haushalten,<br />
andererseits nach Warenkategorien aufgeschlüsselt. Angegeben werden Bestände und<br />
Ströme von Waren und Dienstleistungen in monetären Einheiten.<br />
Die Umweltökonomische Gesamtrechnung (UGR) erweitert die VGR um Umweltbelastungen<br />
durch Materialflüsse, wie z. B. die pro Jahr entnommenen Rohstoffe, die pro Jahr emittierten<br />
Schadstoffe usw. sowie um Umweltzustandsgrößen. Beim Umweltzustand handelt es sich im<br />
Gegensatz zu den Belastungen um die Beschreibung eines Bestandes. Beispielsweise soll<br />
dargestellt werden, wie viel Bodenfläche von welchem wirtschaftlichen Akteur zu einem<br />
bestimmten Zeitpunkt für Siedlungs- und Verkehrszwecke beansprucht wird.<br />
Sowohl bei den Umweltbelastungen als auch beim Umweltzustand besteht ein wesentlicher<br />
Unterschied zu den VGR-Konten darin, dass die Ströme bzw. Bestände nicht mehr in Geldeinheiten<br />
dargestellt werden, sondern in den „ursprünglichen" physischen Einheiten (Umweltnutzung<br />
und Wirtschaft, 2005).<br />
Die UGR haben eine ausschließlich beschreibende, also keine wertende Funktion. Vom<br />
Ansatz basieren sie auf Statistik, sind also retrospektiv und können keine Aussagen über<br />
Zukunftsszenarien machen. Jedoch können die in den VGR und UGR erstellten Input-<br />
Output-Tabellen in Analysen verwendet werden, siehe nächsten Abschnitt.<br />
Die folgende Tabelle fasst zusammen, inwieweit die Methode die Anforderungen erfüllt.<br />
41
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 2. Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung<br />
Anforderungen an die Methode<br />
Bewertung von Zukunftsoptionen<br />
Untersuchungsraum Deutschland<br />
multi-kriteriell<br />
multi-dimensional<br />
multi-sektoral<br />
kann mit Unsicherheit u. geringer Validität der Daten umgehen<br />
kann mit geringer Datenverfügbarkeit umgehen<br />
eindeutiges Kriterium für die Gesamtbeurteilung<br />
Transparenz der Bewertung<br />
Einbezug qualitativer Größen (Kriterien)<br />
erfüllt von „Umweltökonomische<br />
Gesamtrechnung"?<br />
nein<br />
ja<br />
ja<br />
nur Ökonomie und Ökologie<br />
ja<br />
Die Methode stellt Daten zur Verfügung,<br />
aber nicht für die Zukunft<br />
nein<br />
ja<br />
nein<br />
Input-Output -Analyse<br />
Die Input-Output-Analyse ist ein Verfahren der empirischen Wirtschaftsforschung, das für<br />
volkswirtschaftliche Analysen eingesetzt wird. Kern der Input-Output-Analyse ist die Input-<br />
Output-Tabelle. In ihren Zeilen findet man die Information, wofür die Produktion (der Output)<br />
eines jeden Sektors verwendet wird. In den Spalten kann man ablesen, welche Vorprodukte<br />
und Produktionsfaktoren (Inputs) man für die Produktion benötigt. Der Tabellenwert a, ,k steht<br />
für die Lieferungen des Sektors i an den Sektor k. Alle Werte beziehen sich auf Geldeinheiten.<br />
Solche Tabellen werden z. B. in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des Statistischen<br />
Bundesamts erstellt. Bei der Umweltökonomischen Gesamtrechnung kommen weitere Input-<br />
Output-Tabellen hinzu, in denen Stoff- und Energieströme verknüpft werden; diese werden<br />
nicht in Geldeinheiten, sondern in physischen Einheiten angegeben.<br />
Das Prinzip der Input-Output-Tabellen wird auch in Ökobilanzen angewendet, z. B. von<br />
Frischknecht et al. (1996). Dort sind die Tabellenwerte in physischen Einheiten angegeben<br />
(z. B. Material-Inputs in kg pro Stromerzeugung in kWh).<br />
Klann und Schulz (2003) verwenden die Input-Output-Analyse zur Erstellung nationaler<br />
Ökobilanzen. Weil die Methodik von Prozesskettenanalysen für Ökobilanzen sehr detaillierte<br />
Eingangsdaten erfordert, ist sie wenig geeignet, einen Überblick über größere Bereiche oder<br />
gar die gesamte Volkswirtschaft zu geben. Andererseits liefert die Input-Output-Analyse<br />
Daten nur in relativ groben Kategorien (nach Branchen und großflächig), so dass sie keine<br />
Aussage über bestimmte Anlagen oder Technologien machen kann. Aufgrund der verschiedenen<br />
Charakteristika ist es naheliegend, Input-Output-Analysen komplementär zu Prozesskettenanalysen<br />
einzusetzen: Man kann damit Werte für in Prozesskettenanalysen nicht<br />
beachtete Vorleistungen – insbesondere Dienstleistungen – abschätzen, wie z. B. in Marheineke<br />
(2002). Dabei muss man sich aber bewusst sein, dass eine solche Abschätzung auf<br />
derzeitigen Daten basiert und zukünftige Entwicklungen, beispielsweise Änderungen von<br />
Rohstoffbedarf, Arbeits- und Transportaufwand durch geänderte Produktionsverfahren, darin<br />
nicht berücksichtigt sind.<br />
Eine Analyse auf der Basis der Input-Output-Tabellen der Umweltökonomischen Gesamtrechnung<br />
ist multi-sektoral und multi-kriteriell, berücksichtigt aber im Wesentlichen nur die<br />
42
2.2 Akteursunabhängige Verfahren<br />
beiden Dimensionen Wirtschaft und Umwelt. Aussagen für den Untersuchungsraum<br />
Deutschland sind möglich, aber die Umweltdaten beschränken sich auf quantitativ bedeutsame<br />
Größen. Die Analyse von zukünftigen Entwicklungen und Zukunftsszenarien ist nicht<br />
möglich, da die Daten aus den Input-Output-Tabellen nur für das Erfassungsjahr gelten.<br />
Die folgende Tabelle fasst zusammen, inwieweit die Methode die Anforderungen erfüllt.<br />
Anforderungen an die Methode<br />
Bewertung von Zukunftsoptionen<br />
Untersuchungsraum Deutschland<br />
multi-kriteriell<br />
multi-dimensional<br />
multi-sektoral<br />
kann mit Unsicherheit u. geringer Validität der Daten umgehen<br />
kann mit geringer Datenverfügbarkeit umgehen<br />
eindeutiges Kriterium für die Gesamtbeurteilung<br />
Transparenz der Bewertung<br />
Einbezug qualitativer Größen (Kriterien)<br />
erfüllt von<br />
„Input-Output-Analyse"?<br />
nein<br />
ja<br />
ja<br />
nur Ökonomie und Ökologie<br />
ja<br />
Die Methode stellt Daten zur Verfügung,<br />
aber nicht für die Zukunft<br />
nein<br />
ja<br />
nein<br />
Umweltökonomische Simulationsmodelle<br />
Während die Volkswirtschaftliche und Umweltökonomische Gesamtrechnung die statistisch<br />
erfassten Vorgänge, also die Vergangenheit beschreiben, machen umweltökonomische<br />
Simulationsmodelle Prognosen des zukünftigen Verlaufs dieser Vorgänge. Im ökonomischen<br />
Modell werden bestimmte Zusammenhänge als gegeben vorausgesetzt und die Reaktion<br />
des Systems z. B. auf geänderte Steuern, Zinssätze oder Energiepreise berechnet. Der<br />
Umweltteil des Modells errechnet daraus die Umweltbelastungen, z. B. Emissionen, auf der<br />
Basis der Daten der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen. Ein Beispiel für ein umweltökonomisches<br />
Simulationsmodell ist PANTA RHEI 8 . Mit diesem Modell werden Simulationen<br />
u. a. zur ökologischen Steuerreform, zu Emissionssteuern, verschiedenen Energiesteuern<br />
und dem Ausstieg aus der Kernenergie gerechnet.<br />
Das Simulationsmodell PANTA RHEI berechnet, welche Zukunftsentwicklung zu erwarten ist,<br />
wenn bestimmte (vor allem ökonomische) Randbedingungen gesetzt werden. Die Zukunftsentwicklungen<br />
der meisten Modellparameter können nicht extern vorgegeben werden, sondern<br />
werden modellintern berechnet. So wird z. B. der technologische Fortschritt als durch<br />
den Kostendruck und einen Zeitfaktor bedingte Effizienzsteigerung berechnet (Distelkamp et<br />
al. 2003). Auch in einer zukünftigen Weiterentwicklung des Modells, in der eine Wahl zwischen<br />
alternativen Technologien ermöglicht werden soll, soll diese Wahl modellintern auf der<br />
Basis des ökonomischen Vorteils getroffen werden (ebd.). In dieser Weise werden zwar<br />
gewisse zukünftige Entwicklungen berücksichtigt, jedoch beschränkt auf die im Modell vorgesehenen<br />
Zusammenhänge, die übrigen Daten werden auf der Basis der Input-Output-<br />
Tabellen fortgeschrieben. Davon abweichende Zukunftsentwicklungen können nicht modelliert<br />
werden. Durch die modellinterne Bereitstellung aller Daten stellt die Methode keine<br />
8 http://www.gws-os.de/Research/Modelle/panta%2Orhei/panta.htm (2005-11-30)<br />
43
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 2. Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung<br />
hohen Anforderungen an die verfügbaren Daten, andererseits bedeutet dies aber, dass auch<br />
nur diese Daten verwendet werden können und keine anderen, die beispielsweise ein vorgegebenes<br />
Szenario beschreiben.<br />
Die folgende Tabelle fasst zusammen, inwieweit die Methode die Anforderungen erfüllt.<br />
Anforderungen an die Methode<br />
Bewertung von Zukunftsoptionen<br />
Untersuchungsraum Deutschland<br />
multi-kriteriell<br />
multi-dimensional<br />
multi-sektoral<br />
kann mit Unsicherheit u. geringer Validität der Daten umgehen<br />
kann mit geringer Datenverfügbarkeit umgehen<br />
eindeutiges Kriterium für die Gesamtbeurteilung<br />
Transparenz der Bewertung<br />
Einbezug qualitativer Größen (Kriterien)<br />
erfüllt von „Umweltökonomische<br />
Simulationsmodelle"?<br />
nur bestimmte Entwicklungen können<br />
modelliert werden, aber keine<br />
beliebig vorgegebenen Szenarien<br />
ja<br />
ja<br />
nur Ökonomie und Ökologie<br />
ja<br />
Die Methode stellt Daten zur<br />
Verfügung, aber nur eingeschränkt<br />
für Zukunftsoptionen<br />
nein<br />
ja<br />
nein<br />
Kosten-Nutzen-Analyse<br />
Die Kosten-Nutzen-Analyse (KNA) wird hauptsächlich dazu benutzt, die Effizienz von Projekten<br />
zu beurteilen, die nicht primär der Erzielung monetärer Gewinne dienen, insbesondere<br />
staatlicher Projekte. Sie ist für Projekte der Öffentlichen Hand in Deutschland vorgeschrieben.<br />
Im Gegensatz zu einer rein betriebswirtschaftlichen Rechnung werden dabei auch<br />
Kosten und Nutzen einbezogen, die extern (außerhalb der wirtschaftlichen Betrachtungseinheit)<br />
anfallen. Bei einem Autobahnbau sind direkte (interne) Kosten die Kosten für die<br />
Grundstücke und Bauarbeiten, diese trägt die Öffentliche Hand. Externe Kosten sind beispielsweise<br />
für Anwohner eine Verlängerung der Fahrtwege, wo die Autobahntrasse bisherige<br />
Nebenstraßen unterbricht, sowie der Verkehrslärm. Der externe Nutzen besteht in einer<br />
Verkürzung der Fahrzeit für die Benutzer der Autobahn. Zur Durchführung der KNA müssen<br />
alle Kosten und Nutzen monetarisiert werden.<br />
Problematisch bei dieser Methode ist erstens die Abgrenzung des Betrachtungsumfangs.<br />
Was ist als Kosten zu betrachten: Nur die Verlängerung der Fahrtwege für die Anwohner,<br />
oder z. B. auch die zusätzliche Lärmbelastung, Luftverschmutzung, Beeinträchtigung des<br />
Landschaftsbilds oder Beeinträchtigung von Ökosystemen? Was ist als Nutzen zu betrachten:<br />
Die Verringerung von Fahrzeiten, oder auch neue Gewerbeansiedlungen im durch die<br />
Autobahn erschlossenen Gebiet? Soll die Verringerung der Fahrzeit nur von deutschen<br />
Fahrzeugen oder auch von ausländischen Fahrzeugen als Nutzen eingerechnet werden? Ist<br />
eine etwaige Erhöhung des gesamten Verkehrsaufkommens durch das attraktivere Autobahnnetz<br />
den Nutzen, den Kosten, oder gar nicht anzurechnen?<br />
Zweitens ist die Monetarisierung von externen Kosten und Nutzen unsicher: Der monetäre<br />
Schaden durch die Lärmbelastung kann z. B. als Kosten von Lärmschutzmaßnahmen oder<br />
44
2.2 Akteursunabhängige Verfahren<br />
als Wertverlust von Grundstücken bzw. Verringerung von Mieteinnahmen oder als Kosten für<br />
lärmbedingte Erkrankungen oder Kombination dieser Kosten berechnet werden.<br />
Drittens hat bei der Kosten-Nutzen-Bilanz die Diskontierung von in der Zukunft anfallenden<br />
Kosten und Nutzen einen großen Einfluss, umstritten ist aber die Höhe des anzusetzenden<br />
Zinssatzes.<br />
Die Methode kann Zukunftsoptionen bewerten. Die Anwendung auf den Untersuchungsraum<br />
Deutschland ist prinzipiell möglich. Die Methode wurde bisher aber nur auf einzelne Projekte<br />
angewendet, nicht auf komplette Szenarien; für umfassende Szenarien ist es kaum möglich,<br />
valide Schätzungen von Kosten und Nutzen anzugeben, da die geringe Datenverfügbarkeit<br />
bereits bei einem einzelnen Projekt Probleme bereitet. Prinzipiell ist die Methode multikriteriell,<br />
multidimensional und multi-sektoral angelegt, unklar ist aber, wer die einzubeziehenden<br />
Kriterien auszuwählen hat. Die Methode liefert ein eindeutiges Kriterium für die Gesamtbeurteilung.<br />
Datenunsicherheit und geringe Datenverfügbarkeit führen aber zu geringer Belastbarkeit<br />
der Ergebnisse.<br />
Die Transparenz ist gering, weil Werturteile nicht explizit ausgewiesen werden. Einige qualitative<br />
Kriterien werden berücksichtigt, indem dafür Geldwerte angesetzt werden. Für diese<br />
Monetarisierung gibt es unterschiedliche Ansätze, die zu erheblichen Unterschieden im<br />
Ergebnis führen können.<br />
Die folgende Tabelle fasst zusammen, inwieweit die Methode die Anforderungen erfüllt.<br />
Anforderungen an die Methode<br />
Bewertung von Zukunftsoptionen<br />
Untersuchungsraum Deutschland<br />
multi-kriteriell<br />
multi-dimensional<br />
multi-sektoral<br />
kann mit Unsicherheit u. geringer Validität der Daten umgehen<br />
kann mit geringer Datenverfügbarkeit umgehen<br />
eindeutiges Kriterium für die Gesamtbeurteilung<br />
Transparenz der Bewertung<br />
Einbezug qualitativer Größen (Kriterien)<br />
erfüllt von<br />
„Kosten-Nutzen-Analyse"?<br />
nur für einzelne Projekte<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
ja<br />
nein<br />
nein<br />
ja<br />
nein<br />
nur mittels Monetarisierung<br />
Kennzahlen<br />
Eine Kennzahl ist eine Zahl, die das Verhältnis zwischen einem Istwert und einem Zielwert<br />
(oder Grenzwert) ausdrückt. Häufig werden dabei mehrere Beiträge aggregiert.<br />
Die Eigenschaften von Kennzahlen lassen sich an der Kennzahl „Deutscher Umweltindex"<br />
(kurz DUX)9 des Umweltbundesamtes veranschaulichen:<br />
»Der DUX setzt sich aus den unterschiedlichen Werten der 9 Einzelindikatoren des Umwelt-<br />
Barometers zusammen. Jeder Einzelwert kann maximal 1000 Punkte erreichen. Allen Indika-<br />
9 http://www.umweltbundesamt.de/dux/dux.htm (2005-11-29)<br />
45
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 2. Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung<br />
toren liegen quantitative Ziele zu Grunde. Die Anzahl der Punkte ist ein Maß für die Erreichung<br />
dieses Ziels gegenüber dem Bezugsjahr. Die Indikatoren des Umwelt-Barometers sind<br />
Klima, Luftqualität, Boden (Flächenverbrauch), Wasser, Energieproduktivität, Rohstoffproduktivität,<br />
Mobilität, Landwirtschaft (N-Überschuss) und Artenvielfalt.«<br />
Der Indikator „Luftqualität" beispielsweise ist wiederum ein aggregierter Wert. Er ist der Wert<br />
der »Emissionsminderung in Prozent von Schwefeldioxid (SO 2 ), Stickstoffoxid (NOx), Ammoniak<br />
(NH 3) und flüchtigen organischen Verbindungen (NMVOC) seit 1990 (Mittelwert).« Zielwert<br />
ist »Emissionsminderung [...] um 70% bis 2010 auf der Basis von 1990.«10<br />
Vorteile einer solchen Kennzahl sind: Sie bezieht sich auf Zielwerte und zeigt deren Erreichung<br />
an. Trends sind unmittelbar zu erkennen. Ein Nachteil ist die Beschränkung auf eine<br />
bestimmte Zielsetzung: »Für die Beschreibung der Umweltqualität in Deutschland als Ganzes<br />
kann der DUX nicht herangezogen werden; vielmehr stellt er eine Messlatte dar, die<br />
zeigt, inwieweit ausgewählte, in der Umweltpolitik formulierte Ziele erreicht worden sind.«11<br />
Die Setzung der Zielwerte erfordert Wertungen, die in der Methode nicht transparent gemacht<br />
werden.<br />
Die Daten zur Berechnung des DUX-Werts werden aus den Statistiken des Statistischen<br />
Bundesamts entnommen. Für Zukunftsoptionen sind keine Statistiken verfügbar, die Daten<br />
müssen dann auf andere Weise ermittelt werden. Hierzu könnten beispielsweise Ökobilanzen<br />
erstellt werden.<br />
Die folgende Tabelle fasst zusammen, inwieweit die Methode die Anforderungen erfüllt.<br />
Anforderungen an die Methode<br />
Bewertung von Zukunftsoptionen<br />
Untersuchungsraum Deutschland<br />
multi-kriteriell<br />
multi-dimensional<br />
multi-sektoral<br />
kann mit Unsicherheit u. geringer Validität der Daten umgehen<br />
kann mit geringer Datenverfügbarkeit umgehen<br />
eindeutiges Kriterium für die Gesamtbeurteilung<br />
Transparenz der Bewertung<br />
Einbezug qualitativer Größen (Kriterien)<br />
erfüllt von „Kennzahlen"?<br />
nein<br />
ja<br />
eingeschränkt<br />
nein<br />
ja<br />
nein<br />
nein<br />
ja<br />
nein<br />
nein<br />
2.2.2 Diskussion der Verfahren<br />
Charakteristisch für die „akteursunabhängigen" Verfahren ist, dass alle in irgendeiner Form<br />
eine Bilanzierung (unter Umständen auch qualitativ) vornehmen und bei einigen zusätzlich<br />
eine Wertung oder Aggregierung erfolgt. Indikatoren nehmen eine Sonderstellung ein, da sie<br />
kein Verfahren im eigentlichen Sinn darstellen, sondern den Betrachtungsumfang der Bilanzierung<br />
festlegen und die Schnittstelle zur Wertung oder Aggregierung bilden.<br />
10 http://www.umweltbundesamt.de/dux/lu-inf.htm (2005-11-29)<br />
11 http://www.umweltbundesamt.de/dux/faq.htm (2005-11-29)<br />
46
2.3 Akteursabhängige Verfahren<br />
Hinsichtlich der Bilanzierung lassen zwei Gruppen unterscheiden: Zum einen die Gruppe<br />
Ökobilanz, Produktlinienanalyse und PROSA, die bei der Bilanzierung von einem einzelnen<br />
Produkt ausgeht („mikro-ökonomisch" bzw. „mikro-ökologisch"), zum anderen die Gruppe<br />
Input-Output-Analyse, umweltökonomische Gesamtrechnung und umweltökonomische Simulationsmodelle,<br />
die eine gesamtwirtschaftliche Bilanzierung vornimmt („makro-ökonomisch"<br />
bzw. „makro-ökologisch"). Die beiden Gruppen unterscheiden sich auch hinsichtlich der<br />
benötigten Daten, so dass sie eine gegenseitige Ergänzung bilden können. Kosten-Nutzen-<br />
Analyse und Kennzahlen bauen auf den genannten Verfahren auf und nehmen aggregierende<br />
Wertungen vor.<br />
Hinsichtlich der Aggregierung und Wertung ergibt sich eine andere Einteilung: Ökobilanz,<br />
Input-Output-Analyse, umweltökonomische Gesamtrechnung und umweltökonomische Simulationsmodelle<br />
enthalten keine Aggregierung oder Wertung. Kennzahlen enthalten eine<br />
implizite, nicht transparente Aggregierung. Die Kosten-Nutzen-Analyse führt eine Bewertung<br />
mittels Monetarisierung durch, allerdings bisher ohne Beteiligung gesellschaftlicher Akteure.<br />
Produktlinienanalyse und PROSA nehmen multiattribute Wertungen vor, gegebenenfalls<br />
auch unter Einbezug gesellschaftlicher Akteure.<br />
Die Ergebnisse von Ökobilanzen und ähnlicher Verfahren sind allerdings nicht robust, sondern<br />
hängen davon ab, welche Materialien und Substanzen bilanziert werden und welche<br />
nicht, und welche Methodik im Detail gewählt wird. Außerdem können aus derselben Studie<br />
sehr unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen werden, abhängig davon, welche Fragen<br />
an die Studie gestellt werden, z. B. welche Bilanzergebnisse als besonders wichtig anzusehen<br />
sind (Finnveden 2000).<br />
Daher sollten „akteursunabhängige" Verfahren nur eingebettet in einen Prozess verwendet<br />
werden, in dem die von diesen Verfahren zu beantwortenden Fragen und die verwendete<br />
Methodik von den beteiligten Akteuren festgelegt werden.<br />
2.3 Akteursabhängige Verfahren<br />
In akteursabhängigen Verfahren wird auf der Basis vorliegender Informationen durch die<br />
beteiligten Akteure eine Gesamtbewertung vorgenommen. Die als Grundlage dienenden<br />
Informationen können u. a. von den im vorigen Abschnitt beschriebenen akteursunabhängigen<br />
Verfahren bereitgestellt werden. Als Beispiele werden im folgenden Planungswerkstatt,<br />
Planungszelle, Delphi-Verfahren und die Nutzwertanalyse dargestellt.<br />
Bei den akteursabhängigen Verfahren werden entweder Laien durch repräsentative Auswahl<br />
aus der Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger für einen Planungsprozess ausgewählt<br />
(Planungszelle) (Dienel 1978) oder in sog. Planungswerkstätten zusätzlich interessierte<br />
Vereine oder Ortsgruppen zur Abbildung des sozialen Strukturgefüges beteiligt (Tschiedel,<br />
1997; Tacke, 1999). Delphi-Verfahren beteiligen vornehmlich wissenschaftliche Experten. Die<br />
Nutzwertanalyse lässt die Art der partizipierenden gesellschaftlichen Gruppe uneingeschränkt.<br />
Die Beschreibung eines jeden Verfahrens beginnt mit einer Definition. Anschließend werden<br />
charakteristische Merkmale der jeweiligen Verfahren aufgezeigt. Darauf folgend werden mit<br />
dem Instrument intendierte Zielsetzungen heraus gestellt und die Anwendungsbereiche<br />
näher erläutert, bevor Aufbau sowie Vor- und Nachteile erörtert werden. Die Betrachtung<br />
47
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 2. Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung<br />
schließt mit der Kurzbeschreibung eines Anwendungsbeispiels aus dem Bereich der netzgebundenen<br />
<strong>Versorgung</strong>.<br />
2.3.1 Planungszelle<br />
Begriff und Definition<br />
Der Begriff „Planungszelle" geht im deutschen Sprachraum auf Dienel (1971) zurück. Begriffe<br />
wie „Bürgerforum" konnten sich nicht durchsetzen. Der Begriff Planungszelle wurde auch in<br />
der japanischen Literatur übernommen Die englischen Veröffentlichungen sprechen von<br />
„Citizen Jury". In Südafrika wird von „Peoples Planning" gesprochen. Und in Spanien nennt<br />
sich die Merkmalskombination seit Ende der 80 Jahre „Nucleos de Intervention Participativa"<br />
(Dienel & Trütken, 1999). Durch eine repräsentative Auswahl aus der Gesamtheit der Bürgerinnen<br />
und Bürger werden Laien für einen Planungsprozess ausgewählt. Die Ergebnisse sind<br />
gemeinsam erarbeitete Empfehlungen, die zu einem sog. Bürgergutachten zusammengefasst<br />
werden (Dienel, 1978).<br />
Merkmale<br />
Kennzeichen der Planungszelle ist die aktive Beteiligung des Bürgers an Planungsprozessen.<br />
Den Beteiligungsprozess charakterisieren folgende Merkmale: Die Informiertheit der<br />
Teilnehmer. Diese wird dadurch sichergestellt, dass alle vom Problem Betroffenen Gelegenheit<br />
erhalten, sich zu Beginn der Planungszelle durch Referate, Hearings oder Ortsbegehungen<br />
zu informieren. Neben der Experteninformation ist als weiteres Kriterium das Gespräch<br />
zu nennen. Denn der direkte Austausch (deliberation) ist für die Meinungsbildung von großer<br />
Bedeutung. So sind die 25 Teilnehmer einer Planungszelle die meiste Zeit in fünf gleich<br />
großen Gruppen tätig, deren Zusammensetzung von Sitzung zu Sitzung rotiert. Außerdem<br />
müssen die Verfahrensbeteiligten an vier Arbeitstagen voll zur Verfügung stehen können, um<br />
hinreichend Zeit für die Bearbeitung der Problemstellung zu haben.<br />
Die Auswahl der Teilnehmer in einem Auswahlbezirk erfolgt per Zufallsprinzip, um eine Vielzahl<br />
von möglicherweise entgegenstehenden Teilinteressen einzubinden. Eine Verzerrung<br />
zugunsten bestimmter Interessengruppen, aber auch ein Missbrauch von „Profilierungssüchtigen"<br />
wird mit diesem Auswahlverfahren auszuschließen gesucht (Dienel & Trütken, 1999;<br />
Beckmann & Keck, 1999).<br />
Ein weiteres Merkmal der Planungszelle stellt der konkrete Auftrag durch einen meist öffentlichen<br />
Auftraggeber dar. Es wird nicht als Problem-Suchgruppe gearbeitet. Die Teilnehmer an<br />
einer Planungszelle sind in der Rolle eines unabhängigen Gutachters, da die Repräsentanten<br />
der organisierten Interessen nur als Referenten auftreten, aber kein Stimmrecht haben.<br />
Ziele bzw. Aufgaben<br />
Ziel dieses Instruments ist der verstärkte Einbezug des Bürgers in die Erörterung, Bewertung<br />
und Entscheidung der gegenwärtig anstehenden Probleme (Dienel & Trütken, 1999).<br />
Einsatzgebiete<br />
Die Planungszelle wurde zunächst vorwiegend bei öffentlichen Planungen auf kommunaler<br />
und regionaler Ebene eingesetzt. Die ersten Planungszellenprojekte waren in Schwelm in<br />
48
2.3 Akteursabhängige Verfahren<br />
den Jahren 1972/73 und in Hagen-Haspe im Jahr 1975. Für das Köln-Projekt aus den Jahren<br />
1979/80 wurde erstmals ein Bürgergutachten erstellt. (Für eine Übersicht über Anwendungen<br />
der Planungszelle, siehe Dienel, 2002.) Neuerdings wird die Planungszelle immer<br />
häufiger auch zur Lösung übergreifender Probleme, wie bei der Technikfolgeabschätzung,<br />
der Zukunftsforschung oder bei Ethikdiskursen eingesetzt (Dienel, 1999; Dienel & Trütken,<br />
1999).<br />
Aufbau<br />
Jeweils 25 im Zufallsverfahren ausgewählte Erwachsene werden in einer Planungszelle<br />
betraut, sich mit einem vorgegebenen Problem 4 Tage lang zu befassen und deren Lösungsalternativen<br />
zu verstehen und zu beurteilen. Je nach Größe des Projektes partizipieren in<br />
mehreren Zellen zwischen 100 und 250 Personen. Die Ergebnisse werden mit denjenigen<br />
anderer Gruppen, die an der gleichen Aufgabenstellung tätig waren, zu einem Bürgergutachten<br />
zusammengefasst. Das Verfahren setzt außer dem öffentlichen Auftraggeber eine unabhängige<br />
Institution zu dessen Durchführung voraus. Diese begleitet das Verfahren und erstellt<br />
abschließend das Bürgergutachten (Dienel & Trütken, 1999; Beckmann & Keck, 1999).<br />
Der Ablauf einer Planungszelle gliedert sich in Vorbereitungsphase, Durchführungsphase,<br />
Auswertungsphase und Umsetzungsphase.<br />
In der Vorbereitungsphase hat der Durchführungsträger zwei Aufgaben zu lösen. Zum einen<br />
muss er ein aufgabenorientiertes Arbeitsprogramm erarbeiten, in dem Teilziele definiert, die<br />
betroffenen Gruppen, Ämter und Personen identifiziert und Informations- und Bewertungsmaterialen<br />
zusammengestellt werden.<br />
Die eigentliche Planungszelle konstituiert sich in der Durchführungsphase, in der meist zwei<br />
Gruppen parallel und leicht zeitversetzt von verschiedenen Referenten Vorträge zur verstärkten<br />
Heranführung an die Problematik gehalten werden. Anschließend werden in Kleingruppen<br />
und auf Plenarebene Bewertungen der Ist-Situation, Problemlösungsvorschläge und<br />
Empfehlungen für die Auftraggeber oder Entscheidungsträger erarbeitet.<br />
In der Auswertungsphase werden von den Mitgliedern des Durchführungsteams die Diskussionsergebnisse<br />
und Empfehlungen qualitativ ausgewertet und zur Kontrolle den ehemaligen<br />
Laienjuroren zugeleitet. Danach wird eine gedruckte und vorlagegeeignete Zusammenfassung<br />
als Bürgergutachten erstellt.<br />
Die Umsetzungsphase beginnt mit der Überreichung der Bürgergutachten an die Planungszellenteilnehmer<br />
und den Auftraggeber. Das Bürgergutachten wird erfahrungsgemäß in den<br />
einzelnen Gremien bei der Entscheidung zugunsten einer Alternative eingehend erwogen<br />
(Dienel & Trütken, 1999).<br />
Vor- und Nachteile<br />
Der Vorzug der Planungszelle als Bürger-Beteiligungsverfahren liegt in der Art der Auswahl<br />
der Beteiligten mittels des Zufallsverfahrens, das nicht einzelne oder ganze Gruppen bevorzugt,<br />
ihre Interessen oder Wertanschauungen durchzusetzen. Ein weiterer Vorteil ist die<br />
Möglichkeit zum ausführlichen Austausch von Informationen und Argumenten.<br />
Als nachteilig kann sich jedoch die Bewertung von Planungsalternativen ohne strukturiertes<br />
formales Bewertungsverfahren erweisen.<br />
49
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 2. Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung<br />
Anwendungsbeispiele<br />
Das Bürgergutachten „Klimaverträgliche Energie" (Akademie für Technikfolgenabschätzung<br />
in Baden-Württemberg) und die Planungszellen „Zukünftige Energiepolitik" (Programmgruppe<br />
„Mensch und Technik" der Kernforschungsanlage Jülich) aus dem Jahr 1985 sind Beispiele<br />
des Verfahrens zum Thema „Energie".<br />
Ziel der Planungszellen war nicht nur die Verbreitung des Wissens im Hinblick auf soziale<br />
Aspekte der Energieversorgung zu untersuchen, sondern darüber hinaus eine konkrete<br />
Entscheidungshilfe für die Energiepolitik und Energiewirtschaft anzubieten.<br />
Neben generellen Standpunkten der Bürger zum Problem der zukünftigen Energieversorgung,<br />
wie Sicherung des Friedens und der Arbeitsplätze sowie der Sorge um den Umweltschutz,<br />
wurden spezifische Empfehlungen zur zukünftigen Energiepolitik gegeben. Unter<br />
anderem wurde sich für eine Befriedigung der zukünftigen Energienachfrage mit Hilfe des<br />
verstärkten Einsatzes neuer technologischer Entwicklungen für die Stromerzeugung und das<br />
Energiesparen ausgesprochen. Jedoch sind Energieversorgungssysteme so auszulegen,<br />
dass die Gesundheit der Bevölkerung keinesfalls gefährdet wird. Sie sollen sicher im Betrieb<br />
und in der <strong>Versorgung</strong> sein sowie die Umwelt so wenig wie möglich belasten. Hinsichtlich der<br />
einzelnen Energieträger wurde beispielsweise angemahnt, den Bau weiterer Kraftwerke bis<br />
zur Lösung der Entsorgungsfrage zurück zu stellen und heimische Energiequellen zur Wahrung<br />
der <strong>Versorgung</strong>ssicherheit vorrangig einzusetzen (Dienel & Garbe, 1985).<br />
2.3.2 Planungswerkstatt<br />
Begriff und Definition<br />
Das Verfahren der Planungswerkstatt wurde in den 80er Jahren von Hülsmann (1990) und<br />
Tschiedel (1989) entwickelt. Danach sind Planungswerkstätten „Veranstaltungen und Verfahren<br />
zur demokratischen Zukunftsgestaltung" (Tschiedel, 1988). Die Planungswerkstatt integriert<br />
Verfahrenselemente von Zukunftswerkstatt (Albers 2001) und Planungszelle (Dienel,<br />
1971), wobei neben den Betroffenen von Zukunftsplanungen noch weitere interessierte<br />
lokale Vereine und Organisationen in den Gestaltungsprozess integriert werden (Tschiedel,<br />
1997; Tacke, 1999; Dienel & Trütken, 1999).<br />
Merkmale<br />
Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt nicht nach dem Zufallsprinzip (Planungszelle) oder nach<br />
dem Grad der Betroffenheit (Zukunftswerkstatt), sondern zielt darauf ab, die problemzentrierte<br />
Kommunikationsstruktur in einem Diskurs zu organisieren (Tacke, 1999). In Form einer<br />
Quotenauswahl wird das im jeweiligen Problemkontext vorhandene soziale Strukturgefüge<br />
repräsentiert.<br />
Ziele bzw. Aufgaben<br />
Bei dieser Vorgehensweise steht die vorhandene soziale Handlungsstruktur, die durch den<br />
Einsatz und die Verbreitung technischer Innovationen von Veränderungen betroffen wird, im<br />
Mittelpunkt des Untersuchungs- und Gestaltungsinteresses (Tacke, 1999).<br />
50
2.3 Akteursabhängige Verfahren<br />
Einsatzgebiete<br />
Der Einsatz dieses Instrumentes erfolgt bei Planungsprozessen vornehmlich auf kommunaler<br />
Ebene.<br />
Aufbau<br />
Der Ablauf einer Planungswerkstatt umfasst drei Phasen. Die beiden ersten Phasen,<br />
Anknüpfungs- und Erkundungsphase dienen neben der Rekrutierung des Teilnehmerkreises<br />
vor allem der Identifikation, Präzisierung und Analyse des zu behandelnden Problems. In der<br />
Zukunftswerkstatt (Albers & Broux 1999) als dritte Phase sollen Entwürfe für die Lösung der<br />
bestehenden Problemlage erarbeitet werden.<br />
Die Anknüpfungsphase ist darauf ausgerichtet, die zu behandelnde Problematik festzulegen.<br />
Es gilt, eine konkrete Fragestellung zu erarbeiten und zu entscheiden, wer an der Planungswerkstatt<br />
teilnehmen soll. In einer zweiten Phase, der Erkundungsphase, werden die lokalen<br />
Rahmenbedingungen erforscht und die zur Diskussion stehende Situation hinsichtlich ihrer<br />
funktionalen Aspekte und Akteursbezüge analysiert. In der dritten Phase wird mit Hilfe der<br />
Zukunftswerkstatt Kritik an der bestehenden Situation gesammelt, systematisiert und bewertet.<br />
Nachfolgend werden Zukunftsentwürfe in Form von Szenarien ausgearbeitet und anschließend<br />
mit den realen Gegebenheiten konfrontiert, indem unter Einbeziehung von Experten<br />
die Problemlösungsentwürfe einer kritischen Prüfung unterzogen werden, die schließlich<br />
in durchführbare Maßnahmen zur Realisierung erwünschter Zukünfte in Form eines Durchsetzungskonzeptes<br />
münden (Tacke, 1999).<br />
Vor- und Nachteile<br />
Ein Vorzug des Instruments liegt darin, bei lokal begrenzten Problemkontexten den Ortsansässigen,<br />
unmittelbar betroffenen Bürgern die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen und<br />
Phantasie zur Problemlösung bei der Planung mit einzubringen.<br />
Anwendungsbeispiel<br />
Ein Beispiel einer Planungswerkstatt stellt das Verfahren zum Thema „Lokaler Raum und<br />
Telematik" im westfälischen Rheine in den Jahren 1987/88 dar. Dort wurde untersucht, wie<br />
die traditionellen Kommunikationsstrukturen des örtlichen Netzes von Beziehungen und<br />
Abhängigkeiten lokaler Organisationen und Vereine auf Veränderungen reagieren, die durch<br />
moderne Informations- und Kommunikationstechniken verursacht werden (Tacke, 1999).<br />
2.3.3 Delphi-Methode<br />
Begriff und Definition<br />
Bekannt wurde die Delphi-Methode durch einen von der RAND-Corporation in den USA im<br />
Jahr 1964 erarbeiteten „Report an a Long-Range Forecasting Study", der langfristige Vorhersagen<br />
über wissenschaftlich und technische Entwicklungen zum Thema hatte. Eine lange<br />
Tradition hat die Anwendung dieser Methodik auch in Japan.<br />
„Die Delphi-Methode ist eine systematische mehrstufige Expertenbefragung, die dazu dient,<br />
zukünftige Entwicklungen besser abschätzen zu können" (Wohinz, 1983).<br />
51
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 2. Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung<br />
Merkmale<br />
Eine Besonderheit dieser Methode stellt die Heranziehung von Fach-Experten als Gruppe<br />
der Bewertenden dar. Die Formalisierung der Befragung mit Hilfe des Multiple-Choice-<br />
Aufbaus des Antwortkatalogs zu den einzelnen Fragestellungen und die Anonymität der<br />
Einzelantworten sind wesentliche Kennzeichen dieses Verfahrens.<br />
Weiteres Charakteristikum dieser Methodik ist, dass ein objektives Ergebnis durch mehrmalige<br />
„Fragerunden" angestrebt wird. Als Ergebnis einer Delphi-Befragung wird die demokratisch<br />
überwiegende Meinung als Gesamtmeinung der Experten akzeptiert (Hübner & Jahnes,<br />
1992).<br />
Ziele bzw. Aufgaben<br />
Ziel der Delphi-Studien ist es, einen fundierten Blick in die Zukunft zu werfen, um bestimmte<br />
Entwicklungen oder Folgen bereits gegenwärtig einschätzen zu können. Diese Informationen<br />
liefern die Basis, um evidente Fehlentwicklungen rechtzeitig zu bremsen oder dringend benötigte<br />
Innovationen schneller anzustoßen (Cuhls & Blind, 1999).<br />
Einsatzgebiete<br />
Typische Bereiche der Anwendung der Delphi-Methode sind z. B. die Bestimmung von Entwicklungsprognosen<br />
im Technologiebereich und die Abschätzung von ungenau bekannten<br />
Technikfolgen im Risikobereich. Als Prognosegegenstand eignen sich eher langfristige und<br />
komplex zu lösende Probleme. Unter der Bezeichnung Ideen-Delphi kann diese Methode<br />
auch zur Ideengenerierung oder Ideenbewertung durch Experten eingesetzt werden (Wilhelm,<br />
1999).<br />
Aufbau<br />
Das Delphi-Verfahren besteht aus zwei oder mehreren Befragungsrunden von ausgewählten<br />
Experten. Von einer Fachkommission erarbeitete Thesen (in der Regel zu Themen aus Wissenschaft<br />
und Technik) werden in Form eines standardisierten Fragebogens an die Experten<br />
verschickt. Diese müssen unabhängig voneinander und untereinander anonym ihre Stellungnahme<br />
bzw. Bewertung abgeben. Durch die Auswahl einer größeren Anzahl von Experten<br />
wird versucht, dem Einwand zu begegnen, dass aufgrund der engen Verzahnung großen<br />
Sachverstandes mit persönlichen Interessen eine objektive Aussage eines einzelnen Experten<br />
nicht möglich ist. Außerdem wird davon ausgegangen, dass bei einer großen Anzahl der<br />
Befragten die Wahrscheinlichkeit einer treffsicheren Prognose größer ist. Es werden des<br />
Weiteren bewusst keine Gruppen gebildet wie bei anderen Beteiligungsverfahren, um voreilige<br />
Stellungnahmen und gruppendynamische Einflüsse eines persönlichen Kontaktes auszuschalten.<br />
Nach Analyse und Bewertung der ersten Fragerunde durch die Koordinationsgruppe folgt<br />
mindestens noch eine zweite Befragung der ausgewählten Experten und gegebenenfalls<br />
noch weitere Runden, um unter dem Einfluss der Einschätzung anderer Fachkollegen eine<br />
erneute Urteilsbildung zu ermöglichen und zu einer homogenen Gruppenmeinung zu gelangen<br />
(Beckmann & Keck, 1999; Hübner & Jahnes, 1992).<br />
52
2.3 Akteursabhängige Verfahren<br />
Vor- und Nachteile<br />
Die Vorteile der Delphi-Methode bestehen in der Möglichkeit, eine größere Anzahl von Experten<br />
in die Befragung einzubeziehen. Gegenüber Gruppendiskussionen ist weiterhin die<br />
„objektivierte" Meinungsäußerung durch die Gewährleistung der Anonymität und der Ausschaltung<br />
gruppendynamischer Prozesse hervorzuheben.<br />
Als problematisch wird jedoch ein möglicher Konsensdruck durch ein zu starres Befragungsschema<br />
sowie in manipulierenden Interpretationen des Forschers, um eine einheitliche<br />
Gruppenmeinung zu erhalten, gesehen (Häder & Häder, 2000).<br />
Außerdem kann sich die lange Durchführungsdauer eines solchen Verfahrens als Hindernis<br />
erweisen.<br />
Ein Problem dieses Verfahrens ist sicherlich auch, dass Prognosen angesichts der Komplexität<br />
und Dynamik der Gesellschaft immer mit Unsicherheit behaftet sind, die aber in diesem<br />
Verfahren nicht herausgearbeitet wird (Hübner & Jahnes, 1992).<br />
Anwendungsbeispiele<br />
Die erste deutsche Delphi-Studie zur Entwicklung von Wissenschaft und Technik wurde im<br />
Jahr 1993 im Auftrag des BMFT (heute BMBF) durchgeführt. Da sich die erste deutsche<br />
Delphi-Studie in der Umsetzung und strategischen Nutzung für die Wirtschaft als hilfreich<br />
erwiesen hat, wurde im Jahr 1996 mit der Weiterentwicklung der Methode begonnen und die<br />
„Delphi 98" in 12 ausgewählten Feldern gestartet, u. a. „Information & Kommunikation" und<br />
„Energie & Rohstoffe" (Cuhls & Blind, 1999; Hübner & Jahnes, 1992; Wilhelm, 1999). Es<br />
wurde der Fragestellung nachgegangen, in welchen Innovationsfeldern die wirtschaftlich und<br />
gesellschaftlich bedeutungsvollste Innovationsdynamik ersichtlich wird.<br />
Ergebnis des Delphi 98-Verfahrens war beispielsweise im Bereich „Energie" ein Konsens der<br />
Delphi-Experten über die verstärkte Nutzung der Solarenergie im Zeitraum 2013 bis 2023.<br />
Denn erst in diesem Zeitraum gingen sie von einem Anteil regenerativer Energien (ohne<br />
Wasserkraft) an der Stromerzeugung in Deutschland von über 10 % aus. Zudem finden<br />
entsprechend auf die Nutzungsbedingungen ausgerichtete Brennstoffzellen in Wohngebäuden<br />
sowie in Industrie- und Gewerbebetrieben ihrer Ansicht nach verstärkt Anwendung<br />
(Cuhls, Blind & Grupp, 1998).<br />
2.3.4 Nutzwertanalyse<br />
Begriff und Definition<br />
Die Nutzwertanalyse (NWA) gehört, ebenso wie die Nutzen-Kosten-Analyse, zu den Nutzen-<br />
Kosten-Untersuchungen. Die Methode wurde aus den Ingenieurwissenschaften heraus in<br />
den 60er Jahren in den USA entwickelt und in Deutschland Anfang der 70er Jahre von Zangemeister<br />
(1976) verbreitet, um Probleme der Nutzen-Kosten-Analyse zu überwinden.<br />
„Nutzwertanalyse ist die Analyse einer Menge komplexer Handlungsalternativen mit dem<br />
Zweck, die Elemente dieser Menge entsprechend den Präferenzen des Entscheidungsträgers<br />
bezüglich eines multidimensionalen Zielsystems zu ordnen. Die Abbildung dieser Ordnung<br />
erfolgt durch die Angabe der Nutzwerte (Gesamtwerte) der Alternativen" (Zangemeister,<br />
1976) Diese sind relative Werte, die nicht monetär angegeben werden.<br />
53
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 2. Instrumente zur Nachhaltigkeitsbewertung<br />
Merkmale<br />
Die Nutzen-Kosten-Analyse bewertet nur die wirtschaftliche Effizienz und ist nur auf monetär<br />
bestimmte Ziele hin ausgerichtet. Die NWA hingegen ermöglicht bei der Auswahl und Bewertung<br />
komplexer Projektalternativen auch solche Bewertungskriterien einzubeziehen, die<br />
subjektiv und nicht in Geldeinheiten ausdrückbar sind (wie z. B. technische, psychologische<br />
oder soziale Bewertungskriterien). Die gesuchten Nutzwerte stellen jeweils das Ergebnis<br />
einer ganzheitlichen Bewertung sämtlicher Zielerträge einer Alternative dar.<br />
Ein Nutzwert ist jedoch nicht direkt als Ertragsgröße zu verstehen, sondern kann nur unter<br />
Zuhilfenahme eines zuvor aufgestellten Zielsystems und der zugehörigen Präferenzen des<br />
Entscheidungsträgers interpretiert werden (Zangemeister, 1976; Klenner, 2002).<br />
Ziele bzw. Aufgaben<br />
Zweck der Nutzwertanalyse ist die Ordnung einer Menge von Alternativen bei Vorliegen einer<br />
Mehrfach-Zielsetzung entsprechend den Präferenzen des Entscheidungsträgers (Zangemeister,<br />
1976). Dazu werden Alternativen und Varianten verglichen und dabei herauszufinden<br />
versucht, wie groß der Wert einer bestimmten Maßnahme oder Projektalternative ist<br />
(Nutzwert).<br />
Einsatzgebiete<br />
Aufgrund der leicht verständlichen Vorgehensweise zur Berücksichtigung aller relevanten<br />
Bewertungskriterien erscheint die NWA für die Entscheidungsunterstützung ökologieorientierter<br />
Problemstellungen besonders geeignet. Insbesondere ist sie in der wasserwirtschaftlichen<br />
Praxis ein häufig angewandtes Planungs- und Bewertungsinstrument. Auch wird sie in<br />
Kombination mit einer Delphi-Befragung eingesetzt, in der die Bewertungen der Experten<br />
beispielsweise hinsichtlich ökologischer Wirkungen bestimmter Alternativen mittels der<br />
Nutzwertanalyse in ein Ranking gebracht werden (Böhm et al., 2002; Wilhelm, 1999).<br />
Aufbau<br />
Die Nutzwertanalyse lässt sich in die drei Phasen Konzeption, Bewertung und Ergebnisdarstellung<br />
unterteilen.<br />
In der „Konzeptionsphase" wird das Zielsystem bestimmt, welches qualitative und quantitative<br />
Ziele umfassen kann. Diese sind Grundlage für die Bestimmung von Bewertungskriterien,<br />
nach denen die zuvor erarbeiteten Alternativen bewertet werden sollen. Dabei ist darauf zu<br />
achten, dass die Ziele nicht an den Ergebnissen orientiert werden, sondern von ihnen unabhängig<br />
sind. Zur Erstellung des Zielsystems werden die Ziele nach sachlichen Aspekten in<br />
Gruppen zusammengefasst und in eine hierarchische Ordnung gebracht.<br />
In der „Bewertungsphase" werden zuerst die Bewertungskriterien nach der Reihenfolge ihrer<br />
Bedeutung sortiert und eine entsprechende Gewichtung zugewiesen. Die Gewichtung besitzt<br />
rein subjektiven Charakter. Darauf werden die in der Konzeptionsphase ausgesuchten Alternativen<br />
im Hinblick auf den Zielerfüllungsgrad je Kriterium (= Zielerträge) bewertet. Anschließend<br />
werden die Zielerträge in eine gemeinsame Dimension überführt.<br />
In der „Ergebnisphase" erfolgt die Bestimmung der Teilnutzwerte für die einzelnen Bewertungskriterien<br />
durch Multiplikation des Kriteriengewichts mit den normierten Zielerträgen.<br />
Darauf können die einzelnen Teilnutzwerte innerhalb einer Alternative zusammen addiert<br />
54
2.3 Akteursabhängige Verfahren<br />
werden (= Wertsynthese). So entstehen die Gesamtnutzwerte der verschiedenen Alternativen,<br />
und es lässt sich eine Rangfolge der einzelnen Alternativen angeben (Klenner, 2002;<br />
Böhm et al., 2002).<br />
Vor- und Nachteile<br />
Gegenüber der Nutzen-Kosten-Analyse weist die Nutzwertanalyse methodische und praktische<br />
Vorteile auf, da sie mit weniger Präferenzinformationen als nutzentheoretisch gefordert<br />
auskommt. Beispielsweise wird in der NWA nicht gefordert, dass die Entscheidungsträger in<br />
der Lage sein müssen, Ausprägungsdifferenzen kardinal zu bewerten und Substitutionsraten<br />
zwischen den einzelnen Kriterien anzugeben.<br />
Die Nutzwertanalyse erlaubt es zudem, Entscheidungen bei mehrfachen Zielsetzungen<br />
abzubilden. Dabei verschafft die Dekomposition des Bewertungsprozesses in Teilaspekte<br />
höhere Transparenz. Zu den Vorteilen der NWA zählt auch, dass quantitative und qualitative<br />
Angaben kombiniert werden können und sie außerdem relativ einfach und kostengünstig im<br />
Vergleich zur KNA durchzuführen ist.<br />
Da es jedoch nicht möglich ist, formale allgemeingültige Kriterien der Güte der Bewertung<br />
anzugeben, fällt es schwer, die Qualität einer solchen Bewertung einzustufen. Auch ist die<br />
Nutzwertanalyse aufgrund einiger ihr zugrunde liegenden theoretischen Annahmen, wie z. B.<br />
Nutzenunabhängigkeit der Ziele und Additivität des Nutzteilwerte, oder Konstanz der Zielgewichte,<br />
nicht frei von Kritik. Eine Verzerrung des Gesamtnutzens kann sich aber auch bei der<br />
Abschätzung von solchen Nutzwerten ergeben, die sich nicht aus physikalischen Werten<br />
ableiten lassen, also einer kardinalen Skalierung zugänglich sind. Erzwungene ordinale<br />
Skalierungen können zu Ungenauigkeiten bei der Berechnung des Gesamtnutzens führen.<br />
Praktische Probleme bestehen insbesondere darin, dass es keine klare Vorgaben für die<br />
Auswahl von Kriterien gibt und dass manche Kriterien für mehrere Ziele bedeutsam sind<br />
(Gefahr der Doppelerfassung) (Klenner, 2002; Böhm et al., 2002; Hoffmeister, 2000).<br />
Anwendungsbeispiel<br />
Ein Beispiel der Nutzwertanalyse im <strong>Versorgung</strong>ssektor ist die „wasserwirtschaftliche Planung<br />
Emstal". Aufgabe des Verfahrens war es, verschiedene Alternativen und Varianten zum<br />
Hochwasserschutz und zur Wiederherstellung von historischen Brücken und Mühlen im<br />
Planungsgebiet „Ernster zu bewerten und die Alternativen in eine Rangfolge zu bringen<br />
(Rickert et al., 1993).<br />
55
56
Teil II Empirische Untersuchung<br />
57
Teil II Empirische Untersuchung: 1. Gegenstand und Ziel<br />
58
1.1 Die Zukunftsszenarien<br />
1. Gegenstand und Ziel<br />
Nachfolgend werden der Untersuchungsgegenstand und die Zielstellung der Untersuchung<br />
dargestellt.<br />
1.1 Die Zukunftsszenarien<br />
Den Ausgangspunkt der Untersuchung bilden vier Zukunftsszenarien <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong><br />
mit räumlichem Fokus Deutschland und Zeithorizont 2025. Anhand eines softwaregestützten<br />
Verfahrens in Anlehnung an von Reibnitz (1987) wurden diese explorativen Szenarien<br />
entwickelt. Explorative Szenarien gehen im Gegensatz zu normativen Szenarien nicht<br />
von der Frage aus: „Welche Zukunft wollen wir", sondern von der Frage „Was könnte sein,<br />
wohin könnte sich die Zukunft entwickeln'?" Anlagenhersteller, <strong>Versorgung</strong>sdienstleister, <strong>Versorgung</strong>sunternehmen,<br />
industrielle Kunden, Vertreter der Umwelt- und Verbraucherverbände,<br />
Behörden, Gewerkschaft und Wissenschaftler aus allen vier Sektoren Strom, Gas, Wasser<br />
und Telekommunikation entwickelten gemeinsam in drei aufeinander folgenden, jeweils<br />
zweitägigen moderierten Szenario-Workshops diese gesamtgesellschaftlichen Zukunftsszenarien.<br />
Involviert waren somit Fachkompetenzen für sektorspezifische und sektorübergreifende<br />
Entwicklungen aus unterschiedlichen Perspektiven, um sich der Frage zu widmen, wie<br />
netzgebundene <strong>Versorgung</strong> im Jahre 2025 für Deutschland aussehen könnte und welche<br />
Entwicklungen heute plausibel erscheinen. Diese Zukunftsszenarien sind eine gemeinsame<br />
Antwort verschiedener gesellschaftlicher Akteure auf die Frage, mit welchen Entwicklungen<br />
in der <strong>Versorgung</strong> zu rechnen ist. Sie sind keine Prognose, sondern zeigen einen Möglichkeitsraum<br />
auf. Diesem Ansatz, mögliche Zukunftsoptionen im Austausch zwischen Wissenschaft<br />
und gesellschaftlichen Akteuren aus der Praxis der <strong>Versorgung</strong> zu entwickeln, liegt der<br />
Gedanke zugrunde, dass viele verschiedene gerade qualitative Einfußfaktoren in ihrer<br />
Wechselbezüglichkeit die Zukunft vorantreiben. Gerade diese galt es mit dem Erfahrungshorizont<br />
der Akteure einzufangen.<br />
Erkenntnisleitend war dabei die Hypothese, dass sich wichtige aktuelle Entwicklungstendenzen<br />
in den vier Sektoren durch folgende in allen Sektoren ähnliche Entwicklungen auszeichnen:<br />
(1) die Veränderung des Zentralisierungsgrades, d. h. beispielsweise eine Veränderung<br />
des Anteils dezentraler, „intelligenter" Netzstrukturen oder verteilter Stromerzeugung in Mikro-KWKs,<br />
(2) die Veränderung der Wechselwirkung zwischen den Sektoren, d. h. der Grad<br />
an Kopplung der Sektoren und Auflösung der Sektorengrenzen wie beispielsweise durch<br />
Synergien im Unterhalt, der Planung und im Betrieb der kostenaufwändigen Infrastrukturen<br />
der Sektoren oder eine Veränderung des Anteils an intelligenter Anlagen- und Gerätesteuerung<br />
wie „virtuellen Kraftwerken", und (3) die Veränderung der Dienstleistungsorientierung,<br />
d. h. der Grad der Orientierung des <strong>Versorgung</strong>sgeschäfts hin zu Kunden und Dienstleistungen.<br />
59
Teil II Empirische Untersuchung: 1. Gegenstand und Ziel<br />
Die Ausgangsfrage für die Entwicklung der Szenarien lautete:<br />
Wie sieht die Zukunft des <strong>Versorgung</strong>ssektors (für Strom, Gas, Wasser / Abwasser<br />
und Telekommunikation) aus hinsichtlich<br />
• Zentralisierungsgrad<br />
• Wechselwirkung der Sektoren<br />
• Dienstleistungsorientierung<br />
und von welchen Einflussfaktoren hängt dies ab?<br />
Im Folgenden werden die vier Zukunftsszenarien in ihren wesentlichen Grundzügen beschrieben<br />
und zur Verdeutlichung der Unterschiede tabellarisch gegenüber gestellt (siehe<br />
Tabelle 1 auf Seite 66; eine ausführliche tabellarische Gegenüberstellung siehe Anhang, Kapitel<br />
A.1). Eine detaillierte Beschreibung der Szenarien findet sich in Jäger et al. (2004).<br />
1.1.1 Szenario A<br />
Politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen<br />
Im Konsens getragene Leitbilder für den <strong>Versorgung</strong>ssektor können im Wege von Verhandlungs-<br />
und Beteiligungsprozessen seitens der Vertreter von Wirtschaft, Gesellschaft und<br />
Politik erzielt werden. Über das Primat von Umwelt und Klima besteht Einigkeit. Die vorgegebenen<br />
Umwelt- und Gesundheitsziele bleiben allerdings moderat. Das Hauptinstrument<br />
der politischen Steuerung ist der Emissionshandel, ergänzt durch wenige ordnungsrechtliche<br />
Maßnahmen. Auf diese Weise entsteht eine verlässliche Basis für Innovationen, die zudem<br />
von einem moderaten Wirtschaftswachstum von real 2% p.a. und entsprechend guten finanzwirtschaftlichen<br />
Randbedingungen profitieren. Das staatliche Budget für Innovationsförderung<br />
bleibt nahezu unverändert.<br />
Trotz rückläufiger Einwohnerzahl nimmt die kumulierte Wohnfläche zu, da zunehmend finanziell<br />
gut gestellte Ein- und Zwei-Personen-Haushalte wegen der besseren Umweltqualität<br />
aus Stadtwohnungen in Häuser auf dem Land umziehen. Der Wunsch nach Komfort einschließlich<br />
neuer Dienstleistungen im <strong>Versorgung</strong>sbereich steigt. Gesundheitsaspekte haben<br />
einen sehr hohen Stellenwert.<br />
Struktur und Entwicklung der <strong>Versorgung</strong>smärkte<br />
Als Folge dieser Entwicklungen treten in den <strong>Versorgung</strong>smärkten zahlreiche kleinere Unternehmen<br />
neben den etablierten Großversorgern auf. Gestützt wird diese Dekonzentration<br />
durch eine Marktregulierung, die auf eine Stärkung des Wettbewerbs zielt. Im Ergebnis ist<br />
der <strong>Versorgung</strong>smarkt 2025 durch eine Mischung aus Stadtwerken, neuen Dienstleistern,<br />
Handwerksbetrieben, ausländischen Anbietern sowie großen Versorgern (verbleibender<br />
Marktanteil 50%) gekennzeichnet.<br />
Ein lohnendes Investment sind Firmen, die dezentrale Technologien verstärkt nutzen oder<br />
ausschließlich Dienstleistungen anbieten. Konsequentes Unbundling der Wertschöpfungsstufen<br />
verhindert die Quersubventionen innerhalb großer Konzerne und ermöglicht fairen Wettbewerb.<br />
Die <strong>Versorgung</strong>ssektoren sind auch auf der Erzeugerseite zunehmend integriert<br />
(Multi-Utility-Konzept).<br />
60
1.1 Die Zukunftsszenarien<br />
Dienstleistungen, wie Smart Building, Rundum-Sorglos-Pakete werden nicht nur genutzt, um<br />
Komfortansprüche zu befriedigen, sondern auch aus Effizienzgründen. Smart Building-Anwendungen<br />
setzen sich auf breiter Front durch (Marktdurchdringung 30%). In Demand Side<br />
Management wird eine Möglichkeit gesehen, die ökonomische und ökologische Effizienz der<br />
<strong>Versorgung</strong>ssysteme zu steigern und gleichzeitig Exportmärkte für intelligente Steuerungstechnologie<br />
zu entwickeln (Marktdurchdringung 20%). Die bewusste Ausschöpfung von angebots-<br />
und nachfrageseitigen Effizienzpotenzialen sowie hohe Sparanstrengungen seitens<br />
der Bevölkerung führen zu einem deutlichen Rückgang des Verbrauchs an Strom, Wasser,<br />
Gas um real mehr als 5%.<br />
Der Anstieg der Verbraucherpreise ist gering (Strom und Gas 1 %/a, Wasser 2°/0/a). Transparenz<br />
sowohl bei den Preisen als auch hinsichtlich der Umweltwirkungen ist für die Kundenakzeptanz<br />
wichtig (Umwelt- und Preislabeling).<br />
Technologische Entwicklung<br />
Diese gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozesse resultieren in einer völlig veränderten<br />
Mischung bei den Energieträgern und Erzeugungsanlagen. Kernenergie wird 2025 nicht<br />
mehr genutzt, der Anteil der Kohle an der Stromproduktion halbiert sich auf 24%, und der<br />
Erdgaseinsatz vervierfacht sich auf rd. 45%. Rund ein Drittel des Stroms stammt aus Erneuerbaren<br />
Energien. Dezentrale Technologien und Verfahren werden stark ausgeweitet, dezentrale<br />
Mikro-KWK-Anlagen auf Erdgasbasis tragen dennoch nur 3%, Mini-KWK-Anlagen 5%<br />
zur gesamten Stromerzeugung bei, dezentrale Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien<br />
immerhin 15%; ein stark verbreitetes Demand Side Management verkoppelt Produktion und<br />
Verbrauch. Verbunden ist diese Entwicklung mit einem starken Umbau der Netze in Richtung<br />
Verteilungsfunktion sowie mit einer umfangreichen Einbindung des TK-Sektors. Die verschiedenen<br />
Sektoren werden in virtuellen Kraftwerken integriert. Ermöglicht werden diese<br />
Entwicklungen durch eine umfassende sektorübergreifende Standardisierung.<br />
1.1.2 Szenario B<br />
Politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen<br />
Auf Grund unübersehbarer Verschlechterungen der Umweltbedingungen betreibt der Staat<br />
aktiv den Schutz von Klima und Umwelt. Die vorgegebenen Umwelt- und Gesundheitsziele<br />
bleiben allerdings moderat. Politisches Ziel ist die Beschleunigung der technologischen Entwicklung<br />
im Hinblick auf Klima und Umwelt, um eine effizientere Energiebereitstellung und<br />
eine Senkung des Verbrauchs zu erreichen. Dementsprechend wird das staatliche Budget für<br />
Innovationen im Energie- und <strong>Versorgung</strong>sbereich zwischen 2004 und 2025 um real 50%<br />
ausgeweitet. Regulatorisch flankiert wird dies durch eine Mischung aus Ordnungsrecht und<br />
marktwirtschaftlich-wettbewerbsrechtlichen Instrumenten, vornehmlich zur Stärkung der Effizienzoffensive<br />
der Unternehmen.<br />
Diese staatlich gesetzten Rahmenbedingungen fallen zusammen mit einer nur durchschnittlichen<br />
Entwicklung der Wirtschaft (Wirtschaftswachstum von real 1,5% p.a.). Dennoch steht<br />
der <strong>Versorgung</strong>sbranche ausreichend Kapital zur Verfügung, da innovative Technologien<br />
Wachstum versprechen.<br />
61
Teil II Empirische Untersuchung: 1. Gegenstand und Ziel<br />
Die Randlagen von Ballungsgebieten gewinnen an Attraktivität gegenüber ländlichen Gebieten.<br />
Die Zahl der Ein-Personen-Haushalte nimmt zu, ebenso die Wohnfläche pro Kopf. Hieraus<br />
resultiert eine verstärkte Nachfrage nach Endgeräten und <strong>Versorgung</strong>sleistungen, verbunden<br />
mit Wünschen nach Komfort. Auch Gesundheitsaspekte beeinflussen die Akzeptanz<br />
von <strong>Versorgung</strong>sprodukten.<br />
Struktur und Entwicklung der <strong>Versorgung</strong>smärkte<br />
Die starke Regulierung, insbesondere in Form des Wettbewerbsrechts, führt zu einer ausgeprägten<br />
Dekonzentration des Marktes. Großkonzerne erhalten Konkurrenz durch ausländische<br />
und durch mittelgroße inländische Firmen. Eine starke Dienstleistungsorientierung von<br />
Unternehmen wird zum Wettbewerbsfaktor. Man versucht, den Kundenwünschen nach Komfort<br />
zu entsprechen. Ein Strukturumbau der <strong>Versorgung</strong>smärkte ist jedoch auf die Ballungsgebiete<br />
beschränkt. Neue Dienstleistungen wie Rundum-Sorglos-Pakete, Smart Building<br />
werden noch wenig nachgefragt (Marktdurchdringung jeweils 5%). Außerdem wird begonnen,<br />
die Vorteile des Demand Side Managements zu nutzen (Marktdurchdringung 10%). Die<br />
Endnachfrage nach Strom, Gas und Wasser insgesamt bleibt etwa auf dem heutigen Wert;<br />
der Grund liegt in starken Effizienzsteigerungen auf der Angebots- und Nachfrageseite, die<br />
komfortbezogene Steigerungen des Strom-, Gas- und Wasserverbrauchs kompensieren.<br />
Der Anstieg der Verbraucherpreise ist relativ gering (Strom und Gas 1,5'%/a, Wasser 3c/o/a).<br />
Der Staat verordnet ein Umwelt- und Preislabeling.<br />
Technologische Entwicklung<br />
Im Bereich der Energiebereitstellung kommen die Förder- und Steuerungsmaßnahmen insbesondere<br />
einer Effizienzsteigerung bei zentralen Technologien zugute. Dies gilt sowohl für<br />
konventionelle Anlagen als auch für solche auf der Basis erneuerbarer Energien. Dabei wird<br />
Gas (Anteil am Energiemix 45%) auf Kosten von Kohle (24% Anteil) zum zentralen Pfeiler<br />
der Energieversorgung. Durch Großanlagen (Windparks, PV-Parks) steigt der Anteil der<br />
Erneuerbaren Energien an der Stromproduktion um das gut dreifache auf 30%. Hierin drückt<br />
sich der hohe Stellenwert des Klima- und Umweltschutzes aus. Dezentrale Mikro- und Mini-<br />
KWK-Anlagen auf Erdgasbasis tragen 1 % bzw. 3% zur gesamten Stromerzeugung bei,<br />
dezentrale Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien 10%.<br />
Auch auf der Nachfrageseite ist eine Effizienzsteigerung zu verzeichnen, die durch Innovationen<br />
erzielt wird. Die dezentralen und integrativen Varianten der Technologien können ihren<br />
Marktanteil nur moderat ausweiten, da sie nicht in größerem Umfang wirtschaftlich erschließbar<br />
sind. Zudem finden sich innovative TK-Dienste, die eine Voraussetzung für derartige<br />
Technologien sind, lediglich in Ballungsräumen.<br />
1.1.3 Szenario C<br />
Politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen<br />
Durch eine massive Innovations- und Technologiepolitik (Erhöhung des staatlichen Budgets<br />
um real 50 %) soll der Erfolg deutscher Unternehmen gefördert werden. Umwelt- und Gesundheitsziele<br />
bleiben allerdings moderat und sind nachrangig; auch das öffentliche Umweltbewusstsein<br />
ist wenig entwickelt. Ziel der Politik ist ein wirtschaftlicher <strong>Versorgung</strong>smix. Die<br />
62
1.1 Die Zukunftsszenarien<br />
Finanzierungsbedingungen für Investitionen sind aufgrund attraktiverer Renditen in anderen<br />
Branchen schwierig.<br />
Der private Wohlstand (Wirtschaftswachstum von real 2% p.a.) ist relativ hoch und verursacht<br />
eine Zunahme von Wohneigentum – vor allem in den Randlagen der Ballungszentren<br />
– sowie eine Steigerung der Wohnfläche um 25%. Komfortaspekte gewinnen deutlich an<br />
Bedeutung. Gesundheitsaspekte haben ihnen gegenüber einen geringeren Stellenwert.<br />
Struktur und Entwicklung der <strong>Versorgung</strong>smärkte<br />
Die Struktur der Märkte ist in allen Sektoren durch starke Preisregulierung und scharfen<br />
Wettbewerb gekennzeichnet. Nur international tätige Großkonzerne haben die nötige Finanzkraft,<br />
um langfristig überleben zu können. Vier bis fünf Großunternehmen beherrschen den<br />
deutschen Markt, insbesondere im Sektor Strom. Der Anteil der Stadtwerke oder anderer<br />
kleiner Unternehmen am Energiemarkt ist mit 10% sehr gering. Der Zentralisierungsgrad ist<br />
also sehr hoch.<br />
Die <strong>Versorgung</strong>sunternehmen beziehen zunehmend den TK-Bereich in ihre Aktivitäten ein,<br />
um die wachsenden Komfortansprüche ihrer Kunden durch Dienstleistungen, wie Smart<br />
Building, Rundum-Sorglos-Pakete (Marktdurchdringung 20%) zu befriedigen. Smart Building-<br />
Anwendungen setzen sich auf breiter Front durch (Marktdurchdringung 30%). Die Einführung<br />
eines ausgeprägten Demand Side Managements (Marktdurchdringung 15%) wirkt Kosten<br />
dämpfend, da es hilft, Kapazitäten optimal auszulasten und unnötige Reserven zu vermeiden.<br />
Die Endnachfrage nach Strom und Gas steigt gegenüber heute mäßig an, denn angebots-<br />
und nachfrageseitige Effizienzzuwächse reichen nicht aus, um den Bedarf nach Strom<br />
und Gas auf Grund von Komfortsteigerungen und dem verstärkten Einsatz von gasgefeuerten<br />
Stromerzeugungstechnologien vollständig auszugleichen. Der Wasserbedarf ist leicht<br />
sinkend.<br />
Der Anstieg der Verbraucherpreise ist mäßig (Strom und Gas 2°/0/a, Wasser 3%/a). In diesem<br />
Szenario sind (im Gegensatz zu den anderen Szenarien) verbrauchsabhängige Preisbestandteile<br />
geringer gewichtet als verbrauchsunabhängige. Die Verbraucher sind an der<br />
Transparenz der Preise (Preislabeling) interessiert.<br />
Technologische Entwicklung<br />
Sowohl bei der Industrie als auch im privaten Bereich steht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund;<br />
hierdurch entsteht ein verbreitertes Technologieportfolio, das heimische wirtschaftliche<br />
Primärenergieträger in den Vordergrund rückt. Der Primärenergie-Mix zur Stromerzeugung<br />
enthält somit große Teile an Kohle (etwa 50%) und Kernenergie (20%). Während der Anteil<br />
Erneuerbarer Energien (10%) stagniert, nehmen gasgefeuerte Anlagen bis 2025 von gegenwärtig<br />
9% auf 17% zu. Dezentrale Technologien haben aus ökonomischen Gründen oder auf<br />
Grund der begrenzten Ausdehnung ihrer Einsatzmöglichkeiten nur einen geringen Anteil.<br />
Hervorzuheben bei den dezentralen Technologien ist die starke Marktdurchdringung von<br />
Brennstoffzellenanlagen im Vergleich zur Gegenwart, allerdings ist ihr Beitrag zur Stromerzeugung<br />
immer noch gering: Dezentrale Mikro- und Mini-KWK-Anlagen auf Erdgasbasis<br />
tragen 1% bzw. 3% zur gesamten Stromerzeugung bei, dezentrale Anlagen auf Basis erneuerbarer<br />
Energien 5%. Auf der Verbraucherseite wird die Entwicklung effizienterer Technologien<br />
durch verstärkte Nachfrage vorangetrieben. Die Effizienz der Stromnetze wird in den<br />
63
Teil II Empirische Untersuchung: 1. Gegenstand und Ziel<br />
bestehenden Strukturen verbessert; virtuelle Kraftwerke und aktive Netze sind noch Ausnahmeerscheinungen.<br />
1.1.4 Szenario D<br />
Politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen<br />
Die Volkswirtschaft in Deutschland entwickelt sich nur schwach; im Zeitraum von 2004 bis<br />
2025 liegt das durchschnittliche Wachstum bei real 1% p.a. Sowohl in der Wirtschaft als<br />
auch beim Staat überwiegt das ökonomische Kalkül. Auf Grund der knappen öffentlichen<br />
Mittel sinkt das Budget für staatliche Innovationen im Betrachtungszeitraum um real 50%;<br />
nur die am Bedarf des Marktes orientierten Innovationen werden noch gefördert.<br />
Der Wettbewerb im <strong>Versorgung</strong>ssektor wird nicht sehr stark reguliert, so dass sich oligopolistische<br />
Marktstrukturen ausbilden. Durch Druck der so erstarkten Großunternehmen werden<br />
ordnungsrechtliche Regulierungsinstrumente zurückgefahren; 2025 finden sich nur noch<br />
marktwirtschaftliche Instrumente wie Steuern, Abgaben und gezielte Investitionen. Umweltund<br />
Gesundheitsziele bleiben moderat. Das Interesse der Bevölkerung an Umwelt- und<br />
Klimapolitik ist gering. Probleme im Umwelt- und Gesundheitsbereich werden zwar wahrgenommen,<br />
aber daraus wird nur ein geringer Handlungsdruck abgeleitet.<br />
Durch die makroökonomischen Verhältnisse entsteht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft mit<br />
einer schmalen, finanzkräftigen Oberschicht. Deren privater Verbrauch ist konsum- und<br />
genussorientiert.<br />
In räumlicher Hinsicht besteht eine Tendenz der Bevölkerung zur Migration in Ballungszentren.<br />
Es erfolgt eine Ansiedlung in verdichteten städtischen Strukturen.<br />
Struktur und Entwicklung der <strong>Versorgung</strong>smärkte<br />
Hinsichtlich der Infrastrukturen der Märkte überwiegen die Beharrungskräfte. Wegen mangelnder<br />
Förderung und Steuerung sind die technischen Fortschritte nur gering, sodass zentrale<br />
<strong>Versorgung</strong>sstrukturen gefestigt werden.<br />
Wegen der schwachen Wirtschaftsentwicklung bleiben Investitionen in neue, effiziente Geräte<br />
weitgehend aus. Die Dienstleistungsorientierung ist zwar hoch, die marktbeherrschenden<br />
Großunternehmen orientieren sich aber primär am Shareholder Value und entsprechen<br />
Kundenwünschen nur bei befriedigenden Umsätzen. Smart Building-Angebote und Rundum-<br />
Sorglos-Pakete finden sich für Bürogebäude und die finanzkräftige Oberschicht. Ihre Marktdurchdringung<br />
beträgt jeweils 10%. Demand Side Management kann sich als Dienstleistung<br />
bei neuen Haustechnikinstallationen und <strong>Versorgung</strong>sverträgen in geringem Maße etablieren<br />
(über 10% Marktdurchdringung). Die Nachfrage nach Strom und Gas bleibt konstant, da<br />
komfortbezogene Zuwächse bei der „upper dass" durch Kauf von neuen effizienten Endgeräten<br />
kompensiert werden. Im Wassersektor sinkt sie trotz Wellness-Anwendungen im Haus<br />
der Oberschicht auf Grund des ökonomischen Sparzwangs der breiten Masse.<br />
Der Anstieg der Verbraucherpreise ist höher (Strom und Gas 2,5%/a, Wasser 4%/a).<br />
64
1.1 Die Zukunftsszenarien<br />
Technologische Entwicklung<br />
Hinsichtlich des Kraftwerksparks steht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Kohle dominiert<br />
mit 52% weiterhin die Stromerzeugung; Kernenergie wird auch 2025 noch erheblich genutzt<br />
(20%). Der Einsatz von Erdgas nimmt auf 17% zu. Der Anteil Erneuerbarer Energien an der<br />
Stromerzeugung stagniert bei 10%, da nur wirtschaftliche Technologien eingesetzt werden<br />
(Offshore-Windenergie; Biomasse-KWK). Dezentrale Technologien haben auf Grund der<br />
geringen Erweiterungsmöglichkeiten ihres Einsatzpotenzials sowie aus ökonomischen Gründen<br />
nur einen geringen Anteil: Dezentrale Mikro-KWK-Anlagen sind vernachlässigbar, Mini-<br />
KWK-Anlagen tragen 2% zur gesamten Stromerzeugung bei, dezentrale Anlagen auf Basis<br />
erneuerbarer Energien 5%. Auf Seiten der Verbraucher werden konservative Lösungen<br />
bevorzugt; entsprechend schwach ist die Verbreitung dezentraler Anlagen, die zudem nur<br />
selten zu virtuellen Kraftwerken vernetzt sind. Im Sektor Wasser ist die Dezentralisierung<br />
stärker fortgeschritten; hier treten bei konventioneller Technik in Ballungsgebieten <strong>Versorgung</strong>sprobleme<br />
auf.<br />
65
66<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
Umwelt- und Klimapolitik Primat von Umwelt und Klima in Staat betreibt aktiv Schutz von Umwelt- u. Gesundheitsziele nach- Interesse an Umwelt- und Klimapoligesellschaftlichem<br />
Konsens Umwelt und Klima rangig, Primat auf Wirtschaftlichkeit tik ist gering, Staat zieht sich zurück<br />
Dominanz marktwirtschaftlicher Mischung aus Ordnungsrecht und Dominanz marktwirtschaftlicher Abbau bestehender ordnungsrechtli-<br />
Instrumente marktwirtschaftlichen Instrumenten Instrumente cher u. marktwirtschaftl. Instrumente<br />
Wirtschaftswachstum 2% p.a. 1,5% p.a. 2% p.a. 1% p.a.<br />
Finanzierungsbedingungen günstig, Sollzinsen 6%/a ungünstig, Sollzinsen 9%/a günstig, Sollzinsen 6%/a<br />
staatliches Innovationsbudget bleibt gleich Erhöhung des staatlichen Innovationsbudgets um 50% Verringerung um 50%<br />
Siedlungsstruktur Migration in ländliche Gebiete Randlagen von Ballungszentren werden bevorzugt Konzentration in Ballungszentren<br />
Gesundheitsbewusstsein sehr hoch hoch nachrangig vorhanden, aber nicht umgesetzt<br />
Wirtschaftspolitik mittlere Marktregulierung zielt auf dominante wettbewerbsorientierte schwache Marktregulierung soll mittlere Marktregulierung soll Mini-<br />
Stärkung des Wettbewerbs Marktregulierung starke deutsche, international mum an Wettbewerb gewährleisten<br />
Unternehmensstruktur (in den Dekonzentration mit Kooperationen ausgerichtete Unternehmen fördern<br />
<strong>Versorgung</strong>sbereichen) insbes. im Bereich Ab-/Wasser Dekonzentration Oligopole Oligopole<br />
Dienstleistungen: Anteile von: Anlagencontracting 30% Anlagencontracting 5% Anlagencontracting 30% Anlagencontracting 10%<br />
Rundum-Sorglos-Pakete 15% Rundum-Sorglos-Pakete 5% Rundum-Sorglos-Pakete 20% Rundum-Sorglos-Pakete 10%<br />
Smart Building 30% Smart Building 5% Smart Building 30% Smart Building 10%<br />
Demand Side Management 20% Demand Side Management 10% Demand Side Management 15% Demand Side Management 10%<br />
Endverbrauch<br />
bei Strom, Gas und Wasser Rückgang<br />
um mehr als 5%<br />
bei Strom, Gas und Wasser gleich<br />
bleibend<br />
bei Strom und Gas Zunahme um 2%,<br />
bei Wasser leichter Rückgang<br />
bei Strom und Gas gleich bleibend,<br />
bei Wasser leichter Rückgang<br />
Preisanstieg bei Strom und Gas 1 %/a 1,5%/a 2%/a 2,5%/a<br />
Preisanstieg bei Wasser 2%/a 3%/a 3%/a 4%/a<br />
Preisstruktur stärkere Gewichtung von verbrauchsabhängigen geringere Gewichtung von stärkere Gewichtung von<br />
gegenüber verbrauchsunabhängigen Bestandteilen verbrauchsabhängigen Bestandteilen verbrauchsabhängigen Bestandteilen<br />
Anteile an d. Stromerzeug.: Erdgas 45% 45% 17% 17%<br />
Kohle (Braun- + Stein-) 24% (10% + 14%) 24% (8% + 16%) 52% (22% + 30%) 52% (30% + 22%)<br />
Erneuerbare Energien 30% 30% 10% 10%<br />
Kernkraft 0% 0% 20% 20%<br />
Anteil dezentraler Stromerzeugung 22,5% 14,0% 8,5% 7,5%<br />
Anteil Stromspeichertechnik 5% 2%
1.2 Ziel<br />
1.2 Ziel<br />
Ziel dieses Forschungsvorhabens ist die Konzipierung und Durchführung eines Verfahrens,<br />
das Entscheidungen für zukünftige Weichenstellung unter Unsicherheit unterstützt. Auf der<br />
Basis multi-kriterieller Verfahren und eines diskursiven Ansatzes gilt es, ein praktikables und<br />
transparentes Verfahren zu entwickeln und zu erproben.<br />
Bereits im Vorfeld manifester Entscheidungen sind Chancen und Risiken zukünftiger Entwicklungen<br />
<strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong> auszuloten. Dazu gehört es, abzuschätzen, welche<br />
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen mit verschiedenen Entwicklungen verbunden<br />
sein können und wie bedeutsam diese vor dem Hintergrund unterschiedlicher gesellschaftlicher<br />
Zielvorstellungen und Interessen eingeschätzt werden. Ziel ist es, zu eruieren,<br />
welche Schwerpunkte aus der Sicht gesellschaftlicher Akteure gesetzt werden und welche<br />
Zielkorridore zukunftsträchtig sein könnten.<br />
2. Methode<br />
Im Folgenden werden die Grundzüge der Methode, auf die sich die Untersuchung stützt und<br />
die konkrete Konzeption des Verfahrens in der vorliegenden Untersuchung beschrieben.<br />
2.1 Hintergrund<br />
Unterschiedliche Pointierungen und Sichtweisen sind in Bezug auf die Ausgestaltung konstitutiver<br />
Elemente von Nachhaltigkeit, wie beispielsweise Ein-, Drei oder Mehr-Säulen-Konzepte,<br />
intra- und intergenerative Gerechtigkeit zu erkennen. Diesen liegen unterschiedliche<br />
Paradigmen zugrunde (siehe Teil I, Kapitel 1). Dem gemäß existieren verschiedene Methoden<br />
zur Bewertung von Nachhaltigkeit (siehe Teil I, Kapitel 2). Zwei Klassen von Methoden<br />
lassen sich hervorheben: (a) die wissenschaftlich-theoretische Ableitung zur Ermittlung von<br />
Zielen bis hin zu genauen Messgrößen zur Füllung der Nachhaltigkeitsdefinition und (b)<br />
diskursive Verfahren.<br />
Im ersten Fall werden z. B. theoretisch aus den Grunddaseinsfunktionen (Jäger, 2002) oder<br />
aus den konstitutiven Elementen erwachsene Anforderungen an Inhalte von Nachhaltigkeit<br />
Ziele nachhaltiger Entwicklung abgeleitet. Die weitere Präzisierung erfolgt z. B. durch Formulierung<br />
von Regeln und die Konkretisierung durch Bildung von Kriterien (Brandi et al., 2001).<br />
Im zweiten Fall erfolgt die Inhaltsbestimmung unter Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure.<br />
Begründet wird dieses Vorgehen zum einen mit der Abhängigkeit nachhaltiger Politik von den<br />
jeweiligen Randbedingungen, wodurch sich keine allgemeinen Verhaltensregeln ableiten<br />
lassen. Zum anderen wird der Einsatz gesellschaftlicher Diskurse deshalb als einziges Mittel<br />
zur Rechtfertigung des Handels hervorgehoben, da die Entscheidungen über Naturerhalt und<br />
Naturnutzung Prozesse kollektiver Bewertung und Abwägung erfordern. Dazu muss sich die<br />
Gesellschaft über Präferenzen und Gewichtungen von Werten verständigen (Renn, 2002).<br />
67
Teil II Empirische Untersuchung: 2. Methode<br />
Zwar gibt es eine ganze Reihe solcher diskursiven Verfahren zur Bewertung einer nachhaltigen<br />
Entwicklung (siehe beispielhaft Teil I, Abschnitt 2.2), doch es soll ein Verfahren zur Anwendung<br />
gelangen, das in der Lage ist,<br />
• mehrdimensionale Kriterien zur Beurteilung von zukünftigen Entwicklungspfaden heranzuziehen,<br />
• neben monetären und physischen Wertmaßstäben auch qualitative zu berücksichtigen,<br />
• die explizite Trennung von Wirkungsanalyse und Bewertung vorzunehmen und<br />
• einen Vergleich der Zukunftsszenarien zu ermöglichen.<br />
Dazu eignen sich in besonderer Weise multi-kriterielle Entscheidungsverfahren.<br />
2.2 Multi-kriterielle Entscheidungsverfahren<br />
Multi-kriterielle Bewertungs- und Entscheidungsverfahren bilden die Grundlage der Bestimmung<br />
einer individuellen Ordnung von Handlungsalternativen bei Entscheidungen mit Mehrfachzielsetzung<br />
(von Winterfeldt, 1999). In der praktischen Anwendung steht eine Theorie im<br />
Mittelpunkt: die additive multiattribute Nutzentheorie (Multi-Attribute Utility Theory, MAUT).<br />
MAUT zielt darauf ab, eine Entscheidung zugunsten einer Option aus einer Auswahl von<br />
Alternativen anhand eines Bündels von Attributen (oder Kriterien) zu fällen. Attribute bezeichnen<br />
die Bewertungsaspekte, die bei der Beurteilung der Entscheidungsoptionen (hier:<br />
die Zukunftsszenarien) aus Sicht des Bewerters von Bedeutung sind. Die Entscheiderpräferenzen<br />
werden in einem formal-mathematischen Modell abgebildet.<br />
Die Grundannahme dieser Theorie besagt, dass ein schwieriges Entscheidungsproblem sich<br />
durch Dekomposition, d. h. das Zerlegen des Problems in einzelne Komponenten, das Erzeugen<br />
von Teilmodellen und anschließender Zusammenfassung in ein Gesamtmodell,<br />
besser lösen lässt. Dabei werden im Entscheidungsmodell zwei Kategorien von Input-Daten<br />
unterschieden: Zum einen Kenntnisse bzw. Erwartungen bezüglich der Konsequenzen bzw.<br />
Wirkungen, die sich aus den jeweiligen Optionen ergeben können. Hier geht es um mehr<br />
oder weniger gesichertes Faktenwissen. Zum anderen Wertungen, nämlich die Attribute<br />
(Kriterien), die die Ziele des Entscheidungsträgers und ihre Bedeutung offenbaren (Schneeweiß,<br />
1991). Die Dekomposition der Entscheidungssituation wird als grundlegende Vorgehensweise<br />
zur Förderung der Rationalität einer Entscheidungsunterstützung erachtet. So<br />
können Wertedebatten von Sachdebatten unterschieden werden mit dem Ziel, einen höheren<br />
Grad an Transparenz für Wert- und Sachergebnis zu erreichen (Oppermann & Langer, 2000;<br />
Skorupinski & Ott, 2000).<br />
2.2.1 Klassifikation von multi-kriteriellen Verfahren<br />
Es lassen sich zwei Klassen unterscheiden:<br />
• MADM-Verfahren und<br />
• Outranking-Verfahren<br />
Verfahren des MADM (engl. Multi Attribute Decision Making) fußen im Wesentlichen auf der<br />
MAUT. Diese hat unter anderem ihren Ursprung in der „Expected Utility Theory". Die MAUT<br />
spielt als präskriptive Anwendung der Entscheidungstheorie und nicht als deskriptives Ver-<br />
68
2.2 Multi-kriterielle Entscheidungsverfahren<br />
fahren eine zentrale Rolle. Präskriptive Ansätze stellen den Versuch dar, eine Entscheidungshilfe<br />
über die systematische und logisch fundierte Analyse bestehender Informationen<br />
zu erreichen (Keeney, 1992b). Genau auf die Strukturierung und Transparenz des Entscheidungsprozesses<br />
zielt die MAUT ab. Raiffa (1969) und Edwards (1971 und 1977) verliehen<br />
der MAUA (engl. Multi Attribute Utility Analysis) ihr Ansehen in der Praxis. Eine erstmals<br />
geschlossene Darstellung dieses Entscheidungsverfahrens ist bei Keeney & Raiffa (1976) zu<br />
finden (von Winterfeldt & Edwards, 1986).<br />
Zur Familie der MADM-Verfahren auf Basis von nutzen- und entscheidungstheoretischer<br />
Überlegungen gehört die Nutzwertanalyse als ältestem Verfahren (siehe Teil I, Abschnitt 2.1)<br />
Während die MAUT eine begründete Theorie darstellt, die streng auf die Einhaltung von<br />
nutzentheoretischen Rationalitätsaxiomen beruht, handelt es sich bei der Nutzwertanalyse<br />
um ein eher heuristisches Verfahren.<br />
Eine der bedeutendsten Weiterentwicklungen der MADM-Verfahren ist der AHP (engl. Analytic<br />
Hierarchy Process). Die Konzeption des AHP geht auf den Ökonomen und Mathematiker<br />
T. S. Saaty zurück, der diese Bewertungsmethode in den 70er Jahren entwickelte (Saaty,<br />
1972 und 1977). Saaty & Forman (1992) listen eine Sammlung von mehr als 500 Modellen<br />
auf, die in der Praxis erfolgreich angewandt wurden. Der AHP ist ein standardisiertes und<br />
prozessorientiertes Verfahren.<br />
Neben den MADM-Verfahren sind die sogenannten „Outranking-Verfahren" zu nennen. Die<br />
beiden bedeutendsten sind Electre und Promethee (Klenner, 2002; Benayoun et al., 1966).<br />
Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Ansätzen sind „Outranking-Verfahren" jedoch nur in<br />
denjenigen Fällen eine gute Wahl, in denen eine Entscheidungssituation vorliegt, in der eine<br />
große Zahl von Alternativen durch wenige Kriterien beurteilt werden sollen (Triantaphyllou,<br />
2000)12.<br />
2.2.2 Anwendungen<br />
MADM-Verfahren finden Anwendung bei Entscheidungen mit multiplen Zielen und/oder<br />
mehreren Entscheidungsträgern. Insbesondere für Entscheidungen, bei denen nur wenig<br />
Feedback über deren Fehlerfreiheit zu erwarten ist, sind sie relevant (Katzman, 1987).<br />
MADM-Verfahren werden in zahlreichen Problemfeldern eingesetzt. Folgende für das Thema<br />
<strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong> relevante Anwendungsbeispiele lassen sich anführen:<br />
• Zur Konsensbildung bei Entscheidungen mit hohem Konfliktpotenzial<br />
Ein Beispiel hierfür ist die Entscheidung über die Wahl des besten Standortes einer Deponie<br />
für nukleare Sonderabfälle (Apostolakis & Picket, 1998) oder des Einsatzes von in der Öffentlichkeit<br />
sehr kontrovers diskutierter Energieversorgungstechnologien (Hämäläinen,<br />
1990).<br />
• Planungen des öffentlichen Sektors<br />
Beispiele sind die Bewertung von alternativen Energieversorgungsplänen zur Entscheidung<br />
über den vorzugswürdigsten Plan (Keeney & McDaniels, 1999; Hobbs & Meier, 1994; Hämäläinen<br />
& Seppäläinen, 1986), die strategische Planung des Einsatzes verschiedener Stro-<br />
12<br />
Im Folgenden wird nur auf die für die vorliegende Untersuchung relevanten MADM-Verfahren<br />
eingegangen<br />
69
Teil II Empirische Untersuchung: 2. Methode<br />
merzeugungstechnologien (Lo, Campo & Ma, 1987), Allokationspläne für die Verteilung der<br />
Energieressourcen auf die jeweiligen Industriezweige (Saaty & Mariano, 1979), die Entwicklung<br />
eines Plans zur Nutzung von Wasserressourcen (Keeney & Wood, 1977) oder die Planung<br />
einer Abwasserkläranlage einer Großstadt (Keeney, McDaniels & Ridge-Cooney, 1996).<br />
• Bereitstellung von Informationen für politische Entscheidungsträger als deren Entscheidungsgrundlage<br />
Beispielhaft für die Unterstützung nationaler Politiken sei die Bewertung alternativer Optionen<br />
der Energiepolitik für Deutschland genannt (Keeney, von Winterfeldt & Eppel, 1990). Andere<br />
Beispiele sind für USA Gholamnezhad & Saaty (1982), für Finnland Hämäläinen & Karjalainen<br />
(1992), für UK Jones, Hope & Hughes (1990) oder für China Zongxin & Zhihong (1997).<br />
• Bereitstellung von Informationen für Entscheidungsträger auf Unternehmensebene<br />
Beispiele sind der Einsatz zur Wahl der besten Option hinsichtlich alternativer Strategien zur<br />
Ausdehnung der Stromerzeugung eines Energieversorgungsunternehmens (Akash et al.,<br />
1999; Keeney, 1992a; Keeney & McDaniels, 1999) oder bei Entscheidungen im Informationstechnologiebereich<br />
hinsichtlich des geeignetsten Distributionskanals für ein bestimmtes<br />
Produkt (Roper-Lowe & Sharp, 1990; Keeney, 2001)<br />
2.2.3 Grundprinzip der MAUT und des AHP<br />
Die Grundstruktur eines Entscheidungsproblems kann beschrieben werden durch die Komponenten<br />
„Handlungsalternativen" (auch Optionen), deren „Konsequenzen" (auch Zielerreichungsgrad<br />
oder Attributausprägung der Alternative) sowie die Ziele des Entscheiders. Bewertet<br />
wird jede Alternative durch Attribute, die die Ziele des Entscheiders repräsentieren.<br />
Die Struktur des Entscheidungsproblems ist in Tabelle 2 dargestellt.<br />
Attribut K 1<br />
Attribut K2<br />
• • •<br />
Attribut Kn<br />
a1 1/1 (a1) V2 (a1) • - vn (a1)<br />
a 2 v1 (a2 ) v2 (a2 ) .... vn (a2)<br />
... ...<br />
a m v1 (a m ) v2 (a m ) ... vn (am)<br />
Tabelle 2: Struktur des Entscheidungsproblems bei multikriteriellen Entscheidungsverfahren<br />
Gegeben sind m Alternativen ..., a m. Die Alternativen sind durch n Attribute K gekennzeichnet.<br />
Es sind die Alternativen a 1 bis a m im Hinblick auf n Attribute zu bewerten. Die Ausprägung<br />
der Alternative ai auf dem k-ten Attribut wird mit vk (ai) bezeichnet.<br />
Das Entscheidungsmodell der MAUT ist die formalisierte Abbildung der für wesentlich erachteten<br />
Elemente und Beziehungen eines Entscheidungsproblems. Das Entscheidungsmodell<br />
ermöglicht die logische Ableitung einer Problemlösung. Gemäß der Grundidee der präskriptiven<br />
Entscheidungstheorie wird der Nutzen einer Alternative als Funktion der Teilnutzen, die<br />
die Alternative bzgl. der einzelnen Ziele aufweist, erfasst.<br />
70
2.2 Multi-kriterielle Entscheidungsverfahren<br />
Es wird angenommen, dass der Entscheider für alle Alternativen die relevanten Attribute<br />
kennt, dass er für jedes Attribut eine sog. Partialnutzenfunktion besitzt und jedem Attribut<br />
eine bestimmte Wichtigkeit w beimisst. Gemäß MAUT bestimmt der Entscheider für jede<br />
Alternative ihren Gesamtnutzenwert als die Summe aus den Produkten der Wichtigkeit mit<br />
den Partialnutzenwerten der Ausprägung auf alle Attribute. Formal heißt dies:<br />
Kai ) = Ewkyk(ai)<br />
k=1<br />
mit:<br />
v(a;) : Gesamtnutzenwert der Alternative ai<br />
Gewichte der k = 1 n Attribute<br />
vk (aJ) : bewertete Konsequenzen der Alternative a . über die k = 1 n Attribute (Partialnutzen)<br />
Die Reihung der Alternativen in eine besser / schlechter Anordnung stellt das Ergebnis dar.<br />
Der Entscheider wählt diejenige Option, die den höchsten Gesamtnutzen hat. Dabei wird<br />
unterstellt, dass er sich rational verhält und seinen Nutzen zu maximieren sucht (Eisenführ &<br />
Weber, 1999).<br />
Die MAUT gehört zu den kompensatorischen Entscheidungsregeln (Hogarth, 1987): Eine<br />
schlechte Ausprägung, die eine Option auf einem Attribut aufweist, kann grundsätzlich durch<br />
eine gute Ausprägung auf einem anderen Attribut kompensiert werden. Die additive Aggregation<br />
der Teilnutzen ist allerdings nur dann zulässig, wenn (a) die Vergleichbarkeit aller Attribute<br />
gegeben ist, damit eine Kompensierbarkeit aller Vor- und Nachteile vorhanden ist sowie<br />
(b) die präferentielle Unabhängigkeit zwischen den Attributen gewährleistet ist (von Nitzsch,<br />
1996).<br />
Der AHP basiert wie die MAUT auf einem linearen additiven Entscheidungsmodell. MAUT<br />
und AHP unterscheiden sich vor allem in drei Punkten:<br />
1. Während die MAUT mit einer nicht-hierarchischen Struktur des Entscheidungsproblems<br />
auskommen kann, erfordert der AHP explizit eine hierarchische Strukturierung.<br />
2. Während bei der MAUT die Attributausprägungen der Alternativen (Partialnutzen) explizit<br />
als Nutzenfunktion bestimmt werden, erfolgt beim AHP deren Bestimmung (Partialgewichte)<br />
anhand der sog. „Eigenwert-Methode" auf Basis des streng formalisierten<br />
Verfahrens des sukzessiven Paarvergleichs.<br />
3. Während die MAUT verschiedene Verfahren zur Bestimmung der Gewichte der Attribute<br />
zulässt, erlaubt der AHP nur das direkte Verfahren des Paarvergleichs.<br />
Kennzeichnend für den AHP ist die strenge Ordnung der Entscheidungssituation in hierarchische<br />
Ebenen (siehe beispielhaft Abbildung 1).<br />
71
Teil II Empirische Untersuchung: 2. Methode<br />
Zielebene 0<br />
Oberziel<br />
Zielebene 1<br />
Zielebene 2<br />
Abbildung 1: Hierarchische Struktur des AHP<br />
Aus einem Oberziel wird eine Zielhierarchie abgeleitet, wobei die Subziele auf der untersten<br />
Ebene analog zur MAUT als Attribute bezeichnet werden können. Die Zielerreichung wird an<br />
den Alternativen bestimmt, die das letzte Glied der Hierarchie darstellen. Im AHP werden alle<br />
Elemente in einer Hierarchieebene im Paarvergleich auf der neunstufigen AHP-Skala miteinander<br />
verglichen. Diese reicht von „absolut dominierend" (= 9) über „gleich gewichtig"(= 1)<br />
bis „absolut unterlegen" (= 1/9). Der AHP geht davon aus, dass sich der Entscheider bei<br />
seinen Aussagen reziprok verhält.<br />
Daher ergibt sich die Anzahl P der Paarvergleiche in der Subziel-Ebene E aus:<br />
n m .(m _1)<br />
P(E) = I<br />
2 I j=1<br />
mit Anzahl der Subziele unter dem Subziel j der übergeordneten Ebene (E-1), n: Anzahl<br />
der Subziele in der übergeordneten Ebene,<br />
sowie in der Ebene der Alternativen aus:<br />
m -(m -1)<br />
P(m,n)=<br />
2<br />
mit m: Anzahl der Alternativen, n: Anzahl der Attribute (Subziele der untersten Ebene).<br />
Im AHP werden die Gewichte durch die Eigenvektorisierung von Paarvergleichsmatrizen<br />
ermittelt. Die Teilgewichte werden relativ zum Oberziel ermittelt und in eine neue Matrix<br />
überführt. Diese Informationen werden aggregiert, um ein Gewicht für jede Alternative zu<br />
berechnen und damit ein Ranking zu erhalten. Mit der Eigenwert-Methode wird gleichzeitig<br />
für jede Paarvergleichsmatrix ein Konsistenztest durchgeführt.<br />
72
2.2 Multi-kriterielle Entscheidungsverfahren<br />
Das Vorgehen beider Bewertungs- und Entscheidungsverfahren, setzt sich aus folgenden<br />
fünf Schritten zusammen:<br />
• Strukturierung des Problems,<br />
• Formulierung der Ziele,<br />
• Impact Assessment,<br />
• Gewichtung der Ziele einschließlich je nach Verfahren die Bestimmung von Einzel-<br />
Wert-/Nutzenfunktionen, sowie<br />
• Bestimmung der Präferenz einer Alternative.<br />
2.2.3.1. Strukturierung des Problems<br />
Der erste Schritt jedes Entscheidungsprozesses ist die exakte Problemdefinition. Sie ergibt<br />
sich aus der Formulierung einer Leitfrage. Mögliche Zielsetzungen können diejenigen sein,<br />
die die Alternative ermitteln, die den größten Nutzen bringt, oder es soll jene Alternative<br />
heraus gearbeitet werden, die die geringsten Kosten verursacht oder das geringste Risiko in<br />
sich birgt, das beste Verhältnis aus Kosten-Nutzen-Risiko aufweist oder schließlich den<br />
größten Beitrag leistet (Meixner & Haas, 2002).<br />
Bei der Problemdefinition soll das Problemumfeld nicht außer Acht gelassen werden. Beachtet<br />
werden soll auch, dass die Ziele, die elizitiert werden sollen, auch in der Lage sind, auf<br />
die Lösung des Problems abzuzielen. Außerdem ist es wichtig die „richtigen" Teilnehmer an<br />
dem Entscheidungsprozess zu beteiligen, nämlich solche, die mit der Fragestellung in irgendeiner<br />
Weise verbunden sind (Saaty & Vargas, 2000).<br />
2.2.3.2. Formulierung von Zielen<br />
„Klarheit über Ziele ist ... eine Voraussetzung für die Rationalität von Entscheidungen" (Eisenführ<br />
& Weber, 1986, S. 907). Im Entscheidungsmodell multi-attributiver Verfahren sind die<br />
Attribute und die damit verbundenen Ziele die Komponente, mit denen die möglichen Konsequenzen<br />
der Alternativen/Optionen bestimmt werden können. Ist – wie im AHP – die Erstellung<br />
einer Zielhierarchie gefordert, stehen zwei Ansätze zur Verfügung:<br />
• Der Top-down-Ansatz und<br />
• der Bottom-up-Ansatz.<br />
Beim Top-down-Ansatz erfolgt die Entwicklung der Zielhierarchie durch Aufspaltung der<br />
Oberziele in Unterziele. Dieses Vorgehen bietet sich bei Entscheidungen an, bei denen man<br />
bereits eine gute Vorstellung von der Grobstruktur der für die Entscheidung wichtigen Aspekte<br />
hat. Die Entwicklung der Zielhierarchie im Bottom-up-Ansatz basiert auf der Auflistung<br />
aller möglichen Ziele, wobei zusammengehörige Ziele dann zusammengefasst werden.<br />
Dieses Vorgehen bietet sich bei neuartigen Problemen an. Meist erfolgt eine Kombination<br />
aus Top-down und Bottom-up-Verfahren (Eisenführ & Weber, 1999).<br />
Ein solches Verfahren der Zielerhebung ist die sog. „Wertbaum-Analyse". Ein Wertbaum<br />
umfasst eine geordnete Struktur von Werten eines Individuums oder einer Gruppe in Bezug<br />
auf verfügbare Entscheidungsmöglichkeiten, wobei sich Werte in Ziele umformulieren lassen<br />
(Keeney & McDaniels, 1999). Werte sind dabei definiert als „Konzepte des Wünschenswerten"<br />
(„conception of the desirable") (Kluckhohn, 1962), wobei hervorzuheben ist, dass die<br />
73
Teil II Empirische Untersuchung: 2. Methode<br />
Werteinschätzungen unterschiedlicher Gruppen oder Personen über ökonomische hinausgehen<br />
(Skorupinski & Ott, 2000). Werte werden in der Nutzentheorie nicht als abstrakte<br />
Orientierungsgrößen verstanden, sondern als Dimensionen, an denen der Grad der Erwünschtheit<br />
spezieller Handlungsalternativen oder Konsequenzen abgeschätzt werden soll<br />
(Keeney & Raiffa, 1976).<br />
Als wünschenswerte formale Eigenschaften der Zielhierarchie werden<br />
• Vollständigkeit,<br />
• Operationalität,<br />
• Dekomponierbarkeit,<br />
• Redundanzfreiheit und<br />
• Minimalität<br />
der erhobenen Ziele hervorgehoben (Keeney & Raiffa, 1976). Als vollständig ist eine Zielhierarchie<br />
dann anzusehen, wenn alle für die Bewertung relevanten Aspekte aus der Sicht der<br />
Bewerter integriert sind. Operationalität bezieht sich auf die Messbarkeit der Attribute. Dekomponierbar<br />
ist die Menge der Ziele dann, wenn sich die Merkmale zu disjunkten Teilmengen<br />
zusammenfassen lassen. Redundanzfreiheit liegt vor, wenn jedes Attribut vom anderen<br />
weitestgehend unabhängig ist, also kein Ziel mit einem anderen identisch ist oder in einem<br />
funktionalen Verhältnis zueinander steht. Praktikabilitätsgesichtspunkte gebieten eine Beschränkung<br />
der Anzahl der Attribute auf das unbedingt notwendige.<br />
2.2.3.3. Impact Assessment<br />
Eng mit der Wertelizitierung verbunden ist die Messung der „Impacts" („Konsequenzen" bzw.<br />
„Attributausprägungen") der zu beurteilenden Alternativen in Bezug auf die einzelnen Attribute.<br />
Die Attribute bieten den höchsten Detaillierungsgrad in der Zielehierarchie (Greening &<br />
Bernow, 2004). Jedes Attribut sollte eine geeignete Maßgröße beinhalten bzw. eine Ableitung<br />
ermöglichen (Keeney, 2001).<br />
Zur Bestimmung der Konsequenzen können verschiedene Quellen herangezogen werden.<br />
Diese Informationen können entweder der Literatur entnommen werden, in der solche Wirkungen<br />
in anderen Zusammenhängen bereits dargestellt wurden (wie z. B. aus den Berichten<br />
der Enquete-Kommissionen des Deutschen Bundestages in der Studie Keeney, von<br />
Winterfeldt & Eppel, 1990). Liegen beispielsweise Risikoabschätzungen einzelner Technologien<br />
aufgrund von Risk Assessments vor, lassen sich diese in den Schritt der Wirkungsermittlung<br />
einspeisen (Apostolakis & Pickett, 1998). Des Weiteren kann auf Einschätzungen<br />
wissenschaftlicher Experten zurückgegriffen werden („expert judgments").<br />
Kennzeichnend für die Darstellung aller Wirkungen, die von den einzelnen Handlungsoptionen<br />
ausgehen, ist, dass ihre Beschreibung in quantitativer oder auch qualitativer Art in den<br />
Bewertungsprozess einfließen kann. Als quantitative Maßgrößen werden absolute Zahlen<br />
bzw. Bandbreiten bestimmter Größen herangezogen, um die Vielfalt der Expertisen sichtbar<br />
zu machen. Qualitative Maßstäbe können beispielsweise durch Angaben wie „hoch", „mittel",<br />
„niedrig" etc. als Vergleich der ausgewählten Alternativen formuliert werden (Meixner & Haas,<br />
2002).<br />
74
2.2 Multi-kriterielle Entscheidungsverfahren<br />
2.2.3.4. Gewichtung der Ziele<br />
Bei der Attributgewichtung geht es darum, die unterschiedliche Wichtigkeit, die verschiedene<br />
Attribute für den Bewerter haben, numerisch abzubilden. Dabei wird für jedes Attribut ein<br />
Gewichtungsfaktor wk bestimmt, der meist auf einer kardinalen Skala innerhalb des Intervalls<br />
[0;1] liegt, so dass gilt:<br />
VVk =1<br />
k=1<br />
Neben der Eigenvektormethode im Rahmen des AHP stehen verschiedene Gewichtungsverfahren<br />
zur Verfügung, die sich nach folgenden Dimensionen einteilen lassen (Fishburn,<br />
1967; Eisenführ & Weber, 1999):<br />
• Statistisch versus algebraisch,<br />
• holistisch versus dekompositorisch,<br />
• direkt versus indirekt.<br />
Statistische Verfahren, wie beispielsweise die Conjoint-Analyse, werden im folgenden nicht<br />
näher betrachtet, weil das additive Entscheidungsmodell unterstellt, dass der Entscheider<br />
bestimmbare Präferenzen hat und sich folglich auch Gewichtungen angeben lassen (Weber<br />
& Borcherding, 1993).<br />
Die beiden bekanntesten indirekten Verfahren sind die Swing-Gewichtung und das Trade-off-<br />
Verfahren. Die Rangbildungs-Methode und die Punktegewichtung gehören zu den direkten<br />
Verfahren.<br />
Das ganzheitliche Verfahren der Swing-Methode (von Winterfeldt & Edwards, 1986), erfordert<br />
vom Entscheider Präferenzurteile für eine vollständig definierte Alternativenmenge und<br />
damit die gleichzeitige Betrachtung aller Attributausprägungen in allen Alternativen über alle<br />
Ziele. Bei der Swing-Methode werden zunächst die schlechtestmögliche und die bestmögliche<br />
Ausprägung für jedes der Attribute festgelegt. Auf Basis der Konstruktion einer schlechtestmöglichen<br />
hypothetischen Option gibt dann der Entscheider an, auf welchem Attribut er<br />
eine Veränderung von der schlechtesten zur besten Ausprägung vornehmen würde (sog.<br />
Swing), wenn er ein Attribut verändern dürfte. Dadurch wird das wichtigste Attribut ermittelt.<br />
Bei Wiederholung dieses Vorgangs lassen sich auf diese Weise alle anderen Attribute ordnen<br />
und in eine Rangfolge bringen. Anschließend werden Punkte zwischen den Alternativen<br />
verteilt. Die beste Alternative erhält 100 Punkte, die schlechteste die geringste Punktezahl.<br />
Zur Ermittlung der Gewichte der einzelnen Alternativen werden die Punktzahlen normiert<br />
(Eisenführ & Weber, 1999).<br />
Als Dekompositionsverfahren findet die Trade-off Methode Anwendung (Keeney & Raiffa,<br />
1976). Die Gewichtsbestimmung mit Hilfe eines Trade-offs bedeutet, dass der Entscheider<br />
nach den Austauschraten zwischen zwei Attributausprägungen fragt, bei denen er indifferent<br />
ist. Dazu müssen die einzelnen Partialnutzenfunktionen der Attribute bekannt sein. Es wird<br />
so vorgegangen, dass jeweils Alternativenpaare konstruiert werden, die sich lediglich in zwei<br />
Attributen unterscheiden, wobei die zwei zu vergleichenden Optionen jeweils entgegengesetzt<br />
die schlechteste und die beste Ausprägung aufweisen sollen. Die Präferenz zwischen<br />
den beiden Alternativen wird ermittelt. Der Entscheider muss nun eine Ausprägung eines<br />
Attributes soweit erhöhen oder erniedrigen bis er indifferent bei Wahl dieser Option gegen-<br />
75
Teil II Empirische Untersuchung: 2. Methode<br />
über der zu vergleichenden ist. Die Partialnutzenfunktion, für die die Indifferenz festgestellt<br />
wurde, wird in das MAUT-Modell eingesetzt. Dieser Vorgang wird dann mit allen anderen<br />
Attributspaaren wiederholt. Aus dem so entstandenen Gleichungssystem lassen sich die<br />
Gewichtungen ermitteln (Eisenführ & Weber, 1999).<br />
Gewichte können auch nach der Rangbildungs-Methode ermittelt werden (Jungermann et<br />
al., 1998). Bei diesem direkten Verfahren müssen zunächst alle Attribute in einer Rangreihe<br />
geordnet werden. Es erfolgt die Zuordnung von Rangzahlen. Das wichtigste Attribut erhält<br />
den Rang R, = 1 bis zum unwichtigsten Attribut mit Rang m (bei m Attributen). Für jede<br />
Rangzahl wird der Reziprokwert gebildet. Die Gewichte ergeben sich durch Normierung auf<br />
das Intervall [0;1]:<br />
w,—<br />
1<br />
m<br />
1<br />
R, • E<br />
.J =1 Rj<br />
wobei w, die resultierende Wichtigkeit von Attribut i darstellt.<br />
Bei der Punktegewichtung wird vom Entscheider eine bestimmte Anzahl von Punkten (z. B.<br />
100) so auf die Attribute verteilt, dass die Punkte die relative Wichtigkeit der Attribute zueinander<br />
wiedergeben.<br />
2.2.3.5. Bestimmung der Präferenz einer Alternative<br />
Zur Bestimmung der Präferenz sind nicht-kompensatorische Verfahren von kompensatorischen<br />
Verfahren zu unterscheiden.<br />
Bei nicht-kompensatorischen Entscheidungsregeln wird eine Option dann nicht gewählt,<br />
wenn sie bestimmte vom Entscheider als notwendig erachtete Minimalniveaus auf einem<br />
oder mehreren Attributen nicht überschreitet oder wenn sie bestimmte als „absolut" wichtig<br />
erachtete Merkmale nicht besitzt, unabhängig davon, wie die Option auf anderen Attributen<br />
abschneidet.<br />
Wesentliche nicht-kompensatorische Entscheidungsregeln sind (Jungermann et al., 1998;<br />
Greening & Bernow, 2004):<br />
• Konjunktion: Es wird diejenige Option gewählt, die auf allen Attributen den jeweiligen<br />
Schwellenwert erfüllt.<br />
• Disjunktion: Es wird diejenige Option gewählt, die auf mindestens einem Attribut den<br />
Schwellenwert erfüllt.<br />
• Dominanzregel: Es wird diejenige Option gewählt, die auf allen Attributen mindestens<br />
so gut wie alle anderen Optionen und auf mindestens einem Attribut besser ist.<br />
• Minimax: Es wird die Option gewählt, deren schlechteste Ausprägung auf dem unwichtigsten<br />
Attribut liegt.<br />
Im Gegensatz dazu zählen MAUT und AHP zu den kompensatorischen Verfahren. Eine<br />
schlechte Ausprägung, die eine Option auf einem Attribut hat, kann durch gute Ausprägungen<br />
anderer Attribute ausgeglichen werden.<br />
76
2.3 Methodische Konzeption der Untersuchung<br />
Bei der MAUT wird diejenige Option gewählt, deren Partialnutzenwerte auf den einzelnen<br />
Attributen, jeweils mit den Gewichten der Attribute multipliziert und aufsummiert, den höchsten<br />
Gesamtwert ergibt (Merkhofer & Keeney, 1987, siehe Abschnitt 2.2.3). Dies gilt unter der<br />
Annahme der Nutzen- und Präfenzunabhängigkeit zwischen den jeweiligen Zielen. Andernfalls<br />
muss die lineare Gesamtnutzenfunktion Interaktionsterme enthalten, wodurch deren<br />
Bestimmung wesentlich erschwert wird. Sie wird zu einer multiplikativen oder multilinearen<br />
Nutzenfunktion (von Winterfeldt & Edwards, 1986; Katzman, 1987; Keeney, 1988).<br />
Die Präferenzfunktion im AHP wird durch den paarweisen Vergleich von Attributausprägungen<br />
der Alternativen ermittelt. Auf Basis der Eigenvektorberechnung erfolgt die Berechnung<br />
der Teilgewichte. Die Theoreme hierzu finden sich bei Saaty (1990b). Die Berechnung der<br />
Gesamtgewichte, um zu einem Ranking der Alternativen zu gelangen, erfolgt durch Aggregation<br />
der Teilgewichte.<br />
2.3 Methodische Konzeption der Untersuchung<br />
Ein Verfahren zur Entscheidungsunterstützung unter Unsicherheit erfordert einerseits, das<br />
verfügbare wissenschaftliche Wissen einzufangen und andererseits die gesellschaftlichen<br />
Prozesse abzubilden, die letztlich die Entscheidung für den einen oder anderen Weg in die<br />
Zukunft der <strong>Versorgung</strong> tragen. Dabei ist es von entscheidender Bedeutung, Weichenstellungen<br />
für zukünftige Entwicklungen in einem strukturierten Verfahren zu finden, das vorzeitigen<br />
Festlegungen und Positionen durch größtmögliche Transparenz der Entscheidungsgrundlagen<br />
den Nährboden entzieht. Es geht darum, Bewertungen und Entscheidungen schrittweise<br />
in wechselseitigem Austausch der relevanten gesellschaftlichen Akteure zu entwickeln und<br />
dabei wissenschaftliche Erkenntnisse und gesellschaftliche Interessen in aufeinander aufbauenden<br />
Verfahrensschritten zu berücksichtigen. Die Dekomposition des Entscheidungsproblems<br />
bei multi-kriteriellen Verfahren bietet die Grundlage für ein solches strukturiertes<br />
Vorgehen. Der hier vorgeschlagene Ansatz baut auf dem Verfahren der multi-kriteriellen<br />
Bewertung auf (Saaty, 1990; Keeney & Raiffa, 1976; siehe Abschnitt 2.2), adaptiert ihn aber<br />
an den vorliegenden Problemkontext (siehe Abschnitt 2.3.2).<br />
2.3.1 Diskursiver Ansatz<br />
Das Grundprinzip der Dekomposition des Entscheidungsproblems ermöglicht es, sowohl<br />
wissenschaftliches Wissen als auch Wertewissen in strukturierter Weise einzubringen. Dies<br />
öffnet den Weg zur Beteiligung gesellschaftlicher Akteure.<br />
Hinsichtlich partizipativer Prozesse und deren Ausgestaltung gibt es eine Reihe praktischer<br />
Erfahrungen (u. a. Renn, 1999; Greening & Bernow, 2004). Je nach der Zielsetzung der<br />
Untersuchung werden bei der Anwendung multi-kriterieller Verfahren als diskursive Entscheidungsprozesse<br />
(„deliberative decision making") in den einzelnen Phasen unterschiedliche<br />
Akteure miteinbezogen. Tabelle 3 zeigt beispielhaft unterschiedliche Diskurskonzepte.<br />
77
78<br />
Autoren Zielsetzung Beteiligte Gruppen Methoden<br />
Apostolakis & Pickett, Konsensbildung bei der Entschei- Einbindung von Gruppen gesellschaftlich MAUT zur Bestimmung der Präferenz der<br />
1998 dung über die beste Alternative zur Betroffener (Öffentlichkeit, Deponiebetreiber Alternativen<br />
Sanierung einer Sondermülldeponischen<br />
Aufsichtsbehörde)<br />
sowie Vertreter der nationalen und städti-<br />
Risk Assessment zur Bestimmung der Impacts<br />
AHP zur Bestimmung der Gewichtungen.<br />
Keeney & McDaniels, Konsensbildung bei Planungen Vertreter des Energieversorgers, Stakehol- MAUT zur Elizitierung von Zielen in Einzelinter-<br />
1999 des öffentlichen Sektors hinsicht- der als Vertreter verschiedener gesellschaft- views mit Vertretern des <strong>Versorgung</strong>sunterlich<br />
alternativer Energieversorgungsplänen<br />
licher Perspektiven, Vertreter der Behörde,<br />
die mit <strong>Versorgung</strong>sangelegenheiten betraut<br />
ist<br />
nehmens und der Aufsichtsbehörde sowie in<br />
einem Gruppentreffen aller Stakeholder<br />
Edwards, 1982 Entwicklung eines Plans zur Auf- Vertreter von verschiedenen gesellschaftli- Anwendung der verkürzten Form von MAUT<br />
hebung der Rassentrennung im chen Gruppen der Einwohner von Los Ange- (SMART) (unter Bestimmung von Gewichtun-<br />
Schuldistrikt Los Angeles<br />
les sowie Entscheidungsträgern der Schulbehörde<br />
zur Elizitierung von Werten und<br />
gen auf allen Ebenen des Wertebaums) als Teil<br />
einer Kosten-Nutzen-Analyse<br />
Bildung von Gewichtungsfaktoren:<br />
Experten der Schulbehörde zur Gewinnung<br />
von Nutzenfunktionen je Attribut<br />
Keeney, von Winter- Bewertung von alternativen Optio- Vertreter von betroffenen gesellschaftlichen Public value Forum (Kombination aus Fokusfeldt<br />
& Eppel, 1990 nen der Energiepolitik (verschiedene<br />
Gruppen zur Elizitierung von Werten und gruppen und MAUT)<br />
Energieszenarien)<br />
Erstellen eines gemeinsamen<br />
Wertbaums<br />
Tabelle 3: Beispiele für Diskurskonzepte<br />
Expert Judgements zur Ermittlung der Impacts<br />
Ingenieure, Lehrer der Sozialwissenschaften<br />
als Fokusgruppenteilnehmer zur Bildung von<br />
Einzelnutzenfunktionen und Gewichtungsfaktoren
2.3 Methodische Konzeption der Untersuchung<br />
Das Diskurskonzept der vorliegenden Untersuchung übernimmt die in den meisten Studien<br />
vorgenommene Trennung der Aufgaben, die wissenschaftlichen Experten einerseits und<br />
gesellschaftlichen Akteuren andererseits zukommt. Wissenschaftliche Experten treffen Aussagen<br />
über die „Wirkungen" der Zukunftsszenarien (Attributausprägungen bzw. Zielerreichungsgrad),<br />
gesellschaftliche Akteure bringen ihre Zielvorstellungen und Aussagen über die<br />
Wichtigkeit der Ziele (Zielhierarchie, Gewichtung) ein.<br />
Bei der Frage, welche gesellschaftlichen Akteure in die Untersuchung einbezogen werden<br />
sollen, zeigt sich, dass verschiedene theoretische Begründungen von Partizipationsverfahren<br />
auch zu Unterschieden in der Verfahrensgestaltung führen. Die diskurstheoretische Begründung,<br />
die auf Habermas (z. B. 1987) zurückgeht, verweist auf Verfahren, die sich auf eine<br />
breite Bürgerbeteiligung stützen. Wird hingegen die Legitimitätsfrage in den Blickpunkt gestellt,<br />
wie z. B. bei van den Daele (van den Daele & Neidhardt, 1996), verweist dies auf Verfahren<br />
mit Einbezug von „Stakeholdern" als Vertreter von Interessengruppen. Darüber hinaus<br />
ist anzumerken, dass es kein Verfahren gibt, das einer mathematischen Gleichung entsprechend<br />
zu einer eindeutigen Ableitung von Institutionen bzw. Personen führen würde. Ein<br />
solches Verfahren ist auch nicht denkbar, weil die in der Diskursforschung abstrakt herauskristallisierten<br />
Kriterien der Auswahl, wie z. B. Relevanz oder Fairness (Renn, Webler &<br />
Wiedemann, 1995), jeweils im Einzelfall über eine Verknüpfung mit dem jeweiligen Untersuchungskontext<br />
und Thema konkretisiert werden müssen. Diese Konkretisierung lässt sich nur<br />
im Wege der Interpretation erzielen.<br />
In der vorliegenden Untersuchung werden „Stakeholder" einbezogen. Edwards (1982,<br />
S. 170) definiert „Stakeholder" als ein „set of people, preferably organized, who know enough<br />
about the problem to have coherent and organized opinions and care enough to spent time<br />
working with the decision analyst". Nach Apostolakis & Pickett (1998, S. 623) ist ein „stakeholder"<br />
„any person or organization that may have a stake in the consequences of a particular<br />
decision". Das zentrale Kriterium für die konkrete Auswahl der Interessengruppen ist „die<br />
Betroffenheit" gesellschaftlicher Akteure von potentiellen Wandlungen in den <strong>Versorgung</strong>ssektoren.<br />
Die Betroffenheit der gesellschaftlichen Gruppen kommt dadurch zum Ausdruck,<br />
dass die jeweilige Gruppe in der Realisierung ihrer Ziele durch die Wirkungen, die von den<br />
Veränderungen in den Sektoren ausgehen können, berührt wird. Die Tangierung kann sowohl<br />
den Charakter einer Einschränkung bis hin zur Verhinderung als auch eine Erweiterung<br />
oder gar erst die Ermöglichung der Erreichung von Zielen haben. Diese Veränderungen in<br />
der Realisierung ihrer Ziele betreffen sowohl solche Gruppen, die mit <strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
in Verbindung stehen als auch solche, die vom Herstellungsprozess betroffen sind. Diejenigen<br />
Gruppen, deren Ziele durch die Veränderung der <strong>Versorgung</strong>sleistungen tangiert werden,<br />
können weiter untergliedert werden in solche Gruppen, die auf der Anbieterseite und<br />
solche, die auf der Nachfrageseite von <strong>Versorgung</strong>sleistungen stehen (siehe beispielhaft<br />
Tabelle 4). Aus den Organisationen werden diejenigen Teilnehmer gewählt, die sich in ihren<br />
Organisationen auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und eine möglichst sektorübergreifende<br />
Kompetenz im Bereich der <strong>Versorgung</strong> mitbringen.<br />
79
80<br />
Organisation Wer wird Vertreten Art der Betroffenheit Wie äußert sich Betroffenheit (Beispiele)<br />
BGW<br />
DGB<br />
BDI als Anbieter<br />
Gas- und Wasserversorgungsunternehmen<br />
Arbeitnehmerseite der <strong>Versorgung</strong>swirtschaft<br />
Groß- bis mittlere <strong>Versorgung</strong>s-Unternehmen<br />
- Betroffene im Bereich <strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
und<br />
-dienstleistungen<br />
-- Anbieterseite<br />
Sektoren Wasser, Gas - Bei Veränderung der Marktposition, Markt- und Unternehmensstruktur<br />
infolge der Liberalisierung könnte im Gassektor<br />
die Integration von Unternehmen der einzelnen Wertschöpfungsstufen<br />
und die Wechselwirkung mit dem<br />
Stromsektor sowie im Wassersektor die Wasserqualität eine<br />
wichtige Rolle spielen.<br />
---- sektorübergreifend - Veränderung der Marktposition, Marktstruktur durch Unternehmenszusammenschlüsse<br />
und Auftritt von privaten/öffentlichen<br />
Haushalten als Strom-/Gasproduzenten<br />
könnten zu einer Veränderung der Beschäftigung bei den<br />
<strong>Versorgung</strong>sunternehmen führen<br />
- Veränderung der Dienstleistungsorientierung und der<br />
Marktposition der einzelnen Unternehmen könnte zu einer<br />
Veränderung der Arbeitsbedingungen (hinsichtlich Arbeitszeiten,<br />
Sonderzuwendungen, Arbeitsbelastung etc.) führen<br />
---- sektorübergreifend - Die Nachfrage nach veränderten Strom, Wärme und Telekommunikationsprodukten<br />
und weiteren Dienstleistungen<br />
kann zu einer Veränderung der Art und der Organisation<br />
des Bezugs von <strong>Versorgung</strong>sleistungen führen.<br />
Tabelle 4: Beispiele für potentielle Interessengruppen und ihre Betroffenheit von Veränderungen in den <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
(Fortsetzung auf der nächsten Seite)
Organisation Wer wird vertreten Art der Betroffenheit Wie äußert sich Betroffenheit (Beispiele)<br />
-- Nachfragerseite<br />
BDI als Nach- Groß- bis mittlere Unterneh- Industrie (sektorübergrei- - Betrieb der Produktion von Strom, Wärme und Wasser am<br />
frager men fend)<br />
Unternehmensstandort durch ein <strong>Versorgung</strong>sunternehmen<br />
oder Dienstleister könnte zu einer Veränderung der<br />
Organisation des Bezugs von <strong>Versorgung</strong>sleistungen führen.<br />
Bundesverband Privater Konsum ---- priv. Haushalte (sektorüber- - Veränderung in der Marktstruktur könnte zur Veränderung<br />
Verbraucherschutz<br />
greifend)<br />
der Strom-, Gas- und Wasserpreise und folglich des Kostenanteils<br />
am Haushaltsbudget führen.<br />
- Durch Veränderung des Marktes für TK-Dienste und infolgedessen<br />
die Größe der TK-Infrastruktur und durch Veränderungen<br />
der Wasserqualität könnte die Gesundheit der<br />
Konsumenten berührt werden.<br />
Deutscher Städ- Öffentlicher Konsum ---- öffentliche Haushalte (sek- - Veränderung der Organisation der Produktion von Versortetag<br />
torbergreifend)<br />
gungsleistungen könnte zu verstärktem Auftreten der öff.<br />
HH als Stromanbieter führen.<br />
- Betroffene vom Herstellungsprozess<br />
BUND Umwelt sektorübergreifend - Veränderungen im Energieerzeugungsmix und der Qualität<br />
der Abwasserbehandlung könnte zu Veränderung der Belastungen<br />
der einzelnen Medien (Luft, Wasser, Boden),<br />
führen.<br />
Tabelle 4 (fortgesetzt): Beispiele für potentielle Interessengruppen und ihre Betroffenheit von Veränderungen in den <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
81
Teil II Empirische Untersuchung: 2. Methode<br />
2.3.2 Verfahrensschritte<br />
Das hier vorgeschlagene Verfahren beinhaltet folgende Bausteine (siehe Abbildung 2): (a)<br />
die Erhebung einer Zielhierarchie zur Bewertung der Zukunftsszenarien, (b) die Erfassung<br />
der Gewichte, (c) die Erfassung der Wirkungen bzw. „Konsequenzen" der Szenarien (Attributausprägungen<br />
der Alternative) und (d) die abschließende Bewertung der Szenarien in<br />
einem Workshop gerade unter der Berücksichtigung der Zielerreichungsgrade der Szenarien.<br />
Gemäß dem diskursiven Ansatz der Untersuchung folgt der Baustein Ziele keinem normativen<br />
Ansatz, welcher Maßstab für Nachhaltigkeit anzulegen ist. Daher spielt die Frage der<br />
Ein- oder Mehrdimensionalität von Nachhaltigkeit keine Rolle (siehe Teil I). Es erfolgt vorab<br />
keine Festlegung. Gesellschaftliche Akteure, die letztlich für den Erfolg einer Entwicklungslinie<br />
entscheidend sind, sind es, die Ziele für die Bewertung der Zukunftsszenarien definieren<br />
und über die Gewichtung darlegen, worauf es ihnen besonders ankommt. Das Spektrum der<br />
Ziele hängt von den sie generierenden gesellschaftlichen Akteuren ab.<br />
Für die Gewichtung von Nachhaltigkeitszielen ist u. a. das Wissen darüber entscheidend,<br />
welche Konsequenzen mit den Zukunftsszenarien verbunden sind. Wissenschaftliche Experten<br />
untersuchen in der Impact-Analyse, inwieweit die Zukunftsszenarien mit den ermittelten<br />
Zielen in Einklang stehen. Den Schlusspunkt des Verfahrens bildet ein Workshop unter<br />
Beteiligung von Wissenschaftlern und gesellschaftlichen Akteuren, die im Vorfeld mitgewirkt<br />
haben. Für die Frage der Zukunftsfähigkeit der Szenarien ist entscheidend, wie die gesellschaftlichen<br />
Akteure die Stärken und Schwächen – wie sie von den wissenschaftlichen Experten<br />
aufgezeigt wurden – vor ihrem Interessenshintergrund einschätzen und gewichten.<br />
Die nachfolgende Graphik zeigt die Bausteine und Schritte der Nachhaltigkeitsbewertung der<br />
Zukunftsszenarien.<br />
Erhebung der Ziele<br />
7 Interviews<br />
w<br />
N<br />
Strukturierung der Ziele<br />
7<br />
Rückkopplung<br />
Gewichtung der Ziele<br />
7<br />
Fragebogen<br />
und Interviews<br />
Wirkungen<br />
Bewertung<br />
Impact-Analyse<br />
Chancen - Risiko -<br />
diskussion<br />
der Szenarien<br />
7<br />
7<br />
Zweitägiger<br />
Gutachten Wissenschaft<br />
Workshop<br />
Abbildung 2: Bausteine und Schritte der Nachhaltigkeitsbewertung<br />
82
2.3 Methodische Konzeption der Untersuchung<br />
Im Folgenden werden die einzelnen Schritte der hier vorgeschlagenen methodischen Konzeption<br />
im Überblick beschrieben.<br />
Schritt 1 und 2:<br />
Ziele bzw. diesen zugrunde liegende Werte für die Beurteilung der Nachhaltigkeit der Zukunftsszenarien<br />
werden anhand der Wertbaumanalyse erhoben. Dabei wird sowohl „topdown"<br />
als auch „bottom-up" vorgegangen. Aus den Ergebnissen der Einzelinterviews wird<br />
von den Autoren eine für alle gesellschaftlichen Akteure gemeinsame Zielhierarchie, der<br />
„Zielbaum", konzipiert. Ist der Zielbaum erstellt, erfolgt eine Rückkopplungsschleife mit den<br />
gesellschaftlichen Akteuren. Als Hintergrundinformation erhalten die Teilnehmer die ausführliche<br />
Beschreibung der Zukunftsszenarien.<br />
Schritt 3:<br />
Die Gewichtung erfolgt in einem Kontext kontroverser Auffassungen gesellschaftlicher Akteure<br />
darüber, was unter einer nachhaltigen netzgebundenen <strong>Versorgung</strong> zu verstehen ist. Mit<br />
„Sensibilitäten" der Akteure gegenüber der Offenlegung eigener Gewichtungen ist zu rechnen.<br />
Das hier vorgeschlagene Verfahren trägt diesem Umstand Rechnung. Die Gewichtung<br />
erfolgt zweifach, zum einen in Einzelinterviews und zum anderen in Schritt 5 im Rahmen des<br />
Workshops. Die Bestimmung der Gewichtungsfaktoren in Einzelinterviews erfolgt auf der<br />
Grundlage der gesamten Zielhierarchie und der Kenntnis der Alternativen (d. h. der Zukunftsszenarien).<br />
Die gemeinsame Gewichtung in Schritt 5 erfolgt vor dem Hintergrund der zusätzlichen<br />
Kenntnis der Attributausprägungen der Alternativen. Zur Bestimmung der Gewichtungsfaktoren<br />
in Einzelinterviews werden in einem zweistufigen Verfahren der Rang- und<br />
Punktgewichtung alle Ziele der Zielhierarchie relativ zueinander gewichtet. Die Berechnung<br />
der Gewichte basiert auf dem AHP. Die Ergebnisse sind – entgegen dem herkömmlichen<br />
Vorgehen multi-kriterieller Entscheidungsverfahren – nicht die Grundlage für die Ermittlung<br />
der individuellen Präferenzfunktionen, sondern werden als eigenständige Ergebnisse der<br />
Untersuchung betrachtet, die zudem die Basis für die Gestaltung des Schrittes 5 liefern.<br />
Schritt 4:<br />
Die Impact-Analyse in Bezug auf die in Schritt 1 und 2 ermittelten Attribute erfolgt auf der<br />
Basis von „expert judgments". Die Zukunftsszenarien besitzen zum einen nur mittleren Auflösungsgrad.<br />
Tiefenschärfe auf Indikatorenniveau ist allein für eine begrenzte Anzahl von Variablen<br />
vorhanden. Zum anderen sind die Zukunftsszenarien sektorübergreifend gebildet und<br />
damit von hoher Komplexität. Dies erfordert ein Verfahren, das die Unsicherheit in der Bewertung<br />
explizit erfasst. Methodisch wird für die Einschätzung der Attributausprägungen der<br />
Alternativen der AHP angewendet. Im Paarvergleich werden die Zukunftsszenarien anhand<br />
der AHP-Skala eingeschätzt. Die Konsistenzanalyse seitens des AHP unterstützt die Experten.<br />
Das herkömmliche Verfahren wird zudem mit einer Unsicherheitsanalyse gekoppelt.<br />
Diese beinhaltet Angaben a) zu den Begründungen für die Einschätzungen der Experten und<br />
b) zur jeweiligen Urteilssicherheit. Dies ermöglicht es nachzuvollziehen, welche Unsicherheiten<br />
vorhanden sind und worin Unterschiede in den Experteneinschätzungen begründet liegen.<br />
Schritt 5:<br />
Im Gegensatz zum im Abschnitt 2.2 beschriebenen Verfahren steht als letzter Baustein nicht<br />
die aus den vorhergegangenen Schritten rechnerisch abgeleitete Präferenz für ein Zukunftsszenario.<br />
Nicht die auf der Basis individueller Präferenzfunktionen im Konsens erarbei-<br />
83
Teil II Empirische Untersuchung: 3. Wertbaumanalyse<br />
tete eindeutige Entscheidung für ein Zukunftsszenario ist die Zielsetzung des vorliegenden<br />
Verfahrens, sondern vielmehr die sukzessive, über die verschiedenen Schritte des Prozesses<br />
immer konkreter werdende Bewertung von Chancen und Risiken expliziter Zukunftsoptionen.<br />
Um im gesamten Verfahren einen „black box"-Effekt und vor allem frühzeitige Positionskämpfe<br />
gesellschaftlicher Akteure zu vermeiden, werden die individuellen errechenbaren<br />
Präferenzfunktionen nicht in den Diskussionsprozess eingespeist. Vielmehr bilden alle in<br />
Schritt 1 bis 4 erarbeiteten Ergebnisse die Grundlage eines gemeinsamen Workshops. Damit<br />
gilt es, eine möglichst hohe Nachvollziehbarkeit in Bezug auf alle Verfahrensschritte zu erreichen.<br />
Auf der Basis der Experteneinschätzungen zu den Attributausprägungen der Szenarien<br />
werden zu allen Zielbereichen der Zielhierarchie das Für und Wider eines Zukunftspfades<br />
diskutiert. Auch Expertendissense sind Gegenstand der Diskussion. Vor diesem Hintergrund<br />
geht es vor allem um die Fragen: Wie schlagen sich als wichtig angesehene Ziele auf<br />
die Beurteilung der Zukunftsszenarien nieder? Welche Prioritäten werden gesetzt und wie<br />
werden sie begründet? Zu welchen Punkten sind sich die gesellschaftlichen Akteure weitgehend<br />
einig? Welcher der Zukunftspfade könnte eine Orientierung für die Zukunftsgestaltung<br />
bieten?<br />
3. Wertbaumanalyse<br />
Der erste und zweite Schritt des Verfahrens ist die Erstellung der Zielhierarchie. Die Erhebung<br />
der Zielvorstellungen, anhand derer die verschiedenen Zukunftsszenarien zu beurteilen<br />
sind, erfolgt anhand der Wertbaumanalyse. Im Folgenden sind der methodische Ansatz und<br />
die konkrete Umsetzung in der Untersuchung beschrieben. Auf der Basis der Erläuterung der<br />
Auswertung sind die Ergebnisse dargestellt.<br />
3.1 Durchführung<br />
3.1.1 Ansatz<br />
Die Wertbaumanalyse wurde als diskursive Methode zur Generierung und Strukturierung von<br />
Werten, Zielen bzw. Attributen von Keeney und Raiffa im Jahr 1976 in die Debatte eingeführt.<br />
Eine ausführliche Beschreibung findet sich z. B. bei von Winterfeldt & Edwards (1986).<br />
Werthierarchien werden nicht nach der subjektiven Wichtigkeit einzelner Werte, sondern<br />
nach dem Kriterium des Allgemeinheits- bzw. Abstraktionsgrades gebildet (Keeney, 1992b).<br />
Die nach der Strukturierung der Ziele erhaltene Hierarchie ist jedoch nicht dergestalt angelegt,<br />
dass ein Element der Zielhierarchie als Überkriterium für alle Elemente der darunter<br />
liegenden Zielebene fungieren muss, sondern jedes übergeordnete Ziel kann sich auf eine<br />
bestimmte Gruppe von Zielen unterer Ebenen beziehen (Saaty & Vargas, 2000). Die Elemente<br />
der verschiedenen Ebenen stehen jedoch in linearer Beziehung zueinander, d. h. Ziele<br />
der höheren Ebene können nicht von Zielen weiter unten liegender Ebenen dominiert werden<br />
(Saaty, 1990). Hinsichtlich der weiteren Nutzung der Zielhierarchien ist darauf hinzuweisen,<br />
dass diese nur in einem bestimmten Kontext, also bezüglich eines spezifischen Entscheidungs-<br />
bzw. Bewertungsproblems, gültig sind. Es können folglich keine Hierarchien in Bezug<br />
auf die generelle Bedeutung der aufgenommenen Werte gebildet werden (Brüggemann &<br />
Jungermann, 1996).<br />
84
3.1 Durchführung<br />
Ziel der Wertbaumanalyse ist es, bei Einbezug unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure<br />
einen Wertbaum zu erstellen. Die Wertbaumanalyse ist die „systematische Erfassung der<br />
Werte verschiedener Interessengruppen und die Zusammenstellung aller gesellschaftlich<br />
relevanten Wertmuster zu einem Grundmuster (Wertbaum)" (Opperman & Langer, 2000).<br />
Um zu einem solchen Wertbaum zu gelangen, sind in einem diskursiven Ansatz unterschiedliche<br />
Wege denkbar. Einer dieser Wege ist die Verhandlung. Jede Organisation konstruiert<br />
einen jeweils innerhalb der Organisation abgestimmten Teilbaum. Im Wege der Aus- und<br />
Verhandlung mit anderen gesellschaftlichen Akteuren kann dann ein Einigungsprozess stattfinden.<br />
Dazu braucht es Vertreter von Organisationen mit Mandat als Teilnehmer und ein<br />
Prozedere, wie z. B. Mediationsverfahren (Moore, 1986). Dies ist langwierig und birgt die<br />
Gefahr, dass der Wertbaum eine bloße Zusammenfassung gruppenspezifischer Teilbäume<br />
darstellt (Renn et al., 1985).<br />
Die Autoren entschieden sich für ein Verfahren, das den Akteuren die Mitwirkung erleichtert,<br />
indem sie von der Notwendigkeit „offizieller" Stellungnahmen der Organisation entlastet werden<br />
und die Synthese der jeweiligen Zielvorstellungen in den Händen der Forscher liegt. Die<br />
Hypothese dabei war, dass vor diesem Hintergrund es gelingen könnte, einen integrativen<br />
Wertbaum über unterschiedliche Interessenperspektiven hinweg zu erstellen, in dem sich die<br />
Akteure wiederfinden können, der jedoch nicht nur ein Nebeneinander von zielgruppenspezifischen<br />
Teilbäumen darstellt. Weiterhin war die Hypothese, dennoch durch den Prozess der<br />
gemeinsamen Entwicklung Bindungskraft für Verfahren und Ergebnisse erzeugen zu können.<br />
Im Einzelnen sah die Konzeption folgendes Vorgehen vor:<br />
Basis für den Wertbaum sind die jeweiligen Zielvorstellungen gesellschaftlicher Akteure. Sie<br />
bringen in Einzelinterviews ein, welche Ziele aus ihrer Sicht für die Bewertung der Zukunftsszenarien<br />
herangezogen werden sollen. Durch den Einbezug von Akteuren mit unterschiedlichen<br />
Interessenperspektiven werden verschiedene Dimensionen von Nachhaltigkeit abgedeckt.<br />
Festgelegt wird jedoch kein in der jeweiligen Organisation separat abgestimmter Teilbaum.<br />
Der Input der jeweiligen Akteure wird vielmehr von den Forschern weiterverarbeitet.<br />
Das Ergebnis – die Gesamtzielhierarchie – wird an die Akteure rückgekoppelt. Gefordert sind<br />
keine Deklaration eines Konsenses, sondern ein Einverständnis, dass das Ergebnis eine<br />
geeignete Grundlage darstellt und die Bereitschaft, mit diesem Zielkatalog weiterarbeiten zu<br />
wollen.<br />
3.1.2 Teilnehmer<br />
Das multi-kriterielle Bewertungsverfahren ist auf die Tiefenanalyse des Themas angelegt.<br />
Daher konzentriert sich das diskursive Konzept auf die Einbindung von Multiplikatoren, die<br />
über den gesamten Bewertungsprozess die Verfahrensschritte mit vollziehen (siehe Abschnitt<br />
2.3.1). Um eine möglichst breite Einbindung gesellschaftlicher Gruppen und Meinungsbilder<br />
bei der Entwicklung von Zielvorstellungen einer nachhaltigen <strong>Versorgung</strong> zu<br />
gewährleisten, ist eine stichprobenartige Integration einzelner Akteure der Wirtschaft oder<br />
Gesellschaft nicht zielführend. Erforderlich sind vielmehr auf der nächst höheren Aggregatsebene<br />
die Vertreter der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen, wie z. B. Verbände.<br />
Da die Einbindung der Stakeholder über mehrere Phasen des Projektes notwendig war, wurde<br />
zu deren besseren Orientierung eine detaillierte Information über Ablauf und Schritte der<br />
85
Teil II Empirische Untersuchung: 3. Wertbaumanalyse<br />
Nachhaltigkeitsbewertung erstellt. Daraus ging ihre Rolle und Aufgabe im gesamten Prozess<br />
hervor. Nachfolgend aufgeführte Institutionen waren in die Wertbaumanalyse einbezogen13:<br />
Nr.<br />
Institution<br />
1 Bundesverband der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft (BGW)<br />
2 Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)<br />
3 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)<br />
4 Bündnis 90 / Grüne<br />
5 CDU-Bundestagsfraktion<br />
6 Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB)<br />
7 Deutscher Städtetag<br />
8 Leitstelle Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigkeit<br />
9 SPD-Bundestagsfraktion<br />
10 Verbraucherzentrale, Bundesverband<br />
Tabelle 5: Liste der Praxispartner bei der Wertbaumanalyse<br />
3.1.3 Vorgehen<br />
Die Erhebung der Ziele und Werte bei den betroffenen gesellschaftlichen Gruppen wurde<br />
mittels eines strukturierten Interviews anhand eines Interviewleitfadens durchgeführt. Eine<br />
spezifische Fragetechnik gewährleistete die systematische Erfassung sowohl globaler als<br />
auch möglichst konkreter Ziele und diente der Vorbereitung der hierarchischen Strukturierung<br />
des Wertbaumes. Im Vorfeld des Telefoninterviews wurde den Teilnehmern der Befragung<br />
Gelegenheit gegeben, sich über Ziele und evtl. bereits Strukturierung der Ziele Gedanken zu<br />
machen. Eventuelle Abstimmungsprozesse in den Organisationen konnten dabei vorgenommen<br />
werden. Die Dauer des Interviews war für ca. 60 Minuten angesetzt.<br />
Die Interviews zeigten, dass in der Regel eine Nachbereitung des Telefongesprächs in einem<br />
neuen Interviewtermin unerlässlich war. Dieser Termin diente dazu, durch gezieltes Nachfragen<br />
zu einer weiteren Vertiefung zu gelangen. Der komplexe Gegenstandsbereich der vier<br />
Sektoren machte es häufig zudem erforderlich, sektorspezifische Abteilungen innerhalb der<br />
Organisation hinzuzuziehen.<br />
Nach jedem Interview wurden die Ergebnisse graphisch als akteursspezifische Teilbäume<br />
aufbereitet. Unterschiede zwischen den Akteuren zeigen sich vor allem im Grad der Vertiefung<br />
bestimmter Zielbereiche. Während beispielsweise wirtschaftlich orientierte Gruppen<br />
ökonomische Aspekte stark ausdifferenzieren, spielen diese bei den Umweltgruppen kaum<br />
eine Rolle, bzw. werden nur Einzelaspekte stärker konkretisiert.<br />
13 Angefragt wurde auch die Freie Demokratische Partei (FDP).<br />
86
3.2 Auswertung<br />
3.2 Auswertung<br />
Bei der Entwicklung eines Wertbaums stellt sich nicht nur die Aufgabe, verschiedene Sichtweisen<br />
gesellschaftlicher Akteure, sondern auch verschiedene Sektoren der <strong>Versorgung</strong><br />
adäquat zu berücksichtigen. Diejenigen Zielkataloge für Nachhaltigkeit, die normativ bzw.<br />
aus der Wissenschaft generiert werden, sind entweder sektorunabhängig, daher aber abstrakt<br />
(z. B. CSD, 2001; OECD, 2003) oder aber konkret, dafür aber nur sektorspezifisch (z. B.<br />
UBA (2001) für Wasser, Nitsch & Rösch (2001) für Energie). Die Herausforderung bestand<br />
darin, einen Zielkatalog zu generieren, der für alle vier Sektoren Gültigkeit besitzt und<br />
zugleich konkret genug ist, um eine Bewertung der vier Zukunftsszenarien zu ermöglichen.<br />
Bei der Synthese der Ziele über alle Befragten wurde auf den akteursspezifischen Schwerpunkten<br />
in der Ausdifferenzierung aufgebaut. Die Ergebnisse der Interviews wurden so verdichtet<br />
und strukturiert, dass ähnliche Ziele zwar zusammengefasst, die jeweiligen Akzentuierungen<br />
der gesellschaftlichen Akteure aber hinreichend zum Ausdruck kamen. Bei der<br />
Festlegung der Begrifflichkeiten dienten die in der Literatur vorhandenen Zielsysteme nachhaltiger<br />
Entwicklung als Hintergrundfolie.<br />
Der Komplexität des Gegenstandsbereichs „vier Sektoren" wurde dadurch Rechnung getragen,<br />
dass bei der Konstruktion des Wertbaumes darauf geachtet wurde, dass auf der mittleren<br />
Abstraktionsebene möglichst sektorübergreifende Ziele dargestellt sind. Auf der untersten<br />
Ebene hingegen waren auch sektorspezifische Aspekte ausdifferenziert.<br />
3.3 Ergebnisse<br />
Der im Ergebnis auf der Basis der Interviewdaten hierarchisch strukturierte Wertbaum sektorübergreifender<br />
Nachhaltigkeit umfasst fünf Oberziele: „Umweltschutz", „Soziale Aspekte",<br />
„Wirtschaftliche Aspekte", „Gesundheitsschutz" und „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit". Jeder dieser<br />
Teilbäume besteht aus drei Hierarchieebenen. Der Wertbaum stellt eine Gesamtschau verschiedener<br />
Perspektiven gesellschaftlicher Akteure dar, welche Kriterien zur Beurteilung der<br />
vier Zukunftsszenarien im Hinblick auf eine nachhaltige netzgebundene <strong>Versorgung</strong> mit<br />
Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation zu berücksichtigen sind.<br />
Zusammengefasst lässt sich der Wertbaum wie folgt darstellen (Abbildung 3; eine detailliertere<br />
Beschreibung der einzelnen Ziele findet sich im Anhang, Kapitel A.2):<br />
87
Teil II Empirische Untersuchung: 3. Wertbaumanalyse<br />
rn<br />
rn<br />
Globale Ziele<br />
<strong>Versorgung</strong>s<br />
sicherheit<br />
Soziales<br />
Konkrete Ziele<br />
Aspekte, die sich auf die <strong>Versorgung</strong>sprodukte<br />
beziehen<br />
Aspekte, die sich auf das <strong>Versorgung</strong>ssystem<br />
beziehen <<br />
Gerechtigkeitsaspekte<br />
Aspekte sozialer Leistungen<br />
rn<br />
.r.<br />
.c<br />
_c<br />
Wirtschaft<br />
Markt Aspekte<br />
Aspekte, die sich auf die wirtschaftl.<br />
Handelnden beziehen \<br />
Gesundheit Aspekte. die die zur Belastung <<br />
führenden Wege beschreiben<br />
Umweltschutz<br />
Aspekte, die sich auf die<br />
Eintragsmedien beziehen<br />
Aspekte die sich auf das zu<br />
schützende Aggregat beziehen<br />
Abbildung 3: Ziele einer zukünftigen nachhaltigen <strong>Versorgung</strong><br />
In Abbildung 4 ist der Zielkatalog für den Bereich „Umweltschutz" dargestellt.<br />
1. Ebene 2. Ebene 3. Ebene<br />
— Klimaschutz<br />
— Landschaftsschutz<br />
— Gewässerschutz<br />
Umweltschutz —<br />
— Bodenschutz<br />
— Artenschutz<br />
— Ressourcenschonung<br />
Reduktion der CO2-Emissionen<br />
Reduktion von Methan-Emissionen<br />
Reduktion von N 20 aus Kläranlagen<br />
Vermeidung von Eingriffen in das<br />
Landschaftsbild (z.B. Sendemasten)<br />
Schaffung und Erhaltung von<br />
Erholungsgebieten<br />
Erhalt von Trinkwasserreservoiren<br />
Vermeidung von Schadstoffeinträgen<br />
in Wasserquellen (Oberflächengewässer,<br />
Grundwasser)<br />
Vermeidung von Bodenbelastung<br />
durch Unfälle in EVUs<br />
Deponieraum für radioaktive und<br />
toxische Abfälle<br />
Vermeidung von langfristigen<br />
Schadstoffakkumulationen<br />
Vermeidung der Übernutzung<br />
landwirtschaftlicher Flächen<br />
Schutz der Flora<br />
Schutz der Fauna<br />
Schutz von Habitaten<br />
— Materialien<br />
— Fläche<br />
Rohstoffe<br />
— Wald<br />
— Wasser<br />
Abbildung 4: Teilbaum „Umweltschutz"<br />
88
3.3 Ergebnisse<br />
In Abbildung 5 ist der Zielkatalog für den Bereich „Gesundheitsschutz" dargestellt.<br />
1. Ebene 2. Ebene 3. Ebene<br />
— Schutz vor Luftimmissionen<br />
Mortalität<br />
Morbidität<br />
Beeinträchtigungen<br />
Gesundheitsschutz —<br />
Schutz vor radioaktiver<br />
Strahlung<br />
Schutz vor Elektro-<br />
_<br />
magnetischen Feldern<br />
Mortalität<br />
Morbidität<br />
Beeinträchtigungen<br />
Mortalität<br />
Morbidität<br />
Beeinträchtigungen<br />
Schutz vor Belastung des<br />
Rohwassers / Trinkwassers<br />
Mortalität<br />
Morbidität<br />
Beeinträchtigungen<br />
Abbildung 5: Teilbaum „Gesundheitsschutz"<br />
In Abbildung 6 ist der Zielkatalog für den Bereich „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit" dargestellt.<br />
1. Ebene 2. Ebene 3. Ebene<br />
— Räumliche Verfügbarkeit<br />
in Ballungsräumen<br />
in ländlichen Räumen<br />
in Randlagen von Ballungsräumen<br />
— Allzeitige Verfügbarkeit<br />
— Kostengünstige Verfügbarkeit<br />
— Sicherheit des Netzes<br />
— Veminderung von Störpotentialen —<br />
— Sicherheit der Anlagen<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit —<br />
Erhalt der Reversibilität innerhalb<br />
Anpassungsfähigkeit des<br />
des <strong>Versorgung</strong>ssystems<br />
<strong>Versorgung</strong>ssystems<br />
Fehlertoleranz<br />
— Qualität der <strong>Versorgung</strong><br />
Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus<br />
Angebot einer Vielzahl von<br />
<strong>Versorgung</strong>sdienstleistungen<br />
Mittel- bis langfristig<br />
gesicherte Verfügbarkeit<br />
Unabhängigkeit von knappen<br />
Ressourcen<br />
Diversifikation von <strong>Versorgung</strong>squellen<br />
Diversifikation der Bezugsquellen<br />
Technologische Diversität<br />
Abbildung 6: Teilbaum „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit"<br />
89
Teil II Empirische Untersuchung: 3. Wertbaumanalyse<br />
In Abbildung 7 ist der Zielkatalog für den Bereich „Wirtschaftliche Aspekte" dargestellt.<br />
1. Ebene 2. Ebene 3. Ebene<br />
Sicherung und Steigerung der<br />
Beschäftigung<br />
Wirtschaftliche<br />
Aspekte<br />
— Funktionsfähigkeit des Marktes<br />
— Vorbeugendes Wirtschaftshandeln<br />
— Kostendeckende Preise<br />
— Einkommensentwicklung<br />
— Effizienz der Leistungserstellung<br />
— Flexibilität<br />
Erhalt und Entwicklung<br />
des Wissenskapitals<br />
Pluralistische Marktstruktur (grikl<br />
öff./private)<br />
Internationale Wettbewerbsfähigkeit<br />
Investitionstätigkeit<br />
Innovationstätigkeit<br />
Investitionskosten<br />
Betriebskosten<br />
Internalisierte Kosten<br />
Abgaben<br />
Einkommenssteigerung<br />
Einkommenssicherung<br />
Innovationsfähigkeit<br />
Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse<br />
(Nachfrage, Angebot)<br />
Erhalt und Aufbau von Wissen zu<br />
bestehenden Technologien<br />
Erhalt und Entwicklung institutioneller<br />
Innovationen (Kooperation<br />
Unternehmen, Forschung)<br />
Aufbau und Entwicklung von Wissen<br />
zu neuen Technologien<br />
Abbildung 7: Teilbaum „Wirtschaft"<br />
90
3.3 Ergebnisse<br />
In Abbildung 8 ist der Zielkatalog für den Bereich „Soziale Aspekte" dargestellt.<br />
1. Ebene 2. Ebene 3. Ebene<br />
Soziale Aspekte –<br />
Soziale<br />
Gerechtigkeit<br />
Regionale<br />
Gerechtigkeit<br />
– Partizipation<br />
– Transparenz<br />
– Soziale Sicherheit<br />
Erhaltung der so-<br />
_<br />
zialen Ressourcen<br />
Sozialverträgliche Preise für Haushalte<br />
Gleichberechtigter Zugang zu Ressourcen<br />
von Haushalten, öffentlich. Einrichtungen<br />
und Unternehmen<br />
Gewährleistung einer Grundversorgung für<br />
alle<br />
Faire Rechts- und Vertragsgestaltung zur<br />
<strong>Versorgung</strong> für alle<br />
Vertretbares Wohlstandsgefälle<br />
Geschlechtergerechtigkeit<br />
Internationale Verteilungsgerechtigkeit der<br />
Ressourcennutzung (Industrie und<br />
Entwicklungsländer)<br />
Gleichheit der Lebensverhältnisse<br />
Gesellschaftliche Zielformulierung<br />
Planungsverfahren<br />
Verständlichkeit der Verbraucherinformation<br />
und Verträge zur <strong>Versorgung</strong><br />
Angabe der Höhe der Preise<br />
Angabe der Preisbestandteile (z.B.<br />
Netzkosten, Steueranteile)<br />
Angabe der Leistungsbestandteile (Herkunft<br />
und Art der Leistung)<br />
Angabe der Marktstrukturen<br />
— Vermeidung von Armut<br />
— Erhalt sozialer Sicherungssysteme<br />
Sicherung angemessener Mindestlöhne<br />
— Sicherung humaner Arbeitsbedingungen<br />
Sozialverträgliche Gestaltung des<br />
Beschäftigungswandels<br />
Übernahme von Verantwortung der Gesell-<br />
— schaft für nachfolgende Generationen<br />
Übernahme von Verantwortung der <strong>Versorgung</strong>sunternehmen<br />
für die Daseinsvorsorge<br />
Übernahme von Verantwortung von<br />
- Unternehmen in Entwicklungsländern<br />
Abbildung 8: Teilbaum „Soziales"<br />
Der Wertbaum wurde allen Befragten zugesandt. Als Hintergrundinformation erhielten die<br />
Teilnehmer zudem die Ausarbeitung der Szenarien.<br />
Alle Teilnehmer bewerteten die Zielhierarchie als geeignete Arbeitsgrundlage für die weiteren<br />
Schritte der Nachhaltigkeitsbewertung. Insbesondere wurde der hohe Differenzierungsgrad<br />
des Zielkataloges als positiv hervorgehoben. Ebenso fand positive Beachtung, dass die<br />
„Mehrdimensionalität" der Nachhaltigkeit sich nicht in einer starren Ausformulierung getrennter<br />
„Säulen" darstellt, sondern sich unter dem Thema „Wirtschaft" auch umweltorientierte Akzentuierungen,<br />
wie z. B. das Ziel „vorbeugendes Wirtschaftshandeln", oder unter dem Thema<br />
„<strong>Versorgung</strong>ssicherheit" sich Ziele wie z. B. „Anpassungsfähigkeit des <strong>Versorgung</strong>ssystems"<br />
fanden. Dies führte dazu, dass nicht automatisch eine Identifikation einer Gruppe nur mit<br />
einem bestimmten Teilbaum gegeben war, sondern sich alle Teilnehmer durchaus mit allen<br />
Aspekten des Wertbaumes auseinander zu setzen hatten. Genau das zu erreichen, war das<br />
Ziel des angewendeten Verfahrens der Wertbaumanalyse.<br />
91
Teil II Empirische Untersuchung: 4. Gewichtung der Ziele<br />
4. Gewichtung der Ziele<br />
Die Gewichte der Ziele sind eine wesentliche Komponente des multi-attributen Gesamtmodells.<br />
Im vorliegenden Verfahren hat die Ermittlung der Gewichte einen eigenen Erkenntniswert.<br />
Sie soll aufzeigen, welche Ziele gesellschaftliche Akteure bei der Entscheidung für die<br />
eine oder andere Zukunftsoption besonders erfüllt wissen wollen. Im Folgenden wird die<br />
Bedeutung der Erhebung von Gewichten im vorliegenden Kontext der Untersuchung thematisiert,<br />
das Vorgehen, die Auswertung und die Ergebnisse dokumentiert.<br />
4.1 Durchführung<br />
4.1.1 Ansatz<br />
Der Begriff der Nachhaltigkeit ist durch ein Dilemma gekennzeichnet: auf der einen Seite<br />
besitzt er hohe Integrationskraft für Vertreter unterschiedlicher Interessen. Diese Kraft entfaltet<br />
er jedoch umso weniger, je stärker er konkretisiert wird. Auf der anderen Seite braucht es<br />
aber eine konkrete Operationalisierung und Auseinandersetzung mit Zielkonflikten, um daraus<br />
belastbare Handlungen ableiten zu können.<br />
Seit dem Rio-Gipfel 1992 wird die Gleichgewichtigkeit der ökonomischen, ökologischen und<br />
sozialen Säulen postuliert. Jedes auf dem Grundsatz der Gleichgewichtigkeit der „Säulen"<br />
entwickelte Nachhaltigkeitssystem konstatiert allerdings darüber hinaus die Notwendigkeit<br />
einer Abwägung der verschiedenen Zielkriterien, verlagert diese jedoch auf den konkreten<br />
Fall. Erst im konkreten Fall gilt es – so wird gefordert – zu entscheiden, wie am besten die<br />
verschiedenen Zielkriterien integriert bzw. welche Prioritäten gesetzt werden sollen.<br />
Dies alleine ist jedoch nicht zielführend. Weichenstellungen müssen im Vorfeld konkreter<br />
Fälle erfolgen. Ziel muss es sein, bereits zu einem frühen Zeitpunkt, Chancen und Risiken für<br />
eine nachhaltige Entwicklung so konkret wie möglich abschätzbar zu machen, um Ressourcen<br />
zielgerecht zu allokieren. Darüber hinaus besteht zum späten Zeitpunkt der konkreten<br />
Fallentscheidung bereits meist eine konkrete Konfliktlage zwischen unterschiedlichen Interessen.<br />
Im Vorfeld manifester Entscheidungsoptionen müssen Korridore unter Unsicherheit<br />
beschritten werden. Die Unsicherheit betrifft nicht nur die potentiellen ökologischen, ökonomischen<br />
und sozialen Folgen, sondern auch die Frage, wie sich gesellschaftliche Akteure<br />
dazu positionieren werden.<br />
Zur Erreichung einer hohen Handlungsrelevanz bedarf es eines möglichst konkreten Katalogs<br />
von Zielvorstellungen. Kein Zukunftspfad der <strong>Versorgung</strong> kann alle Zielvorstellungen in<br />
gleichem Masse erfüllen. Daher setzt jede Weichenstellung eine Abwägung zwischen verschiedenen<br />
Zielkriterien voraus. Dieser Abwägungsprozess wird bestimmt durch die jeweilige<br />
Gewichtung der Ziele. Die Gewichtung von Zielen vor dem Hintergrund potentieller Zukunftsoptionen<br />
liefert eine Werterichtschnur. Sie ist ein Anhaltspunkt, mit welchen Konfliktlinien im<br />
Verlaufe von Entwicklungen zu rechnen ist. Die Gewichtung der Ziele ist ein Mittelweg, der<br />
zwar Zielkorridore vorzeichnet und damit handlungsrelevant wird, jedoch für die Beteiligten<br />
Spielräume offen lässt und damit seine integrative Kraft nicht einbüßt.<br />
Um dies zu leisten, muss der Ansatz der multi-kriteriellen Bewertung (Saaty, 1990; Keeney &<br />
Raiffa, 1976) modifiziert werden. Herkömmlich wurde der Ansatz für die Frage „Was ist die<br />
beste Entscheidung" verwendet. Im vorliegenden Fall geht es um die Frage „Welche Korrido-<br />
92
4.1 Durchführung<br />
re sind zukunftsträchtig und welche nicht?". Herkömmlich handelt es sich um eine ergebnisoffene<br />
Situation, in der alle Entscheider an der Identifikation und der Offenlegung ihrer „wahren"<br />
Gewichtungen interessiert sind, um auf dieser Grundlage eine Entscheidung für eine<br />
konkrete Option zu treffen. Im Projektkontext geht es darum, in einer Situation, in der die<br />
Offenlegung der Gewichtungen ein „sensibles" Thema für gesellschaftliche Akteure bedeutet,<br />
Konsenspotentiale auszuloten bzw. zu entwickeln und die Entscheidungsrationale transparent<br />
zu machen.<br />
4.1.2 Teilnehmer<br />
Die im Verfahren entwickelte Zielhierarchie eröffnet die Möglichkeit, ein differenziertes Bild<br />
der Einschätzungen verschiedener gesellschaftlicher Akteure zu gewinnen. Daher wurde der<br />
Teilnehmerkreis erweitert. Damit wird erreicht, die gesellschaftlichen Betroffenheiten nicht nur<br />
in der Breite, sondern auch in der Tiefe abdecken zu können. Insgesamt wurden 22 gesellschaftliche<br />
Akteure befragt.<br />
Die im Bundesverband der Industrie (BDI) vereinigten Perspektiven von Anbietern als auch<br />
Nachfragern von <strong>Versorgung</strong>sleistungen wurden aufgelöst durch Hinzunahme von Einzelperspektiven.<br />
Auf der Anbieterseite wurde gemäß der Wertschöpfungsstufen für die erste Stufe<br />
— der Erzeugung — der Verband der Großkraftwerksbetreiber (VGB) hinzugenommen sowie<br />
auf der Verteilungsstufe der Verband der Verbundunternehmen und regionalen Energieversorger<br />
(VRE). Dieser repräsentiert zudem auch gleichzeitig in der Gruppe der Erzeuger die<br />
kleinen Unternehmen. Um die privatwirtschaftliche Perspektive der Energieversorgung um<br />
öffentliche Sichtweisen zu ergänzen, wurde der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU)<br />
in die Bewertung miteinbezogen. Zusätzlich wurde der Verband der Maschinen- und Anlagenhersteller<br />
(VDMA) mit einbezogen, um die Perspektive der Lieferanten für Vorleistungen,<br />
wie z. B. von Energieerzeugungsanlagen, abzudecken.<br />
Zur Vervollständigung des Bereichs der Produktion von <strong>Versorgung</strong>sleistungen wurde neben<br />
den Sektoren Strom/Gas und Wasser die Perspektive des Telekommunikationssektors durch<br />
den Verband BITKOM hinzugefügt.<br />
Die Nachfrageseite von <strong>Versorgung</strong>sleistungen wurde im Bereich der industriellen Nachfrage<br />
anhand der energieintensivsten Branchen, die von Veränderungen in der Stromwirtschaft<br />
stark betroffen wären, weiter differenziert. Für die Gewichtung gewonnen wurden der Verband<br />
der Chemischen Industrie (VCI) und der Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung<br />
(WSM).<br />
Um das Gleichgewicht gesellschaftlicher Perspektiven zu erhalten, wurde neben der Ausdifferenzierung<br />
der Wirtschaftsperspektive auch die Umweltperspektive erweitert. Zur Stärkung<br />
der internationalen Umwelt- und Entwicklungsperspektive wurde in das Verfahren der Gewichtung<br />
das Forum Umwelt und Entwicklung einbezogen. Zur Verstärkung von Umweltaspekten<br />
im Sektor Wasser wurde die Grüne Liga gewonnen. Der Naturschutzbund Deutschland<br />
(NABU) wurde als Pate für die Perspektive allgemeiner Umwelt- und insbesondere<br />
Naturschutzgesichtspunkte herangezogen. Ebenso nahm an der Gewichtung der Deutsche<br />
Bauernverband in seiner Funktion als Produzent von Vorprodukten, wie z. B. Raps zum Be-<br />
93
Teil II Empirische Untersuchung: 4. Gewichtung der Ziele<br />
trieb von Biomassekraftwärmekopplungsanlagen, teil, als auch als Betroffener durch beispielsweise<br />
Windkraftanlagen in der Weidewirtschaft.14<br />
In Tabelle 6 sind die Teilnehmer der Gewichtung aufgeführt.<br />
Nr.<br />
Institution<br />
1-10 Siehe Tabelle 5 (Seite 86)<br />
11 Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom)<br />
12 Deutscher Bauernverband e.V. (DBV)<br />
13 EnBW Energie Baden-Württemberg AG<br />
14 Forum Umwelt und Entwicklung<br />
15 Grüne Liga e.V.<br />
16 Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU)<br />
17 Verband der Chemischen Industrie (VCI)<br />
18 Verband der Investitionsgüterindustrie (VDMA)<br />
19 Verband der Großanlagenbetreiber VGB PowerTech e.V.<br />
20 Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU)<br />
21 Verband der Verbundunternehmen und regionalen Energieversorger in Deutschland (VRE)<br />
22 Wirtschaftsverband Stahl und Metallverarbeitung e.V. (WSM-Industrie)<br />
Tabelle 6: Liste der Praxispartner bei der Gewichtung des Wertbaumes<br />
4.1.3 Vorgehen<br />
Die Ziele des Wertbaumes repräsentieren die Menge an bewertungsrelevanten, zwischen<br />
den Zukunftsoptionen (Szenarien A-D) differenzierenden Kriterien. Die hierarchische Struktur<br />
des Wertebaumes erlaubt es, eine große Anzahl von Kriterien zu berücksichtigen, indem nur<br />
die jeweils in einem Zweig und auf einer Hierarchieebene vorhandenen Kriterien (Geschwister-Kriterien)<br />
gegeneinander gewichtet werden. Die Wichtigkeit eines Ziels bzw. Kriteriums ist<br />
im vorliegenden Fall immer relativ zum spezifischen Bewertungsproblem (Szenarien A-D)<br />
und relativ zu den anderen Kriterien.<br />
14 Angefragt wurden für die Perspektive der Energieerzeugung der Verband der Deutschen Elektrizitätswirtschaft<br />
(VDEW) und Verband der Deutschen Netzbetreiber (VDN). Nachfragerseitig wurde im<br />
Bereich der Industrie die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der Zentralverband<br />
des Deutschen Handwerks (ZDH) kontaktiert, bei den privaten Nachfragern der Bundesverband der<br />
Deutschen Wohnungsunternehmen, die Bundesarchitektenkammer sowie der Paritätische Wohlfahrtsverband.<br />
94
4.2 Auswertung<br />
Folgendes Gewichtungsverfahren wurde eingesetzt:<br />
• Vorlage eines „Gewichtungsbogens" auf der Basis der Zielhierarchie<br />
• Definitionen der Ziele als „Prompting" für die Befragung<br />
• Individuelle Erhebung der Gewichtungen anhand eines zweistufigen Gewichtungsverfahrens<br />
• Gemeinsame Diskussion von Gewichtungen im Workshop (siehe Kapitel 5)<br />
Anhand eines Gewichtungsbogens wurde die Gewichtung in zwei Schritten vollzogen. Im<br />
ersten Schritt waren die Befragten dazu aufgefordert, die Menge an k Kriterien jedes Astes<br />
nach ihrer Wichtigkeit für die vergleichende Beurteilung der Zukunftsszenarien im Hinblick<br />
auf Nachhaltigkeit in eine Rangreihe zu bringen. Indifferenz konnte durch Vergabe gleicher<br />
Rangplätze zum Ausdruck gebracht werden. Im zweiten Schritt wurde im persönlichen bzw.<br />
Telefoninterview eine Punktegewichtung durchgeführt. Dazu erhielt Rangplatz 1 jeweils als<br />
Ankerwert 100 Punkte. Punkte waren dann so auf die Kriterien zu verteilen, dass sie die relative<br />
Wichtigkeit der Kriterien zueinander widerspiegeln. Bei Indifferenz war die gleiche Punktzahl<br />
zu vergeben. Die Ziele, die aus der Sicht des Befragten bei der Bewertung der Zukunftsoptionen<br />
keine Berücksichtigung finden sollten, erhielten das Gewicht mit dem Wert Null.<br />
Verschiedene Studien zur Validität der Wichtigkeitsurteile zeigten systematische Urteilstendenzen,<br />
je nachdem, welche Methode der Vorgabe der Kriterien und der Erhebung der Urteile<br />
verwandt wird. Die Untersuchung von Borcherding und von Winterfeldt (1988) zeigte, dass<br />
die Bewerter Ziele umso wichtiger einschätzten, je weiter oben sie in der Hierarchie platziert<br />
waren und wenn sie in Unterziele aufgespalten waren (hierarchy bias).<br />
Der hier vorgeschlagene Ansatz sah vor, bei der Bildung der Rangfolge mit der Ebene der<br />
Oberziele (1. Ebene) zu beginnen, die Punktgewichtung hingegen in der umgekehrten Reihenfolge<br />
von den konkreten Unterzielen (3. Ebene) zu den abstrakten Oberzielen (1. Ebene)<br />
zu erheben, um zu belastbaren Aussagen zu gelangen. Die Zieldefinitionen, die sich auf die<br />
Interviews im Rahmen der Wertbaumanalyse gründeten (siehe Anhang, Kapitel A.2), wurden<br />
bei Unklarheiten eingespeist. In diesem Verfahren kam es darauf an, die Facetten der Ziele,<br />
die die Befragten vor Augen hatten, bei der Gewichtung zugrunde zu legen. Die Definition<br />
diente dem „Prompting" der Befragten und dort, wo es nötig war, dem Vorbeugen bzw. Ausräumen<br />
von Missverständnissen. Da keine Definition alle Facetten erfassen kann, sollte der<br />
Interpretationsspielraum nicht zu eng gefasst werden. Der erste Schritt der Rangbildung<br />
diente dazu, die Befragten mit den Zielen und dem Verfahren der Präferenzbildung vertraut<br />
zu machen. Der zweite Schritt der Punktegewichtung diente der Vertiefung. Im zweiten<br />
„Durchgang" nahmen alle Befragten mehr oder weniger umfangreiche Korrekturen vor und<br />
begründeten diese. Die Dauer der Erhebung der Gewichtung betrug jeweils ca. 2 Stunden.<br />
Auch hier wurde den gesellschaftlichen Akteuren die Gelegenheit gegeben, sich in der Organisation<br />
rückzukoppeln und etwaige Änderungen vorzunehmen.<br />
4.2 Auswertung<br />
Anhand der Ergebnisse der Befragung wurden die relativen und absoluten Gewichte der<br />
Ziele berechnet. Die relativen Gewichte geben Auskunft über die Wichtigkeit von Kriterien<br />
innerhalb eines Zweiges auf einer Hierarchieebene. Die absoluten Gewichte ermöglichen<br />
Aussagen über die Wichtigkeit der Kriterien über alle Zweige auf einer Hierarchieebene.<br />
95
Teil II Empirische Untersuchung: 4. Gewichtung der Ziele<br />
G rell<br />
W.<br />
kI<br />
I wj<br />
j=1<br />
Die so berechneten relativen Gewichte sind Werte im Intervall [0;1], ihre Summe über alle<br />
Geschwister-Kriterien beträgt 1.<br />
Die absoluten Gewichte erhält man, indem die relativen Gewichte mit den Gewichten der<br />
jeweils auf einer höheren Ebene ihres Zweiges liegenden Kriterien multipliziert werden. Das<br />
absolute Gewicht eines Kriteriums berechnet sich also als Produkt der relativen Gewichte, so<br />
z. B. das absolute Gewicht des Kriteriums „Reduktion der CO 2-Emissionen" als<br />
Gabs, Reduktion der CO2-Emissionen<br />
= Grel, Umweltschutz X Grel, Klimaschutz X Grel, Reduktion der CO2-Emissionen<br />
Bei dieser Vorgehensweise ist die Summe aller absoluten Gewichte einer Ebene = 1.<br />
4.3 Ergebnisse<br />
4.3.1 Relative Gewichte der Zielkriterien<br />
Tabelle 7 listet die Ergebnisse der Gewichtung für die fünf Oberziele nachhaltiger <strong>Versorgung</strong><br />
auf.<br />
Sektorübergreifende Nachhaltigkeit<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
In der Gewichtungs-Befragung hat der Bewerter für jedes der zu vergleichenden k Geschwister-Kriterien<br />
einen Wert W, zwischen 0 und 100 Punkten vergeben. Aus diesen Punkte-<br />
Werten werden gemäß dem AHP die relativen Gewichte G reu berechnet, indem auf die<br />
Summe der Punkte-Werte normiert wird:<br />
Standardabweichung<br />
Gesundheitsschutz 0,21 0,03<br />
Umweltschutz 0,21 0,04<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit 0,20 0,03<br />
Wirtschaftliche Aspekte 0,20 0,04<br />
Soziale Aspekte 0,19 0,04<br />
Tabelle 7: Kennwerte der relativen Gewichte der fünf Oberziele sektorübergreifender Nachhaltigkeit<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass im Mittel über alle Befragten sowohl der Gesundheits- als auch<br />
der Umweltschutz vorrangig für eine nachhaltige Zukunft der <strong>Versorgung</strong> erfüllt sein müssen.<br />
An letzter Stelle sind es die sozialen Aspekte, die bei der Entscheidung um eine nachhaltige<br />
<strong>Versorgung</strong> aus der Sicht der Befragten zu berücksichtigen sind. Die Unterschiede zwischen<br />
den fünf Zielen nachhaltiger <strong>Versorgung</strong> sind jedoch im Mittel gering.<br />
96
4.3 Ergebnisse<br />
Die Analyse der Streuung der Gewichtungen gibt Aufschluss darüber, wie einig sich die<br />
Befragten in ihren Urteilen sind (siehe Tabelle 7; Abbildung 9)15.<br />
A. Soziale Aspekte<br />
B. <strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
C. Gesundheitsschutz<br />
D. Wirtschaftliche Aspekte<br />
E. Umweltschutz<br />
A B c D E<br />
Abbildung 9: Verteilung der Werte für die fünf Oberziele nachhaltiger <strong>Versorgung</strong> (Boxplot)<br />
Dem Gesundheitsschutz hohe Priorität einzuräumen, darüber sind sich die Akteure weitgehend<br />
einig. Bezüglich des Umweltschutzes und wirtschaftlicher Aspekte streuen die Werte<br />
stärker. Sowohl jenseits des 75. Perzentils (hohes relatives Gewicht) als auch des 25. Perzentils<br />
(geringes relatives Gewicht) sind in beiden Fällen Ausreißer zu verzeichnen. Der<br />
Interquartilbereich ist bei den im Mittel am niedrigsten bewerteten sozialen Aspekte groß.<br />
In Tabelle 8 sind die relativen Gewichte für die Unterkriterien des Umweltschutzes auf der 2.<br />
Hierarchieebene aufgeführt.<br />
Umweltschutz<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Klimaschutz 0,20 0,04<br />
Landschaftsschutz 0,11 0,05<br />
Gewässerschutz 0,19 0,03<br />
Bodenschutz 0,16 0,03<br />
Artenschutz 0,14 0,04<br />
Ressourcenschonung 0,20 0,04<br />
Tabelle 8: Kennwerte der relativen Gewichte der Unterkriterien „Umweltschutz"<br />
Die Ergebnisse zeigen, dass im Mittel über alle Befragten dann, wenn es um den Umweltschutz<br />
zukünftiger <strong>Versorgung</strong> geht, der Klimaschutz und die Ressourcenschonung am<br />
wichtigsten sind. Im Vergleich zu den anderen Kriterien ist für die ökologische Beurteilung<br />
der Zukunftspfade der Landschaftsschutz nachrangig, d. h. die Vermeidung von Eingriffen<br />
durch Windräder oder Sendemasten in das Landschaftsbild und der Erhalt von Erholungsge-<br />
15 Der Boxplot gibt den Median (Balken innerhalb des Kastens) sowie das 75. und 25. Perzentil an.<br />
50% der Fälle haben Werte innerhalb des Kastens. Die „Schnurrhaare" geben den kleinsten und<br />
größten Wert an, der kein Ausreißer ist. Der Kreis repräsentiert Ausreißer, der Stern Extremwerte.<br />
97
Teil II Empirische Untersuchung: 4. Gewichtung der Ziele<br />
bieten. Seitens der Akteure werden hier jedoch unterschiedliche Akzentuierungen gesetzt.<br />
Dies zeigt die Abbildung 10.<br />
0.4<br />
A. Klimaschutz<br />
07<br />
B. Landschaftsschutz<br />
0.3-<br />
010<br />
06<br />
C. Gewässerschutz<br />
D. Bodenschutz<br />
0.2<br />
E. Artenschutz<br />
F. Ressourcenschonung<br />
0.1 -<br />
021<br />
07<br />
0.0<br />
A<br />
Abbildung 10: Verteilung der Werte für die Kriterien des Umweltschutzes (Boxplot)<br />
Der Interquartilbereich für den Landschaftsschutz ist groß. Einer der Befragten vergab für<br />
den Landschaftsschutz ein Null-Gewicht.<br />
Die Ressourcenschonung ist im Vergleich zu anderen Ökologie-Kriterien besonders wichtig.<br />
Dazu gehören vor allem der sparsame Einsatz von Wasser in Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
oder zur Wasserbereitstellung und die Vermeidung von Wasserverlusten<br />
durch Rohrbrüche oder Leckagen sowie die Schonung von Rohstoffen, d. h. der sparsame<br />
Einsatz von Brennstoffen zur Produktion von <strong>Versorgung</strong>sleistungen bei Herstellung und<br />
Betrieb (siehe Tabelle 9).<br />
Umweltschutz / Ressourcenschonung<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Schonung Materialien 0,15 0,05<br />
Schonung Fläche 0,18 0,05<br />
Schonung Rohstoffe 0,24 0,09<br />
Schonung Wald 0,17 0,05<br />
Schonung Wasser 0,25 0,06<br />
Tabelle 9: Kennwerte der relativen Gewichte der Unterkriterien „Ressourcenschonung"<br />
Die Schonung von Materialien, d. h. der sparsame Einsatz von Stoffen, die während des<br />
Baus, Betriebs oder bei der Demontage von <strong>Versorgung</strong>sanlagen eingesetzt werden, wie<br />
z. B. Sand oder Mineralien, weist hingegen im Mittel das geringste relative Gewicht auf. Beim<br />
Thema „Rohstoffe" setzen einige Akteure deutliche Akzente in der Gewichtung (siehe<br />
Abbildung 11).<br />
98
4.3 Ergebnisse<br />
0.7<br />
A. Materialien<br />
0 .6- *7 B. Fläche<br />
0 .5-<br />
0 .4-<br />
0 .3- 812<br />
C. Rohstoffe<br />
01 D. Wald<br />
E. Wasser<br />
0 .2-<br />
0 .1 -<br />
0.0<br />
0 7<br />
841<br />
A B c D E<br />
Abbildung 11: Verteilung der Werte für die ökologischen Kriterien „Ressourcenschonung" (Boxplot)<br />
Neben dem Umweltschutz wurde im Mittel der Gesundheitsschutz als besonders wichtig für<br />
die Beurteilung von Zukunftsoptionen eingeschätzt. Tabelle 10 zeigt, welche der verschiedenen<br />
Gesundheitsrisiken dabei besonderes Gewicht erhalten sollen.<br />
Gesundheitsschutz<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Luftimmissionen 0,27 0,06<br />
Radioaktive Strahlung 0,27 0,07<br />
Elektromagnetische Felder 0,15 0,06<br />
Belastung Roh-/Trinkwasser 0,31 0,12<br />
Tabelle 10: Kennwerte der relativen Gewichte der Unterkriterien „Gesundheitsschutz"<br />
An erster Stelle steht im Mittel der Schutz vor einer Belastung des Roh- bzw. Trinkwassers,<br />
gefolgt vom Schutz vor radioaktiver Strahlung und Luftimmissionen. Das Thema der Elektromagnetischen<br />
Felder (EMF) wird als weniger bedeutsam für Zukunftsentscheidungen in der<br />
netzgebundenen <strong>Versorgung</strong> gesehen. Wie Abbildung 12 zeigt, gibt es bei den meisten<br />
Gesundheitsrisiken eine hohe Übereinstimmung zwischen den befragten Akteuren: Lediglich<br />
die Bedeutung, die dem Schutz vor EMF im Vergleich zu den anderen Gesundheitsrisiken<br />
bei der Beurteilung nachhaltiger Zukunftsoptionen eingeräumt werden soll, wird leicht unterschiedlich<br />
eingestuft.<br />
99
Teil II Empirische Untersuchung: 4. Gewichtung der Ziele<br />
1.0<br />
0 .8-<br />
0 .6-<br />
0 .4- 06<br />
A. Schutz vor Luftimmissionen<br />
B. Schutz vor radioaktiver Strahlung<br />
*10<br />
C. Schutz vor elektromagnetischen<br />
Feldern<br />
D. Schutz vor Belastung des Rohwassers<br />
/ Trinkwassers<br />
07<br />
0 .2-<br />
0.0<br />
06<br />
* 10<br />
*10<br />
A B c<br />
Abbildung 12: Verteilung der Werte für die Kriterien des Gesundheitsschutzes (Boxplot)<br />
Hinsichtlich der <strong>Versorgung</strong>ssicherheit entscheidet sich die Nachhaltigkeit <strong>netzgebundener</strong><br />
<strong>Versorgung</strong> nicht so sehr an der Anpassungsfähigkeit des <strong>Versorgung</strong>ssystems. Ob die<br />
Modifizierbarkeit der Technologiepfade dahingehend erhalten bleibt, dass irreparable Schäden<br />
vermeidbar sind oder aber eine hohe Fehlertoleranz des <strong>Versorgung</strong>ssystems gewährleistet<br />
ist, so dass auch mit einer begrenzten Zahl fehlerhafter Subsysteme durch redundante<br />
Komponenten die Funktion der <strong>Versorgung</strong> erfüllbar bleibt, sind im Mittel der Befragten nicht<br />
die Hauptaspekte. Auch die kostengünstige Verfügbarkeit von Rohstoffen (Brennstoffen) bzw.<br />
Leistungen steht im Mittel nicht an erster Stelle. Wohl zeigt die Abbildung 13 deutliche Pointierungen<br />
seitens einzelner Akteure, die die Bedeutung der kostengünstigen Verfügbarkeit<br />
relativ zu den anderen Kriterien deutlich höher oder aber deutlich niedriger als der Durchschnitt<br />
einschätzen.<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Räumliche Verfügbarkeit 0,14 0,06<br />
Allzeitige Verfügbarkeit 0,15 0,04<br />
Kostengünstige Verfügbarkeit 0,13 0,05<br />
Verminderung von Störpotentialen 0,13 0,03<br />
Anpassungsfähigkeit. d. <strong>Versorgung</strong>ssystems 0,12 0,04<br />
Qualität der <strong>Versorgung</strong> 0,16 0,04<br />
Mittel- bis langfristig gesicherte Verfügbarkeit 0,17 0,03<br />
Tabelle 11: Kennwerte der relativen Gewichte der Unterkriterien ,<strong>Versorgung</strong>ssicherheit"<br />
Die Nachhaltigkeit unter dem Blickwinkel der <strong>Versorgung</strong>ssicherheit entscheidet sich vor<br />
allem daran, inwieweit die Verfügbarkeit der Ressourcen und Leistungen mittel- bis langfristig<br />
gesichert sind (siehe Tabelle 11). Hierin sind sich die befragten Akteure auch weitgehend<br />
einig (siehe Abbildung 13).<br />
100
4.3 Ergebnisse<br />
0.4<br />
A.<br />
B.<br />
Räumliche Verfügbarkeit<br />
Allzeitige Verfügbarkeit<br />
0.3-<br />
04<br />
076<br />
04<br />
C.<br />
Kostengünstige Verfügbarkeit<br />
D. Verminderung von Störpotentialen<br />
0.2-<br />
014<br />
T E.<br />
Anpassungsfähigkeit des <strong>Versorgung</strong>ssystems<br />
F. Qualität der <strong>Versorgung</strong><br />
0.1 -<br />
G. Mittel- bis langfristig gesicherte<br />
0.0<br />
06<br />
014<br />
A<br />
04<br />
B<br />
1016<br />
c<br />
F 0<br />
Verfügbarkeit<br />
Abbildung 13: Verteilung der Werte für die Kriterien der <strong>Versorgung</strong>ssicherheit (Boxplot)<br />
Deutlich unterschiedlicher Auffassung ist man allerdings in der Frage, ob zur Sicherung der<br />
Verfügbarkeit die Unabhängigkeit von knappen Ressourcen maßgeblich ist. Zwar wird dieses<br />
Kriterium relativ zu den anderen im Mittel am höchsten eingeschätzt, jedoch streuen die<br />
Werte stark (siehe Tabelle 12; Abbildung 14).<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit /<br />
Mittel- bis langfristig gesicherte Verfügbarkeit<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Unabhängigkeit von knappen Ressourcen 0,29 0,09<br />
Diversifikation von <strong>Versorgung</strong>squellen 0,25 0,04<br />
Diversifikation der Bezugsquellen 0,23 0,06<br />
Technologische Diversität 0,23 0,08<br />
Tabelle 12: Kennwerte der relativen Gewichte der <strong>Versorgung</strong>ssicherheits-Kriterien „Mittel- bis langfristig<br />
gesicherte Verfügbarkeit"<br />
Wesentlich größere Einigkeit besteht darin, dass es eine Diversifikation von <strong>Versorgung</strong>squellen<br />
geben muss. Für den Strom- und Gassektor bedeutet dies eine möglichst starke<br />
Mischung aus verschiedenen klassischen und erneuerbaren Energieträgern. Inwieweit auch<br />
möglichst verschiedene Technologien zur Sicherstellung der <strong>Versorgung</strong> eingesetzt werden<br />
sollen, die unterschiedliche Ressourcen nutzen und unterschiedliche Einsatzgebiete aufweisen<br />
wie z. B. Grundlast, Mittellast, Spitzenlast für den Strom- und Gassektor, sehen die Akteure<br />
unterschiedlich. Im Mittel ist diese technologische Diversität ebenso wie die Diversifikation<br />
der Bezugsquellen, also z. B. die räumliche Verteilung der Lagerstätten je Energieträger,<br />
relativ zu den anderen Kriterien zur Sicherung der mittel- bis langfristigen Verfügbarkeit von<br />
untergeordneter Bedeutung.<br />
101
Teil II Empirische Untersuchung: 4. Gewichtung der Ziele<br />
01<br />
0s<br />
A. Unabhängigkeit von knappen<br />
Ressourcen<br />
B. Diversifikation von <strong>Versorgung</strong>squellen<br />
C. Diversifikation der Bezugsquellen<br />
D. Technologische Diversität<br />
0.6<br />
0.5-<br />
0.4-<br />
0.3-<br />
0.2-<br />
0.1<br />
0.0<br />
*10<br />
B<br />
010 020<br />
c<br />
Abbildung 14: Verteilung der Werte für die <strong>Versorgung</strong>ssicherheits-Kriterien „Mittel- bis langfristig<br />
gesicherte Verfügbarkeit" (Boxplot)<br />
Die Ergebnisse zu den wirtschaftlichen Aspekten zeigen, dass die befragten Akteure im Mittel<br />
vor allem der Frage der Beschäftigung und der Effizienz der Leistungserstellung hohe Bedeutung<br />
einräumen (siehe Tabelle 13). Zukünftige <strong>Versorgung</strong>ssysteme sind wirtschaftlich<br />
nachhaltig, wenn sie einen Beitrag zur Sicherung und Steigerung der Beschäftigung in den<br />
<strong>Versorgung</strong>ssektoren, aber auch gesamtwirtschaftlich leisten. Ebenso ist es die Effizienz der<br />
Leistungserstellung, z. B. der sparsame Einsatz von Geldmitteln oder erhaltener öffentlicher<br />
Fördermittel durch die Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren, die die wirtschaftliche Nachhaltigkeit<br />
ausmachen. Wie die Abbildung 15 zeigt, gibt es jedoch vor allem bei der Bewertung<br />
der Frage der Beschäftigung einige „Ausreißer". Sie räumen diesem Aspekt im Vergleich<br />
zum Durchschnitt der Befragten geringe Bedeutung bei.<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Sicherung / Steigerung der Beschäftigung 0,14 0,04<br />
Funktionsfähigkeit des Marktes 0,12 0,05<br />
Vorbeugendes Wirtschaftshandeln 0,13 0,04<br />
Kostendeckende Preise 0,13 0,06<br />
Einkommensentwicklung 0,10 0,05<br />
Effizienz der Leistungserstellung 0,14 0,04<br />
Flexibilität 0,11 0,03<br />
Erhalt / Entwicklung des Wissenskapitals 0,13 0,03<br />
Tabelle 13: Kennwerte der relativen Gewichte der Unterkriterien „Wirtschaftliche Aspekte"<br />
102
4.3 Ergebnisse<br />
0.3<br />
A. Sicherung und Steigerung der<br />
Beschäftigung<br />
0.2-<br />
0416<br />
020<br />
04<br />
6<br />
B. Funktionsfähigkeit des Marktes<br />
C. Vorbeugendes Wirtschaftshandeln<br />
012<br />
D. Kostendeckende Preise<br />
E. Einkommensentwicklung<br />
0.1 -<br />
021<br />
* 10<br />
04<br />
_L<br />
00<br />
_L<br />
0.0 *11 V14<br />
A C D F G H<br />
F. Effizienz der Leistungserstellung<br />
G. Flexibilität<br />
H. Erhalt und Entwicklung des Wissenskapitals<br />
Abbildung 15: Verteilung der Werte für die Kriterien der „Wirtschaftlichen Aspekte" (Boxplot)<br />
Im Mittel gehört auch das vorbeugende Wirtschaftshandeln zur wirtschaftlichen Nachhaltigkeit.<br />
Ähnlich der Frage der Beschäftigung gibt es aber auch hier markante „Ausreißer". Vorbeugung<br />
bedeutet Investitionstätigkeit und Innovationstätigkeit gleichermaßen (siehe Tabelle<br />
14). Regelmäßige Investitionen gemäß dem Stand der Technik zur Vermeidung noch höherer<br />
Investitionskosten z. B. durch den Ausfall von <strong>Versorgung</strong>sanlagen und -netzen werden im<br />
Mittel ebenso wichtig erachtet wie kontinuierliche F+E-Aktivitäten bzw. der Einsatz neuer<br />
Technologien in den Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren.<br />
Wirtschaft /<br />
Vorbeugendes Wirtschaftshandeln<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Investitionstätigkeit 0,48 0,10<br />
Innovationstätigkeit 0,52 0,10<br />
Tabelle 14: Kennwerte der relativen Gewichte der Wirtschaftlichkeits-Kriterien „Vorbeugendes Wirtschaftshandeln"<br />
Die Abbildung 16 zeigt die geringe Streuung der Werte. Die Ausreißer zeigen gegenläufige<br />
Bewertungen. Während die einen die Investitionstätigkeit hoch, die Innovationstätigkeit jedoch<br />
gering gewichten, messen die anderen gerade der Innovationstätigkeit die entscheidende<br />
Bedeutung gegenüber der gering gewichteten Investitionstätigkeit zu. Welche Kriterien<br />
als Maß für vorbeugendes Wirtschaftshandeln herangezogen werden sollen, wird also<br />
von einigen Akteuren unterschiedlich eingeschätzt.<br />
103
Teil II Empirische Untersuchung: 4. Gewichtung der Ziele<br />
0.9<br />
A. Investitionstätigkeit<br />
*10 *20 B. Innovationstätigkeit<br />
021<br />
0.5<br />
021<br />
0.8-<br />
0.7-<br />
0.6-<br />
0.4-<br />
0.3-<br />
0.2-<br />
*20 *10<br />
0.1 -<br />
0.0<br />
A<br />
B<br />
Abbildung 16: Verteilung der Werte für die Wirtschaftlichkeits-Kriterien „Vorbeugendes Wirtschaftshandeln"<br />
(Boxplot)<br />
Ein ähnliches Bild im Detail zeigen die Ergebnisse zur Frage der Funktionsfähigkeit des<br />
Marktes. Abbildung 17 zeigt, dass sich die Befragten im Mittel in der Beurteilung dieses<br />
Aspektes gegenüber anderen wirtschaftlichen Kriterien sehr unterscheiden. Der Interquartilbereich<br />
ist groß. Ein Akteur vergab ein Null-Gewicht und vertritt die Auffassung, dass dieses<br />
Kriterium nicht zur Beurteilung wirtschaftlicher Nachhaltigkeit herangezogen werden sollte.<br />
Ob eine pluralistische Marktstruktur oder aber die internationale Wettbewerbsfähigkeit als<br />
Kriterium zur Beurteilung von Zukunftsoptionen im Hinblick auf die Funktionsfähigkeit des<br />
Marktes herangezogen werden soll, bleibt im Mittel unentschieden. Beide Kriterien sind im<br />
Mittel relativ zueinander gleichgewichtig (siehe Tabelle 15).<br />
Wirtschaft /<br />
Funktionsfähigkeit des Marktes<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Pluralistische Marktstruktur 0,50 0,15<br />
Internationale Wettbewerbsfähigkeit 0,50 0,15<br />
Tabelle 15: Kennwerte der relativen Gewichte der Wirtschaftlichkeits-Kriterien „Funktionsfähigkeit des<br />
Marktes"<br />
In Abbildung 17 liefert der Ausreißer einen Hinweis darauf, dass in der individuellen Gewichtung<br />
durchaus gegenläufige Gewichtungen gesetzt werden. Dies zeigt auch die Auswertung<br />
der Rohdaten. Während einige Akteure die Marktaktivität von großen und kleinen Unternehmen<br />
der <strong>Versorgung</strong>ssektoren in öffentlicher und privatwirtschaftlicher Rechtsform hervorheben,<br />
setzen andere auf den Fortbestand deutscher Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
gegenüber internationalen Wettbewerbern als Bewertungskriterium für die Funktionsfähigkeit<br />
des Marktes.<br />
104
4.3 Ergebnisse<br />
1.0<br />
0 .s-<br />
0 .6-<br />
017 05<br />
A. Pluralistische Marktstruktur (gr./kI.,<br />
öff./private)<br />
B. Internationale Wettbewerbsfähigkeit<br />
0 .4-<br />
0 .2-<br />
05 017<br />
0.0<br />
A<br />
B<br />
Abbildung 17: Verteilung der Werte für die Wirtschaftlichkeits-Kriterien „Funktionsfähigkeit des Marktes"<br />
(Boxplot)<br />
Bei den sozialen Aspekten zeigen die Ergebnisse im Mittel eine eindeutige Priorität für die<br />
soziale Gerechtigkeit und den Erhalt sozialer Ressourcen als Bewertungskriterien für die<br />
Zukunftsoptionen <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong>. Hierin sind sich die Befragten auch weitgehend<br />
einig. Die Streuung ist bei beiden Kriterien am geringsten (siehe Tabelle 16). Partizipation,<br />
also die Teilhabe der Bevölkerung in Deutschland an der gesellschaftlichen Zielfindung<br />
bzw. die Teilnahme an Planungsverfahren, wird im Vergleich zu allen anderen sozialen Kriterien<br />
im Mittel am geringsten gewichtet. Nachhaltige Zukunftsoptionen entscheiden sich aus<br />
sozialer Sicht nicht an der Partizipation.<br />
Soziale Aspekte<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Soziale Gerechtigkeit 0,21 0,03<br />
Regionale Gerechtigkeit 0,15 0,05<br />
Partizipation 0,13 0,05<br />
Transparenz 0,15 0,06<br />
Soziale Sicherheit 0,17 0,07<br />
Erhalt sozialer Ressourcen 0,20 0,04<br />
Tabelle 16: Kennwerte der relativen Gewichte der Unterkriterien „Soziale Aspekte"<br />
Etwas anders hingegen wird beispielsweise die Transparenz beurteilt. Im Mittel soll für die<br />
Beurteilung nachhaltiger <strong>Versorgung</strong>ssysteme eine Rolle spielen, inwieweit Verbraucherinformationen<br />
verständlich sind, der Gesamtpreis pro Einheit <strong>Versorgung</strong>sleistung dargelegt,<br />
die Preisbestandteile für die Wertschöpfungsbereiche Exploration/Erzeugung, Transport und<br />
Verteilung oder die Leistungsbestandteile angegeben und offen gelegt werden oder aber die<br />
Eigentümerschaft von Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren angegeben wird. Letzteres<br />
wird allerdings am wenigsten wichtig für die Herstellung der Transparenz angesehen.<br />
Abbildung 18 zeigt, dass gerade bei der Transparenz einige Akteure deutliche Akzente setzen<br />
und dieses Kriterium wichtiger erachten als der Durchschnitt der Befragten.<br />
105
Teil II Empirische Untersuchung: 4. Gewichtung der Ziele<br />
A. Soziale Gerechtigkeit<br />
B. Regionale Gerechtigkeit<br />
C. Partizipation<br />
D. Transparenz<br />
E. Soziale Sicherheit<br />
F. Erhaltung der sozialen Ressourcen<br />
0.4<br />
0.3-<br />
0.2<br />
0.1 -<br />
07<br />
* 14<br />
012<br />
0.0 Os 011<br />
A<br />
Abbildung 18: Verteilung der Werte für die Kriterien „Soziale Aspekte" (Boxplot)<br />
So eindeutig das Votum der Befragten im Mittel für die soziale Gerechtigkeit ist, so unterschiedlich<br />
werden die Aspekte beurteilt, die die soziale Gerechtigkeit ausmachen. Fast alle<br />
Kriterien weisen eine starke Streuung auf (siehe Tabelle 17; Abbildung 19).<br />
Soziale Aspekte/ Soziale Gerechtigkeit<br />
Arithmetisches<br />
Mittel<br />
Standardabweichung<br />
Sozialverträgliche Preise für Haushalte 0,19 0,05<br />
Gleichberechtigter Zugang zu Ressourcen 0,21 0,07<br />
Grundversorgung für alle 0,24 0,06<br />
Faire Rechts- u. Vertragsgestaltung 0,18 0,06<br />
Vertretbares Wohlstandsgefälle 0,12 0,08<br />
Geschlechtergerechtigkeit 0,06 0,07<br />
Tabelle 17: Kennwerte der relativen Gewichte des sozialen Kriteriums „Soziale Gerechtigkeit"<br />
Aus der Sicht der befragten Akteure sind die Zukunftsoptionen dann sozial gerecht, wenn<br />
eine Grundversorgung für alle und ein gleichberechtigter Zugang zu den Ressourcen gewährleistet<br />
ist. Dies bedeutet beispielsweise, dass kein Haushalt in finanziellen Notlagen von<br />
<strong>Versorgung</strong>sleistungen ausgeschlossen werden darf oder aber ein bevorrechtigter Zugang<br />
eines volkswirtschaftlichen Sektors zulasten der anderen Sektoren ermöglicht wird.<br />
106
4.3 Ergebnisse<br />
0.4<br />
014<br />
Os<br />
A. Sozialverträgliche Preise für<br />
Haushalte<br />
0 .2- ternehmen<br />
0 .1 -<br />
0 .3-<br />
B. Gleichberechtigter Zugang zu<br />
Ressourcen von Haushalten, öffentlichen<br />
Einrichtungen und Un-<br />
C. Gewährleistung einer Grundversorgung<br />
für alle<br />
010 0s D. Faire Rechts- und Vertragsgestaltung<br />
zur <strong>Versorgung</strong> für alle<br />
0.0 E. Vertretbares Wohlstandsgefälle<br />
A<br />
F. Geschlechtergerechtigkeit<br />
Abbildung 19: Verteilung der Werte für die sozialen Kriterien „Soziale Gerechtigkeit" (Boxplot)<br />
Eher unbedeutend im Vergleich zu allen anderen Kriterien werden im Mittel für eine soziale<br />
Nachhaltigkeit der Beitrag der <strong>Versorgung</strong>ssektoren zur Erreichung eines vertretbaren<br />
Wohlstandsgefälles und der Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit eingeschätzt. Ob zukünftige<br />
Wege der <strong>Versorgung</strong> sozial nachhaltig sind, beurteilt sich nach der überwiegenden<br />
Meinung der Akteure kaum danach, inwieweit die <strong>Versorgung</strong>ssektoren dazu beitragen,<br />
Einkommensunterschiede zwischen den obersten und untersten 10% der Bevölkerung in<br />
Deutschland nicht zu groß werden zu lassen oder inwieweit sie die Nutzungsprofile der<br />
<strong>Versorgung</strong> an den Bedürfnissen beider Geschlechter ausrichten bzw. Chancengleichheit<br />
innerhalb der Unternehmen umsetzen. Vier der 22 Befragten entschieden, dass das Ziel<br />
eines vertretbaren Wohlstandsgefälles nicht als Kriterium zur Beurteilung der Nachhaltigkeit<br />
herangezogen werden soll und vergaben ein Null-Gewicht. Acht der 22 Befragten entschieden<br />
dies für das Kriterium der Chancengleichheit.<br />
4.3.2 Bewertungsprofile der Befragten<br />
Die Korrelationsmatrix der absoluten Gewichte auf der zweiten Ebene des Wertbaums zeigt<br />
eine Reihe signifikanter Zusammenhänge in der Bewertung der Kriterien.<br />
Der Klimaschutz wurde im Mittel von den Befragten als das wichtigste ökologische Kriterium<br />
für eine nachhaltige <strong>Versorgung</strong> herausgestellt (siehe Tabelle 8). Je bedeutsamer der Klimaschutz<br />
für eine nachhaltige <strong>Versorgung</strong> von den Befragten eingeschätzt wurde, desto höher<br />
wurden auch andere ökologische Ziele, wie der Gewässerschutz (r = 0,44; p = 0,04) sowie<br />
der Artenschutz (r = 0,49; p = 0,02) und die Ressourcenschonung (r = 0,63; p = 0,00) eingeschätzt.<br />
Eine signifikante negative Korrelation hingegen besteht zwischen dem Klimaschutz<br />
und der Effizienz der Leistungserstellung (r = -0,51; p = 0,02) sowie dem Klimaschutz und<br />
der Verminderung von Störpotentialen (r = -0,48; p = 0,03). Je höher der Klimaschutz gewichtet<br />
wurde, desto weniger bedeutsam wurden diese beiden Ziele eingestuft.<br />
Die Effizienz der Leistungserstellung gehört aus der Sicht der Befragten im Mittel zu den<br />
wichtigsten wirtschaftlichen Nachhaltigkeitskriterien (siehe Tabelle 13). In Bezug auf die<br />
Bedeutung der Effizienz der Leistungserstellung sind folgende Zusammenhänge statistisch<br />
signifikant: Je höher die Effizienz der Leistungserstellung gewichtet wurde, desto geringer<br />
107
Teil II Empirische Untersuchung: 4. Gewichtung der Ziele<br />
wurden nicht nur der Klimaschutz, sondern ebenso alle anderen ökologischen Kriterien mit<br />
Ausnahme der Ressourcenschonung gewichtet. Eine negative Korrelation besteht also zwischen<br />
der Gewichtung der Effizienz und der Gewichtung des Landschaftsschutzes (r = -0,5;<br />
p = 0,02), des Gewässerschutzes (r = -0,47; p = 0,03), des Bodenschutzes (r = -0,6;<br />
p = 0,00) sowie des Artenschutzes (r = -0,74; p = 0,00). Zudem zeigen die Ergebnisse eine<br />
negative Korrelation zwischen der Einschätzung der Effizienz und der Gewichtung des Kriteriums<br />
„Schutz vor radiaktiver Strahlung" (r = -0,67; p = 0,00). Je höher die Effizienz gewichtet<br />
wurde, desto weniger bedeutend wurde die Vermeidung von Gesundheitsrisiken durch<br />
radioaktive Strahlung als Kriterium einer nachhaltigen <strong>Versorgung</strong> angesehen. Auf der anderen<br />
Seite korreliert die Bewertung der Effizienz der Leistungserstellung positiv mit der Gewichtung<br />
des Kriteriums „kostendeckende Preise" (r = 0,64; p = 0,00) und „kostengünstige<br />
Verfügbarkeit" (r = 0,54; p = 0,01). Zudem besteht ein positiver Zusammenhang zwischen<br />
der Gewichtung der Effizienz und dem Gewicht, das dem Kriterium „Entwicklung und Erhalt<br />
des Wissenskapitals" (r = 0,61; p = 0,00), und dem Kriterium „Erhalt sozialer Ressourcen"<br />
(r = 0,5; p = 0,09) beigemessen wurde. Je mehr Gewicht die Befragten auf das Kriterium der<br />
Effizienz als relevant für die Beurteilung einer nachhaltigen <strong>Versorgung</strong> gelegt haben, umso<br />
stärker gewichteten sie die Notwendigkeit, Wissen über bestehende und/oder neue Technologien<br />
bzw. institutionelle Kooperationen beispielsweise zwischen Wirtschaft und Universitäten<br />
sowie soziale Ressourcen, wie beispielsweise Verantwortung der Unternehmen in Entwicklungsländern,<br />
zu erhalten und aufzubauen.<br />
In Bezug auf die <strong>Versorgung</strong>ssicherheit wurde im Mittel die mittel- bis langfristige Verfügbarkeit<br />
der Ressourcen als am wichtigsten gewertet (siehe Tabelle 11). Die Ergebnisse zeigen<br />
keine statistisch signifikanten Zusammenhänge in der Bewertung mit den anderen Kriterien.<br />
Positiv korreliert allerdings die Gewichtung des Kriteriums der „allzeitigen Verfügbarkeit" mit<br />
der kostengünstigen Verfügbarkeit (r = 0,68; p = 0,00) und der Forderung nach einem flexiblen<br />
<strong>Versorgung</strong>ssystem (r = 0,45; p = 0,04). Je höher das Kriterium der Rund-um-die-Uhr-<br />
<strong>Versorgung</strong> eingeschätzt wurde, desto wichtiger war es den Befragten, dass eine kostengünstige<br />
Verfügbarkeit gewährleistet ist und das <strong>Versorgung</strong>ssystem sich durch Innovationsfähigkeit<br />
und/oder Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse auszeichnet. Auf der anderen<br />
Seite zeigen die Ergebnisse, dass eine höhere Gewichtung der allzeitigen Verfügbarkeit mit<br />
einer geringeren Gewichtung sozialer Kriterien einhergeht. Je mehr Wert auf eine Rund-umdie-Uhr-<strong>Versorgung</strong><br />
gelegt wurde, umso weniger wichtig wurden die soziale Gerechtigkeit<br />
(r = -0,54; p = 0,01), die soziale Sicherheit (r = -0,43; p = 0,05) und die Partizipation<br />
(r = -0,46; p = 0,05) als Ziele einer nachhaltigen <strong>Versorgung</strong> eingeschätzt. Diese Zusammenhänge<br />
sind statistisch signifikant. Ebenso statistisch signifikant sind die Zusammenhänge<br />
zwischen der Gewichtung der räumlichen Verfügbarkeit und der kostengünstigen Verfügbarkeit<br />
einerseits (r = -0,45; p = 0,04) und der Gewichtung der räumlichen Verfügbarkeit und<br />
der Qualität der <strong>Versorgung</strong> anderseits (r = 0,53; p = 0,01). Je bedeutsamer die Befragten<br />
die räumliche Verfügbarkeit der <strong>Versorgung</strong>sleistungen in Ballungszentren, Randlagen und/<br />
oder Land einschätzten, desto stärker gewichteten sie die Qualität der <strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
und desto geringer gewichteten sie den Aspekt der kostengünstigen Verfügbarkeit von<br />
Rohstoffen (Brennstoffen) und <strong>Versorgung</strong>sdienstleistungen.<br />
„Soziale Gerechtigkeit" ist im Mittel das bedeutendste Ziel der sozialen Nachhaltigkeit (siehe<br />
Tabelle 16). Je höher dieses Kriterium gewichtet wurde, desto bedeutsamer wurde auch das<br />
Kriterium der regionalen Gerechtigkeit eingestuft (r = 0,52; p = 0,01). Ein negativer Zusammenhang<br />
besteht allerdings nicht nur zur allzeitigen Verfügbarkeit als Aspekt der Versor-<br />
108
4.3 Ergebnisse<br />
gungssicherheit, sondern auch zu wirtschaftlichen Kriterien, nämlich den Kriterien „Funktionsfähigkeit<br />
des Marktes" (r = 0,45; p = 0,04) und „Flexibilität" (r = -0,45; p = 0,04). Je relevanter<br />
das Kriterium der sozialen Gerechtigkeit für eine nachhaltige <strong>Versorgung</strong> gewichtet<br />
wurde, umso weniger Gewicht wurde auf die Gewährleistung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit<br />
und/oder dem Vorhandensein einer pluralistischen Marktstruktur sowie auf die<br />
Innovations- und Anpassungsfähigkeit des <strong>Versorgung</strong>ssystems an Markterfordernisse gelegt.<br />
Die Auswertung nach Akteursgruppen zeigt, dass es signifikante Unterschiede in der Gewichtung<br />
der Ziele zwischen Wirtschaftsakteuren und Sozial- bzw. Umweltakteuren gibt. Die<br />
Auswertung erfolgte anhand folgender Gruppen16:<br />
• Gruppe 1 umfasst 13 Akteure<br />
• Gruppe 2 umfasst 9 Akteure.<br />
Die beiden Gruppen unterscheiden sich vor allem in der Gewichtung wirtschaftlicher Kriterien.<br />
Die Gruppe der Wirtschaftsakteure gewichtete die Effizienz der Leistungserstellung im<br />
Mittel signifikant höher als die Gruppe der Sozial- und Umweltakteure (t = 3,14; df = 16,2;<br />
p = 0,01). Ebenso höher gewichteten sie die Funktionsfähigkeit des Marktes in ihrer Relevanz<br />
für die Nachhaltigkeit der <strong>Versorgung</strong> (t = 2,78; df = 14,05; p = 0,02) sowie die Flexibilität<br />
des <strong>Versorgung</strong>ssystems (t = 2,52; df = 19,32; p = 0,02). In Bezug auf andere wirtschaftliche<br />
Kriterien, wie z. B. die Bedeutung der Sicherung und Steigerung der Beschäftigung oder<br />
eines vorbeugenden Wirtschaftshandelns für eine nachhaltige Entwicklung gibt es keine<br />
signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen.<br />
In Bezug auf ökologische Kriterien zeigen sich beispielsweise beim Klimaschutz als eines<br />
der im Mittel über alle Befragten am wichtigsten eingestuften ökologischen Kriterien ebenfalls<br />
keine signifikanten Unterschiede. Wohl aber bei der Bewertung der Kriterien „Bodenschutz"<br />
(t = -2,41; df = 16,84; p = 0,03) und „Artenschutz" (t = -4,53; df = 19,98; p = 0,00). Der<br />
Schutz des Bodens beispielsweise durch die Vermeidung der Nutzung als Deponieraum für<br />
radioaktive und toxische Abfälle wird von den Sozial- und Umweltakteuren im Mittel signifikant<br />
höher bewertet. Gleiches gilt für den Artenschutz.<br />
Auch in der Bedeutung des Schutzes vor radioaktiver Strahlung als Kriterium zur Beurteilung<br />
der Nachhaltigkeit unterscheiden sich die beiden Gruppen (t = -2,33; df = 20; p = 0,03).<br />
Dieses Kriterium wird von der Gruppe der Sozial- und Umweltakteure im Mittel signifikant<br />
höher eingeschätzt. Hinsichtlich sozialer Kriterien zeigen die Ergebnisse bei dem über alle<br />
Befragten im Mittel wichtigsten Kriterium die „soziale Gerechtigkeit" keine signifikanten Unterschiede.<br />
Eine unterschiedliche Gewichtung zeigt sich in Bezug auf die Kriterien „Partizipation"<br />
und „Erhalt sozialer Ressourcen". Während das Kriterium einer stärkeren Teilhabe der<br />
Gesellschaft an Entscheidungen von der Gruppe der Sozial- und Umweltakteuren bedeutsamer<br />
eingestuft wird (t = -2,33; df = 16,79; p = 0,03), wird die Bedeutung des Erhalts sozialer<br />
Ressourcen von den Wirtschaftsakteuren im Mittel stärker gewichtet (t = 2,5; df = 19,5;<br />
p = 0,01).<br />
16 Der Gruppe 1 wurden folgende Institutionen zugeordnet: BGW, BDI, BITKOM, DBV, EnBW, VCI,<br />
VDMA, VGB, VKU, VRE, WSM-Industrie, Deutscher Städtetag und die CDU.<br />
Der Gruppe 2 wurden folgende Institutionen zugeordnet: BUND, DGB, Life e.V., vzbv, Forum Umwelt<br />
und Entwicklung, Grüne Liga, NABU, SPD und Bündnis 90/Grüne.<br />
109
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
5. Impact-Analyse<br />
Die Ermittlung der Konsequenzen bzw. Wirkungen der Zukunftsszenarien (Attributausprägungen)<br />
sind der vierte Schritt des Verfahrens (siehe Abschnitt 2.3.2). Anhand von „expert<br />
judgement" werden diese in Bezug auf die 3. Ebene der Zielhierarchien bestimmt. Um Unsicherheiten<br />
und Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten in den Expertenurteilen herauszuarbeiten,<br />
wird ein Kategoriensystem vorgestellt, anhand dessen die Auswertung erfolgt. Nachfolgend<br />
sind Durchführung, Auswertung und Ergebnisse dargestellt.<br />
5.1 Durchführung<br />
5.1.1 Ansatz<br />
Aufgabe der Impact-Analyse ist die wissenschaftliche Einschätzung der Ausprägungen, die<br />
die vier Zukunftsszenarien auf den jeweiligen in der Wertbaumanalyse gewonnenen Attributen<br />
einnehmen, wie z. B. die Höhe der CO 2-Emissionen je Szenario. Welche ökologischen,<br />
sozialen und wirtschaftlichen Wirkungen mit den Zukunftspfaden verknüpft sind, ist unsicher.<br />
Zum einen sind die Szenarien selbst mit Unsicherheit behaftet. Die Szenarien stellen urteilsbegründete<br />
Zusammenhänge auf einem mittleren Auflösungsgrad dar. Nur punktuell liegt<br />
Tiefenschärfe auf Indikatorenniveau vor. Mit Unvollständigkeit und Ungenauigkeit ist bei der<br />
Abschätzung umzugehen. Zum anderen liegen für die Beurteilung, ob die jeweilige zukünftige<br />
Entwicklung bestimmte Zielkriterien erfüllt, häufig keine abgesicherten und belastbaren<br />
Informationen vor. Selbst dort, wo empirische Studien zum Zusammenhang zwischen bestimmten<br />
Szenario-Elementen und deren Wirkungen, wie z. B. Gesundheitsrisiken oder<br />
Beschäftigungseffekten, vorliegen, stellt sich beispielsweise immer noch die Frage nach der<br />
Qualität dieser Studien, die unterschiedliche Experten verschieden beurteilen können. Abschätzungsunsicherheiten<br />
sind häufig gepaart mit kontroversen Auffassungen ihrer Bewertung<br />
(Expertendilemma).<br />
Die Konzeption der Impact-Analyse sieht daher vor, Transparenz zu schaffen. „Expert judgements"<br />
wurden so abgefragt, dass deutlich wird, wo Unsicherheiten liegen und worin sich<br />
Experten in ihren Einschätzungen unterscheiden. Wesentliche Bausteine der hier konzipierten<br />
Evidenz-/Unsicherheitsanalyse sind die Angabe<br />
1. der Begründungen für die Einschätzungen der Experten und<br />
2. der Urteilssicherheit.<br />
5.1.2 Teilnehmer<br />
Bei der Auswahl der wissenschaftlichen Experten wurde darauf geachtet, dass möglichst alle<br />
Ziele des Zielkataloges fachspezifisch abgedeckt sind. Die Beurteilung der Zukunftsszenarien<br />
auf den Zielen erforderte zum Teil auch sektorspezifische Kompetenzen. Um zumindest<br />
in beschränktem Rahmen Expertenpluralität zu gewährleisten, wurden für Umweltschutz,<br />
Wirtschaft und <strong>Versorgung</strong>ssicherheit mehrere Experten mit den gleichen Aufgaben betraut.<br />
In Tabelle 18 sind die Gutachter der Impact-Analyse aufgeführt.<br />
110
5.1 Durchführung<br />
Nr. Institution Einschätzung der Zielbereiche<br />
1 Herr Prof. Dr.-Ing. Holländer<br />
Universität Leipzig<br />
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät<br />
2 Herr Prof. Dr.-Ing. Londong<br />
Universität Weimar<br />
Fakultät Bauingenieurwesen/<br />
Siedlungswasserwirtschaft<br />
3 Frau Dipl.-Ing. Tanja Leinweber<br />
Universität Hannover<br />
Institut für Landschaftspflege und Naturschutz<br />
4 Herr Dr. Bradke<br />
Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und<br />
Innovationsforschung (ISI)<br />
Abt. Energietechnik<br />
5 Herr Prof. Dr.-Ing. Pfaffenberger<br />
bremer energie institut<br />
6 Herr Dr. Duscha<br />
ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung<br />
Heidelberg GmbH<br />
7 Herr Dr. Markewitz<br />
Forschungszentrum Jülich<br />
Programmgruppe Systemforschung und Tech -<br />
nologische Entwicklung (STE)<br />
8 Herr Dipl.-Ing. Pötter<br />
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und<br />
Mikrointegration (IZM)<br />
Abt. Environmental Engineering<br />
9 Herr Dr. Jakobs<br />
Institut für Geophysik und Meteorologie<br />
Außenstelle für atmosphärische Umweltforschung<br />
Universität Köln<br />
10 Herr Dr. Csicsaky<br />
Niedersächsisches Ministerium für Soziales,<br />
Familie und Gesundheit<br />
11 Prof. Dr. Lange<br />
Universität Bremen<br />
Forschungszentrum Arbeit und Technik<br />
Wirtschaft<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit (vor allem Verfügbarkeit)<br />
Umweltschutz (vor allem Wasserreservoire)<br />
Sektor Wasser<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
Umweltschutz (vor allem Emissionen, Ressourcenschonung)<br />
Sektor Wasser, insbesondere dezentrale technische<br />
Abwasseranlagen<br />
Umweltschutz (vor allem Schutz von Landschaft,<br />
Boden, Wasser, Arten)<br />
Sektoren Energie, Wasser<br />
Umwelt<br />
Wirtschaft<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
Sektor Energie<br />
Wirtschaft<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
Sektor Energie<br />
Umweltschutz<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
Sektor Energie<br />
Wirtschaft<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
Umweltschutz (vor allem Emissionen, Ressourcenschonung)<br />
Sektor Energie<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit (Kosten, Sicherheit)<br />
Umweltschutz (Klimaschutz, Landschaftsbild,<br />
Ressourcenschonung)<br />
Sektor TK mit Einfluss auf Sektor Energie<br />
Gesundheit (Luftimmissionen)<br />
Sektor Energie<br />
Gesundheit<br />
Sektoren: Energie, Wasser, TK<br />
Soziales<br />
Sektoren: Energie, Wasser, TK<br />
Tabelle 18: Liste der Gutachter<br />
5.1.3 Vorgehen<br />
Als Arbeitsgrundlage für die wissenschaftlichen Experten wurden für alle Experten einheitliche<br />
Datenblätter zur Abgabe ihrer Urteile und eine ausführliche Instruktion erstellt. Im Einzelnen<br />
hatten die Gutachter folgende Aufgaben zu bearbeiten:<br />
111
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
1. Auf der konkreten Ebene des Zielkatalogs (Ebene 3, siehe Abbildung 4 bis Abbildung 8 ab<br />
Seite 88), waren die vier Szenarien einzuschätzen. Liegen die Ziele noch auf einem zu<br />
hohen Aggregationsniveau vor, waren sie in einem ersten Schritt entsprechend zu operationalisieren,<br />
damit konkrete Aussagen möglich sind.<br />
2. Wo immer möglich, war eine quantitative Abschätzung gefordert. Abgestuft dazu waren<br />
die Angabe eines „ranges", in dem aus der Sicht des Experten wahrscheinlich die Werte<br />
liegen, und die Angabe des wahrscheinlichsten Wertes, möglich.<br />
3. War eine quantitative Angabe nicht möglich, waren gemäß dem AHP Paarvergleichsurteile<br />
für alle vier Szenarien in Bezug auf das jeweilige Kriterium auf folgender in beide Richtungen<br />
neunstufigen verbal verankerten Rating-Skala abzugeben (siehe Saaty, z. B. 1990).<br />
Wie gut erfüllt Szenario X im Vergleich zu Szenario Y das Kriterium x.<br />
Gleich Etwas Erheblich Sehr viel Absolut dominiegut<br />
besser besser besser rend<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
2, 4, 6, 8 sind Zwischenwerte zur Feinabstufung<br />
Zudem waren verbale Einschätzungen anzugeben, die die Unterschiede zwischen den Szenarien<br />
verdeutlichen.<br />
1. Die Urteilssicherheit war auf einer fünfstufigen Rating-Skala für jedes Urteil abzugeben.<br />
0= Ich bin mir meiner Angabe völlig unsicher;<br />
5= Ich bin mir meiner Angabe ganz sicher.<br />
2. Für jede Einschätzung waren Begründungen anzugeben. Es war deutlich zu machen,<br />
worauf sich die jeweiligen Einschätzungen stützen, welche Annahmen und Hypothesen<br />
dem Urteil zugrunde liegen bzw. welche Szenario-Elemente für das Urteil herangezogen<br />
wurden.<br />
3. Nach Abschluss aller Gutachten waren die eigenen Urteile vor dem Hintergrund der Einschätzungen<br />
der anderen Experten zu überprüfen.<br />
In der vorliegenden Konzeption basieren die Experteneinschätzungen nicht nur auf vergleichbaren<br />
Maßstäben, sondern durch die Evidenzanalyse wird die Frage der Vergleiche<br />
von Experteneinschätzungen vor dem Hintergrund des sog. Expertendilemmas explizit gemacht.<br />
5.2 Auswertung<br />
Die Ergebnisse der Expertengutachten (Datenblätter und textliche Begründung) wurden so<br />
aufbereitet, dass der Vergleich zwischen den Einschätzungen verschiedener Experten auf einen<br />
Blick möglich ist. Hierzu wurde eine einheitlich strukturierte tabellarische Darstellung gewählt,<br />
die a) die aus den qualitativen Einschätzungen der Paarvergleiche extrahierten Rangfolgen<br />
in der Form „A>B»C=D" angibt, was zu lesen ist als „A ist besser als B, B ist deutlich<br />
besser als C, C ist gleich gut wie D", b) die aus den Texten extrahierten ausschlaggebenden<br />
Begründungen in Stichworten, c) die Szenario-Elemente, auf die sich das Urteil gründet, und<br />
d) die jeweilige Urteilssicherheit angibt. Diese Tabelle wurde in mehreren Rückkopplungsschleifen<br />
mit den Experten generiert. Dabei galt es, etwaige Inkonsistenzen in der Bewertung<br />
zu diskutieren und Missverständnisse zu klären. Ergebnis ist ein mit den jeweiligen Experten<br />
112
5.2 Auswertung<br />
abgestimmtes Synthesepapier aller Gutachten, das im Anhang (Kapitel A.3) wiedergegeben<br />
ist.<br />
In der „Delphi-Runde" wurde dieses Synthesepapier versendet, wobei die Namen der anderen<br />
Experten anonymisiert waren. Korrekturen der Experteneinschätzungen wurden in die<br />
zusammenfassenden Tabellen übernommen.<br />
Obwohl in der Delphi-Runde einige Experteneinschätzungen revidiert wurden, verblieben<br />
doch bei einigen Kriterien mehr oder weniger große Unterschiede zwischen den Experten.<br />
Insgesamt zeigen die Ergebnisse aber, dass trotz hoher Unsicherheit in der Mehrzahl der<br />
Fälle eine gute Übereinstimmung in der Bewertung zwischen den Experten vorliegt. Dies<br />
spricht für die grundsätzliche Belastbarkeit der Expertenurteile.<br />
Das vorliegende Konzept der Impact-Analyse ermöglicht es, herauszuarbeiten, worin die Unterschiede<br />
in den Experteneinschätzungen liegen. Unterschiede lassen sich in verschiedene<br />
Fälle kategorisieren (Kasten 1). Diese Kategorien wurden zunächst aufgrund von theoretischen<br />
Überlegungen aufgestellt und dann anhand der konkret auftretenden Fälle ergänzt.<br />
113
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Zu unterscheiden sind zunächst zwei Gruppen von Differenzen zwischen den Experten:<br />
Gruppe A. Im Ergebnis kommen die Experten zur gleichen Rangfolge der Szenarien.<br />
Gruppe B. Im Ergebnis kommen die Experten zu einer unterschiedlichen Rangfolge der<br />
Szenarien.<br />
In die Gruppe A fallen auch Expertenurteile, die (a) sich lediglich in den Begründungen<br />
unterscheiden oder (b) die Höhe der relativen Unterschiede zwischen den Szenarien unterschiedlich<br />
einschätzen.<br />
Die Gruppe B lässt sich zum einen durch (a) sachbezogene und zum anderen durch (b)<br />
beurteilungsrelevante Differenzen charakterisieren.<br />
I. Sachbezogene Differenzen aufgrund sektorspezifischer und/oder fachspezifischer Fokussierung<br />
des Beurteilungsgegenstandes.<br />
Die Erfüllung des Kriteriums (des Attributs) ist sektorspezifisch. Die Einschätzung eines<br />
Experten gilt nur für die Erfüllung des Kriteriums in dem von ihm beurteilten Sektor.<br />
Beispielsweise ist die Sicherheit des Stromversorgungsnetzes zu unterscheiden<br />
von der Sicherheit des Wasserversorgungsnetzes.<br />
lb. In einzelnen Fällen gibt es sachbezogene Differenzen in den Einschätzungen desselben<br />
Experten, z. B. aufgrund der Betrachtung unterschiedlicher räumlicher Bereiche<br />
oder unterschiedlicher Schadstoffe.<br />
II. Beurteilungsbezogene Differenzen zwischen den Experten<br />
1. Die Experten unterscheiden sich in der Höhe der relativen Einschätzungen der Szenarien<br />
nur wenig, auch wenn die Rangfolge im Ergebnis unterschiedlich ist.<br />
1 b. Die Experten schätzen den Rang der Szenarien teils gleich, teils unterschiedlich ein,<br />
es lässt sich aber eine gemeinsame, d. h. zu allen Experteneinschätzungen kompatible<br />
Reihenfolge der Szenarien angeben.<br />
2. Die Experten nennen die gleichen Faktoren, die das Urteil begründen, halten sie a-<br />
ber für unterschiedlich wichtig, oder schätzen unterschiedliche Faktoren als wichtig<br />
ein.<br />
3. Die Experten nutzen den Interpretationsspielraum der Szenarien unterschiedlich.<br />
4. Die Experten legen unterschiedliche Hypothesen über Wirkungszusammenhänge zu<br />
Grunde.<br />
5. Experten weichen von der weitgehend übereinstimmenden Einschätzung anderer<br />
Experten ab, geben aber selbst eine große Unsicherheit ihrer Einschätzung an, während<br />
die anderen Experten eine geringere Unsicherheit angeben.<br />
Kasten 1: Kategoriensystem zur Analyse von Expertendifferenzen<br />
Die Analyse individueller Experteneinschätzungen ist die Grundlage dafür, ein Konzept für<br />
die daraus resultierende Gesamtbewertung der Szenarien zu entwickeln:<br />
Keine Probleme mit der Aggregation mehrerer Experteneinschätzungen bestehen für die<br />
erste Gruppe der Einschätzungen mit gleicher Rangfolge (Gruppe A). Liegen Unterschiede in<br />
der Rangfolge vor (Gruppe B), ist je nach Art der Differenzen verschieden zu verfahren:<br />
114
5.2 Auswertung<br />
Sachbezogene Differenzen erfordern eine nach Sektoren (Strom / Gas vs. Wasser vs. Telekommunikation)<br />
getrennte Auswertung:<br />
Im Bereich „Umweltschutz" wurden 12 Kriterien für die Sektoren Strom / Gas und Wasser<br />
gemeinsam, 5 Kriterien (CO 2-Freisetzung, Methan-Freisetzung, Schadstoffakkumulationen<br />
im Boden, Schonung von Materialien, und Schonung von Rohstoffen) getrennt behandelt, 1<br />
Kriterium trifft nur auf den Sektor Strom zu (Unfälle in EVUs). Der Sektor Telekommunikation<br />
wurde hauptsächlich im Hinblick auf die Anwendung von TK-Einrichtungen in den Sektoren<br />
Strom / Gas und Wasser betrachtet, dies ist in die Einschätzungen für diese Sektoren eingeflossen.<br />
Im Bereich „Gesundheitsschutz" ist das Kriterium „Schutz vor Belastung des Rohwassers /<br />
Trinkwassers" aus Sicht des Sektors Wasser eingeschätzt, das Kriterium „Schutz vor elektromagnetischen<br />
Feldern" aus gemeinsamer Sicht von Stromversorgung und Telekommunikation.<br />
Bei den Kriterien „Schutz vor Luftimmissionen" und „Schutz vor radioaktiver Strahlung"<br />
bildet die Gesamtexposition der Bevölkerung die Basis der Einschätzung, beispielsweise<br />
sind bei Luftimmissionen neben den Emissionen aus dem Sektor Strom / Gas auch die E-<br />
missionen von Verkehr, Industrie, Gewerbe, Haushalten und Landwirtschaft berücksichtigt.<br />
Im Bereich „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit" wurden alle Kriterien separat nach den Sektoren Strom /<br />
Gas einerseits und Wasser andererseits behandelt, weil die technischen Randbedingungen<br />
und die äußeren Einflüsse, die die Ausprägungen im Bereich <strong>Versorgung</strong>ssicherheit beeinflussen,<br />
für die beiden Sektoren unterschiedlich sind. Der Sektor Telekommunikation (TK)<br />
wurde im Hinblick auf die Anwendung von TK-Einrichtungen in den Sektoren Strom / Gas<br />
und Wasser betrachtet; dies ist in die Einschätzungen für diese Sektoren eingeflossen, z. B.<br />
dadurch, dass TK-Systeme die Fehlererkennungsmöglichkeiten und somit die <strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
verbessern.<br />
Im Bereich „Wirtschaftliche Aspekte" wurden 12 Kriterien für die Sektoren Strom / Gas und<br />
Wasser gemeinsam behandelt, weil dabei auch die Experten sektorübergreifende Begründungen<br />
angegeben haben. 5 Kriterien wurden getrennt behandelt (Sicherung und Steigerung<br />
der Beschäftigung, Investitionstätigkeit, Effizienz der Leistungserstellung, Innovationsfähigkeit,<br />
und Aufbau und Entwicklung von Wissen zu neuen Technologien), weil dabei sektorabhängig<br />
deutlich unterschiedliche Begründungen angegeben wurden. Der Sektor Telekommunikation<br />
fließt indirekt ein, indem er bereits in der Definition der Szenarien als Enabler für<br />
bestimmte Entwicklungen in den anderen Sektoren wirkt.<br />
Im Bereich „Soziale Aspekte" sind die Einschätzungen durchweg sektorübergreifend.<br />
115
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Bereich<br />
Sektoren gemeinsam<br />
Kriterien insgesamt<br />
nach Sektoren getrennt<br />
(Strom / Gas; Wasser; Telekomm.)<br />
Umweltschutz 13<br />
Gesundheitsschutz 3<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit 0<br />
Wirtschaftliche Aspekte 12<br />
Soziale Aspekte<br />
23<br />
19<br />
4<br />
15<br />
17<br />
23<br />
1<br />
6<br />
(6 ; 5; 3)<br />
1<br />
(0 ; 1 ; 0)<br />
15<br />
(15 ; 11 ; 0)<br />
5<br />
(5 ; 5 ; 0)<br />
0<br />
Tabelle 19: Anzahl der sektorübergreifenden und sektorspezifischen Experteneinschätzungen<br />
Bei beurteilungsbezogenen Differenzen ist eine Aggregation – unabhängig davon welches<br />
konkrete Verfahren dazu gewählt wird – nicht immer zielführend. In dem hier vorgeschlagenen<br />
Ansatz der multi-kriteriellen Bewertung geht es darum, die Unsicherheit, mit der Urteile<br />
verknüpft sind, transparent zu machen. In der Regel stehen sich kontroverse Experteneinschätzungen<br />
gegenüber. Wie belastbar die jeweiligen Einschätzungen sind, lässt sich nur<br />
durch die Offenlegung der Beurteilungsbasis nachvollziehen. Eine Entscheidung für oder<br />
gegen Optionen zukünftiger Entwicklung muss diese Unsicherheiten einkalkulieren. Daher<br />
müssen in den Fällen, in denen substantielle Unterschiede vorliegen, diese auch kenntlich<br />
gemacht werden. Eine Aggregation bei den beurteilungsbezogenen Differenzen empfiehlt<br />
sich daher nur im Falle der geringen Differenzen in der Einschätzung der Höhe der Unterschiede<br />
zwischen den Szenarien (Kategorie B II 1 und B II 1b, siehe Kasten 1). In allen<br />
anderen Fällen sind die Einschätzungen der einzelnen Experten separat darzustellen. Die<br />
Aggregation dient hier lediglich der Veranschaulichung, welche Gesamtbewertung bei einem<br />
fiktiven Abstimmungsprozess zustande kommen würde, nimmt man den Mittelwert über die<br />
unterschiedlichen Einschätzungen.<br />
Für die Aggregation von Paarvergleichen gibt es unterschiedliche Regeln, die in der Literatur<br />
diskutiert sind. Basis für die Aggregation sind die Werte auf der AHP-Skala, die Paarvergleichs-Faktoren<br />
von 1 bis 9 (Saaty, 1990; Forman & Selly, 2002). Die vorliegende Auswertung<br />
beruht auf dem bewährten Verfahren der Aggregation bei Gruppenentscheidungen. Hier<br />
bietet sich die Bildung des Mittelwerts an (Meixner & Haas, 2002), indem für jeden Paarvergleich<br />
der Ausprägungen der geometrische Mittelwert über die Paarvergleichs-Faktoren aller<br />
Experten berechnet wird. Der geometrische Mittelwert ist dem arithmetischen hier vorzuziehen,<br />
weil nur beim geometrischen Mittelwert der Mittelwert unabhängig von der Reihenfolge<br />
der Bewerter ist (Meixner & Haas, 2002). Für die in den folgenden Kapiteln abgebildeten<br />
Grafiken werden entsprechend dem Verfahren im „Analytic Hierarchy Process" (AHP) aus<br />
den Paarvergleichs-Faktoren die Ausprägungen der Optionen (d. h. der vier Szenarien) auf<br />
jedem Kriterium mittels Eigenvektor der Vergleichsmatrix berechnet, und zwar in jedem Fall<br />
116
5.3 Ergebnisse<br />
für die aggregierten Paarvergleichs-Faktoren und im Falle von Differenzen zwischen den<br />
Experten-Einschätzungen auch für die Paarvergleichs-Faktoren der einzelnen Experten. Die<br />
resultierenden Ausprägungen sind relative Werte zwischen 0 und 1, deren Summe für jedes<br />
Kriterium jeweils = 1 ist. Sind die vier Szenarien hinsichtlich dieses Kriteriums gleichwertig,<br />
dann sind die Ausprägungen alle = 0,25. Sind die Unterschiede zwischen den Ausprägungen<br />
der Szenarien groß und gibt es dabei einen Konsens der Experten, dann weichen die Ausprägungen<br />
stark von 0,25 ab. Der Wert ist kleiner als 0,25, wenn das Szenario als schlechter,<br />
größer als 0,25, wenn das Szenario als besser eingeschätzt wurde. Daher werden graphisch<br />
die Abweichungen der Ausprägungen von dem mittleren Wert 0,25 dargestellt.<br />
5.3 Ergebnisse<br />
Die Ergebnisse der Gutachten zeigen, dass quantitative Abschätzungen in der Regel nicht<br />
möglich waren. Für einige Ziele gaben die Experten an, aufgrund der Ungenauigkeit der<br />
Szenarien keine Aussagen treffen zu können. Dies spiegelt die Situation hoher Unsicherheit<br />
wieder. (Das im Anhang, Kapitel A.3 wiedergegebene „Synthesepapier" enthält die Zusammenstellung<br />
der Experteneinschätzungen in Tabellenform einschließlich der Selbsteinschätzung<br />
der Urteilssicherheit der Experten.)<br />
Schon bei der Entwicklung der Szenarien zeigte sich, dass der Schwerpunkt der Zukunftsszenarien<br />
auf dem Energiesektor und dem Wassersektor liegt. Der Sektor Telekommunikation<br />
wurde in Bezug auf seine Wechselwirkung mit den anderen <strong>Versorgung</strong>ssektoren als<br />
Enabler betrachtet, um solche Dienstleistungsangebote wie Smart Building oder die Entstehung<br />
virtueller Kraftwerke mittels aktiver Netze erst zu ermöglichen. Jedoch wurden die<br />
Wirkungen anderer <strong>Versorgung</strong>ssektoren auf den TK-Sektor als marginal eingestuft. Die<br />
Einflussfaktoren, die genuin die Zukunftsentwicklung des TK-Sektors bestimmen, spielten<br />
aus der Sicht der Teilnehmer der Szenario-Workshops bei der sektorübergreifenden Betrachtung<br />
nur eine untergeordnete Rolle.<br />
Die Gutachten zum Sektor Telekommunikation zeigen nun überdies, dass dieser Sektor<br />
kaum zwischen den Szenarien im Hinblick auf ökologische Kriterien differenziert, insbesondere<br />
sind seine Beiträge zur CO 2-Freisetzung oder zum Materialverbrauch vernachlässigbar.<br />
Im Folgenden werden die Ergebnisse für alle fünf Zielbereiche „Umweltschutz" „Gesundheitsschutz",<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit", „Wirtschaftliche Aspekte" und „Soziale Aspekte" dargestellt.<br />
17 Die Beschreibung der Ergebnisse beginnt für jeden Zielbereich mit einer Zusammenfassung<br />
der Stärken und Schwächen der Szenarien (Attributausprägungen) aus der Sicht der<br />
wissenschaftlichen Experten sowie die wesentlichen Einflussfaktoren, die diese begründen.<br />
Dann werden für jedes einzelne Kriterium angegeben: Die Kategorie der Übereinstimmung<br />
der Experteneinschätzungen, eine grafische Darstellung der Ergebnisse der Paarvergleiche,<br />
stichpunktartig in einer Tabelle die von den Experten für die Einschätzung herangezogenen<br />
Einflussfaktoren, sowie gegebenenfalls ein Auszug aus den Begründungen der Experten.<br />
Richtung und Größe der jeweiligen Einflüsse werden in den Tabellen durch folgende Symbole<br />
dargestellt:<br />
17 In den Beschreibungen werden grundsätzlich die Einschätzungen der Experten wiedergegeben,<br />
auch dort, wo nicht ausdrücklich darauf hingewiesen ist. Bei Anmerkungen, die nicht von den Experten<br />
stammen, wird die Quelle angegeben.<br />
117
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
++ starker positiver Einfluss<br />
+ positiver Einfluss<br />
(+) schwacher positiver Einfluss<br />
± neutral<br />
(-) schwacher negativer Einfluss<br />
negativer Einfluss<br />
starker negativer Einfluss<br />
Abschließend wird mit Blick auf die Frage der Nachhaltigkeit dezentraler Systeme deren<br />
Beitrag analysiert.<br />
5.3.1 Umweltschutz<br />
5.3.1.1. Zusammenfassung<br />
Stärken und Schwächen der Szenarien<br />
Die Stärken von Szenario A liegen in der „Reduktion der CO 2-Emissionen" und „Schonung<br />
von Rohstoffen", in der „Schonung von Wasser" und „Erhalt von Trinkwasserreservoiren", in<br />
geringerer Gefahr von „Bodenbelastung durch Unfälle in EVUs" und geringerer Belastung<br />
des Bodens als „Deponieraum für radioaktive Abfälle". Die „Vermeidung von Schadstoffakkumulationen<br />
im Boden" ist im Sektor Strom und Gas gut, aber im Sektor Wasser schlecht.<br />
Schwächen hat Szenario A bei „Schonung von Flächen", „Eingriffen ins Landschaftsbild",<br />
„Schaffung und Erhalt von Erholungsgebieten" und beim „Schutz von Fauna, Flora und Habitaten".<br />
Eine weitere Schwäche liegt bei der geringen „Schonung von Materialien".<br />
Insgesamt ist Szenario A charakterisiert durch ausgeprägte Stärken, aber andererseits einige<br />
ausgeprägte Schwächen.<br />
Szenario B hat wie Szenario A Stärken bei „Reduktion der CO2-Emissionen" und „Schonung<br />
von Rohstoffen", jedoch nicht so ausgeprägt wie bei Szenario A. Weitere Stärken von Szenario<br />
B sind - wie bei Szenario A - die geringere Gefahr von „Bodenbelastung durch Unfälle in<br />
EVUs" und geringerem „Deponieraum für radioaktive Abfälle". Im Gegensatz zu Szenario A<br />
ist „Schaffung und Erhalt von Erholungsgebieten" in Szenario B eine Stärke.<br />
Bei Szenario B entfallen die bei Szenario A ausgeprägten Schwächen bei „Schonung von<br />
Flächen und Wald", „Eingriffen ins Landschaftsbild" und beim „Schutz von Fauna, Flora und<br />
Habitaten", die Einschätzungen für diese Kriterien liegen im Mittelfeld. Auch die Ausprägungen<br />
der meisten anderen Kriterien liegen im Mittelfeld. Schwächen gibt es lediglich bei „Erhalt<br />
von Trinkwasserreservoiren" und in geringerem Maße bei „Schonung von Materialien".<br />
Insgesamt ist Szenario B im Umweltschutzbereich ein sehr ausgeglichenes Szenario, bei<br />
dem die Stärken zwar nicht so ausgeprägt sind wie bei Szenario A, aber voll zum Tragen<br />
kommen, weil sich nur wenig Schwächen zeigen.<br />
Die Szenarien C und D sind bei vielen Kriterien sehr ähnlich eingeschätzt. Sie haben die<br />
gleichen ausgeprägten Schwächen bei „Reduktion der CO 2-Emissionen", „Schonung von<br />
Rohstoffen", „Schonung von Wasser", „Erhalt von Trinkwasserreservoiren", „Bodenbelastung<br />
durch Unfälle in EVUs" und „Deponieraum für radioaktive Abfälle". Eine weitere Schwäche in<br />
Szenario D ist die mangelnde „Vermeidung von Schadstoffakkumulationen im Boden"; in<br />
118
5.3 Ergebnisse<br />
Szenario C ist dies nur im Sektor Strom und Gas eine Schwäche, im Sektor Wasser hingegen<br />
eine Stärke, so dass diese sich gegenseitig aufheben. Von beiden Szenarien hat im<br />
Umweltschutzbereich nur Szenario D eindeutige Stärken, und zwar bei „Schonung von Flächen",<br />
„Vermeidung von Eingriffen ins Landschaftsbild", „Schutz von Fauna und Habitaten"<br />
und „Schonung von Materialien".<br />
Wesentliche Einflussfaktoren<br />
Der Endenergieverbrauch, der in Szenario A um 5% geringer ist, und der Energiemix zur<br />
Stromerzeugung haben nach Einschätzung der Experten wesentlichen Einfluss auf Klimaschutz<br />
und Ressourcenschonung.<br />
Der höhere Anteil erneuerbarer Energien in Szenario A und (etwas geringer) in B und die<br />
Substitution von Kohle durch Erdgas ist nicht nur vorteilhaft für die Kriterien „Schonung von<br />
Rohstoffen" (Brennstoffen) und die „Reduktion der CO 2-Emissionen", sondern auch für die<br />
Reduktion der Schadstoffemissionen aus der Kohleverbrennung, die sich auf die Kriterien<br />
„Vermeidung von langfristigen Schadstoffakkumulationen" (Bodenschutz) und „Vermeidung<br />
von Schadstoffeinträgen in Wasserquellen" (Gewässerschutz) auswirken. Andererseits ist<br />
aber zu befürchten, dass ein verstärkter Anbau von Biomasse als nachwachsender Energieträger<br />
die „Übernutzung landwirtschaftlicher Flächen" (Bodenschutz) und damit die „langfristigen<br />
Schadstoffakkumulationen" im Boden und die „Schadstoffeinträge in Wasserquellen"<br />
verschlechtert. Schadstoffeinträge sind jedoch nicht zwangsläufig hoch, sondern werden<br />
möglicherweise durch Umweltschutzmaßnahmen reduziert, die durch staatliche Auflagen und<br />
Kontrollen sowie durch den Druck der Bevölkerung, basierend auf verstärktem Gesundheitsbewusstsein,<br />
eingeführt werden. Beide, Gesundheitsbewusstsein und staatliche Eingriffe,<br />
sind in Szenario D am geringsten. Auch bei der Windenergie werden Nachteile angeführt,<br />
diese liegen in „Eingriffen ins Landschaftsbild", geringerer „Schonung von Flächen" und<br />
geringerem „Schutz von Flora, Fauna und Habitaten".<br />
Einfluss auf die größte Zahl der Kriterien im Umweltschutz (10 von insgesamt 19) hat die<br />
Siedlungsstruktur Die in Szenario A angenommene „Siedlungsbewegung aufs Land" mit den<br />
dafür erforderlichen Verkehrswegen hat die am stärksten verringerte „Schonung von Flächen"<br />
und „Wald", verringerten „Schutz von Flora, Fauna und Habitaten", mehr „Eingriffe ins<br />
Landschaftsbild" und weniger „Erholungsgebiete", mehr „Verbrauch von Rohstoffen" und<br />
„Materialien" und mehr „Schadstoffeinträge in Wasserquellen" zur Folge. Das Siedeln in<br />
Ballungsräumen (Szenario D) hat die geringsten negativen Auswirkungen, Siedlungen in<br />
Randgebieten von Ballungsräumen (Szenarien B und C) liegen in den Auswirkungen dazwischen.<br />
Ähnliche Folgen hat der Abbau von Braunkohle (besonders hoch in Szenario D): Er<br />
betrifft 9 von 19 Kriterien, dabei entfallen „Materialverbrauch" und „Schadstoffe in Wasserquellen",<br />
dafür kommt geringerer „Erhalt von Trinkwasserreservoiren" hinzu. Allerdings sind<br />
die Auswirkungen begrenzt auf die Braunkohlenreviere.<br />
Kleine, dezentrale Anlagen bedingen einen erhöhten Materialverbrauch (geringere „Schonung<br />
von Materialien") sowohl im Sektor Strom als auch im Sektor Wasser, allerdings wird<br />
dies im Sektor Wasser durch geringeren Materialverbrauch für die Netze kompensiert. Die<br />
Abwasserbehandlung in kleinen, dezentralen Anlagen hat positiven Einfluss auf die „Schonung<br />
von Wasser" und „Erhalt von Trinkwasserreservoiren", aber die Gefahr von mehr<br />
„Schadstoffeinträgen in Böden und Wasserquellen".<br />
119
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
5.3.1.2. Einzelbeschreibung<br />
Klimaschutz<br />
Klimaschutz — Reduktion der CO2-Emissionen<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas<br />
Gleiche Rangfolge bei allen Experten<br />
A<br />
B<br />
c<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 20: Mittlere Einschätzung der Experten zur CO 2-Freisetzung, Sektor Strom und Gas (Klimaschutz)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ geringerer Energie- gleich bleibender Ener- - höherer Energie- gleich bleibender Energieverbrauch<br />
gieverbrauch verbrauch verbrauch<br />
++ geringerer Anteil von ++ geringerer Anteil von - höherer Anteil von Braun-<br />
Kohle, mehr Erdgas, Kohle, mehr Erdgas,<br />
kohle<br />
mehr erneuerbare mehr erneuerbare<br />
- geringere Wirkungsgrade<br />
Energien Energien durch mehr ältere Anlagen<br />
Wichtigste Einflussgrößen sind – für alle Experten übereinstimmend – Endenergieverbrauch<br />
und Energiemix zur Stromerzeugung. Demgegenüber sind die Beiträge der Sektoren Wasser<br />
und Information / Telekommunikation zur CO 2-Freisetzung so gering, dass sie nicht nennenswert<br />
zu Unterschieden zwischen den Szenarien beitragen. Daher wird das Kriterium<br />
sektorspezifisch betrachtet. Dabei kommen die Experten im wesentlichen zu übereinstimmenden<br />
Einschätzungen: In den Szenarien A und B wird deutlich weniger CO 2 freigesetzt als<br />
in den Szenarien C und D, weil bei der in A und B vermehrten Verwendung von Erdgas und<br />
erneuerbaren Energien weniger CO 2 anfällt als bei der Gewinnung der gleichen Energie aus<br />
Kohle. Die CO 2-Freisetzung ist in A noch geringer als in B wegen des geringeren Endenergieverbrauchs.<br />
Obwohl der Endenergieverbrauch in C höher ist als in D, wird in D mehr CO2<br />
freigesetzt als in C: Wegen des höheren Anteils von Braunkohle, bei der ein höherer spezifischer<br />
Emissionsfaktor zu berücksichtigen ist, und wegen geringerer Wirkungsgrade durch<br />
den Weiterbetrieb älterer Anlagen.<br />
Die CO 2-Freisetzung ist eines der wenigen Kriterien, für das quantitative Abschätzungen<br />
erstellt wurden. Diese sind in der folgenden Tabelle wiedergegeben.<br />
120
5.3 Ergebnisse<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1. Experte l8 180 (170-190) Mt 187 (180-200) Mt 262 (260-280) Mt 264 (260-280) Mt<br />
2. Experte 215 Mt 226 Mt 337 Mt 349 Mt<br />
3. Experte 194 Mt 203 Mt 274 Mt 288 Mt<br />
Tabelle 20: Ergebnisse der quantitativen Abschätzung der CO 2-Emissionen aus der Stromerzeugung<br />
(Klimaschutz). Werte in Millionen Tonnen (Mt) pro Jahr.<br />
Sektor Wasser<br />
Der Beitrag des Sektors Wasser zur CO 2-Freisetzung ist so gering, dass er nicht nennenswert<br />
zu Unterschieden zwischen den Szenarien beiträgt.<br />
Klimaschutz — Reduktion der Methan - Emissionen<br />
Kategorie A: Gleiche Rangfolge bei allen Experten<br />
Die Methan-Freisetzung wird von allen Experten übereinstimmend als vernachlässigbar<br />
angesehen gegenüber anderen Quellen, insbesondere der Landwirtschaft, die aber außerhalb<br />
des Betrachtungsrahmens der Studie liegen. Daher gibt es innerhalb des Betrachtungsrahmens<br />
hinsichtlich der Freisetzung von Methan keine wesentlichen Unterschiede zwischen<br />
den Szenarien. Im Sektor Strom und Gas, isoliert betrachtet, wird als Haupteinfluss der<br />
Verbrauch an Erdgas gesehen, was zu der Rangfolge D>C>A>B führt. Im Sektor Wasser,<br />
isoliert betrachtet, wird ein höherer Anteil dezentraler Abwasserreinigungsanlagen negativ<br />
gewertet, weil in dezentralen Anlagen (im Gegensatz zu zentralen) das entstehende Methan<br />
nicht aufgefangen wird; das ergibt die Rangfolge D>C>B>A.<br />
Klimaschutz — Reduktion von N 20-Emissionen aus Kläranlagen<br />
Kategorie A: Gleiche Rangfolge bei allen Experten<br />
Die Freisetzung von N 20 aus Kläranlagen wird von allen Experten übereinstimmend als<br />
vernachlässigbar angesehen gegenüber anderen Quellen, insbesondere der Landwirtschaft,<br />
die aber außerhalb des Betrachtungsrahmens der Studie liegen. Daher gibt es innerhalb des<br />
Betrachtungsrahmens hinsichtlich der Freisetzung von Methan und N 20 keine wesentlichen<br />
Unterschiede zwischen den Szenarien.<br />
Ressourcenschonung<br />
Ressourcenschonung — Schonung von Rohstoffen (Brennstoffen)<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas:<br />
Kategorie B.II.1: Geringe beurteilungsbezogene Differenzen<br />
18 Hier sind (im Gegensatz zum Synthesepapier (Anhang, Kapitel A.3)) die Experten bei jedem Kriterium<br />
neu nummeriert, die Nummerierung ist daher weder zwischen den einzelnen Kriterien noch mit<br />
dem Synthesepapier vergleichbar.<br />
121
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100<br />
0,200 0,300<br />
Abbildung 21: Mittlere Einschätzung der Experten zur Schonung der Rohstoffe (Ressourcenschonung)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ geringerer Energieverbrauch<br />
- höherer Energieverbrauch<br />
++ höherer Anteil er- ++ höherer Anteil er- - höherer Anteil von - höherer Anteil von<br />
neuerbarer Energien neuerbarer Energien Kohle Kohle<br />
[- Siedlungsbewegung<br />
aufs Land erfordert<br />
höheren Verbrauch für<br />
Gebäudeheizung und<br />
Verkehr]<br />
[- höherer Verbrauch<br />
von Braunkohle]<br />
[+ Siedlungsbewegung<br />
in Ballungszentren<br />
erfordert geringeren<br />
Verbrauch für Gebäudeheizung<br />
und Verkehr]<br />
Beim Rohstoff- (Brennstoff-) Verbrauch besteht darin Übereinstimmung, dass der in den<br />
Szenarien A und B verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien zu einem geringeren Brennstoffverbrauch<br />
führt als in den Szenarien C und D. Der Brennstoffverbrauch im Wasser- und<br />
Telekommunikationssektor ist demgegenüber unbedeutend19.<br />
Der Brennstoffverbrauch ist wegen des geringeren Endenergieverbrauchs in Szenario A noch<br />
geringer als in B. Wenn man allerdings annimmt (wie einer der Experten), dass der Endenergieverbrauch<br />
in Szenario A wegen der Siedlungsbewegung aufs Land höher ist als in B (d. h.<br />
höher als in der Szenario-Beschreibung angegeben), dann hätte Szenario A einen höheren<br />
Brennstoffverbrauch als B.<br />
Wegen des höheren Endenergieverbrauchs hat Szenario C gegenüber D einen höheren<br />
Brennstoffverbrauch. Weil aber die Braunkohle-Reserven geringer sind als die Steinkohle-<br />
Reserven, ist der in D höhere Verbrauch von Braunkohle kritischer einzuschätzen, daher<br />
wird Szenario D geringfügig schlechter eingeschätzt als C.<br />
Sektor Wasser<br />
Der Beitrag des Sektors Wasser zum Rohstoff- (Brennstoff-) Verbrauch ist so gering, dass er<br />
nicht nennenswert zu Unterschieden zwischen den Szenarien beiträgt.<br />
Ressourcenschonung - Schonung von Materialien<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas:<br />
Gleiche Rangfolge bei allen Experten<br />
19 Die Einschätzung, dass der Rohstoffverbrauch in den Sektoren Wasser und TK gegenüber dem<br />
Sektor Strom unbedeutend ist, basiert allein auf dem unmittelbaren Verbrauch. Der Rohstoffverbrauch<br />
für Herstellung und Entsorgung wurde nicht berücksichtigt.<br />
122
5.3 Ergebnisse<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0200 -0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 22: Mittlere Einschätzung der Experten zur Schonung der Materialien (Ressourcenschonung)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
- kleine Anlagen haben - kleine Anlagen haben + große Anlagen haben + große Anlagen haben<br />
höheren Materialbedarf höheren Materialbedarf weniger Materialbedarf weniger Materialbedarf<br />
als große als große als kleine als kleine<br />
- Wirtschaftswachstum - Wirtschaftswachstum<br />
- Baumaterial für Siedlungsbewegung<br />
aufs<br />
verbrauch<br />
- höherer Energie-<br />
Land<br />
+ Weiternutzung bestehender<br />
Anlagen (auch<br />
Kernkraftwerke) schont<br />
Materialressourcen<br />
Kleine Anlagen, die in den Szenarien A und B einen höheren Anteil haben (Dezentralisierung),<br />
benötigen pro erzeugter Energie mehr Materialeinsatz als große, dagegen spart die<br />
Weiterverwendung bestehender Anlagen (insbesondere in Szenario D) Material ein. Höheres<br />
Wirtschaftswachstum (in Szenarien A und C) führt zu höherem Materialverbrauch. Siedlungen<br />
auf dem Land (in Szenario A) verbrauchen mehr Material als konzentrierte Bebauung in<br />
Städten (Szenario D) oder am Stadtrand (Szenarien B und C).<br />
Sektor Wasser:<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 23: Einschätzung des Experten zur Schonung der Materialien (Ressourcenschonung)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
- Materialbedarf für<br />
dezentrale Anlagen<br />
- Materialbedarf für<br />
dezentrale Anlagen<br />
- Materialbedarf für - Materialbedarf für<br />
Netze<br />
Netze<br />
Nach Einschätzung des Experten heben sich der Mehrbedarf an Material bei den dezentralen<br />
Anlagen, die einen hohen Anteil in Szenarien A und B haben, und die durch dezentrale<br />
Anlagen mögliche Materialeinsparung bei den Netzen in etwa auf.<br />
123
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Ressourcenschonung - Schonung von Fläche<br />
Kategorie B.II.1: Geringe beurteilungsbezogene Differenzen<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 24: Mittlere Einschätzung der Experten zur Schonung von Fläche (Ressourcenschonung)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
-- Siedlungsbewegung - Siedlung am Stadt- - Siedlung am Stadt- ± Konzentration in<br />
aufs Land rand rand Ballungsräumen<br />
(-) Windkraft erfordert (-) Braunkohleabbau (-) Braunkohleabbau<br />
Fläche<br />
Die Experten sehen übereinstimmend die Siedlungsstruktur und die dafür erforderlichen<br />
Verkehrswege als Haupteinflussgröße auf den Flächenverbrauch: Die Siedlungsbewegung<br />
aufs Land in Szenario A hat den höchsten, die Siedlungsbewegung in Ballungsräume in<br />
Szenario D den geringsten Flächenverbrauch. Welche Rolle Windkraftanlagen (höchster<br />
Anteil in Szenario A) und Braunkohletagebaue (höchster Anteil in Szenario D) für den Flächenverbrauch<br />
spielen, wird unterschiedlich eingeschätzt.<br />
Ressourcenschonung - Schonung von Wald<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 25: Mittlere Einschätzung der Experten zur Schonung von Wald (Ressourcenschonung)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
-- Siedlungsbewegung - Siedlung am Stadt- - Siedlung am Stadt- ± Konzentration in<br />
aufs Land rand rand Ballungsräumen<br />
- Braunkohleabbau - Braunkohleabbau<br />
Negativen Einfluss auf die Waldfläche haben die Zersiedelung und die dafür benötigten Verkehrswege,<br />
die in Szenario A am stärksten, in D am geringsten, in B und C mäßig stark sind.<br />
Einen geringeren negativen Einfluss haben Braunkohletagebaue, die in Szenario D am intensivsten<br />
genutzt werden. Diese Einflüsse werden jedoch abgemildert durch bestehende Gesetze,<br />
die den Erhalt oder den Ersatz von Waldflächen fordern.<br />
124
5.3 Ergebnisse<br />
Ressourcenschonung - Schonung von Wasser<br />
Kategorie B.II.1: Geringe beurteilungsbezogene Differenzen<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 26: Mittlere Einschätzung der Experten zur Schonung von Wasser (Ressourcenschonung)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ geringerer Wasserverbrauch<br />
+ höherer Anteil dezentraler<br />
Versickerung<br />
+ geringere Wasserverluste<br />
im Netz durch<br />
dezentrale Anlagen<br />
- höherer Wasserverbrauch<br />
- höhere Wasserverluste<br />
im Netz durch geringere<br />
Investitionen<br />
[+ höherer Anteil dezen- [+ höherer Anteil dezen- [- höherer Anteil zentra- [- höherer Anteil zentratraler<br />
Stromerzeugung traler Stromerzeugung ler Stromerzeugung] ler Stromerzeugung]<br />
und Erneuerbarer und Erneuerbarer<br />
Energien]<br />
Energien]<br />
Wichtige Einflüsse auf die Ressource „Wasser' sind der in den Szenariobeschreibungen angegebene<br />
Wasser-Endverbrauch (am geringsten in A, am größten in C), Wasserverluste im<br />
Netz, und Regenerierung der Wasserressourcen durch dezentrale Versickerung. Ein weiterer<br />
Einfluss könnte der Wasserverbrauch von zentralen Stromerzeugungsanlagen m sein, deren<br />
Anteil in den Szenarien C und D höher ist. (Anm. der Autoren: Da dabei in der Regel Flusswasser<br />
verbraucht wird und staatliche Auflagen die Entnahme nur soweit gestatten, dass der<br />
Mindestwasserpegel des Flusses gewährleistet bleibt, ist fraglich, ob dadurch die Trinkwasserreserven<br />
verringert werden.)<br />
Gewässerschutz<br />
Gewässerschutz - Erhalt von Trinkwasserreservoiren<br />
Kategorie B.II.1: Geringe beurteilungsbezogene Differenzen<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 27: Mittlere Einschätzung der Experten zum Erhalt von Trinkwasserreservoiren (Gewässerschutz)<br />
20 Anm. der Autoren: Bezogen auf eine Kraftwerksleistung von 1000 MW verdunsten in einem Nasskühlturm<br />
je nach Betriebsweise und Witterungsverhältnissen 0,08 bis 0,63 m 3 Wasser pro Sekunde,<br />
das sind rund 7000 bis 54000 m 3 pro Tag. Quelle (2005-04-21):<br />
http://www.bayern.de/Ifw/technik/abwasser/infoblaetter/thermkw_kuehl/wasserverbrauch.htm<br />
125
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ geringerer Wasser- - höherer Wasser- (+) gleicher oder gerinverbrauch<br />
verbrauch gerer Wasserverbrauch<br />
++ viel mehr Grauwasser-<br />
u. Regenwassernutzung<br />
+ mehr Grauwasser- u.<br />
Regenwassernutzung<br />
+ Erhalt von Trinkwas- (-) weniger Trinkwas- - noch weniger Trink- -- viel weniger Trinkser-Schutzgebieten<br />
ser-Schutzgebiete wasser-Schutzgebiete wasser-Schutzgebiete<br />
- Grundwasserabsenkung<br />
für Braunkohletagebaue<br />
- Grundwasserabsenkung<br />
für Braunkohletagebaue<br />
Je höher der Wasserverbrauch (höher in Szenario C, geringer in Szenario A), desto schwieriger<br />
ist der Erhalt von Trinkwasserreservoiren. Grauwasser- und Regenwassernutzung<br />
tragen partiell zu einer notwendigen Schonung bei. Bei dezentraler Wassergewinnung (Szenario<br />
A) werden viele, auch kleine Wasserschutzgebiete erhalten, bei zentraler Wassergewinnung<br />
(Szenarien C, D) werden nur wenige große Wasserschutzgebiete erhalten und viele<br />
kleine aufgegeben, zum Teil unwiederbringlich. Ein Abbau von Regelungen und Überwachung<br />
durch den Staat kann zu Lockerung der Auflagen in Wasserschutzzonen führen, mit<br />
potentiell negativem Einfluss auf den Erhalt von Trinkwasserreservoiren (Szenarien C, D).<br />
Staatlicher Schutz von Umwelt wirkt sich positiv auf den Gewässerschutz und damit auf<br />
Grund- und Oberflächenwasser zur Trinkwassernutzung aus, dies führt zur Abwertung von<br />
Szenario C und D. Außerdem beeinträchtigen Grundwasserabsenkungen für Braunkohletagebaue<br />
(Szenarien C, D) die Trinkwasserreservoire.<br />
Gewässerschutz – Vermeidung von Schadstoffeinträgen in Wasserquellen<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas:<br />
Kategorie B.II.2: Beurteilungsbezogene Differenzen, unterschiedliche Wichtigkeit der Einflussfaktoren<br />
1. Exp 21 .: A=B>C=D, Urteilssicherheit 3<br />
2. Exp.: A>B>C=D, Urteilssicherheit 1<br />
3. Exp.: D>C=B>A, Urteilssicherheit 3<br />
A<br />
- 200<br />
e.,<br />
N.,<br />
o<br />
M<br />
3<br />
I<br />
.0, M<br />
-0,100 0,000 0 100 0,200 0,300<br />
Abbildung 28: Mittlere Einschätzung der Experten zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in Wasserquellen,<br />
Sektor Strom u. Gas (Gewässerschutz)<br />
21 Hier sind (im Gegensatz zum Synthesepapier) die Experten bei jedem Kriterium neu nummeriert,<br />
die Nummerierung ist daher weder zwischen den einzelnen Kriterien noch mit dem Synthesepapier<br />
vergleichbar.<br />
126
5.3 Ergebnisse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1. Ex- - höherer Anteil von - höherer Anteil von<br />
perte Strom aus Kohle und Strom aus Kohle und<br />
Kernenergie<br />
Kernenergie<br />
2. Ex- ++ hohes Bewusst- + mäßig hohes - wenig Bewusstsein - kaum Bewusstsein<br />
perte sein für Gesundheit Bewusstsein für für Gesundheit für Gesundheit<br />
Gesundheit<br />
3. Ex- - Nitrat und Phos- - Nitrat und Phos- - viel Kohleabbau und - viel Kohleabbau und<br />
perte phat aus Anbau phat aus Anbau Kohlekraftwerke Kohlekraftwerke<br />
nachwachsender nachwachsender<br />
Energieträger Energieträger<br />
-- Zersiedelung - Zersiedelung - Zersiedelung<br />
Bei der Einschätzung von Schadstoffeinträgen in Wasserquellen aus dem Sektor Strom<br />
werden unterschiedliche Einflussgrößen als wichtig angesehen, die zu unterschiedlichen<br />
Einschätzungen führen. Eine eindeutige Rangfolge ist nicht feststellbar.<br />
Der 1. Experte betrachtet als Quellen für Schadstoffeinträge klassische Schadstoffe (z. B.<br />
SO 2) und radioaktive Stoffe aus der Abluft von Kernkraftwerken und schätzt daher die Szenarien<br />
C und D mit höherem Anteil von Strom aus Kohle und Kernenergie schlechter ein.<br />
Für den 2. Experten ist das Gesundheitsbewusstsein, das in Szenario A besonders hoch,<br />
dagegen in C und D gering ist, ausschlaggebend für Maßnahmen zur Reduzierung von<br />
Schadstoffeinträgen.<br />
Der 3. Experte sieht Quellen für Schadstoffeinträge in den Emissionen aus Kohleabbau,<br />
Kohlehalden und Kohlekraftwerken, die in Szenarien C und D verstärkt zu erwarten sind, in<br />
Ausschwemmungen von Nitrat und Phosphat aus dem Anbau nachwachsender Energieträger,<br />
die in A und B einen höheren Anteil haben, sowie in Verkehrsunfällen mit Ölaustritt und<br />
in Undichtigkeiten im Abwassernetz, die in Szenario A wegen der dezentralen Siedlungsstruktur<br />
in größerem Umfang zu erwarten sind.<br />
Sektor Wasser:<br />
Kategorie B.II.2: Beurteilungsbezogene Differenzen, unterschiedliche Wichtigkeit der Einflussfaktoren<br />
4. Exp.: A>B>C>D, Urteilssicherheit 4<br />
5. Exp. ((Schwer-)Metalle): B=C>D>A, Urteilssicherheit 4<br />
5. Exp. (Nitrat): A=B>C=D, Urteilssicherheit 4<br />
A<br />
• E<br />
-0200<br />
-0,100 0,000 0,100 0 200 0,300<br />
Abbildung 29: Mittlere Einschätzung der Experten zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in Wasserquellen,<br />
Sektor Wasser (Gewässerschutz)<br />
127
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
4. Ex- ++ weniger Misch- und + etwas weniger Misch- ++ zentrale + zentrale Anlagen<br />
perte Regenwassereinleitung und Regenwassereinlei- Anlagen reinigen das Abwasser<br />
in Gewässer wegen tung in Gewässer we- reinigen das besser, aber weniger<br />
dezentraler Versicke- gen dezentraler Versi- Abwasser gute Überwachung<br />
rung<br />
++ weniger Schmutzckerung<br />
+ etwas weniger<br />
besser, außerdem<br />
bessere<br />
wasseraustritt aus<br />
undichten Kanälen<br />
wegen geringerer<br />
Netzlänge durch dezentrale<br />
Anlagen<br />
Schmutzwasseraustritt<br />
aus undichten Kanälen<br />
wegen geringerer Netzlänge<br />
durch dezentrale<br />
Anlagen<br />
Überwachung<br />
5. Ex- -- dezentrale Abwas- - der Staat zieht sich<br />
perte seranlagen sind aus der Überwachung<br />
(Schwer<br />
metalle)<br />
schlechter überwacht,<br />
daher fließen aus ihnen<br />
mehr Schadstoffe ab<br />
5. Ex- + mehr Umweltbe- + mehr Umweltbewusstperte<br />
wusstsein führt zu ge- sein führt zu geringerer<br />
(Nitrat) ringerer Nitratbelastung Nitratbelastung<br />
zurück, daher fließen<br />
aus Abwasseranlagen<br />
mehr Schadstoffe ab<br />
Bei der Einschätzung von Schadstoffeinträgen in Wasserquellen aus dem Sektor Wasser<br />
werden unterschiedliche Einflussgrößen als wichtig angesehen, die zu unterschiedlichen<br />
Einschätzungen führen. Eine eindeutige Rangfolge ist nicht feststellbar.<br />
4. Experte: »Wesentliche Eintragspfade für Verschmutzungen aus dem Sektor Wasser sind:<br />
(1) Abläufe von Kläranlagen, (2) Mischwasserabschläge und Regenwassereinleitungen aus<br />
urbanen Gebieten und (3) Infiltration von Abwasser in Grundwasser bei undichten Kanälen.<br />
[1] Bei zentralen Kläranlagen erfolgt in der Regel eine Einleitung in Oberflächengewässer.<br />
[...] Zentrale Anlagen werden gut überwacht und arbeiten relativ stabil und sicher. Dezentrale<br />
kleine Kläranlagen werden nicht anhand der Ablaufwerte kontrolliert, sondern es wird eine<br />
sog Einhaltefiktion definiert, die sich an der Bauartzulassung der Anlage und einer regelmäßigen<br />
Wartung orientiert. Für den Vergleich wird unterstellt, dass bis 2025 nur noch Anlagen<br />
existieren, die o.g. Anforderungen erfüllen. Dann wird die Reinigungsleistung bei Einleitung<br />
in ein Oberflächengewässer nur leicht schlechter sein als bei einer zentralen Anlage. Staatlicher<br />
Schutz von Umwelt wirkt sich positiv auf Gewässerschutz aus, führt zur Abwertung von<br />
C und D. [...] [2] Mischwasserabschläge stellen in vielen Gebieten heute schon den Haupteintragspfad<br />
in Oberflächengewässer dar. Bei einem Trennsystem, vor allem aber bei Regenwasserversickerung<br />
können die Belastungen für die Oberflächengewässer verringert<br />
werden. Eine Zunahme an Dezentralisierung, die einher geht mit einer dezentralen Versickerung<br />
und einer Reduktion von Kanallängen (geringer Infiltration) wird die Belastung aus<br />
Misch und Regenwasser verringern. Aufmerksamkeit muss der Bodenbelastung bei Versickerung<br />
geschenkt werden. Dies wird unter dem Punkt Bodenschutz bewertet. [3] Je geringer<br />
die Länge der Kanäle, desto weniger Abwasser kann ins Grundwasser austreten.«<br />
Der 5. Experte differenziert zwischen Schwermetall-Einträgen und Nitrat-Einträgen. »Cadmium,<br />
Katalysatormetalle aus diffusen Quellen wie Verkehr, privaten Haushalten einschließlich<br />
Schlammnutzung in der Landwirtschaft sind Hauptkomponenten, die die Probleme von<br />
Schadstoffeinträgen in Wasserquellen ausmachen. Bestimmende Größe für die Einschätzung<br />
der Szenarien ist der Anteil dezentraler Anlagen, denn es wird davon ausgegangen,<br />
128
5.3 Ergebnisse<br />
dass dezentrale Anlagen schlechter als zentrale überwacht werden. Daher ist Szenario A mit<br />
einem besonders hohen Anteil mit der schlechtesten Bewertung versehen und Szenario D<br />
mit der zweitschlechtesten, weil in diesem Szenario der Staat sich zurück zieht, also auch<br />
keine Kontrollaufgaben wahrnimmt. In den Szenarien A und B werden dagegen Kontrollaufgaben<br />
im gegenwärtigen Umfang durchgeführt.«<br />
In den Szenarien A und B sei mit geringeren Nitrat-Einträgen zu rechnen als in C und D.<br />
»Begründet wird dies mit dem hohen Umweltbewusstsein der Bevölkerung bzw. den staatlichen<br />
Umweltschutzaktivitäten in den Szenarien A und B im Gegensatz zu den Szenarien C<br />
und D. Als Hauptemissionsquellen werden die Landwirtschaft sowie bestehende Rückhaltungen<br />
im Boden gesehen.«<br />
Bodenschutz<br />
Bodenschutz — Vermeidung von Bodenbelastung durch Unfälle in EVUs<br />
Das Kriterium betrifft nur den Sektor Strom und Gas.<br />
Kategorie A: Gleiche Rangfo ge bei allen Experten<br />
B<br />
c<br />
1<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 30: Mittlere Einschätzung der Experten zur Vermeidung von Bodenbelastung durch Unfälle<br />
in EVUs (Bodenschutz)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
- Anteil Kernenergie - Anteil Kernenergie<br />
[(-) höherer Gesamtstromverbrauch]<br />
Die Experten sind sich einig darüber, dass hier der Anteil der Kernenergie bestimmend ist,<br />
der in Szenarien A und B gleich Null ist und in Szenario D genauso groß wie in Szenario C.<br />
Der 2. Experte sieht zusätzlich Szenario D »etwas besser« als C wegen des in C höheren<br />
Stromverbrauchs (und daher auch mehr Strom aus Kernenergie). Der Unterschied im Stromverbrauch<br />
ist aber nur gering.<br />
Bodenschutz – Deponieraum für radioaktive und toxische Abfälle<br />
Es wurden nur Einschätzungen für den Sektor Strom und Gas abgegeben.<br />
Kategorie A: Gleiche Rangfolge bei allen Experten<br />
B<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 31: Mittlere Einschätzung der Experten zur Vermeidung von Deponieraum für radioaktive<br />
und toxische Abfälle (Bodenschutz)<br />
129
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
- Anteil Kernenergie - Anteil Kernenergie<br />
[(-) höherer Gesamtstromverbrauch]<br />
Die Experten sind sich einig darüber, dass hier der Anteil der Kernenergie bestimmend ist,<br />
der in Szenarien A und B gleich Null ist und in Szenario D genauso groß wie in Szenario C.<br />
Ein Experte sieht zusätzlich Szenario D »etwas besser« als C wegen des in C höheren<br />
Stromverbrauchs (und daher auch mehr Strom aus Kernenergie). Der Unterschied im Stromverbrauch<br />
ist aber nur gering. Der erste Experte relativiert den Unterschied: »In allen Szenarien<br />
wird durch den Abriss der Kernkraftwerke Deponieraum für radioaktive Stoffe benötigt.<br />
Dieser Bedarf ist durch den Weiterbetrieb der bestehenden Kernkraftwerke in den Szenarien<br />
C und D nur leicht höher.«<br />
Bodenschutz – Vermeidung von langfristigen Schadstoffakkumulationen<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas:<br />
Kategorie B.II.1: Geringe beurteilungsbezogene Differenzen<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 32: Mittlere Einschätzung der Experten zur Vermeidung von langfristigen Schadstoffakkumulationen<br />
aus dem Sektor Strom und Gas (Bodenschutz)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
(-) Anbau nachwach- (-) Anbau nachwach- - Kohleabbau und - Kohleabbau und<br />
sender Energieträger sender Energieträger Kohlekraftwerke Kohlekraftwerke<br />
++ hohes Bewusstsein + mäßig hohes Be- (-) kaum Bewusstsein<br />
für Gesundheit<br />
wusstsein für Gesundheit<br />
für Gesundheit<br />
Wichtige Quellen für Schadstoffeinträge sind klassische Schadstoffe (z. B. SO 2 ) und radioaktive<br />
Stoffe aus der Abluft von Kernkraftwerken, daher werden die Szenarien C und D mit<br />
höherem Anteil von Strom aus Kohle und Kernenergie schlechter eingeschätzt. Zwar könnte<br />
ein höheres Gesundheitsbewusstsein politischen Druck erzeugen, um durch technische<br />
Maßnahmen die Schadstoffemissionen zu reduzieren, das Gesundheitsbewusstsein ist<br />
jedoch gerade in den Szenarien C und D gering. Der Anbau nachwachsender Energieträger,<br />
die in A und B einen höheren Anteil haben, könnte die Schadstoffakkumulationen im Boden<br />
erhöhen, dieser Einfluss wird jedoch als geringer gesehen als der Einfluss der klassischen<br />
Schadstoffe.<br />
130
5.3 Ergebnisse<br />
Sektor Wasser:<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 33: Einschätzung des Experten zur Vermeidung von langfristigen Schadstoffakkumulationen<br />
aus dem Sektor Wasser (Bodenschutz)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
- mehr Emissionen aus<br />
Klärschlammverbrennung<br />
- Schadstoffeinträge - Schadstoffeinträge aufgrund geringerer<br />
aus dezentraler Re- aus dezentraler Re- staatlicher Auflagen<br />
genwasserversickerung genwasserversickerung<br />
Zitat aus dem Gutachten: »Es wird davon ausgegangen, dass bis 2025 die Verbrennung von<br />
Klärschlamm und die Einhaltung strenger Regeln für die Abluftbehandlung die Regel ist. Bei<br />
zentraler Entsorgung ist die Bodenbelastung aus diesem Kompartiment dann nicht weiter bedeutend.<br />
Sollten Umweltauflagen reduziert werden (D) wird Belastung aus Abluft ansteigen.<br />
Dezentral entstehender Klärschlamm ist in der Regel problemlos aus Sicht des Bodenschutzes<br />
landwirtschaftlich verwertbar.« »Die Gefahr einer langfristigen Bodenbelastung bei der<br />
Regenwasserversickerung ist unklar. Es gibt kaum Langzeiterfahrungen. Die Unsicherheit ist<br />
entsprechend groß.«<br />
Bodenschutz - Vermeidung der Übernutzung landwirtschaftlicher Flächen<br />
Kategorie B.lI.5: Beurteilungsbezogene Differenzen bei hoher Unsicherheit eines der Experten<br />
1. Exp.: C=D=A=B, Urteilssicherheit 3<br />
2. Exp.: A>B>C=D, Urteilssicherheit 1<br />
3. Exp.: C=D>A=B (aber nur geringer Unterschied), Urteilssicherheit 3<br />
B<br />
D<br />
e›•<br />
4<br />
-0,200 -0.100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 34: Mittlere Einschätzung der Experten zur Vermeidung der Übernutzung landwirtschaftlicher<br />
Flächen (Bodenschutz)<br />
131
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1. Experte<br />
2. Experte<br />
3. Experte<br />
Unterschiede sind nicht in den Szenariobeschreibungen enthalten bzw. schlüssig aus diesen<br />
ableitbar<br />
++ hohes Bewusstsein für<br />
Gesundheit<br />
- mehr Anbau nachwachsender<br />
Energieträger<br />
+ mäßig hohes Bewusstsein<br />
für Gesundheit<br />
- mehr Anbau nachwachsender<br />
Energieträger<br />
Während der 1. Experte bei der Übernutzung landwirtschaftlicher Flächen keinen Unterschied<br />
zwischen den Szenarien sieht, begründet der 2. Experte den Unterschied mit dem<br />
besonders in Szenario A höheren Gesundheitsbewusstsein, gibt aber eine hohe Unsicherheit<br />
an. Der 3. Experte sieht einen geringen Unterschied auf Grund des in A und B vermehrten<br />
Anbaus nachwachsender Energieträger. Als aggregierte Einschätzung ergibt sich fast eine<br />
Gleichbewertung aller 4 Szenarien, weil sich die Einschätzungen von Experte 2 und 3 gegenseitig<br />
nahezu aufheben. Obwohl die Einschätzungen in Kategorie B.II.5 fallen (Experte 2<br />
hat eine hohe Unsicherheit angegeben), erscheint es nicht angemessen, die Einschätzung<br />
von Experte 2 zu ignorieren, weil auch Experte 3 dahingehend argumentiert, dass die tatsächlichen<br />
Auswirkungen eines verstärkten Anbaus nachwachsender Energieträger erheblich<br />
vom Ausmaß der Verwendung von Düngemitteln und Pestiziden abhängen, und so die<br />
Einschätzung von Experte 2 als Ergänzung der Einschätzung von Experte 3 erscheint.<br />
Artenschutz<br />
Artenschutz — Schutz der Flora<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
A<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 35: Mittlere Einschätzung der Experten zum Schutz der Flora (Artenschutz)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
-- Zersiedelung - Zersiedelung - Zersiedelung<br />
- Gewinnung von - Gewinnung von - Braunkohle-Tagebaue -- Braunkohle-Tagebaue und<br />
Biomasse Biomasse schlechte Renaturierung<br />
Während ein Experte keinen Unterschied zwischen den Szenarien sieht, erfolgt nach Einschätzung<br />
des 2. Experten »der Schutz der Flora vor allem über den Schutz von Flächen,<br />
die Pflanzen Lebensraum bieten. Ursache für den Artenschwund sind vor allem die direkte<br />
Zerstörung und mechanische Schädigung sowie die Verinselung und Zerschneidung der<br />
Lebensräume, insbesondere durch den Städtebau, den Bau von Verkehrswegen und den<br />
Abbau von Rohstoffen. Den wichtigsten Einfluss auf den Schutz der Flora hat daher die Form<br />
der Siedlungsentwicklung inklusive ihrer dazu erforderlichen Infrastruktur. Dabei hat die<br />
Zunahme der Wohnbebauung im ländlichen Raum mit dem parallel erfolgenden Ausbau der<br />
132
5.3 Ergebnisse<br />
Verkehrsinfrastruktur (Szenario A) die negativsten Auswirkungen, da sie in einem größeren<br />
Umfang Lebensräume für die Flora beeinträchtigt, zerschneidet oder zerstört. [...] Die Gewinnung<br />
der Rohstoffe zur Energiegewinnung kann ebenfalls zu Auswirkungen auf das<br />
Schutzgut Flora führen. Die Gewinnung der Braunkohle im Tagebau führt hierbei zu den<br />
weitreichendsten Beeinträchtigungen und zur Umwandlung von ganzen Landschaften. Deshalb<br />
werden die Szenarien C und D mit einem jeweiligen Kohleanteil an den Energieträgern<br />
von 52% eine viel größere Flächeninanspruchnahme im Verhältnis zu den Szenarien A und<br />
B mit einem Kohleanteil von nur 24% bewirken. Bei Szenario A wird zudem die Renaturierung<br />
der Bergbaufolgenlandschaft für die Flora aufgrund der ökologischen Einstellung der<br />
Bevölkerung und der Administration und des starken Ordnungsrechtes zu den positivsten<br />
Ergebnissen im Vergleich der vier Szenarien gelangen. Etwas schlechter werden die Renaturierungsmaßnahmen<br />
im Szenario B durchgeführt werden, da dort die Renaturierungsmaßnahmen<br />
nur gestützt auf eine starke Administration und das starke Ordnungsrecht durchgeführt<br />
wird, während die Unterstützung durch die Bevölkerung und damit der gesellschaftliche<br />
Druck weitgehend fehlen. Bei Szenario C wird aufgrund der moderaten Umweltziele der<br />
Politik und des geringen Interesses der Bevölkerung eine weit weniger ambitioniertere Umsetzung<br />
der Renaturierungsmaßnahmen zu erwarten sein. Bei Szenario D spielen Renaturierungsmaßnahmen<br />
aufgrund der starken Orientierung auf wirtschaftliche Aspekte und eines<br />
weitgehend fehlenden Umweltbewusstseins nur eine sehr untergeordnete Bedeutung und<br />
werden vermutlich zu großen Teilen gar nicht durchgeführt. [...] Insgesamt erscheinen durch<br />
die Nutzung von Biomasse einerseits leicht positive Auswirkungen auf die Flora durch die<br />
Nutzung von Landschaftspflegematerial und andererseits jedoch auch schwerer wiegende<br />
negative Auswirkungen durch die leichte Ausweitung der Ackernutzung und die negativen<br />
Auswirkungen auf die Waldlebensräume für Pflanzen und Tiere zu erwarten sein. Da aufgrund<br />
der geringen Angaben nicht beurteilt werden kann, inwieweit der politische und ökonomische<br />
Rahmen bestimmte Formen der Biomassegewinnung über das hier angenommene<br />
Maß hinaus forciert, wird hier angenommen, dass die negativen Auswirkungen ungefähr<br />
doppelt so schwer wiegen als die positiven.« Der 3. Experte hat in der Delphi-Runde die<br />
Einschätzung des 2. Experten übernommen.<br />
Artenschutz – Schutz der Fauna und Schutz von Habitaten<br />
(Diese beiden Kriterien wurden exakt gleich eingeschätzt.)<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
A -E<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 36: Mittlere Einschätzung der Experten zum Schutz der Fauna und Schutz von Habitaten<br />
(Artenschutz)<br />
133
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
-- Zersiedelung - Zersiedelung - Zersiedelung<br />
- Gewinnung von - Gewinnung von -- Braunkohle- -- Braunkohle-Tage-<br />
Biomasse Biomasse Tagebaue baue und schlechte<br />
- Windenergieanlagen - Windenergieanlagen Renaturierung<br />
Während ein Experte keine Unterschiede zwischen den Szenarien feststellt, sind in der<br />
Einschätzung des 2. Experten zunächst die gleichen Einflussfaktoren entscheidend wie bei<br />
der Einschätzung des Kriteriums „Schutz der Flora", die im vorigen Abschnitt beschrieben<br />
wurde. Bei Fauna und Habitaten werden zusätzlich die Windenergieanlagen als negativer<br />
Einfluss genannt: »[...] können Windenergieanlagen insbesondere durch die Scheuchwirkung<br />
der Rotorblätter und der Betriebsgeräusche umfangreiche negative Auswirkungen auf<br />
die Vogelwelt, insbesondere die Zug- und Rastvögel haben. [...] Für die Einschätzung der<br />
Szenarien wird [...] davon ausgegangen, dass von Offshore und Onshore Windenergieanlagen<br />
in der Summe vermutlich gleich schwere Beeinträchtigungen für die Fauna ausgehen<br />
werden. Es wird im Rahmen der Beurteilung der Szenarien daher nur zwischen denjenigen<br />
mit einem hohen Anteil von Anlagen auf Basis erneuerbarer Energien mit einem entsprechenden<br />
Anteil Windenergie von je 30% (Szenarien A und B) und denjenigen mit einem<br />
geringen Anteil von je 10% (Szenarien C und D) unterschieden.« Der 3. Experte hat in der<br />
Delphi-Runde die Einschätzung des 2. Experten übernommen.<br />
Landschaftsschutz<br />
Landschaftsschutz - Vermeidung von Eingriffen in das Landschaftsbild<br />
Kategorie B.lI.2: Beurteilungsbezogene Differenzen, unterschiedliche Wichtigkeit der Einflussfaktoren<br />
1. u. 2. Exp.: D>C>B>A, Urteilssicherheit 3, 3<br />
3. Exp.: B>D>C=A, Urteilssicherheit 4<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 37: Einschätzungen der Experten zur Vermeidung von Eingriffen in die Landschaft (Landschaftsschutz)<br />
134
5.3 Ergebnisse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1. Experte<br />
-- Zersiedelung<br />
-- Windkraftanlagen<br />
- Zersiedelung<br />
-- Windkraftanlagen<br />
- Zersiedelung<br />
2. Experte<br />
- Windkraftanlagen<br />
(+) weniger Stromleitungen<br />
durch dezentrale<br />
Erzeugung<br />
- Windkraftanlagen (-) Windkraftanlagen<br />
3. Experte<br />
Zersiedelung - Zersiedelung - Zersiedelung<br />
-- Braunkohletagebaue<br />
-- Braunkohletagebaue<br />
Die Experten sind sich einig darin, dass Zersiedelung, Windkraftanlagen und Braunkohletagebaue<br />
das Landschaftsbild stören, jedoch schätzt jeder der Experten einen anderen dieser<br />
Faktoren als geringfügig ein. Die Zersiedelung betrifft besonders stark Szenario A, mäßig B<br />
und C, und gering D. Windkraftanlagen betreffen die Szenarien A und B. Braunkohletagebaue<br />
werden vor allem in den Szenarien D und C genutzt.<br />
Landschaftsschutz - Schaffung und Erhaltung von Erholungsgebieten<br />
Kategorie B.II.2: Beurteilungsbezogene Differenzen, unterschiedliche Wichtigkeit der Einflussfaktoren<br />
1. Exp.: A=B=C=D, Urteilssicherheit 3<br />
2. Exp.: B>D=C=A, Urteilssicherheit 1<br />
3. Exp.: B=D>C>A, Urteilssicherheit 4<br />
A<br />
-0 . 200 -0100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 38: Mittlere Einschätzung der Experten zur Schaffung und Erhaltung von Erholungsgebieten<br />
(Landschaftsschutz)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1. Experte<br />
Hinweise sind nicht in den Szenariobeschreibungen enthalten, die erkennen lassen, dass<br />
Unterschiede existieren<br />
2. Experte<br />
-- Zersiedelung<br />
- Zersiedelung<br />
- Zersiedelung<br />
+ Gesundheitsbewusstsein<br />
+ Gesundheitsbewusstsein<br />
- Gesundheitsbewusstsein<br />
3. Experte<br />
-- Zersiedelung - Zersiedelung - Zersiedelung<br />
- Braunkohleabbau - Braunkohleabbau<br />
Ein Experte hat keine Unterschiede zwischen den Szenarien festgestellt. Der anderen Experten<br />
stimmen überein, dass die Siedlungsstruktur einen hohen Einfluss auf den Erhalt von<br />
Erholungsgebieten hat. Dieser wird aus Sicht des 2. Experten durch den gegenläufigen<br />
Einfluss des Gesundheitsbewusstseins weitgehend kompensiert, so dass nur ein leichter<br />
Vorteil für Szenario B verbleibt. In der Einschätzung des 3. Experten spielt neben der Sied-<br />
135
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
lungsstruktur der Braunkohleabbau eine wesentliche Rolle, wobei diese beiden Einflüsse in<br />
den Szenarien B und D gegenläufig sind, so dass B und D gleich eingeschätzt werden.<br />
5.3.2 Gesundheitsschutz<br />
5.3.2.1. Zusammenfassung<br />
Im Gutachten zu gesundheitlichen Auswirkungen wird unter anderem begründet, warum es<br />
schwierig ist, separate Einschätzungen für Beeinträchtigungen, Erkrankungen und Todesfälle<br />
anzugeben: »Beeinträchtigungen, Erkrankungen und Todesfälle korrelieren positiv miteinander;<br />
unterschiedlich ist bei gleicher Dosis (=Expositionshöhe x Einwirkungsdauer) nur die<br />
Zahl der Betroffenen: viele werden beeinträchtigt, einige erkranken und wenige sterben.<br />
Durchbrochen wird dieser Grundsatz bei niedriger Expositionshöhe, wenn die für jeden der<br />
genannten Effekte unterschiedlich hoch liegende Wirkungsschwelle nicht erreicht wird. Dann<br />
gilt die Regel: Beeinträchtigung vor Erkrankung vor Todesfall. Ein weiterer Sonderfall sind die<br />
krebserzeugenden Stoffe, für die es nach heutigem Wissenschaftlerkonsens keine Wirkungsschwelle<br />
gibt. Bei diesen Stoffen tritt die Wirkung schon bei geringsten Expositionshöhen,<br />
aber sehr verzögert auf (Krebslatenz), so dass der Erkrankung keine Beeinträchtigungen<br />
vorgeschaltet sind. Bei schwer heilbaren Krebsen wie Lungen- und Leberkrebs sind die<br />
Erkrankungsfälle mit den Sterbefällen zahlenmäßig gleichzusetzen. Ansonsten gilt auch hier,<br />
dass es bei gegebener Expositionshöhe mehr Erkrankte als zusätzliche Tote gibt.«<br />
Aus diesen Gründen werden die Einschätzungen für den gesamten Komplex gesundheitlicher<br />
Wirkungen, d. h. für Beeinträchtigungen, Erkrankungen und Todesfälle, gemeinsam<br />
angegeben.<br />
Stärken und Schwächen der Szenarien<br />
Stärken von Szenario A sind der Schutz vor Luftimmissionen und vor radioaktiver Strahlung,<br />
dies sind Schwächen der Szenarien C und D. Der „Schutz vor Belastung des Trinkwassers"<br />
wird in den Szenarien A und C als mäßige Schwäche, in B als Stärke gesehen. Die Szenarien<br />
C und D haben im Gesundheitsschutz keine Stärken.<br />
Wesentliche Einflussfaktoren<br />
Haupteinfluss auf Gesundheitseffekte, und zwar infolge von Luftimmissionen, hat die Menge<br />
der zur Energieerzeugung verbrannten Kohle. Der Anteil der Steinkohle führt außerdem noch<br />
zu radioaktiver Belastung. Dezentrale Anlagen zur Abwasserbehandlung und Wasseraufbereitung<br />
können die bakterielle Belastung von Roh- und Trinkwasser beeinflussen, aber sowohl<br />
positiv als auch negativ, so dass dieser Einfluss nicht eindeutig eingeschätzt werden<br />
kann.<br />
136
5.3 Ergebnisse<br />
5.3.2.2. Einzelbeschreibungen<br />
Schutz vor Mortalität, Morbidität und Beeinträchtigungen durch Belastung des<br />
Roh- oder Trinkwassers<br />
Es wurden nur Einschätzungen für den Sektor Wasser abgegeben.<br />
Kategorie B.Ib: Sachbezogene Differenzen in der Einschätzung eines Experten<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0200 -0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 39: Einschätzung des Experten zu Schutz vor Mortalität, Morbidität und Beeinträchtigungen<br />
durch Belastung des Roh- oder Trinkwassers<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
- schlechtere Kontrolle bei - weniger Erneuerung und<br />
dezentralen Anlagen<br />
Pflege der Anlagen wegen<br />
ungünstiger Finanzierungsbedingungen<br />
-- hoher Anteil Regen- und - mäßiger Anteil Regen- und<br />
Grauwassernutzung<br />
Grauwassernutzung<br />
++ starke Nutzung der + mäßige Nutzung der<br />
Membrantechnik<br />
Membrantechnik<br />
Bakterielle Belastungen des Rohwassers können auftreten, wenn Abwasseranlagen ungenügend<br />
überwacht oder gepflegt werden, bakterielle Belastungen des Trinkwassers, wenn ungenügend<br />
gereinigtes Regenwasser oder Grauwasser verwendet wird.<br />
Der 2. Experte gibt keine Gesamteinschätzung für das Kriterium an, weil er zwei gegenläufige<br />
Einflüsse sieht und nicht sicher ist, welcher Einfluss stärker ist.<br />
Der 1. Experte wertet Szenario A ab wegen des höheren Anteils dezentraler Anlagen; mit<br />
dem gleichen Argument müsste dann aber auch Szenario D abgewertet werden, denn darin<br />
ist der Anteil dezentraler Anlagen ähnlich hoch wie in A. Er wertet Szenario C ab, weil wegen<br />
ungünstiger Finanzierungsbedingungen weniger Erneuerung und Pflege der Anlagen stattfinde.<br />
Mit einem ähnlichen Argument könnte aber auch Szenario D abgewertet werden, denn<br />
dort könnte die Erneuerung und Pflege der Anlagen wegen geringen Interesses an Umweltund<br />
Gesundheitsschutz und geringen Wirtschaftswachstums vernachlässigt werden.<br />
Insgesamt ist die Einschätzung dieses Kriteriums sehr unsicher.<br />
Schutz vor Mortalität, Morbidität und Beeinträchtigungen durch radioaktive<br />
Strahlung<br />
Es wurden nur Einschätzungen für den Sektor Strom und Gas abgegeben.<br />
(nur 1 Experte)<br />
137
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 40: Einschätzung des Experten zu Mortalität, Morbidität und Beeinträchtigungen durch<br />
radioaktive Strahlung<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ keine Kernenergienutzung<br />
+ keine Kernenergienutzung<br />
+ Anteil von Steinkohle (+) Anteil von Steinkohle - Anteil von Steinkohle (-) Anteil von Steinkohle<br />
14% 16% 30% 22%<br />
Wesentliche Quellen für radioaktive Strahlenbelastung aus dem Sektor Strom und Gas sind<br />
zum einen die Kernenergienutzung, zum anderen die Steinkohleverbrennung. Diese Strahlenbelastung<br />
aus dem Sektor Strom und Gas ist aber gering gegenüber anderen Quellen,<br />
wie z. B. der natürlichen Strahlenbelastung und der Strahlenbelastung durch medizinische<br />
Anwendungen, so dass die Reduktion des zivilisatorisch bedingten Krebsrisikos für die Szenarien<br />
A und B auf etwa 10%, in D auf 5% und in C auf 4% eingeschätzt wird.<br />
Schutz vor Mortalität, Morbidität und Beeinträchtigungen durch Luftimmissionen<br />
Es wurden nur Einschätzungen für den Sektor Strom und Gas abgegeben.<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0200 -0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 41: Einschätzung des Experten zu Mortalität, Morbidität und Beeinträchtigungen durch<br />
Luftimmissionen<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ geringerer Anteil von + geringerer Anteil von - höherer Anteil von - höherer Anteil von<br />
Kohle an der Stromer- Kohle an der Stromer- Kohle an der Stromer- Kohle an der Stromerzeugung<br />
zeugung zeugung zeugung<br />
(-) höherer Anteil von (-) höherer Anteil von<br />
Braunkohle als in B<br />
Braunkohle als in C<br />
Die Einschätzung der durch Luftimmissionen verursachten Gesundheitseffekte erfolgte in<br />
zwei separaten Gutachten.<br />
Im ersten Gutachten wurden für die vier Szenarien die Emissionen eingeschätzt und die<br />
daraus resultierenden orts- und zeitabhängigen Immissionen angegeben. Dazu wurden die<br />
138
5.3 Ergebnisse<br />
vier Zukunftsszenarien A B C und D verglichen mit Szenarien des EMEP-Programms 22 , für<br />
die bereits Immissionsrechnungen vorlagen. Dieser Vergleich ergab, dass eines der EMEP-<br />
Szenarien den Emissionen in den Szenarien A und B, ein anderes den Szenarien C und D<br />
entspricht, jedoch weder zwischen den Szenarien A und B noch zwischen den Szenarien C<br />
und D differenziert werden kann. Die Emissionen in A und B betragen etwa 75% der Emissionen<br />
in C und D. Bei der absoluten Höhe der Emissionen sind die Emissionen aus allen<br />
Sektoren berücksichtigt, für die Unterschiede zwischen den Szenarien aber nur die Unterschiede<br />
der Emissionen aus Großfeuerungsanlagen (Sektor Strom und Gas).<br />
Im zweiten Gutachten wurden aus den Ergebnissen des ersten Gutachtens (orts- und zeitabhängige<br />
Immissionen) die Gesundheitseffekte abgeschätzt. In der Tendenz müsste der in<br />
A gegenüber B und in D gegenüber C höhere Anteil von Braunkohle an der Stromerzeugung<br />
einen negativen Einfluss auf die Gesundheitseffekte haben, wie in der Tabelle der Einflussfaktoren<br />
angegeben ist. Da aber im ersten Gutachten bei den Emissionen kein Unterschied<br />
zwischen den Szenarien A und B und ebenfalls kein Unterschied zwischen den Szenarien C<br />
und D gemacht werden konnte, konnte auch das zweite Gutachten etwaige Unterschiede bei<br />
den Gesundheitseffekten nicht quantifizieren.<br />
Schutz vor Mortalität, Morbidität und Beeinträchtigungen durch elektromagnetische<br />
Felder<br />
Betrachtet wurden die Sektoren Strom und Gas sowie Information und Telekommunikation.<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 42: Einschätzung des Experten zu Mortalität, Morbidität und Beeinträchtigungen durch<br />
elektromagnetische Felder<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
(-) höherer Anteil von (-) höherer Anteil von<br />
Smart Building<br />
Smart Building<br />
Im Sektor Strom und Gas spielen nur niederfrequente Felder eine Rolle. Bei diesen gibt es<br />
zwar schwache Hinweise auf eine mögliche krebserzeugende Wirkung, die Exposition mit<br />
diesen Feldern hängt aber nicht von den in den Szenarien spezifizierten Einflussgrößen ab,<br />
daher gibt es hier keine Unterschiede zwischen den Szenarien.<br />
Im Sektor Information und Telekommunikation gibt es zwar bei der Exposition möglicherweise<br />
Unterschiede zwischen den Szenarien, und zwar unter anderem durch den Anteil von<br />
Smart Building, ob dies aber tatsächlich zu unterschiedlicher Exposition führt, kann aus den<br />
Angaben in den Szenariobeschreibungen und den derzeitigen Informationen zu Smart Build-<br />
22 Das EMEP-Programm („Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-range<br />
Transmission of Air pollutants in Europe", http://www.emep.inti) befasst sich mit der grenzüberschreitenden<br />
Messung und Prognose von Emission, Transport und Ablagerung luftgetragener<br />
Schadstoffe in Europa.<br />
139
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
ing nicht geschlossen werden. Zudem gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise auf Gesundheitseffekte<br />
durch die bei Smart Building auftretenden Felder.<br />
Insgesamt gibt es wahrscheinlich keine Unterschiede bei Gesundheitseffekten durch elektromagnetische<br />
Felder, allenfalls eine erhöhte Exposition bei Smart Building.<br />
5.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
5.3.3.1. Zusammenfassung<br />
Die Faktoren, die die <strong>Versorgung</strong>ssicherheit beeinflussen, und die Merkmale, an denen sie<br />
zu messen ist, sind in den Sektoren so verschieden, dass alle Kriterien im Bereich <strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
sektorspezifisch behandelt werden (Kategorie B.I).<br />
Stärken und Schwächen der Szenarien<br />
Im Bereich <strong>Versorgung</strong>ssicherheit hat jedes der Szenarien sowohl Stärken als auch Schwächen.<br />
Szenario A hat Vorteile bei der „Unabhängigkeit von knappen Ressourcen", bei der „Fehlertoleranz"<br />
und bei „Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen". Nachteile sehen die<br />
Experten bei „räumlicher Verfügbarkeit" und „kostengünstiger Verfügbarkeit". Hinsichtlich der<br />
kostengünstigen Verfügbarkeit gibt es jedoch unterschiedliche Einschätzungen, da einerseits<br />
laut Beschreibung in Szenario A die geringsten Preissteigerungen für Strom, Gas, Wasser<br />
und Telekommunikationsleistungen stattfinden, andererseits einige Experten dies anzweifeln<br />
und der Auffassung sind, dass dezentrale Systeme und Erneuerbare Energien teurer sind als<br />
zentrale Systeme und fossile Energieträger.<br />
Szenario B hat eine Stärke bei „Unabhängigkeit von knappen Ressourcen", eine Schwäche<br />
bei „Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen".<br />
Szenario C hat Stärken im Sektor Strom und Gas bei „Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen",<br />
im Sektor Wasser bei „allzeitiger Verfügbarkeit" und „Sicherheit der Anlagen".<br />
Schwächen bestehen bei „Unabhängigkeit von knappen Ressourcen", im Sektor Strom<br />
und Gas bei „Fehlertoleranz" und im Sektor Wasser bei „Sicherheit der Netze" und „Angebot<br />
einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen".<br />
Szenario D hat Stärken im Sektor Wasser bei „räumlicher Verfügbarkeit", Schwächen bei<br />
„Unabhängigkeit von knappen Ressourcen", „Fehlertoleranz" und „Angebot einer Vielzahl<br />
von <strong>Versorgung</strong>sleistungen".<br />
Wesentliche Einflussfaktoren<br />
Im Sektor Strom und Gas wird am häufigsten der Anteil dezentraler Anlagen als Einflussfaktor<br />
genannt, dabei wird dieser Einfluss hinsichtlich „Diversifikation" und „Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>squellen"<br />
positiv, hinsichtlich „Kostengünstigkeit" negativ, hinsichtlich „Sicherheit des<br />
Netzes", „Sicherheit der Anlagen" und „Fehlertoleranz" unterschiedlich eingeschätzt. Der<br />
Einfluss des Anteils Erneuerbarer Energien wird hinsichtlich der „Unabhängigkeit von knappen<br />
Ressourcen" und „Unabhängigkeit von Bezugsquellen" positiv, hinsichtlich „allzeitiger<br />
Verfügbarkeit" negativ, hinsichtlich „Sicherheit des Netzes" unterschiedlich eingeschätzt. Ein<br />
140
5.3 Ergebnisse<br />
hoher Anteil von Erdgas ist ungünstig hinsichtlich „Unabhängigkeit von knappen Ressourcen"<br />
und „Unabhängigkeit von Bezugsquellen". Im Sektor Wasser wird am häufigsten der<br />
Einfluss staatlicher Auflagen und Kontrollen genannt, der für „Qualitätsniveau", „allzeitige<br />
Verfügbarkeit", „Sicherheit des Netzes" und „Sicherheit der Anlagen" als vorteilhaft eingeschätzt<br />
wird, allerdings negativ auf die „kostengünstige Verfügbarkeit" wirkt.<br />
5.3.3.2. Einzelbeschreibungen<br />
Mittel- bis langfristige Verfügbarkeit<br />
Mittel- bis langfristige Verfügbarkeit — Unabhängigkeit von knappen Ressourcen<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas:<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
B<br />
c<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 43: Mittlere Einschätzung der Experten zu Unabhängigkeit von knappen Ressourcen,<br />
Sektor Strom und Gas (Mittel- bis langfristige Verfügbarkeit)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ geringerer Endenergieverbrauch<br />
- höherer Endenergieverbrauch<br />
+ hoher Anteil Erneuer- + hoher Anteil Erneuer- - geringer Anteil Erneu- - geringer Anteil Erneubarer<br />
Energien barer Energien erbarer Energien erbarer Energien<br />
(-) hoher Erdgasanteil (-) hoher Erdgasanteil (+) geringerer Erdgasanteil<br />
(+) geringerer Erdgasanteil<br />
Der 1. Experte schreibt dazu: »Die heute bekannten Kohlereserven führen zu Reichweiten,<br />
die um eine Zehnerpotenz und mehr über denen von Öl und Gas liegen. Eine mögliche<br />
Verknappung der Kohleressourcen ist vor diesem Hintergrund eher von untergeordneter<br />
Bedeutung. Das Zielkriterium der Unabhängigkeit von knappen Ressourcen ist daher insbesondere<br />
im Hinblick auf Öl und Gas zu sehen. Der Einsatz erneuerbarer Energien sowie eine<br />
Reduzierung des Strom- und Gasverbrauchs führt zu größerer Unabhängigkeit von knappen<br />
Ressourcen. Die Szenarien A und B besitzen aufgrund des hohen Anteils von Erneuerbaren<br />
daher Vorteile. Andererseits liegen die Anteile des Erdgaseinsatzes mit 45% sehr hoch, was<br />
negativ zu werten ist. Demgegenüber ist durch die Diversifikation des Energieträgereinsatzes<br />
der Gasanteil an der Stromerzeugung in den Szenarien C und D deutlich geringer. Aufgrund<br />
des hohen Anteils Erneuerbarer und eines sinkenden Strom- und Gasverbrauchs besitzt<br />
Szenario A leichte Vorteile gegenüber allen anderen Szenarien.« Die Begründungen der<br />
anderen Experten sind ähnlich, mit leicht unterschiedlichen Gewichtungen der einzelnen<br />
Einflussfaktoren.<br />
141
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Sektor Wasser:<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 44: Einschätzung des Experten zu Unabhängigkeit von knappen Ressourcen, Sektor Wasser<br />
(Mittel- bis langfristige Verfügbarkeit)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
++ geringerer Wasserverbrauch + etwas gerin-<br />
+ Erhalt von Wasserschutzzonen ++ Erhalt von Wasserschutzzonen<br />
gerer Wasserverbrauch<br />
++ Schonung von Rohstoffen + Schonung von Rohstoffen (Dün-<br />
(Dünger) durch Nutzung von ger) durch Nutzung von Klär-<br />
Klärschlamm<br />
schlamm<br />
Begründung des Experten: »Sinkender Wasserverbrauch verbessert die Unabhängigkeit von<br />
knappen Wasser-Ressourcen, die lokal gegeben sein können: Vorteile für A und D. Sinkender<br />
Wasserverbrauch, Zusammenschluss von Versorgern führt dazu, dass Kapazitätsreserven<br />
abgebaut werden können. Dies kann zur Aufgabe von Wasserschutzgebieten führen.<br />
Vorteil für Szenario B, bei dem dies nicht geschieht. Die Sicherung einer hohen Qualität von<br />
Oberflächengewässern und Grundwasser sichert langfristig die Ressource Wasser: Positive<br />
Bewertung von A und B. In zentralen Abwasserentsorgungsszenarios (C, D) wird Klärschlamm<br />
nicht in die Landwirtschaft verbracht, Teilströme werden kaum genutzt. Daher<br />
werden nur A und B positiv bewertet.«<br />
Mittel- bis langfristige Verfügbarkeit – Diversifikation von <strong>Versorgung</strong>squellen<br />
Es wurden nur Einschätzungen für den Sektor Strom / Gas abgegeben:<br />
Kategorie B.II.2: Beurteilungsbezogene Differenzen, unterschiedliche Wichtigkeit der Einflussfaktoren<br />
1. Experte 23 : C=D>A=B, Urteilssicherheit 3<br />
2. Experte: A>B>C=D, Urteilssicherheit 4<br />
3. Experte: A»B>C=D, Urteilssicherheit 4<br />
4. Experte: C=D=B>A, Urteilssicherheit nicht angegeben<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
I<br />
• ■<br />
•<br />
• N.- • •<br />
• e. • •<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
•<br />
Abbildung 45: Mittlere Einschätzung der Experten zur Diversifikation von <strong>Versorgung</strong>squellen, Sektor<br />
Strom und Gas (Mittel- bis langfristige Verfügbarkeit)<br />
23 Hier sind (im Gegensatz zum Synthesepapier) die Experten bei jedem Kriterium neu nummeriert,<br />
die Nummerierung ist daher weder zwischen den einzelnen Kriterien noch mit dem Synthesepapier<br />
vergleichbar.<br />
142
5.3 Ergebnisse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1. Experte<br />
+ viele unterschiedliche<br />
Technologien<br />
+ viele unterschiedliche<br />
Technologien<br />
2. u. 3.<br />
Experte<br />
++ höchster Anteil<br />
dezentraler Anlagen<br />
an der Stromerzeugung<br />
+ hoher Anteil dezentralerAnlagen<br />
an der<br />
Stromerzeugung<br />
geringer Anteil dezentralerAnlagen<br />
an der<br />
Stromerzeugung<br />
geringer Anteil dezentralerAnlagen<br />
an der<br />
Stromerzeugung<br />
4. Experte<br />
- hohe Abhängigkeit<br />
von Erdgas<br />
Ein Experte sieht eine Diversifikation von <strong>Versorgung</strong>squellen dann als gegeben, wenn viele<br />
verschiedene Technologien genutzt werden, und hält daher die Szenarien C und D für vorteilhaft.<br />
Zwei Experten sehen das Kriterium erfüllt bei einem hohen Anteil dezentraler Anlagen<br />
wie in den Szenarien A und B. Der vierte Experte sieht die Diversifikation von <strong>Versorgung</strong>squellen<br />
durch die in den Szenarien A und B hohe Abhängigkeit vom Erdgas gefährdet.<br />
Mittel- bis langfristige Verfügbarkeit - Diversifikation der Bezugsquellen<br />
Es wurden nur Einschätzungen für den Sektor Strom / Gas abgegeben:<br />
Kategorie B.II.1: Geringe beurteilungsbezogene Differenzen<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100<br />
0200 0,300<br />
Abbildung 46: Mittlere Einschätzung der Experten zur Diversifikation der Bezugsquellen, Sektor Strom<br />
und Gas (Mittel- bis langfristige Verfügbarkeit)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
-- hohe Abhängigkeit von -- hohe Abhängigkeit von (-) Abhängigkeit von (-) Abhängigkeit von<br />
Erdgas Erdgas Kernbrennstoffen Kernbrennstoffen<br />
[++ geringe Abhängigkeit<br />
bei Erneuerbaren Energien]<br />
[+ geringe Abhängigkeit bei<br />
Erneuerbaren Energien]<br />
Die Experten sind sich darüber einig, dass Erdgas ungünstig hinsichtlich der Diversifikation<br />
der Bezugsquellen ist und daher die Szenarien A und B wegen des hohen Anteils von Erdgas<br />
schlechter einzuschätzen sind. Der 3. Experte sieht dies jedoch mehr als kompensiert durch<br />
die von Bezugsquellen wenig abhängigen Erneuerbaren Energien, die in A und B einen<br />
hohen Anteil haben.<br />
143
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Mittel- bis langfristige Verfügbarkeit – technologische Diversität<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas<br />
Kategorie B.lI.2: Beurteilungsbezogene Differenzen, unterschiedliche Wichtigkeit der Einflussfaktoren<br />
1. Experte: A>B>C>D, Urteilssicherheit 4<br />
2. Experte: D=C»B=A, Urteilssicherheit 4<br />
3. Experte: C>A=B>D, Urteilssicherheit 3<br />
4. Experte: A=B=C=D, Urteilssicherheit nicht angegeben<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
e..<br />
♦ 1<br />
ev<br />
».<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 47: Mittlere Einschätzung der Experten zur technologischen Diversität, Sektor Strom und<br />
Gas (Mittel- bis langfristige Verfügbarkeit)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1. Experte<br />
+ viele unterschiedliche<br />
Technologien<br />
- Kernenergie fehlt<br />
2. Experte<br />
- Kernenergie fehlt - Kernenergie fehlt<br />
3. Experte<br />
+ hohes Budget zur<br />
Innovationsförderung<br />
+ hohes Budget zur<br />
Innovationsförderung<br />
- geringes Budget zur<br />
Innovationsförderung<br />
+ hoher Anteil Smart<br />
Building<br />
+ hoher Anteil Smart<br />
Building<br />
4. Experte<br />
Technologische Diversität ist in allen Szenarien gegeben<br />
Die Experten schätzen die technologische Diversität unterschiedlich ein. 1. Experte: »Die<br />
technologische Diversität ist in den Szenarien A und B am ausgeprägtesten. Das Spektrum<br />
der Technologien reicht hierbei von Erneuerbaren bis hin zu Kohle- und Gaskraftwerken und<br />
Speichertechnologien. Andererseits spielt in den Szenarien A und B der Kernenergieeinsatz<br />
keine Rolle mehr.« 2. Experte: »Der Verzicht auf die Kernenergie ist ein deutlicher Verlust in<br />
Bezug auf die technologische Diversität. Die Szenariobeschreibung gibt keine Hinweise auf<br />
eine stärkere Diversifizierung bei den Techniken zur Nutzung der erneuerbaren Energiequellen.«<br />
Der 3. Experte gründet seine Einschätzung auf die Einflussfaktoren „staatliches Budget<br />
zur Innovationsförderung" und „Anteil Smart Building". Der 4. Experte sieht technologische<br />
Diversität in allen Szenarien als gegeben.<br />
144
5.3 Ergebnisse<br />
Sektor Wasser:<br />
(nur 1 Experte)<br />
B<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 48: Einschätzung des Experten zur technologischen Diversität, Sektor Wasser (Mittel- bis<br />
langfristige Verfügbarkeit)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
++ Dezentralisierung + Dezentralisierung<br />
++ Marktregulierung, geringer<br />
Anteil Großversorger<br />
+ Marktregulierung, geringer<br />
Anteil Großversorger<br />
+ Innovationsförderung ++ Innovationsförderung ++ Innovationsförderung<br />
Begründung des Experten: »Die mittlere Marktregulierung in Szenario A verstärkt Dekonzentration,<br />
diese verstärkt Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sdienstleistungen. Wird das<br />
Angebot auf wenige Großversorger reduziert (C, D) wird die technologische Diversität reduziert.<br />
Eine Ausweitung von Förderung von Innovation führt zu Neuentwicklungen und somit<br />
zur Erhöhung der Diversität.«<br />
Qualität der <strong>Versorgung</strong><br />
Qualität der <strong>Versorgung</strong> - Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas<br />
Kategorie B.II.1: Geringe beurteilungsbezogene Differenzen<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 49: Mittlere Einschätzung der Experten zur Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus, Sektor<br />
Strom und Gas (Qualität der <strong>Versorgung</strong>)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
- etwas Einspeisung (-) wenig Einspeisung ± kaum Einspeisung ± kaum Einspeisung<br />
von Biogas von Biogas von Biogas von Biogas<br />
+ Rundum-Sorglos- ± Rundum-Sorglos- + Rundum-Sorglos- (+) Rundum-Sorglos-<br />
Pakete 15% Pakete 5% Pakete 20% Pakete 10%<br />
Die Experten sind sich einig, dass die Qualität der <strong>Versorgung</strong> grundsätzlich gewährleistet<br />
ist. Die Qualität des im Netz verteilten Gases wird geringfügig negativ beeinflusst durch die<br />
Einspeisung von Biogas (besonders in Szenarien A und B). Rundum-Sorglos-Pakete, die vor<br />
145
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
allem in den Szenarien C und A verbreitet sind, wirken positiv, weil sie dem Kunden eine<br />
definierte <strong>Versorgung</strong>squalität garantieren, aber auch dieser Einfluss ist gering.<br />
Sektor Wasser<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 50: Einschätzung des Experten zur Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus, Sektor Wasser<br />
(Qualität der <strong>Versorgung</strong>)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ Rohwasserqualität + Anlagenstandard - Abbau von Regelungen<br />
und Überwachung<br />
durch den Staat<br />
- Abbau von Regelungen<br />
und Überwachung<br />
durch den Staat<br />
Begründung des Experten: »Ein Abbau von Regelungen und Überwachung durch den Staat<br />
kann zu Lockerung der Auflagen in Wasserschutzzonen, bei Betriebsregeln, bei der Überwachung<br />
von Roh-, Trink- und gereinigtem Abwasser führen, dies verringert das Qualitätsniveau<br />
(C, D). Die Qualität des für die Trinkwasseraufbereitung genutzten Grundwassers und Oberflächenwassers<br />
wird aufgrund des höheren staatlichen Engagements bei A am besten, bei D<br />
am schlechtesten beurteilt.«<br />
Qualität der <strong>Versorgung</strong> - Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas<br />
Kategorie B.II.1: Geringe beurteilungsbezogene Differenzen<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 51: Mittlere Einschätzung der Experten zum Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen,<br />
Sektor Strom und Gas (Qualität der <strong>Versorgung</strong>)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
++ Anlagencontracting ++ Anlagencontracting (+) Anlagencontracting<br />
+ Rundum-Sorglos- ++ Rundum-Sorglos- (+) Rundum-Sorglos-<br />
Pakete Pakete Pakete<br />
++ Demand Side Management<br />
++ dezentrale Technologien<br />
+ dezentrale Technologien<br />
+ Demand Side Management<br />
146
5.3 Ergebnisse<br />
Anlagencontracting, Rundum-Sorglos-Pakete, Demand Side Management und dezentrale<br />
Technologien erhöhen die Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen, damit sind die Szenarien A<br />
und C deutlich besser als B und D. Ob Rundum-Sorglos-Pakete oder Demand Side Management<br />
diesbezüglich einen höheren Einfluss haben, wird unterschiedlich eingeschätzt,<br />
was die Rangfolge der Szenarien A und C bestimmt, der Unterschied ist aber nur gering. Die<br />
Rangfolge von B und D hängt davon ab, ob ein positiver Einfluss dezentraler Systeme berücksichtigt<br />
wird oder nicht, dies ergibt ebenfalls nur einen geringen Unterschied zwischen B<br />
und D.<br />
Sektor Wasser<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 52: Einschätzung des Experten zum Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen,<br />
Sektor Wasser (Qualität der <strong>Versorgung</strong>)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
++ Dezentralisierung + Dezentralisierung<br />
+ Marktregulierung + Marktregulierung<br />
Begründung des Experten: »Wasserversorgung mit Wasserdurchleitungsrechten ist erheblich<br />
problematischer als bei den anderen Sektoren, da sich verschiedene Wässer nur schwer<br />
mischen lassen. Der Anteil an Durchleitung wird daher in allen Szenarien als verschwindend<br />
gering eingeschätzt. Der Bürger hat also keine Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen<br />
Wasseranbietern.« Entsprechend dem Zentralisierungsgrad schneiden die Szenarien C und<br />
D schlechter ab als A und B und A besser als B. »Zentrale Abwasserentsorgung wird ein<br />
Gebietsmonopol bleiben, da Abwassertransport netzgebunden ist und meist im Freigefälle<br />
erfolgt. Eine freie Wahl für die Dienstleistung Abwasserentsorgung bleibt also nur bei dezentralen<br />
Lösungen. Die mittlere Marktregulierung in Szenario A verstärkt Dekonzentration,<br />
diese verstärkt das Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sdienstleistungen. Wird das Angebot<br />
auf wenige Großversorger reduziert (C, D), wird das Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sdienstleistungen<br />
reduziert.«<br />
Allzeitige Verfügbarkeit<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 53: Mittlere Einschätzung der Experten zur allzeitigen Verfügbarkeit, Sektor Strom und Gas<br />
147
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
(-) Anteil Erneuerbarer (-) Anteil Erneuerbarer<br />
Energien mit schwan- Energien mit schwankendem<br />
Angebot (Wind, kendem Angebot (Wind,<br />
Sonne)<br />
Sonne)<br />
+ Anteil Stromspeicher- (+) Anteil Stromspeitechnologien<br />
5% chertechnologien 2%<br />
Die allzeitige Verfügbarkeit kann grundsätzlich in allen Szenarien gewährleistet werden. Die<br />
Schwankungen im Angebot der nicht allzeitig verfügbaren Erneuerbaren Energien Wind und<br />
Sonne können durch Gas-Kraftwerke gut ausgeregelt werden, außerdem sind in den Szenarien<br />
A und B Stromspeichertechnologien verfügbar.<br />
Sektor Wasser<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 54: Einschätzung des Experten zur allzeitigen Verfügbarkeit, Sektor Wasser<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
- Vorrang für Wirtschaftlichkeit<br />
- geringere staatliche Überwachung - geringere staatliche Überwachung<br />
++ Zentralisierung + Zentralisierung<br />
Als wesentlich wird der Netzbetrieb einschließlich der Reinvestition in Netze und Anlagen<br />
angesehen. Bei extremer Ausrichtung auf wirtschaftliche Aspekte (z. B. durch Rückzug des<br />
Staates in Szenario D) besteht die Gefahr, dass vorbeugende Maßnahmen und Bestandserhalt<br />
an Bedeutung verlieren.<br />
Zieht sich der Staat aus der Überwachung zurück, wird die zeitliche Verfügbarkeit sinken.<br />
Szenarien C und D werden daher gegenüber A und B abgewertet.<br />
Ein hoher Zentralisierungsgrad macht schnelles Handeln bei Störfallsuche und Beseitigung<br />
möglich: Vorteile für C und D.<br />
Kostengünstige Verfügbarkeit<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas<br />
Kategorie B.II.3: Beurteilungsbezogene Differenzen, Szenarien unterschiedlich interpretiert<br />
1. Experte: A>B>C>D, Urteilssicherheit 4<br />
2. Experte: C>D>B>A B=A), Urteilssicherheit 3<br />
3. Experte: D>C»B=A (D EC), Urteilssicherheit 5<br />
4. Experte: D=C=B>A, Urteilssicherheit nicht angegeben<br />
148
1<br />
5.3 Ergebnisse<br />
A<br />
B<br />
c<br />
•<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 55: Mittlere Einschätzung der Experten zur kostengünstigen Verfügbarkeit, Sektor Strom<br />
und Gas<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1. Experte<br />
+ Preissteigerung f.<br />
Strom u. Gas 1 %/a<br />
(+) Preissteigerung f.<br />
Strom u. Gas 1,5%/a<br />
(-) Preissteigerung f.<br />
Strom u. Gas 2%/a<br />
- Preissteigerung f.<br />
Strom u. Gas 2,5%/a<br />
2. Experte<br />
- höhere Kosten für<br />
Infrastruktur und<br />
Regelenergie<br />
- höhere Kosten für<br />
Infrastruktur und<br />
Regelenergie<br />
(+) hohes Innovationsbudget<br />
+ langjährig erprobte<br />
Technologien<br />
(+) hohes Innovationsbudget<br />
+ langjährig erprobte<br />
Technologien<br />
3. Experte<br />
(+) lange Nutzung<br />
abgeschriebener<br />
Anlagen<br />
+ lange Nutzung<br />
abgeschriebener<br />
Anlagen<br />
4. Experte<br />
- höhere spezifische<br />
Investitionskosten bei<br />
dezentralen als bei<br />
zentralen Anlagen<br />
Ein Experte bezieht sich auf die in den Szenariobeschreibungen angegebene Preissteigerungsrate<br />
für Strom und Gas, hinsichtlich derer Szenario A am besten abschneidet. Die<br />
anderen drei Experten weichen davon ab, begründet wird dies z. B. wie folgt: Die Szenarien<br />
C und D setzen zu einem Großteil auf langjährig erprobte Technologien, die im hohen Maße<br />
standardisiert sind und kostenseitig deutlich Vorteile gegenüber neuen dezentralen Techniken<br />
besitzen. Die Verfügbarkeit kostengünstiger Techniken wird durch eine Erhöhung des<br />
staatlichen Innovationsbudgets (Szenarien B und C) begünstigt. Erneuerbare Energien sind<br />
trotz höherer Preise für fossile Energien gegenüber Kosten bei abgeschriebenen (Kern-)<br />
Kraftwerken nicht konkurrenzfähig.<br />
Die Frage, ob Erneuerbare Energien und dezentrale Anlagen höhere Stromkosten bedingen<br />
oder nicht und ob die geringe Preissteigerung für Strom und Gas in den Szenarien A und B<br />
trotz (oder wegen) der vermehrten Verwendung Erneuerbarer Energien und dezentraler<br />
Anlagen realistisch ist oder nicht, wurde auch im Ergebnisworkshop diskutiert. Demnach<br />
entscheidet sich diese Frage daran, ob die Rohstoffpreise der fossilen Energieträger bis zum<br />
Stichjahr der Szenarien so stark angestiegen sind, dass die Kosten für Strom aus fossilen<br />
Energien die Kosten für Strom aus Erneuerbaren Energien erreichen oder übersteigen.<br />
149
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Sektor Wasser<br />
Kategorie B.lb: Sachbezogene Differenzen in den Einschätzungen eines Experten<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 56: Mittlere Einschätzung der Experten zur kostengünstigen Verfügbarkeit, Sektor Wasser<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
- geringe Netzdichte in - geringere Netzdichte - geringere Netzdichte -- noch geringere<br />
Städten wegen Sied- in ländlichen Räumen in ländlichen Räumen Netzdichte in ländlichen<br />
lungsbewegung aufs und kaum dezentrale Räumen<br />
Land<br />
Anlagen<br />
- höhere Kapitalkosten<br />
durch ungünstige Finanzierungsbedingungen<br />
+ geringere Betriebskosten<br />
durch Zentralisierung<br />
+ Kostensenkung durch + Kostensenkung durch<br />
Innovation<br />
Innovation<br />
++ geringere Betriebskosten<br />
durch Zentralisierung<br />
und weniger<br />
Vorschriften und Überwachung<br />
Während ein Experte als einzigen Einflussfaktor die Netzdichte heranzieht, dabei aber einen<br />
Unterschied sieht zwischen Ballungsräumen und ländlichen Räumen, berücksichtigt der<br />
andere Experte zusätzlich Finanzierungsbedingungen, staatliche Überwachung und Vorschriften,<br />
sowie Innovationsförderung. Bei hoher Netzdichte sind die Netzkosten für Wasser<br />
und Abwasser geringer. Die Netzdichte ist abhängig von den Siedlungsbewegungen. Daher<br />
ist die Netzdichte in den Städten bei einem hohen Anteil der Bevölkerung in ländlichen Räumen<br />
wie in Szenario A im Vergleich zu den Szenarien B bis D am geringsten und daher die<br />
Kosten am höchsten. In den Szenarien B bis D sind in den Städten die Kosten aufgrund der<br />
bevorzugten Bevölkerungssiedlung in Ballungsräumen und daher einer höheren Netzdichte<br />
wesentlich geringer und somit die kostengünstige Verfügbarkeit höher. Im ländlichen Raum<br />
steigen die Kosten bei sinkendem Anteil dezentraler Anlagen von Szenario B nach D und<br />
ebenfalls fallender Bevölkerungsdichte von Szenario B nach D. Günstige Finanzierungsbedingungen<br />
in den Szenarien A, B und D führen für C zu höheren Kapitalkosten. Der Rückzug<br />
des Staates aus der Überwachung und die Lockerung von Regeln (C, D) werden zu Kosteneinsparungen<br />
im Betrieb führen. Bei starker Förderung von Innovation (B, C) besteht die<br />
Chance, dass sich kostensenkende Technik entwickeln lässt. Die Unterschiede in den Experteneinschätzungen<br />
sind weniger auf unterschiedliche Beurteilung (Kategorie II), sondern<br />
eher auf gleichzeitig wirkende und zum Teil gegenläufige Einflüsse zurückzuführen. Daher<br />
wird hier trotz der Unterschiede in den Experteneinschätzungen aggregiert.<br />
150
5.3 Ergebnisse<br />
Räumliche Verfügbarkeit<br />
Räumliche Verfügbarkeit — in Ballungsräumen und Randlagen von Ballungsräumen<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas<br />
Gleiche Rangfolge bei allen Experten<br />
A<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 57: Mittlere Einschätzung der Experten zur räumlichen Verfügbarkeit in Ballungsräumen<br />
und Randlagen von Ballungsräumen, Sektor Strom und Gas<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
keine Unterschiede zwischen den Szenarien<br />
Die Experten stimmen überein, dass in Ballungsräumen und Randlagen von Ballungsräumen<br />
die <strong>Versorgung</strong> mit Strom und Gas für alle zur Verfügung stehen wird.<br />
Sektor Wasser<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 58: Mittlere Einschätzung der Experten zur räumlichen Verfügbarkeit in Ballungsräumen<br />
und Randlagen von Ballungsräumen, Sektor Wasser<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
1. Experte<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
räumliche Verfügbarkeit ist in allen Szenarien gegeben<br />
2. Ex- + großer Anteil der + großer Anteil der ++ großer Anteil der<br />
perte Bevölkerung in Rand- Bevölkerung in Rand- Bevölkerung in Ballagen<br />
von Ballungs- lagen von Ballungs- lungsräumen erzeugt<br />
räumen erzeugt räumen erzeugt großen politischer<br />
großen politischer großen politischer Druck zur Sicherung<br />
Druck zur Sicherung<br />
der Verfügbarkeit<br />
Druck zur Sicherung<br />
der Verfügbarkeit<br />
der Verfügbarkeit<br />
Für den einen Experten ist die räumliche Verfügbarkeit der Wasserversorgung in allen Szenarien<br />
gegeben, da er voraussetzt, dass der Grundsatz „Wasserversorgung gehört zu den<br />
staatlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge" nicht geändert wird, und zwar sowohl für Ballungsräume<br />
als auch für den ländlichen Raum und für Randlagen von Ballungsräumen. Die<br />
Wasserentsorgung in Ballungsräumen und deren Randlagen ist entweder staatlich gesichert<br />
oder (bei Rückzug des Staates wie in Szenario D) für potentielle Anbieter wirtschaftlich und<br />
151
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
wird daher auch angeboten. Der andere Experte sieht die Wasserversorgung in Ballungsräumen<br />
und Randlagen umso besser gesichert, je mehr Bevölkerung dort lebt und politischen<br />
Druck erzeugt, die <strong>Versorgung</strong> zu sichern.<br />
Räumliche Verfügbarkeit - in ländlichen Räumen<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
A<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 59: Mittlere Einschätzung der Experten zur räumlichen Verfügbarkeit in ländlichen Räumen,<br />
Sektor Strom und Gas<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1.-3.<br />
Experte<br />
4. Experte<br />
- steigende Anforderungen an<br />
die Netze durch die Siedlungsbewegung<br />
aufs Land<br />
räumliche Verfügbarkeit ist in allen Szenarien gegeben<br />
Drei Experten sehen bezüglich der räumlichen Verfügbarkeit keinen Unterschied zwischen<br />
den Szenarien. Der vierte sieht tendenziell Probleme durch steigende Anforderungen an die<br />
Netze auf Grund der Siedlungsbewegung in ländliche Gebiete in Szenario A.<br />
Sektor Wasser<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 60: Mittlere Einschätzung der Experten zur räumlichen Verfügbarkeit in ländlichen Räumen,<br />
Sektor Wasser<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1. Experte<br />
2. Experte<br />
- hoher Anteil dezentraler<br />
Anlagen in<br />
ländlichen Räumen<br />
räumliche Verfügbarkeit ist in allen Szenarien gegeben<br />
Für den einen Experten ist die räumliche Verfügbarkeit der Wasserversorgung in allen Szenarien<br />
gegeben, da er voraussetzt, dass der Grundsatz „Wasserversorgung gehört zu den<br />
152
5.3 Ergebnisse<br />
staatlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge" nicht geändert wird, und zwar sowohl für Ballungsräume<br />
als auch für den ländlichen Raum und für Randlagen von Ballungsräumen.<br />
Bezüglich der Wasserentsorgung sieht er kein technisches Problem, allenfalls ein finanzielles,<br />
daher sei auch diese in allen Szenarien gegeben. Der andere Experte sieht hinsichtlich<br />
der Wasserversorgung bei abnehmenden Sommerniederschlägen und zunehmendem<br />
Verbrauch für Bewässerung die Gefahr eines Mangels in Wasser führenden Schichten und<br />
damit ein Verfügbarkeitsproblem für dezentrale Anlagen, das besonders in Szenario A mit<br />
einem hohen Anteil dezentraler Anlagen relevant wird.<br />
Verminderung von Störpotentialen<br />
Verminderung von Störpotentialen - Sicherheit des Netzes<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas<br />
Kategorie B.II.2: Beurteilungsbezogene Differenzen, unterschiedliche Wichtigkeit der Einflussfaktoren<br />
1. Experte: D>C»B>A, Urteilssicherheit 3<br />
2. Experte: A>B>C=D, Urteilssicherheit 4<br />
3. Experte: A=B=C=D, Urteilssicherheit nicht angegeben<br />
4. Experte: A=B=C=D, Urteilssicherheit nicht angegeben<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
e. •<br />
1<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0 300<br />
Abbildung 61: Mittlere Einschätzung der Experten zur Sicherheit des Netzes, Sektor Strom und Gas<br />
(Verminderung von Störpotentialen)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1. Experte<br />
2. Experte<br />
3. Experte<br />
4. Experte<br />
-- viel Erneuerbare<br />
Energien und dezentrale<br />
Anlagen<br />
++ viele dezentrale<br />
Strukturen<br />
- (nicht ganz so) viel<br />
Erneuerbare Energien<br />
und dezentrale<br />
Anlagen<br />
+ dezentrale Strukturen<br />
+ bestehende Netzstruktur<br />
mit bekannter,<br />
niedriger Störanfälligkeit<br />
(+) etwas dezentrale<br />
Strukturen<br />
+ bestehende Netzstruktur<br />
mit bekannter,<br />
niedriger Störanfälligkeit<br />
Hinsichtlich technischer <strong>Versorgung</strong>ssicherheit keine Unterschiede zwischen den Szenarien<br />
Die Sicherheit des Netzes hängt von der Auslegung ab, sie ist in allen Szenarien möglich.<br />
Während zwei Experten keinen Unterschied zwischen den Szenarien sehen, sieht einer der<br />
Experten in Erneuerbaren Energien und dezentralen Anlagen einen negativen, ein anderer<br />
einen positiven Einfluss auf die Sicherheit des Netzes. Nach der einen Einschätzung »erfordert<br />
ein höherer Anteil von erneuerbaren Energien sowie von Dezentralisierung erhebliche<br />
Modifikationen des Stromnetzes, die mit entsprechenden Störpotenzialen einhergehen könnten.<br />
Während es sich bei den Szenarien C und D um bestehende Infrastruktur handelt, für<br />
153
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
deren Betrieb langjährige Erfahrungen vorliegen, wird in A und B eine neue Netzstruktur<br />
aufgebaut, mit all den damit verbundenen Unwägbarkeiten und nicht vorhandenem Erfahrungsschatz.«<br />
Nach der anderen Einschätzung »haben dezentrale Erzeugungsstrukturen<br />
(vor allem in Szenarien A und B) Vorteile bei der Sicherheit des Netzes aufgrund der einfacheren<br />
Reservehaltung und der kürzeren Transportentfernungen.«<br />
Sektor Wasser<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 62: Einschätzung des Experten zur Sicherheit des Netzes, Sektor Wasser (Verminderung<br />
von Störpotentialen)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ dezentrale autarke + Zentralisierung + Zentralisierung<br />
Systeme - geringere staatliche - geringere staatliche<br />
Überwachung<br />
Überwachung<br />
- ungünstige Finanzierungsbedingungen<br />
für<br />
Instandhaltung<br />
Ein hoher Zentralisierungsgrad macht schnelles Handeln bei Störfallsuche und Beseitigung<br />
möglich: Vorteile für C und D. Die Zunahme von komplett dezentralen Lösungen ohne Netzabhängigkeit<br />
bringt Vorteile für Szenario A. Ein Rückzug des Staates aus der Überwachung<br />
und die Lockerung von Regeln (C, D) werden zu einem Rückgang der Sicherheit im Netzbetrieb<br />
führen. Günstige Finanzierungsbedingungen (A, B, D) ermöglichen Investitionen ins<br />
Netz, z. B. zur vorbeugenden Instandhaltung.<br />
Verminderung von Störpotentialen – Sicherheit der Anlagen<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas<br />
Kategorie B.II.2: Beurteilungsbezogene Differenzen, unterschiedliche Wichtigkeit der Einflussfaktoren<br />
1. Experte: A=B=C=D, Urteilssicherheit nicht angegeben<br />
2. Experte: D=C>B>A, Urteilssicherheit 3<br />
3. Experte: A>B»C>D, Urteilssicherheit 4<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0 100 0 000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 63: Mittlere Einschätzung der Experten zur Sicherheit der Anlagen, Sektor Strom und Gas<br />
(Verminderung von Störpotentialen)<br />
154
5.3 Ergebnisse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1. Experte<br />
Die Sicherheit der Anlagen hängt von der Auslegung ab, sie ist in allen Szenarien möglich.<br />
2. Experte<br />
-- viel neuartige<br />
Technologien<br />
- virtuelle Kraftwerke<br />
- (nicht ganz so) viel<br />
neuartige Technologien<br />
+ bestehende Anlagen<br />
mit bekannter,<br />
niedriger Störanfälligkeit<br />
+ bestehende Anlagen<br />
mit bekannter,<br />
niedriger Störanfälligkeit<br />
3. Experte<br />
(+) viele dezentrale<br />
Strukturen<br />
(+) dezentrale Strukturen<br />
- große Anlagen,<br />
Kernkraftwerke<br />
- große Anlagen,<br />
Kernkraftwerke<br />
Während ein Experte die Sicherheit der Anlagen in allen Szenarien als machbar ansieht, ist<br />
für einen anderen »ein hoher Anteil neuer noch nicht langjährig erprobter Technologien bzw.<br />
Anlagen ein Störpotential«, für den dritten »haben dezentrale Erzeugungsstrukturen Vorteile<br />
bei der Sicherheit der Anlagen aufgrund der einfacheren Reservehaltung. Zentrale Anlagen<br />
großer Leistung können bei Ausfällen größere Schäden anrichten, sie sind für bewusste<br />
Störungen von außen attraktiver. Kernkraftwerke stellen hier ein relativ großes Potential dar.<br />
Sektor Wasser<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0200 -0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 64: Einschätzung des Experten zur Sicherheit der Anlagen, Sektor Wasser (Verminderung<br />
von Störpotentialen)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ Innovationsförderung + Innovationsförderung<br />
+ Zentralisierung ++ Zentralisierung + Zentralisierung<br />
- geringere staatliche - geringere staatliche<br />
Überwachung<br />
Überwachung<br />
- ungünstige Finanzierungsbedingungen<br />
für<br />
Instandhaltung<br />
Bei starker Förderung von Innovation (B, C) besteht die Chance, dass sich sicherere Technik<br />
entwickeln lässt. Die Zunahme von komplett dezentralen Lösungen ohne Netzabhängigkeit<br />
hat eine Zunahme an Anlagen zur Folge. Mit der zunehmenden Anzahl steigt das Störfallrisiko,<br />
allerdings sind die Auswirkungen einer Störung bei einer kleinen Anlage geringer als bei<br />
einer großen: Dennoch Vorteile für Szenario C und D. Ein hoher Zentralisierungsgrad macht<br />
schnelles Handeln bei Störfallsuche und Beseitigung möglich: Vorteile für C und D. Rückzug<br />
des Staates aus der Überwachung und die Lockerung von Regeln (C, D) werden zum Rückgang<br />
der Sicherheit im Anlagenbetrieb führen.<br />
155
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Anpassungsfähigkeit des <strong>Versorgung</strong>ssystems<br />
Anpassungsfähigkeit des <strong>Versorgung</strong>ssystems — Erhalt der Reversibilität innerhalb<br />
des <strong>Versorgung</strong>ssystems<br />
Es wurden nur Einschätzungen für den Sektor Strom und Gas abgegeben<br />
Kategorie B.lI.2: Beurteilungsbezogene Differenzen, unterschiedliche Wichtigkeit der Einflussfaktoren<br />
1. Experte: B>A=C>D, Urteilssicherheit 3<br />
2. Experte: A>B»C=D, Urteilssicherheit 4<br />
3. Experte: A=C>B=D, Urteilssicherheit 3<br />
4. Experte: B=C=D>A, Urteilssicherheit nicht angegeben<br />
B<br />
c<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 65: Mittlere Einschätzung der Experten zur Erhalt der Reversibilität innerhalb des <strong>Versorgung</strong>ssystems,<br />
Sektor Strom und Gas (Anpassungsfähigkeit des <strong>Versorgung</strong>ssystems)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1. Ex- + viele dezentrale + viele dezentrale<br />
perte Anlagen und Gaskraftwerke<br />
Anlagen und Gaskraftwerke<br />
2. Experte<br />
- hohe Investitionen<br />
in neue Strukturen<br />
++ viele dezentrale<br />
Anlagen<br />
+ dezentrale Anlagen - große Anlagen,<br />
Kernkraftwerke<br />
3. Ex- + Anlagen werden + Anlagen werden<br />
perte schneller ausgetauscht<br />
schneller ausgetauscht<br />
4. Experte<br />
- irreversibler Rückbau<br />
zentraler Netze<br />
- große Anlagen,<br />
Kernkraftwerke<br />
Hinsichtlich der Reversibilität werden kleine Anlagen (die vermehrt in den Szenarien A und B<br />
eingesetzt werden) durchweg günstiger eingeschätzt als große (Szenarien C und D). Unterschiede<br />
in den Einschätzungen liegen darin begründet, inwieweit die hohen Investitionen in<br />
den Umbau der <strong>Versorgung</strong>sstruktur (besonders in Szenario A) oder dieser Umbau selbst die<br />
Reversibilität negativ beeinflussen.<br />
156
5.3 Ergebnisse<br />
Anpassungsfähigkeit des <strong>Versorgung</strong>ssystems - Fehlertoleranz<br />
Es wurden nur Einschätzungen für den Sektor Strom und Gas abgegeben<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 66: Mittlere Einschätzung der Experten zur Fehlertoleranz, Sektor Strom und Gas (Anpassungsfähigkeit<br />
des <strong>Versorgung</strong>ssystems)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
++ viele dezentrale + dezentrale Anlagen - große Anlagen - große Anlagen<br />
Anlagen<br />
(+) Entwicklung im TK-<br />
Bereich<br />
+ Demand Side Management<br />
-- komplexe Steuerungssysteme<br />
- komplexe Steuerungssysteme<br />
(+) Demand Side Management<br />
Die Experten stimmen in der Einschätzung und den Begründungen näherungsweise überein:<br />
Kleinere Gaskraftwerke ermöglichen eine flexible Reaktion auf Störungen. Die Reaktion auf<br />
Störungen in Großkraftwerken ist relativ schwierig (Szenarien C, D), Weiterentwicklungen im<br />
TK-Bereich (z. B. Demand Side Management) können die Störungserkennung und Beseitigung<br />
fördern (Szenarien A und C). Einer der Experten sieht die höhere Fehlertoleranz dezentraler<br />
Systeme aufgewogen durch die höhere Fehleranfälligkeit der für die Koordination<br />
dieser Systeme erforderlichen Informationstechnik.<br />
5.3.4 Wirtschaftliche Aspekte<br />
5.3.4.1. Zusammenfassung<br />
Stärken und Schwächen der Szenarien<br />
Die Stärken von Szenario A liegen in „Investitionstätigkeit" vor allem in dezentrale Anlagen<br />
und dadurch bedingt „Sicherung und Steigerung der Beschäftigung", „Einkommenssteigerung"<br />
und „Einkommenssicherung", „institutionelle Innovationen", „Anpassungsfähigkeit an<br />
Markterfordernisse" und „Aufbau und Entwicklung von Wissen zu neuen Technologien". Die<br />
Dekonzentration der Unternehmen verwirklicht eine „pluralistische Marktstruktur". Andererseits<br />
bedingt die Dezentralisierung weniger „kostendeckende Preise", die pluralistische<br />
Marktstruktur und die kostenintensiven dezentralen Anlagen eine geringere „internationale<br />
Wettbewerbsfähigkeit". Der „Erhalt des Wissens zu bestehenden Technologien" ist gefährdet.<br />
Szenario B hat Stärken bei „Innovationstätigkeit" und „Innovationsfähigkeit", bedingt durch<br />
die Kombination eines hohen Innovationsbudgets und Investitionen in neue Technologien. Es<br />
hat wie A eine „pluralistische Marktstruktur" und „Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse".<br />
Wie in A ist die „internationale Wettbewerbsfähigkeit" schwach, im Gegensatz zu A je-<br />
157
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
doch auch die „Einkommenssteigerung", die „Sicherung und Steigerung der Beschäftigung",<br />
und, in geringerem Maße, die „Effizienz der Leistungserstellung". Wie in Szenario A ist „Aufbau<br />
und Entwicklung von Wissen zu neuen Technologien" stark, „Erhalt des Wissens zu<br />
bestehenden Technologien" schwach.<br />
Die Stärken von Szenario C liegen bei „internationaler Wettbewerbsfähigkeit", „Erhalt des<br />
Wissens zu bestehenden Technologien" und „Einkommenssteigerung", Schwächen bei „Investitionstätigkeit",<br />
„Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse", „pluralistischer Marktstruktur",<br />
„Aufbau und Entwicklung von Wissen zu neuen Technologien" und, in geringerem Maße,<br />
„Innovationstätigkeit".<br />
Szenario D hat nur wenige Stärken: Bei „internationaler Wettbewerbsfähigkeit" und „Erhalt<br />
des Wissens zu bestehenden Technologien". Es ist schwach bei „Investitionstätigkeit", „Innovationstätigkeit",<br />
„Innovationsfähigkeit" und „institutionellen Innovationen", bei „Sicherung und<br />
Steigerung der Beschäftigung", „Einkommenssteigerung" und „Einkommenssicherung",<br />
„Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse", „pluralistischer Marktstruktur" und „Aufbau und<br />
Entwicklung von Wissen zu neuen Technologien".<br />
Wesentliche Einflussfaktoren<br />
Der besonders in Szenario A stattfindende Umbau der <strong>Versorgung</strong>ssysteme mit Dezentralisierung<br />
sowie Wechsel von Kohle und Kernenergie auf Gas und Erneuerbare Energien ist<br />
nur mit hoher „Investitionstätigkeit" zu erreichen und im Sektor Strom und Gas auch mit<br />
„Innovationstätigkeit" verbunden. Er schafft „Sicherung und Steigerung der Beschäftigung",<br />
möglicherweise auch „Einkommenssteigerung", und verbessert die „Anpassungsfähigkeit an<br />
Markterfordernisse". Er ist aber kostspielig, so dass in Anbetracht der in Szenario A geringen<br />
Preissteigerung kaum „kostendeckende Preise" zu erzielen sind und die „internationale<br />
Wettbewerbsfähigkeit" gefährdet ist. Vermehrte Dienstleistungen (z. B. Rundum-Sorglos-<br />
Pakete) begünstigen „Innovationstätigkeit", „institutionelle Innovationen" und „Sicherung und<br />
Steigerung der Beschäftigung".<br />
5.3.4.2. Einzelbeschreibungen<br />
Sicherung und Steigerung der Beschäftigung<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas:<br />
Kategorie B.II.1: Geringe beurteilungsbezogene Differenzen<br />
B<br />
c<br />
D<br />
r-7<br />
-0,200 0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 67: Mittlere Einschätzung der Experten zu Sicherung und Steigerung der Beschäftigung,<br />
Sektor Strom und Gas<br />
158
5.3 Ergebnisse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ hohes Wirtschafts- ± mäßiges Wirtschafts- + hohes Wirtschafts- - schwaches Wirtwachstum<br />
wachstum wachstum schaftswachstum<br />
+ verstärkte Aktivitäten ± kaum Aktivitäten im + verstärkte Aktivitäten ± kaum Aktivitäten im<br />
im Dienstleistungsbe- Dienstleistungsbereich im Dienstleistungsbe- Dienstleistungsbereich<br />
reich reich (+) Kernenergie<br />
(+) Kernenergie<br />
(-) Substitution Kohle<br />
durch Gas<br />
+ Erneuerbare Energiequellen<br />
+ effiziente Stromerzeugung<br />
und -nutzung<br />
(-) Substitution Kohle<br />
durch Gas<br />
(+) Erneuerbare Energiequellen<br />
+ effiziente Stromerzeugung<br />
und -nutzung<br />
+ Dezentralisierung (+) Dezentralisierung<br />
Obwohl die Experten sich in den Einschätzungen nur wenig unterscheiden und die Haupteinflussfaktoren<br />
zum Teil gleich sind, sind die Begründungen wesentlich vielschichtiger und<br />
zeigen die hohe Unsicherheit, die mit der Einschätzung dieses Kriteriums verbunden ist:<br />
1. Experte: »Prinzipiell ist anzumerken, das die von Veränderungen des Energiesystems<br />
ausgehenden Beschäftigungseffekte das Arbeitslosenproblem im Grundsatz nicht lösen<br />
werden. In aktuellen Diskussion wird diesem Kriterium zu viel Gewicht eingeräumt. Bei der<br />
Sicherung und Steigerung von Beschäftigung ist zu unterscheiden, ob die Effekte im Ausland<br />
oder im Inland ausgelöst werden. Bereits heute werden eine Vielzahl von Kraftwerksbauteilen<br />
im Ausland gefertigt. Weiterhin ist zu sehen, dass durch den Bau neuer <strong>Versorgung</strong>sanlagen<br />
oftmals nur zeitweilig neue Arbeitsplätze und keine Dauerarbeitsplätze entstehen. Von<br />
positiver Wirkung dürften dagegen verstärkte Aktivitäten im Dienstleistungsbereich sein.<br />
Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass ein höheres Wirtschaftwachstum positive Beschäftigungseffekte<br />
auslöst. Aufgrund der hohen Investitionen, die in den Szenarien A und B<br />
für den Bau von <strong>Versorgung</strong>sanlagen und Infrastruktur zu tätigen sind, werden zumindest<br />
kurzzeitig größere direkte Beschäftigungseffekte ausgelöst. Andererseits ist davon auszugehen,<br />
dass die in den Szenarien A und B implementierten Maßnahmen erhebliche Kosten<br />
erfordern, die auf die Preise umgelegt werden und von den Verbrauchern bezahlt werden<br />
müssen. Die indirekten negativen Beschäftigungseffekte dürften nicht unerheblich sein.«<br />
2. Experte: »Eine der schwersten zu beantwortenden Fragen. Studien zu dieser Fragestellung<br />
kommen je nach politischer Färbung, gewähltem methodischen Ansatz und Abschneidekriterien<br />
zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Während die direkten Beschäftigungseffekte<br />
in der Elektrizitätswirtschaft relativ gut abschätzbar sind, wird es bei den Anlagenherstellern<br />
und der Zulieferindustrie aufgrund möglicher Exportvorteile schon schwieriger. Preissteigerungen<br />
beim Strom können die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen<br />
beinträchtigen. Allerdings werden nicht alle Kostensteigerungen von der Elektrizitätswirtschaft<br />
an die Industriekunden weitergegeben. Auch ist der Stromkostenanteil für eine Reihe<br />
exportintensiver Industriezweige relativ gering, so dass sich Strompreissteigerungen nicht<br />
nennenswert auf den Verkaufspreis und damit auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirken.<br />
Welche Art von Produkten oder Dienstleistungen von den Privatkunden bei höheren Stromkosten<br />
weniger nachgefragt werden und die hierdurch ausgelösten möglichen Arbeitsplatzeffekte<br />
in Deutschland erscheint höchst unsicher. Insgesamt dürfte eine Substitution von fossiler<br />
oder nuklearer Energie durch Erneuerbare Energiequellen und eine effiziente Stromerzeugung<br />
und -nutzung zu positiven Netto-Beschäftigungseffekten in Deutschland führen.«<br />
159
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
3. Experte: »Wirtschaftswachstum und Dezentralisierung der Energieversorgung fördern die<br />
Beschäftigung, haben jedoch auch negative Effekte auf die Gesamtbeschäftigung. Substitution<br />
von Kohle durch Gas verringert die heimische Wertschöpfung. Kernenergie ist verbunden<br />
mit hohem Dienstleistungsanteil.«<br />
Sektor Wasser:<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
B<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 68: Einschätzung des Experten zu Sicherung und Steigerung der Beschäftigung, Sektor<br />
Wasser<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ hoher Anteil dezentra- (+) mäßig hoher Anteil<br />
ler Systeme<br />
dezentraler Systeme<br />
Ein hoher Anteil dezentraler Technologien benötigt mehr Service. Daher wird in den Szenerien<br />
A und D aufgrund höherer Anteile dezentraler Technologien eine leichte Beschäftigungszunahme<br />
im Wassersektor erwartet.<br />
Effizienz der Leistungserstellung<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas:<br />
Kategorie B.II.1b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
1. Experte: A>B>C>D, Urteilssicherheit 3<br />
2. Experte: C=D»A=B, Urteilssicherheit 1<br />
3. Experte: A>B>C>D, Urteilssicherheit nicht angegeben<br />
A<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 69: Mittlere und einzelne Einschätzungen der Experten zu Effizienz der Leistungserstellung,<br />
Sektor Strom und Gas<br />
160
5.3 Ergebnisse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
1. Experte<br />
2. Experte<br />
3. Experte<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ Einsatz ordnungsrechtlicher<br />
Instrumente<br />
- Investition in neue<br />
Anlagen<br />
+ Preiserhöhung f.<br />
Strom u. Gas 1%<br />
± Policy-Mix - vorwiegend Einsatz<br />
marktwirtschaftlicher<br />
Instrumente<br />
- Investition in neue<br />
Anlagen<br />
± Preiserhöhung f.<br />
Strom u. Gas 1,5%<br />
+ Weiterbetrieb bestehender<br />
Anlagen<br />
- Preiserhöhung f.<br />
Strom u. Gas 2%<br />
-- Konzentration auf<br />
markwirtschaftliche<br />
Instrumente<br />
+ Weiterbetrieb bestehender<br />
Anlagen<br />
-- Preiserhöhung f.<br />
Strom u. Gas 2,5%<br />
Der erste Experte begründet die Wahl der Einflussgröße damit, dass »ordnungspolitische<br />
Instrumente im Hinblick auf umweltpolitische Ziele effizienter als marktwirtschaftliche« seien.<br />
Der zweite Experte sieht die Effizienz durch hohe Investitionskosten für den Ersatz alter<br />
durch neue Anlagen beeinträchtigt. Der dritte Experte zieht als Maßstab für die Effizienz die<br />
Verbraucherpreisentwicklung heran, »da Kosten in den einzelnen Szenarien aufgrund unterschiedlicher<br />
Produkte bzw. Leistungen nicht miteinander vergleichbar sind«. Diese unterschiedlichen<br />
Einflussfaktoren schließen einander aber nicht aus, sondern stellen eine gegenseitige<br />
Ergänzung dar, so dass trotz der durch die Experten unterschiedlich eingeschätzten<br />
Rangfolgen eine Aggregation der Einschätzungen sinnvoll erscheint. Daher werden<br />
entsprechend diesem Vorgehen diese Einschätzungen der Kategorie B.II.1b zugeordnet,<br />
obwohl rein formal die Kategorie B.Il.5 vorliegt, da der zweite Experte für seine Einschätzung<br />
eine hohe Unsicherheit angibt.<br />
Sektor Wasser:<br />
(nur 1 Experte)<br />
B<br />
c<br />
D<br />
1<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 70: Einschätzung des Experten zu Effizienz der Leistungserstellung, Sektor Wasser<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
-- höchster Anteil geringer Anteil dezen- geringer Anteil dezen- - hoher Anteil dezentradezentraler<br />
Systeme traler Systeme traler Systeme ler Systeme<br />
Begründung des Experten: Die Kosten der <strong>Versorgung</strong> steigen mit der Nutzung dezentraler<br />
Systeme.<br />
161
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Kostendeckende Preise<br />
Kostendeckende Preise — für Investitionskosten<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 71: Mittlere Einschätzung der Experten zu Kostendeckende Preise für Investitionskosten<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ höhere verbrauchsund<br />
leistungsunabhängige<br />
Preiskomponente<br />
- Preissteig. 1 %/a ± Preissteig. 1,5%/a + Preissteig. 2%/a ++ Preissteig. 2,5%/a<br />
(-) stärkerer Liberalisierungsdruck<br />
(-) stärkerer Liberalisierungsdruck<br />
(-) höhere Sollzinsen<br />
- rückläufige Strom- ± gleich bleibende + steigende Stromnach- ± gleich bleibende<br />
nachfrage Stromnachfrage frage Stromnachfrage<br />
Drei Experten halten kostendeckende Preise in allen Szenarien für gegeben mit den Begründungen:<br />
»Grundlegende Voraussetzung für eine Investition sind kostendeckende Preise.«<br />
»Langfristig werden Produkte nur angeboten, wenn stets die Kosten gedeckt sind.«<br />
»Kostendeckende Preise werden in allen Szenarien erhoben und auf den Verbraucher umgelegt.«<br />
Der zweite Experte begründet Unterschiede wie folgt: »Szenario C ist das einzige<br />
mit einer hohen verbrauchs- und leistungsunabhängigen und einer niedrigen verbrauchsund<br />
leistungsabhängigen Komponente. Weitere Faktoren sind der stärkere Liberalisierungsdruck<br />
bei A und B, der insgesamt zu niedrigeren Einnahmemöglichkeiten führt, was sich<br />
auch in den Strompreissteigerungen widerspiegelt. Die rückläufige Entwicklung der Stromnachfrage<br />
in Szenario A gegenüber der Zunahme in Szenario C dürfte ungünstiger wirken als<br />
die höheren Sollzinsen in Szenario C.«<br />
Kostendeckende Preise - für Betriebskosten und Abgaben<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 72: Mittlere Einschätzung der Experten zu Kostendeckende Preise für Betriebskosten und<br />
Abgaben<br />
162
5.3 Ergebnisse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ höhere verbrauchsund<br />
leistungsunabhängige<br />
Preiskomponente<br />
- Preissteig. 1 %/a ± Preissteig. 1,5%/a + Preissteig. 2%/a ++ Preissteig. 2,5%/a<br />
(-) stärkerer Liberalisierungsdruck<br />
(-) stärkerer Liberalisierungsdruck<br />
- rückläufige Strom- ± gleich bleibende + steigende Stromnach- ± gleich bleibende<br />
nachfrage Stromnachfrage frage Stromnachfrage<br />
Drei Experten halten kostendeckende Preise in allen Szenarien für gegeben mit Begründungen<br />
wie: »Grundlegende Voraussetzung für eine Investition mit den damit einhergehenden<br />
Betriebskosten sind kostendeckende Preise.« »Langfristig werden Produkte nur angeboten,<br />
wenn stets die Kosten gedeckt sind.« »Kostendeckende Preise werden in allen Szenarien<br />
erhoben und auf den Verbraucher umgelegt.« Der zweite Experte begründet Unterschiede<br />
wie folgt: »Szenario C ist das einzige mit einer hohen verbrauchs- und leistungsunabhängigen<br />
und einer niedrigen verbrauchs- und leistungsabhängigen Komponente. Weitere Faktoren<br />
sind der stärkere Liberalisierungsdruck bei A und B, der insgesamt zu niedrigeren Einnahmemöglichkeiten<br />
führt, was sich auch in den Strompreissteigerungen widerspiegelt. Die<br />
rückläufige Entwicklung der Stromnachfrage in Szenario A dürfte sich ungünstig auswirken,<br />
die Zunahme in Szenario C hingegen günstig.«<br />
Kostendeckende Preise – für internalisierte Kosten<br />
Kategorie B.II.2: Beurteilungsbezogene Differenzen, unterschiedliche Wichtigkeit der Einflussfaktoren<br />
1. Experte: A=B>C>D, Urteilssicherheit 3<br />
2. Experte: D>C>B>A, Urteilssicherheit 1<br />
3. Experte: A=B=C=D, Urteilssicherheit nicht angegeben<br />
4. Experte: A=B=C=D, Urteilssicherheit nicht angegeben<br />
A<br />
-0200 -0100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 73: Mittlere und einzelne Einschätzungen der Experten zu Kostendeckende Preise für<br />
internalisierte Kosten<br />
163
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ höhere verbrauchsund<br />
leistungsunabhängige<br />
Preiskomponente<br />
- Preissteigerung ± Preissteigerung + Preissteigerung ++ Preissteigerung<br />
1%/a 1,5%/a 2'3/0/a 2,5%/a<br />
(-) stärkerer Liberalisierungsdruck<br />
(-) stärkerer Liberalisierungsdruck<br />
- rückläufige Strom- ± gleich bleibende + steigende Strom- ± gleich bleibende<br />
nachfrage Stromnachfrage nachfrage Stromnachfrage<br />
Zwei Experten halten kostendeckende Preise in allen Szenarien für gegeben mit den Begründungen:<br />
»Langfristig werden Produkte nur angeboten, wenn stets die Kosten gedeckt<br />
sind.« »Kostendeckende Preise werden in allen Szenarien erhoben und auf den Verbraucher<br />
umgelegt.« Der erste Experte begründet Unterschiede wie folgt: »Die Internalisierung von<br />
externen Kosten hängt von den umweltpolitischen Vorgaben und deren Ausgestaltung ab.<br />
Das Strompreisniveau liegt in Szenario D am höchsten und erlaubt nur wenig Spielraum für<br />
eine Internalisierung.« Der zweite Experte argumentiert in gleicher Weise wie bei seiner<br />
Einschätzung des Kriteriums „Kostendeckende Preise für Betriebskosten".<br />
Vorbeugendes Wirtschaftshandeln<br />
Vorbeugendes Wirtschaftshandeln - Investitionstätigkeit<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas:<br />
Gleiche Rangfolge bei allen Experten<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 74: Mittlere Einschätzung der Experten zu Investitionstätigkeit, Sektor Strom und Gas<br />
(Vorbeugendes Wirtschaftshandeln)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
++ Bau vieler neuer + Bau mäßig vieler - ungünstige Finanzie-<br />
Anlagen neuer Anlagen rungsbedingungen<br />
Die Experten sind sich einig, dass der Wechsel von Kohle und Kernenergie auf Erdgas (Szenarien<br />
A, B) und von großen zentralen auf kleine dezentrale Anlagen (Szenario A) hohe<br />
Investitionen erfordert.<br />
164
5.3 Ergebnisse<br />
Sektor Wasser:<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 75: Einschätzung des Experten zu Investitionstätigkeit, Sektor Wasser (Vorbeugendes<br />
Wirtschaftshandeln)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
++ geringste Siedlungs- + höhere Siedlungsdich- + höhere Siedlungs- - hohe Siedlungsdichte<br />
dichte te dichte<br />
+ viele dezentrale + viele dezentrale<br />
Anlagen<br />
Anlagen<br />
Geringere Siedlungsdichte (Szenario A) erfordert höhere Investitionen in Wasser- und Abwassernetze.<br />
Dezentrale Anlagen erfordern höhere Investitionen in Anlagen.<br />
Vorbeugendes Wirtschaftshandeln – Innovationstätigkeit<br />
Es wurden nur Einschätzungen für den Sektor Strom / Gas abgegeben:<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 76: Mittlere Einschätzung der Experten zu Innovationstätigkeit, Sektor Strom und Gas<br />
(Vorbeugendes Wirtschaftshandeln)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ Strukturwechsel<br />
erfordert Innovation<br />
+ Strukturwechsel<br />
erfordert Innovation<br />
± mäßige Innovations- + hohe Innovationsför- + hohe Innovationsför- - geringe Innovationsförderung<br />
derung derung förderung<br />
+ erneuerbare Energieträger<br />
+ Vernetzung dezentraler<br />
Systeme<br />
+ neue Dienstleistungskonzepte<br />
+ erneuerbare Energieträger<br />
+ Vernetzung dezentraler<br />
Systeme<br />
+ neue Dienstleistungskonzepte<br />
Beide Experten sehen den Strukturwechsel in der Energieversorgung, d. h. wachsende Anteile<br />
erneuerbarer Energien und dezentraler Anlagen, sowie die Innovationsförderung als treibende<br />
Kräfte für Innovationen an. Ein Experte nennt zusätzlich neue Dienstleistungskonzepte<br />
als innovationsfördernd.<br />
165
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Erhalt und Entwicklung des Wissenskapitals<br />
Erhalt und Entwicklung des Wissenskapitals — Erhalt und Aufbau von Wissen zu<br />
bestehenden Technologien<br />
Es wurden nur Einschätzungen für den Sektor Strom / Gas abgegeben:<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 77: Mittlere Einschätzung der Experten zu Erhalt und Aufbau von Wissen zu bestehenden<br />
Technologien, Sektor Strom und Gas (Erhalt und Entwicklung des Wissenskapitals)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
- bestehende Techno- - bestehende Techno- + bestehende Techno- + bestehende Technologien<br />
werden in hohem logien werden in hohem logien werden in ähnli- logien werden in ähnli-<br />
Maße durch neue Maße durch neue chem Umfang weiter chem Umfang weiter<br />
ersetzt (noch mehr als<br />
in B)<br />
ersetzt genutzt genutzt<br />
Die Experten sind sich einig, dass beim Einsatz bestehender Technologien das Wissen über<br />
diese erhalten bleibt. Unterschiede in der Einschätzung bestehen darüber, ob Unterschiede<br />
im Umfang der Nutzug bestehender Technologien zu Unterschieden im Wissen über diese<br />
Technologien führen oder nicht. Unstrittig ist ein Rückgang des Wissens über die Kernenergie<br />
in den Szenarien A und B, in denen diese überhaupt nicht mehr genutzt wird, dennoch<br />
berücksichtigt der 3. Experte dies nicht in seiner Rangfolge der Szenarien.<br />
Erhalt und Entwicklung des Wissenskapitals —Aufbau und Entwicklung von Wissen zu<br />
neuen Technologien<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas:<br />
Gleiche Rangfolge bei allen Experten<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 78: Mittlere Einschätzung der Experten zu Aufbau und Entwicklung von Wissen zu neuen<br />
Technologien, Sektor Strom und Gas (Erhalt und Entwicklung des Wissenskapitals)<br />
166
5.3 Ergebnisse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
++ stärkster Einsatz + starker Einsatz neuer ± geringer Einsatz neuer - geringer Einsatz<br />
neuer Technologien Technologien Technologien neuer Technologien<br />
Die Experten sind sich einig, dass das Wissen über neue Technologien mit dem Umfang<br />
ihres Einsatzes steigt. Das Innovationsbudget wird auch als Einflussfaktor genannt, hat<br />
jedoch nur geringen Einfluss auf die Einschätzung der Rangfolge der Szenarien.<br />
Sektor Wasser:<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 79: Einschätzung des Experten zu Aufbau und Entwicklung von Wissen zu neuen Technologien,<br />
Sektor Wasser (Erhalt und Entwicklung des Wissenskapitals)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
± gleich bleibendes + erhöhtes Innovations- + erhöhtes Innovations- - Rückgang des Inno-<br />
Innovationsbudget budget budget vationsbudgets<br />
Hier wird das Innovationsbudget als (einziger) wichtiger Einflussfaktor genannt.<br />
Erhalt und Entwicklung des Wissenskapitals - Erhalt und Entwicklung institutioneller<br />
Innovationen<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 80: Mittlere Einschätzung der Experten zu Erhalt und Entwicklung institutioneller Innovationen<br />
(Erhalt und Entwicklung des Wissenskapitals)<br />
167
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
++ Anlagencontracting ± Anlagencontracting ++ Anlagencontracting + Anlagencontracting<br />
30% 5% 30% 10%<br />
+ Rundum-Sorglos- ± Rundum-Sorglos- ++ Rundum-Sorglos- + Rundum-Sorglos-<br />
Pakete 15% Pakete 5% Pakete 20% Pakete 10%<br />
+ viel Multi-Utility<br />
++ großer Anpassungs- + mäßige Anpassungs- + mäßige Anpassungs- - geringe Anpassungsfähigkeit<br />
staatlicher fähigkeit staatlicher fähigkeit staatlicher fähigkeit staatlicher<br />
Vorschriften Vorschriften Vorschriften Vorschriften<br />
Zwei Experten sehen institutionelle Innovationen in erweiterten Dienstleistungen (Anlagencontracting,<br />
Rundum-Sorglos-Pakete, Multi-Utility), einer außerdem in der Anpassungsfähigkeit<br />
staatlicher Vorschriften, während ein Experte hinsichtlich institutioneller Innovationen<br />
keine Unterschiede zwischen den Szenarien auszumachen vermag.<br />
Funktionsfähigkeit des Marktes<br />
Funktionsfähigkeit des Marktes – pluralistische Marktstruktur<br />
Es wurden nur Einschätzungen für den Sektor Strom / Gas abgegeben:<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D I<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 81: Mittlere Einschätzung der Experten zu pluralistische Marktstruktur, Sektor Strom und<br />
Gas (Funktionsfähigkeit des Marktes)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ Dekonzentration + Dekonzentration - Internationale Oligopole<br />
- Internationale Oligopole<br />
Während zwei Experten für ihre Einschätzung direkt das Szenario-Merkmal „Marktstruktur"<br />
heranziehen, schätzt der dritte Experte die Auswirkungen dieses Merkmals auf den Markt ein<br />
und kommt dabei zu dem Schluss, dass die Marktstruktur in allen vier Szenarien angemessen<br />
ist.<br />
168
5.3 Ergebnisse<br />
Funktionsfähigkeit des Marktes - internationale Wettbewerbsfähigkeit<br />
Es wurden nur Einschätzungen für den Sektor Strom / Gas abgegeben:<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0200 -0,100 0,000 0,100 0200 0,300<br />
Abbildung 82: Mittlere Einschätzung der Experten zu internationale Wettbewerbsfähigkeit, Sektor<br />
Strom und Gas (Funktionsfähigkeit des Marktes)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
- Dekonzentration - Dekonzentration + Oligopole + Oligopole<br />
+ Energiepreisanstieg (+) Energiepreisanstieg ± Energiepreisanstieg (-) Energiepreisanstieg<br />
1% 1,5% 2% 2,5%<br />
- viel Erneuerbare - viel Erneuerbare + Nutzung von Kern- + Nutzung von Kern-<br />
Energien Energien energie energie<br />
Oligopolistische Unternehmen werden als wettbewerbsfähiger eingeschätzt als eine Vielzahl<br />
kleinerer Unternehmen. Ein Anstieg der Energiepreise verringert die Wettbewerbsfähigkeit,<br />
der Einfluss ist jedoch zu relativieren gegenüber anderen Kosten. Erneuerbare Energien<br />
verursachen höhere Stromerzeugungskosten und verringert damit die Wettbewerbsfähigkeit,<br />
während Kernenergie niedrigere Kosten verursacht und damit die Wettbewerbsfähigkeit<br />
erhöht. Die Einschätzungen sind unsicher, weil die internationale Wettbewerbsfähigkeit nur<br />
zu einem Teil von den Bedingungen in Deutschland abhängt, aber der andere Teil, nämlich<br />
die wirtschaftlichen Randbedingungen in den konkurrierenden Ländern, in den Szenarien<br />
nicht angegeben ist. Der dritte Experte sieht die Wettbewerbsfähigkeit in erster Linie durch<br />
Arbeitskosten und nur in einigen Branchen durch Energiekosten beeinflusst und weiterhin<br />
davon abhängig, inwieweit die Kosten an die Kunden weitergegeben werden können. Dennoch<br />
sei die Wettbewerbsfähigkeit nach Einschätzung des dritten Experten in allen Szenarien<br />
gegeben.<br />
Flexibilität<br />
Flexibilität - Innovationsfähigkeit<br />
Kategorie B.I: Sachbezogene Differenzen: Sektorspezifische Betrachtung<br />
Sektor Strom und Gas:<br />
Kategorie B.II.2: Beurteilungsbezogene Differenzen, unterschiedliche Wichtigkeit der Einflussfaktoren<br />
1. Experte: B>C>A>D, Urteilssicherheit 3<br />
2. Experte: A>B>C=D, Urteilssicherheit 2<br />
169
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
A<br />
c<br />
-0200 -0100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 83: Mittlere Einschätzung der Experten zu Innovationsfähigkeit, Sektor Strom und Gas<br />
(Flexibilität)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
1. Experte<br />
± gleich bleibendes<br />
Innovationsbudget<br />
+ erhöhtes Innovationsbudget<br />
+ erhöhtes Innovationsbudget<br />
- Rückgang des<br />
Innovationsbudgets<br />
2. Experte<br />
+ viel Wettbewerb (+) mäßig viel Wettbewerb<br />
(-) weniger Wettbewerb<br />
(-) weniger Wettbewerb<br />
Für den ersten Experten ist das Innovationsbudget entscheidend, nach Einschätzung des<br />
zweiten werden Innovationen durch viel Wettbewerb begünstigt.<br />
Sektor Wasser:<br />
(nur 1 Experte)<br />
A<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 84: Einschätzung des Experten zu Innovationsfähigkeit, Sektor Wasser (Flexibilität)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
± gleich bleibendes + erhöhtes Innovations- + erhöhtes Innovations- - Rückgang des Inno-<br />
Innovationsbudget budget budget vationsbudgets<br />
Hier wird das Innovationsbudget als (einziger) wichtiger Einflussfaktor genannt.<br />
Flexibilität -Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse<br />
Kategorie B.II.1: Geringe beurteilungsbezogene Differenzen<br />
A<br />
B<br />
D<br />
-0,200 -0,100<br />
0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 85: Mittlere Einschätzung der Experten zu Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse<br />
(Flexibilität)<br />
170
5.3 Ergebnisse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ viele kleine und mittlere + viele kleine und mittlere - wenige zentrale - wenige zentrale<br />
Anlagen Anlagen große Anlagen große Anlagen<br />
+ kleinere Unternehmen,<br />
große Zahl an Versorgern<br />
+ höherer Anteil Erdgas<br />
und Erneuerbare Energien<br />
+ kleinere Unternehmen,<br />
große Zahl an Versorgern<br />
+ höherer Anteil Erdgas<br />
und Erneuerbare Energien<br />
+ größere Vielzahl von + größere Vielzahl von<br />
Technologien und Dienstleistungen<br />
Technologien und Dienstleistungen<br />
- hohe Investitionen in<br />
neue Strukturen (z. B.<br />
virtuelle Kraftwerke) behindern<br />
Anpassungsfähigkeit<br />
- kleine Zahl an<br />
Versorgern<br />
- kleine Zahl an<br />
Versorgern<br />
Es besteht weitgehend Übereinstimmung darin, dass kleinere Anlagen und kleinere Unternehmen<br />
anpassungsfähiger sind als große Anlagen und Unternehmen. Weitere Einflussfaktoren,<br />
die von einzelnen Experten genannt werden, ändern die Rangfolge nur unwesentlich.<br />
Einkommensentwicklung<br />
Einkommensentwicklung - Einkommenssteigerung<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 86: Mittlere Einschätzung der Experten zu Einkommenssteigerung (Einkommensentwicklung)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ Wirtschaftswachstum (+) Wirtschaftswachs- + Wirtschaftswachstum ± Wirtschaftswachstum<br />
2 (Yo / a tum 1,5%/a 2%/a 1 %/ a<br />
+ innovative dezentrale<br />
Anlagen<br />
Zwei Experten leiten die Einkommenssteigerung vom Einflussfaktor „Wirtschaftswachstum"<br />
ab. Ein Experte sieht eine Einkommenssteigerung durch neue dezentrale Technologien<br />
begünstigt: »Durch Einführung von dezentralen Anlagen in hohem Maße unter der Vorraussetzung<br />
der Entwicklung neuer Technologien wird eine höhere Produktivität und somit die<br />
Möglichkeit eines Beschäftigungsanstiegs im <strong>Versorgung</strong>ssektor gepaart mit Einkommenszuwächsen<br />
gesehen, allerdings nur in Szenario A aufgrund des höchsten Anteils von dezentralen<br />
Anlagen, bei denen in einem ausreichenden Maße neue Technologien implementiert<br />
werden können, die eine durchschlagende Produktivitätssteigerung bei den betriebenen<br />
dezentralen Anlagen ermöglichen.«<br />
171
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Einkommensentwicklung – Einkommenssicherung<br />
Kategorie B.11.1 b: Beurteilungsbezogene Differenzen, aber gleiche Rangfolge<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Abbildung 87: Mittlere Einschätzung der Experten zu Einkommenssicherung (Einkommensentwicklung)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ innovative dezen- - Beschäftigungsmangel, daher<br />
trale Anlagen<br />
erhebliche Schwierigkeiten bei<br />
der Einkommenssicherung<br />
Der erste Experte sieht die Einkommenssicherung im wesentlichen durch Beschäftigungsmangel<br />
(Zwei-Klassen-Gesellschaft) in Szenario D gefährdet, der zweite Experte sieht eine<br />
Einkommenssteigerung durch neue dezentrale Technologien begünstigt (Argumentation wie<br />
bei Einkommenssteigerung).<br />
5.3.5 Soziale Aspekte<br />
5.3.5.1. Zusammenfassung<br />
Stärken und Schwächen der Szenarien<br />
Im Text des Gutachtens werden keine Aussagen zu einzelnen Kriterien gemacht, »da es<br />
schwer fällt, die Relevanz der Szenarienelemente bezüglich ihrer sozialen Aspekte klar von<br />
einander zu unterscheiden«. Es findet sich aber folgende Gesamtbewertung (Zitat aus dem<br />
Gutachten):<br />
»Insgesamt schneiden [...] unter dem Gesichtspunkt der „sozialen Aspekte" die Szenarien A<br />
und B deutlich besser ab als die Szenarien C und D. Szenario B setzt weniger Aktivismus24<br />
voraus als Szenario A. Es ist insofern pragmatischer und in seinen sozialen Umsetzungsmöglichkeiten<br />
vermutlich besser handhabbar.<br />
Szenario D erscheint insgesamt noch ausschließlicher auf die Logik wirtschaftlicher Zielstellungen<br />
privater Unternehmen zentriert, als das in Szenario C der Fall ist. Es ist damit<br />
zugleich dasjenige, in dem soziale Aspekte vergleichsweise am stärksten am Rande stehen.«<br />
24 Szenario B setzt weniger Aktivismus voraus, weil hier die Entwicklung hauptsächlich in staatlicher<br />
Regie verläuft, während in Szenario A zunächst der gesellschaftliche Konsens hergestellt werden<br />
muss.<br />
172
5.3 Ergebnisse<br />
Wesentliche Einflussfaktoren<br />
Positiv für soziale Aspekte sind die nur in Szenario A ausgeprägte öffentliche Konsensbildung<br />
und die besonders in Szenario B, mit Abstrichen auch in Szenario A vorhandene Setzung<br />
von Standards durch den Staat. Negativ sind ausschließlich an der Wirtschaftlichkeit orientierte<br />
Handlungen und Maßnahmen.<br />
Die Einflussfaktoren im Überblick:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
Akzeptanz + öffentliche Kon- (-) Wirtschaftlich- - Wirtschaftlich- - Wirtschaftlichsensbildung<br />
keitsüberlegungen keitsüberlegungen keitsüberlegungen<br />
Transparenz (+) durch öffentli- + staatlich verordne- - wenig Interesse - wenig Interesse<br />
chen Konsens tes Umwelt- und an Umwelt- und an Umwelt- und<br />
getragenes Umweltund<br />
Preislabeling<br />
Preislabeling Preislabeling Preislabeling<br />
Politik und (+) soziale Rah- + soziale Rahmen- - soziale Rahmen- - soziale Rahmen-<br />
Wirtschaft menbedingungen bedingungen und bedingungen und bedingungen und<br />
und Standards im Standards in staatli- Standards bleiben Standards bleiben<br />
Konsens cher Regie Unternehmen überlassen<br />
Unternehmen überlassen<br />
Innovations- (-) der Innovations- + gezielte Innovati- (-) Innovationsför- - generell zu wenig<br />
förderung förderung mangelt onsförderung auch derung nur im Innovationsfördean<br />
finanzieller<br />
Masse<br />
in sozialer Hinsicht Hinblick auf Wirtschaftlichkeit<br />
rung<br />
Marktstruktur (+) dezentralisierte + gut regulierte - hohe Unterneh- - hohe Unternehund<br />
Regulierunte<br />
aber wenig regulier-<br />
Marktstruktur menskonzentration menskonzentration<br />
Marktstruktur<br />
Die Kriterien lassen sich nach der Einschätzung der Rangfolge der Szenarien in zwei Kategorien<br />
einteilen.<br />
Bei 11 der 23 Kriterien wurde die Rangfolge der Szenarien mit B>A>C>D oder B>A>C=D<br />
eingeschätzt. Dies sind die Kriterien aus der Gruppe „Soziale Gerechtigkeit" (mit Ausnahme<br />
von „Sozialverträgliche Preise"), die Gruppe „Transparenz" und das Kriterium „Gleichheit der<br />
Lebensverhältnisse" aus der Gruppe „Regionale Gerechtigkeit".<br />
Haupteinflussfaktor für diese Einschätzung ist die besonders in Szenario B stattfindende<br />
staatliche Regelung der entsprechenden Bereiche. Zitat: »Eine moderierende Rahmung und<br />
ein politischer Abschluss derartiger Prozesse [Setzung von Rahmenbedingungen und Standards]<br />
in staatlicher Regie dürfte jedoch in der Regel breitere Möglichkeiten bieten, dem<br />
Gebot sozialer Gerechtigkeit zu entsprechen, als wenn dies den Unternehmen und ihren<br />
Wirtschaftlichkeitserwägungen vorbehalten bleibt.« »Am sozial akzeptabelsten erscheint<br />
Szenario B mit einer hohen, aber sowohl im Einsatz der Instrumente als auch in der Zieldimension<br />
differenzierten Perspektive. Hier kann am breitesten versucht werden, [...] den<br />
sechs Teilzielen des Zielkatalogs „soziale Gerechtigkeit", den beiden Teilzielen des Zielkatalogs<br />
„Regionale Gerechtigkeit" und in Grenzen auch den fünf Teilzielen des Zielkatalogs<br />
„Soziale Sicherheit" zu entsprechen. [...]<br />
Innovationen und die Diffusion entsprechender Produkte und Dienstleistungen berühren aber<br />
zugleich auch die Seite der Arbeitsanforderungen („humane Arbeitsanforderungen") und der<br />
Verdienstmöglichkeiten („Sicherung angemessener Mindestlöhne").<br />
173
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Vor diesem Hintergrund besitzt auch Szenario A eine gewisse soziale Resonanzfähigkeit.<br />
Szenario C und Szenario D sind gegenüber den hier zur Debatte stehenden sozialen Anforderungen<br />
eher zu eng. Die hohe Unternehmenskonzentration stellt darüber hinaus auch ein<br />
Machtpotential dar, das nur schwer zu beeinflussen ist, wenn es sich erst einmal konsolidiert<br />
hat.<br />
Im Falle gravierender Umbrüche in der Fertigung, in der Produktstruktur, in der quantitativen<br />
Bedeutung herkömmlicher Produkte einerseits und neuer Produkte andererseits werden aber<br />
wohl – vorübergehend oder auf Dauer – auch überkommene soziale Sicherheiten in Frage<br />
gestellt und neue Möglichkeiten und Grenzen gesetzt. Insofern können auch die Teilziele<br />
„Sozialverträgliche Gestaltung des Beschäftigungswandels" und im Extremfall und bezogen<br />
auf das speziell betroffene Beschäftigungssegment auch der „Erhalt sozialer Sicherungssysteme"<br />
oder gar der „Vermeidung von Armut" berührt werden.«<br />
Bei der anderen Kategorie von Kriterien (12 von 23) ist die Rangfolge A>B>C>D oder<br />
A>B>C=D. Hierunter fallen „Sozialverträgliche Preise", „Internationale Verteilungsgerechtigkeit"<br />
und die Kriterien in den Gruppen „Partizipation", „Soziale Sicherheit" und „Erhalt der<br />
sozialen Ressourcen".<br />
Beim Kriterium „Sozialverträgliche Preise" ist die Höhe der Verbraucherpreise ausschlaggebend,<br />
die in Szenario A am niedrigsten ist. Für andere Kriterien dieser Kategorie ist als Einflussfaktor<br />
die Unternehmenskonzentration angegeben, die in Szenario A am geringsten ist.<br />
Zitat: »Die hohe Unternehmenskonzentration stellt [...] ein Machtpotential dar, das nur mehr<br />
schwer zu beeinflussen ist, wenn es sich erst einmal konsolidiert hat. Im Falle gravierender<br />
Umbrüche in der Fertigung, in der Produktstruktur, [...] werden aber [...] auch überkommene<br />
soziale Sicherheiten in Frage gestellt und neue Möglichkeiten und Grenzen gesetzt. Insofern<br />
können auch die Teilziele „Sozialverträgliche Gestaltung des Beschäftigungswandels" und im<br />
Extremfall und bezogen auf das speziell betroffene Beschäftigungssegment auch der „Erhalt<br />
sozialer Sicherungssysteme" oder gar der „Vermeidung von Armut" berührt werden. Machtkonzentrationen<br />
dieses Umfangs erscheinen nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der<br />
sozialen Teilziele „Übernahme von Verantwortung der Gesellschaft für nachfolgende Generationen"<br />
und „Übernahme von Verantwortung von Unternehmen in Entwicklungsländern"<br />
bedenklich.«<br />
Hinsichtlich „Partizipation" und „Transparenz" »schneidet Szenario A vergleichsweise am<br />
positivsten ab, weil hier die öffentliche Konsensbildung im Vordergrund steht. Wirtschaftlichkeitsüberlegungen<br />
als zusätzliches bzw. auf konträre praktische Konsequenzen (weniger<br />
Transparenz bei Preisen und Öko-Anforderungen) zielendes Kriterium wie in Szenario B<br />
dürften nur bedingt als sozial angemessen akzeptiert werden. Die Szenarien C und D erscheinen<br />
vor diesem Hintergrund als kaum akzeptanzfähig.<br />
Es ist allerdings davon auszugehen, dass das in Szenario A angenommene hohe Interesse<br />
an öffentlicher Aushandlung nicht durchgängig relevant sein wird. [...] Solange sie keine<br />
spektakulären und entsprechend skandalisierbaren Defizite aufweisen, dürfte sich das hohe<br />
Interesse an Gesundheitsverträglichkeit und Ressourceneffektivität neuer Produkte eher im<br />
Sinne entsprechender Kontroll- und Regulierungsanforderung an den Staat auswirken. [...]<br />
Unter dem Gesichtspunkt sozialer Gerechtigkeit ist dies auch die naheliegende Option für<br />
jene Teile der Bevölkerung, die [...] als materiell weniger gut gestellt, oft weniger gut informiert<br />
und gesellschaftlich weniger artikulationsgewohnt und -interessiert angesprochen<br />
werden: Während es für [die wohlhabenden Teile der Bevölkerung] eine Frage der Pragmatik<br />
174
5.3 Ergebnisse<br />
ist, sich nur in herausragenden Fällen öffentlich einzumischen, im übrigen aber den Staat als<br />
eine Art Dienstleister für die Einhaltung von Standards verantwortlich zu machen, ist es [...]<br />
stärker eine Frage des Schutzes und der Fürsorglichkeit in Bezug auf schwächere Teile der<br />
Bevölkerung.<br />
In beiderlei Hinsicht ist ein staatlich verordnetes Umwelt- und Preislabeling die naheliegendste<br />
Option. Diese wird aber nicht in Szenario A, sondern in Szenario B am deutlichsten profiliert.<br />
Szenario C und D können insofern als sozial am wenigsten angemessen und akzeptanzfähig<br />
gelten.« (Zitat)<br />
5.3.5.2. Einzelbeschreibungen<br />
Soziale Gerechtigkeit<br />
Sozialverträgliche Preise für Haushalte<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Abbildung 88: Einschätzung des Experten zu Sozialverträgliche Preise für Haushalte (Soziale Gerechtigkeit)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ Preissteigerung f. (+) Preissteigerung f. (-) Preissteigerung f. - Preissteigerung f.<br />
Strom u. Gas 1%/a Strom u. Gas 1,5%/a Strom u. Gas 2`)/o/a Strom u. Gas 2,5%/a<br />
Die sozialverträglichen Preise können unmittelbar aus der in der Szenariobeschreibung<br />
angegebenen Preisentwicklung abgeleitet werden.<br />
Gleichberechtigter Zugang zu Ressourcen, Gewährleistung einer Grundversorgung für<br />
alle, faire Rechts- und Vertragsgestaltung, vertretbares Wohlstandsgefälle,<br />
Geschlechtergerechtigkeit<br />
Abbildung 89: Einschätzung des Experten zu Gleichberechtigter Zugang zu Ressourcen (Soziale<br />
Gerechtigkeit)<br />
0,400<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Abbildung 90: Einschätzung des Experten zu Gewährleistung einer Grundversorgung für alle (Soziale<br />
Gerechtigkeit)<br />
175
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
B<br />
c<br />
-0,200 -0,100 0,0000,100 0200 0,300 0,400<br />
Abbildung 91: Einschätzung des Experten zu den 3 Kriterien Faire Rechts- und Vertragsgestaltung,<br />
Vertretbares Wohlstandsgefälle und Geschlechtergerechtigkeit (Soziale Gerechtigkeit)<br />
Diese 5 Kriterien des Bereichs Soziale Gerechtigkeit sieht der Gutachter am ehesten durch<br />
staatliche Setzung von Rahmenbedingungen und Standards erfüllt.<br />
Erhaltung der sozialen Ressourcen<br />
Übernahme von Verantwortung der Gesellschaft für nachfolgende Generationen<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Abbildung 92: Einschätzung des Experten zu Übernahme von Verantwortung der Gesellschaft für<br />
nachfolgende Generationen (Erhaltung der sozialen Ressourcen)<br />
Übernahme von Verantwortung der <strong>Versorgung</strong>sunternehmen für die<br />
Daseinsvorsorge, Übernahme von Verantwortung von Unternehmen in<br />
Entwicklungsländern<br />
B<br />
L<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Abbildung 93: Einschätzung des Experten zu Übernahme von Verantwortung der <strong>Versorgung</strong>sunternehmen<br />
für die Daseinsvorsorge (Erhaltung der sozialen Ressourcen)<br />
B<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Abbildung 94: Einschätzung des Experten zu Übernahme von Verantwortung von Unternehmen in<br />
Entwicklungsländern (Erhaltung der sozialen Ressourcen)<br />
Wichtigste Einflussgrößen für die Gruppe „Erhaltung der sozialen Ressourcen":<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ Unternehmenskon- (+) Unternehmenskon- - Unternehmenskon- - Unternehmenskonzentration<br />
gering zentration etwas höher zentration hoch zentration hoch<br />
Der Gutachter führt für diese Gruppe von Kriterien als Einflussfaktor die Unternehmenskonzentration<br />
an, die in Szenario A am geringsten ist.<br />
176
5.3 Ergebnisse<br />
Soziale Sicherheit<br />
Vermeidung von Armut, Erhalt sozialer Sicherungssysteme, Sicherung angemessener<br />
Mindestlöhne, Sicherung humaner Arbeitsbedingungen, Sozialverträgliche Gestaltung<br />
des Beschäftigungswandels<br />
A<br />
1<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Abbildung 95: Einschätzung des Experten zu Soziale Sicherheit<br />
Wichtigste Einflussgrößen für die Gruppe „Soziale Sicherheit":<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ Unternehmenskon- (+) Unternehmenskon- - Unternehmenskon- - Unternehmenskonzentration<br />
gering zentration etwas höher zentration hoch zentration hoch<br />
Der Gutachter führt für diese Gruppe von Kriterien als Einflussfaktor die Unternehmenskonzentration<br />
an, die in Szenario A am geringsten ist.<br />
Regionale Gerechtigkeit<br />
Internationale Verteilungsgerechtigkeit der Ressourcennutzung<br />
A<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Abbildung 96: Einschätzung des Experten zu Internationale Verteilungsgerechtigkeit der Ressourcennutzung<br />
(Regionale Gerechtigkeit)<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
+ Unternehmenskon- (+) Unternehmenskon- - Unternehmenskon- - Unternehmenskonzentration<br />
gering zentration etwas höher zentration hoch zentration hoch<br />
Obwohl der Gutachter für dieses Kriterium als Einflussfaktor die staatliche Setzung von<br />
Rahmenbedingungen und Standards angibt, dürfte angesichts der angegebenen Rangfolge<br />
die Unternehmenskonzentration der Haupteinflussfaktor sein, die bei anderen Kriterien explizit<br />
genannt ist und von der Begründung her auch hier zutreffen könnte.<br />
Gleichheit der Lebensverhältnisse<br />
B<br />
c<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Abbildung 97: Einschätzung des Experten zu Gleichheit der Lebensverhältnisse (Regionale Gerechtigkeit)<br />
177
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Wichtigste Einflussgrößen:<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
Primat von Klima und Staat setzt sich gegen Wirtschaftlichkeit steht Wirtschaftlichkeit steht<br />
Umwelt im gesellschaft- Unternehmensinteres- im Vordergrund im Vordergrund<br />
lichen Konsens sen zugunsten von Zwei-Klassen-<br />
Klima und Umwelt durch<br />
Gesellschaft, finanzkräftige<br />
Oberschicht<br />
Der Gutachter sieht die regionale Gerechtigkeit am ehesten durch staatliche Setzung von<br />
Rahmenbedingungen und Standards erfüllt.<br />
Transparenz<br />
Verständlichkeit der Verbraucher-Information und Verträge, Angabe der Höhe der<br />
Preise, Angabe der Preisbestandteile, Angabe der Leistungsbestandteile, Angabe der<br />
Marktstrukturen<br />
A<br />
B<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Abbildung 98: Einschätzung des Experten zu Verständlichkeit der Verbraucher-Information und Verträge<br />
(Transparenz)<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Abbildung 99: Einschätzung des Experten zu Angabe der Höhe der Preise (Transparenz)<br />
A<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Abbildung 100: Einschätzung des Experten zu den 3 Kriterien Angabe der Preisbestandteile, Angabe<br />
der Leistungsbestandteile und Angabe der Marktstrukturen (Transparenz)<br />
Wichtigste Einflussgrößen für die Gruppe „Transparenz":<br />
Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
(+) Verbraucherinteres- + staatlich verordnetes Verbraucherinteresse an Kein Verbraucherintese<br />
an Umwelt- und Umwelt- und Preislabeling<br />
Preislabeling<br />
resse an Labeling<br />
Preislabeling<br />
Der Gutachter sieht die Transparenz durch staatlich verordnetes Labeling am besten gewährleistet.<br />
Dies ist in Szenario B am deutlichsten ausgeprägt.<br />
178
5.3 Ergebnisse<br />
Partizipation<br />
Gesellschaftliche Zielformulierung, Planungsverfahren<br />
B<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Abbildung 101: Einschätzung des Experten zu Gesellschaftliche Zielformulierung (Partizipation)<br />
c<br />
D<br />
-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Abbildung 102: Einschätzung des Experten zu Planungsverfahren (Partizipation)<br />
Der Gutachter gibt für die Kriterien der Gruppe „Partizipation" explizit keinen Einflussfaktor<br />
an. Von der eingeschätzten Rangfolge her könnten als Einflussfaktoren die Unternehmenskonzentration<br />
(in Szenario A am geringsten) oder die Akzeptanz (Szenario A: gesellschaftlicher<br />
Konsens für das Primat von Klima und Umwelt) zutreffen.<br />
5.3.6 Zusammenfassung<br />
Bei den meisten Kriterien gaben die Gutachter keine quantitativen Einschätzungen ab. Dies<br />
liegt einerseits daran, dass die dafür erforderlichen Informationen in den Szenariobeschreibungen<br />
nicht oder nicht ausreichend detailliert enthalten sind, andererseits ist bei vielen der<br />
Kriterien (wie z. B. Artenschutz, Reversibilität des <strong>Versorgung</strong>ssystems, Innovationsfähigkeit)<br />
offen, über welche Indikatoren sie quantifiziert werden könnten. Die AHP-Methode 25 erlaubt<br />
es dennoch, mittels Paarvergleichen relative Urteile über die Ausprägungen der Szenarien<br />
auf den Kriterien abzugeben26.<br />
Außer im Bereich „soziale Aspekte" musste bei den meisten Kriterien sachbezogen zwischen<br />
dem Sektor „Strom und Gas" und dem Sektor „Wasser" differenziert werden. Zum einen<br />
unterscheidet sich der Beurteilungsgegenstand, so ist z. B. die „Sicherheit des Netzes" für<br />
das Stromversorgungsnetz etwas anderes als für das Wasserversorgungsnetz. Zum anderen<br />
unterscheidet sich die Ausprägung der Dezentralität in den beiden Sektoren: Der Anteil dezentraler<br />
Stromerzeugungsanlagen ist in den Szenarien A und B am höchsten, der Anteil<br />
dezentraler Wasserver- und -entsorgungsanlagen in den Szenarien A und D.<br />
Für alle Kriterien, die sektorübergreifend oder spezifisch für den Sektor Strom und Gas beurteilt<br />
wurden, liegen Experteneinschätzungen vor, dagegen wurde für den Sektor Wasser für<br />
einige Kriterien keine Einschätzung abgegeben.<br />
Die Grafiken mit den Einschätzungen der Experten sind in den Tabellen 21 bis 25 im Anschluss<br />
an diese Zusammenfassung noch einmal im Überblick dargestellt.<br />
25 beschrieben im Abschnitt 2.2.3<br />
26 beschrieben im Abschnitt 5.1.3<br />
179
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Die meisten beurteilungsbezogenen Differenzen zwischen den Experten traten im Bereich<br />
„<strong>Versorgung</strong>ssicherheit" auf (bei 43% der Kriterien) im Vergleich zu den Bereichen „Umweltschutz"<br />
(24%) und „Wirtschaft" (20%). Der größte Teil der Differenzen im Bereich „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit"<br />
beruht auf unterschiedlicher Auffassung darüber, ob die Kriterien „Sicherheit<br />
des Netzes", "Sicherheit der Anlagen", „Reversibilität innerhalb des <strong>Versorgung</strong>ssystems"<br />
und „technologische Diversität" besser durch kleine, dezentrale Anlagen und erneuerbare<br />
Energien oder durch große, zentrale Anlagen und konventionelle Energieträger zu erfüllen<br />
sind. Ein dritter Standpunkt hierzu ist, dass diese Kriterien sowohl mit dezentralen als auch<br />
mit zentralen Anlagen zu erfüllen seien, es hier vielmehr darauf ankomme, wie viel in die<br />
technische Zuverlässigkeit investiert werde (was aber in den Szenariobeschreibungen nicht<br />
spezifiziert ist). Der zweite Komplex wichtiger Beurteilungsunterschiede liegt in einer vermuteten<br />
Inkonsistenz der Szenariobeschreibungen: Es wurde bezweifelt, ob in Szenario A angesichts<br />
hoher Investitionen (insbesondere in dezentrale Anlagen) und durch dezentrale<br />
Systeme und verstärkte Dienstleistungsangebote bedingter hoher Beschäftigung die laut<br />
Szenariobeschreibung niedrigen Preise kostendeckend sein könnten.<br />
Bei der Mehrzahl der Kriterien werden zwar die Szenarien A und B besser eingeschätzt als C<br />
und D, jedoch hat insbesondere Szenario A auch Schwächen. Im Bereich „soziale Aspekte"<br />
ist Szenario A die bessere Zukunftsoption hinsichtlich „sozialer Sicherheit" und „Partizipation",<br />
entsprechend dem Szenarioelement des gesellschaftlichen Konsenses, Szenario B<br />
hinsichtlich „sozialer Gerechtigkeit" und „Transparenz', entsprechend dem Szenarioelement<br />
der staatlichen Regulierung. Im Bereich „Umweltschutz" liegen die Szenarien A und B vorn<br />
bei der „Schonung von Rohstoffen" und der „Minderung der CO 2-Emissionen" sowie im „Gesundheitsschutz"<br />
beim „Schutz vor Luftimmissionen", allein schon wegen des Energiemixes<br />
(verstärkte Nutzung von Erdgas und erneuerbaren Energien gegenüber Kohle). Schwächen<br />
zeigt Szenario A bei „Landschaftsschutz', „Artenschutz" und „Schonung von Flächen" wegen<br />
der dezentralen Siedlungsstruktur, sowie beim „Materialverbrauch", der bei kleinen dezentralen<br />
Anlagen höher ist als bei großen zentralen. Die Szenarien C und D haben eine eindeutige<br />
Stärke im Bereich „wirtschaftliche Aspekte" bei der „internationalen Wettbewerbsfähigkeit",<br />
das wird allerdings erkauft mit mangelnder „pluralistischer Marktstruktur", geringerer „Investitionstätigkeit",<br />
geringerer „Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse" und höheren<br />
„Verbraucherpreisen".<br />
Für eine Gesamtbewertung ist wesentlich, ob beispielsweise die Kriterien, bei denen A besonders<br />
gut abschneidet, seitens der gesellschaftlichen Akteure ein hohes Gewicht erhalten<br />
oder die Kriterien, bei denen A besonders schlecht abschneidet. Die Gesamtbewertung wird<br />
im abschließenden Ergebnisworkshop vorgenommen, siehe Kapitel 6.<br />
180
Bodenbel. d. Unfälle; Deponieraum<br />
f. radioakt. u. tox. Abfälle<br />
langfristige Schadstoffakkumulationen<br />
im Boden<br />
Übernutzung landwirtschaftlicher<br />
Flächen<br />
Schonung von Rohstoffen<br />
(Brennstoffen)<br />
Tabelle 21: Überblick über die Experten-Einschätzungen im Bereich Umweltschutz<br />
181
A<br />
B<br />
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Die Tabelle für den Bereich „Gesundheitsschutz“ befindet sich aus Platzgründen auf Seite 184.<br />
Räumliche Verfügbarkeit<br />
in Ballungsräumen und Randlagen<br />
Strom / Gas<br />
Wasser<br />
0,100 0,200 0,300<br />
in ländlichen Räumen<br />
0,000<br />
0,100 0,200 0,300<br />
Allzeitige Verfügbarkeit<br />
0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Kostengünstige Verfügbarkeit<br />
0,000<br />
0,100 0,200 0,300<br />
Verminderung von Störpotentialen<br />
Sicherheit des Netzes<br />
0,000<br />
0,300<br />
Sicherheit der Anlagen<br />
Anpassungsfähigkeit des <strong>Versorgung</strong>ssystems<br />
Erhalt der Reversibilität innerhalb<br />
des <strong>Versorgung</strong>ssystems<br />
- 0,100 0,000<br />
0,300<br />
Fehlertoleranz<br />
Qualität der <strong>Versorgung</strong><br />
Qualitätsniveau<br />
Angebot einer Vielzahl von<br />
<strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
Mittel- bis langfristig gesicherte Verfügbarkeit<br />
Unabhängigkeit von knappen<br />
Ressourcen<br />
Diversifikation der <strong>Versorgung</strong>squellen<br />
Diversifikation der Bezugsquellen<br />
Technologische Diversität<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
- 0,200 - 0,100 0,000 0,100 0,200 0,3<br />
Tabelle 22: Überblick über die Experten-Einschätzungen im Bereich <strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
182
- 0,200 - 0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
5.3 Ergebnisse<br />
A<br />
Sicherung und Steigerung der<br />
B<br />
C<br />
D<br />
Beschäftigung- 0,200<br />
Wasser<br />
- 0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Funktionsfähigkeit des Marktes<br />
Pluralistische Marktstruktur<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
- 0,200<br />
0,200 0,300<br />
Internationale Wettbewerbsfähigkeit<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
Vorbeugendes Wirtschaftshandeln<br />
Investitionstätigkeit<br />
0,000<br />
0,100 0,200 0,300<br />
Innovationstätigkeit<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
- 0,200 0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Kostendeckende Preise<br />
für Investitionskosten<br />
für Betriebskosten<br />
für Abgaben<br />
für internalisierte Kosten<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
- 0,200 - 0,100 0,100<br />
0,200<br />
0,300<br />
- 0,200<br />
-0,100<br />
0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Einkommensentwicklung<br />
Einkommenssteigerung<br />
Einkommenssicherung<br />
Effizienz der Leistungserstellung<br />
-0,200 -0,100<br />
0,000 0,100<br />
0,200<br />
0,300<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
- 0,2<br />
- 0,100<br />
0,000 0,100<br />
0,200 0,300<br />
Flexibilität<br />
A<br />
Innovationsfähigkeit<br />
B<br />
C<br />
D<br />
-0,200<br />
-0,100 0,000<br />
0,100<br />
Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
- 0,200<br />
- 0,100<br />
0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Erhalt und Entwicklung des Wissenskapitals<br />
Aufbau u. Entw. v. Wissen z.<br />
bestehend. Technolog.<br />
Erhalt und Entwicklung institutioneller<br />
Innovationen<br />
Aufbau u. Entw. v. Wissen zu<br />
neuen Technologien<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
- 0,200<br />
- 0,100 0,000 0,200 0,300<br />
Tabelle 23: Überblick über die Experten-Einschätzungen im Bereich Wirtschaftliche Aspekte<br />
183
A<br />
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Wasser<br />
Schutz vor Luftimmissionen<br />
Schutz vor radioaktiver<br />
Strahlung<br />
Schutz vor EMF<br />
B<br />
C<br />
D<br />
- 0,200 - 0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Schutz vor Belastung des<br />
Rohwassers / Trinkwassers<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
- 0,200 - 0,100 0,000 0,100 0,200 0,300<br />
Tabelle 24: Überblick über die Experten-Einschätzungen im Bereich Gesundheitsschutz<br />
Soziale Gerechtigkeit<br />
Sozialverträgliche Preise<br />
Gleichberechtigter Zugang zu Ressourcen<br />
Grundversorgung für alle<br />
Faire Rechts- und Vertragsgestaltung<br />
Vertretbares Wohlstandsgefälle<br />
Gesch lechtergerechtig keit<br />
- 0,200 - 0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Regionale Gerechtigkeit<br />
Internationale Verteilungsgerechtigkeit der Ressourcennutzung<br />
Gleichheit der Lebensverhältnisse<br />
0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Partizipation<br />
Gesellschaftliche Zielformulierung<br />
Planungsverfahren<br />
Transparenz<br />
Verständlichkeit der Verbraucher-Information<br />
Angabe der Höhe der Preise<br />
Angabe der Preisbestandteile<br />
Angabe der Leistungsbestandteile<br />
Angabe der Marktstrukturen<br />
Soziale Sicherheit<br />
Vermeidung von Armut<br />
Erhalt sozialer Sicherungssysteme<br />
Sicherung angemessener Mindestlöhne<br />
Sicherung humaner Arbeitsbedingungen<br />
Sozialverträgliche Gestaltung des Beschäftigungswandels<br />
0,100 0,200 0,300 0,400<br />
- 0,200 - 0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
- 0,200 - 0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Erhaltung der sozialen Ressourcen<br />
Übern. v. Verantw. d. Gesellschaft f. nachfolgende Generationen<br />
Übern. v. Verantw. d. <strong>Versorgung</strong>suntern. f. d. Daseinsvorsorge<br />
Übern v Verantw v Unternehmen in Entwicklungsländern<br />
- 0,200 - 0,100 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400<br />
Tabelle 25: Überblick über die Experten-Einschätzungen im Bereich Soziale Aspekte<br />
184
5.3 Ergebnisse<br />
5.3.7 Dezentralisierung und Nachhaltigkeit<br />
Die vier Varianten zukünftiger Entwicklung <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong> unterscheiden sich –<br />
gemäß der Ausgangsfrage (siehe Abschnitt 1.1) – vor allem hinsichtlich ihres De-/Zentralisierungsgrades.<br />
Bei der Zentralisierung oder Dezentralisierung ist zu unterscheiden zwischen<br />
Einflüssen durch dezentrale Anlagen zur Stromversorgung, durch dezentrale Anlagen zur<br />
Abwasseraufbereitung und durch dezentrale wirtschaftliche Strukturen der <strong>Versorgung</strong>sunternehmen.<br />
Im Folgenden wird daher untersucht, welchen Einfluss die Zentralisierung oder Dezentralisierung<br />
auf die Ausprägung der Kriterien seitens der Experteneinschätzungen hat. Einflüsse<br />
aus dem Sektor Telekommunikation spielen nach Einschätzung der Experten fast keine<br />
Rolle.<br />
Die Stärken dezentraler Anlagen liegen bei der Schonung der Wasserreserven, der Diversifikation<br />
der <strong>Versorgung</strong>squellen, dem Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen und<br />
der Einkommenssteigerung und -sicherung. Die Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse<br />
wird sowohl durch dezentrale Anlagen als auch durch dezentrale Wirtschaftsstrukturen gefördert.<br />
Schwächen zeigen dezentrale Anlagen bei der kostengünstigen Verfügbarkeit und in<br />
gleicher Weise bei der Effizienz der Leistungserstellung. Sie sind außerdem ungünstig für die<br />
Schonung von Materialien. Die Auswirkung dezentraler Anlagen auf die Sicherheit von Netzen<br />
und Anlagen und die Fehlertoleranz wird von den Experten unterschiedlich eingeschätzt.<br />
Im Detail sind die Wirkungen dieser Einflüsse auf die Kriterien in der folgenden Tabelle zusammengestellt.<br />
185
Teil II Empirische Untersuchung: 5. Impact-Analyse<br />
Kriterium<br />
dezentrale<br />
Stromerzeugung<br />
Umweltschutz: Schonung von Materialien -<br />
dezentrale<br />
Abwasseraufbereitung<br />
": Schutz von Trinkwasserreservoiren +<br />
": Schonung von Wasser + +<br />
": Vermeidung von Schadstoffeinträgen in Wasserquellen + / -<br />
": Vermeidung von langfristigen Schadstoffakkumulationen<br />
im Boden<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit: Diversifikation von <strong>Versorgung</strong>squellen<br />
": Technologische Diversität + / - +<br />
+<br />
-<br />
dezentrale<br />
Wirtschaftsstrukturen<br />
": Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen + + +<br />
": Allzeitige Verfügbarkeit -<br />
": Kostengünstige Verfügbarkeit - -<br />
": Räumliche Verfügbarkeit -<br />
": Sicherheit des Netzes + : -<br />
": Sicherheit der Anlagen + : - -<br />
": Erhalt der Reversibilität + : -<br />
": Fehlertoleranz + : -<br />
Wirtschaftliche Aspekte: Sicherung und Steigerung der<br />
Beschäftigung<br />
+ +<br />
": Effizienz der Leistungserstellung - -<br />
": Investitionstätigkeit + +<br />
": Innovationstätigkeit +<br />
": Pluralistische Marktstruktur +<br />
": Internationale Wettbewerbsfähigkeit -<br />
": Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse + + +<br />
": Einkommenssteigerung + +<br />
": Einkommenssicherung + +<br />
Gesundheitsschutz: Schutz vor Belastung des Wassers + / -<br />
Soziale Aspekte: (Kein Einfluss)<br />
Hierin bedeutet:<br />
+ Dezentralität hat positiven Einfluss auf Erfüllung des Kriteriums<br />
- Dezentralität hat negativen Einfluss auf Erfüllung des Kriteriums<br />
+ / - Dezentralität hat sowohl positiven als auch negativen Einfluss<br />
+ : - der Einfluss wird von verschiedenen Experten unterschiedlich eingeschätzt<br />
Bei den CO2-Emissionen und dem Rohstoffverbrauch wurde die Dezentralität nicht als Einflussfaktor<br />
genannt. Sie hat darauf allerdings indirekt einen Einfluss, falls sie zu einem höheren Anteil von Kraft-<br />
Wärme-Kopplung bei der Stromerzeugung führt.<br />
Tabelle 26: Einfluss von Zentralisierung und Dezentralisierung auf die Ausprägung der Kriterien<br />
186
6.1 Ansatz<br />
6. Ergebnisworkshop<br />
Der Ergebnisworkshop ist der letzte Schritt des hier vorgeschlagenen Verfahrens. Im Folgenden<br />
sind Ansatz, Durchführung und Ergebnisse beschrieben.<br />
6.1 Ansatz<br />
Im Ansatz der multi-kriteriellen Bewertung kommen den im Verfahren involvierten Akteuren<br />
unterschiedliche Rollen zu. Faktenwissen wird von den wissenschaftlichen Experten geliefert,<br />
Ziel- bzw. Wertewissen von den gesellschaftlichen Akteuren. Es sind nicht die gesellschaftlichen<br />
Akteure, die aus ihrer Interessensperspektive heraus beurteilen, wie gut oder<br />
schlecht die Zukunftsszenarien Nachhaltigkeitszielen entsprechen. Es sind vielmehr die<br />
wissenschaftlichen Experten, die dies einschätzen (siehe Abschnitt 2.3.2). Gesellschaftliche<br />
Akteure beurteilen, für wie bedeutsam sie die jeweiligen Nachhaltigkeitswirkungen der Szenarien<br />
vor dem Hintergrund ihrer Zielvorstellungen und Interessen erachten. Die Zukunftsszenarien<br />
und ihre von den Experten eingeschätzten Wirkungen sind die Ausgangsbasis, um<br />
unterschiedliche Zielvorstellungen nicht abstrakt, sondern im konkreten „virtuellen" Kontext<br />
zu entwickeln, zu reflektieren und sich darüber auszutauschen. Der Ergebnisworkshop zielt<br />
darauf ab, gemeinsam Zielkorridore und Zielhierarchien auszuloten. Dabei geht es um folgende<br />
Fragen:<br />
• Welche Nachhaltigkeitsziele sind besonders wichtig bei der Entscheidung für einen Zukunftspfad<br />
in der <strong>Versorgung</strong>?<br />
• Warum muss darauf besonders geachtet werden?<br />
• Welche Vor- und Nachteile werden den Zukunftsszenarien attestiert?<br />
• Gibt es gemeinsam getragene Prioritäten, wenn es um Zukunftsentscheidungen in der<br />
<strong>Versorgung</strong> geht?<br />
• Gibt es gemeinsame Vorstellungen darüber, was erwartbar und machbar sein könnte?<br />
Die Herausforderung für die Konzeption des Ergebnisworkshops war es, ein Setting zu<br />
schaffen, das a) statt eines Dialogs über Positionen zwischen den gesellschaftlichen Akteuren,<br />
z. B. zur dezentralen <strong>Versorgung</strong>, einen Dialog über Interessen und Zielvorstellungen<br />
ermöglicht und b) strategisch vorgefertigte Einschätzungen der Pro's und Kontra's der Zukunftsszenarien<br />
überwindet zugunsten eines offeneren Dialogs über Chancen und Risiken<br />
der Zukunftsszenarien.<br />
6.2 Durchführung<br />
Insgesamt 16 Teilnehmer der bereits im Vorfeld involvierten Akteure nahmen am zweitägigen<br />
Workshop teil. Im Workshop wurde die unterschiedliche Rollenverteilung zwischen den gesellschaftlichen<br />
Akteuren (12 Teilnehmer) und den wissenschaftlichen Experten (4 Teilnehmer)<br />
explizit eingeführt.<br />
Nachfolgend sind die Bausteine des Workshops aufgeführt.<br />
187
Teil II Empirische Untersuchung: 6. Ergebnisworkshop<br />
Schritte Beschreibung Zielsetzung<br />
Szenario-Cafes • Diskussion der Szenarien und ihrer • Sondierungsprozess<br />
Stärken und Schwächen sowie • Auseinandersetzung mit<br />
Auswahl der wichtigsten je Zielkategorie<br />
und<br />
Experteneinschätzungen<br />
Szenario<br />
Zweierdiskussion • Meinungsaustausch zwischen zwei • Förderung des Verständi-<br />
Stakeholdern mit unterschiedlicher gungsprozesses<br />
Gewichtung derselben Ziele in der<br />
Vorbefragung<br />
Prioritätensetzung I • Ranking der wichtigsten Stärken • Ausloten von Gewichtunund<br />
Schwächen für eine nachhaltige<br />
<strong>Versorgung</strong> je Szenario und<br />
gen und Zielkorridoren,<br />
Unterschieden und Ge-<br />
Diskussion der Gründe<br />
meinsamkeiten<br />
Prioritätensetzung II • Direktes Ranking der Zukunftsopti- • Ausloten tragfähiger Zuonen<br />
kunftslösungen<br />
Podiumsdiskussion • Präsentation und Diskussion der • Reflexionsprozess und<br />
identifizierten Stellschrauben der Ausblick für weitere Schrit-<br />
Szenarien zu mehr oder weniger te zur Gestaltung der Zu-<br />
Nachhaltigkeit durch die wissenschaftlichen<br />
Experten<br />
kunft der <strong>Versorgung</strong><br />
Tabelle 27: Bausteine des Ergebnisworkshops<br />
Als Input in den Workshop dienten die Ergebnisse der vorangegangenen Schritte des Verfahrens:<br />
(1) Im Vorfeld des Ergebnisworkshops erfolgte die individuelle Gewichtung der Ziele (siehe<br />
Kapitel 4). Die Ergebnisse dienten als Grundlage für den Baustein „Zweierdiskussion". Diejenigen<br />
Akteure, die in der individuellen Gewichtung die größten Differenzen aufwiesen, wurden<br />
miteinander ins Gespräch gebracht. Als Grundlage für die Diskussion erhielten die Akteure<br />
die Zielhierarchie und die Beschreibung des jeweiligen zu diskutierenden Attributs, die<br />
mittlere Einschätzung aller Befragten dazu sowie ihre jeweiligen Gewichtungen in den Einzelinterviews.<br />
Argumente wurden ausgetauscht und etwaige Änderungen in der Auffassung<br />
dokumentiert.<br />
(2) Die Ergebnisse der Impact-Analyse (siehe Kapitel 5) wurden aufbereitet und dienten den<br />
Teilnehmern als Diskussionsgrundlage für die Einschätzung der Vor- und Nachteile der Szenarien.<br />
Damit erfolgte keine abstrakte, vom Kontext losgelöste Diskussion, sondern basierend<br />
auf den Zukunftsszenarien und ihrer Attributausprägungen.<br />
Einen weiteren Input lieferten die wissenschaftlichen Experten während des Workshops.<br />
(3) Die Experten speisten Erläuterungen der Ergebnisse der Impact-Analyse in die gesellschaftliche<br />
Debatte um Vor- und Nachteile der Szenarien ein. Weiterhin erarbeiteten die<br />
Experten im Workshop die wesentlichen Stellgrößen der Szenarien zu mehr oder weniger<br />
Nachhaltigkeit und stellten die Ergebnisse zur Diskussion. Sie legten dar, welche Elemente<br />
der Szenarien es sind, die wesentlich die Ausprägung der Ziele bedingen.<br />
Die Diskussion gesellschaftlicher Akteure um die Relevanz von Zielkriterien und die Zuschreibung<br />
von Stärken und Schwächen der Zukunftsszenarien erfolgte in zwei Schritten:<br />
188
6.3 Ergebnisse<br />
Im ersten Schritt wurden in Arbeitsgruppen für die vier Szenarien von den gesellschaftlichen<br />
Akteuren für die Zielbereiche „Gesundheit", „Wirtschaft", „Umwelt", „Soziales" und „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit"<br />
in der Auseinandersetzung mit den Experteneinschätzungen jeweils die<br />
zwei wesentlichsten Zielkriterien, die für bzw. gegen das jeweilige Szenario sprechen, benannt.<br />
Im zweiten Schritt wurde in Arbeitsgruppen über alle Zielbereiche hinweg eine Rangfolge der<br />
wesentlichen drei Stärken und Schwächen herausgearbeitet. Der Einigungsprozess erfolgte<br />
gestuft. Jeweils zwei Arbeitsgruppen bearbeiten dasselbe Szenario, stellten ihre Prioritätensetzung<br />
vor und versuchten, sich auf ein gemeinsames Ranking zu einigen.<br />
6.3 Ergebnisse<br />
6.3.1 Stärken und Schwächen der Szenarien je Zielbereich<br />
Im Einzelnen wurden auf der Basis der Experteneinschätzungen folgende Gewichtungen<br />
der Kriterien und damit die Zuweisung von Stärken und Schwächen je Szenario vorgenommen:<br />
Szenario A<br />
Im Bereich Umweltschutz wurden als Stärken die Kriterien „Reduktion der CO2-Emissionen"<br />
und „Schonung von Rohstoffen" ausgewählt. Diese sind in Szenario A aufgrund des hohen<br />
Anteils an Erneuerbaren Energien und der sinkenden Nachfrage nach Energie besonders<br />
stark ausgeprägt.<br />
Als wichtigste Schwächen ausgewählt wurden die mangelnde „Schonung von Materialien",<br />
bedingt durch den höheren Materialbedarf bei kleinen Anlagen und erneuerbaren Energien,<br />
sowie die Mängel bei „Schonung von Flächen" und „Artenschutz" auf Grund der Siedlungsbewegung<br />
aufs Land.<br />
Von den vier Kriterien im Bereich Gesundheitsschutz wurden der „Schutz vor radioaktiver<br />
Belastung" und der „Schutz vor Luftimmissionen" als wesentliche Stärken angesehen, die<br />
durch den Ausstieg aus der Kernenergie und den Rückgang der Kohleverbrennung geprägt<br />
sind.<br />
Eine Schwäche (allerdings wenig ausgeprägt) liegt im „Schutz vor Belastung des Trinkwassers".<br />
Im Bereich <strong>Versorgung</strong>ssicherheit wurden „Fehlertoleranz" und „Unabhängigkeit von knappen<br />
Ressourcen" als wesentliche Stärken erachtet. Eine hohe Fehlertoleranz ist nach Einschätzung<br />
der wissenschaftlichen Experten in Szenario A deshalb gegeben, weil der Anteil<br />
kleiner, dezentraler Anlagen zur Stromerzeugung in diesem Szenario hoch ist und der Ausfall<br />
einer kleinen Anlage geringere Konsequenzen hat als der Ausfall einer großen Anlage. Dieser<br />
Punkt wurde seitens der gesellschaftlichen Akteure als wichtiges Merkmal von Szenario A<br />
angesehen. Hohe Anteile erneuerbarer Energien und dezentraler Abwasserversickerung<br />
sowie Verbrauchsrückgänge verbessern die Unabhängigkeit von knappen Ressourcen.<br />
Allerdings zweifelten einige Akteure die Unabhängigkeit von knappen Ressourcen an, da in<br />
diesem Szenario eine hohe Abhängigkeit vom Erdgas besteht.<br />
189
Teil II Empirische Untersuchung: 6. Ergebnisworkshop<br />
Schwächen bestehen nach Experten-Einschätzung lediglich bei der „räumlichen Verfügbarkeit"<br />
und der „kostengünstigen Verfügbarkeit". Diese wurden von den Workshop-Teilnehmern<br />
als potentielle Schwächen ausgewählt, gleichzeitig aber angemerkt, dass bei der kostengünstigen<br />
Verfügbarkeit eine Inkonsistenz bestehe zwischen der laut Szenario-Beschreibung<br />
in A geringsten Preissteigerung und der negativen Experten-Einschätzung des Kriteriums<br />
„kostengünstige Verfügbarkeit".<br />
Im Bereich Wirtschaft wurden die Kriterien „Sicherung und Steigerung der Beschäftigung"<br />
und „Investitionstätigkeit" als wesentliche Stärken ausgewählt.<br />
Als wesentliche Schwäche des Szenarios wurde zum einen die geringe „Entwicklung des<br />
Wissens zu bestehenden Technologien" angesehen, da aufgrund des Ausstiegs aus der<br />
Kernenergie und aufgrund der Verringerung des Anteils konventioneller Stromerzeugung<br />
durch Kohle gefeuerte Kraftwerke Wissen in diesem Bereich nicht mehr fortentwickelt wird.<br />
Zum anderen wurde das Kriterium „kostendeckende Preise" auf Basis der Experten-Einschätzung<br />
als Schwäche ausgewählt; auch hier wurde die gleiche Inkonsistenz gesehen wie<br />
bei der „kostengünstigen Verfügbarkeit".<br />
Im Bereich Soziales wurden von den gesellschaftlichen Akteuren die „Grundversorgung für<br />
alle" sowie die „Generationengerechtigkeit" als wesentliche Stärken herausgestellt, obwohl<br />
die „Grundversorgung für alle" nach Experteneinschätzung nur mittelmäßig ist. Schwächen<br />
wurden keine verzeichnet.<br />
Szenario B<br />
Im Umweltschutz wurden der Klimaschutz durch „Reduktion der CO 2-Emissionen" sowie die<br />
Ressourcenschonung bei „Schonung von Rohstoffen" als wesentliche Stärken des Szenarios<br />
gewürdigt. Denn ein wesentliches Charakteristikum dieses Szenarios sind staatliche Aktivitäten,<br />
die auf Effizienzerfolge bei <strong>Versorgung</strong>stechnologien zugunsten des Umweltschutzes<br />
und der Verringerung des Ressourcenverbrauchs abzielen. Schwächen wurden keine gesehen.<br />
Bezüglich des Gesundheitsschutzes wurden der „Schutz vor Belastung des Trinkwassers"<br />
sowie der „Schutz vor Luftimmissionen" als Stärken ausgewählt. Schwächen wurden keine<br />
ausgemacht, da hier keine negativen Experten-Einschätzungen vorliegen.<br />
im Bereich der <strong>Versorgung</strong>ssicherheit wurde das Kriterium „Unabhängigkeit von knappen<br />
Ressourcen" als wesentliche Stärke erachtet.<br />
Als größte Schwächen in Bezug auf die Sicherstellung der <strong>Versorgung</strong> wurde zum einen der<br />
Kompetenzverlust der <strong>Versorgung</strong>sunternehmen durch Beschränkung auf Kerngeschäfte<br />
infolge der Verringerung des „Angebots einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen" und des<br />
verstärkten Wettbewerbsdrucks gesehen, zum anderen eine geringere „technologische<br />
Diversität", insbesondere bei den Anlagen zur Stromversorgung aufgrund des Ausstiegs aus<br />
der Kernenergie und dem Fehlen innovativer Technologien bei Steinkohlekraftwerken (wie<br />
Anlagen mit integrierter Kohlevergasung). Hier haben die Akteure aus den unterschiedlichen<br />
Einschätzungen der Experten diejenigen übernommen, die hinsichtlich der technologischen<br />
Diversität bei Szenario B eher Schwächen sehen.<br />
Für den Bereich Wirtschaft wurden die Kriterien „Pluralistische Marktstruktur", „Innovationsfähigkeit"<br />
und „Innovationstätigkeit" als wesentliche Stärken identifiziert. Zudem wurde die<br />
„Innovationsfähigkeit" als Voraussetzung für „Innovationstätigkeit" gesehen. Die Wichtigkeit<br />
190
6.3 Ergebnisse<br />
der innovationsbezogenen Kriterien liegt nach Auffassung der gesellschaftlichen Akteure in<br />
ihrer Bedeutsamkeit für die Erreichung anderer Zielkategorien, wie „Umweltschutz", „Ressourcenschonung"<br />
oder „Kostengünstige Verfügbarkeit" durch Schaffung von entsprechenden<br />
Umwelt-, Energie und Kosteneffizienzpotenzialen.<br />
Als eine der zwei größten Schwächen des Szenarios wird von den Akteuren der Beschäftigungsrückgang<br />
genannt. Dieser tritt ein unter der Annahme, dass staatliche Marktliberalisierungsbemühungen<br />
in den <strong>Versorgung</strong>ssektoren durch entsprechende Regulierung zu einer<br />
Ausweitung der Anzahl der <strong>Versorgung</strong>sunternehmen und damit zu verstärkter Wettbewerbsintensität<br />
führt. Die Folge sind Entlassungen der Beschäftigten in der <strong>Versorgung</strong>swirtschaft<br />
aufgrund verstärkten Kostendrucks. Als zweite wird die geringe „Effizienz der Leistungserstellung"<br />
auf Grund des Verlusts von Synergien durch die Trennung der <strong>Versorgung</strong>sbereiche<br />
Strom, Gas und Wasser hervorgehoben, denn beispielsweise bedeutet die getrennte Abrechnung<br />
und Rechnungserstellung von Strom, Gas und Wasser durch verschiedene <strong>Versorgung</strong>sunternehmen<br />
einen höheren Aufwand an Personal, Betriebsmitteln etc. als wenn<br />
dies ein Unternehmen für alle drei Sektoren durchführen würde. Indem die Akteure sich<br />
dieser Argumentation anschließen, ersetzen sie die uneinheitliche Einschätzung der Experten<br />
durch eine eindeutig negative.<br />
Im Bereich Soziales galten den Akteuren die Kriterien „Gleichheit der Lebensverhältnisse",<br />
„Grundversorgung für alle" und „gleichberechtigter Zugang zu Ressourcen" (im Workshop<br />
unter „Verteilungsgerechtigkeit" zusammengefasst) sowie die „Transparenz bezüglich Marktstrukturen<br />
und Leistungsbestandteilen" (z. B. mittels Windkraft, Mikro-KWK etc.) als wichtigste<br />
Vorzüge dieses Szenarios.<br />
Die größte Schwäche dieses Szenarios besteht nach Ansicht der Akteure im „Verlust sozialer<br />
Ressourcen", sowohl durch die Verringerung des Dienstleistungsumfangs als auch durch<br />
eine Verminderung der Dienstleistungsqualität zu Lasten der Nachfrager, besonders in den<br />
Sektoren Strom/Gas. Ein geringerer Dienstleistungsumfang bedeutet in diesem Szenario für<br />
die Interessenvertreter ein ausschließliches Angebot der Kernprodukte Strom, Gas und<br />
Wasser. Unter abnehmender Qualität wurde beispielsweise der wenig kundenfreundliche<br />
Service über eine Hotline mit personenloser Menüführung verstanden.<br />
Szenario C<br />
Von den gesellschaftlichen Akteuren wurden im Bereich Umweltschutz das Fehlen des Klimaschutzes<br />
infolge der Innovationsschwäche im Bereich erneuerbare Energien negativ gewertet.<br />
Die Innovationsschwäche besteht im Sektor Strom/Gas aufgrund der an Wirtschaftlichkeitskriterien<br />
orientierten Politik, die der Fortentwicklung von konventionellen Technologien<br />
den Vorzug gibt. Das gleiche Argument der Orientierung an Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten<br />
führt auch zur ebenfalls ausgewählten geringen Ressourceneffizienz hinsichtlich<br />
„Schonung von Rohstoffen".<br />
Unter den Zielen des Gesundheitsschutzes wurden die „Belastung der Trink- und Badegewässer"<br />
aufgrund geringerer Erneuerung und Pflege von Abwassersystemen durch ungünstige<br />
Finanzierungsbedingungen sowie der geringe „Schutz vor Luftimmissionen" und „Schutz<br />
vor Radioaktivität" aufgrund des höheren Anteils an Kohle befeuerten Stromerzeugungsanlagen<br />
und des Einsatzes von Kernenergie hervorgehoben.<br />
191
Teil II Empirische Untersuchung: 6. Ergebnisworkshop<br />
Im Bereich <strong>Versorgung</strong>ssicherheit wurden die „kostengünstige Verfügbarkeit" (im Sektor<br />
Strom/Gas) sowie das „Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen" (ebenfalls nur im<br />
Sektor Strom/Gas) als wesentliche Stärken dieses Szenarios angesehen. Kostengünstige<br />
Verfügbarkeit liegt in diesem Szenario aus der Sicht einiger Experten deshalb vor, weil keine<br />
Investitionskosten für abgeschriebene Kraftwerke (insbesondere Kernkraftwerke) anzusetzen<br />
sind und durch den geringen Anteil von erneuerbaren Energien nur geringe Kosten für neue<br />
Infrastruktur und für Regelenergie einzukalkulieren sind. Die in diesem Szenario zweithöchsten<br />
Preissteigerungen sprechen jedoch gegen eine kostengünstige Verfügbarkeit. Die gesellschaftlichen<br />
Akteure schließen sich jedoch der ersten Auffassung der Experten an und<br />
schreiben dem Szenario hier eine Stärke zu. Die Zielsetzung einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
ist in Szenario C auch aus Sicht der Akteure erfüllt, da Dienstleistungen wie Anlagencontracting,<br />
Rundum-Sorglos-Pakete und Demand Side Management hohe Marktdurchdringungen<br />
aufweisen.<br />
Die geringe „Unabhängigkeit von knappen Ressourcen" wurde als wesentlicher Mangel bewertet,<br />
da im Sektor Strom/Gas der Anteil an Erneuerbaren Energien gering ist und der Anteil<br />
an Kohle zur Stromerzeugung als endlicher Energieträger hoch ist. Dies wird durch den<br />
steigenden Verbrauch noch verschärft. Auch im Sektor Wasser trifft ein erhöhter Verbrauch<br />
mit der Tendenz zusammen, dass auf Grund der Zentralisierung die Anzahl der Wasserschutzgebiete<br />
zurückgeht.<br />
Im Bereich Wirtschaft wurden in Szenario C die „internationale Wettbewerbsfähigkeit" und<br />
der „Erhalt des Wissens zu bestehenden Technologien", jeweils im Sektor Strom/Gas, als die<br />
bedeutenden Stärken des Szenarios eingeschätzt. Denn in diesem Szenario wird eine wirtschaftsorientierte<br />
Politik betrieben, die die Wettbewerbsfähigkeit von Großkonzernen in Form<br />
eines gesteigerten staatlichen Innovationsbudgets zu stärken sucht und eine Regulierung<br />
betreibt, die den Markteintritt von kleinen Newcomern erschwert.<br />
Als Schwächen wurden die „Innovationstätigkeit" und die „Investitionstätigkeit" sowie die<br />
„Effizienz der Leistungserstellung" (als Ausdruck geringer Ressourceneffizienz) genannt.<br />
Im sozialen Bereich wurde die Transparenz als Stärke ausgewählt, obwohl diese vom Experten<br />
negativ eingeschätzt wurde. Für eine positivere Einschätzung als in Szenario D spricht<br />
das in Szenario C ausgewiesene Verbraucherinteresse an Preislabeling.<br />
Als besonders negativ herausgestellt wurden von den Akteuren die geringe „internationale<br />
Verteilungsgerechtigkeit" sowie die geringe Möglichkeit zur „Partizipation und gesellschaftlichen<br />
Zielformulierung". In Bezug auf die geringe Zielerfüllung internationaler Verteilungsgerechtigkeit<br />
wird auch unter sozialen Aspekten die vornehmliche Wirtschaftlichkeitsorientierung<br />
von den Akteuren als kritisch angesehen.<br />
192
6.3 Ergebnisse<br />
Szenario D<br />
Im Umweltschutz wurde die „Schonung von Materialien" und „Schonung von Flächen" von<br />
den Akteuren als wesentliche Stärken herausgestellt. Nach Experteneinschätzung ist der<br />
hohe Anteil konventioneller zentraler Technologien zur Stromerzeugung für den geringen<br />
Materialverbrauch je Einheit erzeugten Strom verantwortlich. Der geringe Flächenverbrauch<br />
im Szenarienvergleich entsteht durch die Konzentration der Bevölkerung in den Ballungszentren.<br />
Als eine der wesentlichen Schwächen wurde der mangelnde Klimaschutz durch geringe<br />
„Reduktion der CO 2-Emissionen" beklagt. Denn diese wurde von den gesellschaftlichen<br />
Akteuren bei sehr langfristiger Betrachtung als wichtigste Vorraussetzung für die wirtschaftliche<br />
Entwicklung aufgrund zu befürchtender Kosten zum Schutz gegen die Auswirkungen des<br />
Klimawandels und die Beschäftigung angesehen. Die zweite wesentliche Schwäche des<br />
Szenarios lag nach Meinung der Akteure in der geringen Zielerfüllung der „Vermeidung von<br />
langfristigen Schadstoffakkumulationen im Boden".<br />
Im Bereich Gesundheitsschutz wurden die Probleme hinsichtlich des „Schutzes vor Luftimmissionen"<br />
sowie des „Schutzes vor radioaktiver Strahlung" gesehen. Der mangelnde Schutz<br />
vor Luftimmissionen wurde deshalb als so gravierend eingestuft, da nach Einschätzung der<br />
Akteure von diesem Problem die gesamte Bevölkerung betroffen ist. Der mangelnde Schutz<br />
vor radioaktiver Strahlung wurde als zweite wesentliche Schwäche des Szenarios aufgrund<br />
der negativen Experteneinschätzung identifiziert.<br />
Im Bereich <strong>Versorgung</strong>ssicherheit wurden geringe „Fehlertoleranz" im Sektor Strom/Gas und<br />
eine geringe „Unabhängigkeit von knappen Ressourcen" in beiden Sektoren als Hauptschwächen<br />
angesehen. Eine geringe Fehlertoleranz wird auf die zentrale <strong>Versorgung</strong>sstruktur<br />
zurückgeführt und kann zusammen mit einer hohen Fehlerhäufigkeit, die auf Grund der<br />
überalterten <strong>Versorgung</strong>ssysteme erwartet wird, umso mehr zu einer geringen <strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
führen. Auch die geringe Unabhängigkeit von knappen Ressourcen wird als kritisch<br />
gesehen, da von den wissenschaftlichen Experten die Reichweite von Uran bei erwarteter<br />
Zunahme der weltweiten Nachfrage als sehr begrenzt angesehen wurde. Im Falle der<br />
Ressource Wasser wird von den Experten infolge des Konzentrationsprozesses auf dem<br />
Wassermarkt ein Abbau von Kapazitätsreserven unterstellt mit der Folge der Aufgabe von<br />
Wasserschutzgebieten und daher die Übernutzung von Wasserreservoiren befürchtet.<br />
In diesem Szenario sind im Bereich Wirtschaft die Kosteneffizienz („Effizienz der Leistungserstellung")<br />
und das „Wissen zu bestehenden Technologien" aus Sicht der gesellschaftlichen<br />
Akteure die wesentlichen Stärken, obwohl die wissenschaftlichen Experten die Effizienz eher<br />
negativ eingeschätzt haben. Die kostengünstige Stromerzeugung basiert auf der Annahme<br />
der Experten, dass die Investitionen der Kraftwerke zumeist vollständig abgeschrieben sind<br />
und die Unternehmen für ihre Kalkulationsbasis nur die Betriebskosten zugrunde legen<br />
müssen.<br />
Besonders hervorgehoben wurden als Schwächen die mangelnde „Sicherung der Beschäftigung"<br />
sowie die „Innovationsfähigkeit" im Sektor Strom/Gas. Die Innovationsfähigkeit wurde<br />
auch als Vorraussetzung für andere Ziele gesehen.<br />
Im Bereich Soziales wurde aufgrund des Beschäftigungsmangels, der in diesem Szenario<br />
vorherrscht, die „Vermeidung von Armut" als Bestandteil sozialer Sicherheit von den gesellschaftlichen<br />
Akteuren als wesentliches Ziel, das verfehlt wird, eingestuft. Eine weitere we-<br />
193
Teil II Empirische Untersuchung: 6. Ergebnisworkshop<br />
sentliche Schwäche des Szenarios besteht aufgrund der im Szenarienvergleich stärksten<br />
Preissteigerung für <strong>Versorgung</strong>sleistungen in einem Mangel an sozialverträglichen Preisen,<br />
denn diese wurden als Basis für die Vermeidung von Armut eingestuft.<br />
6.3.2 Gewichtungen und ihre Begründungen<br />
Insgesamt wurden 30 Argumentationsrunden in Form von „Zweiergesprächen" durchgeführt.<br />
Kriterium für die Auswahl der zu diskutierenden Attribute und der „Partner" waren die „Extrempaare"<br />
im Hinblick auf die absoluten Gewichte – maximale Differenz zwischen Maximum<br />
und Minimum – aus den Einzelinterviews. Im Ergebnis hielten sich Annäherungen und unverrückbare<br />
Positionen in etwa die Waage. Die Annäherung konnte sowohl nur in einer Richtung<br />
erfolgen als auch in beide Richtungen, d. h. beide Akteure bewegten sich in ihren Auffassungen<br />
aufeinander zu.<br />
Nachfolgend sind zwei Beispiele für Annäherung und zwei Beispiele für unveränderte Einschätzungen<br />
seitens der Akteure dargestellt.<br />
In Bezug auf das Kriterium „Sozialverträgliche Preise", d. h. die Preishöhe je Einheit <strong>Versorgung</strong>sleistung,<br />
die einen bestimmten Anteil des durchschnittlichen Haushaltseinkommens<br />
nicht überschreiten soll (als ein Aspekt im Bereich „Soziales") wurden folgende Argumente<br />
ausgetauscht.<br />
h h<br />
Daseinsvorsorge = für jeden Geldbeutel bezahlbar<br />
Subventionierung vermeiden, Grundversorgung<br />
besser staatlich organisieren<br />
Grundbedürfnisse sollten gedeckt werden können<br />
Gemeinwohlinteresse geht vor Profitinteresse<br />
Verbraucher hat keine Alternative<br />
Hohe Preise geben Anreiz zum Sparen<br />
Mindeststandard sollte leistbar sein, aber nicht<br />
„neurotischer Duscher" (Staffelpreise wären<br />
denkbar)<br />
Preis als staatliches Steuerungsinstrument ist<br />
zu eng.<br />
Im Ergebnis wurde die niedrige Gewichtung „sozialverträglicher Preise" zugunsten einer<br />
höheren Gewichtung relativiert.<br />
Im nachfolgenden Beispiel zeigten die Ergebnisse der Einzelinterviews eine gegenläufige<br />
Gewichtung zweier Attribute.<br />
h h w du ,Si h h it N t '<br />
Der Ausfall eines Netzknotens führt schon zum<br />
<strong>Versorgung</strong>sausfall<br />
Bei Windkraft-Nutzung ist das Netz besonders<br />
wichtig zum Leistungsausgleich<br />
Pr<br />
gen"<br />
ni ri w rtun Sich rh it r nl<br />
Bei intaktem Netz ist der Ausfall von bis zu 2 Blöcken<br />
der größten Leistungsklasse ohne <strong>Versorgung</strong>sausfälle<br />
möglich<br />
Netze"<br />
i i rt Si h h it<br />
Bei dezentralen Anlagen ist das Netz weniger<br />
wichtig<br />
r h h w rtun Sich rh it r nl<br />
gen"<br />
Angriffe auf die Anlagen sind denkbar<br />
194
6.3 Ergebnisse<br />
Während ein Akteur die „Sicherheit des Netzes" am höchsten, die „Sicherheit der Anlagen"<br />
hingegen am niedrigsten gewichtete, maß ein anderer Akteur gerade der Sicherheit der<br />
Anlagen" das höchste Gewicht und der „Sicherheit des Netzes" das geringste Gewicht bei.<br />
Beide Kriterien sind Attribute des Bereichs „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit".<br />
Der Austausch der Argumente führte zu einer geänderten Auffassung eines Akteurs: „die<br />
Sicherheit des Netzes" wurde höher gewichtet als ursprünglich und zugleich die „Sicherheit<br />
der Anlagen" geringer gewichtet.<br />
Bei dem Thema der „kostengünstigen Verfügbarkeit", d. h. die Verfügbarkeit von Rohstoffen<br />
für das Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren als Produzent sowie von <strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
für dessen Kunden (im Bereich „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit") blieben die Akteure bei ihren<br />
ursprünglichen Auffassungen. Nachfolgend sind die Argumente unterschiedlicher „Akteurspaare"<br />
aufgeführt.<br />
r h h w rtun<br />
Nachhaltigkeit bedeutet Gleichrangigkeit, Ausgleich<br />
muss stattfinden, nicht Öko-Vorrang.<br />
Beschäftigungseffekte werden erzielt<br />
Wirtschaftspolitik nur wenn Rohstoffe kostengünstig<br />
—> Arbeitsplätze<br />
Verbrauchsverhalten wird nicht durch Energiepreise<br />
gesteuert<br />
Beschäftigungsabbau [ist] ein Risiko von Preissteigerungen<br />
für Steuerung des Verbrauchsverhaltens.<br />
r ni riw rtun<br />
Gleichgewichtigkeit ist Augenwischerei, eine<br />
Säule wird stets bevorzugt, Verfügbarkeit von<br />
Energie ist noch keine soziale Frage, noch kein<br />
Aspekt der sozialen Gerechtigkeit.<br />
Energiepreise werden ansteigen, um<br />
Verbrauchsverhalten zu ändern.<br />
Bei der Einschätzung liegt der Fokus auf<br />
Verbraucher<br />
Pr h h w rtun<br />
Beeinflusst internationale Wettbewerbsfähigkeit<br />
Wirkt auf andere NH-Felder<br />
Nur wirtschaftlich gesunde Felder können soziale<br />
Aspekte gewährleisten.<br />
Hohe Energiepreise sind unsozial (auf der<br />
Verbraucherseite)<br />
Ob hohe Kosten oder niedrige Kosten spielt<br />
keine Rolle. Kosten beeinflussen nur z.T. Energieverbrauch,<br />
nur wenn ganz hohe Kosten, dann<br />
Veränderung des Verbraucherverhaltens<br />
Über Ordnungsrecht Verbrauch senken, Industrie<br />
kann ausweichen<br />
Pr ni ri w rtun<br />
Unterschied zwischen Preis und Kosten.<br />
Durch energieeffiziente Maßnahmen Preise<br />
niedrig => internationale Wettbewerbsfähigkeit<br />
Strom darf teuer sein, damit wenig Energie<br />
verbraucht wird.<br />
Energieeffizienz geht auch bei Produzenten.<br />
Internalisierung externer Kosten, dann Kosten<br />
weniger<br />
Obwohl in vielen Punkten keine Veränderung in den Einschätzungen erzielt wurde, konstatierten<br />
alle Teilnehmer des Workshops, dass dieses Vorgehen die gegenseitige Verständigung<br />
fördern konnte.<br />
195
Teil II Empirische Untersuchung: 6. Ergebnisworkshop<br />
6.3.3 Rangfolge der Stärken und Schwächen der Szenarien<br />
Aus den – wie im Abschnitt 6.3.1 beschrieben – für jeden Zielbereich ausgewählten Stärken<br />
und Schwächen wurden in zwei Arbeitsgruppen über alle Zielbereiche hinweg eine Rangfolge<br />
der wesentlichen drei Stärken und Schwächen herausgearbeitet und anschließend im<br />
Plenum beider Gruppen diskutiert. In den Tabellen 28 und 29 sind die Ergebnisse der Diskussion<br />
aufgeführt. In den Fällen, in denen zwei Ziele in einer Zelle stehen, konnte keine<br />
Einigung über die Rangfolge erzielt werden.<br />
Ränge<br />
Stärken<br />
Szenarien<br />
Rang 1 Steigerung der Innovations- Internationale Aufbau von<br />
Beschäftigung fähigkeit und Wettbewerbs- Wissen zu<br />
Klimaschutz -tätigkeit fähigkeit bestehenden<br />
Klimaschutz Angebot einer Technologien<br />
Vielzahl v. <strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
Kosteneffizienz<br />
Rang 2 Klimaschutz Klimaschutz Aufbau von Kosteneffizienz<br />
Generationen- Verteilungs- Wissen zu Aufbau von<br />
gerechtigkeit/ gerechtigkeit bestehenden Wissen zu<br />
Sicherung der (Gleichheit der Technologien bestehenden<br />
sozialen Ressourcen<br />
Lebensverhältnisse)<br />
Technologien<br />
Rang 3 Generationen- Unabhängigkeit Kostengünstige Schonung von<br />
gerechtigkeit/ von knappen Verfügbarkeit Materialien<br />
Sicherung der<br />
sozialen Ressourcen<br />
Ressourcen<br />
Steigerung der<br />
Beschäftigung<br />
Tabelle 28: Stärken der Szenarien aus der Sicht gesellschaftlicher Akteure<br />
Der Diskurs zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren vor dem von Experten<br />
eingebrachten Hintergrundwissen im Workshop zeigte, dass es gerade der Klimaschutz ist,<br />
der für die Einschätzung der Chancen und Risiken der Zukunftsszenarien maßgeblich ist.<br />
Zukunftspfaden wie Szenario C oder D, die bezüglich des Klimaschutzes deutlich schlechter<br />
abschneiden, wird dies als bedeutsame Schwäche attestiert (siehe Tabelle 29). Hingegen<br />
wird der bessere Klimaschutz bei Szenario A und B von allen Beteiligten als Vorteil dieser<br />
Zukunftspfade angesehen. Alle Akteure waren der Auffassung, dass in einer Langfristperspektive<br />
die Verletzung des Klimaschutzes Nachteile auch in anderen Zielbereichen, wie<br />
Wirtschaft und Soziales, mit sich bringen wird.<br />
196
6.3 Ergebnisse<br />
Schwächen<br />
Ränge<br />
Szenarien<br />
Rang 1 Ressourcen- Beschäftigungs- Fehlender Mangelnde<br />
verbrauch/ rückgang Klimaschutz soziale<br />
Flächen, Materia Geringere Effizienz<br />
der Leistungserstellung<br />
Gerechtigkeit<br />
Rang 2 Abbau von Geringere Effi- Geringere Fehlender<br />
Wissen zu zienz der Leis- Ressourcen- Klimaschutz<br />
bestehenden tungserstellung effizienz<br />
Technologien Verlust sozialer<br />
Ressourcen<br />
Rang 3 Geringerer Verlust sozialer geringe Investiti- Mangelnde<br />
Artenschutz Ressourcen onstätigkeit Innovations-<br />
Kompetenz- keine Partizipati- fähigkeit<br />
verlust<br />
on/ gesellschaftliche<br />
Zielformulierung<br />
Tabelle 29: Schwächen der Szenarien aus der Sicht gesellschaftlicher Akteure<br />
Abhängigkeit von<br />
knappen Ressourcen<br />
In der Diskussion der wichtigsten Schwächen wurde noch einmal aufgegriffen, dass die<br />
Workshop-Teilnehmer in Szenario A eine Inkonsistenz zwischen Schwächen bei „kostengünstiger<br />
Verfügbarkeit" und „kostendeckenden Preisen" und einer Stärke bei „Investitionstätigkeit"<br />
gesehen haben. Laut Beschreibung ist in den Szenarien A bis C der „Preisanstieg in<br />
allen Sektoren moderat", von drei der Experten wurde jedoch Szenario A hinsichtlich der<br />
kostengünstigen Verfügbarkeit am schlechtesten eingeschätzt mit der Begründung, dass<br />
erneuerbare Energien und dezentrale Erzeugung teurer sind. Es wurde gefragt, womit die in<br />
A hohe Investitionstätigkeit bezahlt werden solle, wenn die Preise moderat und nach Experteneinschätzung<br />
nicht kostendeckend seien. Ein Experte erläuterte hierzu, dass er bezweifle,<br />
dass die erforderlichen Investitionen und die erneuerbaren Energien mit moderaten Preisen<br />
kostendeckend finanzierbar seien, dass aber drei andere Experten kein Problem mit kostendeckenden<br />
Preisen sähen, weil nur dann etwas produziert werde, wenn die Preise kostendeckend<br />
seien. Von mehreren wurde angemerkt, dass zwar ein höherer Anstieg der Energiepreise<br />
erwartet werde (als in der Szenario-Beschreibung angegeben), dass dieser aber u. U.<br />
im Vergleich zum Preisanstieg in den anderen Szenarien relativ moderat sei, wenn die Preise<br />
für fossile Energien stärker stiegen als die für erneuerbare. Da keine Einigung erzielt<br />
wurde, wurden die „kostengünstige Verfügbarkeit" und die „kostendeckenden Preise" bei den<br />
drei wichtigsten Schwächen des Szenarios A nicht berücksichtigt.<br />
Des Weiteren zeigte sich im Diskurs der gesellschaftlichen Akteure, dass neben dem Klimaschutz<br />
auch die Ressourcenschonung für die Einschätzung der Chancen und Risiken der<br />
vier Zukunftspfade entscheidend ist. So wird bei den Szenarien A und C der hohe Ressourcenverbrauch<br />
als wesentliche Schwäche erachtet. Jedoch unterscheiden sich die beiden<br />
Szenarien in der Art des als kritisch angesehenen hohen Ressourcendurchsatzes. Während<br />
in Szenario A der hohe Materialienverbrauch aufgrund der Ausdehnung des Anteils Erneuerbarer<br />
Energien und dezentraler Energieversorgungsanlagen für problematisch gehalten wird,<br />
zeigt sich die Schwäche von Szenario C insbesondere im Einsatz von Rohstoffen (Brennstoffen)<br />
mit relativ geringer Effizienz.<br />
197
Teil II Empirische Untersuchung: 6. Ergebnisworkshop<br />
Im Gegensatz dazu wird in Szenario B die starke Schonung von Rohstoffen bezüglich der<br />
Energieerzeugung aufgrund von hohen Wirkungsgraden durch den verstärkten Einsatz von<br />
GuD-Kraftwerken, insbesondere in der Ausführung als Kraft-Wärmekopplungs-Anlagen, als<br />
Stärke hervorgehoben. Denn ein wesentliches Charakteristikum dieses Szenarios sind staatliche<br />
Aktivitäten, die auf Effizienzerfolge bei <strong>Versorgung</strong>stechnologien zugunsten der Verringerung<br />
des Ressourcenverbrauchs abzielen. In Szenario D ist es der geringe Materialverbrauch,<br />
der von allen Beteiligten als wesentlicher Vorzug gesehen wird. Dieser resultiert<br />
aus dem geringen Anteil dezentraler Anlagen und dem marginalen Neubau von Kraftwerken<br />
im Kontext der schwachen Wirtschaftsentwicklung.<br />
In der Prioritätensetzung zeigen sich aber auch kontroverse Auffassungen. So wurde beispielsweise<br />
vor allem aus der Sicht der Energieerzeugungswirtschaft die Innovationsfähigkeit<br />
der <strong>Versorgung</strong>ssysteme als am wichtigsten betrachtet, da diese als wesentliche Grundlage<br />
für weitere Ziele, Klimaschutz und Ressourcenschonung erachtet wurde. Vertreter von Politik<br />
und der Perspektive des nationalen und internationalen Umweltschutzes messen hingegen<br />
dem Klimaschutz die oberste Priorität zu, denn bei sehr langfristiger Betrachtung (Zeithorizont<br />
von 50 Jahren) dürften alle wirtschaftlichen Aktivitäten durch extrem ansteigende Umweltschutzkosten<br />
geprägt sein, so dass zu deren Vermeidung dem Klimaschutz der erste<br />
Rang einzuräumen sei.<br />
Unterschiedliche Auffassungen zwischen den Akteuren zeigten sich auch in der Priorisierung<br />
von „Klimaschutz" versus „Beschäftigungseffekte". Dies zeigt sich zum Beispiel in der Diskussion<br />
um Vor- und Nachteile von Szenario A und Szenario B. Szenario A schneidet in<br />
beiden Punkten positiv im Vergleich zu den anderen Szenarien ab und dies wird auch von<br />
allen gesellschaftlichen Akteuren als bedeutsam vor dem Hintergrund ihrer Interessenslagen<br />
bewertet. Während die Umweltverbände den Klimaschutz als wichtiger im Hinblick auf die<br />
Chancen, die dieser Zukunftspfad eröffnet, einschätzten, sah die <strong>Versorgung</strong>swirtschaft die<br />
Beschäftigung an erster Stelle. Die Sicherung und Steigerung der Beschäftigung wurde als<br />
Voraussetzung für andere Ziele, wie soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Entwicklung,<br />
angesehen.<br />
6.3.4 Stärken und Schwächen im Ergebnisworkshop im Vergleich<br />
zur Impact-Analyse<br />
In den folgenden Tabellen sind für die vier Szenarien die zwei Arten von Ergebnissen des<br />
vorliegenden multi-kriteriellen Verfahrens gegenübergestellt. Zum einen die Kriterien, die<br />
aufgrund der Bewertung der Attribute in der Impact-Analyse als Stärken und Schwächen zu<br />
bezeichnen sind, zum anderen die, die im Ergebnisworkshop von den gesellschaftlichen<br />
Akteuren als wesentlich gewichtet wurden.<br />
Die Auswahl aus den Ergebnissen der Impact-Analyse basiert auf der Ausprägung des Kriteriums,<br />
die aus den Paarvergleichen der Experten ermittelt wurde. Sie ist eine Zahl zwischen<br />
0 und 1, wobei die Summe der Ausprägungen aller vier Szenarien auf einem Kriterium 1<br />
beträgt. Das bedeutet, wenn die Ausprägung aller vier Szenarien auf einem Kriterium gleich<br />
ist, dann ist sie für alle vier Szenarien 1/4 = 0,25. In der Spalte „Imp.-An." wird ein Kriterium<br />
dann als Stärke „+" oder Schwäche „-" aufgelistet, wenn die Ausprägung um mehr als 0,06<br />
über oder unter dem Indifferenzwert 0,25 liegt und die Einschätzungen der verschiedenen<br />
Experten in die gleiche Richtung gehen und (in der Regel, aber nicht immer) die Einschät-<br />
198
6.3 Ergebnisse<br />
zungen für den Sektor Wasser und den Sektor Strom und Gas nicht stark von einander abweichen.<br />
(In einigen Fällen von Abweichung zwischen den Sektoren Wasser und Strom / Gas<br />
wird die Einschätzung für Strom / Gas als dominierend angesehen und allein für die Beurteilung<br />
als Stärke oder Schwäche herangezogen.)<br />
Darüber hinaus ist ein Kriterium in den Tabellen aufgeführt, wenn es zwar nicht diesen Auswahlkriterien<br />
entspricht, es aber von den Workshop-Teilnehmern als Stärke oder Schwäche<br />
ausgewählt wurde. In einigen Fällen sind die Workshopteilnehmer von der Experteneinschätzung<br />
abgewichen, oder haben sich einer der von einander abweichenden Expertenmeinungen<br />
angeschlossen, oder haben ein Kriterium ausgewählt, dessen Ausprägung nur gering<br />
vom Indifferenzwert abweicht. Solche Kriterien sind in der Spalte „Imp.-An." bei von einander<br />
abweichenden Experten-Einschätzungen mit „+/—", bei wenig oder nicht vom Indifferenzwert<br />
abweichender Ausprägung mit „(+)", „(—)" oder „(0)" gekennzeichnet.<br />
In den drei Spalten unter der Überschrift „Workshop" ist angegeben, wie die Kriterien von den<br />
Teilnehmern des Ergebnisworkshops gewichtet wurden. Die zunächst (wie in Abschnitt 6.3<br />
beschrieben) aus jedem der fünf Bereiche (Umweltschutz, Gesundheitsschutz, <strong>Versorgung</strong>ssicherheit,<br />
wirtschaftliche Aspekte und soziale Aspekte) ausgewählten jeweils (maximal) zwei<br />
Stärken und Schwächen sind in der Spalte „erste Ausw." markiert. Die daraus (wie in Abschnitt<br />
6.3.3 beschrieben) ausgewählten drei wichtigsten Stärken und Schwächen sind in<br />
den Spalten „wichtigste drei" für jede der zwei Arbeitsgruppen eingetragen. Die Rangfolge ist<br />
durch die Zahlen 1 bis 3 gekennzeichnet, wobei die Rangfolge der Schwächen in Negativdruck<br />
(0 , ©, angegeben ist.<br />
199
Teil II Empirische Untersuchung: 6. Ergebnisworkshop<br />
Szenario A<br />
Imp.<br />
An.<br />
Workshop<br />
erste wichtigste drei<br />
Ausw. Gr.1 : Gr.2<br />
Reduktion der CO 2-Emissionen + + 2 1<br />
Erhalt von Trinkwasserreservoiren +<br />
Vermeidung von Schadstoffakkumulationen im Boden (Strom/Gas) +<br />
Schonung von Rohstoffen + +<br />
Schonung von Wasser +<br />
Deponieraum für radioaktive Abfälle +<br />
Bodenbelastung durch Unfälle in EVU +<br />
Schaffung und Erhalt von Erholungsgebieten -<br />
Vermeid. Eingriffe ins Landschaftsbild -<br />
Artenschutz - -<br />
Schonung von Flächen und Materialien - -<br />
Schutz vor radioaktiver Strahlung + +<br />
Schutz vor Luftimmissionen + +<br />
Schutz vor Belastung des Trinkwassers (-) -<br />
Fehlertoleranz + +<br />
Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen +<br />
Unabhängigkeit von knappen Ressourcen + + *<br />
kostengünstige Verfügbarkeit +/- - 4<br />
räumliche Verfügbarkeit - -<br />
1 1<br />
Sicherung und Steigerung der Beschäftigung + + 1 3<br />
Investitionstätigkeit + +<br />
pluralistische Marktstruktur +<br />
Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse +<br />
Aufbau u. Entwicklung von Wissen zu neuen Technologien (Strom/Gas) +<br />
institutionelle Innovationen +<br />
Einkommenssteigerung und -sicherung +<br />
kostendeckende Preise (für internalisierte Kosten kontrovers) (-)<br />
internationale Wettbewerbsfähigkeit -<br />
Erhalt des Wissens zu bestehenden Technologien - - E E<br />
Erh. d. soz. Ressourcen: Generationengerechtigkeit + + 3 2<br />
Internationale Verteilungsgerechtigkeit +<br />
Partizipation: Gesellschaftliche Zielformulierung, Planungsverfahren +<br />
Erh. d. soz. Ressourcen: Verantw. der VU für die Daseinsvorsorge +<br />
Erh. d. soz. Ressourcen: Verantw. v. Untern. in Entwickl.ländern +<br />
Grundversorgung für alle (0) +<br />
Sozialverträgliche Preise für Haushalte +<br />
soziale Sicherheit (5 Unterkriterien) +<br />
Tabelle 30: Vergleich der Stärken und Schwächen von Szenario A aus der Impact-Analyse mit denen<br />
aus dem Ergebnis-Workshop<br />
Anmerkungen:<br />
* Einige Workshop-Teilnehmer zweifelten die Unabhängigkeit von knappen Ressourcen an, da in<br />
diesem Szenario eine hohe Abhängigkeit vom Erdgas besteht.<br />
Bei den Punkten „kostengünstige Verfügbarkeit" und „kostendeckende Preise" besteht ein Dissens<br />
der Experten, wie in Abschnitt 6.3.3 beschrieben.<br />
200
6.3 Ergebnisse<br />
Szenario B<br />
Imp.<br />
-An.<br />
Workshop<br />
erste wichtigste drei<br />
Ausw. Gr.1 : Gr.2<br />
Reduktion der CO 2-Emissionen + + 2 1<br />
Schaffung und Erhalt von Erholungsgebieten +<br />
Schonung von Rohstoffen + +<br />
Deponieraum für radioaktive Abfälle +<br />
Bodenbelastung durch Unfälle in EVU +<br />
Erhalt von Trinkwasserreservoiren -<br />
Schonung von Materialien -<br />
Schutz vor Belastung des Trinkwassers + +<br />
Schutz vor Luftimmissionen + +<br />
Unabhängigkeit von knappen Ressourcen + + 3 3<br />
geringere Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen (Strom/Gas) - -<br />
technologische Diversität (in Impact-Analyse kontrovers) g +/- -<br />
Innovationstätigkeit und -fähigkeit + + 1<br />
pluralistische Marktstruktur + +<br />
Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse +<br />
Aufbau und Entwicklung von Wissen zu neuen Technologien +<br />
Sicherung und Steigerung der Beschäftigung (-)<br />
Effizienz d. Leistungserstellung („Minderung d. Verlust an Synergien" ") +/- - *<br />
internationale Wettbewerbsfähigkeit -<br />
Erhalt des Wissens zu bestehenden Technologien -<br />
Einkommenssteigerung -<br />
Gleichheit der Lebensverhältnisse, im Workshop +<br />
Grundversorgung für alle, „Verteilungs- + + 2<br />
gleichberechtigter Zugang zu Ressourcen gerechtigkeit" +<br />
faire Rechts- und Vertragsgestaltung +<br />
vertretbares Wohlstandsgefälle +<br />
Geschlechtergerechtigkeit +<br />
Transparenz (5 Unterkriterien) + +<br />
Erhalt der sozialen Ressourcen („Dienstleistung nimmt ab") (-)<br />
internationale Verteilungsgerechtigkeit -<br />
Tabelle 31: Vergleich der Stärken und Schwächen von Szenario B aus der Impact-Analyse mit denen<br />
aus dem Ergebnis-Workshop<br />
Anmerkungen:<br />
Die Entwicklung der Beschäftigung ist von den Workshop-Teilnehmern negativer eingeschätzt worden<br />
als von den Experten. Diese Einschätzung wurde damit begründet, dass die staatliche Regulierung<br />
hohen Wettbewerbsdruck erzeuge und dadurch zu Entlassungen führen würde.<br />
* Von den Experten wurde die Effizienz der Leistungserstellung im Sektor Strom/Gas kontrovers<br />
eingeschätzt, die Workshopteilnehmer hoben den „Verlust an Synergien durch Trennung der <strong>Versorgung</strong>sbereiche"<br />
hervor und stuften das Kriterium daher als Schwäche ein.<br />
-<br />
E<br />
M<br />
201
Teil II Empirische Untersuchung: 6. Ergebnisworkshop<br />
Szenario C<br />
Imp.<br />
An.<br />
Reduktion der CO 2-Emissionen - -<br />
Reduktion von Schadstoffeinträgen in Wasserquellen -<br />
Erhalt von Trinkwasserreservoiren -<br />
Schonung von Rohstoffen -<br />
Schonung von Wasser -<br />
Deponieraum für radioaktive Abfälle -<br />
Bodenbelastung durch Unfälle in EVU -<br />
Schutz vor Belastung des Trinkwassers (-) -<br />
Schutz vor radioaktiver Strahlung - -<br />
Schutz vor Luftimmissionen - -<br />
Workshop<br />
erste wichtigste drei<br />
Ausw. Gr.1 I Gr.2<br />
allzeitige Verfügbarkeit (Wasser) +<br />
kostengünstige Verfügbarkeit (Strom/Gas; Impact-Analyse kontrovers) +/- 3 3<br />
Sicherheit der Anlagen (Wasser) +<br />
Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen (Strom/Gas) + + 1<br />
Sicherheit des Netzes (Wasser) -<br />
Fehlertoleranz (Strom/Gas) -<br />
Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen (Wasser) -<br />
Unabhängigkeit von knappen Ressourcen - -<br />
internationale Wettbewerbsfähigkeit + + 1<br />
Erhalt des Wissens zu bestehenden Technologien + + 2 2<br />
Einkommenssteigerung +<br />
Effizienz der Leistungserstellung +/- - *<br />
E *<br />
Innovationstätigkeit (-) - z<br />
Investitionstätigkeit - -<br />
pluralistische Marktstruktur -<br />
Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse -<br />
Aufbau und Entwicklung von Wissen zu neuen Technologien -<br />
Transparenz (5 Unterkriterien) -<br />
+ x<br />
alle sozialen Kriterien -<br />
internationale Verteilungsgerechtigkeit - -<br />
Partizipation: gesellschaftliche Zielformulierung - -<br />
Tabelle 32: Vergleich der Stärken und Schwächen von Szenario C aus der Impact-Analyse mit denen<br />
aus dem Ergebnis-Workshop<br />
Anmerkungen:<br />
* Im Workshop wurde „geringe Ressourceneffizienz" als Schwäche ausgewählt. Darunter wurden<br />
sowohl die wirtschaftliche Effizienz der Leistungserstellung (Bereich Wirtschaft) als auch die Schonung<br />
von Rohstoffen (Bereich Umwelt) verstanden.<br />
# Einige Workshop-Teilnehmer zweifelten die kostengünstige Verfügbarkeit an, d. h. die Annahme,<br />
dass Kohle und Kernenergie kostengünstig seien.<br />
Z Einige Workshop-Teilnehmer äußerten Zweifel, ob die Investitionstätigkeit in Szenario C wirklich so<br />
gering ist, wie von den Experten eingeschätzt. Ein Experte wies darauf hin, dass Investitionen in allen<br />
Szenarien stattfinden, nur eben in C vergleichsweise weniger als in A und B. Außerdem würden Investitionen<br />
außerhalb der <strong>Versorgung</strong>ssektoren stattfinden.<br />
• In Anbetracht der Szenario-Beschreibung, nach der in Szenario D kein Interesse an Labeling besteht,<br />
in Szenario C aber immerhin ein Verbraucher-Interesse an Preislabeling, stellen die Workshop-<br />
Teilnehmer die gleich negative Experten-Einschätzung der Transparenz in den Szenarien C und D in<br />
Frage und schätzen abweichend von der Einschätzung der Experten in Szenario C die Transparenz<br />
als Stärke ein.<br />
202
6.3 Ergebnisse<br />
Szenario D<br />
Imp.<br />
An.<br />
Workshop<br />
erste wichtigste drei<br />
Ausw. Gr.1 : Gr.2<br />
Schutz von Fauna und Habitaten +<br />
Vermeid. Eingriffe ins Landschaftsbild +<br />
Schonung von Flächen + +<br />
Schonung von Materialien + + 3 3<br />
Reduktion der CO 2-Emissionen -<br />
Erhalt von Trinkwasserreservoiren -<br />
- E E<br />
Vermeidung von Schadstoffakkumulationen im Boden - -<br />
Schonung von Rohstoffen -<br />
Schonung von Wasser -<br />
Deponieraum für radioaktive Abfälle -<br />
Bodenbelastung durch Unfälle in EVU -<br />
Schutz vor radioaktiver Strahlung - -<br />
Schutz vor Luftimmissionen - -<br />
räumliche Verfügbarkeit (Wasser) +<br />
Fehlertoleranz - -<br />
Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen -<br />
Abhängigkeit von knappen Ressourcen - -<br />
Effizienz der Leistungserstellung („Kosteneffizienz") +1- + • 2 1<br />
internationale Wettbewerbsfähigkeit +<br />
Erhalt des Wissens zu bestehenden Technologien + + 1 2<br />
Sicherung und Steigerung der Beschäftigung (Strom) - -<br />
Einkommenssteigerung und Einkommenssicherung -<br />
Innovationstätigkeit -<br />
Investitionstätigkeit -<br />
pluralistische Marktstruktur -<br />
Innovationsfähigkeit - -<br />
Anpassungsfähigkeit an Markterfordernisse -<br />
Aufbau und Entwicklung von Wissen zu neuen Technologien -<br />
institutionelle Innovationen -<br />
alle sozialen Kriterien -<br />
Vermeidung von Armut - -<br />
sozialverträgliche Preise - -<br />
Tabelle 33: Vergleich der Stärken und Schwächen von Szenario D aus der Impact-Analyse mit denen<br />
aus dem Ergebnis-Workshop<br />
Anmerkungen:<br />
* Die Effizienz der Leistungserstellung (im Workshop hier als „Kosteneffizienz" bezeichnet) ist von den<br />
Experten für den Sektor Strom kontrovers eingeschätzt worden. Die Workshop-Teilnehmer haben hier<br />
die Einschätzung (positiv) und Begründung (Weiterbetrieb bestehender Anlagen ist kostengünstig) von<br />
Experte 2 übernommen.<br />
# Die beiden Gruppen hatten jeweils eines dieser Kriterien auf den dritten Rang gesetzt. In der Diskussion<br />
einigte man sich darauf, dass beide Kriterien den dritten Rang haben.<br />
203
Teil II Empirische Untersuchung: 6. Ergebnisworkshop<br />
6.3.5 Präferenzen für die Zukunftsszenarien<br />
Die gesellschaftlichen Akteure gaben zu Beginn und am Ende des Workshops ein holistisches,<br />
direktes Gesamtrating der Zukunftsszenarien ab. Tabelle 34 zeigt das Ergebnis der<br />
Abstimmung über die Wünsch- und Machbarkeit der vier Zukunftsszenarien.<br />
Zu Beginn<br />
Am Ende<br />
Machbarkeit<br />
Wünschbarkeit<br />
Szenario A 0 0 14<br />
Szenario B 6 9 2<br />
Szenario C 3 3 0<br />
Szenario D 7 4 0<br />
Tabelle 34: Ergebnis der Abstimmung über die Wünsch- und Machbarkeit der vier Zukunftsszenarien<br />
Tabelle 34 zeigt, dass sich die Einschätzung der Machbarkeit der Zukunftsszenarien über die<br />
vertiefte Diskussion der Chancen und Risiken im Verlauf des Workshops verändert hat. Zu<br />
Beginn des Workshops hielt noch eine Mehrheit der Teilnehmer Szenario D für einen plausiblen<br />
zukünftigen Weg nachhaltiger <strong>Versorgung</strong>. Am Ende hatte sich die Mehrheit (9 von 16<br />
Akteuren) zugunsten Szenario B verschoben. Hinsichtlich der Wünschbarkeit ergibt sich ein<br />
eindeutiges Bild. Alle Akteure präferierten Szenario A, hielten diesen Zukunftspfad aber<br />
zugleich für nicht machbar. An zweiter Stelle stand Szenario B, dem zugleich eine Mehrheit<br />
der Teilnehmer am Ende des Workshops Machbarkeit bescheinigte.<br />
6.3.6 Stellgrößen der Szenarien zu mehr Nachhaltigkeit<br />
Nach Abschluss der Bewertung der Zukunftsszenarien erfolgte ein Ausblick auf die Frage der<br />
notwendigen Schritte zu einer netzgebundenen nachhaltigen <strong>Versorgung</strong>. Die Experten<br />
stellten die Elemente vor, die ihrer Ansicht nach szenarienübergreifend die entscheidenden<br />
Stellgrößen zu mehr oder weniger Nachhaltigkeit darstellen. Verändert man diese Elemente,<br />
so ergeben sich deutliche Änderungen vor allem in den ökologischen und ökonomischen<br />
Nachhaltigkeitswirkungen.<br />
Tabelle 35 zeigt, dass die Effizienz eine wesentliche Stellgröße der Szenarien darstellt. Höhere<br />
Wirkungsgrade der Stromerzeugungsanlagen ermöglichen geringere Emissionen und<br />
somit Beiträge zu verbessertem Klimaschutz. Ein geringerer Einsatz von Rohstoffen (Brennstoffen)<br />
ermöglicht die längere Nutzung endlicher Ressourcen und sichert damit die Verfügbarkeit<br />
von solchen Brennstoffen. Aber auch Kosteneffizienz spielt eine Rolle. Sie ermöglicht<br />
die anderweitige Verwendung von Finanzmitteln. Der Energiemix ist für alle Zielbereiche<br />
relevant, z. B. für den Bodenschutz und den Klimaschutz, spielt aber auch bei der Frage der<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit, dem Gesundheitsschutz und wirtschaftlichen Aspekten, wie der Frage<br />
der Wettbewerbsfähigkeit, eine Rolle. Für die Emissionen aus dem Sektor Stromerzeugung<br />
ist neben dem Energiemix vor allem die staatliche Aufsicht entscheidend. Ohne Dezentralität<br />
der Unternehmensstrukturen ist Wettbewerb im Wassersektor kaum denkbar. Auch<br />
auf die Beschäftigung wirkt Dezentralität positiv (allerdings ist der Beitrag der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
zur Gesamtzahl der Arbeitsplätze gering). Die höhere Beschäftigung sowie die bei<br />
204
6.3 Ergebnisse<br />
kleineren Anlagen insgesamt höheren Investitionskosten sind aber negativ in Hinblick auf<br />
kostengünstige Verfügbarkeit. Ob bei dezentralen Strukturen die Anpassungsfähigkeit besser<br />
und die Störanfälligkeit geringer ist als bei zentralen Strukturen oder eher umgekehrt, ist<br />
strittig. Die Störanfälligkeit wird aber stärker von anderen Faktoren beeinflusst, z. B. dem<br />
Umfang von Investitionen in Netze und Anlagen. Auch die Netzlänge erhöht die Kosten. Sie<br />
wird hauptsächlich durch die Dezentralität der Siedlungsstrukturen verursacht. Diese Stellgrößen<br />
sind die zentralen Aspekte für die Weichenstellung der Zukunft der <strong>Versorgung</strong>.<br />
Die gesellschaftlichen Akteure waren sich einig, dass die in dem Gesamtverfahren vorliegenden<br />
sehr differenziert erarbeiteten Ergebnisse als Grundlage für die gemeinsame Ausarbeitung<br />
eines konkreten Nachhaltigkeitsprogramms dienen können.<br />
Gesundheit Umwelt <strong>Versorgung</strong>ssicherheit Wirtschaft<br />
Z<br />
sich de<br />
Verfüg arkeit<br />
vucaucuclu.,111,,jnelt<br />
Staatliche<br />
Aufsicht<br />
Staatliche<br />
Aufsicht<br />
Staub<br />
,<br />
Zentral VS<br />
Zentral Zentral ii,<br />
vs<br />
z ntr 11<br />
dezentral<br />
dez ntral<br />
...--<br />
- Verf Qualität, ,,,,LLIJCVV,,113<br />
if St - f<br />
h ft g _ K t .<br />
h<br />
S z WLhing,<br />
Innovationspotential<br />
knstehngünstige<br />
Verfügbarkeit<br />
Wettbewerb<br />
Qualität<br />
er Vers rgung<br />
Wettbewerb<br />
g t'<br />
Braunkohle vs,- — vs. EE<br />
Gas EE_ ---<br />
gesicherte<br />
I osten<br />
Luftemissionen Ec Verfügbarkeit Wettbewerbsfähigkeit<br />
Wirtschaftswachstum<br />
Beschäftigung<br />
Tabelle 35: Stellgrößen der Szenarien zu mehr Nachhaltigkeit<br />
205
Teil II Empirische Untersuchung<br />
7. Diskussion<br />
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, Entscheidungen über nachhaltige zukünftige Entwicklungen<br />
der <strong>Versorgung</strong> zu unterstützen. Eine der wesentlichen methodischen Herausforderungen,<br />
dies zu leisten, ist die Verknüpfung von wissenschaftlichem Wissen mit „Stakeholder-Prozessen".<br />
Eine solche Verknüpfung wurde vom National Research Council (1996)<br />
im Sinne eines „analytic-deliberative approach" empfohlen. „Deliberation" wurde definiert als<br />
„any formal or informal process for communication and collective consideration of issues.<br />
Participants in deliberation discuss, ponder, exchange observation and views, reflect upon<br />
information and judgements concerning matters of mutual interest and attempt to persuade<br />
each other." Wissenschaftliche Analyse hingegen „uses rigorous, replicable methods, evaluated<br />
under the agreed protocols of an expert community (...) to arrive at answers to factual<br />
questions". Multi-kriterielle Verfahren liefern aufgrund ihres dekompositorischen Ansatzes die<br />
Struktur für eine solche Verknüpfung.<br />
Bei der Konzeption analytisch-deliberativer Verfahren ist eine Reihe von Problemen zu bearbeiten.<br />
Das National Center for Environmental Decision Making Research (NCEDR, 1996)<br />
unterscheidet vier Arten von Problemen: (a) „information flow problems", d. h. Probleme<br />
bezüglich der Produktion relevanter wissenschaftlicher Informationen, deren Kommunikation<br />
und Erörterung mit anderen Entscheidungsträgern (b) „decision process problems", d. h.<br />
Probleme bei der Organisation des Entscheidungsablaufes, (c) „methods problems", d. h.<br />
Probleme im Umgang mit Unsicherheiten, mit Expertendissens, der Gewichtung von Zielen<br />
und der Aggregation von multidimensionalen Bewertungen sowie (d) „participation problems",<br />
d. h. Probleme bei der Auswahl von legitimen Interessenvertretern, bezüglich des Modus der<br />
partizipativen Entscheidung.<br />
Die Komplexität des Themas <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong> verbunden mit der hohen Unsicherheit,<br />
die die Zukunftsszenarien ausmachen, stellte spezifische methodische Anforderungen,<br />
die oben genannten Probleme zu bewältigen. In Bezug auf den „Informationsfluss" war<br />
die zielgruppengerechte Aufbereitung der Fülle an Informationen eine wesentliche Schwierigkeit<br />
des Verfahrens. Für die wissenschaftlichen Experten galt es, die Zukunftsszenarien so<br />
detailliert wie nötig und doch so komprimiert wie gerade vertretbar zu dokumentieren. Für die<br />
gesellschaftlichen Akteure mussten sowohl Zukunftsszenarien als auch wissenschaftliche<br />
Aussagen möglichst anschaulich und nachvollziehbar aufbereitet werden. Hinzukommt das<br />
Problem der Akzeptanz. Die gesellschaftlichen Akteure hatten die Zukunftsszenarien, die<br />
nicht von ihnen selbst erarbeitet waren, als Grundlage ihrer Bewertung anzuerkennen. Das<br />
Vorgehen des Verfahrens, von Anfang an die jeweiligen Rollen der im Verfahren involvierten<br />
Akteure zu klären, die Notwendigkeit herauszustellen, Aufgaben, die jeweils unterschiedliche<br />
Akteure erfordern, voneinander abzugrenzen, nämlich die Aufgabe der Szenario-Konstruktion<br />
mit der Frage „Was könnte sein" und die Aufgabe der Bewertung mit der Frage „Was<br />
wollen wir", sowie dies durch die Gestaltung des Verfahrensprozesses zu untermauern, ist<br />
ein Erfolgsfaktor. Zudem erwies es sich als hilfreich, den Akteuren im Bewertungsworkshop<br />
die Möglichkeit einzuräumen, etwaige aus ihrer Sicht vorhandene Inkonsistenzen der Zukunftsszenarien<br />
zu diskutieren und den Einfluss auf ihre Bewertung abzuwägen.<br />
Für das „decision process" Problem ist die Transparenz aller Verfahrensschritte, die Kontinuität<br />
des Arbeitsprozesses über einen definierten Zeitraum mit einem festen Kreis an Teilnehmern<br />
und die Klärung der Arbeitsbeziehungen maßgeblich von Bedeutung. Dabei kann das<br />
206
7. Diskussion<br />
Verfahren ohne formale Geschäftsordnung auskommen, wie sie z. B. bei Mediationsverfahren<br />
unerlässlich ist (Moore, 1986). Die Untersuchung zielte nicht auf eine konsensuale Entscheidung<br />
für ein bestimmtes Zukunftsszenario. Ziel war die reflektierte Bewertung der<br />
Chancen und Risiken potentieller Zukunftspfade. Die mit den Akteuren entwickelte Zielhierarchie<br />
war als Arbeitsgrundlage anerkannt. Das hier vorgeschlagene Verfahren mündet<br />
nicht in eine für alle bindende Entscheidung bzw. Empfehlung, sondern erhöht vielmehr die<br />
Chance zu Lernprozessen der Akteure. Unabdingbar ist dafür jedoch, auch in einem mulitkriteriellen<br />
Verfahren, die Komponente „Stakeholder-Diskurs" mit einem unabhängigen externen<br />
Moderator durchzuführen.<br />
Entscheidend bei der Durchführung analytisch-deliberativer Prozesse ist die Frage des Umgangs<br />
mit „methods problems". Die Methodenprobleme bei Wichtigkeitsurteilen sind hinlänglich<br />
beschrieben (z. B. Weber & Borcherding, 1993; Borcherding et al., 1995). Paarvergleichsurteile<br />
oder indirekte Verfahren, wie die Swing-Gewichtung, sind zeitintensiv. Solche<br />
Verfahren sind für Interessenvertreter wenig praktikabel, insbesondere dann, wenn die gesamte<br />
Zielhierarchie Grundlage des Gewichtungsverfahrens sein soll. Erst der Einbezug aller<br />
Hierarchieebenen erbringt jedoch ein differenziertes Bild davon, worauf es den gesellschaftlichen<br />
Akteuren bei der Nachhaltigkeit ankommt. Der vorliegende Ansatz setzt deshalb auf die<br />
mehrfache individuelle Reflexion von Gewichtungen in Einzelinterviews und schließlich die<br />
kooperative Gewichtung im Bewertungsworkshop. Individuelle Gewichtungen werden zudem<br />
nicht als Komponente des Entscheidungsmodells zur Errechung der individuellen Präferenzen<br />
benützt, sondern führen im Ergebnis vielmehr zu einer handlungsrelevanten Konkretisierung<br />
des Nachhaltigkeitsbegriffs. Im Vorfeld konkreter Entscheidungen werden damit zum<br />
einen Zielkonflikte transparent und zum anderen offenbar, mit welchen Abwägungsprozessen<br />
im konkreten Fall zu rechnen ist.<br />
Der Umgang mit Unsicherheit stellt die größte methodische Schwierigkeit dar. Auf der einen<br />
Seite liegt ein differenzierter Zielkatalog vor, welche Kriterien bei der Beurteilung von Zukunftsoptionen<br />
zu berücksichtigen sind. Auf der anderen Seite bieten die Zukunftsszenarien<br />
für die Bewertung ihrer Folgen nicht für alle Kriterien eine ausreichend belastbare Datengrundlage.<br />
Hinzu kommt, dass Szenarien Systemgrenzen zugrunde legen müssen. Zwar<br />
enthalten sie Informationen für alle vier Sektoren Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation,<br />
schließen jedoch andere Sektoren aus, wie z. B. den Sektor Verkehr, der jedoch für die<br />
Bewertung nachhaltiger <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong> relevant sein kann. Eine weitere Systemgrenze<br />
stellt der räumliche Fokus eines Szenarios dar, in diesem Fall Deutschland. Der<br />
hier vorgeschlagene Ansatz, verschiedene Arten von Unsicherheiten der „expert judgements"<br />
explizit zu thematisieren und transparent zu machen, hat sich bewährt. Erst die Verknüpfung<br />
des AHP-Ansatzes mit der Unsicherheitsanalyse erbrachte eine belastbare Basis für den<br />
„Stakeholder-Diskurs". Der AHP gewährleistete zum einen den Vergleich zwischen den Expertenurteilen<br />
durch die einheitliche AHP-Skala zur Beurteilung der Attributausprägungen der<br />
Zukunftsszenarien und zum anderen ein fundiertes Urteil durch seine Konsistenzanalyse. Die<br />
Unsicherheitsanalyse erlaubte anhand der Kategorisierung der Expertenurteile auf der Basis<br />
der AHP-Bewertung und ihrer Begründungen einen systematischen Umgang mit Expertendissensen.<br />
Eine Weiterentwicklung dieses Verfahrens kann darin bestehen, dieses Vorgehen<br />
mit einem „Expertenworkshop" zu ergänzen, der weitergehend als die hier eingesetzte abschließende<br />
Delphi-Runde einen Austausch der Begründungen und damit eine potentielle<br />
Annäherung divergierender Auffassungen ermöglichen könnte. Der Einsatz eines „Expertenworkshops"<br />
oder die Anwendung eines „Delphi-Verfahrens" alleine ist jedoch nicht zielfüh-<br />
207
Teil II Empirische Untersuchung<br />
rend. Nur eine vertiefte Analyse in der Form ausgearbeiteter Gutachten gepaart mit der Anwendung<br />
eines standardisierten Beurteilungsformates für die Bewertung kann bei dem komplexen<br />
Gegenstandsbereich gesamtgesellschaftlicher Zukunftsszenarien die Annahmen und<br />
Einflussfaktoren, die die Expertenurteile begründen, explizit machen und diese in vergleichbare<br />
Urteile abbilden.<br />
Deliberative Verfahren hängen auch davon ab, wie erfolgreich der Einbezug relevanter gesellschaftlicher<br />
Akteure gelingt. Die Frage, wer in ein solches Verfahren einzubinden ist und<br />
welcher Modus der Partizipation vorliegt, hängt von der Ziel- und Fragestellung ab. Im Ansatz<br />
des kooperatives Diskurses (Renn, 1999b) werden beispielsweise „citizen panels" zur<br />
Bewertung von Optionen vorgeschlagen. In der vorliegenden Untersuchung galt es, wie z. B.<br />
bei Apostolakis & Pickett (1998), Multiplikatoren für die abschließende Bewertung der Zukunftsszenarien<br />
einzubinden. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, diejenigen, die<br />
maßgeblich von Entscheidungen über die Zukunft <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong> betroffen<br />
sind, in ein strukturiertes Forum für Lern- und Reflexionsprozesse zu involvieren. Dabei<br />
stand die Frage der Repräsentanz institutionalisierter Interessen im Vordergrund. Die Mitwirkung<br />
der Akteure über den gesamten Bewertungsprozess ist ein Erfolgsfaktor für ein solches<br />
Verfahren.<br />
Die Güte analytisch-deliberativer Bewertungs- und Entscheidungsprozesse ist an verschiedenen<br />
Kriterien zu messen. Janis & Mann (1977) schlagen vor, die Beurteilung der Entscheidungsgüte<br />
auf den Prozess des Entscheidens zu beziehen. Beierle (2002) zog für seine<br />
Analyse der Qualität von „stakeholder-basierten" Entscheidungen beispielsweise die Kriterien<br />
„Kosteneffizienz" und „Beitrag zu innovativen Ideen und Analysen" heran. Multi-kriterielle<br />
Verfahren sind zeit- und ressourcenintensiv. Die vorliegende Konzeption ist ein Vorschlag zu<br />
einem dennoch praktikablen Verfahren. Die Ergebnisse haben – nach Einschätzung der<br />
Teilnehmer des Prozesses – einen hohen Anregungs- und Orientierungswert.<br />
Das Verfahren lieferte im Ergebnis einen differenzierten Zielkatalog, der die Debatte um die<br />
Nachhaltigkeit <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong> voranbringen kann. Aus dem Vergleich des<br />
Zielkatalogs mit aus der Wissenschaft definierten Zielvorstellungen ist ersichtlich, dass die<br />
meisten Studien „Klimaschutz", „Ressourcenschonung", „Risikoarmut und Fehlertoleranz",<br />
„Wirtschaftlichkeit" sowie „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit" sowohl in den Energiesektoren als auch im<br />
Wassersektor als Oberziele anführen. Als operationalisierte Zielsetzungen werden in der<br />
ökologischen Dimension am häufigsten der „Schutz der Flächen", „Erhöhung der Produktion<br />
und der Nutzung der umweltfreundlichen Energiequellen", „rationelle Energiewandlung",<br />
„Minimierung des Materialverbrauchs" sowie „Artenvielfalt" und „Schutz der Lebensräume"<br />
für wichtig erachtet. Im Sektor Wasser werden am häufigsten die „Reduktion der Quellenverschmutzung"<br />
und der „Erhalt des quantitativen Zustands" genannt (z. B. UBA, 2002; Enquete-Kommission,<br />
2002; Nitsch & Rösch, 2001). In der Gesamtschau der Zielvorstellungen gesellschaftlicher<br />
Akteure sind diese Ziele ebenfalls relevant. Der Vorteil des Zielkatalogs liegt<br />
darin, dass er sektorübergreifend Gültigkeit besitzt, jedoch konkret genug ist, die spezifischen<br />
Anforderungen jedes Sektors abzubilden.<br />
Die Einschätzung der Ausprägungen der Szenarien auf den Kriterien durch die Experten<br />
erbrachte ein differenziertes Bild.<br />
Keines der Szenarien hat ausschließlich Vor- oder Nachteile.<br />
Szenario A ist dasjenige, das dem hypothetischen Zukunftsbild „Integrierte Mikrosysteme"<br />
am nächsten kommt. Es zeichnet sich durch einen umweltorientierten Energiemix aus: 45 %<br />
208
7. Diskussion<br />
Erdgas, 30 % Erneuerbare Energien und ein hoher Anteil dezentraler Anlagen prägen das<br />
Szenario. Die Dezentralität spiegelt sich auch im Dekonzentrationsprozess der Unternehmen<br />
in den <strong>Versorgung</strong>ssektoren wieder. Szenario A ist aus Sicht der Teilnehmer, die die Szenarien<br />
entwickelten, nur bei einem guten Wirtschaftswachstum und einem hohen gesamtgesellschaftlichen<br />
Konsens für das Primat des Umweltschutzes denkbar.<br />
Die dezentralen Anlagen und Unternehmen in Szenario A tragen nach Ansicht der Experten<br />
zur „Sicherung und Steigerung der Beschäftigung" bei, da die dezentralen Anlagen zuerst<br />
gebaut und dann betrieben und gewartet werden müssen. Allerdings tragen die <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
nur in geringem Maße zur gesamtwirtschaftlichen Arbeitsplatzsituation bei.<br />
Die Dezentralität führt andererseits aber zu höheren Kosten für die Erstellung von <strong>Versorgung</strong>sleistungen.<br />
Das wirkt sich negativ auf die „Effizienz der Leistungserstellung" und die<br />
„internationale Wettbewerbsfähigkeit" aus.<br />
Für die Ökologie hat die Dezentralität sowohl positive als auch negative Effekte. Einerseits<br />
erlauben dezentrale Anlagen tendenziell einen höheren Anteil von Kraft-Wärme-Kopplung,<br />
andererseits ist der Materialverbrauch für kleine zentrale Anlagen höher als für große zentrale.<br />
Daneben ist die in Szenario A angenommene dezentrale Siedlungsstruktur eindeutig<br />
negativ wegen des Verbrauchs an Fläche und Landschaft und dem daraus folgenden Mangel<br />
beim Artenschutz, außerdem müssten noch die längeren Fahrstrecken mit dem dadurch<br />
bedingten Energieverbrauch und den entsprechenden Emissionen berücksichtigt werden,<br />
aber der Sektor Verkehr liegt außerhalb des Untersuchungsrahmens.<br />
Ob dezentrale Anlagen auf die Sicherheit der Netze und der Anlagen positiv, negativ oder<br />
indifferent wirken, wurde für den Sektor Strom und Gas unterschiedlich eingeschätzt. Der<br />
Ausfall einer kleinen (dezentralen) Anlage hat eine geringere Auswirkung auf die <strong>Versorgung</strong><br />
als der Ausfall einer großen Anlage; die „Fehlertoleranz" wird entsprechend positiv eingeschätzt.<br />
Dezentrale technische Strukturen sind daher weniger lohnende Ziele für bewusste<br />
Störungen von außen (z. B. terroristische Angriffe). Dieses Argument wird dadurch entkräftet,<br />
dass auch der Ausfall einer großen Anlage durch ein dafür ausgelegtes Netz ausgeglichen<br />
werden kann. Vielmehr wird argumentiert, dass die Sicherheit dezentraler Strukturen geringer<br />
sei, da diese neuen Technologien, Netzstrukturen und Steuerungen noch nicht praxisbewährt<br />
seien. Weiterhin wird zwar konstatiert, dass die Umschlagzeiten bei dezentralen Anlagen<br />
schneller sind und damit eine höhere Reversibilität einmal eingeschlagener Wege gegeben<br />
sei, jedoch der Rückbau der Hochspannungsnetze, die bei dezentralen Anlagen nicht<br />
mehr gebraucht werden, dies konterkariert.<br />
Im Sektor Wasser hat die Dezentralität unterschiedliche Auswirkungen. So können bei dezentraler<br />
Wasserversorgung zwar mehr Grundwasserreserven genutzt und bei dezentraler<br />
Abwassernutzung auch geschont werden, ein überregionaler Ausgleich zwischen niederschlagsarmen<br />
und niederschlagsreichen Gebieten ist aber schwieriger als bei zentral strukturierten<br />
Netzen. Zudem ist die Qualitätssicherung bei dezentralen, in privater Verantwortung<br />
befindlichen Anlagen schwieriger als bei öffentlichen Netzen. Aber nur die Dezentralisierung<br />
ermöglicht im Wassersektor einen Wettbewerb verschiedener Anbieter, da eine Durchleitung<br />
durch Netze anderer Anbieter bei Wasser viel schwieriger ist als bei Strom.<br />
Auch die in Szenario A hohe Dienstleistungsorientierung führt einerseits zu erhöhter Beschäftigung,<br />
da sie aber auch finanziert werden muss, andererseits zu höheren Kosten.<br />
Im Bereich <strong>Versorgung</strong>ssicherheit sind neben der bereits erwähnten „Fehlertoleranz" auch<br />
bezüglich der „Unabhängigkeit von knappen Ressourcen" Stärken zu verzeichnen, bedingt<br />
209
Teil II Empirische Untersuchung<br />
durch den ökologischen Energiemix und den Rückgang des Verbrauchs an Strom, Gas und<br />
Wasser.<br />
Im Bereich „soziale Aspekte" ist Szenario A zwar in den meisten Fällen, aber nicht durchgängig<br />
positiv eingeschätzt. So sind z. B. die soziale Gerechtigkeit (mit Ausnahme der sozialverträglichen<br />
Preise) und die Transparenz in Szenario B besser eingeschätzt als in Szenario A,<br />
weil sie nach Ansicht des Experten unter staatlicher Aufsicht besser zu realisieren sind als in<br />
gesellschaftlicher Konsensbildung.<br />
Charakteristisch für Szenario B ist die Förderung der Ökologie und des Verbraucherschutzes<br />
durch den Staat. Das Wirtschaftswachstum ist nur mäßig. Die starke staatliche Regulierung<br />
führt zu einer Dekonzentration der Unternehmen, allerdings nicht ganz so weit wie in<br />
Szenario A. Der Energiemix ist wie in Szenario A durch einen hohen Anteil von Erdgas und<br />
erneuerbaren Energien geprägt. Der Anteil dezentraler Stromerzeugungsanlagen ist geringer<br />
als in Szenario A, aber immer noch höher als in C und D. Der Anteil dezentraler Anlagen im<br />
Wassersektor ist im Vergleich der vier Szenarien bei B am geringsten.<br />
Bei den wirtschaftlichen Kriterien führt die Trennung der <strong>Versorgung</strong>sbereiche zum Verlust<br />
von Synergieeffekten und damit zu einer geringeren Effizienz der Leistungserstellung. Bei<br />
der „Sicherung und Steigerung der Beschäftigung" wird Szenario B negativ eingeschätzt<br />
wegen des mäßigen Wirtschaftswachstums, allerdings nicht ganz so negativ wie Szenario D.<br />
Die ökologischen Kriterien sind in Szenario B im Wesentlichen durch den ökologisch orientierten<br />
Energiemix geprägt, die Dezentralität spielt demgegenüber nur eine unwesentliche<br />
Rolle. Entsprechend ist die CO 2-Freisetzung gering, jedoch wegen des höheren Stromverbrauchs<br />
nicht so gering wie in A. Der Nachteil des höheren Materialverbrauchs ist wegen<br />
des geringeren Anteils dezentraler Anlagen nicht so ausgeprägt wie in A. Die mittlere Siedlungsstruktur<br />
(Zubau in Randlagen von Ballungsräumen) hat einen nur mäßigen Flächenund<br />
Landschaftsverbrauch zur Folge.<br />
Im Bereich <strong>Versorgung</strong>ssicherheit wird wegen der geringen Dienstleistungsorientierung das<br />
geringe „Angebot einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen" bemängelt. Dagegen ist die<br />
„Unabhängigkeit von knappen Ressourcen" fast so gut wie in Szenario A.<br />
Bei den sozialen Aspekten liegt Szenario B nicht ganz so oft vorn wie Szenario A. Die Schaffung<br />
der in Szenario B dafür vorausgesetzten gesellschaftlichen Randbedingungen wird<br />
allerdings als praktikabler eingeschätzt.<br />
Insgesamt zeigt Szenario B zwar nicht ganz so deutlich ausgeprägte Stärken wie Szenario A,<br />
andererseits aber auch wenig ausgeprägte Schwächen.<br />
In Szenario C wird an zentralen <strong>Versorgung</strong>sstrukturen festgehalten, die Verbesserung der<br />
Effizienz wird vom Staat gefördert. Die dadurch pro erzeugter Energie erzielte Verringerung<br />
von Rohstoffverbrauch und CO 2-Freisetzung wird aber von der Steigerung des Endverbrauchs<br />
mehr als kompensiert. Zusammen mit dem eher konventionellen Energiemix mit<br />
einem hohen Anteil von Kohle bedingt dies eine negative Einschätzung bei Klimaschutz und<br />
Schonung von Rohstoffen. Siedlungsstruktur und Flächenverbrauch liegen wie bei Szenario<br />
B im Mittelfeld.<br />
Durch eine schwache Marktregulierung beherrschen zwei Großunternehmen den Energiemarkt<br />
und integrieren auch den Bereich Telekommunikation. Dies bedingt eine schlechte<br />
Einschätzung hinsichtlich „pluralistischer Marktstruktur". Wegen der relativ hohen Preise für<br />
<strong>Versorgung</strong>sleistungen ist die „Effizienz der Leistungserstellung" nur mittelmäßig.<br />
210
7. Diskussion<br />
Die Dienstleistungsorientierung ist unter allen Szenarien am höchsten, was im Sektor Strom<br />
und Gas zur positiven Einschätzungen bei der „Qualität der <strong>Versorgung</strong>" führt. Demgegenüber<br />
wird im Wassersektor das „Qualitätsniveau" an staatliches Engagement und das „Angebot<br />
einer Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungen" an Dezentralität geknüpft, darum ist hier die<br />
„Qualität der <strong>Versorgung</strong>" in den Szenarien C und D gering.<br />
Die bedeutendste Stärke dieses Szenarios liegt bei der internationalen Wettbewerbsfähigkeit,<br />
die durch eine massive Erhöhung des staatlichen Innovationsbudgets gefördert wird.<br />
Die Einkommensentwicklung ist (bedingt durch das Wirtschaftswachstum) positiv. Die Beschäftigung<br />
ist relativ hoch, allerdings nicht so hoch wie in Szenario A.<br />
Das Szenario D ist die Folge eines längerfristig allein an Wirtschaftlichkeitsüberlegungen<br />
orientierten Handelns, bei dem der Staat sich zurückzieht.<br />
Der Weiterbetrieb alter Anlagen und der wie in Szenario C konventionelle Energiemix bedingen<br />
das unter den vier Szenarien schlechteste Abschneiden bei Klimaschutz und Rohstoffverbrauch;<br />
durch den Weiterbetrieb alter Anlagen werden aber auch Materialien geschont,<br />
die zum Bau neuer, insbesondere kleiner dezentraler Anlagen erforderlich wären. Wegen der<br />
zentralen Siedlungsstruktur hat Szenario D im ökologischen Bereich auch Pluspunkte bei<br />
Schonung von Flächen und Artenschutz.<br />
Im wirtschaftlichen Bereich ist ähnlich wie in Szenario C eine Konzentration der Unternehmen<br />
zu verzeichnen, die dem Ziel einer „pluralistischen Marktstruktur" entgegensteht. Allein<br />
bei der „internationalen Wettbewerbsfähigkeit" schneidet Szenario D positiv ab, bei allen<br />
anderen wirtschaftlichen Kriterien aber negativ – trotz der Orientierung an Wirtschaftlichkeitsüberlegungen.<br />
Im sozialen Bereich hat Szenario D bei allen Kriterien die schlechteste Einschätzung, da eine<br />
„Zweiklassengesellschaft" zu bemängeln ist, die durch die wirtschaftlichen Randbedingungen<br />
entsteht.<br />
Insgesamt wurde Szenario D von den Experten bei der Mehrzahl der Kriterien als das<br />
schlechteste eingeschätzt<br />
Viele Ergebnisse der Experten-Einschätzungen ließen sich nur erzielen, weil die Untersuchung<br />
sich auf Szenarien und nicht nur auf die isolierte Betrachtung von Technologien stützt.<br />
Auch für die gesellschaftlichen Akteure war wichtig, dass Zielvorstellungen an konkreten<br />
Zukunftsszenarien diskutiert werden konnten. Die isolierte Betrachtung von Technologien –<br />
ohne aus einem Szenario die Randbedingungen zu kennen – wurde bereits von IER und ISI<br />
in der im Auftrag des UBA von prognos durchgeführten Studie bemängelt (Bohnenschäfer et<br />
al., 2003). Auch bei der Delphi-Studie „EurEnDel" (2004) besteht keine Vorgabe, unter welchen<br />
Rahmenbedingungen sich die befragten Experten die Zukunft der Technologie vorstellen.<br />
Die Studie versucht dies aufzufangen, indem indirekt eine Zuordnung von Technologien<br />
zu vorgegebenen Szenarien vorgenommen wurde.<br />
Im übrigen kommt die prognos-Studie hinsichtlich der CO 2-Emissionen zu der gleichen<br />
Schlussfolgerung wie die in der hier vorliegenden Studie eingebundenen Experten, dass<br />
Stromerzeugungstechnologien, die auf Kohle basieren, ungünstiger sind als eine mit Erdgas<br />
befeuerte GuD-Anlage. Im Unterschied zur vorliegenden Studie werden hinsichtlich der<br />
Beschäftigungsintensität den Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien (EE) gegenüber<br />
der Vergleichstechnologie Erdgas-GuD-Kraftwerk trotz der dezentralen Erzeugungsstruktur<br />
keine Vor- oder Nachteile zugeordnet, wohl aber ökologische Vorteile (wie vorlie-<br />
211
Teil II Empirische Untersuchung<br />
gend) und ökonomische Vorteile (vorliegend wird argumentiert, dass wir die künftige Entwicklung<br />
der Preise bei konventionellen und erneuerbaren Energien nicht kennen). Beim Vergleich<br />
der mit Erdgas betriebenen Technologien werden bei den dezentralen (KWK, Mikroturbine)<br />
leichte soziale und vor allem ökologische Vorteile gegenüber GuD-Anlagen im Kondensationsbetrieb<br />
ausgemacht (wie vorliegend), beim ökonomischen Kriterium wird kein Voroder<br />
Nachteil zwischen diesen Technologien gesehen (in der vorliegenden Studie haben<br />
dezentrale Anlagen ökonomische Nachteile).<br />
Aus der Sicht gesellschaftlicher Akteure wird Szenario A im Hinblick auf eine nachhaltige<br />
Zukunft – und zwar von allen – als wünschenswert erachtet, jedoch als nicht plausibel eingeschätzt.<br />
Szenario B wird von den Akteuren als plausibler angesehen als Szenario A. Szenario<br />
D wurde zu Beginn des Workshops von der Mehrheit der Teilnehmer als das plausibelste<br />
angesehen. Nach dem gemeinsamen Diskussionsprozess verschob sich diese Einschätzung<br />
zugunsten Szenario B.<br />
Die Stärken im Klimaschutz und der Ressourcenschonung, die dem Szenario A von den<br />
wissenschaftlichen Experten einheitlich attestiert wurden, werden seitens der gesellschaftlichen<br />
Akteure auch als bedeutsam bewertet. Jedoch wird von den Interessenvertretern das<br />
Risiko einer mangelnden kostengünstigen Verfügbarkeit von Rohstoffen (Brennstoffen) für<br />
das Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren als Produzent sowie von <strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
für dessen Kunden hervorgehoben. Dieses Risiko wird von den wissenschaftlichen Experten<br />
auch nicht einheitlich ausgeschlossen. Je nachdem wie realistisch die in Szenario A ausgewiesene<br />
Preisentwicklung für dezentrale und erneuerbare Energien eingeschätzt wird, wird<br />
die kostengünstige Verfügbarkeit im Szenario A in Frage gestellt. Einerseits wurde argumentiert,<br />
dass die Verbraucherpreise von Szenario A nach D zunehmen und daher Szenario A<br />
am Besten zu bewerten ist. Unter anderem Blickwinkel schneiden jedoch Szenario C und D<br />
besser ab, nämlich, wenn man besonderes Gewicht auf die Kosten legt, die durch erprobte<br />
Technik und Nutzung vorhandener Anlagen in C und D geringer sind und durch Erneuerbare<br />
Energien und Neuinvestitionen in dezentrale Anlagen in A und B höher sind.<br />
Die Bewertung der Frage der Sicherstellung der kostengünstigen Verfügbarkeit stellt eine<br />
Konfliktlinie zwischen den gesellschaftlichen Akteuren dar. Aus der Sicht von Wirtschaftsakteuren<br />
geht eine mangelnde kostengünstige Verfügbarkeit mit sinkender Wettbewerbsfähigkeit<br />
der Wirtschaft und dem Verlust von Arbeitsplätzen (außerhalb der <strong>Versorgung</strong>ssektoren)<br />
einher. Dieses Risiko wird in der Bedeutung höher gewichtet als der in diesem Szenario<br />
vorhandene Nutzen des besseren Umweltschutzes. Beide Aspekte begründen einen Zielkonflikt,<br />
der je nach Interessenslage zu einer unterschiedlichen Einschätzung des Szenarios A<br />
führt. Wie bedeutsam diese Konfliktlinie einzuschätzen ist, zeigen die Ergebnisse der „Zweiergespräche"<br />
im Bewertungs-Workshop. Hier sind sich diejenigen, die sich in der Gewichtung<br />
dieses Kriteriums in den Einzelinterviews am stärksten unterschieden, auch durch den<br />
Austausch von Argumenten nicht näher gekommen.<br />
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die starke Ausdifferenzierung der Zielhierarchie und<br />
die dazu vorhandenen Attributausprägungen dazu verhalfen, eine vertiefte Diskussion um<br />
Zielvorstellungen führen zu können.<br />
Einig war man sich in der prinzipiell hohen Gewichtung des Klimaschutzes, die sich sowohl<br />
in den Einzelinterviews, als auch in der gemeinsamen Gewichtung im Workshop niederschlug.<br />
Ebenso gibt es weitgehend Einigkeit in der Frage der Bedeutung der Innovationsfähigkeit<br />
der <strong>Versorgung</strong>ssysteme und der Sicherung von Arbeitsplätzen für eine nachhaltige<br />
212
7. Diskussion<br />
Zukunft. Selbst in dem Fall, in dem die Experten – wie bei Szenario B – einer Meinung sind,<br />
dass mit einem Beschäftigungsrückgang nicht zu rechnen sei, wird der potentiellen Gefahr<br />
seitens der gesellschaftlichen Akteuren hohe Bedeutung beigemessen. Bei einem moderaten<br />
Wirtschaftswachstum von 1,5% befürchten die Akteure einen negativen Saldo von Entlassungen<br />
in der Steinkohleindustrie und den positiven Beschäftigungseffekten bei den Erneuerbaren<br />
Energien und dem Dienstleistungsmarkt.<br />
Viele der Kriterien flossen in die Debatte bei der Bewertung der Zukunftsoptionen ein. Der<br />
Rückbezug auf die Szenarien ermöglichte eine Konkretisierung der Nachhaltigkeitsdiskussion.<br />
Im Ergebnis zeigte sich, dass die Präferenz für oder gegen einen Zukunftspfad seitens<br />
der gesellschaftlichen Akteure maßgeblich von den Kriterien Klimaschutz, Schonung von<br />
Rohstoffen, Effizienz der Leistungserstellung, kostengünstige Verfügbarkeit, Sicherung und<br />
Steigerung der Beschäftigung, Innovationsfähigkeit, Erhalt und Ausbau von Wissensressourcen<br />
und die sozialen Aspekte der Gerechtigkeit und des Erhalts der sozialen Ressourcen<br />
geprägt ist. Stand der Gesundheitsschutz bei der individuellen Gewichtung an erster Stelle<br />
mit einer geringen interindividuellen Varianz, gelangte man in der kooperativen Bewertung zu<br />
der Auffassung, dass andere Ziele vorrangig zu gewichten seien. Die Akteure teilten die<br />
Einschätzung der Experten, dass die Gewährleistung des Gesundheitsschutzes mit der<br />
Sicherung anderer Kriterien einhergeht, die es folglich prioritär zu fordern gilt. Die Ergebnisse<br />
der individuellen Gewichtung sozialer Kriterien zeigen eine hohe Varianz. In der kooperativen<br />
Gewichtung fokussierte man sich auf einige wenige, wie die soziale Gerechtigkeit. Dabei war<br />
man sich einig, dass diese generell bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit von Zukunftspfaden<br />
zu berücksichtigen sind. Lediglich hinsichtlich ihres Stellenwertes im Vergleich zu anderen<br />
Kriterien war man unterschiedlicher Auffassung.<br />
Im Ergebnis lieferte das Verfahren transparente und nicht nur für die Beteiligten, sondern<br />
auch für Außenstehende nachvollziehbare Bewertungsprozesse. Die vertiefte Diskussion<br />
über Chancen und Risiken potenzieller Zukunftspfade im „Stakeholder"-Workshop machte<br />
Zielkonflikte offenbar und erbrachte in vielen Punkten eine Annäherung. Dieser Lernprozess<br />
manifestiert sich auch in der unterschiedlichen Bewertung einzelner Szenarien hinsichtlich<br />
ihrer Wünsch- und Machbarkeit vor und nach dem Workshop.<br />
213
Literatur<br />
Literatur<br />
Akash, B. A., Mamlook, R., & Mohsen, M. S. (1999). Multicriteria selection of electric power plants<br />
using analytical hierarchy process. Electric Power Systems Research, 52 (1), 2935.<br />
Albers, 0. (2001). Gekonnt moderieren: Zukunftswerkstatt und Szenariotechnik. Regensburg;<br />
Düsseldorf; Berlin: Fit for Business<br />
Albers, 0., & Broux, A. (1999). Zukunftswerkstatt und Szenariotechnik. Weinheim; Basel: Beltz<br />
Apostolakis, G. E., & Pickett, S. E. (1998). Deliberation: Integrating Analytical Results into<br />
Environmental Decisions Involving Multiple Stakeholders. Risk Analysis, 18 (5), 621-634.<br />
Ayres, R. U., & Ayres, L. W. (1996). Industrial ecology: towards closing the materials cycle.<br />
Cheltenham: Edward Elgar<br />
Beck, U. (1986). Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a. M. Zitiert nach<br />
Rink & Wächter (2002)<br />
Becker, E., & Jahn, T. (Hrsg.) (1999). Sustainability and the Social Sciences. A Cross-Disciplinary<br />
Approach to Integrating Environmental Considerations into Theoretical Reorientation. London:<br />
Zed Books<br />
Beckmann, J., & Keck, G. (1999). Beteiligungsverfahren in Theorie und Anwendung. Stuttgart:<br />
Akademie für Technikfolgenabschätzung<br />
Beierle, T. C. (2002). The quality of stakeholder-based decisions. Risk Analysis, 22 (4), 739-749.<br />
Benayoun, R., Roy, B., & Sussman, B. (1966). ELECTRE: Une methode pour guider le choix en<br />
präsence de points de vue multiples. Note de Travail, 49. Paris: SEMA-METRA International,<br />
Direction Scientifique<br />
Binswanger, H. C., Bonus, H., & Timmermann, M. (1981). Wirtschaft und Umwelt: Möglichkeiten einer<br />
ökologieverträglichen Wirtschaftspolitik. Stuttgart (u. a.): Kohlhammer<br />
Binswanger, M. (1993). From microscopic to macroscopic theories: Entropic aspects of ecological and<br />
economic processes. Ecological Economics, 8 (3), 209-234.<br />
Birnbacher, D., Schicha, & Christian (1996). Vorsorge statt Nachhaltigkeit - ethische Grundlagen der<br />
Zukunftsverantwortung. In: Kastenholz, H.G., Erdmann, K.-H., Wolff, M. (Hrsg.), Nachhaltige<br />
Entwicklung - Zukunftschancen für Mensch und Umwelt. Berlin; Heidelberg: Springer<br />
Böhm, E., Hillenbrand, T., et al. (2002). Kosten-Wirksamkeitsanalyse von nachhaltigen Maßnahmen<br />
im Gewässerschutz. UBA-Texte, 12/02. Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes. Berlin:<br />
Umweltbundesamt<br />
Bohnenschäfer, W., Koepp, M., Scheelhaase, J. D., et al. (2003). Perspektiven für elektrischen Strom<br />
in einer nachhaltigen Entwicklung. Reihe Climate Change, 07/03. Berlin: Prognos AG; Berlin:<br />
Umweltbundesamt. Kurzfassung URL (2004-05-12): http://www.umweltbundesamt.org/fpdfk/2432.pdf<br />
Booth, D. E. (1994). Ethics and the limits of environmental economics. Ecological Economics, 9 (3),<br />
241-252.<br />
Borcherding, K., & von Winterfeldt, D. (1988). The effect of varying value trees an multiattribute<br />
evaluations. Acta Psychologica, 68 (1-3), 153-170.<br />
Borcherding, K., Schmeer, & Weber, M. (1995). Biases in multiattribute weight elicitation. In: Caverni,<br />
J.-P., Bar-Hillel, M., Hutton Barron, F., & Jungermann, H. (Eds.), Contributions to decision<br />
making. (p. 3-28) Amsterdam: Elsevier<br />
Bossel, H. (1998). Globale Wende. Wege zu einem gesellschaftlichen und ökologischen<br />
Strukturwandel. München: Droemer Knaur<br />
Brand, K.-W. (Hrsg.) (1997). Nachhaltige Entwicklung - Eine Herausforderung an die Soziologie.<br />
Opladen. Zitiert nach Kraemer & Metzner (2002)<br />
214
Literatur<br />
Brandl, V., Jörissen, J., Kopfmüller, J., et al. (2001). Das Integrative Konzept: Mindestbedingungen<br />
nachhaltiger Entwicklung. In: Grunwald, A., Coenen, R., Nitsch, J., Sydow, A., Wiedemann, P.<br />
(Hrsg:), Forschungswerkstatt Nachhaltigkeit. (p. 79-101) Berlin: edition sigma<br />
Brösle, U. (1999). Einführung in die Volkswirtschaftslehre. Mikroökonomie. 3. Aufl., München:<br />
Oldenbourg<br />
Brown, L., Flavin, C., & Postel, S. (1991). Saving the Planet: How to Shape an Environmentally<br />
Substainable Global Economy. Worldwatch Environmental Alert Series, W. W. Norton &<br />
Company<br />
Brüggemann, A., & Jungermann, H. (1996). Strukturen der Bewertung von Gentechnik. Bericht, Nr. JU<br />
69/96. Berlin: Institut für Psychologie der TU Berlin<br />
BUND & Misereor (Hg.) (1996). Zukunftsfähiges Deutschland: Ein Beitrag zu einer global nachhaltigen<br />
Entwicklung. Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser<br />
Coenen, R. (2001). Die Umsetzung des Leitbildes in nationalen Nachhaltigkeitsstrategien. In:<br />
Grunwald, A., Coenen, R., Nitsch, J., et al. (Hrsg.), Forschungswerkstatt Nachhaltigkeit. (p. 59-<br />
75) Berlin: edition sigma<br />
Common, M., & Perrings, C. (1992). Towards an ecological economics of Sustainability. Ecological<br />
Economics, 6 (1), 7-34.<br />
Constanza, R. (1991). Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability. New<br />
York: Columbia Univ. Press<br />
Constanza, R., Low, B., Ostrom, E., & Wilson, J. (1999). Institutions, Ecosystems and Sustainability.<br />
Cambridge. Zitiert nach Voß et al. (2002)<br />
CSD (United Nations Commission for Sustainable Development) (1996). Work Programme an<br />
Indicators of Sustainable Development, Framework and Methodologies. Working Paper. New<br />
York: United Nations<br />
CSD (United Nations Commission for Sustainable Development) (2001). Indicators of Sustainable<br />
Development: Guidelines and Methodologies. New York: United Nations. URL (2006-02-13):<br />
http://www.un.org/esa/sustdev/publications/indisd-mg2001.pdf<br />
Cuhls, K., & Blind, K. (1999). Die Delphi-Methode als Instrument der Technikfolgenabschätzung. In:<br />
Bröchler, S., Simonis, G., Sundermann, K. (Hrsg.), Handbuch Technikfolgenabschätzung.<br />
(Bd. 2, p. 541-544) Berlin: edition sigma<br />
Cuhls, K., Blind, K., & Grupp, H. (1998). Dephi 98 - Studie zur globalen Entwicklung von Wissenschaft<br />
und Technik. Studie im Auftrag des BMBF. Karlsruhe: Fraunhofer Institut für Systemtechnik und<br />
Innovationsforschung<br />
Daly, H. E. (1996). Beyond growth: The economics of sustainable development. Boston: Beacon Press<br />
Daly, H. E. (1999). Ecological Economics and the Ecology of Economics. Essays in Criticism.<br />
Cheltenham: Edgar Elgar<br />
Daly, H. E, Nelson, G., & Cobb, J. (1991). An introduction to ecological economics. [45 minute video<br />
from the 1991 conference "Forging a New Economics"]. Gates Mills, OH: Griesinger Films<br />
Der Lissabonner Aktionsplan: Von der Charta zum Handeln (1996). Angenommen von den<br />
Teilnehmern der Zweiten Europäischen Konferenz über zukunftsbeständige Städte und<br />
Gemeinden. Lissabon. URL (2006-02-10):<br />
http://www.apug.de/archiv/pdf/lissabonner_aktionsplan.pdf<br />
Dienel, P. C. (1971). Wie können die Bürger an Planungsprozessen beteiligt werden? Der Bürger im<br />
Staat, 21. Jg., 151-156.<br />
Dienel, P. C. (1978). Die Planungszelle. Opladen: Westdeutscher Verlag<br />
Dienel, P. C. (1999). Bürgergutachten. In: Bröchler, S., Simonis, G., Sundermann, K. (Hrsg.),<br />
Handbuch Technikfolgenabschätzung. (Bd. 2, p. 563-564) Berlin: edition sigma<br />
Dienel, P. C. (2002). Die Planungszelle: Der Bürger als Chance. 5. Aufl. mit Statusreport 2002,<br />
Stuttgart: Westdeutscher Verlag<br />
215
Literatur<br />
Dienel, P. C., & Garbe, D. (1985). Zukünftige Energiepolitik. Ein Bürgergutachten. Edition "Technik und<br />
sozialer Wandel", München: High Tech<br />
Dienel, P. C., & Trütken, B. (1999). Die Planungszelle. In: Bröchler, S., Simonis, G., Sundermann, K.<br />
(Hrsg.), Handbuch Technikfolgenabschätzung. (Bd. 2, p. 551-561) Berlin: edition sigma<br />
Dierkes, M., Marz, L., & Berthoin Antal, A. (2002). Sozialbilanzen. Konzeptioneller Kern und diskursive<br />
Karriere einer zivilgesellschaftlichen Innovation, FS II 02-107. Veröffentlichung der Abteilung<br />
"Organisation und Technikgenese" des Forschungsschwerpunktes Technik-Arbeit-Umwelt am<br />
WZB. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung gGmbH (WZB).<br />
URL (2005-12-09): http://skylla.wz-berlin.de/pdf/2002/1102-107.pdf<br />
Distelkamp, M., Hohmann, F., Lutz, C., et al. (2003). PANTA RHEI V. Modelldarstellung und Prognose<br />
der CO2-Emissionen. GWS Discussion Paper, 2003/1. Osnabrück: Gesellschaft für<br />
Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) mbH.<br />
URL (2005-12-08): http://www.gws-os.de/Downloads/gws-paper03-1.pdf<br />
Döring, R., & Ott, K. (2002). Nachhaltigkeit. Information Philosophie, 1.<br />
Edeling, T., Jann, W., & Wagner, D. (Hrsg.) (1999). Institutionenökonomie und Neuer<br />
Institutionalismus. Opladen. Zitiert nach Voß et al. (2002)<br />
Edwards, W. (1971). Social utilities. Engineering Economist, 6, 119-129.<br />
Edwards, W. (1977). How to use multiattribute utility measurement for social decision making. IEEE<br />
Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 7 (5), 326-340.<br />
Edwards, W., & Newman, J. R. (1982). Multiattribute Evaluation. Sage University Papers Series on<br />
Quantitative Applications in the Social Sciences, Beverly Hills, CA: Sage<br />
Eisenführ, F., & Weber, M. (1986). Structering Attributes as a Critical Step in Decision Analysis.<br />
Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 38, 907-929.<br />
Eisenführ, F., & Weber, M. (1999). Rationales Entscheiden. Berlin: Springer<br />
Enquete-Kommission "Nachhaltige Energieversorgung unter den Bedingungen der Globalisierung und<br />
der Liberalisierung" (2002). Schlussbericht. Bundestags-Drucksache, 14/9400. Berlin:<br />
Deutscher Bundestag (Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Köln). URL (2006-01-26):<br />
http://www.bundestag.de/parlament/kommissionen/archiv14/ener/schlussbericht/index.htm<br />
Enquete-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" (1994). Die Industriegesellschaft<br />
gestalten. Perspektiven für einen nachhaltigen Umgang mit Stoff- und Materialströmen.<br />
Bundestags-Drucksache, 12/8260. Bonn: Deutscher Bundestag. Bonn: Economica. URL (2006-<br />
01-26): Suche in http://www.parlamentsspiegel.de/<br />
Enquete-Kommission "Schutz des Menschen und der Umwelt" (1998). Abschlussbericht: Konzept<br />
Nachhaltigkeit. Vom Leitbild zur Umsetzung. Bundestags-Drucksache, 13/11200. Bonn:<br />
Deutscher Bundestag (Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Köln). URL (2006-01-26):<br />
http://dip.bundestag.de/btd/13/112/1311200.pdf<br />
Erdmann, & Seifert, E. K. (2003). Nachhaltigkeit. In: Herrmann-Pillath, C., Lehmann-Waffenschmidt,<br />
M. (Hrsg.), Handbuch der Evolutorischen Ökonomik. (Bd. 3) Heidelberg; New York: Springer<br />
EurEnDel - Technology and Social Visions for Europe's Future. A Europe-wide Delphi Study (2004).<br />
Final Report. Berlin: IZT - Institute for Futures Studies and Technology Assessment (www.izt.de)<br />
Feess, E. (1998). Umweltökonomie und Umweltpolitik. München: Vahlen<br />
Finnveden, G. (2000). On the Limitations of Life Cycle Assessment and Environmental Systems<br />
Analysis Tools in General. International Journal of Life Cycle Assessment, 5 (4), 229-238.<br />
Fishburn, P. C. (1967). Methods of estimating additive utilities. Management Science, 13, 435-453.<br />
Forman, E., & Selly, M. A. (2002). Decision By Objectives: How to Convince Others That You Are<br />
Right. River Edge, NJ: World Scientific Publishing. Electronic version available (2005-01-11) on<br />
page http://mdm.gwu.edu/forman/ as URL http://mdm.gwu.edu/forman/DBO.pdf<br />
216
Literatur<br />
Frischknecht, R., Bollens, U., Bosshart, S., et al. (1996). Ökoinventare von Energiesystemen:<br />
Grundlagen für den ökologischen Vergleich von Energiesystemen und den Einbezug von<br />
Energiesystemen in Ökobilanzen für die Schweiz, Auflage No. 3. Bern: Bundesamt für<br />
Energiewirtschaft. Gruppe Energie - Stoffe - Umwelt (ESU), Eidgenössische Technische<br />
Hochschule Zürich, und Sektion Ganzheitliche Systemanalysen, Paul Scherrer Institut, Villigen<br />
Gawel, E. (1996). Neoklassische Umweltökonomie in der Krise? In: Köhn, J., Welfens, M.J. (Hrsg.),<br />
Neue Ansätze in der Umweltökonomie. (p. 45-88) Marburg: Metropolis<br />
Gholamnezhad, A., & Saaty, T. L. (1982). A desired energy mix for the Unites States in the year 2000:<br />
An analytic hierarchy approach. International Journal of Policy Analysis and Information<br />
Systems, 6 (1), 47-64.<br />
Gloy, K. (1996). Das Verständnis der Natur. Band 2. Die Geschichte des ganzheitlichen Denkens.<br />
München. Zitiert nach Rink & Wächter (2002)<br />
Greening, L., & Bernow, S. (2004). Design of coordinated energy and environmental policies: Use of<br />
multi-criteria decision making. Energy Policy, 32, 721-735.<br />
Grossmann, W. D., Lintl, M., Bray, D., et al. (2002). Sozial- und umweltfreundliche<br />
Informationsgesellschaft. In: Balzer, I., Wächter, M. (Hrsg.), Sozial-ökologische Forschung. (p.<br />
261-280) München: ökom verlag<br />
Grunwald, A., Coenen, R., Nitsch, J., et al. (2001). Forschungswerkstatt Nachhaltigkeit. Wege zur<br />
Diagnose und Therapie von Nachhaltigkeitsdefiziten. Reihe "Global zukunftsfähige Entwicklung<br />
- Perspektiven für Deutschland", Bd. 2, Berlin: edition sigma<br />
Haber, W. (2001). Ökologie und Nachhaltigkeit. In: Di Blasi, L., Goebel, B., Hösle, V., Nachhaltigkeit in<br />
der Ökologie. Wege in eine zukunftsfähige Welt. München: Beck<br />
Habermas, J. (1987). The philosophical discourse of modernity. Cambridge: Polity Press<br />
Habermas, J. (1989). Erläuterungen zum Begriff des kommunikativen Handelns. In: Habermas, J.,<br />
Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns. (p. 571-606) Frankfurt<br />
a. M.: Suhrkamp<br />
Habermas, J. (1991). Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln. Frankfurt a. M.: Suhrkamp<br />
Häder, M., & Häder, S. (2000). Die Delphi-Technik in den Sozialwissenschaften. Methodische<br />
Forschungen und innovative Anwendungen. Opladen: Westdeutscher Verlag<br />
Hämäläinen, R. P. (1990). A decision aid in the public debate on nuclear power. European Journal of<br />
Operational Research, 48 (1), 66-76.<br />
Hämäläinen, R. P., & Karjalainen, R. (1992). Decision support for risk analysis in energy policy.<br />
European Journal of Operational Research, 56 (2), 172-183.<br />
Hämäläinen, R. P., & Seppäläinen, T. 0. (1986). The analytic network process in energy policy<br />
planning. Socio-Economic Planning Sciences, 20 (6), 399-405.<br />
Hampicke, U. (1992). Ökologische Ökonomie. Opladen: Westdeutscher Verlag<br />
Hampicke, U. (1999). Grenzen der monetären Bewertung. In: Beckenbach, F., Hampicke, U., et al.<br />
(Hrsg.), Jahrbuch Ökologische Ökonomik. (Bd. 1, p. 151-179) Marburg: Metropolis<br />
Hans-Böckler-Stiftung (Hrsg.) (2000). Verbundprojekt Arbeit und Ökologie. Abschlussbericht.<br />
Düsseldorf: Der Setzkasten<br />
Hartig, G. L., & Hartig, T. (1834). Forstliches und forstwissenschaftliches Conservationslexikon.<br />
Stuttgart; Tübingen:<br />
Heller, W. W. (1971). Economic growth and ecology - an economists's view. Monthly Labor Review, 94<br />
(11), 14-21.<br />
Hermann-Pillath, C., & Lehmann-Waffenschmidt, M. (2003). Handbuch der Evolutorischen Ökonomik.<br />
Stuttgart; Heidelberg; New York: Springer<br />
Hobbs, B. F., & Meier, P. M. (1994). Multicriteria methods for resorce planning: An experimental<br />
comparison. IEEE Transactions on Power Systems, 9 (4), 1811-1817.<br />
217
Literatur<br />
Hogarth, R. M. (1987). Judgement and choice. The psychology of decision. Chichester: John Wiley &<br />
Sons<br />
Huber, J. (1995). Nachhaltige Entwicklung - Strategien für eine ökologische und soziale Erdpolitik.<br />
Berlin. Zitiert nach Kraemer & Metzner (2002)<br />
Huber, J. (2001). Allgemeine Umweltsoziologie. Wiesbaden. Zitiert nach Kraemer & Metzner (2002)<br />
Hübner, H., & Jahnes, S. (1992). Instrumente als Management-Technologie für die<br />
Technikwirkungsanalyse, Technikwirkungs- und Innovationsforschung. Kassel: Universität-<br />
Gesamthochschule Kassel<br />
Hülsmann, B. (1990). Gerät und Handlungskultur. Soziologische Analyse der Vergesellschaftung über<br />
Dinge. In: Tschiedel, R. (Hrsg.), Die technische Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit.<br />
Gestaltungsperspektiven der Techniksoziologie. (Technik- und Wissenschaftsforschung, Nr. 11,<br />
p. 139-156) München: Profil<br />
Jacobs, M. (1997). Sustainability and Markets: On the Neoklassical Model of Environmental<br />
Economics. New Political Economy, 2 (3), 365-385.<br />
Jäger, C. T. (2002). System von Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung in Hessen. Dissertation.<br />
Frankfurt a. M.: Universität Frankfurt<br />
Jäger, T., Mertens, J., Karger, C. (2004): Zukunftsszenarien <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong>. Studie im<br />
Rahmen des Verbundprojektes „Integrierte Mikrosysteme der <strong>Versorgung</strong>", gefördert vom<br />
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Förderschwerpunkt „Sozial-<br />
Ökologische Forschung" (SÖF). Jülich: Forschungszentrum Jülich GmbH<br />
Jahn, T., & Wehling, P. (1998). Gesellschaftliche Naturverhältnisse - Konturen eines theoretischen<br />
Konzepts. In: Brand, K.-W. (Hrsg.), Soziologie und Natur. Theoretische Perspektiven. Opladen,<br />
S. 75-95. Zitiert nach Voß et al. (2002)<br />
Jänicke, M. (1993). Über ökologische und politische Modernisierungen. Zeitschrift für Umweltpolitik<br />
und Umweltrecht 16 (2): 159-173. Zitiert nach Kraemer & Metzner (2002)<br />
Jänicke, M. (Hrsg.) (1996). Umweltpolitik der Industrieländer. Entwicklung - Bilanz -<br />
Erfolgsbedingungen. Berlin. Zitiert nach Kraemer & Metzner (2002)<br />
Jänicke, M. (1999). Das 21. Jahrhundert. In: Agenda 21. Vision Nachhaltige Entwicklung. Frankfurt a.<br />
M.: Campus<br />
Jänicke, M., & Weidner, H. (Eds.) (1997). National Environment Policies. A Comparative Study of<br />
Capacity-Building. Berlin. Zitiert nach Kraemer & Metzner (2002)<br />
Janis, 1. L., & Mann, L. (1977). Decision making. A Psychological Analysis of Conflict, Choice and<br />
Commitment. New York: The Free Press<br />
Jones, M., Hope, C., & Hughes, R. (1990). A multi-attribute value model for the study of UK energy<br />
policy. Journal of the Operational Research Society, 41, 919-929.<br />
Jörissen, J., Kopfmüller, J., & Brandl, V. (1999). Ein integratives Konzept nachhaltiger Entwicklung.<br />
Wissenschaftliche Berichte FZKA, 6393. Karlsruhe: Forschungszentrum Karlsruhe<br />
Jörissen, J., Kneer, G., & Rink, D. (2001). Wissenschaftliche Konzeption zur Nachhaltigkeit. In:<br />
Grunwald, A., Coenen, R., Nitsch, J., et al. (Hrsg.), Forschungswerkstatt Nachhaltigkeit. (p. 33-<br />
58) Berlin: edition sigma<br />
Jungermann, H., Pfister, H. R., & Fischer, K. (1998). Die Psychologie der Entscheidung. Eine<br />
Einführung. Heidelberg; Berlin: Spektrum<br />
Katzman, M. T. (1987). Multiattribute Utility Elicitation Techniques and public policy: a meta-analysis of<br />
empirical applications. In: Schultz, R.L. (Ed.), Applications of management science. A research<br />
annual. (Vol. 5, p. 237-303) Greenwich, Conn: JAI<br />
Keeney, R. L. (1988). Value-driven expert systems for decision support. Decision Support Systems, 4<br />
(4), 405-412.<br />
Keeney, R. L. (1992a). On the Foundations of Prescriptive Decision Analysis. In: Edwards, W. (Ed.),<br />
Utility Theories: Measurements and Applications. (p. 57-72) Dordrecht: Kluwer<br />
218
Literatur<br />
Keeney, R. L. (1992b). Value-Focused Thinking: A Path to Creative Decision Making. Cambridge, MA,<br />
USA: Harvard University Press<br />
Keeney, R. L. (2001). Modeling values for telecommunications management. IEEE Transactions an<br />
Engineering Management, 48 (3), 370-379.<br />
Keeney, R. L., & McDaniels, T. L. (1999). Identifying and structuring values to guide integrated<br />
resource planning at BC Gas. Operations Research, 47 (5), 651-662.<br />
Keeney, R. L., & Raiffa, H. (1976). Decisions with Multiple Objectives. New York: Wiley<br />
Keeney, R. L., & Wood, E. F. (1977). An illustrative example of the use of multiattribute utility theory for<br />
water resource planning. Water Resources Research, 13, 705-716.<br />
Keeney, R. L., McDaniels, T. L., & Ridge-Cooney, V. L. (1996). Using values in planning wastewater<br />
facilities for metropolitan Seattle. Journal of the American Water Resources Association, 32 (2),<br />
293-303.<br />
Keeney, R. L., von Winterfeldt, D., & Eppel, T. (1990). Eliciting public values for complex policy<br />
decisions. Management Science, 36 (9), 1011-1030.<br />
Klaasen, G. A., & Opschoor, J. B. (1991). Economics of sustainability or the sustainability of<br />
economics: Different paradigms. Ecological Economics, 4 (2), 93-115.<br />
Klann, U., & Nitsch, J. (2004). Durch den Rückspiegel. Nützliche Erfahrungen aus Planung,<br />
Organisation und Arbeitsablauf des Projekts "Global zukunftsfähige Entwicklung - Perspektiven<br />
für Deutschland". Technikfolgenabschätzung - Theorie und Praxis, 13 (1), 48-53.<br />
URL (2005-11-30): http://www.itas.fzk.de/tatup/041/kIniO4a.pdf auf Seite<br />
http://www.itas.fzk.de/tatup/041/inhalt.htm<br />
Klann, U., & Schulz, V. (2003). Großflächige Ökobilanzen - Anwendungen der umweltbezogenen<br />
Input-Output-Analyse. In: Stein, Gotthard (Hrsg.), Umwelt und Technik im Gleichklang. (p. 49-<br />
60) Berlin: Springer. Manuskript URL (2005-11-28):<br />
http://www.dIr.de/tt/institut/abteilungen/system/publications/Stein_Buch_End.pdf<br />
Klenner, R. (2002). Unterstützung stoff- und energieflussinduzierter Entscheidungen durch<br />
Betriebliche Umweltinformationssysteme. Dissertation. Aachen: Shaker<br />
Klöpffer, Walter (1991). Produktlinienanalyse und Ökobilanz - Methodische Ansätze zur rationellen<br />
Beurteilung von Produkten unter Umweltaspekten. Umweltwissenschaften und Schadstoff-<br />
Forschung 3 (2), 114-118<br />
Kluckhohn, C. (1962). Values und Value Orientation in the Theory of Action. An Exploration in<br />
Definition and Classification. In: Parsons, T., Shils, E.A. (Eds.), Towards a General Theory of<br />
Action. (p. 388-433) Cambridge: Harvard University Press, 1951. Reprinted New York: Harper<br />
and Row, 1962<br />
Knaus, A., & Renn, 0. (1998). Den Gipfel vor Augen. Unterwegs in eine nachhaltige Zukunft. Marburg.<br />
Zitiert nach Kraemer & Metzner (2002)<br />
Korff, W. (1995). Umweltethik. In: Junkernheinrich, M., Klemmer, P., Wagner, G. (Hrsg.): Handbuch zur<br />
Umweltökonomie. (Handbücher zur angewandten Umweltforschung, Band 2). Berlin: Analytica,<br />
S. 278-284.<br />
Kraemer, K. (1997). Nachhaltigkeit durch Konsumverzicht? „Sustainable Development" - eine<br />
soziologische Betrachtung. Zeitschrift für angewandte Umweltforschung, 10: 198-209. Zitiert<br />
nach Kraemer & Metzner (2002)<br />
Kraemer, K. (1998). Konsum und Verteilung. Der blinde Fleck der „Nachhaltigkeits"-Debatte. In:<br />
Engelhardt, K. (Hrsg.), Umwelt und Entwicklung. Ein Beitrag zur lokalen Agenda 21. Münster,<br />
S. 127-149. Zitiert nach Kraemer & Metzner (2002)<br />
Kraemer, K., & Metzner, A. (2002). Industrielle Innovationssyklen als Gegenstand der sozialökologischen<br />
Forschung. In: Balzer, I., Wächter, M. (Hrsg.), Sozial-ökologische Forschung. (p.<br />
301-315) München: ökom verlag<br />
219
Literatur<br />
Kruse-Graumann, L. (1996). Psychologische Ansätze zur Entwicklung einer zukunftsfähigen<br />
Gesellschaft. In: Kastenholz, H.G., Erdmann, K.-H., Wolff, M. (Hrsg.), Nachhaltige Entwicklung -<br />
Zukunftschancen für Mensch und Umwelt. (p. 121-139) Berlin; Heidelberg: Springer<br />
Lindbloom, C. (1965). The Intelligence of Democracy. Decision Making Through Mutual Adjustment.<br />
New York: Basic Books<br />
Linscheidt, B. (1999). Nachhaltiger technologischer Wandel aus Sicht der evolutorischen Ökonomik.<br />
Umweltökonomische Diskussionsbeiträge des Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstituts an<br />
der Universität zu Köln, Nr. 99-1. Köln<br />
Lo, E.O., Campo, R., & Ma, F. (1987). Decision Framework for New Technologies: A tool for strategic<br />
planning of electric utilities. IEEE Transactions on Power Systems, 2 (4), 959-967.<br />
Luhmann, N. (1983). Legitimation durch Verfahren. Frankfurt a. M.: Suhrkamp<br />
Luhmann, N. (1986). Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf<br />
ökologische Gefährdungen einstellen? Opladen. Zitiert nach Rink & Wächter (2002)<br />
Macnaghten, P., & Jacobs, M. (1997). Public identification with sustainable development: Investigating<br />
cultural barriers to participation. Global Environmental Change, 7 (1), 5-24.<br />
Macnaghten, P., & Urry, J. (1998). Contested Natures. London: Sage<br />
Manstetten, R., & Faber, M. (1999). Umweltökonomie, Nachhaltigkeitsökonomie und ökologische<br />
Ökonomie. In: Beckenbach (Hrsg.), Zwei Sichtweisen auf das Umweltproblem: Neoklassische<br />
Umweltökonomik versus Ökologische Ökonomie. (p. 54-97) Marburg: Metropolis<br />
Marheineke, T. (2002). Lebenszyklusanalyse fossiler, nuklearer und regenerativer<br />
Stromerzeugungstechniken. Dissertation, Fakultät Energietechnik der Universität Stuttgart.<br />
Forschungsbericht, Band 87, Stuttgart: Institut für Energiewirtschaft und Rationelle<br />
Energieanwendung (IER), Universität Stuttgart,<br />
URL (2004-05-13): http://elib.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/2002/1144/<br />
Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (1993). Die neuen Grenzen des Wachstums.<br />
Reinbek: Rowohlt<br />
Meixner, 0., & Haas, R. (2002). Computergestützte Entscheidungsfindung: Expert Choice und AHP -<br />
innovative Werkzeuge zur Lösung komplexer Probleme. Frankfurt a. M.; Wien: Redline<br />
Wirtschaft bei Ueberreuter<br />
Merkhofer, M. W., & Keeney, R. L. (1987). A Multiattribute Utility Analysis of Alternative Sites for the<br />
Disposal of Nuclear VVaste. Risk Analysis, 7 (2), 173-193.<br />
Minsch, J., Feindt, P., & Meister, H.-P. (Arbeitsgemeinschaft IWÖ-HSG/IFOK Institut für Wirtschaft und<br />
Ökologie der Universität St. Gallen / Institut für Organisationskommunikation) (1998).<br />
Institutionelle Reformen für eine Politik der Nachhaltigkeit, hrsg. von der Enquete-Kommission<br />
„Schutz des Menschen und der Umwelt" des 13. Deutschen Bundestages. Berlin. Zitiert nach<br />
Kraemer & Metzner (2002)<br />
Minsch, J., Feindt, P., Meister, H.-P., et al. (1998). Institutionelle Reformen für eine Politik der<br />
Nachhaltigkeit. Berlin (u. a.). Zitiert nach Voß et al. (2002)<br />
Mohr, H. (1996). Wieviel Erde braucht der Mensch? Untersuchungen zur globalen und regionalen<br />
Tragekapazität. In: Kastenholz, H.G., Erdmann, K.-H., Wolff, M. (Hrsg.), Nachhaltige<br />
Entwicklung - Zukunftschancen für Mensch und Umwelt. Berlin; Heidelberg: Springer<br />
Moore, C. W. (1986). The mediation process. Practical strategies for resolving conflict. San Francisco;<br />
London: Jossey-Bass<br />
Münch, R. (1996). Risikopolitik. Frankfurt a. M. Zitiert nach Kraemer & Metzner (2002)<br />
National Research Council (1996). Understanding Risk: Informing Decisions in an Democratic Society.<br />
Stern, P.C., & Fineberg, H.V. (Eds.), Committee on Risk Characterization, National Research<br />
Council, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC:<br />
National Academy Press. URL (2006-02-17, only partial view):<br />
http://fermat.nap.edu/catalog/5138.html<br />
220
Literatur<br />
NCEDR National Center for Environmental Decision-Making Research (1996): Program Plan and<br />
Research Design. Januar 1996<br />
Nelson, R. R., & Winter, S. G. (1982). An evolutionary theory of economic change. Cambridge:<br />
Belknap<br />
Nitsch, J., & Rösch, C. (2001). Perspektiven für die Nutzung regenerativer Energien. In: Grunwald, A.,<br />
Coenen, R., Nitsch, J., Sydow, A., Wiedemann, P. (Hrsg.), Forschungswerkstatt Nachhaltigkeit -<br />
Wege zur Diagnose und Therapie von Nachhaltigkeitsdefiziten. (p. 290-323) Berlin: edition<br />
sigma<br />
OECD (2001). Key Environmental Indicators. Paris: OECD. URL (2006-01-27):<br />
http://www.oecd.org/dataoecd/36/37/18544223.pdf<br />
OECD (2003). OECD Environmental Indicators - development, measurement and use. Reference<br />
paper. Paris: OECD. URL (2006-01-27): http://www.oecd.org/dataoecd/7/47/24993546.pdf<br />
OECD (2004). OECD Key Environmental Indicators. Reference paper. Paris: OECD. URL (2006-01-<br />
27): http://www.oecd.org/dataoecd/32/20/31558547.pdf<br />
Öko-Institut/Projektgruppe Ökologische Wirtschaft (1987). Produktlinienanalyse - Bedürfnisse,<br />
Produkte und ihre Folgen. Kölner Volksblatt Verlag, Köln<br />
Öko-Institut (2004). Arbeitspapier Auswertung PROSA/PLA Waschen und Waschmittel.<br />
URL (2005-11-25):<br />
http://www.prosa.org/fileadmin/user_upload/pdf/Arbeitspapier_VVaschen_und_Waschmittel.pdf<br />
Oppermann, B., & Langer, K. (2000). Umweltmediation in Theorie und Anwendung. Stuttgart:<br />
Akademie für Technikfolgenabschätzung Baden-Württemberg<br />
Pearce, D., & Turner, W. (1990). Economics of National Resources and the Environment. New York:<br />
Harvester Wheatsheaf<br />
Pearce, D., Barbier, E., & Markandya, A. (1990). Sustainable development: Economics and<br />
environment in the Third World. London: Edward Elgar<br />
Peters, W. (1984). Die Nachhaltigkeit als Grundsatz der Forstwirtschaft ihre Verankerung in der<br />
Gesetzgebung und ihre Bedeutung in der Praxis. Dissertation. Hamburg: Universität Hamburg,<br />
Fachbereicht Biologie<br />
Petschow, U., Hübner, K., Dröge, S., et al. (1998). Nachhaltigkeit und Globalisierung.<br />
Herausforderungen und Handlungsansätze. Berlin: Springer<br />
Raiffa, H. (1969). Preferences for multiattributed alternatives. Report, No. RM-5868-DOT/RC. Santa<br />
Monica, CA: Rand Corporation<br />
Rawls, J. (1999). A Theoof of Justice. Oxford: Oxford University Press<br />
Renn, 0. (1995). Risikobewertung aus Sicht der Soziologie. In: Berg, M., Erdmann, G., Leist, A., et al.<br />
(Hrsg.), Risikobewertung im Energiebereich. (Polyprojekt Risiko und Sicherheit, Dokumente, Nr.<br />
7, p. 71-134) Zürich: vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich<br />
Renn, 0. (1996). Ökologisch denken - sozial handeln. Die Realisierbarkeit einer nachhaltigen<br />
Entwicklung und die Rolle der Kultur- und Sozialwissenschaften. In: Kastenholz, H.G., Erdmann,<br />
K.-H., Wolff, M. (Hrsg.), Nachhaltige Entwicklung - Zukunftschancen für Mensch und Umwelt. (p.<br />
79-117) Berlin; Heidelberg: Springer<br />
Renn, 0. (1999). Die Wertbaumanalyse. Ein diskursives Verfahren zur Bildung und Begründung von<br />
Kriterien zur Bewertung von Technikfolgen. In: Bröchler, S., Simonis, G., Sundermann, K.<br />
(Hrsg.), Handbuch Technikfolgenabschätzung. (Bd. 2, p. 617-624) Berlin: edition sigma<br />
Renn, 0. (1999b). A Model for an Analytic-Deliberative Process in Risk Management. Environmental<br />
Science and Technology, 33 (18), 3049 - 3055.<br />
Renn, 0. (2002). Nachhaltige Entwicklung - Zur Notwendigkeit von Zieldiskursen. In: Brand, Karl-<br />
Werner (Hrsg.), Politik der Nachhaltigkeit: Voraussetzungen, Probleme, Chancen - eine kritische<br />
Diskussion. (p. 211-225) Berlin: edition sigma<br />
221
Literatur<br />
Renn, 0., Albrecht, G., Kotte, U., et al. (1985). Sozialverträgliche Energiepolitik. Ein Gutachten für die<br />
Bundesregierung. München: High Tech<br />
Renn, 0., Knaus, A., & Kastenholz, H. (1999). Wege in eine nachhaltige Zukunft. In: Breuel, Birgit<br />
(Hrsg.), Agenda 21: Vision: Nachhaltige Entwicklung. Frankfurt a. M.; New York: Campus<br />
Renn, 0., Webler, Th. & Wiedemann, P. (Hrsg.) (1995). Fairness and Competence in Citizen<br />
Participation. Evaluating New Models for Environmental Discourse. Dordrecht; Boston: Kluwer<br />
Rennings, K. (1994). Indikatoren für eine dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung. (Rat von<br />
Sachverständigen für Umweltfragen (Hrsg.): Materialien zur Umweltforschung, Heft 24)<br />
Stuttgart: Metzler-Poeschel<br />
Richter, R., & Furubotn, E. G. (1996). Neue Institutionenökonomik: Eine Einführung und kritische<br />
Würdigung. Tübingen: Mohr<br />
Rickert, K., Ruiz-Rodriguez, E., & Ruwenstroth, G. (1993). Fallbeispiele zur Nutzwertanalyse -<br />
Wasserwirtschaftliche Planung Emstal. Beitrag des DVWK-Fachausschusses "Projektplanungsund<br />
Bewertungsverfahren". Bonn: Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau<br />
(DVWK)<br />
Rink, D., & Wächter, M. (2002). Naturverständnisse in der Nachhaltigkeitsforschung. In: Balzer, I.,<br />
Wächter, M. (Hrsg.), Sozial-ökologische Forschung. (p. 339-361) München: ökom verlag<br />
Roper-Lowe, G. C., & Sharp, J. A. (1990). The Analytic Hierarchy Process and its Application to an<br />
Information Technology Decision. Journal of the Operational Research Society, 41 (1), 49-59.<br />
Saaty, T. L. (1972). An Eigenvalue Allocation Model for Prioritization and Planning. Energy<br />
Management and Policy Center, University of Pennsylvania<br />
Saaty, T. L. (1977). A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures. Journal of Mathematical<br />
Psychology, 15, 234-281.<br />
Saaty, T. L. (1990). The Analytic Hierarchy Process. Pittsburgh: RWS<br />
Saaty, T. L. (1990b). Eigenvector and logarithmic least squares. European Journal of Operational<br />
Research, 48, 156-160.<br />
Saaty, T. L., & Forman, E. A. (1992). The Hierarchon: A Dictionary of Hierarchies. Analytic Hierarchy<br />
Process Series, Vol. 5, Pittsburgh: Rws Publications<br />
Saaty, T. L., & Mariano, R. S. (1979). Rationing Energy to Industries: Priorities and Input-Output<br />
Dependence. Energy Systems and Policy, 3 (1), 85-111.<br />
Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (1994). Decision Making in Economic, Social and Technological<br />
Environments. Analytic Hierarchy Process Series, Vol. 7, Pittsburgh: Rws Publications<br />
Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2000). Models, Methods, Concepts and Applications of the Analytic<br />
Hierarchy Process. Boston: Kluwer<br />
Schneeweiß, C. (1991). Planung. Band 1: Systemanalytische und entscheidungstheoretische<br />
Grundlagen, Berlin: Springer<br />
Simonis, U., & Brühl, T. (1999). Strukturen und Trends der Weltökologie. In: Hauchler, I., Messner; D.,<br />
Nuscheler, F., Globale Trends 2000. Frankfurt a. M.: Fischer<br />
Skorupinski, B., & Ott, K. (2000). Technikfolgenabschätzung und Ethik. Zürich: vdf Hochschulverlag<br />
AG an der ETH Zürich<br />
Solow, R. (1992). An Almost Practical Step Towards Sustainability. Washington, DC: Resources for the<br />
Future<br />
Soper, K. (1995). What is Nature? Culture, Politics and the Non-Human. Oxford. Zitiert nach Rink &<br />
Wächter (2002)<br />
Spangenberg, J. H. (2002). Soziale Nachhaltigkeit: Eine integrierte Perspektive für Deutschland. In:<br />
Dally, A., Heins, B. (Hrsg.), Politische Strategien für die soziale Nachhaltigkeit. Loccum:<br />
Rehburg<br />
222
Literatur<br />
SRU - Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (1994). Umweltgutachten 1994. Für eine<br />
dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung. Bundestags-Drucksache, 12/6995. Bonn: Deutscher<br />
Bundestag. Stuttgart: Metzler-Poeschel. URL (2006-01-26): Suche in<br />
http://www.parlamentsspiegel.de/<br />
SRU - Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (1998). Umweltgutachten 1998.<br />
Umweltschutz: Erreichtes sichern -- Neue Wege gehen. Bundestags-Drucksache, 13/10195.<br />
Bonn: Deutscher Bundestag. Stuttgart: Metzler-Poeschel. URL (2006-01-26):<br />
http://www.umweltrat.de/02gutach/umwelt.htm<br />
SRU - Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (2002). Umweltgutachten 2002. Für eine neue<br />
Vorreiterrolle. Bundestags-Drucksache, 14/8792. Berlin: Deutscher Bundestag (Vertrieb:<br />
Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Köln). URL (2003-11-27):<br />
http://www.umweltrat.de/02gutach/umwelt.htm<br />
Tacke, K. (1999). Planungswerkstatt. In: Bröchler, S., Simonis, G., Sundermann, K. (Hrsg.), Handbuch<br />
Technikfolgenabschätzung (Bd. 2, p. 679-687). Berlin: edition sigma<br />
Toman, M. A., Pezzey, J., & Krautkraemer, J. (1993). Economic Theory and Sustainability. Discussion<br />
Paper, No. 9315. London: University College<br />
Triantaphyllou, E. (2000). Multi-Criteria Decision Making Methods: A Comparative Study. Dordrecht;<br />
Boston; London: Kluwer<br />
Tschiedel, R. (1988). Anstiftung zur Kommunikation. Notwendige Erläuterungen zum Konzept. In:<br />
Franken, A. (Hrsg.), Anstiftung zur Kommunikation. Ein Leitfaden zum Nachmachen und<br />
Bessermachen in Initiativen, Vereinen und Weiterbildungseinrichtungen. (p. 1-28) Münster;<br />
Rheine<br />
Tschiedel, R. (1989). Kommunale Denktechniken. In: Blumberger, W., Hülsmann, H. (Hrsg.),<br />
Menschen, Zwänge, Denkmaschinen. (p. 247-264) München: Profil<br />
Tschiedel, R. (1997). Wie weit können wir sehen. In: Becker; U., Fischbeck, H.-J., Rinderspacher, J.<br />
(Hrsg.), Über Konzepte und Methoden zeitlicher Fernorientierung. (p. 31-48) Bochum: SWI<br />
Umweltbundesamt (UBA) (1997). Nachhaltiges Deutschland: Wege zu einer dauerhaftumweltgerechten<br />
Entwicklung. Berlin: Erich Schmidt<br />
Umweltbundesamt (Hrsg.) (UBA) (2001). Nachhaltige Wasserversorgung in Deutschland. Berlin: Erich<br />
Schmidt Verlag<br />
Umweltbundesamt (Hrsg.) (UBA) (2002). Langfristszenarien für eine nachhaltige Energienutzung in<br />
Deutschland. UBA-Texte, 01/02. Berlin: Umweltbundesamt<br />
Umweltnutzung und Wirtschaft. Bericht zu den Umweltökonomischen Gesamtrechnungen 2005. (Nov.<br />
2005). Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.<br />
URL (2005-11-28): http://www.destatis.de/download/d/ugr/berichtugr05.pdf<br />
Van den Daele, W., & Neidhardt, F. (Hrsg.) (1996). Kommunikation und Entscheidung. Politische<br />
Funktionen öffentlicher Meinungsbildung und diskursiver Verfahren. WZB-Jahrbuch, 1996,<br />
Berlin: edition sigma<br />
von Carlowitz, H. C. (1713). Sylvicultura Oeconomica, oder haußwirthliche Nachricht und Naturmäßige<br />
Anweisung zur Wilden Baum-Zucht. Leipzig: Braun<br />
von Nitzsch, R. (1996). Entscheidungslehre. 3. Aufl., Aachen: Verlag der Augustinus Buchhandlung<br />
von Prittwitz, V. (Hrsg.) (2000). Institutionelle Arrangements in der Umweltpolitik. Zukunftsfähigkeit<br />
durch innovative Verfahrenskombination? Opladen. Zitiert nach Voß et al. (2002)<br />
von Reibnitz, U. (1987). Szenarien - Optionen für die Zukunft. Hamburg: McGraw-Hill<br />
von Weizsäcker, E. U., Lovins, A. B., & Lovins, H. L. (1995). "Faktor 4". Doppelter Wohlstand -<br />
halbierter Naturverbrauch. München: Droemer-Knaur<br />
von Winterfeldt, D. (1999). On the relevance of behavioral decision research for decision analysis. In:<br />
Shanteau, J., Mellers, B.A., Schum, D.A. (Eds.), Decision Science and Technology: Reflections<br />
an the Contributions of Ward Edwards (p. 133-154) Boston: Kluwer<br />
223
Literatur<br />
von Winterfeldt, D., & Edwards, W. (1986). Decision Analysis and Behavioral Research. Cambridge:<br />
Cambridge University Press<br />
Voß, J. P., Barth, R., & Ebinger, F. (2002). Institutionelle Innovationen: Potenziale für die<br />
transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung. In: Balzer, 1., Wächter, M. (Hrsg.), Sozialökologische<br />
Forschung. (p. 69-87) München: ökom verlag<br />
Wachlin, K. D., & Renn, 0. (1999). Diskurse an der Akademie für TA in Baden-Württemberg:<br />
Verständigung, Abwägung, Gestaltung, Vermittlung. In: Bröchler, S., Simonis, G., Sundermann,<br />
K. (Hrsg.), Handbuch Technikfolgenabschätzung. (Bd. 2, p. 713-722) Berlin: edition sigma<br />
WBGU (1996). Welt im Wandel - Herausforderung für die deutsche Wissenschaft. Jahresgutachten<br />
1996. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Berlin:<br />
Springer. URL (2006-02-13): http://www.wbgu.de/wbgu_jg1996.pdf<br />
WBGU (2003). Welt im Wandel - Energiewende zur Nachhaltigkeit. Jahresgutachten 2003.<br />
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Berlin: Springer.<br />
URL (2006-02-17): http://www.wbgu.de/wbgujg2003.pdf<br />
Weber, M., & Borcherding, K. (1993). Behavioral influences on weight judgments in multiattribute<br />
decision making. European Journal of Operations Research, 67 (1), 1-12.<br />
Weimann, J. (1990). Umweltökonomik: Eine theorieorientierte Einführung. Berlin: Springer<br />
Weinbrenner, P. (1995). Joghurt ist nicht gleich Joghurt - Die Produktlinienanalyse als<br />
Entscheidungshilfe für ökologisches Verbraucherverhalten. Anleitung zur selbständigen<br />
Durchführung und Auswertung von Produktlinienanalysen. Bielefeld. URL (2005-11-23):<br />
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/uekontaktschulen/medio/Fortbildung/prod_mat/<br />
Prodanalyse.pdf<br />
Wilhelm, J. (1999). Ökologische und ökonomische Bewertung von Agrarumweltprogrammen: Delphi-<br />
Studie, Kosten-Wirksamkeits-Analyse und Nutzen-Kosten-Betrachtung. Dissertation. Frankfurt<br />
a. M.: Peter Lang<br />
Wohinz, J. W. (1983). Wertanalyse - Innovationsmanagement. Würzburg; Wien: Physica<br />
Young, O.R. (Ed.) (1998). Science Plan for the project on the institutional dimensions of global<br />
environmental change. Bonn: International Human Dimensions Programme on Global<br />
Environmental Change (IHDP). Zitiert nach Voß et al. (2002)<br />
Zangemeister, C. (1976). Nutzwertanalyse in der Systemtechnik. 4. Auflage, München:<br />
Wittemannsche Buchhandlung<br />
Zongxin, W., & Zhihong, W. (1997). Mitigation assessment results and priorities for China's energy<br />
sector. Applied Energy 56 (3/4), 237-251.<br />
Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.) (1999). Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit,<br />
sozialer Zusammenhalt, ökologische Nachhaltigkeit. Drei Ziele - ein Weg. Bonn: Dietz<br />
224
Anhang<br />
225
226
Inhaltsverzeichnis<br />
A.1 Tabellarische Darstellung der Szenarien 228<br />
A.2 Beschreibung der Ziele 234<br />
A.2.1 Umweltschutz 234<br />
A.2.2 Gesundheitsschutz 236<br />
A.2.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit 237<br />
A.2.4 Wirtschaftliche Aspekte 238<br />
A.2.5 Soziale Aspekte 240<br />
A.3 Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)243<br />
A.3.1 Umweltschutz 243<br />
A.3.2 Gesundheitsschutz 257<br />
A.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit 261<br />
A.3.4 Wirtschaftliche Aspekte 278<br />
A.3.5 Soziale Aspekte 293<br />
227
228 A.1. Tabellarische Darstellung der Szenarien<br />
A.1 Tabellarische Darstellung der Szenarien<br />
Inhalte Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
Allg. Rahmenbedingungen<br />
Wirtschaftswachstum 2%/a 1,5%/a 2%/a 1,0%/a<br />
Demographische Entwicklung Schrumpfung der Bevölkerung um 1,5%;<br />
Erhöhung des Bevölkerungsanteils der über 60-jährigen von 25% auf 33%<br />
Räumliche Veränderung der<br />
Verbraucherstrukturen<br />
Gesellschaft und Akzeptanz<br />
Generelle Charakterisierung<br />
Gesellschaftl. Akzeptanz neuer DL<br />
+Technologien<br />
Gesundheitsbezogene Akzeptanz<br />
von <strong>Versorgung</strong>sprodukten<br />
Bedeutung von Transparenz für<br />
Kundenakzeptanz<br />
Komfortbezogene Akzeptanz der<br />
Kunden/Nutzer<br />
Binnenmigration in ländliche<br />
Gebiete<br />
Primat von Klima und Umwelt im<br />
gesellschaftlichen Konsens<br />
Staat setzt sich gegen<br />
Unternehmensinteressen<br />
zugunsten von Klima und Umwelt<br />
durch<br />
Gesundheitsschutz hat hohen Stellenwert<br />
Verbraucherinteresse an Umweltund<br />
Preislabeling<br />
Komfort hat sehr hohen<br />
Stellenwert<br />
staatlich verordnetes Umwelt- und<br />
Preislabeling<br />
Ökologisches Bauen und Wohnen Realisierung auf breiter Front Realisierung in moderatem<br />
Umfang<br />
Nachfragemenge Sinkende Nachfrage n.<br />
Strom/Gas/Wasser >5%;<br />
TK wächst um
Politik<br />
Nationale Umwelt- und<br />
Gesundheitsziele<br />
Inhalte Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
Policy-Mix der Energie- und<br />
Umweltpolitik<br />
Verlagerungen von Entscheidungen<br />
nach Europa<br />
Staatliches Budget zur<br />
Innovationsförderung<br />
Politische Anforderungen an die<br />
<strong>Versorgung</strong>ssicherheit (Zugang)<br />
Investitionen und<br />
Kapitalmärkte<br />
Finanzierungsbedingungen<br />
Sollzinsen<br />
Umschlagszeiten von<br />
Infrastrukturteilen<br />
Durchführung von<br />
Infrastrukturinvestitionen<br />
Größe und Struktur des<br />
Kraftwerksparks<br />
Deckung des Ersatzbedarfs durch<br />
kleine u. mittlere Kraftwerksgrößen<br />
Investitionsbedarf im<br />
Abwasserbereich<br />
Politik folgt gesellschaftlichem<br />
Konsens zugunsten moderater<br />
Umwelt- und Gesundheitsziele<br />
Dominanz marktwirtschaftlicher<br />
Instrumente z. Förderung v.<br />
gesellschaftl. und techn.<br />
Innovationen<br />
Umweltpolitik setzt verlässlichen<br />
Rahmen juristisch und finanziell;<br />
Besonders strenge Grenzwerte<br />
und Verbote für einzelne Stoffe<br />
Staat betreibt aktiv Schutz von<br />
Klima und Umwelt bei Vorgabe<br />
moderater Ziele<br />
Mix aus Ordnungsrecht und<br />
marktwirtschaftl. Instr. z. Fortführung<br />
der Effizienzoffensive<br />
zwecks Beschreitung eines<br />
umweltfreundl. Technologiepfades<br />
Primat auf Wirtschaftlichkeit und<br />
weniger auf Umweltschutz<br />
Dominanz marktwirtschaftlicher<br />
Instr. f. eine forcierte<br />
Technologiepolitik zwecks<br />
Wettbewerbsfähigkeit der<br />
Industrie<br />
Deutliche Verlagerung der Kompetenzen auf die EU-Ebene<br />
Erlass von weiteren Grenzwerten<br />
und Verboten für einzelne Stoffe<br />
Kein Erlass von weiteren<br />
Grenzwerten und Verboten für<br />
einzelne Stoffe<br />
Staat zieht sich zurück<br />
Abbau bestehender<br />
ordnungsrechtlicher und<br />
marktwirtschaftlicher Instrumente<br />
zwecks Stabilisierung der<br />
wirtschaftlichen Situation<br />
Aufweichung von bestehenden<br />
Grenzwerten und Verboten für<br />
einzelne Stoffe<br />
Konstant (+/-10%) Massive Ausweitung um 50% Rückgang um 50%<br />
Fortsetzung des heutigen Ansatzes<br />
einer Strategie der Diversifikation der Energieträgerstruktur und Bezugsquellen<br />
sowie Nutzung von Rationalisierungspotenzialen<br />
Günstig<br />
6%/a<br />
Ungünstig<br />
9%/a<br />
Günstig<br />
6%/a<br />
Nehmen ab Konstant Nehmen ab Konstant<br />
Zum Zubau, Erwelerung, Reparatur<br />
oder Instandhaltung techn. Anlagen<br />
Ersatzbedarf des Kraftwerksparks<br />
zur Stromerzeugung von 50%<br />
Zu 50% Zu 30%<br />
Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen umfassen<br />
Kläranlagen, Pumpstationen, Kanalnetze<br />
229 A.1. Tabellarische Darstellung der Szenarien
230 A.1. Tabellarische Darstellung der Szenarien<br />
Inhalte Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
Marktstruktur und<br />
Regulierung<br />
Intensität der Marktregulierung<br />
Mittlere Intensität der<br />
Marktregulierung verstärkt<br />
Dekonzentration<br />
Dominante,<br />
wettbewerbsorientierte<br />
Regulierung erzeugt<br />
Dekonzentration<br />
Schwache Intensität der<br />
Marktregulierung soll die<br />
Entstehung starker deutscher<br />
international ausgerichteter Player<br />
fördern<br />
Mittlere Intensität der<br />
Marktregulierung soll Minimum an<br />
Wettbewerb gewährleisten<br />
Liberalisierungsdruck Hoch durch kartellrechtliche Hoch durch kartellrechtliche Niedrig, lediglich kartellrechtliche Vorgaben<br />
Vorgaben und Unbundling Vorgaben und Unbundling sowie<br />
Preisregulierung<br />
Unternehmens-/ Dekonzentration Oligopol<br />
Marktkonzentration<br />
Jedoch Gesamtzahl der Zudem spielen internationale priv. Nur zwei deutsche international 4-5 deutsche Versorger<br />
<strong>Versorgung</strong>sunternehmen Firmen im Wassersektor eine tätige Großunternehmen prägen dominieren den Markt, im Bereich<br />
schrumpft infolge Kooperationen<br />
von deutschen Unternehmen im<br />
Bereich Ab-/Wasser<br />
wichtigere Rolle<br />
neben ausländischen den Markt,<br />
Integration des TK-Bereichs, im<br />
Wassersektor ist Konzentration<br />
niedriger<br />
(Ab)wasser übernehmen sie<br />
ehemals öffentl. Aufgaben<br />
Marktanteile der 4-5 größten 50% >50% >90% >90%<br />
<strong>Versorgung</strong>sunternehmen<br />
Infrastrukturelle Konvergenz (Multi- MU-Konzepte zielen auf: MU-Konzepte zielen auf: MU-Konzepte zielen auf: MU-Konzepte zielen auf:<br />
Utility)<br />
Nutzung dezentr. Technologien,<br />
Kundenbetreuung,<br />
Netzbetrieb<br />
Kundenbetreuung,<br />
Netzbetrieb<br />
Dezentr., integr. Erzeugungseinh.<br />
Kundenbetreuung,<br />
Netzbetrieb in begrenzt. Umfang<br />
Sektorübergreifende Zunehmende Standardisierung und Integration Zunehmende Standardisierung<br />
Standardisierung zwischen Strom, Gas, (Ab-)Wasser und TK und Integration zw. Strom, Gas,<br />
(Ab-)Wasser und in geringem<br />
Maße TK<br />
Standardisierung innerh. d. Sekt.<br />
Bei Kundenbetreuung und Bei Kundenbetreuung und Bei Einf. dezentr. Bei Kundenbetreuung und<br />
Netzbetrieb, insbes. im Zuge der Netzbetrieb Erzeugungseinheiten Netzbetrieb<br />
Einf. dezentr Erzeugungseinh.<br />
Nimmt zu<br />
Anforderungsprofile der Sektor übergreifende Berufsbilder Erste Sektor übergreifende Neue Berufsbilder im Bereich Geringe Querschnitts-<br />
Beschäftigten<br />
mit Fachkompetenzen in<br />
mehreren <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Berufsbilder mit Fachkompetenzen<br />
in mehreren<br />
dezentraler <strong>Versorgung</strong>ssysteme anforderungen an Beschäftigte<br />
<strong>Versorgung</strong>ssektoren
Inhalte Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
Produkte und<br />
Dienstleistungen<br />
Dienstleistungsorientierung<br />
Unternehmen sind kunden- und<br />
dienstleistungsorientiert<br />
Ausmaß der Integriertes Facility Management Ausführung komfortbezogener Integriertes Facility Management Ausführung komfortbezogener<br />
Dienstleistungsorientierung bei priv. HH und Unternehmen Dienstleistungen je Sektor primär bei priv. HH und Unternehmen Dienstleistungen je Sektor bei<br />
durch Spezialanbieter und bei Unternehmen durch Versorger durch Versorger privaten HH (Oberschicht) durch<br />
Versorger und kooperierende Versorger<br />
Handwerksbetriebe<br />
Marktdurchdringung von:<br />
Anlagencontracting 30% 5% 30% 10%<br />
Rundum-Sorglos-Paketen 15% 5% 20% 10%<br />
Marktentwicklung von „Smart Einsatz bei priv. HH und Primär Einsatz bei Unternehmen Einsatz bei priv. HH und Einsatz bei priv. HH und<br />
Building" Unternehmen Unternehmen Unternehmen<br />
Marktdurchdringung 30% 5% 30% 10%<br />
Integration von dezentralen Stark ausgeprägt Findet nur vereinzelt statt Bildet die Ausnahme Keine<br />
Anlagen zu „virtuellen Kraftwerken"<br />
Demand Side Management Realisierung auf breiter Basis bei Unklare Randbedingungen Moderate Realisierung bei Schwache Verbreitung trotz ververlässlichem<br />
Regelungsrahmen erschweren Verbreitung verlässlichem Regelungsrahmen lässlichen Regelungsrahmens<br />
aufgrund Konzentration auf<br />
Ballungszentren<br />
Marktdurchdringung 20% 10% 15% 10%<br />
Endverbraucher-Preisentwicklung Preisanstieg in allen Sektoren moderat Deutlicher Preisanstieg in<br />
allen Sektoren<br />
Preiserhöhungen für:<br />
Strom und Gas 1%/a 1,5%/a 2%/a 2,5%/a<br />
Wasser 2%/a 3%/a 3%/a 4%/a<br />
TK 0,5%/a 1,0%/a 1,0%/a 1,5%/a<br />
Preisstruktur Stärkere Gewichtung von verbrauchsabh. Geringere Gewichtung von Stärkere Gewichtung von<br />
gegenüber verbrauchsunabh. Bestandteilen<br />
verbrauchsabh. gegenüber verbrauchsabh. gegenüber<br />
verbrauchsunabh. Bestandteilen verbrauchsunabh. Bestandteilen<br />
231 A.1. Tabellarische Darstellung der Szenarien
232 A.1. Tabellarische Darstellung der Szenarien<br />
Inhalte Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
Technische Entwicklung<br />
Nutzung dezentraler Technologien Dezentrale Technologien prägen Zentrale Technologien prägen Mix Zentrale Technologien prägen den Zentrale Technologien prägen den<br />
und Verfahren Mix bei hohem Anteil v. Tech- bei hohem Anteil dezentr. Tech- Mix; Brennstoffzellen haben Mix; Dezentrale Anlagen<br />
nologien a. Gasbasis als gesellschaftl.<br />
nolog. a. Basis Erneuerb. Energ. Konjunktur überzeugen Bevölkerung nicht<br />
tragfähige Innovation<br />
Anteil a. d. Stromerzeugung 22,5% 14,0% 8,5% 7,5%<br />
Energiemix Orientierung an Umweltschutzzielen Orientierung an Wirtschaftlichkeit<br />
->Gas und Erneuerbare Energien gewinnen stark an Bedeutung; -> Dominanz der Kohle, Nutzung heimischer Braunkohle aber nicht<br />
Nutzung heimischer Braunkohle aber nicht heimischer Steinkohle<br />
heimischer Steinkohle (keine Subventionierung)<br />
Ausstieg aus Kernenergie<br />
Weiternutzung der Kernenergie<br />
Anteil a. d. Stromerzeugung:<br />
Gas Nimmt stark zu auf 45% Nimmt geringfügig zu auf 17%<br />
Öl bleibt konstant bei 1% bleibt konstant bei 1%<br />
Kohle nimmt stark ab auf 24% bleibt konstant bei 52%<br />
Braunkohle / Steinkohle 10% / 14% 8% / 16% 22% / 30% 30% / 22%<br />
Erneuerbare Energien nimmt stark zu auf 30% kaum Zubau gegenüber heute auf 10%<br />
Kernkraft nimmt stark ab auf 0% nimmt ab auf 20%<br />
Zentrale Anlagen auf Basis Offshore Windkraft, Offshore Windkraft, Geringe Wirtschaftlichkeit bremst Ausbau<br />
Erneuerb. Energien<br />
Wasserkraft, Biomasse sind<br />
wettbewerbsfähig<br />
Biomasse, PV-Parks;<br />
nur Wasserkraft ist<br />
Offshore Windkraft (vereinzelt errichtet),<br />
Wasserkraft, Biomasse sind wettbewerbsfähig<br />
wettbewerbsfähig<br />
Anteil. a. d. Stromerzeug. 15% 20% 5%<br />
Dezentrale Anlagen auf Basis Onshore Windkraft, Wasserkraft, Onshore Windkraft, Wasserkraft, Onshore Windkraft, Wasserkraft, PV;<br />
Erneuerb. Energien<br />
Biomasse, PV sind Biomasse sind wettbewerbsfähig,<br />
Nur Biomasse ist wettbewerbsfähig<br />
wettbewerbsfähig<br />
PV wird gefördert<br />
Anteil. a. d. Stromerzeug. 15% 10% 5%<br />
Dezentrale Anlagen auf Gasbasis Mikro- u. Mini-KWK Mini-KWK<br />
(Brennstoffzellen, Stirlingmotoren,<br />
gr. Motoren, Mikrogasturbinen)<br />
(Brennstoffzellen, gr. Motoren,<br />
Mikrogasturbinen)<br />
(Brennstoffzellen, gr. Motoren,<br />
Mikrogasturbinen)<br />
(Brennstoffzellen, gr. Motoren,<br />
Mikrogasturbinen)<br />
Anteil. a. d. Stromerzeug. 7,5% 4% 3,5% 2%<br />
Entw. v. Technolog. z. Effizienz- Hohe Effizienz bei der Erzeugung Orientierung an Rentabilität und<br />
steigerung auf Erzeugerseite<br />
bewährter Technik<br />
Reduktionspot. b. Anl. z. Stromerz 20% 10%
Inhalte Szenario A Szenario B Szenario C Szenario D<br />
Technische Entwicklung<br />
Entwicklung von Entsorgungs-/ Verstärkte Nutzung dezentraler Nutzung dezentraler Technologien Nutzung dezentraler Technologien Ordnungsrechtliche Vorgaben<br />
Aufbereitungstechnologien im Technologien, verkoppelt mit durch priv. HH durch priv. HH determinieren Nutzung dezentr.<br />
Wassersektor Energieversorgung, durch priv. Technologien durch priv. HH und<br />
Marktdurchdringung von: HH und Unternehmen Unternehmen<br />
Regenwasser-Nutzung 30% 15% 15% 20%<br />
Grauwasser-Recycling 30% 10% 10% 15%<br />
Urin-Separation 5% 0% 1% 0%<br />
Wärmerückgewinn. aus Abwasser 20% 5% 5% 5%<br />
dezentraler Versickerung keine Angabe keine Angabe keine Angabe keine Angabe<br />
Entwicklung von Technologien zur Effizientere Technik spart Effizientere Technik spart Effizientere Technik spart Strom,<br />
Effizienzsteigerung auf der Strom, Wärme und Wasser in Strom, Wärme und Wasser in Wärme und Wasser in priv. HH<br />
Nachfrageseite priv. HH, Gewerbe, Handel und Industrie priv. HH, Gewerbe, Industrie (Oberschicht), Gewerbe, Industrie<br />
Reduktionspotenziale bei:<br />
Strom und Wärme 25% 15% 5%<br />
Im Bereich Wasser 20% 10% 5-10%<br />
TK-Technologien als Enabler für<br />
andere <strong>Versorgung</strong>stechnologien<br />
Einheitliche Plattform seitens TK als<br />
Voraussetzung von Smart-Building<br />
Entwicklung von Netztechnologien Bei Strom: Umbau von Bei Strom: Keine wesentl. Bei Strom: Optimierung der Netze Bei Strom: Keine wesentl.<br />
in den Sektoren Strom+TK Übertragung zu Verteilung Veränderung des Netzes bei bestehender Struktur Veränderung des Netzes<br />
Bei Gas: leichter Ausbau der Verteilung<br />
Gas: punktuell. Ausb. d. Verteilg.<br />
Bei TK: Ausbau der Software und Bei TK: vereinzelter Ausbau der Bei TK: Ausbau der Software und Bei TK: Ausbau der Software und<br />
Netzdienste für „aktive" Netze Software und Netzdienste für Netzdienste für „aktive" Netze nur Netzdienste für „aktive" Netze nur<br />
„aktive" Netze in Pilotprojekten in Pilotprojekten<br />
Entwicklung von Stromspeicher-<br />
Kleine Speicher sind marktreif und zu marktfähigen Preisen verfügbar<br />
technologien: Marktdiffusion 5% 2%
A.2. Beschreibung der Ziele<br />
A.2 Beschreibung der Ziele<br />
A.2.1 Umweltschutz<br />
Ziele<br />
Klimaschutz<br />
Reduktion der CO 2-<br />
Emissionen<br />
Reduktion der Methan-<br />
Emissionen<br />
Reduktion von N 20 aus<br />
Kläranlagen<br />
Landschaftsschutz<br />
Vermeidung von Eingriffen in<br />
das Landschaftsbild<br />
Schaffung und Erhaltung von<br />
Erholungsgebieten<br />
Gewässerschutz<br />
Vermeidung von Schadstoffeinträgen (Nitrat, Schwermetalle, Arzneimit-<br />
tel) in Wasserreservoire (Oberflächengewässer, Grundwasser) zur<br />
Trinkwassererzeugung<br />
Erhalt von Trinkwasserreservoiren<br />
Vermeidung von Schadstoffeinträgen<br />
in Wasserquellen<br />
(Oberflächengewässer,<br />
Grundwasser)<br />
Bodenschutz<br />
Verringerung des Deponieraums zur Senkung der Gefahr von Boden-<br />
kontaminationen in Lagerstätten für radioaktive und toxische Abfälle<br />
Vermeidung von Bodenbelastung<br />
durch Unfälle in<br />
EVU's<br />
Vermeidung von Deponieraum<br />
für radioaktive und<br />
toxische Abfälle<br />
Definition<br />
Reduktion der CO 2-Emissionen von Haushalten, produzierenden<br />
Unternehmen und von Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Beispiel: Verbesserung der Wirkungsgrade oder Einbau weiterer Luftfilter<br />
bei Kraftwerken<br />
Reduktion der Methan-Emissionen von Haushalten, produzierenden<br />
Unternehmen und von Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren bzw.<br />
ihrer Netze<br />
Beispiel: Vermeidung der Entstehung und des Austritts von Methan aus<br />
Kläranlagen und Abwasserkanälen<br />
Reduktion der N 20-Emissionen von Haushalten, produzierenden<br />
Unternehmen und Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Beispiel: Reduktion durch geschlossene Anlagen<br />
Vermeidung der Störung des Blicks eines Betrachters durch Objekte<br />
aus den <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Beispiele: Sendemasten für den Mobilfunk, Masten für Windkraftanlagen<br />
Ausweisung und Erhaltung von Gebieten primär zu Zwecken der<br />
Erholung der Bevölkerung aus ländlichen und Ballungsgebieten<br />
Beispiel: Naturparks, Landschaftsschutzgebiete<br />
Erhalt von Grundwasser führenden Schichten durch Neubildung aus<br />
Fließgewässern und Seen sowie Oberflächengewässern mit Trinkwasserqualität<br />
Beispiele: Wasserschutzgebiete, Trinkwassertalsperren<br />
Beispiel: hormonhaltige/Arzneimittelhaltige Einträge in Seen oder<br />
Flüsse durch Kläranlagen der Siedlungswasserwirtschaft oder durch<br />
die Landwirtschaft<br />
Vermeidung von Bodenbelastungen im Umfeld von Unternehmen der<br />
<strong>Versorgung</strong>ssektoren infolge von Unfällen<br />
Beispiel Austritt von radioaktivem Kühlwassers von Kernkraftwerken<br />
und Verseuchung des Bodens<br />
Beispiel: Bodeneinträge durch die Lagerung von verunreinigtem Gips<br />
aus der Kohleentschwefelung<br />
234
A.2.1 Umweltschutz<br />
Nutzung landwirtschaftlicher Flächen im Rahmen der Energieversor-<br />
gung<br />
Ziele<br />
Vermeidung von langfristigen<br />
Schadstoffakkumulationen<br />
Vermeidung der Übernutzung<br />
landwirtschaftlicher Flächen<br />
Artenschutz<br />
Schutz der Flora<br />
Schutz der Fauna<br />
Schutz von Habitaten<br />
Ressourcenschonung<br />
Materialien<br />
Fläche<br />
Rohstoffe<br />
Wald<br />
Wasser<br />
Definition<br />
Vermeidung von kontinuierlichen Einträgen von Pflanzenschutzmitteln<br />
oder Schwermetallen im Boden<br />
Beispiel: Pestizideinträge bei landwirtschaftlich genutzten Flächen für<br />
die Biotreibstofferzeugung; Schwermetalleinträge im Umfeld von Kohlekraftwerken<br />
Beispiel: Auslaugung des Bodens infolge Anbaus nur einer Pflanzensorte<br />
zur Erzeugung von Biotreibstoffen<br />
Schutz der Pflanzen zwecks Arterhaltung und zur Biodiversität<br />
Beispiel: Schutz einer Pflanzenart, die von Aussterben bedroht ist<br />
Schutz der Pflanzen zwecks Arterhaltung und zur Biodiversität<br />
Beispiel: Schutz einer Tierart, die vom Aussterben bedroht ist<br />
Abiotische Areale zum Erhalt von Rückzugsgebieten für Tiere und<br />
Pflanzen<br />
Beispiele: Seen aufgrund von Tagebauen, aufgelassene Abraumhalden<br />
Sparsamer Einsatz von Stoffen, die während des Baus, Betriebs oder<br />
bei der Demontage von <strong>Versorgung</strong>sanlagen (Kraftwerke, Windräder,<br />
Heizungen) eingesetzt werden<br />
Beispiel: Sand, Mineralien, Metalle zum Bau von Kraftwerken<br />
Ausmaß der anthropogenen Nutzung von Flächen<br />
Beispiele: Errichtung von Siedlungen, Gewerbe- und Industriegebieten,<br />
Gelände für <strong>Versorgung</strong>sunternehmen einschließlich Abraumhalden,<br />
Tagebaugebieten<br />
Sparsamer Einsatz von Brennstoffen zur Produktion von <strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
bei Herstellung und Betrieb<br />
Beispiele: Öl, Gas, Kohle<br />
Vermeidung der Umwandlung des Waldes in andere anthropogene<br />
Nutzungszwecke sowie seine energetische Nutzung<br />
Beispiele: Errichtung von Siedlungen, Gewerbe- und Industriegebieten,<br />
Gelände für <strong>Versorgung</strong>sunternehmen<br />
Sparsamer Einsatz von Wasser in Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
oder zur Wasserbereitstellung; Vermeidung von Wasserverlusten<br />
durch Rohrbrüche oder Leakagen<br />
Beispiele: Sparsamer Einsatz zu Kühlzwecken in <strong>Versorgung</strong>sunternehmen;<br />
Gereinigte Wassermenge für Haushalte und produzierende Unternehmen<br />
zu Konsum- oder Produktionszwecken<br />
235
A.2. Beschreibung der Ziele<br />
A.2.2 Gesundheitsschutz<br />
Ziele<br />
Definition<br />
Schutz vor Luftimmissionen<br />
Mortalität<br />
Morbidität<br />
Beeinträchtigungen<br />
Todesfälle in der Bevölkerung aufgrund von Luftimmissionen<br />
Beispiel: Lungenkrebs durch Feinstäube aus Dieselruß<br />
Körperliche Erkrankungen der Bevölkerung aufgrund von Luftimmissionen<br />
Beispiel: Atemwegserkrankungen durch bodennahes Ozon<br />
Immissionen, die keine gesundheitlichen Schäden, doch Beeinträchtigungen<br />
des Lebensgefühls hervorrufen<br />
Beispiel: Kopfschmerzen, Übelkeit durch Einatmung von Schwefelverbindungen<br />
in der Umgebung von Kraftwerken<br />
Schutz vor radioaktiver Strahlung<br />
Mortalität<br />
Morbidität<br />
Beeinträchtigungen<br />
Todesfälle des Personals und der Bevölkerung aufgrund starker Exposition<br />
radioaktiver Strahlungen aus Kernkraftwerken und Endlagern<br />
während des gewöhnlichen Betriebs, bei Unfällen oder aufgrund von<br />
Terrorangriffen<br />
Körperliche Erkrankungen des Personals und der Bevölkerung aufgrund<br />
Exposition radioaktiver Strahlungen während des Betriebs von<br />
Kernkraftwerken und Endlagern sowie aufgrund der weiteren Verwendung<br />
des Schutts nach Abriss der Anlagen sowie der Metalle der<br />
Brennelemente<br />
Beispiel: Leukämieerkrankungen aufgrund eines Reaktorunfalls<br />
Expositionen, die keine gesundheitlichen Schäden, doch Beeinträchtigungen<br />
des Lebensgefühls hervorrufen<br />
Schutz vor Elektromagnetischen Feldern<br />
Mortalität<br />
Morbidität<br />
Beeinträchtigungen<br />
Todesfälle der Bevölkerung aufgrund starker Exposition elektromagnetischer<br />
Felder<br />
Körperliche Erkrankungen der Bevölkerung aufgrund starker Exposition<br />
elektromagnetischer Felder<br />
Expositionen, die keine gesundheitlichen Schäden, doch Beeinträchtigungen<br />
des Lebensgefühls oder komfortbezogene Einschränkungen<br />
oder wirtschaftliche Schäden hervorrufen<br />
Schutz vor Belastung des Rohwassers/Trinkwassers<br />
Mortalität<br />
Morbidität<br />
Beeinträchtigungen<br />
Todesfälle in der Bevölkerung aufgrund Genusses von verschmutztem<br />
Trinkwassers<br />
Beispiel: Kindersterblichkeit durch verunreinigtes Trinkwasser nach<br />
einem Unfall in einem Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Körperliche Erkrankungen durch mikrobielle Einträge oder Erkrankungen<br />
durch Schwermetalle oder terroristische Wasserverunreinigungen<br />
Beispiel: Durchfall aufgrund von E.Coli-Bakterien,<br />
Beeinträchtigung infolge der verstärkten Desinfektion des Rohwassers<br />
in Form von Geruch oder schlechtem Geschmack des Wassers<br />
Beispiel: starke Chlorierung des Wassers bei niedriger Rohwasserqualität<br />
236
A.2.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
A.2.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
Ziele<br />
Räumliche Verfügbarkeit<br />
In Ballungsräumen<br />
In ländlichen Räumen<br />
Hohe Anschlussdichte von Strom, Gas, Wasser und Telekommunikati-<br />
an für Haushalte, öffentliche und private Unternehmen in Gebieten mit<br />
geschlossener Bebauung in städtischen Randlagen<br />
In Randlagen von Ballungsgebieten<br />
Allzeitige Verfügbarkeit<br />
Verfügbarkeit von Rohstoffen für das Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>s-<br />
sektoren als Produzent sowie von <strong>Versorgung</strong>sleistungen für dessen<br />
Kunden<br />
Kostengünstige Verfügbarkeit<br />
Verminderung von Störpotenzialen<br />
Sicherheit des Netzes<br />
Sicherheit der Anlagen<br />
Anpassungsfähigkeit des <strong>Versorgung</strong>ssystems<br />
Erhalt der Reversibilität<br />
innerhalb des <strong>Versorgung</strong>ssystems<br />
Fehlertoleranz<br />
Qualität der <strong>Versorgung</strong><br />
Sicherung eines hohen<br />
Qualitätsniveaus<br />
Angebot einer Vielzahl von<br />
<strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
Definition<br />
Hohe Anschlussdichte von Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikation<br />
für Haushalte, öffentliche und private Unternehmen in Gebieten mit<br />
geschlossener Bebauung in den Kernstädten<br />
Beispiel: Stromanschluss direkt am Grundstück des Wohnhauses<br />
Hohe Anschlussdichte von Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation<br />
für Haushalte, öffentliche und private Unternehmen in Gebieten mit<br />
geschlossener Bebauung in ländlichen Gebieten<br />
Verfügbarkeit einer ausreichenden <strong>Versorgung</strong> (Strom, Gas, Wasser,<br />
Telekommunikationsdiensten)<br />
Beispiel: 24h <strong>Versorgung</strong> mit Wasser<br />
Beispiel: Kostengünstige Verfügbarkeit von Kohle für das Strom erzeugende<br />
<strong>Versorgung</strong>sunternehmen<br />
Vermeidung von technischen Netzausfällen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Beispiel Gas: Ausfall des Gasnetzes infolge eines Rohrbruchs<br />
Vermeidung von technischen Ausfällen von <strong>Versorgung</strong>sanlagen<br />
Beispiel Wasser: Aufbereitungsanlagen, Pumpen<br />
Erhaltung der Modifizierbarkeit von Technologiepfaden dahingehend,<br />
dass Wiederherstellbarkeit des Ursprungszustandes ermöglicht wird<br />
und keine Schäden verursacht werden, die irreparabel sind<br />
Beispiel: Nutzung der Windkraft, die nach dessen technischer Überalterung<br />
keine Folgen hinterlässt<br />
Fähigkeit eines <strong>Versorgung</strong>ssystems auch mit einer begrenzten Zahl<br />
fehlerhafter Subsysteme, Komponenten etc. seine spezifische Funktion<br />
der <strong>Versorgung</strong> mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation zu<br />
erfüllen. Diese wird gewährleistet durch redundante Komponenten etc.<br />
Beispiel: Vermeidung eines Stromausfalls aufgrund techn. Störung in<br />
einem Kraftwerksblock durch Übernahme der Stromproduktion mittels<br />
eines zweiten Blocks<br />
Erhalt eines hohen Qualitätsniveaus von <strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
Beispiel Strom: Sicherstellung der Konstanz von Spannung und Frequenz<br />
im Netz<br />
Angebotsvielfalt an <strong>Versorgung</strong>sleistungen umfasst neben den Kernprodukten<br />
Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsgrunddiensten<br />
(Telefonie) weitere <strong>Versorgung</strong>sleistungen, wie Contracting, Rundum-<br />
Sorglos-Pakete<br />
237
A.2. Beschreibung der Ziele<br />
Ziele<br />
Mittel- bis langfristige gesicherte Verfügbarkeit<br />
Unabhängigkeit von knappen<br />
Ressourcen<br />
Diversifikation von <strong>Versorgung</strong>squellen<br />
Diversifikation von Bezugsquellen<br />
Technologische Diversität<br />
Definition<br />
Langfristig endliche Ressourcen, wie fossile Energieträger, seltene<br />
Metalle, sollen substituiert werden<br />
Für die Strom- und Wärmeerzeugung: Möglichst starke Mischung aus<br />
verschiedenen klassischen (Gas, Öl, Kohle, Kernkraft) und erneuerbaren<br />
Energiequellen (Sonne, Wind, Wasser)<br />
Räumliche (globale) Verteilung der Lagerstätten je Energieträger,<br />
Wasserreservoir<br />
Beispiel: Lagerstätten von Kohle in Europa, Südamerika, Asien etc.<br />
Es sollen möglichst zahlreiche unterschiedliche Verfahrentechniken zur<br />
Sicherstellung der <strong>Versorgung</strong> eingesetzt werden, die unterschiedliche<br />
Ressourcen nutzen und unterschiedliche Einsatzgebiete (Grundlast,<br />
Mittellast, Spitzenlast) aufweisen<br />
Beispiel Strom: Braunkohlekraftwerke mit optimierter Anlagetechnik,<br />
GuD-Kraftwerke, Brennstoffzellen, Spitzenlastturbinen;<br />
A.2.4 Wirtschaftliche Aspekte<br />
Ziele<br />
Erhalt bestehender Arbeitsverhältnisse und Entstehung neuer Arbeits-<br />
plätze bei Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren sowie der Beitrag<br />
der <strong>Versorgung</strong>ssektoren zur gesamtwirtschaftlichen Beschäftigung<br />
und innerhalb der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Sicherung und Steigerung<br />
der Beschäftigung<br />
Funktionsfähigkeit des Marktes<br />
Pluralistische Marktstruktur<br />
Fortbestand deutscher Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren gegen-<br />
über internationalen Wettbewerbern durch Sicherung des Umsatzes<br />
von <strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
Internationale Wettbewerbsfähigkeit<br />
Vorbeugendes Wirtschaftshandeln<br />
Investitionstätigkeit<br />
Innovationstätigkeit<br />
Definition<br />
Beispiel Erhalt von Arbeitsplätzen im Kohlekraftwerksbereich, jedoch<br />
auch im Bereich von Biomasse gefeuerten BHKW's<br />
Marktaktivität von großen und kleinen Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
in öffentlicher und privatwirtschaftlicher Rechtsform<br />
Beispiele: international tätiger Großversorger, Stadtwerk,<br />
Beispiel: Kontinuierliche Umsatzsteigerungen eines deutschen Gasversorgungsunternehmens<br />
durch Ausdehnung seiner Unternehmensaktivitäten<br />
in Deutschland und im Ausland<br />
Regelmäßige Investitionen gemäß Stand der Technik zur Vermeidung<br />
von noch höheren Investitionskosten durch Totalausfall von <strong>Versorgung</strong>sanlagen<br />
und -netzen<br />
Beispiel: Kontinuierliche Investitionen zur Erhaltung des Wassernetzes<br />
Kontinuierlicher Betrieb von F + E-Aktivitäten sowie Einsatz neuer<br />
Technologien in Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren, um die Vorreiterfunktion<br />
im Vergleich zu den Wettbewerbern zu übernehmen<br />
Beispiel: Bau eines Kohlekraftwerks als Modellanlage mit CO2-<br />
Abscheidung<br />
238
A.2.4 Wirtschaftliche Aspekte<br />
Ziele<br />
Kostendeckende Preise<br />
Deckung der Investitionskosten<br />
Deckung der Betriebskosten<br />
Deckung der internalisierten<br />
Kosten<br />
Deckung der Abgaben<br />
Einkommensentwicklung<br />
Einkommenssteigerung<br />
Einkommenssicherung<br />
Effizienz der Leistungser-<br />
Stellung<br />
Flexibilität<br />
Innovationsfähigkeit<br />
Definition<br />
Vollständige Deckung der fixen Bestandteile der Produktionskosten bei<br />
Erzeugung/Exploration, Transport und Verteilung in den Unternehmen<br />
der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Beispiel: Deckung der Investitionen in die Modernisierung von Kraftwerken<br />
Vollständige Deckung der variablen Bestandteile der Produktionskosten<br />
Erzeugung/Exploration, Transport und Verteilung bei Unternehmen<br />
der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Beispiel: Deckung der Kosten für Roh-, Betriebs- und Hilfsstoffe zur<br />
Stromerzeugung in einem Kraftwerk<br />
Vollständige Deckung internalisierter externer Produktionskosten bei<br />
Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Beispiele: Maßnahmen zur Grundwasserneubildung, Mineralölsteueranteil<br />
als Ökosteuer, Stromsteuer, CO2-Emissionszertifikate<br />
Vollständige Deckung der Abgaben, die aus dem Betrieb von Unternehmen<br />
in den <strong>Versorgung</strong>ssektoren resultieren<br />
Beispiel: Körperschafts-, Gewerbesteuer<br />
Zuwachs des nationalen Volkseinkommens (BIP)<br />
Dabei ist der Einfluss der <strong>Versorgung</strong>ssektoren auf den Zuwachs des<br />
nationalen Volkseinkommens zu würdigen<br />
Konstanz des nationalen Volkseinkommens (BIP)<br />
Dabei ist der Einfluss der <strong>Versorgung</strong>ssektoren auf die Konstanz des<br />
nationalen Volkseinkommens zu würdigen<br />
Kosten bezogene Effizienz bedeutet den sparsamen Einsatz von<br />
Geldmitteln durch die Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren zur<br />
Erstellung ihrer <strong>Versorgung</strong>sleistungen als auch hinsichtlich des Einsatzes<br />
der erhaltenen öffentlichen Fördermittel.<br />
Beispiel: Stetige Investitionen zur Erhaltung des Wassernetzes im<br />
Vergleich zur einmaligen Generalsanierung des gesamten Netzes<br />
Gesamtwirtschaftl. Effizienz bedeutet eine Preisbildung für <strong>Versorgung</strong>sleistungen,<br />
die Monopolgewinne vermeidet<br />
Beispiel: Idealtypische Situation: Grenzkosten gleich Preis<br />
Umwelt bezogene Effizienz bedeutet einen möglichst geringen Einsatz<br />
von realen Größen (Stoffen/Gütern) zur Erzeugung von <strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
Beispiel: Sparsamer Einsatz von Ressourcen zur Stromerzeugung<br />
Maß, in wieweit Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren in der Lage<br />
sind technische Neuerungen bei konventionellen oder bei innovativen<br />
Technologien in ihren Unternehmen zu implementieren<br />
Beispiel: Hinzunahme von gasgefeuerten GuD-Kraftwerken und Brennstoffzellen<br />
in das unternehmenseigene Portfolio zur Stromerzeugung<br />
239
A.2. Beschreibung der Ziele<br />
Ziele<br />
Anpassungsfähigkeit an<br />
Markterfordernisse<br />
Erhalt und Entwicklung des Wissenskapitals<br />
Erhalt von Wissen zu bestehenden<br />
Technologien<br />
Erhalt und Entwicklung<br />
institutioneller Innovationen<br />
Aufbau von Wissen zu neuen<br />
Technologien<br />
Erhalt der Reversibilität<br />
innerhalb des <strong>Versorgung</strong>ssystems<br />
Fehlertoleranz<br />
Definition<br />
Fähigkeit von Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren sich sowohl<br />
angebotsseitigen als auch nachfrageseitigen Erfordernissen anzupassen.<br />
Beispiel: Angebotsseite: Orientierung an den eingesetzten Technologien<br />
der Wettbewerber<br />
Beispiel Nachfrageseite: Orientierung an Kundenwünschen, wie Ausweis<br />
von Preisbestandteilen oder des eingesetzten Anlagenmixes zur<br />
Stromerzeugung in der Rechnung<br />
Erhalt des Fachwissens in den Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
bezüglich des Betriebs von <strong>Versorgung</strong>sanlagen durch Begrenzung<br />
der Auslagerung an Fremdfirmen<br />
Beispiel: Stadtwerk behält Kernbestand an Personal zum Betrieb,<br />
Wartung, und Reparatur von Stromerzeugungsanlagen<br />
Erhalt und Ausbau von Kooperationen zwischen Unternehmen der<br />
<strong>Versorgung</strong>ssektoren oder produzierenden Unternehmen und Forschungsinstitutionen<br />
zwecks Generierung neuer Produkte, Produktionsprozesse<br />
und zur Verringerung von Herstellungskosten<br />
Beispiel: Vergabe von Forschungsaktivitäten an entsprechende Institute<br />
von Hochschulen<br />
Aufbau des Fachwissens in den Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
bezüglich neuester <strong>Versorgung</strong>stechnologieentwicklungen durch<br />
Weiterbildung und eigener F+E-Aktivitäten<br />
Beispiel: Stadtwerk hält sich eigene Personalkapazitäten, die die<br />
Entwicklung der Technologien von Stromerzeugungsanlagen verfolgen<br />
Erhaltung der Modifizierbarkeit von Technologiepfaden dahingehend,<br />
dass Wiederherstellbarkeit des Ursprungszustandes ermöglicht wird<br />
und keine Schäden verursacht werden, die irreparabel sind<br />
Beispiel: Nutzung der Windkraft, die nach dessen technischer Überalterung<br />
keine Folgen hinterlässt<br />
Fähigkeit eines <strong>Versorgung</strong>ssystems auch mit einer begrenzten Zahl<br />
fehlerhafter Subsysteme, Komponenten etc. seine spezifische Funktion<br />
der <strong>Versorgung</strong> mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation zu<br />
erfüllen. Diese wird gewährleistet durch redundante Komponenten etc..<br />
Beispiel: Vermeidung eines Stromausfalls aufgrund techn. Störung in<br />
einem Kraftwerksblock durch Übernahme der Stromproduktion mittels<br />
eines zweiten Blocks<br />
A.2.5 Soziale Aspekte<br />
Beispiel: kein bevorrechtigter Zugang von landwirtschaftlichen Betrie-<br />
ben zur Wassernutzung gegenüber den Haushalten<br />
Ziele<br />
Soziale Gerechtigkeit<br />
Sozialverträgliche Preise für<br />
Haushalte<br />
Gleichberechtigter Zugang zu<br />
Ressourcen von Haushalten,<br />
öffentlichen Einrichtungen<br />
und Unternehmen<br />
Definition<br />
Preishöhe je Einheit <strong>Versorgung</strong>sleistung, die einen bestimmten Anteil<br />
des durchschnittlichen Haushaltseinkommens nicht überschreitet<br />
Beispiel: Wasserpreis pro m 3 sollte bestimmten Anteil des durchschnittlichen<br />
Haushaltseinkommens nicht überschreiten<br />
Kein bevorrechtigter Zugang eines volkswirtschaftlichen Sektors<br />
zulasten der anderen Sektoren<br />
240
A.2.5 Soziale Aspekte<br />
Ziele<br />
Gewährleistung einer Grundversorgung<br />
für alle<br />
Faire Rechts- und Vertragsgestaltung<br />
zur <strong>Versorgung</strong> für<br />
alle<br />
Vertretbares Wohlstandsgefälle<br />
Geschlechtergerechtigkeit<br />
Regionale Gerechtigkeit<br />
Gleichberechtigter Zugang der Bevölkerungen in Industrie- und Ent-<br />
wicklungsländern zu Ressourcen<br />
Beispiel: Energieträger (Öl, Erdgas, Biogas, Kohle, Wasserstoff,<br />
Erneuerbare Energie) zur Strom- und Wärmeerzeugung<br />
Internationale Verteilungsgerechtigkeit<br />
der Ressourcennutzung<br />
(Industrie- und<br />
Entwicklungsländer)<br />
Gleichheit der Lebensverhältnisse<br />
Partizipation<br />
Gesellschaftliche Zielformulierung<br />
Planungsverfahren<br />
Transparenz<br />
Verbraucherinformation der <strong>Versorgung</strong>ssektoren für die privaten<br />
Haushalte sollen Abrechnungsmodalitäten, Nennung von Qualitätspa-<br />
rametern übersichtlich dargestellt enthalten.<br />
Verständlichkeit der Verbraucherinformation<br />
und Verträge<br />
der <strong>Versorgung</strong><br />
Angabe der Höhe der Preise<br />
Angabe der Preisbestandteile<br />
Definition<br />
Kein Ausschluss von <strong>Versorgung</strong>sleistungen (Wasser/Abwasser,<br />
Strom, Gas) in finanziellen Notlagen von privaten Haushalten<br />
Beispiel: keine Absperrung des Wassers bei Insolvenz eines Haushalts<br />
Stärkung der Mängelrechte für private Haushalte sowie Einräumung<br />
von Kündigungsmöglichkeiten<br />
Beispiel: Verstärkung der Mängelrechte von privaten Haushalten bei<br />
Stromausfall<br />
Einkommensunterschiede zwischen obersten und untersten 10% der<br />
Bevölkerung von Deutschland sollte nicht zu groß sein. Dabei ist der<br />
Einfluss der <strong>Versorgung</strong>ssektoren auf das Wohlstandsgefälle zu<br />
würdigen<br />
Ausrichtung der Nutzungsprofile an den Bedürfnissen beider Geschlechter<br />
sowie Chancengleichheit innerhalb der Unternehmen<br />
Beispiel: Tarifangebote zugeschnitten auf weibliche Bedürfnisse;<br />
Chancengleichheit bei der Erlangung von Führungspositionen in<br />
Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Trend zur gleichmäßigen Verteilung des BIP Wachstums im Raum.<br />
Dabei ist der Einfluss der <strong>Versorgung</strong>ssektoren auf die Verteilung des<br />
BIP Wachstums zu würdigen.<br />
Beispiel: Gleiche Steigerungsraten des BIP in Ballungs- und ländlichen<br />
Räumen<br />
Teilnahme der Bevölkerung in Deutschland an der gesellschaftlichen<br />
Zielfindung und an Umsetzungsstrategien auf lokaler, nationaler und<br />
internationaler Ebene<br />
Beispiel: lokale Agenda 21, Nachhaltigkeitsstrategie<br />
Dabei ist der Einfluss der <strong>Versorgung</strong>ssektoren auf gesellschaftliche<br />
Zielfindungen zu würdigen.<br />
Teilnahme der Bürger in Deutschland an Planungsverfahren in Bezug<br />
auf die <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Beispiel: Bebauungsplan, Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
Beispiele: Abrechnungszeitraum, Häufigkeit der Vorauszahlung; Gute<br />
Gliederung, verständliche Sprache in der Abrechnung, Nennung von<br />
Zahlungsbedingungen<br />
Offenlegung des Gesamtpreises pro Einheit <strong>Versorgung</strong>sleistung<br />
Beispiel: Durchschnittlicher Gesamtpreis pro Einheit für Gas, Strom,<br />
Wasser auf der Rechnung<br />
Offenlegung der Preisbestandteile für die Wertschöpfungsbereiche<br />
Exploration/Erzeugung, Transport, Verteilung einschließlich aller<br />
241
A.2. Beschreibung der Ziele<br />
Ziele<br />
Angabe über die Bereitstellung der reinen <strong>Versorgung</strong>sleistung oder<br />
zusätzlich weiterer Dienstleistungen sowie Angabe der Herstellungs-<br />
weise von <strong>Versorgung</strong>sleistungen<br />
Angabe der Leistungsbestandteile<br />
(Herkunft und Art<br />
der Leistung)<br />
Angabe der Marktstrukturen<br />
Soziale Sicherheit<br />
Vermeidung von Armut<br />
Sicherstellung einer medizinischen Grundversorgung sowie Altersver-<br />
sorgung der Beschäftigten von Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Erhalt sozialer Sicherungssysteme<br />
Sicherung angemessener<br />
Mindestlöhne<br />
Sicherung humaner Arbeitsbedingungen<br />
Sozialverträgliche Gestaltung<br />
des Beschäftigungswandels<br />
Erhaltung der sozialen Ressourcen<br />
Übernahme von Verantwortung<br />
der Gesellschaft für<br />
nachfolgende Generationen<br />
Erhalt von unterstützenden Aktivitäten von Unternehmen der Versor-<br />
gungssektoren zur Funktionsfähigkeit des Gemeinwesens einer<br />
Gebietskörperschaft<br />
Beispiele: Sponsoring von örtlichen Vereinen, Vergabe von Mitteln zur<br />
Förderung der Jugendarbeit<br />
Übernahme von Verantwortung<br />
der <strong>Versorgung</strong>sunternehmen<br />
für die Daseinsvorsorge<br />
Schaffung sozialer Standards in Entwicklungsländern durch Unter-<br />
nehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren aus Industrieländern<br />
Übernahme von Verantwortung<br />
von Unternehmen in<br />
Entwicklungsländern<br />
Definition<br />
Steuern pro Einheit Gas, Strom, Wasser auf der Rechnung<br />
Beispiel: Netzkosten für Strom als Preisbestanteil der Wertschöpfungsstufe<br />
Transport<br />
Beispiel: Vertragsbestandteile sind die Lieferung von Strom als auch<br />
die monatliche Darstellung des Strombezugsprofils; zudem Angabe<br />
der Anlagengröße (Kraftwerk, BHKW) oder der Energiequelle (Gas,<br />
Kohle, Erneuerbare Energien)<br />
Transparenz der Eigentümerschaft von Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Beispiel: Angabe des Anteils eines privaten <strong>Versorgung</strong>sunternehmens<br />
an einem Stadtwerk<br />
Vermeidung von finanzieller Armut von arbeitslos gewordenen Beschäftigten<br />
von Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren durch Existenz<br />
einer Arbeitslosenversicherung<br />
Beispiel: Zahlung von Arbeitslosengeld an einen Mitarbeiter, dessen<br />
Arbeitsplatz durch die Stillegung eines Kernkraftwerks verloren ging<br />
Einhaltung von Mindestlöhnen bei Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren,<br />
die einen angemessenen Beitrag zum Lebensstandard in<br />
Deutschland ermöglichen<br />
Beispiel: keine Dumping-Löhne<br />
Begrenzung der täglichen Arbeitszeit sowie Gewährleistung des<br />
Arbeitsschutzes bei Unternehmen der <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Beispiel: Einhaltung der maximalen täglichen Arbeitszeit von 12 h<br />
Vermeidung von Friktionen (Anstieg der Anforderungen an Mitarbeiter<br />
steigen infolge Erweiterung oder Neuausrichtung der Tätigkeitsfelder)<br />
beim Strukturwandel in den <strong>Versorgung</strong>ssektoren<br />
Beispiele: Fortbildungen der Mitarbeiter,<br />
Erhalt der Aktivitätsvielfalt zukünftiger Generationen<br />
Dabei ist der Einfluss der <strong>Versorgung</strong>ssektoren auf den Erhalt der<br />
Aktivitätsvielfalt zukünftiger Generationen zu würdigen<br />
Beispiel: Vermeidung der Nutzungseinschränkung von Landschaftsteilen<br />
durch Lager für Kernbrennelemente<br />
Beispiele: Zulassung von Gewerkschaften, keine Kinderarbeit<br />
242
A.3 Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Hinweis: Die Nummerierung der Experten ist konsistent in allen 5 folgenden Abschnitten.<br />
A.3.1 Umweltschutz<br />
Ziele<br />
Reduktion der<br />
CO2-Emissionen<br />
(Strom/Gas)<br />
Vergleich<br />
Szenarien<br />
A > B»C > D<br />
Experte 1<br />
A = B»D = C<br />
Experte 2<br />
revidiert zu<br />
A > B»D > C<br />
Gesichtspunkte<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
CO2-Emissionen hängen vorwiegend v Einsatz<br />
fossiler Energieträger ab. Verstärkte Nutzung<br />
Erneuerbarer Energien inkl. Gruben-, Klär- und<br />
Deponiegas führt zur Reduktion. Vermehrter<br />
Einsatz von Gas anstelle von Kohle verringert<br />
Emissionen. Emissionen werden u.a. wirtschaftlicher<br />
Entwicklung beeinflusst. Emissionen<br />
steigen bei erhöhtem Verkehrsaufkommen.<br />
Anteil von Kohle an Stromerzeugung<br />
Gasanteil an Stromerzeugung<br />
Anteil EE an Stromerzeugung<br />
Anteil KWK an Stromerzeugung<br />
Gas- u. Stromverbrauch<br />
Siedlungsstruktur<br />
Rechnung u. Gesamtbewertung nur für Stromerzeugung,<br />
aus Erzeugung, Technikmix, Wirkungsgrad<br />
u. Brennstoffumsatz, ohne Vorketten,<br />
ergibt CO2-Freis.:<br />
(berechneter Wert)<br />
CO2-Freis. d. Stromerz. bezogen auf Szen. A<br />
CO2-Freis. d. Stromerz. bezogen auf 2003<br />
Bewertung für gesamte CO2-Freis. (auch für<br />
nicht-Stromerzeugung) auf Basis eigener Überschlagsrechnung.<br />
Kriterien: Nachfrage, Anlagenmix,<br />
Effizienzsteigerung.<br />
Gesamtfreisetzung<br />
Gesamtfreisetzung bezogen auf heute<br />
(Gesamtfreisetzung bezogen auf A)<br />
(Freisetzung nur aus Stromerzeugung u. FW)<br />
(nur aus Stromerzeug. u. F1714 bezogen auf A)<br />
gering (+)<br />
steigt (+)<br />
steigt (+)<br />
gehen zurück (+)<br />
"aufs Land" (-)<br />
Stromerzeugung<br />
sinkt um 5%<br />
170-190 Mt<br />
(180 Mt)<br />
-48%...-42%<br />
Szenarien<br />
A B C D<br />
714 Mt<br />
-156 Mt<br />
-17% (-15%...-20%)<br />
(215 Mt)<br />
gering (+)<br />
steigt (+)<br />
steigt (+)<br />
konstant<br />
Stadtrand<br />
Stromerzeugung<br />
gleich<br />
180-200 Mt<br />
(187 Mt)<br />
=1,04xA<br />
-45%...-39%<br />
751 Mt<br />
-120 Mt<br />
-14% (-10%...-15%)<br />
(=1,05xA)<br />
(226 Mt)<br />
(=1,05xA)<br />
hoch (-)<br />
steigt gering (-)<br />
bei 10% (-)<br />
20% (+)<br />
steigen mäßig (-)<br />
Stadtrand<br />
Stromerzeugung<br />
wächst um 2% 1<br />
260-280 Mt<br />
(262 Mt)<br />
=1,46xA<br />
-21%...-15%<br />
875 Mt<br />
+5 Mt<br />
-0% (-3%...+2%)<br />
(=1,23xA)<br />
(337 Mt)<br />
(=1,57xA)<br />
hoch (-)<br />
steigt gering (-)<br />
bei 10% (-)<br />
20% (+)<br />
konstant<br />
Konz.i Ballungsz(+)<br />
Stromerzeugung<br />
gleich<br />
260-280 Mt<br />
(264 Mt)<br />
=1,47xA<br />
-21%...-15%<br />
876 Mt<br />
+6 Mt<br />
+1% (0%...+5%)<br />
(=1,23x4)<br />
(349 Mt)<br />
(=1,63xA)<br />
Urteilssicherheit<br />
4<br />
5<br />
1 Die Steigerung der gesamten Strom-Nachfrage in Szenario C ist in der Szenario-Beschreibung nur qualitativ angegeben. In Abstimmung mit den Experten wurde die Steigerung auf 2% festgelegt.<br />
243 A.3.1 Umweltschutz
244 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szenarien Urteils-<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D sicherheit<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A > B»C > D Rechnung u. Gesamtbewertung nur für Strom- Stromerzeugung: Stromerzeugung: Stromerzeugung: Stromerzeugung: 3<br />
erzeugung, aus Erzeugung, Technikmix, Wirkungsgrad<br />
u. Brennstoffumsatz, einschl.<br />
geht um 5% zurück gleich wächst um 2% 1 gleich<br />
Experte 3<br />
Gewinnung der Primärenergieträger; Öl-KW u.<br />
Mikro-KWK als vernachlässigbar ausgelassen<br />
CO2-Freis. d. Stromerz. absolut (berechnet) (194 Mt) (203 Mt) (274 Mt)) (288 Mt)<br />
CO2-Freis. d. Stromerz. bezogen auf Szen. A =1,04xA =1,41xA =1,48xA<br />
CO2-Freis. d. Stromerz. bezogen auf "heute -35% -32% -8% -4%<br />
Reduktion der D > B > C > A Steigerung Bedarf el. Energie gegenüber 2004 Um 1- 4 Prozent Um 0,5 – 1 Prozent Um 1- 3 Prozent keine nennenswerte<br />
2<br />
CO2-Emissionen Experte 8<br />
(Unter Zugrundlegung d. Strommenge v. 2004)<br />
Änderung<br />
(luK)<br />
Bedarf an elektrischer Energie in Deutschland<br />
durch vermehrten Einsatz v. Mess- und Regeltechnik<br />
(Betrachtung d. Betriebs) wg.<br />
virtuellen Kraftwerken,<br />
dezentraler Energiewandlung, Gebäudeautomation,<br />
Energieeffizienzdienstleistungen<br />
Reduktion der A>B=C>D Wesentlichen Einfluss auf CO2-Emissionen hat<br />
3<br />
CO2-Emissionen Experte 6<br />
der Energieverbrauch. Dezentrale Anlagen zur<br />
Wasseraufbereitung (Grauwasser, Regenwasser)<br />
und technischen Abwasserreinigung haben<br />
(Wasser)<br />
einen höheren Energieverbrauch als eine<br />
zentrale Wasserversorgung. (Einsparungen bei<br />
den zentralen Systemen sind berücksichtigt)<br />
Strommehrverbrauch inf. Regenwassernutzung 187 GWh/a 94 GWh/a 94 GWh/a 125 GWh/a<br />
Strommehrverbrauch inf. Grauwassernutzung 580 GWh/a 193 GWh/a 193 GWh/a 483 GWh/a<br />
Wärmerückgewinnung kann den Energiemehrverbrauch<br />
teilweise kompensieren: -812 GWh/a -204 GWh/a -204 GWh/a -204 GWh/a<br />
Rückgang oder Anstieg des Energieverbrauchs<br />
durch dezentrale Abwassertechnik, Regen- u.<br />
Grauwassernutzung insgesamt -45 GWh/a +83 GWh/a +83 GWh/a +404 GWh/a<br />
Anmerk. von MUT: Für Bereich Wasser<br />
signifikant (A>B=C>D), insgesamt unbedeutend<br />
(
"Absolut gesehen<br />
sind Unterschiede<br />
unbedeutend"<br />
Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szenarien Urteils-<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D sicherheit<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Reduktion der insg. gering Methan wird vorwiegend in Landwirtschaft,<br />
2<br />
Kohlebergbau, bei Erdgasverteilung und in<br />
Methan-<br />
für Strom/Gas:<br />
Abfallwirtschaft (Deponien) freigesetzt. Verstärkte<br />
Nutzung von Gruben-, Klär- und Depo-<br />
Emissionen D>C>A>B<br />
(Strom/Gas) Experte 1<br />
niegas führt zur Reduktion.<br />
Betrachtet werden aber nur energiebedingte<br />
Emissionen inkl. Steinkohlenbergbau und<br />
Gasverteilung<br />
Gasanteil an Stromerzeugung steigt (-) steigt (-) steigt gering (0) steigt gering (0)<br />
Nutzung der heimischen Kohle keine (+) keine (+) keine (+) keine (+)<br />
Gas- und Stromverbrauch gehen zurück (+) konstant (0) steigen mäßig (-) konstant (0)<br />
Wirtschaftswachstum 2% 1,5% (+) 2% 1% (+)<br />
Nutzung von Klär-, Deponie- und Biogas verstärkt (+) verstärkt (+) verstärkt (+) weniger<br />
Bei Bergbau kein Unterschied. Unterschiede<br />
zwischen den jeweiligen Szenarien sind daher<br />
auf verstärkte Nutzung von Gruben- und Klärgas<br />
oder die absolute Höhe der Gasverbräuche<br />
zurückzuführen. Absolut gesehen sind<br />
Unterschiede unbedeutend da andere<br />
Hauptemittenten (Landwirtschaft > 60%)<br />
A = B = C = D<br />
Experte 2<br />
Aus den Szenarienbeschreibungen ergeben<br />
sich keine eindeutigen Hinweise. Emissionen<br />
etwa wie heute etwa wie heute etwa wie heute etwa wie heute 4<br />
hängen vor allem von Leckagen ab, nicht von<br />
siehe hierzu Aus-<br />
Fördervolumen. Viel Biogas + viel Hausansage<br />
Experte 1:<br />
schlüsse + viel Biomasse-Verrottung = hohe<br />
Methanemissionen. Entscheidend ist Wille zur<br />
Reduktion der Methanemissionen. In den<br />
Szenarienbeschreibungen aber nicht erkennbar.<br />
Nach Szenario-Kurzdarstellung, Zeile 3<br />
müsste jedoch A besser B besser C besser D<br />
sein.<br />
keine Aussage Wegen widersprechender Tendenzen und Freisetzung aus Freisetzung aus<br />
Experte 3<br />
extremer Unsicherheit: Keine Aussage möglich Gasproduktion Gasproduktion<br />
höher, aus Abfällen höher, aus Abfällen<br />
und Tierhaltung<br />
geringer<br />
und Tierhaltung<br />
geringer<br />
Reduktion der D > C > B > A Hauptquellen sind anaerobe Faulgruben. Eine A, B: 3<br />
Methan- Experte 6 Gasnutzung findet i.d.R. nicht statt, da auf<br />
Emissionen<br />
(Wasser)<br />
Hausbasis mit üblicher Technik nicht wirtschaftlich.<br />
Jede Ausweitung der dezentralen anaeroben<br />
Vorbehandlung ist schlechter (6,6 kg<br />
CH4/Einw a) im Verhältnis zur zentralen<br />
Technik. Emission aus Kläranlagen ist im<br />
Verhältnis zu anderen Quellen gering.<br />
Methan aus Kleinkläranlagen ++ +++<br />
C, D: 5<br />
245 A.3.1 Umweltschutz
246 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szenarien Urteils-<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D sicherheit<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Reduktion der A = B = C = D Hauptverursacher sind industr. Prod. und 1<br />
N 20-Emissionen Experte 1 Landwirtschaft.<br />
N20 aus Kläranl. ist unbedeutend.<br />
aus Kläranlagen<br />
A = B = C = D Vermutlich technisch lösbar, unabhängig von etwa wie heute etwa wie heute etwa wie heute etwa wie heute 3<br />
Experte 2<br />
Anlagenstruktur (zentral/dezentral). Nach<br />
Szenario-Kurzdarstellung (Zeile 3) müsste A<br />
besser B besser C besser D sein, allerdings<br />
finden sich in den Szenarienbeschreibungen<br />
m.E. keine eindeutigen Hinweise auf die<br />
Umsetzung.<br />
keine Aussage keine Aussage<br />
Experte 3<br />
A = B = C = D<br />
Experte 6<br />
Emissionen sind sehr gering und hängen nicht<br />
von der Technik ab<br />
4<br />
Vermeidung von D > C > B > A Zersiedelung incl. Verkehrswege, Windkraftanl. 3<br />
Eingriffen in das Experte 2<br />
Landschaftsbild<br />
Schaffung und<br />
Erhaltung von<br />
Erholungsgebieten<br />
Eingriffe in das Landschaftsbild im Wesentlichen<br />
durch Zersiedelung. Ob stärkere Nutzung<br />
reg. Energie od. dezentr. Erzeug. wesentlich zu<br />
Beeinflussung d. Landschaftsbilds beiträgt, ist<br />
aus Sz. nicht ableitbar<br />
Eingriffsintensität hoch moderat gering Vermeid. v. Eingr.<br />
D > C > B > A Übertragungsnetze weniger konst. konst. konst. 3<br />
Experte 3 Inlandwindanlagen mehr konst. konst. konst.<br />
Offshorewindanlagen viel mehr viel mehr wenige Ausbau<br />
B > D > C = A Zersiedelung und Bauen sehr schlecht schlecht schlecht etwas schlecht 4<br />
Experte 4<br />
Kraftwerkspark (gleich wg. gegenlf. Effekte) gleich schlecht gleich schlecht gleich schlecht gleich schlecht<br />
Telekomm: kein Ausbau gleich gleich gleich gleich<br />
Rohstoffgewinnung etwas schlecht (etwas) schlecht erh.-sehr schlecht sehr schlecht<br />
Biomassegewinnung etwas gut etwas gut neutral neutral<br />
Gesamtbewertung schlecht etwas schlecht schlecht etw. schl. - schl.<br />
keine Aussage Hinweise sind nicht in den Szenariobeschreibungen<br />
3<br />
Experte 2<br />
enthalten<br />
revidiert zu:<br />
revidiert zu Hinweise sind nicht in den Szenariobeschreibungen<br />
enthalten, die erkennen<br />
A = B = C = D<br />
lassen, dass Unterschiede existieren<br />
B>A=C=D Siedlungsstruktur B>A B=C C C > A Zersiedelung und Bauen sehr schlecht schlecht schlecht etwas schlecht 4<br />
Experte 4<br />
Kraftwerkspark (gleich wg. gegenlf. Effekte) gleich schlecht gleich schlecht gleich schlecht gleich schlecht<br />
Telekomm: kein Ausbau gleich gleich gleich gleich<br />
Rohstoffgewinnung etwas schlecht (etwas) schlecht erh.-sehr schlecht sehr schlecht<br />
Gesamtbewertung erheblich schlecht schlecht schl. - erh. schl. schlecht
Ziele<br />
Erhalt von<br />
Trinkwasserreservoiren<br />
Vergleich<br />
Szenarien<br />
keine Aussage<br />
Experte 2<br />
revidiert zu<br />
A = B = C = D<br />
A>D>B>C<br />
Experte 3<br />
A»B = D > C<br />
Experte 4<br />
A>B>C=D<br />
Experte 6<br />
A»B > C > D<br />
Experte 7<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D<br />
Hinweise sind nicht in den Szenariobeschreibungen<br />
enthalten<br />
revidie r zu<br />
Hinweise : sind nicht in den Szenariobeschreibungen<br />
enthalten, die erkennen<br />
lassen, dass Unterschiede existieren<br />
Wasserverbrauch Rückgang >5% bleibt gleich steigt leicht bleibt gleich oder<br />
sinkt leicht<br />
Wasserverbrauch<br />
zentrale / dezentrale Wassergewinn.flächen<br />
Braunkohleabbau<br />
Gesamtbewertung<br />
Grauwasser- u. Regenwassernutzung<br />
Wasserschutzzonen<br />
Gewässerschutz<br />
Gesamtbewertung<br />
Erhalt d. Trinkwasser-Schutzgebiete<br />
(Prozentwerte: Änderungen gegenüber heute)<br />
gut<br />
gut<br />
etwas schlecht<br />
gut<br />
++<br />
+<br />
++<br />
+++++<br />
0% (0...-15%)<br />
Keine oder nur<br />
geringe Abnahme<br />
neutral<br />
schlecht<br />
etwas schlecht<br />
neutr. - etw. schl.<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+++<br />
-5% (-5%...-10%)<br />
Weniger<br />
schlecht<br />
schlecht<br />
sehr schlecht<br />
schl. - sehr schl.<br />
-10% (-5%...-20%)<br />
Weniger<br />
gut<br />
schlecht<br />
sehr schlecht<br />
neutr.- etw. schl.<br />
-15% ( 5%...-20%)<br />
Weniger<br />
Urteilssicherheit<br />
3<br />
3<br />
3<br />
2<br />
3<br />
247 A.3.1 Umweltschutz
248 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szenarien Urteils-<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D sicherheit<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Vermeidung von A = B > C = D klassische Luftschadstoffe (z.B. S02) und<br />
3<br />
Schadstoff- Experte 2<br />
nukleare Abluft<br />
Emissionen aus Kernenergie und Kohle, jedoch geringer Anteil von geringer Anteil von höher Anteil von höher Anteil von<br />
einträgen in begrenzt durch Filter und Vorschriften Kernenergie und Kernenergie und Kernenergie und Kernenergie und<br />
Wasserquellen Weitere Emiss. aus Industrie und Verkehr Kohle Kohle Kohle Kohle<br />
A>B>C=D Nitratgrenzwert 50 mg/I gleich gleich gleich gleich 1<br />
Experte 3<br />
Bewusstsein f Gesundheit sehr hoch hoch gering Nebensache<br />
D > C = B > A Kohleabbau, -halden, -KW: Schwermet., PAK etwas schlecht etwas schlecht schlecht schlecht 3<br />
Experte 4<br />
Ackerbau für Biomasse: Nitrat, Phosphat etwas schlecht etwas schlecht neutral neutral<br />
Zersiedelung erheblich schlecht schlecht schlecht etwas schlecht<br />
Gesamtbewertung schlecht etw. schl. - schl. etw. schl. - schl. etwas schlecht<br />
A>B>C>D Annahme: Bis 2025 erfüllen alle dezentralen 4<br />
Experte 6<br />
Abwasser-Reinigungsanlagen den Stand der<br />
Technik, d.h. etwa gleiche Reinigungsleistung<br />
wie zentrale.<br />
Staatlicher Umweltschutz wäre positiv, führt zur<br />
Abwertung von C und D.<br />
Dezentrale Versickerung u. Reduktion von<br />
Kanallängen reduziert Gewässerbelastung<br />
(aber erhöht Bodenbelastung).<br />
Urinabtrenn. verringert Gewässerbelast. (Sz.A)<br />
Abläufe von Kläranlagen ++<br />
Misch- u. Regenwasser aus urbanen Gebieten +++ ++<br />
Abwasser aus undichten Kanälen ++ +<br />
Gesamtbewertung +++++ +++ ++<br />
Regen- und Mischwasser<br />
eher positiv,<br />
Kläranlagen eher<br />
negativ<br />
Mischwasser führt<br />
hier zur Abwertung<br />
B = C > D > A<br />
Experte 7<br />
Emission von (Schwer-)Metallen in Gewässer<br />
(Cd, Katalysatormetalle, Metall-Organyl-Verbindungen);<br />
diffuse Quellen wie Verkehr, private<br />
Haushalte einschl. Schlammnutzung in der<br />
Landwirtschaft<br />
keine Fortschritte,<br />
regional auch Verschlecht.<br />
mögl.<br />
gut gut mittel 4<br />
A = B > C = D Nitratfrachten in oberirdischen Gewässern: An- 40% (30%...50%) 40% (30%...50%) 25% (20%...30%) 25% (20%...30%) 4<br />
Experte 7 teil der Messstellen in einem definierten Gebiet nach DUX2 nach DUX nach DUX nach DUX<br />
oberirdischer Gewässer, bei denen d. Gesamtstickstoff<br />
Ziele<br />
Vermeidung von<br />
Bodenbelastungen<br />
durch Unfälle<br />
in EVUs<br />
Deponieraum für<br />
radioaktive und<br />
toxische Abfälle<br />
Vergleich<br />
Szenarien<br />
A = B»C = D<br />
Experte 2<br />
A = B»D > C<br />
Experte 3<br />
A = B»C = D<br />
Experte 4<br />
A = B > C = D<br />
Experte 2<br />
A = B»D > C<br />
Experte 3<br />
A = B»C = D<br />
Experte 4<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D<br />
radioaktive Stoffe<br />
Betrieb und Abriss von KKW nur Abriss nur Abriss Betrieb und Abriss Betrieb und Abriss<br />
Urteilssicherheit<br />
Anteil Kernkraft und Stromverbrauchsentwicklung<br />
1<br />
hohe statistische Unsicherheit<br />
Anteil Kernenergie sehr gut sehr gut sehr schlecht sehr schlecht 3<br />
In allen Szenarien wird durch den Abriss der<br />
Kernkraftwerke Deponieraum für radioaktive<br />
Stoffe benötigt. Dieser Bedarf ist durch den<br />
Weiterbetrieb der bestehenden Kernkraftwerke<br />
in den Szenarien C und D nur leicht höher.<br />
Anteil Kernkraft und Stromverbrauchsentwicklung<br />
Weiterbetrieb KKW Weiterbetrieb KKW 3<br />
keine Kernkraft keine Kernkraft Kernkraft Kernkraft, aber geringerer<br />
Stromverbr<br />
Kernenergie-Endlager sehr gut sehr gut sehr schlecht sehr schlecht 2<br />
3<br />
3<br />
249 A.3.1 Umweltschutz
250 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Urteilssicherheit<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Vermeidung von A = B > C = D radioaktive Stoffe, klassische Luftschadstoffe höherer Anteil höherer Anteil 3<br />
langfristigen Experte 2 (z.B. S02), Bauabfälle von Häusern Kernenergie und Kernenergie und<br />
Kohle<br />
Kohle<br />
Schadstoffakkumulationen<br />
im<br />
A>B>C>D<br />
(negativ) Menge des Kohleeinsatzes (aus Sz.-B.: 24%) (aus Sz.-B.: 24%) (aus Sz.-B.: 52%) (aus Sz.-B.: 52%) 3<br />
Experte 3<br />
(pos.:) Gesundheitsbewusstsein: Bemühung<br />
Boden um Schadstoff-Reduzierung, z.B. SO2 sehr hoch hoch gering Nebensache<br />
(Strom/Gas) A = B > C = D Kohleabbau und -KW: Schwermet., PAK etwas schlecht etwas schlecht schlecht schlecht 3<br />
Experte 4<br />
Radioaktive Belastungen werden nicht als<br />
Schadstoffe gewertet.<br />
Anbau Biomasse: Nitrat, Phosphat, Pflanzenschutzm.,<br />
Schwermetalle, Tierarzneimittel neutr. - etw. schl. neutr. - etw. schl. neutral neutral<br />
Gesamtbewertung etwas schlecht etwas schlecht etw. schl. - schl. etw. schl. - schl.<br />
Vermeidung von C > A = B = D Umgang mit Klärschlamm + B: 3<br />
langfristigen Experte 6 Regenwasserversickerung + +<br />
A,C,D: 2<br />
Abwasser aus undichten Kanälen 0 0 0 0<br />
Schadstoffakku-<br />
Gesamtbewertung + + ++ +<br />
mulationen im<br />
Boden (Wasser)<br />
Vermeidung der<br />
Übernutzung<br />
landwirtschaftlicher<br />
Flächen<br />
A = B = C = D nicht in den Szenariobeschreibungen enthalten<br />
3<br />
Experte 2<br />
bzw. schlüssig aus diesen ableitbar. Möglicherweise<br />
könnte eine zu starke Nutzung von<br />
Biomasse für energetische Zwecke zu einer<br />
Übernutzung führen. Allerdings könnte man<br />
unterstellen, dass bei einer stärkeren Biomassenutzung<br />
auch auf deren Nachhaltigkeit<br />
geachtet wird<br />
A>B>C=D Nitratgrenzwert 50 mg/I gleich gleich gleich gleich 1<br />
Experte 3<br />
Bewusstsein f Gesundheit sehr hoch hoch gering Nebensache<br />
C = D > A = B Anbau Biomasse (aber nur geringer Einfluss) etwas schlecht etwas schlecht neutral neutral 3<br />
Experte 4
Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szenarien Urteils-<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D sicherheit<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Schutz der Flora A = B = C = D nicht in den Szenariobeschreibungen enthalten<br />
3<br />
Experte 2<br />
bzw. schlüssig aus diesen ableitbar<br />
A>B>C=D Umwelt und Gesundheitsbewusstsein sehr hoch hoch gering Nebensache 1<br />
Experte 3<br />
revidiert zu<br />
B=D=C>A<br />
B = D = C > A Siedlungsentwicklung und zugeh. Infrastruktur sehr schlecht schlecht schlecht etwas schlecht 4<br />
Experte 4<br />
(hoher Einfluss)<br />
Tagebaue und Renaturierung (geringer Einfl.) etwas schlecht etwas schl. bis schl. erh. schl.-sehr schl. sehr schlecht<br />
Nutzung von Biomasse (geringer Einfl.) schlecht schlecht etwas schlecht etwas schlecht<br />
Schutz der Fauna A = B = C = D<br />
Gesamtbewertung erheblich schlecht schlecht schlecht schlecht<br />
nicht in den Szenariobeschreibungen enthalten<br />
3<br />
Experte 2<br />
bzw. schlüssig aus diesen ableitbar<br />
A>B>C=D Umwelt und Gesundheitsbewusstsein sehr hoch hoch gering Nebensache 1<br />
Experte 3<br />
revidiert zu<br />
D>C=B>A<br />
D > C = B > A Siedlungsentwicklung und zugeh. Infrastruktur sehr schlecht schlecht schlecht etwas schlecht 3<br />
Experte 4<br />
(hoher Einfluss)<br />
Windenergie (geringer Einfl.) erhebt. schlecht erhebt. schlecht etwas schlecht etwas schlecht<br />
Tagebaue und Renaturierung (geringer Einfl.) etwas schlecht etwas schl. bis schl. erh. schl.-sehr schl. sehr schlecht<br />
Nutzung von Biomasse (geringer Einfl.) schlecht schlecht etwas schlecht etwas schlecht<br />
Schutz von Habitaten<br />
A = B = C = D<br />
Gesamtbewertung erheblich schlecht schlecht schlecht etw. schl. - schl.<br />
nicht in den Szenariobeschreibungen enthalten<br />
3<br />
Experte 2<br />
bzw. schlüssig aus diesen ableitbar<br />
A>B>C=D Umwelt und Gesundheitsbewusstsein sehr hoch hoch gering Nebensache 1<br />
Experte 3<br />
revidiert zu<br />
D>C=B>A<br />
D > C = B > A Siedlungsentwicklung und zugeh. Infrastruktur sehr schlecht schlecht schlecht etwas schlecht 3<br />
Experte 4<br />
(hoher Einfluss)<br />
Windenergie (geringer Einfl.) erhebt. schlecht erhebt. schlecht etwas schlecht etwas schlecht<br />
Tagebaue und Renaturierung (geringer Einfl.) etwas schlecht etwas schl. bis schl. erh. schl.-sehr schl. sehr schlecht<br />
Nutzung von Biomasse (geringer Einfl.) schlecht schlecht etwas schlecht etwas schlecht<br />
Gesamtbewertung erheblich schlecht schlecht schlecht etw. schl. - schl.<br />
251 A.3.1 Umweltschutz
252 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szenarien Urteils-<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D sicherheit<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Schonung von D > C > B > A Baustoffe, Eisen,Stahl 3<br />
Materialien Experte 1 Mit der Größe der Anlage sinkt bezogen auf die<br />
(S /Gas Leistung der spezifische Materialbedarf. Gaskraftwerke<br />
haben einen deutlich niedrigeren<br />
Materialbedarf als alle anderen konventionellen<br />
Kraftwerkstypen. Wirtschaftswachstum bedeutet<br />
auch Mehrverbrauch an Materialien.<br />
Anteil Kohle gering (+) gering (+) hoch (–) hoch (–)<br />
Anteil Gas steigt (+) steigt (+) steigt gering (–) steigt gering (–)<br />
Anteil erneuerbare Energien (EE) steigt (–) steigt (–) 10% (–) 10% (–)<br />
Gas- und Stromverbrauch sinkt (+) bleibt steigt mäßig (–) bleibt<br />
Anteil kleine und mittlere KW 50% d. Ers. (–) 30% d. Ers. (–) 30% d. Ers. (–) 30% d. Ers. (=)<br />
Anteil dezentraler Techn. 22,5% (–) 14% (–) 8,5% (–) 7% (=)<br />
Siedlungsstruktur aufs Land (–) Stadtrand (=) Stadtrand (=) Konzentration (+)<br />
Wirtschaftswachstum 2%<br />
Wg. Rückg. Stromverbr.<br />
u. höh. Anteil<br />
1,5%<br />
Wg. Rückg. Stromverbr.<br />
u. höh. Anteil<br />
2%<br />
f. Stromerz. nur<br />
leicht geringerer<br />
1%<br />
f. Stromerz. nur<br />
leicht geringerer<br />
Gaskraftw. sinkt Gaskraftw. sinkt Materialv. als heute Materialv. als heute<br />
Schonung von<br />
Materialien (Wasser)<br />
D > C > B > A<br />
Experte 2<br />
keine Aussage<br />
Experte 3<br />
A > B > C = D<br />
Experte 6<br />
Baustoffe (Beton), Stahl, Kupfer<br />
Weiternutzung bestehender Anlagen (auch<br />
Kernkraftwerke) schont Materialressourcen.<br />
Große, fossil befeuerte Anlagen haben pro<br />
erzeugter Strommenge kleineren bis viel<br />
kleineren Materialbedarf als dezentrale bzw.<br />
regenerative Energie umw. Anlagen. Metalle<br />
sind gut zu recyceln, da sie in großen Mengen<br />
konzentriert und sortenrein anfallen.<br />
Einfamilienhäuser haben vergl. mit Mehrfamilienhäusern<br />
deutlich größeren Materialbedarf.<br />
bei ern. En. und dezentralen Strukturen höherer<br />
Materialverbrauch; gegenläufig: Materialverbrauch<br />
durch Konsumgüter<br />
keine valide Aussage möglich<br />
(Zentrale und) dezentrale Wasser- und Abwasseranlagen<br />
haben in etwa gleichen Materialverbrauch.<br />
Zentral steckt Material im Netz, dezentral<br />
ist Materialeinsatz vor Ort.<br />
Urinseparation hat höheren Materialverbrauch,<br />
kommt aber nur wenig zur Anwendung<br />
Materialv. gegenüb.<br />
heute, gebremst d.<br />
Trend zu kleineren<br />
Einheiten. Wg.<br />
Materialv. gegenüb.<br />
heute, gebremst d.<br />
Trend zu kleineren<br />
Einheiten. Wg.<br />
Wanderung aufs Wanderung z.<br />
Land deutl. erh. Bedarf<br />
an Baumateri-<br />
erh. Bedarf<br />
Stadtrand leicht<br />
al. Zusätzl. Bedarf<br />
d. Wirtsch.wachst.<br />
dezentrale (–)<br />
regenerative (–)<br />
kleine (–)<br />
Wg. Wanderung z.<br />
Stadtrand leicht<br />
erh. Bedarf<br />
Wg. Konzentr. in<br />
Ballungsräumen<br />
relativ unveränderter<br />
Bedarf<br />
Weiternutzung<br />
bestehender<br />
Anlagen (+)<br />
4<br />
A, B: 3<br />
C, D: 4
Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szenarien Urteils-<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D sicherheit<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Schonung von D > C > B > A Flächenverbrauch wegen der hohen Leistungsdichte<br />
4<br />
bei konventionellen Anlagen sehr viel<br />
Flächen<br />
Experte 1<br />
geringer als bei dezentralen. Wind und PV<br />
benötigen mehr Fläche als fossile KW. Hoher<br />
Braunkohleanteil an Stromerzeugung bedeutet<br />
hohe Flächeninanspruchnahme. Bau von Infrastrukturen<br />
(z.B. Fernwärmeversorgung) führt zu<br />
höherem Flächenbedarf. Siedlungsstrukturen<br />
im ländlichen Bereich nehmen größere Flächen<br />
in Anspruch. Höheres Wirtschaftswachstum<br />
führt zu höheren Einkommen und ermöglicht<br />
den Kauf größere Grundstücke<br />
Kraftwerksbau, insb. erneuerbare (EE) EE 30% (–) EE steigt (–) EE 10% (+) EE 10% (+)<br />
Braunkohletagebaue 10% (+) 8% (+) 22% (–) 30% (–)<br />
Gas- und Stromverbrauch sinkt (+) bleibt (=) steigt mäßig (–) bleibt (=)<br />
Siedlungsstruktur aufs Land (–) Stadtrand (=) Stadtrand (=) Konzentration (+)<br />
f. Stromerz. rel.<br />
hoher Flächenverbrauch,<br />
d. Wanderung<br />
aufs Land<br />
zusätzlich hoher<br />
Bedarf, in Summe<br />
erheblich mehr als<br />
heute<br />
f. Stromerz. hoher<br />
Flächenverbrauch,<br />
d. Wand. z. Stadtrand<br />
leicht höher, in<br />
Summe geringfügig<br />
höher als heute<br />
f. Stromerz. nur<br />
leicht verändert, d.<br />
Wand. z. Stadtrand<br />
leicht höher, in<br />
Summe leicht<br />
höher als heute<br />
f. Stromerz. nur<br />
leicht verändert, d.<br />
Konz. in Ballungsr.<br />
rel. unverändert, in<br />
Summe konst.<br />
D > C = B > A Siedlungsfläche, Fläche f. Windkraftanlagen 4<br />
Experte 2<br />
Zersiedelung der Landschaft im Zusammenh.<br />
m. d. Wanderungsbewegungen u. d. Präferenzen<br />
für Siedlungs- bzw. Gebäudestruktur und<br />
revidiert zu<br />
D > C > B > A den damit verbund. Verkehrswegen. Ob stärkere<br />
Nutzung regenerativer Energien oder dezentraler<br />
Erzeugung wesentlich zu Ausweitung der<br />
Flächennutzung beiträgt, ist nicht ableitbar<br />
keine Aussage am ehesten Analogieschluss über 0<br />
Experte 3<br />
Umwelt und Gesundheitsbewusstsein sehr hoch hoch gering Nebensache<br />
revidiert zu<br />
(A>B>C=D)<br />
B=D>C>A<br />
B = D > C > A Zersiedelung und Bauen (hoher Einfluss) sehr schlecht schlecht schlecht etwas schlecht 3<br />
Experte 4 Tagebaue und Renaturierung (geringer Einfl.) etwas schlecht etwas schl. bis schl. erh. schl.-sehr schl. sehr schlecht<br />
Gesamtbewertung erheblich schlecht schlecht schl. - erh. schl. schlecht<br />
253 A.3.1 Umweltschutz
254 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szenarien Urteils-<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D sicherheit<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Schonung von B > A»D > C Rohstoffbedarf der Kraftwerke hängt vorwiegend<br />
4<br />
von Wirkungsgraden und Strommix ab.<br />
Rohstoffen Experte 1<br />
Hoher Anteil an REG führt zu niedrigem Rohstoffbedarf.<br />
Rohstoffbedarf sinkt mit geringerem<br />
(Brennstoffe)<br />
(Strom/Gas)<br />
Wirtschaftswachstum. Wanderungsbewegung<br />
aufs Land führen zu mehr Verkehr und zu<br />
höherem Rohstoffverbrauch<br />
Anteil Kohle gering gering hoch (–) hoch (–)<br />
Anteil EE steigt (+) steigt (+) 10% (–) 10% (–)<br />
Anteil Gas steigt (+) steigt (+) steigt gering (–) steigt gering (–)<br />
Gas- und Stromverbrauch sinkt (+) (') steigt mäßig (–) (=)<br />
Siedlungsstruktur aufs Land (–) Stadtrand (=) Stadtrand (=) Konzentration (+)<br />
Trotz rel. hoh. Wirtsch.wachst. Rohstoffbedarf<br />
aufgrund verstärkt. Einsatz erneuerb. Energien<br />
in Sz. A am niedrigsten, in C und D höher. Wg.<br />
hohen Wirtsch.wachst. C schlechter als D.<br />
(Hinweis: Bereich Mobilität ist in Szenarienbeschreib.<br />
ausgeklammert. Würde er berücksichtigt,<br />
fiele Rohstoffbedarf für Szenarien mit<br />
ländlichen Siedl.strukt. höher aus. Gleiches gilt<br />
f. Zusammenh. v. Wirtsch.wachst. u. Mobilität.)<br />
MUT: B>A ist nur verständlich wenn Siedlungsstruktur<br />
berücksichtigt wurde<br />
A> B»C = D A und B mit höherem Anteil regenerativer 5<br />
Experte 2<br />
Energieträger sowie höheren Effizienz haben<br />
deutlichen Vorteil bezgl. Ressourcenschonung<br />
von Kohle, Gas, Uran gegenüber C und D. Es<br />
stellt sich jedoch die Frage, ob Kohle, Gas u.<br />
Uran gleich zu bewerten sind.<br />
A>B>C>D Verbrauch nichtregenerativer Energieträger Kohleverbrauch Verbrauch geringer<br />
Verbr. wie C, aber 3<br />
Experte 3<br />
noch geringer als in als in C, D<br />
Reserve an Braunkohle<br />
geringer als<br />
B<br />
Steinkohle<br />
Schonung von<br />
Rohstoffen<br />
(Brennstoffe)<br />
(Wasser)<br />
keine Aussage<br />
Experte 7<br />
Wärmerückgewinnung aus Brauchwasser wird<br />
bei dezentralen Anlagen nur bei Wässern zur<br />
Anwendung gelangen, die ohne Fäkalien und<br />
möglichst fettfrei sind. Aufgrund der schwierigen<br />
Handhabung mit häufiger Spülung oder<br />
Reinigung der Systeme wird deren Einführung<br />
nur vereinzelt und zwar nur in Szenario A aufgrund<br />
der hohen Aufgeschlossenheit der Bevölkerung<br />
für umweltbezogene Innovationen gesehen.<br />
Andere Wege zur Warmwasserherstellung,<br />
wie Solarthermie werden als wesentlich<br />
kostengünstiger und einfacher in der Handhabung<br />
bezeichnet.
Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szenarien Urteils-<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D sicherheit<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Schonung von A = B = C = D Veränderungen im Bereich 'Wald" vernachlässigbar<br />
4<br />
(schon alleine aufgrund bestehender<br />
Wald<br />
Experte 1<br />
Gesetze)<br />
A = B = C = D nicht in den Szenariobeschreibungen enthalten<br />
3<br />
Experte 2<br />
bzw. schlüssig aus diesen ableitbar<br />
keine Aussage<br />
Experte 3<br />
keine valide Angabe möglich mit den gegebenen<br />
Daten<br />
B = D > C > A Zersiedelung und Bauen (hoher Einfluss) sehr schlecht schlecht schlecht etwas schlecht 3<br />
Experte 4<br />
Tagebaue und Renaturierung (geringer Einfl.) etwas schlecht etwas schl. bis schl. erh. schl.-sehr schl. sehr schlecht<br />
Gesamtbewertung erheblich schlecht schlecht schl. - erh. schl. schlecht<br />
255 A.3.1 Umweltschutz
256 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szenarien Urteils-<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D sicherheit<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Schonung von A > B»C > D Anteil von Kohle gering gering (+) hoch (–) hoch (–) 4<br />
Wasser Experte 1<br />
Anteil von Gas steigt steigt (+) steigt gering (–) steigt gering (–)<br />
Anteil EE steigt steigt (+) 10% (–) 10% (–)<br />
Wasserverbrauch sinken (+)<br />
konst<br />
sinkt leicht (+) sinkt leicht (+)<br />
Anteil dezentraler Technologien hoch (+)<br />
14%<br />
Grundsätzlich ist Wasserverbrauch durch<br />
Einsatz erneuerbarer Energien und Einsatz von<br />
KWK deutlich niedriger als bei konventionellen<br />
Anlagen. Daher sind A und B deutlich positiver<br />
als C und D. Wasserverbrauch sinkt insgesamt<br />
in A, bleibt annähernd konstant in B, daher A<br />
besser als B<br />
A = B = C = D Aufgrund der unterschiedlich zu gewichtenden 4<br />
Experte 2<br />
Auswirkung der unterschiedlichen Nutzungen<br />
des Wassers und teilweise gegenläufiger Einflüsse<br />
erscheint mir eine zusammenfassende<br />
Bewertung nicht möglich<br />
A>D>B>C<br />
primär Wasserverbrauch Rückgang >5% bleibt gleich steigt leicht bleibt gleich oder<br />
3<br />
Experte 3<br />
sinkt leicht<br />
A>B=C=D Vermeidung der Übernutzung Keine Übernutzung Keine Übernutzung Keine Übernutzung Keine Übernutzung<br />
Experte 7<br />
Die weitere Ausdehnung der Nutzung von de- bei Ausdehnung bei Ausdehnung bei Ausdehnung bei Ausdehnung<br />
zentralen Regenwassernutzungsanlagen, ins- der dezentralen der dezentralen der dezentralen der dezentralen<br />
besondere im ländlichen Raum, aufgrund von Regenwasserbe- Regenwasserbe- Regenwasserbe- Regenwasserbegeringeren<br />
Kosten im Vergleich zu zentralen wirtschaftung und wirtschaftung und wirtschaftung und wirtschaftung und<br />
Systemen ermöglicht eine Versickerung und weiterer GW- weiterer GW- weiterer GW- weiterer GWdamit<br />
eine weitere Grundwasseranreicherung. Anreicherung Anreicherung Anreicherung Anreicherung 3<br />
Daher wird Szen. A mit dem größten Anteil<br />
dezentraler Regenwassernutzungsanlagen und<br />
dem höchsten Anteil ländlicher Bevölkerung als<br />
vorteilhafter in Bezug auf die Grundwasserneubildung<br />
angesehen als die Szen. B, C und D.<br />
A>B=C>D<br />
Experte 7<br />
Wasserverluste d. Leckagen und Rohrbrüche 5% (3%...15%) 8% (3%...15%) 8% (3%...15%) 10% (3%...15%) 3
A.3.2 Gesundheitsschutz<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D<br />
Berechnung der Experte 9 Emissionen: gegenüber Sz. C u. D insgesamt starke Emissionen etwa so hoch wie heute<br />
- Szenarien enthalten nur den Einfluss des Verringerung von NO2, S02, CO und (2002)<br />
Immissionen als<br />
Energieträgermixes, die Emissionsminderung PM10. Weniger starke Verringerung von<br />
Ausgangsbasis<br />
im Verkehrssektor (durch techn. Verbess.) ist Ozon<br />
für die Einschätzung<br />
nicht zu betrachten.<br />
der Gesund-<br />
- Anteile der Energieversorgung an den Emis-<br />
sionen ist je nach Schadstoff unterschiedlich.<br />
heitseffekte<br />
- Bezüglich Emissionen sind Sz. A und B als<br />
gleich zu betrachten, ebenso C und D.<br />
- daher werden für A und B die Emissionen des<br />
Jahres 2010 und für C und D die Emissionen<br />
d.J. 2002 aus EMEP (2004) 3 herangezogen.<br />
Experte 9<br />
Immissionen:<br />
wurden aus den o.g. Emissionen mit dem wahrscheinlichster Wert (Bereich): wahrscheinlichster Wert (Bereich):<br />
EURAD-Modell berechnet. Dies ergibt:<br />
max. Tagesmittelwerte v. SO2 80 (40...100) pg / m 3 150 (80...200) pg / m 3 3<br />
max. Tagesmittelwerte v. Staub (PM10) 80 (35...125) pg / m3 (heute 100pg/m 3) 120 (50...150) pg / m 3 (heute 100pg/m 3) 2<br />
Jahresmittelwerte von Staub (PM10) 20 (12...25) pg / m3 (heute 25pg/m 3 ) 25 (15...35) pg / m 3 (heute 25pg/nl 4<br />
maximale 8 h-Werte von Ozon 130 (80...150) pg / m 3 (heute 150pg/m 3) 150 (100...180) pg / m 3 (heute 150pg/m 3 ) 3<br />
Schutz vor Luft- B > A»C > D Gesamtbewertung für Mortalität, Morbidität und Rückgang der Atemfunktionsbeeinträchti- kein Rückgang der Atemfunktionsbeein- 3<br />
schadstoffen Experte 10 Beeinträchtigungen gungen durch Rauchgase wg. Umstieg trächtigungen durch Rauchgase wg.<br />
auf erneuerbare Ene gien + KWK hohem Kohleverfeuerungsanteil<br />
etwas schlechter<br />
etwas schlechter<br />
wg. höherem<br />
wg. höherem<br />
Braunkohleanteil<br />
Braunkohleanteil<br />
Urteilssicherheit<br />
3 EMEP (2004): Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air pollutants in Europe http://www.emep.int/REVIEW/2004/Nat_tot_emis1-6.html<br />
257 A.3.2 Gesundheitsschutz
258 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Schutz vor Mortalität<br />
durch Luftimmissionen<br />
Vergleich<br />
Szenarien<br />
Experte 10<br />
aus den angegebenen<br />
Zahlenwerten<br />
Gesichtspunkte<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Mortalität<br />
Die Zahl der Akut-Todesfälle durch mehrtägige<br />
Spitzenkonzentrationen von SO2 und Staub<br />
wurde aus den Konzentrationen über lineare<br />
Extrapolation einer für hohe Dosen ermittelten<br />
A B<br />
Szenarien<br />
C D<br />
Urteilssicherheit<br />
folgt<br />
A=B>C=D Beziehung in den Niedrigdosisbereich berech- wahrscheinlichster Wert (Bereich): wahrscheinlichster Wert (Bereich):<br />
net: Todesf./Mill.E = 25,5 x S0 2[mg/m 3] x<br />
Staub[mg/m 3]. Dies ergibt: 0,16 (0,08 .. 0,20) Todesf. / Mill. Expon. 0,46 (0,24 .. 0,61) Todesf. / Mill. Expon. 3<br />
Die Abnahme der jährlichen Todesfälle durch<br />
eine verringerte Langzeitexposition mit Staub<br />
(Sz. A u. B) wurde über lineare Extrapolation<br />
mit einer aus aktuellen Studien ermittelten<br />
Beziehung berechnet:<br />
Todesf./Mill.E = 400 x (Staub [pg/m 3 ] / 10pg<br />
Staubitt:1'). Dies ergibt: -200 (-520 ... 0) Todesf. / Mill. Expon. 0 (-400 ... +400) Todesf. / Mill. Expon. 4<br />
Die Abnahme vorgezogener jährlicher Todesfälle<br />
(bei bereits geschwächten Personen)<br />
durch verringerte Spitzenkonzentrationen von<br />
Ozon (Sz. A u. B) wurde über lineare Extrapolation<br />
mit einer aus aktuellen Studien ermittelten<br />
Beziehung berechnet:<br />
Todesf./Mill.E = 80 x (Ozon [pg/m 3] / 10 pg<br />
Ozon/m ). Dies ergibt: -160 (-560 0) Todesf. / Mill. Expon. 0 (-400 +240) Todesf. / Mill. Expon. 3
Ziele<br />
Schutz vor Morbidität<br />
durch Luftimmissionen<br />
Vergleich<br />
Szenarien<br />
Experte 10<br />
aus den angegebenen<br />
Zahlenwerten<br />
folgt<br />
A=B>C=D<br />
Gesichtspunkte<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Morbidität<br />
Die Abnahme von Krankenhauseinweisungen<br />
(Herz-Kreislauf-Erkr.) d. verringerte mehrtägige<br />
Spitzenkonzentrationen von Staub (Sz. A u. B)<br />
wurde über lineare Extrapolation mit einer aus<br />
aktuellen Studien ermittelten Beziehung<br />
berechnet:<br />
Kr./Mill.E = 100 x (Staub [pg/m 3] / 10pg Staub /<br />
m 3). Dies ergibt:<br />
Szenarien<br />
A B C D<br />
wahrscheinlichster Wert (Bereich):<br />
-200 (-650 ...+250) Kr. / Mill. Expon.<br />
wahrscheinlichster Wert (Bereich):<br />
+200 (-500 ...+500) Kr. / Mill. Expon.<br />
Urteilssicherheit<br />
2...3<br />
Die Abnahme von Krankenhauseinweisungen<br />
(Atemwegserkr.) durch verringerte Spitzenkonzentrationen<br />
von Ozon über 3 oder mehr Tage<br />
wurde über lineare Extrapolation mit einer aus<br />
aktuellen Studien ermittelten Beziehung<br />
berechnet:<br />
Kr./Mill.E = 160 x (Ozon [pg/m1 / 10pg Ozon /<br />
m 3). Dies ergibt:<br />
-320 (-1120 ... 0) Kr. / Mill. Expon.<br />
0 (-800 ... +480) Kr. / Mill. Expon.<br />
3<br />
Schutz vor elektromagnetischen<br />
Feldern – luK<br />
hinsichtlich CO also<br />
A = B = C = D<br />
B = D 2 A = C<br />
Experte 10<br />
In Deutschland sind die anthropogenen Kohlenmonoxidemissionen<br />
rückläufig. Im Gegensatz<br />
zur Nachkriegszeit, wo es im Zusammenhang<br />
mit winterlichen Inversionswetterlagen bis in die<br />
späten achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts<br />
immer wieder zu Smogepisoden mit<br />
gesundheitlich bedenklichen CO-Anreicherungen<br />
in der Außenluft kam, werden unter heutigen<br />
Bedingungen gesundheitsschädliche CO-<br />
Konzentrationen praktisch nicht mehr erreicht.<br />
Keine nachgewiesenen Gesundheitseffekte,<br />
angesichts der wissenschaftlichen Unsicherheit<br />
ist es vernünftig, die Exposition so klein wie<br />
möglich zu halten, ohne dabei technische<br />
Entwicklungen zu blockieren.<br />
Schutz vor elektromagnetischen<br />
Feldern –<br />
Energietechnik<br />
A = B = C = D<br />
Experte 10<br />
Anteil Smart Building<br />
Exposition<br />
"es gibt begrenzte Beweise für eine krebserzeugende<br />
Wirkung niederfrequenter Magnetfelder<br />
in Bezug auf Leukämie bei Kindern" (IARC,<br />
2002)<br />
Die Exposition hängt jedoch nicht von den<br />
Unterschieden zwischen den Szenarien ab.<br />
höher<br />
kein Unterschied<br />
wenn leitungsgebundene<br />
Technik,<br />
potentiell höher<br />
wenn drahtlose<br />
Technik<br />
höher<br />
kein Unterschied<br />
wenn leitungsgebundene<br />
Technik,<br />
potentiell höher<br />
wenn drahtlose<br />
Technik<br />
259 A.3.2 Gesundheitsschutz
260 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szenarien Urteils-<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D sicherheit<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Schutz vor Beeinträchtigungen<br />
B = D » A = C<br />
bakterielle Belastungen weniger sicher sicher weniger sicher sicher 3<br />
Experte 7<br />
Sz. A. schlechtere Kontrolle bei dezentralen<br />
Anlagen<br />
d. Belast. des<br />
Sz. C: weniger Erneuerung und Pflege wegen<br />
Rohwassers/<br />
ungünstiger Finanzierungsbedingungen<br />
Trinkwassers<br />
Wegen der Trinkwasseraufbereitung und -kontrolle<br />
Experte 10<br />
gibt es keinen unmittelbaren Zusammen-<br />
hang zwischen Maßnahmen zur Verbesserung<br />
der Abwassersituation und potenziellen Gefahren<br />
für Roh- und Trinkwasser. Beim Regenwas-<br />
Gesamtbewertung<br />
unklar wegen gegenläufiger<br />
Einflüsse<br />
ser muss man eigentlich differenzieren zwischen<br />
den Risiken der Nutzung nicht hygienisierten<br />
Regenwassers im Haushalt (B=C>D>A): am schlechtesten am besten am besten mittel<br />
und dem Schutz vor Erkrankungsrisiken durch<br />
Einführung der Membrantechnik in die Regenund<br />
Grauwasseraufbereitung (A>D>B=C): am besten am schlechtesten am schlechtesten mittel<br />
letztere wirkt auch weiter über die höhere<br />
Wasserqualität in den Vorflutern und damit<br />
letztlich auch an den Flussbadestellen<br />
Schutz vor Morbidität<br />
A>D>B=C<br />
bakterielle/virale Belastungen<br />
4/3/3/3<br />
durch Belas- Experte 10<br />
Rückgang der Infektionen bei Badegästen an<br />
Badestellen durch dezentrale Abwassertung<br />
der Badegewässer<br />
behandlung (Membrantechnik) ja gering gering gering<br />
Schutz vor Morbi- A>B>D>C AKW Stillegung Stillegung<br />
dität durch radio-<br />
Experte 10<br />
Steinkohleeinsatz Reduktion um 57%<br />
zivilisatorisch bed. Krebsrisiko Rückgang
A.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Urteilssicherheit<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Räumliche Verfüg- A = B = C = D Netzdichte Hoch, keine Hoch, keine Hoch, keine Hoch, keine 5<br />
barkeit in Ballungsräumen<br />
den Ballungsräumen zur Verfügung stehen.<br />
Experte 1<br />
Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung<br />
Grundsätzlich werden Strom und Gas für alle in<br />
(Strom/Gas)<br />
Ausbau des Gas- bzw. Fernwärmenetzes wird<br />
zum Anschluss von noch mehr Kunden führen<br />
A = B = C = D Netzdichte hoch, keine hoch, keine hoch, keine hoch, keine 4<br />
Experte 2 Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung<br />
Anteil Erneuerbare Energien-Einsatz (EE) 30% 30% 10% 10%<br />
zwecks autonomer Stromproduktion<br />
Grundsätzlich werden Strom und Gas für alle in<br />
den Ballungsräumen zur Verfügung stehen<br />
Räumliche Verfügbarkeit<br />
in Ballungsräumen<br />
(Wasser)<br />
A = B = C = D Moderne Verteilungssysteme Verfügbarkeit Verfügbarkeit Verfügbarkeit Verfügbarkeit Nicht angege-<br />
Experte 3<br />
räumlich gleichverteilteilteilt<br />
räumlich gleichver-<br />
räumlich gleichver-<br />
räumlich gleichverteilt<br />
ben<br />
A = B = C = D<br />
Experte 6<br />
Auch im Falle staatlichen Rückzuges aus der<br />
Aufgabe Abwasserentsorgung in Ballungsräumen<br />
aufgrund wirtschaftlicher Attraktivität<br />
dieses Wirtschaftszweiges sehr hohe räumliche<br />
Verfügbarkeit gegeben<br />
D>B=C>A Räumliche allzeit. Verfügbarkeit 3<br />
Experte 7<br />
Binnenwanderung In ländliche Räume In Randlagen von In Randlagen von In Ballungszentren<br />
Ballungsgebieten Ballungsgebieten<br />
Anteil dezentraler Anlagen hoch niedriger niedriger niedriger<br />
Politische Macht z. Sicherung der Verfügbarkeit<br />
ist abh. v. Anteil der in Ballungsgebieten<br />
lebenden Bev.<br />
Räuml. allz. Verfügbark. in allen Szenarien<br />
gesichert<br />
4<br />
261 A.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit
262 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Urteilssicherheit<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Räumliche Verfüg- A = B = C = D Netzdichte Hoch, keine Hoch, keine Hoch, keine Hoch, keine 5<br />
barkeit in ländlichen Experte 1<br />
Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung<br />
Grundsätzlich werden Strom und Gas für alle in<br />
Räumen<br />
den Ballungsräumen zur Verfügung stehen.<br />
(Strom/Gas)<br />
Ausbau des Gas- bzw. Fernwärmenetzes wird<br />
zum Anschluss von noch mehr Kunden führen<br />
A = B = C = D Netzdichte hoch, keine hoch, keine hoch, keine hoch, keine 4<br />
Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung<br />
Experte 2<br />
Anteil Erneuerbare Energien-Einsatz (EE) 30% 30% 10% 10%<br />
zwecks autonomer Stromproduktion.<br />
Grundsätzlich werden Strom und Gas für alle<br />
in ländlichen Räumen zur Verfügung stehen<br />
A = B = C = D Moderne Verteilungssysteme Verfügbarkeit Verfügbarkeit Verfügbarkeit Verfügbarkeit Nicht angege-<br />
Experte 3<br />
räumlich gleichverteilteilteilt<br />
räumlich gleichver-<br />
räumlich gleichver-<br />
räumlich gleichverteilt<br />
ben<br />
Räumliche Verfügbarkeit<br />
in ländlichen<br />
Räumen<br />
(Wasser)<br />
B = C = D > A<br />
Experte 5<br />
A = B = C = D<br />
Experte 6<br />
Anteil dezentr. Anlagen<br />
Tendenziell Probleme für räuml. Verfügbarkeit<br />
in Szen A aufgr. hoher Anford. durch Migration<br />
in ländl. Geb.<br />
Abwasserbeseitigung außerhalb von im<br />
Zusammenhang bebauter Gebiete ist für<br />
Grundstückseigentümer rein finanzielles, kein<br />
technisches Problem ist. Die räumliche Verfügbarkeit<br />
wird daher in allen Szenarien sehr gut<br />
gegeben sein. Es bestehen keine Unterschiede<br />
in der Bewertung<br />
Am höchsten niedriger niedriger niedriger Nicht angegeben<br />
B=C=D>A Räumliche allzeit. Verfügbarkeit 3<br />
Experte 7<br />
Binnenwanderung In ländliche Räume In Randlagen von In Randlagen von In Ballungszentren<br />
Ballungsgebieten Ballungsgebieten<br />
Anteil dezentraler Anlagen hoch niedriger niedriger niedriger<br />
Abnehmende Sommerniederschläge und<br />
zunehmende Bewässerung führen zu einem<br />
Mangel bei wasserführenden Schichten f.<br />
dezentrale Anlagen<br />
Räuml. allz. Verfügbark. in Szen. A nicht<br />
gesichert<br />
3,4,3,3
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D<br />
Räumliche Verfüg- A = B = C = D Netzdichte Hoch, keine Hoch, keine Hoch, keine Hoch, keine 5<br />
barkeit in Randlagen<br />
von Ballungsräumen<br />
(Strom/Gas)<br />
Räumliche Verfügbarkeit<br />
in Randlagen<br />
von Ballungsräumen<br />
(Wasser)<br />
Experte 1<br />
Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung<br />
Urteilssicherheit<br />
Grundsätzlich werden Strom und Gas für alle in<br />
den Ballungsräumen zur Verfügung stehen.<br />
Ausbau des Gas- bzw. Fernwärmenetzes wird<br />
zum Anschluss von noch mehr Kunden führen<br />
A = B = C = D Netzdichte hoch, keine hoch, keine hoch, keine hoch, keine 4<br />
Experte 2 Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung<br />
Anteil EE-Einsatz für automome Stromproduktion<br />
30% 30% 10% 10%<br />
Grundsätzlich werden Strom und Gas für<br />
alle in den Ballungsräumen zur Verfügung<br />
stehen<br />
A = B = C = D Moderne Verteilungssysteme Tendenziell Verfügbarkeit Verfügbarkeit Verfügbarkeit Nicht angege-<br />
Experte 3<br />
Probleme für<br />
räumliche Verfügbarkeit<br />
räumlich gleichverteilt<br />
räumlich gleichverteilt<br />
räumlich gleichverteilt<br />
A = B = C = D Innerhalb im Zusammenhang bebauter Gebiete<br />
3,4,3,3<br />
Experte 6<br />
in Randlagen von Ballungsräumen oder rel.<br />
dichter Bebauung werden sich aufgrund<br />
wirtschaftlicher Attrak-tivität Betreiber techn.<br />
Anlagen finden, die eine hohe Verfügbarkeit<br />
sicherstellen.<br />
D>B=C>A Räumliche allzeit. Verfügbarkeit 3<br />
Experte 7<br />
Binnenwanderung In ländliche Räume In Randlagen von In Randlagen von In Ballungszentren<br />
Ballungsgebieten Ballungsgebieten<br />
Anteil dezentraler Anlagen hoch niedriger niedriger niedriger<br />
Politische Macht z. Sicherung der Verfügbarkeit<br />
ist abh. v. Anteil der in Ballungsgebieten<br />
lebenden Bev.<br />
Räuml. allz. Verfügbark. in allen Szenarien<br />
gesichert<br />
ben<br />
263 A.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit
264 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szenarien Urteils-<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D sicherheit<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Allzeitige Verfüg- A = B = C = D Gesetzliche Maßnahmen gegeben gegeben gegeben gegeben 3<br />
barkeit<br />
Experte 1<br />
Wirtschaftliche Gegebenheiten und Anreize gegeben gegeben gegeben gegeben<br />
Allzeitige Verfügbarkeit ist grundsätzlich zu<br />
(Strom/Gas)<br />
gewährleisten. Ob sie in Anspruch genommen<br />
wird, hängt von den Kunden (bzw. ihrer<br />
Zahlungsbereitschaft) ab.<br />
D = C = B = A Anteil dezentr. Erzeugungsstrukt. 22,5% 14% 8,5% 7,5% 4<br />
Experte 2 Anteil Gaskraftwerke 37,5% 41% 17% 17%<br />
Generell sinkt (ohne entspr. Gegenmaßnahmen)<br />
allzeitig. Verfügbarkeit mit Zunahme der<br />
fluktuierenden regenerativen Energieträger.<br />
Jedoch Gas-KW sind in der Lage, schnell<br />
regelbar auf Schwankungen beim Angebot der<br />
Erneuerbaren zu reagieren.<br />
A>B>C=D Politische Anforderungen Fortsetzung Fortsetzung Fortsetzung Fortsetzung Nicht angege-<br />
Experte ben<br />
des heutigen des heutigen des heutigen des heutigen<br />
Anforderung an d. Zuverlässigkeit<br />
Marktdiffusion von Stromspeichertechnologien Ansatzes Ansatzes Ansatzes Ansatzes<br />
(ergebnisbestimmend) Moderat<br />
5 %<br />
Moderat<br />
2 %<br />
Moderat<br />
unter 1 %<br />
Moderat<br />
unter 1%.<br />
A = B = C = D Zeitliche Verfügbarkeit in Spitzenlastsituationen Nicht angege-<br />
Experte 5<br />
(Winterspitze Heizung und Strom) Allzeitige Verfügbarkeit möglich ben<br />
Allzeitige Verfüg- C > B = A = D Störanfälligkeit von Netz und Anl. + +<br />
barkeit Experte 6 Betrieb + +<br />
Dauer von Störungen<br />
(Wasser )<br />
++<br />
Höhere Betriebsstabilität durch kl. Anlagen bei<br />
Betrachtung der ges. Ab-/Wasserinfrastruktur<br />
Netzaufbau/-betrieb wesentlich f. Verfügbark.<br />
b. zentr. (Ab-) Wasserent-/-versorgung<br />
Extreme Ausrichtung auf wirtschaftliche<br />
Aspekte (z.B. durch Rückzug des Staates)<br />
bedingt Rückzug aus Bestandserhalt durch<br />
Streckung v. Reinvest. in Netze/Anl., jedoch<br />
erleichtert hoh. Zentralisierungsgrad schnelle<br />
Störfallsuche und Beseitigung
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D<br />
Kostengünstige C>D>B>A Anteil an der Stromerzeugung 3<br />
Verfügbarkeit Experte 1 Erneuerbare Energien Steigt (-) steigt (-) 10% 10%<br />
Gas steigt steigt Steigt gering steigt gering<br />
(Strom/Gas) C . D; B .-- A Kohle gering gering hoch(+) hoch(+)<br />
Kernkraft 0% 0% 20% (+) 20% (+)<br />
Wettbewerbsdruck hoch (+) hoch (+) niedrig niedrig<br />
Innovationsbudget +/-10% +50%(+) +50% (+) -50%(-)<br />
Urteilssicherheit<br />
Erprobte Techniken sind kostengünstiger<br />
Hohes Innovationspotenzial begünstigt Entwicklung<br />
von kostengünstigen Anlagen<br />
Hoher Wettbewerb begünstigt Entwicklung von<br />
kostengünstigen Anlagen<br />
D > C»B = A Anteil von Kernkraftwerken an der Stromerz. 0% 0% 20% 20% 5<br />
Experte 2<br />
lnv. z. Ausgleich v. naturbedingten Produktionsausfällen<br />
bei Erneuerbaren Energien<br />
Hoch Weniger hoch Geringer Niedrig<br />
D ^C Preise für fossile Energien 1%/a 1,5%/a 2%/a 2,5%/a<br />
Erneuerbare Erneuerbare Kostengünstige Kostengünstigste<br />
Energien sind trotz<br />
höherer Preise für<br />
fossile Energien<br />
gegenüber Kosten<br />
bei abgeschriebenen<br />
(Kern)Kraftwerken<br />
nicht konkurrenzfähig<br />
Energien sind trotz<br />
höherer Preise für<br />
fossile Energien<br />
gegenüber Kosten<br />
bei abgeschriebenen<br />
(Kern)Kraftwerken<br />
nicht konkurrenzfähig<br />
Verfügbarkeit durch<br />
hohen Anteil<br />
abgeschriebener<br />
(Kern)Kraftwerke<br />
und geringeren<br />
Investitionen für<br />
Regelenergie trotz<br />
höherer Preise für<br />
fossile Energien<br />
Verfügbarkeit<br />
durch hohen Anteil<br />
abgeschriebener<br />
(Kern)Kraftwerke<br />
und niedrigen<br />
Investitionen für<br />
Regelenergie trotz<br />
noch höherer<br />
Preise für fossile<br />
Energien<br />
A>B>C>D Preissteigerungen f. Strom/Gas 1%/a 1,5%/a striktes Achten auf 2,5%/a 4<br />
Experte 3<br />
Wirtschaftlichkeit;<br />
Preissteigerungen<br />
für Energieversorger<br />
und Endkunden<br />
am niedrigsten, da<br />
Anteil nicht regenerativer<br />
Energien<br />
klein ist.<br />
Preissteigerungen<br />
für Energieversorger<br />
und Endkunden<br />
am niedrigsten, da<br />
Anteil nicht regenerativer<br />
Energien<br />
klein ist.<br />
2%/a<br />
Preissteigerungen<br />
für Energieversorger<br />
und Endkunden am<br />
höchsten, da Anteil<br />
nicht regenerativer<br />
Energien groß ist.<br />
Preissteigerungen<br />
für Energieversorger<br />
und Endkunden<br />
am höchsten,<br />
da Anteil nicht<br />
regenerativer<br />
Energien groß ist.<br />
B = C = D > A<br />
Anteil dezentr. Anlagen hoch niedriger niedriger niedriger Nicht angegeben<br />
Experte 5<br />
Preisniveau abh. v. Kostenstruktur; höhere<br />
spezifische Inv.-Kosten bei dezentr. als b.<br />
zentr. Anl.<br />
A = B = C = D Nicht relevant, da Mess- und Regeltechnik Kein Unterschied zwischen den Szenarien 4<br />
Experte 8<br />
Basistechnologie f. virtuelle Kraftwerke,<br />
dezentr. Energiewandlung und -einspeisung,<br />
Gebäudeautomation sowie Energieeffizienz-DL<br />
265 A.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit
266 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Kostengünstige<br />
Verfügbarkeit<br />
(Wasser)<br />
Vergleich<br />
Szenerien<br />
D>B=C>A<br />
Experte 6<br />
B = C = D»A<br />
Experte 7<br />
A>B>C>D<br />
Experte 7<br />
Gesichtspunkte<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Kapitalkosten f. Anlagen<br />
Betriebskosten<br />
Reinvestitionsbedarf<br />
Günstige Finanzierungsbeding. führen zu<br />
höheren Kapitalkosten<br />
Betriebsk. bei zentr. Strukturen sind geringer<br />
als bei dezentralen<br />
Bei starker Förderung v. Innovation besteht<br />
Chance d. Entw. kostensenkender Technik<br />
In Ballungsräumen<br />
Netzdichte<br />
Binnenmigration<br />
Bei hoher Netzdichte sind Netzkosten für<br />
(Ab-)Wasser geringer<br />
Netzdichte ist abh. von der Siedlungsdichte<br />
Kostengünstig. Verfügbark. nur in Szen. A nicht<br />
gesichert<br />
In ländlichen Räumen<br />
Netzdichte<br />
Anteil dezentraler Anlagen<br />
Kosten abh. von Netzdichte und Zahl dezentr.<br />
Anlagen<br />
Gesamtkosten für Wasser und Abwasser<br />
steigen in allen Szenarien<br />
Szenarien<br />
A B C D<br />
geringer<br />
in ländliche Räume<br />
gering<br />
am höchsten<br />
Höher<br />
In Randlagen von<br />
Ballungsgebieten<br />
Nicht so gering<br />
Nicht ganz so hoch<br />
+<br />
+<br />
Höher<br />
In Randlagen von<br />
Ballungsgebieten<br />
Höher<br />
geringer<br />
+<br />
++<br />
Höher<br />
In Ballungszentren<br />
Am höchsten<br />
gering<br />
Urteilssicherheit<br />
2,2,3,4<br />
4<br />
2
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D<br />
Sicherheit des D > C»B > A hoher Einfl.: 3<br />
Netzes Experte 1 Gas-, Strom- und Wasserverbrauch Geht zurück (+) konstant Steigt mäßig Konstant/sinkt<br />
Anteil an der Stromerzeugung:<br />
(Strom/Gas) Dezentrale Anlagen 22,5% 14% 8,5% 7,5%<br />
Erneuerbare Energien 30%, steigt(-) 30%, steigt(-) 10% (+) 10%(+)<br />
Gas steigt steigt steigt gering(+) steigt gering(+)<br />
Kohle gering gering hoch(+) hoch(+)<br />
Kernkraft 0% 0% 20%(+) 20%(+)<br />
Virtuelle Kraftwerke stark ausgeprägt(-) vereinzelt Ausnahme keine<br />
Wanderungsbewegung aufs Land(-) Randlagen von Randlagen von Ballungsgebiete<br />
Urteilssicherheit<br />
Ballungsgeb. Ballungsgeb.<br />
geringer Einfl.:<br />
Störpotenziale durch Terrorangriffe<br />
Durch Investition in neue Netze wird Störanfälligkeit<br />
vermindert.<br />
Mit Netzlänge steigt Risiko für Störungen -><br />
Dezentralisierung fördert Sicherheit<br />
Virtuelle Kraftwerke stellen hohe Ansprüche an<br />
das Netz<br />
Ein hoher Anteil an EE wirkt sich negativ auf<br />
die Netzsicherheit aus.<br />
Preis-/Kostendruck führt zur Hinauszögerung<br />
von Investitionen<br />
A>B>C=D Anteil dezentraler Erzeugungsstrukturen a. d. 22,5% 14% 8,5% 7,5% 4<br />
Experte 2<br />
Stromerzeugung<br />
A = B = C = D<br />
Experte 3<br />
A = B = C = D<br />
Experte 5<br />
Einfachere Reservehaltung u. kürzere Transportentfernungen<br />
b. dezentr. Erzeugungsstrukturen<br />
Anforderungen an techn. Zuverlässigkeit moderat moderat moderat moderat Nicht angegeben<br />
Unterschiedl. Sicherheitskonzept<br />
Bei dezentr. Anlagen: Schwerpunkt d. Sicherheit<br />
auf Anl., bei geringen Netzkapazitäten -<br />
Bei zentr. Anlagen: Ausgl. Probleme einzeln.<br />
Anl. durch hohe Netzkapazitäten; -> Je nach<br />
Auslegung Gewährleistung d. Netzsicherheit in<br />
allen Szen. mögl.<br />
Nicht angegeben<br />
Keine Aussage Nicht relevant, da Mess- und Regeltechnik Basistechnologie für virtuelle Kraftwerke, dezentr. Energiewandlung und -einspeisung, Nicht angegemöglich<br />
Gebäudeautomation sowie Energieeffizienz-DL ist und vermehrter Einsatz nichts mit den Auswirkungen auf Netzsicherheit bei einem<br />
ben<br />
hohen Einsatzes von virtuellen Kraftwerken etc. zu tun hat<br />
Experte 8<br />
267 A.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit
268 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Sicherheit des<br />
Netzes<br />
(Wasser)<br />
Vergleich<br />
Szenerien<br />
A > B = D > C<br />
Experte 6<br />
Gesichtspunkte<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Netzkonzept (techn. Entwicklung)<br />
Zentralisierungsgrad<br />
Betriebsregeln<br />
Reinvestition, Instandhaltung<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
Szenarien<br />
A B C D<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
+<br />
Urteilssicherheit<br />
3,3,4,4<br />
Verbundlösungen im Trinkw. führen zur<br />
Erhöhung d. <strong>Versorgung</strong>ssicherheit<br />
Netzsicherheit ist abhängig vom Grad dezentraler<br />
Lösungen<br />
sowie vom Aktivitätsgrad des Staates bzgl.<br />
Überwachung etc.<br />
Hoher Zentralitätsgrad/ komplett dezentr.<br />
Lösungen erleichtern Störfallsuche, Netzinvestitionen<br />
abhängig von Finanzierungsbedingungen
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Urteilssicherheit<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Sicherheit der D = C > B > A Nicht langjährig erprobte Technologien (hoher Hoch Geringer Niedrig Niedrig 3<br />
Anlagen Experte 1 Einfl.)<br />
Deckung Ersatzbedarf durch kleine/mittlere<br />
(Strom/Gas)<br />
Anlagen<br />
zu 50% (+) zu 30% Zu 30% Zu 30%<br />
Anteil an der Stromerzeugung Gasanteil steigt (+) vereinzelt Hoh. Ant. Kernkr.(-) Hoh.Ant. Kernkr.(-)<br />
Hoh.Anteil Kohle (+)<br />
Virtuelle Kraftwerke Stark ausgepr. (-) hoch Ausnahme keine<br />
Wettbewerbsdruck Hoch(-) Hoch (-) niedrig niedrig<br />
Störpotenziale durch Terroraktionen (geringer Niedriger Niedriger Höher Höher<br />
Einfl.)<br />
kleine KW erfordern weniger Reservekapazität<br />
Preis-/Kostendruck führt zur Hinauszögerung<br />
von Investitionen<br />
Standardisierung senkt Ausfallsrisiko<br />
Je weniger Anlagen erforderlich sind, desto<br />
weniger können ausfallen<br />
Einfache Technologien leichter zu handhaben<br />
Bekannte Technologien leichter zu handhaben<br />
Erhöhung der Anlagensicherheit durch Weiterentwicklungen<br />
im IT-Bereich<br />
A > B»C > D Anteil an der Stromerzeugung: Dezentr. 22,5% 14% 8,5% 7,5% 4<br />
Erzeugungsstrukturen (geringer Einfl.)<br />
A^ B, C.-- D<br />
Kernkraftwerke (hoher Einfluss)<br />
Experte 2<br />
0% 0% 20% 20%<br />
keine Aussage<br />
Experte 3<br />
A = B = C = D<br />
Experte 5<br />
Keine Aussage möglich<br />
Unterschiedl. Sicherheitskonzept<br />
Bei dezentr. Anlagen: Schwerpunkt der Sicherheit<br />
auf Anlagen, bei geringen Netzkapazitäten<br />
- Bei zentr. Anlagen: Ausgleich der Probleme<br />
einzeln. Anl. durch hohe Netzkapazitäten; -> Je<br />
nach Auslegung Gewährleistung d. Anl.-<br />
Sicherheit in allen Szen. mögl.<br />
Nicht angegeben<br />
Nicht angegeben<br />
Sicherheit der C > B = D > A Netzkonzept (techn. Entwicklung) ++ + Nicht angege-<br />
Anlagen Experte 6 Zentralisierungsgrad<br />
+ + ben<br />
Betriebsregeln, Reinv., lnstandh.<br />
(Wasser)<br />
Förderung von Innovation ermöglicht Entwicklung<br />
sicherer Technik<br />
Durch komplett dezentr. Lösungen ohne<br />
Netzabh. folgt Zunahme an Anlagen, wodurch<br />
Störfallrisiko steigt<br />
Hoher Zentralisierungsgrad ermöglicht schneles<br />
Handeln bei Störfallsuche u. Beseitigung<br />
Rückzug des Staates aus der Überwachung/<br />
Lockerung von Regeln führen zum Rückgang<br />
der Sicherheit im Anlagenbetrieb<br />
269 A.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit
270 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D<br />
Erhalt der Reversi- B > A = C > D Anteil an der Stromerzeugung 3<br />
bilität innerhalb des Experte 1<br />
dezentrale Anlagen 22,5%(+) 14% 8,5% 7,5%<br />
Erneuerbare Energien steigt(+) steigt(+) 10% 10%<br />
<strong>Versorgung</strong>s- Gas steigt(+) steigt(+) steigt gering(-) steigt gering<br />
systems Kohle gering(+) gering(+) hoch(-) hoch<br />
(Strom/Gas) Kernkraft 0% 0% 20%(-) 20%<br />
Investitionen in neue Strukturen Einspartechn. stark ausgeprägt (-) vereinzelt Ausnahme keine<br />
(virtuelle KW/DSM)<br />
Gas-, Strom- u. Wasserverbrauch sinkt(+) konstant steigen mäßig(-) konstant/sinkt<br />
Ersatzbedarfsdeckung durch kl/mittlere Anlagen<br />
50%(+) 30%(+) 30% 30%<br />
Urteilssicherheit<br />
Kleine KW sind flexibler austauschbar,<br />
Investitionskosten für Gaskraftwerke gering =><br />
kurze Amortisationsdauer<br />
Preis-/Kostendruck führt zur Hinauszögerung<br />
von Investitionen<br />
Einspartechniken erfordern hohe Investitionen,<br />
die sich u.U. erst langfristig auszahlen<br />
A > B»C = D Anteil an der Stromerzeugung: 4<br />
Experte 2 dezentrale Anlagen 22,5% 14% 8,5% 7,5%<br />
Kernkraft 0% 0% 20% 20%<br />
A .-, B<br />
Kohle 24% 24% 52% 52%<br />
Grad der Systemfestschreibung abh. v. Anteil<br />
dezentr. Anlagen<br />
Ausmaß der längerfr. Umweltausw. abh. v.<br />
Betrieb von KK und fossilen Erzeugungseinheiten<br />
A = C»B = D Geschwindigkeit des Anlagenaustausches Verkürzt sich Wie heute Verkürzt sich Wie heute 3<br />
Experte 3<br />
B = C = D > A Anteil dezentraler Anlagen Hoch niedriger Nicht angege-<br />
Experte 5 Rückbau großräu- Aufrechterhaltung zentralerer Netze schließt dagegen nicht ben<br />
miger <strong>Versorgung</strong>snetze<br />
dezentralere Erzeugungsvarianten aus.<br />
aufgrund ho-<br />
hen Anteils dezentraler<br />
Anlagen, jedoch<br />
ist Vorgehen<br />
im Hinblick auf<br />
mögliche künftige<br />
Entwicklung, bei<br />
denen zentrale<br />
<strong>Versorgung</strong>snetze<br />
erforderlich sind,<br />
nicht reversibel.
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D<br />
Fehlertoleranz A>B>C>D Anteil an der Stromerzeugung 3<br />
(Strom/Gas) Experte 1 kl. <strong>Versorgung</strong>seinheiten<br />
Gas<br />
hoch<br />
steigt(+)<br />
weniger hoch<br />
Steigt(+)<br />
niedrig<br />
steigt gering<br />
Kernkraft 0% 0% 20%(-) 20%(-)<br />
Deckung Ersatzbedarf von kl/mittleren Anlagen 50%(+) 30% 30% 30%<br />
Virtuelle Kraftwerke stark ausgeprägt (-) Vereinzelt Ausnahme keine<br />
niedrig<br />
steigt gering<br />
Kleine Anlagen können flexibler gefahren<br />
werden<br />
Durch Informationstechniken werden Fehler<br />
schneller erkannt und behoben werden<br />
Einfache Technologien sind leichter zu hand- Insbesondere<br />
haben kleinere Gaskraft- Insbesondere Anpassung an Anpassung an<br />
Bekannte Technologien sind leichter zu werke als kleine kleinere Gaskraft- Störungen mit Groß- Störungen mit<br />
handhaben<br />
Urteilssicherheit<br />
<strong>Versorgung</strong>seinheiten<br />
ermöglichen<br />
durch ihre flexiblere<br />
Fahrweise eine flexible<br />
Reaktion auf<br />
Störungen<br />
werke ermöglichen<br />
eine flexible<br />
Reaktion auf<br />
Störungen<br />
kraftwerken relativ<br />
schwierig, jedoch<br />
Entwicklung im TK-<br />
Bereich fördert<br />
Störungserkennung<br />
und Beseitigung<br />
Großkraftwerken<br />
relativ schwierig<br />
A > B»C = D Anteil an der Stromerzeugung: 4<br />
Experte 2 dezentrale Anlagen 22,5% 14% 8,5% 7,5%<br />
Kernkraftwerke 0% 0% 20% 20%<br />
Fehler b. gr. zentr. Systemen wirken sich<br />
stärker aus als bei kleinen dezentr. Systemen<br />
A>B>C>D Anteil dezentraler Anlagen an der Stromerzeu- 22,5% 14% 8,5% 7,5% Nicht angege-<br />
Experte 3<br />
gung 20% 10% 15% 10% ben<br />
A = B = C = D<br />
Experte 5<br />
DSM-Verbreitung<br />
Anteil dezentraler Anlagen an der Stromerzeugung<br />
Koordination der dezentr. Anl. mit Hilfe eines<br />
zentr. Info-Systems<br />
Höheren Fehlertoleranzen von dezentr. Anl.<br />
stehen höhere Fehlerpotenziale durch zentr.<br />
Informationssystem dieser Anl. entgegen -><br />
Daher keine Unterschiede zw. den Systemen<br />
ableitbar<br />
Hoch weniger hoch Niedriger Niedrig Nicht angegeben<br />
Hoch Nicht ganz so hoch niedriger niedrig<br />
271 A.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit
272 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Sicherung eines<br />
hohen Qualitätsniveaus<br />
(Strom/Gas)<br />
Sicherung eines<br />
hohen Qualitätsniveaus<br />
(Wasser)<br />
Vergleich<br />
Szenerien<br />
D>C>B>A<br />
Experte 1<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D<br />
Biogasanteil 5%(-) 3%(-),<br />
3%(+),<br />
Netzeinsp. 80% Netzeinsp. 50%<br />
Gas- und Stromverbrauch sinken(-) konstant Steigen mäßig(+) konstant<br />
Einspeisung von Biogas u.ä. vermindert<br />
Gasqualität<br />
Urteilssicherheit<br />
1%(+) 3<br />
C>A>D>B Marktdurchdringung Rundum-Sorglos-Pakete; 15 % 5 % 20 % 10 % 3<br />
Experte 2<br />
Qualität des Gases, Konstanz der Stromfrequenz<br />
wird in Rundum-Sorglos-Paketen<br />
garantiert<br />
D = C = B = A<br />
Experte 3<br />
Qualität gleich Qualität gleich Qualität gleich Qualität gleich Nicht angegeben<br />
A = B = C = D<br />
Experte 5<br />
Keine systematische Unterscheidung zwischen<br />
den Szenarien<br />
Nicht angegeben<br />
A = B»C = D<br />
5,4,3,2<br />
Experte 6<br />
Anlagenstandard, inkl. Zustand der Wasservorräte<br />
Netzzustand<br />
Betrieb<br />
Sinkender Wasserverbrauch, Zusammenschluss<br />
v. Versorgern kann durch Abbau von<br />
Kapazitätsreserven zur Aufgabe von Wasserschutzgebieten<br />
führen.<br />
Abbau von Regelungen und Überwachung<br />
durch Staat kann zu Lockerung der Auflagen in<br />
Wasserschutzzonen, bei Betriebsregeln etc.<br />
führen<br />
Qualität d. Grund-/Oberflächenwassers<br />
korreliert mit Intensität staatlichen Engagements<br />
+<br />
+++<br />
+<br />
+<br />
++
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D<br />
Angebot einer A>C>B>D Marktdurchdringung von: Anlagencontracting 30%(+) 5%(-) 30%(+) 10%(-) 3<br />
Vielzahl von Ver- Experte 1 Rundum-Sorglos-Pakete 15%(+) 5%(-) 20%(+) io%(-)<br />
DMS 20%(+) 10%(-) 15%(+) io%(-)<br />
sorgungsleistungen Anteil dezentraler Technologien 22,5%(+) 14%(+) 8,5% 7%<br />
(Strom/Gas) C>A>D>B Marktdurchdringung von: 3<br />
Experte 2 Rundum-Sorglos-Pakete 15 % 5 `Y. 20 % 10 %<br />
C > A»D > B Marktdurchdringung von: 3<br />
Experte 3<br />
Anlagencontracting (hoher Einfl.) 30% 5% 30% 10%<br />
Rundum-Sorglos-Pak. (hoh. Einfl.) 15% 5% 20% 10%<br />
DMS (niedriger Einfl.) 20% 10% 15% 10%<br />
Urteilssicherheit<br />
A = B > C = D Vielfalt der Angebote Hoch Hoch Niedriger Niedriger Nicht angege-<br />
Experte 5 Zahl an Unternehmen Viele kleine Nicht ganz so viele wenige wenige ben<br />
Angesichts der Angesichts der<br />
größeren Zahl kl. größeren Zahl kl.<br />
Firmen, die keine Firmen, die keine<br />
überregionalen überregionalen<br />
Angebote machen Angebote machen<br />
können, wird diese können, wird diese<br />
Vielfalt nicht für alle Vielfalt nicht für alle<br />
Verbraucher Verbraucher<br />
nutzbar.<br />
nutzbar.<br />
Angebot einer A>B>C=D Zentralisierungsgrad ++ + Nicht angege-<br />
Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sleistungegung<br />
nur bei dezentralen Lösungen<br />
Experte 6<br />
Marktregulierung + + ben<br />
Freie Wahl f. Dienstleistung Abwasserentsor-<br />
(Wasser)<br />
Dekonzentration verstärkt Angebot einer<br />
Vielzahl von <strong>Versorgung</strong>sdienstleistungen<br />
273 A.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit
274 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Urteilssicherheit<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Unabhängigkeit von A>B>D>C Anteile an der Stromerzeugung: 3<br />
knappen Ressour- Experte 1 Erneuerbare Energien 30 %(+) 30%(+) 10 %(-) 10 %(-)<br />
Kernkraft 0% 0% 20 %(+) 20 %(+)<br />
cen<br />
B .=-- D<br />
Erdgas 45%, steigt stark(-) 45%, steigt stark(-) 17%, steigt gering 17%, steigt gering<br />
(Strom/Gas) Verbrauch von Strom- und Gas sinkt(+) konstant steigen mäßig(-) konstant(+)<br />
Wanderungsbewegung aufs Land(-) Randlagen Ballungsgeblungsgeb.<br />
Randlagen Bal-<br />
Ballungsgeb.<br />
Zu den knappen Ressourcen gehören die<br />
fossilen Energieträger Erdgas, Kohle und Öl.<br />
Verbrauch dieser Energieträger wird verringert;<br />
im Bereich des Endverbrauchs durch eine<br />
höhere Energieeffizienz bzw. Verringerung der<br />
Aktivitäten; Im Umwandlungsbereich durch<br />
Verbesserungen der Effizienz (Ausnutzungsgrad)<br />
d. Anlagen, bzw. Subst. d. Energieträger<br />
durch EE<br />
A = B > C = D Anteile an der Stromerzeugung: 4<br />
Experte 2 Erneuerbare Energien (hoh. Einfl) 30 % 30% 10% 10 %<br />
Kernkraft (geringer Einfluss) 0% 0% 20 % 20 %<br />
Erdgas (geringer Einfluss) 45% 45% 17% 17%<br />
Kohle mittlerer Einfluss) 24% 24% 52% 52%<br />
Reichweite von Erdgas und Uran rel. begrenzt<br />
im Vgl. zu Kohle<br />
A = B»C = D Anteile an der Stromerzeugung: Nicht angege-<br />
Experte 3 Kohle 24% 24% 52% 52% ben<br />
Erdgas: 45% 45% 17% 17%<br />
Kohle hat gr. Reichweite als Gas<br />
A = B > C = D<br />
Experte 5<br />
Anteil erschöpfbarer Ressourcen<br />
an der Stromversorgung<br />
niedrig niedrig hoch hoch Nicht angegeben<br />
Flächeninanspruchnahme von Erneuerbaren hoch hoch klein klein<br />
Energien<br />
Abh. von knappen Ressourcen auch bei Szen.<br />
A) und B) durch flächenintensive Erzeugung<br />
mittels erneuerb. Energieträger<br />
Unabhängigkeit von A > B»D > C Wasserverbrauchsentwicklung ++ Nicht angegeknappen<br />
Ressourcen<br />
Möglichkeit des Recyclings von.Nährstoffen ++<br />
Experte 6<br />
Umgang mit Wasserreservoirs und Wasserschutzzonen<br />
+<br />
++ ben<br />
(Wasser)<br />
Sinkender Wasserverbrauch verbessert Unabhängigkeit<br />
von knappen Wasser-Ressourcen<br />
Sinkender Wasserverbrauch, Zusammenschluss<br />
von Versorgern kann durch Abbau von<br />
Kapazitätsreserven zur Aufgabe Wasserschutzgebieten<br />
führen<br />
In zentr. Abwasserentsorgung wird Klärschlamm<br />
nicht in die Landwirtschaft verbracht,
Ziele<br />
Vergleich<br />
Szenerien<br />
Gesichtspunkte<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Szenarien<br />
A B C D<br />
Urteilssicherheit<br />
Teilströme werden kaum genutzt<br />
Diversifikation von D = C > A = B Anteile an der Stromerzeugung: 3<br />
<strong>Versorgung</strong>squellen Experte 1 Erneuerbare Energien steigt Steigt 10%(+) 10%(+)<br />
Kernkraft 0% 0% 20%(+) 20%(+)<br />
(Strom/Gas) Erdgas steigt(-) steigt(-) steigt gering(+) steigt gering(+)<br />
Kohle gering gering hoch (+) hoch(+)<br />
Verbrauch von Strom- und Gas sinkt(+) konstant steigt mäßig konstant<br />
Anteil Biogasnutzung 5%(+) 3% 3% 1%<br />
(80% Netzeinsp)(+) (50% Netzeinsp)<br />
Hohe Diversifizierung von <strong>Versorgung</strong>squellen,<br />
wenn viele unterschiedliche Technologien f.<br />
<strong>Versorgung</strong>saufgabe zur Verfügung stehen. Zu<br />
berücksichtigen ist hierbei insbesondere die<br />
Struktur des Kraftwerksparks (Anteile der<br />
Energieträger, Größe und Art der Kraftwerke)<br />
A>B>C=D Installierte Leistung ? ? ? ? 4<br />
Experte 2<br />
Anteil dezentraler Anlagen an der Stromerzeugung<br />
22,5% 14% 8,5% 7,5%<br />
A»B > C = D Anteil an der Stromerzeugung 4<br />
Experte 3 Erneuerbare Energien 30 % 30 % 10% 10%<br />
dezentrale Anlagen 22,5 % 14% 8,5% 7,5%<br />
B=C=D>A<br />
Experte 5<br />
Abhängigkeit von Erdgas groß niedriger niedriger niedriger Nicht angegeben<br />
275 A.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit
276 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D<br />
Diversifikation der C = D > A = B Anteil an der Stromerzeugung 4<br />
Bezugsquellen Experte 1 Kernkraft 0% 0%. 20%. 20%<br />
Kohle 24% 24%. 52%. 52%<br />
(Strom/Gas) Erdgas 45%, steigt stark 45%, steigt stark 17%, steigt gering 17%, steigt gering<br />
Erneuerbare Energien 30% 30% 10% 10%<br />
Urteilssicherheit<br />
Hohe Diversifizierung von Bezugsquellen ausgewogene An- ausgewogene An- ausgewogene ausgewogene<br />
bedeutet Bezug v. eingesetzten Rohstoffen aus zahl von Bezugs- zahl von Bezugs- Anzahl von Bezugs- Anzahl von<br />
unterschiedlichen Regionen<br />
quellen, insbesondere<br />
quellen, insbesondere<br />
quellen<br />
Bezugsquellen<br />
durch leitungs-<br />
ungebundene fossile<br />
Energieträger,<br />
jedoch Abhängigkeit<br />
vom leitungsgebundenen<br />
Energieträger<br />
Gas hoch<br />
durch leitungs-<br />
ungebundene fossile<br />
Energieträger,<br />
jedoch Abhängigkeit<br />
vom leitungsgebundenen<br />
Energieträger<br />
Gas hoch<br />
A = B = C = D Anteil an der Stromerzeugung: Erdgas 45% 45% 17% 17% 4<br />
Experte 2 Kohle 24% 24% 52% 52%<br />
Kernbrennstoffe 0% 0% 20% 20%<br />
Erdgas, Kernbrennstoffe: relativ wenige<br />
Lieferländer mit gesicherten Ressourcen;<br />
Kohle: weltweit gleichmäßig und reichlich<br />
verteilt<br />
Kombinationen von Ressourcen unterschiedl.<br />
Verfügbarkeit und räuml. Verteilung Maß für<br />
Diversifikation v. Bezugsquellen<br />
A>B>C=D Anteil an der Stromerzeugung: 3<br />
Experte 3 dezentr. Erneuerbarer Energien 15% 10% 5% 5%<br />
fossile Ressourcen niedrig niedrig hoch hoch<br />
Dr.--C>A:=B<br />
Experte 5<br />
Abhängigkeit vom Erdgas<br />
Abhängigkeit von Kohle<br />
Wenige Länder verfügen über dominante<br />
Erdgasquellen<br />
Kohle auf der Welt breit verteilt<br />
Diversifikation am<br />
höchsten aufgrund<br />
des relativ hohen<br />
Anteils dezentraler<br />
EE und geringer<br />
Herkunft der<br />
(fossilen) Ressourcen<br />
aus dem<br />
Ausland<br />
Abhängigkeit vom<br />
Erdgas kritischer<br />
einzuschätzen als<br />
von Kohle<br />
Diversifikation<br />
geringer aufgrund<br />
des nicht ganz so<br />
hohen Anteils<br />
dezentraler EE und<br />
geringer Herkunft<br />
der (fossilen)<br />
Ressourcen aus<br />
dem Ausland<br />
Diversifikation<br />
geringer aufgrund<br />
des relativ geringen<br />
Anteils dezentraler<br />
EE und großer<br />
Mengen (fossiler)<br />
Ressourcen aus<br />
dem Ausland<br />
Diversifikation<br />
geringer aufgrund<br />
des relativ geringen<br />
Anteils<br />
dezentraler EE und<br />
großer Mengen<br />
(fossiler) Ressourcen<br />
aus dem<br />
Ausland<br />
Nicht angegeben
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D<br />
Technologische A>B>C>D Anteil an der Stromerzeugung: 4<br />
Diversität Experte 1 Erneuerbare Energien 30%, steigt 30%, steigt 10% 10%<br />
Kohle 24%, geringer werd 24%, geringer werd 52% 52%<br />
(Strom/Gas) Erdgas 45%, steigt 45%, steigt 17%, steigt gering 17%, steigt gering<br />
Kernenergie 0% 0% 20% 20%<br />
Virtuelle Kraftwerke ist stark ausgeprägt vereinzelt Ausnahme keine<br />
Anteil von Klär-, Deponie- und Biogas am 5% 3% 3% 1%<br />
gesamten Gasbedarf<br />
Innovationsbudget +/-10% +50% +50% -50%<br />
Gas- und Stromverbrauch geht zurück konstant steigt konstant<br />
Einsparungspotenziale v. Technolog. z.<br />
Effizienzsteigerung<br />
(Anlagenmix) 20% 20% 10% 10%<br />
Diversifizierung des Angebotspektrums stark relativ stark stark relativ stark<br />
Urteilssicherheit<br />
Hohe technolog. Diversität liegt bei Verfügbarkeit<br />
unterschiedlicher Technologien vor, wozu<br />
u.a. hohe Innovationstätigkeit beiträgt<br />
C = D»A = B Anteil an der Stromerzeugung: 4<br />
Experte 2 Kernenergie 0% 0% 20% 20%<br />
Erneuerbarer Energien 30% 30% 10% 10%<br />
Vorteilhaftigkeit von Kernenergienutzung für<br />
technolog. Div.<br />
Kein Hinweis auf technolog. Div. durch Erneuerb.<br />
Energien<br />
C > A = B > D Akzeptanz neuer Technologien Widersprüchlich auf Widersprüchlich auf Widersprüchlich auf Widersprüchlich 3<br />
Experte 3 gegenwärtigem gegenwärtigem gegenwärtigem auf gegenwärtigem<br />
Niveau Niveau Niveau Niveau<br />
Steigerung Budget zur Innovationsförderung +/- 10 % + 50 % + 50 % - 50 %<br />
Marktdurchdringung v. Smart-Building 30% 5% 30% 10%<br />
A = B = C = D<br />
Experte 5<br />
Technolog. Diversität ist in allen Szenarien<br />
gegeben<br />
Nicht angegeben<br />
Technologische A>B>C>D Zentralisierung ++ + 3<br />
Diversität Experte 6 Marktregulierung, Anteil Großversorger ++<br />
+<br />
Innovation +<br />
++<br />
(Wasser)<br />
++<br />
Dekonzentration verstärkt Angebot einer<br />
Vielzahl v. <strong>Versorgung</strong>sdienstleistungen<br />
Ausweitung von Förderung von Innovation führt<br />
zu Neuentw.<br />
277 A.3.3 <strong>Versorgung</strong>ssicherheit
278 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
A.3.4 Wirtschaftliche Aspekte<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Sicherung und A=C>B>D Wirtschaftswachstum 2%/a(+) 1,5%/a 2%/a(+) 1%/a(-) 3<br />
Steigerung der Experte 1<br />
Beschäftigung (in<br />
den <strong>Versorgung</strong>ssektoren)<br />
(Strom/Gas)<br />
Diversifikation d. Angebotsspektrums<br />
Entw. Technolog. zur Effizienzsteigerung<br />
Hohes Wirtschaftswachstum wirkt positiv auf<br />
Beschäftigung<br />
Hoher Wettbewerb wirkt neg. auf Beschäftigung<br />
relativ stark<br />
höher<br />
stark<br />
moderat<br />
stark<br />
moderat<br />
relativ stark<br />
sehr moderat<br />
Positives Investitionsklima fördert wirtsch. Entw.<br />
Verstärkte Aktivitäten im Dienstleistungsbereich<br />
fördern Beschäftigung<br />
A>B>C=D Anteil a. d. Stromerzeug.: 4<br />
Experte 2<br />
Erneuerbare Energien 30% 30% 10% 10%<br />
Kohle 24% 24% 52% 52%<br />
Kernkraft 0% 0% 20% 20%<br />
Einsparpotenzial v. Technolog. (Anlagenmix) 20% 20% 10% 10%<br />
Substitution von fossilen/ KK durch EE und<br />
effiziente Stromerzeugung führen zu mehr<br />
Beschäftigung<br />
Urteilssicherheit<br />
A = C > B > D<br />
Experte 5<br />
Wirtschaftswachstum<br />
Anteil a. d. Stromerzeug.:<br />
2%/a (++) 1,5%/a (+) 2%/a(++) 1%/a(-) Nicht angegeben<br />
Kohle 24% 24% 52% 52%<br />
Gas 45% 45% 17% 17%<br />
Kernkraft 0% 0% 20% 20%<br />
dezentraler Anlagen 22,5% 14% 8,5% 7,5%<br />
Wirtschaftswachstum und Dezentralisierung der<br />
Energieversorgung fördern Beschäftigung,<br />
jedoch auch neg. Effekte auf Gesamtbeschäft.<br />
Substitution Kohle durch Gas verringert heimische<br />
Wertschöpfung<br />
Kernenergie ist verbunden mit hohem Dienstleistungsanteil<br />
Sicherung und A>D>B=C Anteil dezentraler Technologien Am höchsten niedriger niedriger Nicht ganz so hoch 3<br />
Steigerung der Experte 7<br />
Beschäftigung (in<br />
den <strong>Versorgung</strong>ssektoren)<br />
(Wasser)<br />
Beschäftigungszunahme bei verstärktem<br />
Einsatz dezentr. Anlagen aufgrund verstärkt<br />
benötigtem Service<br />
Beschäftigungszunahme im (Ab-)Wassersektor<br />
nur in Szen. A und B
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Urteilssicherheit<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Pluralistische A=B>Cz-D Marktstruktur Dekonzentration Dekonzentration Internationale Internationale 3<br />
Marktstruktur Experte 1<br />
Oligopole<br />
Oligopole<br />
Hoher Wettbewerb wirkt positiv auf pluralistische<br />
Marktstruktur<br />
Verstärkte Aktivitäten im Dienstleistungsbereich<br />
fördern pluralistische Marktstruktur<br />
A = B»C = D Marktstruktur Dekonzentration Dekonzentration Oligopol Oligopol 2<br />
Experte 2<br />
A = B = C = D<br />
Experte 5<br />
Pluralistische Marktstruktur ist für Potenzial von<br />
Marktentwicklung von Bedeutung<br />
Marktstruktur Dekonzentration Dekonzentration Oligopol Oligopol Nicht angegeben<br />
Pluralistische<br />
Marktstrukt.<br />
bedeutsam in<br />
Phase der Neuentwicklung<br />
v. Produkten<br />
durch kl.<br />
Unternehmen im<br />
Hinblick auf<br />
Potenzial v.<br />
Marktentwicklung<br />
Pluralistische<br />
Marktstrukt.<br />
bedeutsam in<br />
Phase der Neuentwicklung<br />
v. Produkten<br />
durch kl.<br />
Unternehmen im<br />
Hinblick auf<br />
Potenzial v.<br />
Marktentwicklung<br />
Bei Oligopolistischen<br />
Marktstrukturen<br />
sind es die<br />
Großunternehmen<br />
selbst, die die<br />
Entwicklung neuer<br />
Produkte vorantreiben.<br />
Da größere Veränderungen<br />
nicht<br />
erwünscht sind, ist<br />
oligopolistische<br />
Marktstruktur unter<br />
Einsatz von<br />
kartellrechtlichen<br />
Instrumenten<br />
angemessen<br />
279 A.3.4 Wirtschaftliche Aspekte
280 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Urteilssicherheit<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Internationale C>D>A>B Umweltschutzziele moderat moderat moderat moderat 3<br />
Wettbewerbs- Experte 1 Energiepreisanstieg 1%/a 1,5%/a 2%/a 2,5%/a<br />
Marktstruktur Dekonzentration Dekonzentration Internationale Internationale<br />
fähigkeit<br />
Oligopole<br />
Oligopole<br />
Ambitionierte nationale Energie- und Umweltpolitik<br />
kann zu neg. Effekt führen<br />
Hohe Energieträgerpreise belasten Wirtschaft<br />
„Starke" Unternehmen sind international<br />
konkurrenzfähiger<br />
C = D »A = B Anteil a. d. Stromerzeug.: 3<br />
Experte 2 Erneuerbare Energien 30% 30% 10% 10%<br />
Kernkraft 0% 0% 20% 20%<br />
Marktstrukturen Dekonzentration Dekonzentration Oligopole Oligopole<br />
A = B = C = D<br />
Experte 5<br />
Internationale Wettbewerbsfähigkeit determiniert<br />
durch Arbeitskosten und in einigen Branchen<br />
durch Energiekosten, wobei Höhe abhängig,<br />
in wieweit Kosten der Umweltanforderungen<br />
von Unternehmen oder Verbraucher zu<br />
tragen sind -> hierzu keine eindeutigen Schlüsse<br />
ableitbar Dennoch grundsätzlich Wettbewerbsfähigkeit<br />
gegeben<br />
Höhere Stromerzeugungskosten<br />
aufgrund der<br />
starken Nutzung<br />
von EE und des<br />
Verzichts auf KK<br />
führen zu einem<br />
Verlust internationaler<br />
Wettbewerbsfähigkeit<br />
Höhere Stromerzeugungskosten<br />
aufgrund der<br />
starken Nutzung<br />
von EE und des<br />
Verzichts auf KK<br />
führen zu einem<br />
Verlust internationaler<br />
Wettbewerbsfähigkeit<br />
Oligopolistische<br />
Marktstrukturen<br />
erleichtern den<br />
Großunternehmen,<br />
ausländische<br />
Wettbewerber von<br />
Heimatmarkt<br />
fernzuhalten und in<br />
ausländ. Märkte<br />
einzudringen.<br />
Oligopolistische<br />
Marktstrukturen<br />
erleichtern den<br />
Großunternehmen,<br />
ausländische<br />
Wettbewerber von<br />
Heimatmarkt<br />
fernzuhalten und in<br />
ausländ. Märkte<br />
einzudringen.<br />
Nicht angegeben
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Investitionstätigkeit A>B>D>C Umweltschutzziele moderat moderat moderat moderat 3 (2)<br />
(Strom/Gas) Experte 1 Wirtschaftswachstum 2%/a<br />
1,5%/a<br />
2%/a<br />
1%/a<br />
Finanzierungsbedingung.: günstig<br />
günstig<br />
ungünstig<br />
günstig<br />
Investitionsbedarf hoch hoch niedrig niedrig<br />
Ambitionierte nationale Energie- und Umweltpolitik<br />
kann zu erhöhten Investitionsaktivitäten<br />
führen<br />
Beeinflussung Niveau der Investitionsaktivitäten<br />
durch Wirtschaftswachst. Umlaufzeiten sind<br />
Indikatoren für Investitionstätigkeiten<br />
A>B>D>C Anteil a. d. Stromerzeug.: 3<br />
Experte 2<br />
Erneuerbare Energien 30% 30% 10% 10%<br />
Erdgas 45% 45% 17% 17%<br />
Kernkraftwerke 0% 0% 20% 20%<br />
Keine Aussage<br />
Experte 5<br />
Investitionshöhe<br />
Verzicht auf<br />
Weiterbetrieb v.<br />
Kernkraftwerken<br />
induziert verstärkten<br />
Zubau von<br />
Kraftwerken auf der<br />
Basis von Erdgas<br />
und erneuerbaren<br />
Verzicht auf<br />
Weiterbetrieb der<br />
Kernkraftwerke<br />
induziert verstärkten<br />
Zubau von<br />
Kraftwerken auf der<br />
Basis von Erdgas<br />
und erneuerbaren<br />
Der Weiterbetrieb<br />
von Kernkraftwerken<br />
erfordert einen<br />
geringeren Zubau<br />
von Kraftwerken<br />
auf der Basis von<br />
Erdgas und<br />
erneuerbaren<br />
Der Weiterbetrieb<br />
von Kernkraftwerken<br />
erfordert einen<br />
geringeren Zubau<br />
von Kraftwerken<br />
auf der Basis von<br />
Erdgas und<br />
erneuerbaren<br />
Energieträgern Energieträgern Energieträgern Energieträgern<br />
hoch Nicht ganz so hoch In geringem Investitionen<br />
Umfang<br />
beschränken sich<br />
auf Ersatzbedarf<br />
Rel. höhere Inv. führen zu rel. höheren Kosten<br />
und daher möglicherweise zu höheren Preisen -<br />
> Jedoch mögl. Diskrepanz zw. Inv.-Höhe und<br />
Preisentw.<br />
Investitionstätigkeit A>B>D=D Binnenmigration In ländliche Räume In Randlagen von In Randlagen von In Ballungszentren 3<br />
(Wasser) Experte 7 Ballungsgebieten Ballungsbebieten<br />
Anteil dezentraler Technologien Am höchsten Nicht ganz so hoch niedriger niedriger<br />
Siedlungsdichte ist abh. von Binnenmigration<br />
Netzinv. abhängig von Siedlungsdichte<br />
lnv. abh. v. Anteil dezentr. Technologien<br />
Vornehmlich lnv. in Anl. in Szen. A und B, in<br />
Netze in Szen. C und D<br />
Urteilssicherheit<br />
Nicht angegeben<br />
281 A.3.4 Wirtschaftliche Aspekte
282 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Szenarien<br />
Gesichtspunkte<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Szenarien<br />
A B C D<br />
Innovations- B>C=A>D Marktstruktur Dekonzentration Dekonzentration Oligopol Oligopol 3<br />
tätigkeit Experte 1 Preissteigerungen 1%/a 1,5%/a 2,0%/a 2,5%/a<br />
Innovationsbudget +/-10% +50% +50% -50%<br />
Politische Impulse (z.B. F&E), ein hohes Preisniveau<br />
und hoher Wettbewerbsdruck fördern<br />
Innovationstätigkeit<br />
A = B > C > D Innovationsbudget +/- 10% +50% +50% -50% 2<br />
Experte 2<br />
Anteil Erneuerbarer Energien 30% 30% 10% 10%<br />
Bildung virtueller Kraftw. stark ausgeprägt vereinzelt Ausnahme keine<br />
Dienstleistungen hoch niedrig Nicht ganz so hoch niedriger<br />
Marktstruktur Dekonzentration Dekonzentration Oligopol Oligopol<br />
Keine Aussage<br />
Experte 5<br />
Hohes Innovationsbudget, viele neuartige<br />
Dienstleistungskonzepte, hohe Einbindung<br />
erneuerbarer Energieträger in die Stromerzeugung,<br />
Vernetzung dezentraler Systeme,<br />
hohe Dekonzentration des Marktes ist förderlich<br />
für Innovationstätigkeit<br />
Aufgrund unterschiedl. Umweltzielsetzungen<br />
zw. den Szen. ist Variation der Innovationstätigkeit<br />
zw. Szen. nicht vergleichbar<br />
Urteilssicherheit<br />
Nicht angegeben<br />
Kostendeckende A = B = C = D Marktstruktur Dekonzentration Dekonzentration Oligopol Oligopol 3<br />
Preise für lnvestitionskosten<br />
Experte 1<br />
Preiserhöhungen 1%/a 1,5%/a 2%/a 2,5%/a<br />
Unternehmen investieren nur, wenn ihre Kosten<br />
gedeckt werden<br />
C > D > B > A Preisstruktur, verbrauchs-abhängige Komponente<br />
Hoch Hoch niedrig Hoch 2<br />
Experte 2<br />
Preissteigerungen für Strom/Gas 1%/a 1,5%/a 2%/a 2,5%/a<br />
Stromnachfrage Rückgang konstant mäßig steigend konstant<br />
Finanzierungsbeding 6%/a 6%/a 9%/a 6%/a<br />
.Liberalisierungsdruck hoch hoch niedrig niedrig<br />
Senkung der Einnahmemögl. durch hohe verbrauchs-/<br />
leistungsabhängige Komponente des<br />
Preises, stärkerer Liberalisierungsdruck sowie<br />
rückläufige Entwicklung der Stromnachfrage<br />
A = B = C = D<br />
Experte 5<br />
Langfristig werden Produkte nur angeboten,<br />
wenn stets die Kosten gedeckt sind.<br />
Nicht angegeben<br />
A = B = C = D Kostendeckende Preise in allen Szen. gegeben,<br />
da diese auf den Konsumenten überge-<br />
Experte 7<br />
wälzt werden
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Kostendeckende A = B = C = D Marktstruktur Dekonzentration Dekonzentration Oligopol Oligopol 3<br />
Preise für Betriebskosten<br />
Experte 1<br />
D > C > B > A<br />
Experte 2<br />
A = B = C = D<br />
Experte 5<br />
A = B = C = D<br />
Experte 7<br />
Preiserhöhungen<br />
1%/a 1,5%/a 2%/a 2,5%/a<br />
Urteilssicherheit<br />
Unternehmen betreiben ihre Anlagen nur, wenn<br />
ihre Kosten gedeckt werden<br />
Preisstruktur, verbrauchs-abhängige Komponente<br />
Hoch Hoch niedrig Hoch 2<br />
Preissteigerungen für Strom/Gas 1%/a 1,5%/a 2%/a 2,5%/a<br />
Stromnachfrage Rückgang konstant mäßig steigend konstant<br />
Finanzierungsbeding. 6%/a 6%/a 9%/a 6%/a<br />
Liberalisierungsdruck hoch hoch niedrig niedrig<br />
Senkung der Einnahmemögl. durch hohe<br />
verbrauchs-/ leistungsabhängige Komponente<br />
des Preises, stärkerer Liberalisierungsdruck<br />
sowie rückläufige Entwicklung der Stromnachfrage<br />
Langfristig werden Produkte nur angeboten,<br />
Nicht angegeben<br />
wenn stets die Kosten gedeckt sind.<br />
Kostendeckende Preise in allen Szen. gegeben,<br />
da diese auf den Konsumenten übergewälzt<br />
werden<br />
Nicht angegeben<br />
283 A.3.4 Wirtschaftliche Aspekte
284 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Urteilssicherheit<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Kostendeckende A = B > C > D Umweltpolitische Vorgaben Marktwirtschaftliche Marktwirtschaftliche Marktwirtschaftliche Marktwirtschaftliche 3<br />
Preise für interna- Experte 1 Preissteigerungen für Strom/Gas Instrumente Instrumente Instrumente Instrumente<br />
Marktstruktur 1%/a 1,5%/a 2%/a 2,5%/a<br />
lisierte Kosten<br />
B C Internalisierung abh. v. umweltpol. Vorgaben<br />
Dekonzentration Dekonzentration Oligopol Oligopol<br />
D > C > B > A<br />
Experte 2<br />
A = B = C = D<br />
Experte 5<br />
A = B = C = D<br />
Experte 7<br />
Hohes Preisniv.<br />
schränkt Spielraum<br />
für weitere Kostenaufschläge<br />
ein<br />
Preisstruktur, verbrauchs-abhängige Komponente<br />
Hoch Hoch niedrig Hoch 1<br />
Preissteigerungen für Strom/Gas 1%/a 1,5%/a 2%/a 2,5%/a<br />
Stromnachfrage Rückgang konstant mäßig steigend konstant<br />
Finanzierungsbeding. 6%/a 6%/a 9%/a 6%/a<br />
Liberalisierungsdruck hoch hoch niedrig niedrig<br />
Senkung der Einnahmemögl. durch hohe verbrauchs-/<br />
leistungsabhängige Komponente des<br />
Preises, stärkerer Liberalisierungsdruck sowie<br />
rückläufige Entwicklung der Stromnachfrage<br />
Da langfristig Produkte nur angeboten werden,<br />
wenn stets die Kosten gedeckt sind, werden<br />
auch internalisierte Kosten in allen Szen.<br />
gedeckt; Im Einzelnen ist jedoch aus den<br />
Szenariobeschreibungen nicht ableitbar,<br />
inwieweit sich Szenarien quantitativ voneinander<br />
unterscheiden.<br />
Kostendeckende Preise in allen Szen. gegeben,<br />
da diese auf den Konsumenten übergewälzt<br />
werden<br />
Nicht angegeben<br />
Nicht angegeben
Ziele Vergleich Gesichtspunkte Szenarien Urteils-<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D sicherheit<br />
Kostendeckende D > C > B > A Preisstruktur, verbrauchs-abhängige Komponente<br />
Hoch Hoch niedrig Hoch 0<br />
Preise für Abgaben Experte 2<br />
Preissteigerungen für Strom/Gas 1%/a 1,5%/a 2%/a 2,5%/a<br />
Stromnachfrage Rückgang konstant mäßig steigend konstant<br />
Finanzierungsbeding. 6%/a 6%/a 9%/a 6%/a<br />
Liberalisierungsdruck hoch hoch niedrig niedrig<br />
Verringerung der Einnahmemögl durch hohe<br />
verbrauchs-/ leistungsabhängige Komponente<br />
des Preises, stärkerer Liberalisierungsdruck<br />
sowie durch rückläufige Entwicklung der<br />
Stromnachfrage<br />
A = B = C = D Langfristig werden Produkte nur angeboten,<br />
wenn stets die Kosten gedeckt sind.<br />
Experte 5<br />
A = B = C = D<br />
Experte 7<br />
Kostendeckende Preise in allen Szen. gegeben,<br />
da diese auf den Konsumenten übergewälzt<br />
werden<br />
Einkommens- A=C>B>D Wirtschaftswachstum 2%/a 1,5%/a 2%/a 1%/a 3<br />
steigerung Experte 1 annähernd konstant annähernd konstant annähernd konstant annähernd konstant<br />
Bevölkerungsentwicklung<br />
Anstieg des BIP bei konstanter Bevölkerung<br />
deutet auf Einkommenssteigerung hin.<br />
Keine Aussage<br />
Experte 2<br />
A=C>B>D<br />
Experte 5<br />
A>B=C=D<br />
Experte 7<br />
Einkommen steigt<br />
um über 60%<br />
Einkommen steigt<br />
um über 45%<br />
Einkommen steigt<br />
um über 60%<br />
Einkommen steigt<br />
um über 25%<br />
Allg. wirtsch. Entw. Deutschlands dürfte hier<br />
1<br />
dominieren, jedoch darf m. E. nicht eine exogen<br />
vorgegebene Randbedingung Kriterium für die<br />
Bewertung eines Szen. sein.<br />
Wirtschaftswachstum 2%/a 1,5%/a 2%/a 1%/a Nicht angegeben<br />
Szenariounterschiede hinsichtlich Wirtschaftswachstum;<br />
eigenständige Größe Einkommenssteigerung<br />
kann es folglich nicht geben.<br />
Anteil dezentr. Technologien<br />
Produktivitätszuwachs abh. von Anteil dezentr.<br />
(neuer) Technologien<br />
Beschäftigung abh. von Produktivität<br />
Beschäftigungszuwachs führt zu Einkommenssteigerung<br />
Am höchsten niedriger niedriger niedriger Nicht angegeben<br />
285 A.3.4 Wirtschaftliche Aspekte
286 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Szenarien<br />
Gesichtspunkte<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Szenarien<br />
A B C D<br />
Einkommens- A= B= C»D Wirtschaftswachstum 2%/a 1,5%/a 2%/a 1%/a 3<br />
sicherung Experte 1 Bevölkerungsentwicklung annähernd konstant annähernd konstant annähernd konstant annähernd konstant<br />
Urteilssicherheit<br />
Hohe Einkommenssteigerung lässt hohen<br />
breite Masse der<br />
Spielraum für Einkommenssicherung<br />
Bevölk. leidet an<br />
Beschäftigungsmangel,<br />
daher<br />
erhebl. Schwierigkeiten<br />
bei der<br />
Einkommenssich.<br />
Keine Aussage Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 1<br />
Experte 2<br />
Deutschlands dürfte hier dominieren, jedoch<br />
darf m. E. nicht eine exogen vorgegebene<br />
Randbedingung Kriterium f. d. Bew. eines<br />
Szenarios sein.<br />
Keine Aussage Einkommensentwicklung im Szenariozeitraum<br />
Nicht angegeben<br />
Experte 5<br />
festgelegt, daher Frage, inwieweit durch<br />
Struktur des Sozialprodukts Einkommensentw.<br />
nach der Szenarioperiode beeinflusst wird.<br />
Jedoch liegen für benötigte Rahmenbedingungen<br />
der nachfolgenden Zeit keine Angaben vor.<br />
A>B=C=D<br />
Experte 7<br />
Anteil dezentr. Technologien<br />
Produktivitätszuwachs abh. von Anteil dezentr.<br />
(neuer) Technologien<br />
Beschäftigung abh. von Produktivität<br />
Beschäftigungszuwachs führt zu Einkommenssteigerung<br />
Am höchsten niedriger niedriger niedriger Nicht angegeben
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Effizienz der A>B>C>D Instrumente Einsatz von Einsatz eines vorwiegend Einsatz Konzentration auf 3<br />
Urteilssicherheit<br />
Leistungserstellung<br />
(Strom/Gas)<br />
Experte 1<br />
hoher Wettbewerb fördert gesamtwi. Effizienz<br />
Ordnungspolitische Instrumente sind u.U. im<br />
Hinblick auf umweltpol. Ziele effizienter als<br />
marktwirtschaftliche.<br />
Instrumenten mit<br />
exakter Zielerreichung<br />
(z.B. Emissionshandel)<br />
Policy-Mixes<br />
markwirtschaftlicher<br />
Instrumente<br />
markwirtschaftliche<br />
Instrumente<br />
C = D»A = B Anteil a. d. Stromerzeug.: 1<br />
Experte 2 Kernkraft 0% 0% 20% 20%<br />
Erdgas 45% 45% 17% 17%<br />
Erneuerbare Energien 30% 30% 10% 10%<br />
Marktstruktur Dekonzentration Dekonzentration Oligopol Oligopol<br />
hohe Kosten durch Investition in neue Anlagen hoch hoch gering gering<br />
A> B > C > D<br />
Experte 5<br />
Effizienz ausgedrückt durch Einheit erzeugten<br />
Stroms<br />
Verbraucherpreisentwicklung für Energie bis<br />
2025 im Vergl. zu Szen. A<br />
12,7% 26,6% 41,8% Nicht angegeben<br />
Verbraucherpreisentwicklung als<br />
Effizienzkriterium aufgrund v. Angaben<br />
in Szen.<br />
Aussagen über Kosteneffizienz als Kriterium<br />
nicht möglich, da Kosten in den einzelnen<br />
Szen. aufgrund unterschiedl. Produkte/ Leistungen<br />
nicht miteinander vergleichbar sind<br />
Effizienz der B = C > D > A Anteil dezentraler Technologien Am höchsten Niedrig Niedrig Nicht ganz so hoch 3<br />
Leistungserstellung<br />
(Wasser)<br />
Experte 7<br />
Kosten der <strong>Versorgung</strong> sind abh. v. Nutzung<br />
dezentr. Systeme<br />
287 A.3.4 Wirtschaftliche Aspekte
288 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Innovations- B > C > A> D Innovationsbudget +/-10% +50%(+) +50%(+) -50%(-) 3<br />
fähigkeit Experte 1 Marktstrukturen Dekonzentration Dekonzentration Oligopole Oligopole<br />
Preissteigerungen für Strom/Gas 1%/a 1,5%/a 2%/a 2,5%/a<br />
(Strom/Gas) Förderung Innovationsfähigkeit durch politische wg Neuaufbau von wg. hoher F&E hohes Potenzial für wg. geringer F&E<br />
Nicht angegeben<br />
Innovationsfähigkeit<br />
(Wasser)<br />
Impulse (z.B. F&E) gefördert.<br />
Strukturen wenig<br />
Spielraum für<br />
weitere Innovationen<br />
Ausgaben relativ<br />
hohes Potenzial<br />
Neuerungen<br />
Ausgaben relativ<br />
geringes Potenzial<br />
A>B>C=D Marktstrukturen Dekonzentration Dekonzentration Oligopol Oligopol 2<br />
Experte 2 Dienstleistungsumfang hoch niedrig Nicht ganz so hoch niedriger<br />
Keine Aussage<br />
Experte 5<br />
B=C>A>D<br />
Experte 6<br />
Zwang v. kl. Unt. bei starkem Wettbewerb zu<br />
Innovationen; Annahme schlechterer Ausgangsbedingung<br />
bei kleinen als bei großen Unt.<br />
Da Umweltzielsetzungen zw. Szen. sich unterscheiden,<br />
variiert auch Innovationsfähigkeit zw.<br />
Szen.<br />
Urteilssicherheit<br />
Innovationsbudget ++ ++ Nicht angegeben<br />
Förderung von Innovation führt zu Neuentwicklungen
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Urteilssicherheit<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
A B C D<br />
Anpassungs- B > A = C > D Gas- und Stromverbrauch Sinkt(+) Konstant Steigt mäßig an(-) Konstant Nicht angegefähigkeit<br />
an Markt- Experte 1 Deckung Ersatzbedarf v. kl/mittleren KW 50% 30%<br />
ben<br />
Marktdurchdringung DSM (als Neue Techniken 20%(-)<br />
10%<br />
30°/0 30%<br />
erfordernisse<br />
a. d. Endverbraucherseite)<br />
15%<br />
10%<br />
Virtuelle Kraftwerke stark ausgeprägt vereinzelt<br />
Anteil a. d. Stromerzug.:<br />
dezentraler Technologien 22,5%(+)<br />
14%(+)<br />
Ausnahme<br />
keine<br />
Kohle gering(+) gering(+) 8,5% 7%<br />
Erdgas steigt(+) steigt(+) hoch(-) hoch(-)<br />
Erneuerbare Energien 30%(+) 30%(+) steigt gering(-) steigt gering(-)<br />
Kernkraft 0% 0%<br />
10%(-) 10%(-)<br />
20%(-) 20%(-)<br />
Kleine KW sind flexibler austauschbar; Inv.-<br />
kosten f. Gas-KW gering => kurze Amortisationsdauer.<br />
Preis-/Kostendruck führt z. Hinauszögerung<br />
v. Investitionen<br />
Einspartechniken erfordern hohe Inv., die sich<br />
u.U. erst langfr auszahlen<br />
A = B > C = D Marktstrukturen Dekonzentration Dekonzentration Oligopol Oligopol 1<br />
Experte 2<br />
Dienstleistungsumfang hoch niedrig Nicht ganz so hoch niedriger<br />
Bei stärker wettbewerbl. orientiertem Markt,<br />
großer Technologie- und DL-Vielfalt müssen<br />
insbes. kI. Unt. flexibel sein, um wirtschaftl. zu<br />
überleben<br />
In allen Szenarien passen sich Unternehmen a.<br />
d. jeweiligen Bed. an.<br />
A = B = C = D<br />
Experte 5<br />
A>B>C=D Marktstruktur Polypolistisch Polypolistisch Oligopolistisch Oligopolistisch 3<br />
Experte 7<br />
Anteil dezentraler Systeme Am höchsten Nicht ganz so hoch niedriger niedriger<br />
Viele kleine Unternehmen sind anpassungsfähiger<br />
als wenige große Versorger<br />
Dezentr. Systeme ermögl. flexibl. Reaktion auf<br />
Binnenmigration<br />
Nicht angegeben<br />
289 A.3.4 Wirtschaftliche Aspekte
290 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Aufbau und Ent- C = D > B > A Neue Techn. a. Endverbraucherseite z.B. DSM 20%(-) 10% 15% 10% 4<br />
wicklung von Experte 1 Gas- und Stromverbrauch sinkt(+) konstant steigt mäßig(-) konstant<br />
Deckung Ersatzbedarf v. kl/mittl. KW 50%(+) 30%(+) 30% 30%<br />
Wissen zu beste- B ,-. A Anteil a. d. Stromerzeug.<br />
henden Technolo- Dezentrale Anlagen 22,5%, hoch(+) 14% 8,5% 7%<br />
gien Erneuerbare Energien steigt(+) steigt(+) 10%(-) 10%<br />
Erdgas steigt(+) steigt(+) steigt gering(-) steigt gering<br />
Kohle gering(+) gering(+) hoch(-) hoch<br />
Kernkraft 0% 0% 20%(-) 20%<br />
Urteilssicherheit<br />
Beim Einsatz „alter" Technologien bleibt das<br />
Wissen über diese erhalten<br />
C = D»A = B Anteil Kernenergie 0% 0% 20% 20% 3<br />
Experte 2<br />
Nutzung v. Kernenergie führt zu Wissen in<br />
diesem Technologiebereich<br />
A = B = C = D<br />
Experte 5<br />
Bestehende Technolog. kommen (wenn auch in<br />
unterschiedlichem Umfang) mit Ausnahme<br />
Kernenergie in allen Szen weiter vor. Insofern<br />
ist Erhalt v. Wissen bzgl. bestehender Technolog.<br />
in allen Szen. gegeben<br />
Frage nach erforderlicher Infrastruktur (Ausbildung,<br />
Forschung) wird in Szenarien nicht<br />
angesprochen<br />
Nicht angegeben
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenerien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Erhalt und Ent- A>C>B>D Multi-Utility überwiegt Steigt an Steigt an Steigt an 3<br />
wicklung institutio- Experte 1 Anlagencontracting 30%(+) 5%(-) 30%(+) 10%(-)<br />
Rundum-Sorglos Pakete 15%(+) 5%(-) 20%(+) 10%(-)<br />
Heller Innovationen Marktstruktur Dekonzentration Dekonzentration Oligopol Oligopol<br />
Innovationsbudget +/-10% +50% +50% -50%<br />
Aktivitäten in neuen Arbeitsfeldern führen zu<br />
institut. Veränderungen<br />
Bei vielen Versorgern mit geringen Marktanteilen,<br />
wenig Kapitalkraft bei hartem Wettbewerb<br />
wird eigene Forschung die Ausnahme sein,<br />
Kooperation mit öffentlichen Forschungseinrichtungen<br />
die Regel<br />
A = B = C = D Keine eindeutigen Hinweise auf deutliche 2<br />
Unterschiede zwischen den Szenarien<br />
Experte 2<br />
Keine Aussage<br />
Experte 5<br />
Beim Erhalt institut. Innov handelt es sich<br />
weniger um ein Ziel als um die Form, in der<br />
andere Ziele umgesetzt werden<br />
A>B=C>D Dienstleistungsumfang Am höchsten Niedriger Niedriger Niedrig 3<br />
Experte 7 Anpassungsfähigkeit staatl. Vorschriften Am höchsten Niedriger Niedriger Niedrig<br />
Positive Weiterentwicklung des Wissenskapitals<br />
und institut. Innovationen in den Szen. A bis C,<br />
keine Weiterentw. in D aufgrund Rückzug des<br />
Staates<br />
Urteilssicherheit<br />
Nicht angegeben<br />
291 A.3.4 Wirtschaftliche Aspekte
292 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Gesichtspunkte<br />
Szenarien<br />
Szenarien Einträge in kursiv oder fett kursiv sind nicht A B C D<br />
vom Experten sondern vom Bearbeiter<br />
Aufbau und Ent- A>B>C>D Neue Technol. a. Endverbraucherseite (DSM) 20%(+) 10% 15% 10% 4<br />
wicklung von Experte 1 Deckung Ersatzbedarf kl/mittl. Unt. 50%(+) 30%(+) 30% 30%<br />
Virtuelle Kraftwerke stark ausgeprägt(+) Vereinzelt Ausnahme keine<br />
Wissen zu neuen Innovationsbudget +/-10% +50%(+) +50%(+) -50%(-)<br />
Technologien<br />
Anteil a. d. Stromerzeug.<br />
(Strom/Gas) Dezentrale Anlagen 22,5%(+) 14% 8,5% 7%<br />
Erneuerbare Energien steigt(+) steigt(+) 10%(-) 10%(-)<br />
Erdgas steigt(+) steigt(+) steigt gering(-) steigt gering(-)<br />
Kohle gering(+) gering(+) hoch(-) hoch(-)<br />
Umschlagszeiten nehmen ab konstant nehmen ab(-) konstant<br />
Beim Einsatz n. Techn. wird Wissen aufgebaut<br />
Durch F&E Ausgaben wird Aufbau v. Wissen<br />
gefördert<br />
A>B>C=D Anteil a d. Stromerzeug.: 3<br />
Experte 2 Dezentrale Anlagen 22,5% 14% 8,5% 7%<br />
Erneuerbare Energien 30% 30% 10% 10%<br />
Urteilssicherheit<br />
Hoher Einsatz v. neuen Technologien und<br />
Dienstleistungen führt zum Aufb. v. Wissen zu<br />
neuen Technologien<br />
A>B>C>D Anteil a. d. Stromerzeug. Nicht angege-<br />
Experte 5 Dezentrale Anlagen 22,5% 14% 8,5% 7% ben<br />
Erneuerbare Energien 30% 30% 10% 10%<br />
Aufbau und Entwicklung<br />
von<br />
Wissen zu neuen<br />
Technologien<br />
(Wasser)<br />
B=C>A>D<br />
Experte 6<br />
Diffusionsprozess des Wissens für neue Technologien<br />
ist in Szen. mit größerem Anteil<br />
neuerer Technologien größer<br />
Innovationsbudget<br />
Förderung von Innovation führt zu Neuentwicklungen<br />
++ ++ Nicht angegeben
A.3.5 Soziale Aspekte<br />
Ziele<br />
Vergleich<br />
Szenarien<br />
Gesichtspunkte<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv<br />
sind nicht vom Experten sondern<br />
vom Bearbeiter<br />
Szenarien<br />
A B C D<br />
Urteilssicherheit<br />
Sozialvertr. Preise A> B > C > D Energiepreisanstieg 1%a 1,5%/a 2%/a 2,5%/a 2<br />
Experte 11 Wirtschaftswachstum 2%/a 1,5%/a 2%/a 1%/a<br />
Gleichberechtigter Zu- B > A» C >D Umwelt- und Preislabeling Geringer, da Basis Am Höchsten, da Nur Preislabeling Nur Preislabeling 3<br />
gang zu Ressourcen von Experte 11<br />
Umwelt- und Preislabeling als gesellschaftlicher staatlich verordnet<br />
soziale Standards zum Schutz Konsens<br />
HH, öffentl. Einrichtun-<br />
aller Bev- Gruppen<br />
gen und Unt.<br />
Rahmenbedingungen und<br />
Standards z. Wahrung der<br />
Auf Basis gesellsch.<br />
Konsenses<br />
Staatlich Verordnet Staatliche Orientierung<br />
ausschließlich<br />
Staatliche<br />
Orientierung an<br />
Gewährleistung einer B>A»c.D Interessen aller Bevölkerungstei- auf Wettbewerbsfä- Wirtschaftlich- 3<br />
le. higkeit der Wirtschaft keitskriterien bei<br />
Grundversorgung für alle Experte 11<br />
Rückzug des<br />
Faire Rechts- und Ver- B>A»C>D<br />
Höhere soziale Gerechtigkeit bei<br />
Staates<br />
staatl. Regie 3<br />
tragsgestaltung zur Experte 11 Innovationsbudget +/- 10% +50% +50% -50%,<br />
<strong>Versorgung</strong> für alle<br />
Innovationsbudget soll Vermind. Gefahr der Zielver- Ausreichende Ausreichende Keine Implemenv.<br />
Vertretbares B>A»C>D Inv. b. neuen Tech. ermögli- fehlung aufgrund zu Förderungsmasse mit Fördermasse, jedoch tation v. neuen<br />
chen, jedoch Budgetausrichtung geringer Masse gruppenspezifischer keine spezif. Fest- Technologien 3<br />
Wohlstandsgefälle Experte 11 als Bev- Gruppenspez. Einführungsprogr.<br />
führt zu soz. Gerech-<br />
Ausrichtung<br />
legung zugunsten<br />
sozialer Gruppen<br />
möglich, die nicht<br />
bei Einf. wettbe-<br />
Geschlechtergerech- B > A» C = D tigk. werbsfähig sind<br />
tigkeit Experte 11<br />
Unternehmenskonzentration<br />
Hohe Unternehmenskonzentration<br />
führen zu Machtpotenzial,<br />
das schwer beeinflussbar ist<br />
mit mögl. gravierenden Auswirkungen<br />
bzgl. Ziele sozialer<br />
Gerechtigkeit<br />
Einsatzbreite d. Instr.<br />
Differenzierung der Zielperspektive<br />
Abh. sozialer Akzeptanz von<br />
Breite der Instr. u. Differenzierunsgrad<br />
d. Zielperspektive<br />
Polipolistische<br />
Marktstrukturen<br />
Geringer<br />
Polipolistische<br />
Marktstrukturen<br />
Am höchsten<br />
Oligopole<br />
Geringsten<br />
Oligopole<br />
Geringsten<br />
3<br />
293 A.3.5 Soziale Aspekte
294 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Internat. Verteilungsgerechtigkeit<br />
der Ressourcennutzung<br />
Gleichheit der Lebensverhältnisse<br />
Vergleich<br />
Szenarien<br />
A> B > C = D<br />
Experte 11<br />
B>A>C>D<br />
Experte 11<br />
Gesichtspunkte<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv<br />
sind nicht vom Experten sondern<br />
vom Bearbeiter<br />
Unternehmenskonzentration<br />
Polipolistische<br />
Marktstrukturen<br />
Szenarien<br />
A B C D<br />
Polipolistische<br />
Marktstrukturen<br />
Hohe Unternehmenskonzentration<br />
führen zu Machtpotenzial,<br />
das schwer beeinflussbar ist<br />
mit mögl. gravierenden Auswirkungen<br />
bzgl. Ziele regionaler<br />
Sicherheit<br />
Einsatzbreite d. Instr. Geringer Am höchsten Geringsten Geringsten<br />
Differenzierung der Zielperspektive<br />
Urteilssicherheit<br />
Oligopole Oligopole 3<br />
3<br />
Abh. sozialer Akzeptanz von<br />
Breite der Instr. u. Differenzierunsgrad<br />
d. Zielperspektive<br />
Partizip./Gesellschaftl. A» B > C = D Öffentl. Konsensbildung Steht im Vordergrund Geringer Am geringsten Am geringsten 3<br />
Zielformulierung<br />
Partizip./Planungsverf.<br />
Verständlichk. d.<br />
Verbraucher-Info.<br />
Angabe d. Höhe d.<br />
Preise<br />
Experte 11<br />
A> B > C = D<br />
Experte 11<br />
B > A» C = D<br />
Experte 11<br />
B > A> C = D<br />
Experte 11<br />
Kombination hoher Standards<br />
bzgl. Partizipation, Transparenz,<br />
Erhalt soz. Res. ermöglichen<br />
hohe Akzeptanz v. Technol./<br />
Produkten<br />
Transparenzbreite<br />
Kombination hoher Standards<br />
bzgl. Partizipation, Transparenz,<br />
Erhalt soz. Res. ermöglichen<br />
hohe Akzeptanz v. Technol./<br />
Produkten<br />
Verständl. d. Verbr.<br />
Info.<br />
Preishöhe,<br />
Preisbestandteilen,<br />
Öko-Anforderungen,<br />
Marktstrukturen<br />
Preishöhe,<br />
Öko-Anforderungen<br />
Preishöhe Preishöhe 3<br />
Angabe B>A»C=D 3<br />
Ausschließliche Transparenz b.<br />
Preisbestandteile Experte 11 Preisen u. Öko-Anforderungen<br />
findet nur bedingt Akzeptanz<br />
Angabe Leistungsbestandteile<br />
B > A» C = D<br />
Experte 11<br />
Angabe Marktstrukturen B > A» C = D 3<br />
Experte 11<br />
3<br />
4<br />
3
Ziele<br />
Vermeidung von Armut<br />
Erhalt sozialer Sicherungssysteme<br />
Vergleich<br />
Szenarien<br />
A> B > C > D<br />
Experte 11<br />
A>B>C>D<br />
Experte 11<br />
Gesichtspunkte<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv<br />
sind nicht vom Experten sondern<br />
vom Bearbeiter<br />
Unternehmenskonzentration<br />
Ho he Unterne hmens konzentration<br />
führen zu Machtpotenzial,<br />
das schwer beeinflussbar ist<br />
mit mögl. gravierenden Auswir-<br />
Polipolistische<br />
Marktstrukturen<br />
Szenarien<br />
A B C D<br />
Polipolistische<br />
Marktstrukturen<br />
Urteilssicherheit<br />
Oligopole Oligopole 3<br />
Sich. angemessener A> B > C > D kungen bzgl. Ziele sozialer 3<br />
Mindestlöhne Experte 11 Sicherheit<br />
Sicherung humaner A> B > C > D 3<br />
Arbeitsbedingungen Experte 11<br />
3<br />
Sozialverträgl. Gestaltung<br />
des Beschäftigungswandels<br />
Übernahme v. Verantwortung<br />
d. Gesellschaft f.<br />
nachfolgende Generationen<br />
A> B > C > D<br />
Experte 11<br />
A> B > C = D<br />
Experte 11<br />
Kombination hoher Standards<br />
bzgl. Partizipation, Transparenz,<br />
Erhalt soz. Res. ermöglichen<br />
hohe Akzeptanz v. Technol./<br />
Produkten<br />
Innovationsbudget +/- 10% +50% +50% -50%,<br />
Übernahme v. Verantw. v. A> B > C > D<br />
Innovationsbudget soll Vermind. Gefahr der Zielverfehlung<br />
aufgrund zu Förderungsmasse mit Fördermasse, jedoch tation v. neuen<br />
ausreichende ausreichende Keine Implemen-<br />
Unt. in Entwicklungslän - Experte 111 v. Inv. b. neuen Tech. ermöglidern<br />
chen, jedoch Budgetausrichtung geringer Masse gruppenspezifischer keine spezif. Festlegung<br />
Technologien<br />
als Bev- Gruppenspez. Einführungsprogr.<br />
Ausrichtung<br />
zugunsten möglich, die nicht<br />
führt z. Erh. soz. Res.<br />
sozialer Gruppen bei Einf. wettbe-<br />
werbsfähig sind<br />
Unternehmenskonzentration Polipolistische Polipolistische Oligopole Oligopole<br />
Marktstrukturen Marktstrukturen<br />
Hohe Unternehmenskonzentration<br />
führen zu Machtpotenzial,<br />
das schwer beeinflussbar ist<br />
mit mögl. gravierenden Auswirkungen<br />
bzgl. Ziele sozialer<br />
Sicherheit<br />
3<br />
3<br />
3<br />
295 A.3.5 Soziale Aspekte
296 A.3. Synthesepapier (Zusammenstellung der Einschätzungen der Experten)<br />
Ziele<br />
Übernahme v. Verantw.<br />
der VU's f. Daseinsvorsorge<br />
Vergleich<br />
Szenarien<br />
A> B > C > D<br />
Experte 11<br />
Gesichtspunkte<br />
Einträge in kursiv oder fett kursiv<br />
sind nicht vom Experten sondern<br />
vom Bearbeiter<br />
Kombination hoher Standards<br />
bzgl. Partizipation, Transparenz,<br />
Erhalt soz. Res. ermöglichen<br />
hohe Akzeptanz v. Technol./<br />
Produkten<br />
Innovationsbudget<br />
+/- 10%<br />
Szenarien<br />
A B C D<br />
+50%<br />
+50%<br />
-50%,<br />
Urteilssicherheit<br />
3<br />
Innovationsbudget soll Vermind. Gefahr der Zielver- ausreichende ausreichende Keine Implemenv.<br />
Inv. b. neuen Tech. ermögli- fehlung aufgrund zu Förderungsmasse mit Fördermasse, jedoch tation v. neuen<br />
chen, jedoch Budgetausrichtung geringer Masse gruppenspezifischer keine spezif. Festlegung<br />
Technologien<br />
als Bev- Gruppenspez. Einführungsprogr.<br />
Ausrichtung<br />
zugunsten möglich, die nicht<br />
sozialer Gruppen bei Einf. wettbe-<br />
werbsfähig sind
Schriften des Forschungszentrums Jülich<br />
Reihe Umwelt / Environment<br />
1. Energiemodelle in der Bundesrepublik Deutschland. Stand der Entwicklung<br />
IKARUS-Workshop vom 24. bis 25. Januar 1996<br />
herausgegeben von S. Molt, U. Fahl (1997), 292 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-205-3<br />
2. Ausbau erneuerbarer Energiequellen in der Stromwirtschaft<br />
Ein Beitrag zum Klimaschutz<br />
Workshop am 19. Februar 1997, veranstaltet von der Forschungszentrum Jülich<br />
GmbH und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft<br />
herausgegeben von J.-Fr. Hake, K. Schultze (1997), 138 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-206-1<br />
3. Modellinstrumente für CO2-Minderungsstrategien<br />
IKARUS-Workshop vom 14. bis 15. April 1997<br />
herausgegeben von J.-Fr. Hake, P. Markewitz (1997), 284 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-207-X<br />
4. IKARUS-Datenbank - Ein Informationssystem zur technischen,<br />
wirtschaftlichen und umweltrelevanten Bewertung von Energietechniken<br />
IKARUS. Instrumente für Klimagas-Reduktionsstrategien<br />
Abschlußbericht Teilprojekt 2 „Datenbank"<br />
H.-J. Laue, K.-H. Weber, J. W. Tepel (1997), 90 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-214-2<br />
5. Politikszenarien für den Klimaschutz<br />
Untersuchungen im Auftrag des Umweltbundesamtes<br />
Band 1. Szenarien und Maßnahmen zur Minderung von CO 2-Emissionen in<br />
Deutschland bis zum Jahre 2005<br />
herausgegeben von G. Stein, B. Strobel (1997), 410 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-215-0<br />
6. Politikszenarien für den Klimaschutz<br />
Untersuchungen im Auftrag des Umweltbundesamtes<br />
Band 2. Emissionsminderungsmaßnahmen für Treibhausgase,<br />
ausgenommen energiebedingtes CO2<br />
herausgegeben von G. Stein, B. Strobel (1997), 110 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-216-9<br />
7. Modelle für die Analyse energiebedingter Klimagasreduktionsstrategien<br />
IKARUS. Instrumente für Klimagas-Reduktionsstrategien<br />
Abschlußbericht Teilprojekt 1 „Modelle"<br />
P. Markewitz, R. Heckler, Ch. Holzapfel, W. Kuckshinrichs, D. Martinsen,<br />
M. Walbeck, J.-Fr. Hake (1998), VI, 276 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-220-7
Schriften des Forschungszentrums Jülich<br />
Reihe Umwelt / Environment<br />
8. Politikszenarien für den Klimaschutz<br />
Untersuchungen im Auftrag des Umweltbundesamtes<br />
Band 3. Methodik-Leitfaden für die Wirkungsabschätzung von Maßnahmen<br />
zur Emissionsminderung<br />
herausgegeben von G. Stein, B. Strobel (1998), VIII, 95 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-222-3<br />
9. Horizonte 2000<br />
6. Wolfgang-Ostwald-Kolloquium der Kolloid-Gesellschaft<br />
3. Nachwuchstage der Kolloid- und Grenzflächenforschung<br />
Kurzfassungen der Vorträge und Poster<br />
zusammengestellt von F.-H. Haegel, H. Lewandowski, B. Krahl-Urban (1998),<br />
150 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-223-1<br />
10. Windenergieanlagen - Nutzung, Akzeptanz und Entsorgung<br />
von M. Kleemann, F. van Erp, R. Kehrbaum (1998), 59 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-224-X<br />
11. Policy Scenarios for Climate Protection<br />
Study an Behalf of the Federal Environmental Agency<br />
Volume 4. Methodological Guideline for Assessing the Impact of Measures<br />
for Emission Mitigation<br />
edited by G. Stein, B. Strobel (1998), 103 pages<br />
ISBN: 3-89336-232-0<br />
12. Der Landschaftswasserhaushalt im Flußeinzugsgebiet der Elbe<br />
Verfahren, Datengrundlagen und Bilanzgrößen<br />
Analyse von Wasserhaushalt, Verweilzeiten und Grundwassermilieu im<br />
Flußeinzugsgebiet der Elbe (Deutscher Teil). Abschlußbericht Teil 1.<br />
von R. Kunkel, F. Wendland (1998), 110 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-233-9<br />
13. Das Nitratabbauvermögen im Grundwasser des Elbeeinzugsgebietes<br />
Analyse von Wasserhaushalt, Verweilzeiten und Grundwassermilieu im<br />
Flußeinzugsgebiet der Elbe (Deutscher Teil). Abschlußbericht Teil 2.<br />
von F. Wendland, R. Kunkel (1999), 166 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-236-3<br />
14. Treibhausgasminderung in Deutschland zwischen nationalen Zielen und<br />
internationalen Verpflichtungen<br />
IKARUS-Workshop am 27.05.1998, Wissenschaftszentrum Bonn-Bad<br />
Godesberg. Proceedings<br />
herausgegeben von E. Läge, P. Schaumann, U. Fahl (1999), ii, VI, 146 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-237-1
Schriften des Forschungszentrums Jülich<br />
Reihe Umwelt / Environment<br />
15. Satellitenbildauswertung mit künstlichen Neuronalen Netzen zur<br />
Umweltüberwachung<br />
Vergleichende Bewertung konventioneller und Neuronaler Netzwerkalgorithmen<br />
und Entwicklung eines integrierten Verfahrens<br />
von D. Klaus, M. J. Canty, A. Poth, M. Voß, I. Niemeyer und G. Stein (1999),<br />
VI, 160 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-242-8<br />
16. Volatile Organic Compounds in the Troposphere<br />
Proceedings of the Workshop an Volatile Organic Compounds in the<br />
Troposphere held in Jülich (Germany) from 27 – 31 October 1997<br />
edited by R. Koppmann, D. H. Ehhalt (1999), 208 pages<br />
ISBN: 3-89336-243-6<br />
17. CO2-Reduktion und Beschäftigungseffekte im Wohnungssektor durch das<br />
CO2-Minderungsprogramm der KfW<br />
Eine modellgestützte Wirkungsanalyse<br />
von M. Kleemann, W. Kuckshinrichs, R. Heckler (1999), 29 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-244-4<br />
18. Symposium über die Nutzung der erneuerbaren Energiequellen Sonne und<br />
Wind auf Fischereischiffen und in Aquakulturbetrieben<br />
Symposium und Podiumsdiskussion, lzmir, Türkiye, 28.-30.05.1998.<br />
Konferenzbericht<br />
herausgegeben von A. Özdamar, H.-G. Groehn, K. Ülgen (1999), IX, 245 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-247-9<br />
19. Das Weg-, Zeitverhalten des grundwasserbürtigen Abflusses im<br />
Elbeeinzugsgebiet<br />
Analyse von Wasserhaushalt, Verweilzeiten und Grundwassermilieu im<br />
Flußeinzugsgebiet der Elbe (Deutscher Teil). Abschlußbericht Teil 3.<br />
von R. Kunkel, F. Wendland (1999), 122 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-249-5<br />
20. Politikszenarien für den Klimaschutz<br />
Untersuchungen im Auftrag des Umweltbundesamtes<br />
Band 5. Szenarien und Maßnahmen zur Minderung von CO 2-Emissionen in<br />
Deutschland bis 2020<br />
herausgegeben von G. Stein, B. Strobel (1999), XII, 201 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-251-7<br />
21. Klimaschutz durch energetische Sanierung von Gebäuden. Band 1<br />
von J.-F. Hake, M. Kleemann, G. Kolb (1999), 216 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-252-2
Schriften des Forschungszentrums Jülich<br />
Reihe Umwelt / Environment<br />
22. Electroanalysis<br />
Abstracts of the 8th International Conference held from 11 to 15 June 2000 at the<br />
University of Bonn, Germany<br />
edited by H. Emons, P. Ostapczuk (2000), ca. 300 pages<br />
ISBN: 3-89336-261-4<br />
23. Die Entwicklung des Wärmemarktes für den Gebäudesektor bis 2050<br />
von M. Kleemann, R. Heckler, G. Kolb, M. Hille (2000), II, 94 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-262-2<br />
24. Grundlegende Entwicklungstendenzen im weltweiten Stoffstrom des<br />
Primäraluminiums<br />
von H.-G. Schwarz (2000), XIV, 127 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-264-9<br />
25. Klimawirkungsforschung auf dem Prüfstand<br />
Beiträge zur Formulierung eines Förderprogramms des BMBF<br />
Tagungsband des Workshop „Klimaforschung", Jülich, vom 02. bis 03.12.1999<br />
von J.-Fr. Hake, W. Fischer (2000), 150 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-270-3<br />
26. Energiezukunft 2030<br />
Schlüsseltechnologien und Techniklinien<br />
Beiträge zum IKARUS-Workshop 2000 am 2./3. Mai 2000<br />
herausgegeben von U. Wagner, G. Stein (2000), 201 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-271-1<br />
27. Der globale Wasserkreislauf und seine Beeinflussung durch den Menschen<br />
Möglichkeiten zur Fernerkundungs-Detektion und -Verifikation<br />
von D. Klaus und G. Stein (2000), 183 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-274-6<br />
28. Satelliten und nukleare Kontrolle<br />
Änderungsdetektion und objektorientierte, wissensbasierte Klassifikation von<br />
Multispektralaufnahmen zur Unterstützung der nuklearen Verifikation<br />
von I. Niemeyer (2001), XIV, 206 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-281-9<br />
29. Das hydrologische Modellsystem J2000<br />
Beschreibung und Anwendung in großen Flußgebieten<br />
von P. Krause (2001), XIV, 247 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-283-5<br />
30. Aufwands- und ergebnisrelevante Probleme der Sachbilanzierung<br />
von G. Fleischer, J.-Fr. Hake (2002), IV, 64 Blatt<br />
ISBN: 3-89336-293-2
Schriften des Forschungszentrums Jülich<br />
Reihe Umwelt / Environment<br />
31. Nachhaltiges Management metallischer Stoffströme<br />
Indikatoren und deren Anwendung<br />
Workshop, 27.-28.06.2001 im Congresscentrum Rolduc, Kerkrade (NL)<br />
herausgegeben von W. Kuckshinrichs, K.-L. Hüttner (2001), 216 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-296-7<br />
32. Ansätze zur Kopplung von Energie- und Wirtschaftsmodellen zur<br />
Bewertung zukünftiger Strategien<br />
IKARUS-Workshop am 28. Februar 2002, BMWi, Bonn. Proceedings<br />
herausgegeben von S. Briem, U. Fahl (2003), IV, 184 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-321-1<br />
33. TRAGE. Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology<br />
Volume 1: Proceedings of the Dendrosymposium 2002,<br />
April 11 th — 13 th 2002, Bonn/Jülich, Germany<br />
edited by G. Schleser, M. Winiger, A. Bräuning et al., (2003), 135 pages, many<br />
partly coloured illustrations<br />
ISBN: 3-89336-323-8<br />
34. Klimaschutz und Beschäftigung durch das KfW-Programm zur CO2-<br />
Minderung und das KfW-0O2-Gebäudesanierungsprogramm<br />
von M. Kleemann, R. Heckler, A. Kraft u. a., (2003), 53 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-326-2<br />
35. Klimaschutz und Klimapolitik: Herausforderungen und Chancen<br />
Beiträge aus der Forschung<br />
herausgegeben von J.-Fr. Hake, K. L. Hüttner (2003), III, 231 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-327-0<br />
36. Umweltschutz und Arbeitsplätze, angestoßen durch die Tätigkeiten des<br />
Schornsteinfegerhandwerks<br />
Auswertung von Schornsteinfeger-Daten<br />
von M. Kleemann, R. Heckler, B. Krüger (2003), VII, 66 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-328-9<br />
37. Die Grundwasserneubildung in Nordrhein-Westfalen<br />
von H. Bogena, R. Kunkel, T. Schöbel, H. P. Schrey, F. Wendland (2003), 148<br />
Seiten<br />
ISBN: 3-89336-329-7<br />
38. Dendro-lsotope und Jahrringbreiten als Klimaproxis der letzten 1200 Jahre<br />
im Karakorumgebirge/Pakistan<br />
von K. S. Treydte (2003), XII, 167 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-330-0<br />
39. Das IKARUS-Projekt: Energietechnische Perspektiven für Deutschland<br />
herausgegeben von P. Markewitz, G. Stein (2003), IV, 274 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-333-5
Schriften des Forschungszentrums Jülich<br />
Reihe Umwelt / Environment<br />
40. Umweltverhalten von MTBE nach Grundwasserkontamination<br />
von V. Linnemann (2003), XIV, 179 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-339-4<br />
41. Climate Change Mitigation and Adaptation: Identifying Options for<br />
Developing Countries<br />
Proceedings of the Summer School an Climate Change, 7-17 September 2003,<br />
Bad Münstereifel, Germany<br />
edited by K. L. Hüttner, J.-Fr. Hake, W. Fischer (2003), XVI, 341 pages<br />
ISBN: 3-89336-341-6<br />
42. Mobilfunk und Gesundheit: Risikobewertung im wissenschaftlichen Dialog<br />
von P. M. Wiedemann, H. Schütz, A. T. Thalmann (2003), 111 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-343-2<br />
43. Chemical Ozone Loss in the Arctic Polar Stratosphere: An Analysis of<br />
Twelve Years of Satellite Observations<br />
by S. Tilmes (2004), V, 162 pages<br />
ISBN: 3-89336-347-5<br />
44. TRAGE. Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology<br />
Volume 2: Proceedings of the Dendrosymposium 2003,<br />
May i st — 3rd 2003, Utrecht, The Netherlands<br />
edited by E. Jansma, A. Bräuning, H. Gärtner, G. Schleser (2004), 174 pages<br />
ISBN: 3-89336-349-1<br />
45. Vergleichende Risikobewertung: Konzepte, Probleme und Anwendungsmöglichkeiten<br />
von H. Schütz, P. M. Wiedemann, W. Hennings et al. (2004), 231 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-350-5<br />
46. Grundlagen für eine nachhaltige Bewirtschaftung von Grundwasserressourcen<br />
in der Metropolregion Hamburg<br />
von B. Tetzlaff, R. Kunkel, R. Taugs, F. Wendland (2004), 87 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-352-1<br />
47. Die natürliche, ubiquitär überprägte Grundwasserbeschaffenheit in<br />
Deutschland<br />
von R. Kunkel, H.-J. Voigt, F. Wendland, S. Hannappel (2004), 207 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-353-X<br />
48. Water and Sustainable Development<br />
edited by H. Bogena, J.-Fr. Hake, H. Vereecken (2004), 199 pages<br />
ISBN: 3-89336-357-2<br />
49. Geo- and Biodynamic Evolution during Late Silurian / Early Devonian Time<br />
(Hazro Area, SE Turkey)<br />
by 0. Kranendonck (2004), XV, 268 pages<br />
ISBN: 3-89336-359-9
Schriften des Forschungszentrums Jülich<br />
Reihe Umwelt / Environment<br />
50. Politikszenarien für den Umweltschutz<br />
Untersuchungen im Auftrag des Umweltbundesamtes<br />
Langfristszenarien und Handlungsempfehlungen ab 2012 (Politikszenarien<br />
III)<br />
herausgegeben von P. Markewitz u. H.-J. Ziesing (2004), XVIII, 502 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-370-X<br />
51. Die Sauerstoffisotopenverhältnisse des biogenen Opals lakustriner<br />
Sedimente als mögliches Paläothermometer<br />
von R. Moschen (2004), XV, 130 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-371-8<br />
52. MOSYRUR: Water balance analysis in the Rur basin<br />
von Heye Bogena, Michael Herbst, Jürgen-Friedrich Hake, Ralf Kunkel,<br />
Carsten Montzka, Thomas Pütz, Harry Vereecken, Frank Wendland<br />
(2005), 155 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-385-8<br />
53. TRAGE. Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology<br />
Volume 3: Proceedings of the Dendrosymposium 2004,<br />
April 22 nd – 24th 2004, Birmensdorf, Switzerland<br />
edited by Holger Gärtner, Jan Esper, Gerhard H. Schleser (2005), 176 pages<br />
ISBN: 3-89336-386-6<br />
54. Risikobewertung Mobilfunk: Ergebnisse eines wissenschaftlichen Dialogs<br />
herausgegeben von P. M. Wiedemann, H. Schütz, A. Spangenberg (2005), ca.<br />
380 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-399-8<br />
55. Comparison of Different Soil Water Extraction Systems for the Prognoses<br />
of Solute Transport at the Field Scale using Numerical Simulations, Field<br />
and Lysimeter Experiments<br />
by L. Weihermüller (2005), ca. 170 pages<br />
ISBN: 3-89336-402-1<br />
56. Effect of internal leaf structures an gas exchange of leaves<br />
by R. Pieruschka (2005), 120 pages<br />
ISBN: 3-89336-403-X<br />
57. Temporal and Spatial Patterns of Growth and Photosynthesis in Leaves of<br />
Dicotyledonous Plants Under Long-Term CO2- and 03-Exposure<br />
by M. M. Christ (2005), 125 pages<br />
ISBN: 3-89336-406-4<br />
58. Öffentliche Kommunikation über Klimawandel und Sturmflutrisiken<br />
Bedeutungskonstruktion durch Experten, Journalisten und Bürger<br />
von H. P. Peters, H. Heinrichs (2005), 231 Seiten, CD<br />
ISBN: 3-89336-415-3
Schriften des Forschungszentrums Jülich<br />
Reihe Umwelt / Environment<br />
59. Umsatz verschiedener Ernterückstände in einem<br />
Bodensäulenversuchssystem — Einfluss auf die organische<br />
Bodensubstanz und den Transport zweier Xenobiotika<br />
von N. Drewes (2005), 221 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-417-X<br />
60. Evaluierung der CO2-Minderungsmaßnahmen im Gebäudebereich<br />
von M. Kleemann, P. Hansen (2005), 84 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-419-6<br />
61. TRACE. Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology<br />
Volume 4: Proceedings of the Dendrosymposium 2005,<br />
April 21 st — 23 rd 2005, Fribourg, Switzerland<br />
edited by Ingo Heinrich, Holger Gärtner, Michel Monbaron, Gerhard Schleser<br />
(2006), 313 pages<br />
ISBN: 3-89336-425-0<br />
62. Diffuse Nitrateinträge in die Grund- und Oberflächengewässer von Rhein<br />
und Ems<br />
Ist-Zustands- und Maßnahmenanalysen<br />
von R. Kunkel, F. Wendland (2006), 130 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-437-4<br />
63. Abhängigkeit des Wurzelwachstums vom Lichtregime des Sprosses und<br />
deren Modifikation durch Nährstoffe sowie im Gravitropismus<br />
von Kerstin A. Nagel (2006), 119 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-443-9<br />
64. Chancen und Risiken zukünftiger <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong><br />
Ein multi-kriterielles Verfahren zur Bewertung von Zukunftsszenarien<br />
von C. R. Karger, W. Hennings, T. Jäger (2006), 296 Seiten<br />
ISBN: 3-89336-445-5
Autoren<br />
Cornelia R. Karger ist verantwortlich für den Bereich „Management von Innovationen“ von MUT, Wilfried Hennings ist<br />
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich „Management von Innovationen“ und im Bereich „Umgang mit Unsicherheit“,<br />
Tobias Jäger war wissenschaftlicher Projektmitarbeiter.<br />
Programmgruppe Mensch, Umwelt, Technik (MUT)<br />
Die Programmgruppe Mensch, Umwelt, Technik (MUT) des Forschungszentrums Jülich untersucht den gesellschaftlichen<br />
Umgang mit Chancen und Risiken wissenschaftlicher und technischer Entwicklungen. Dabei konzentriert sie sich<br />
auf drei Schwerpunkte: auf „Management von Innovationen“, „Umgang mit Unsicherheit“ und „Öffentlichkeit,<br />
Politik und Massenmedien“. MUT führt hierzu sozialwissenschaftliche, naturwissenschaftlich-technische und interdisziplinäre<br />
Forschung durch. Die Ergebnisse werden umgesetzt in praktische Ansätze zur Verbesserung des Umgangs mit<br />
Chancen und Risiken. Die Programmgruppe entwickelt und erprobt Instrumente zur Vorsorge, Risikokommunikation und<br />
Konsensfindung, zum Management von Chancen und zur Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.<br />
Band/Volume 64<br />
ISBN 3-89336-445-5<br />
Umwelt<br />
Environment