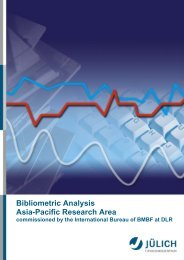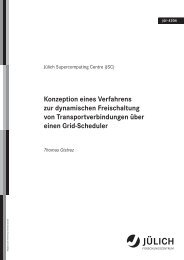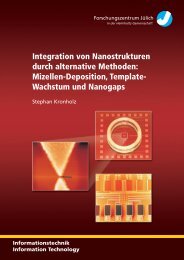netzgebundener Versorgung
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Teil I Nachhaltigkeit – Konzepte und Instrumente: 1. Nachhaltigkeitskonzepte<br />
verlaufsoffene Prozesse innerhalb des untersuchten ökonomischen Systems (Herrmann-<br />
Pillath & Lehmann-Waffenschmidt, 2003).<br />
Zentral für die Erklärung von Ausbreitungen oder aber auch deren Verhinderung von Anstößen<br />
ist der Begriff der Routine. Nelson und Winter (1982) definieren im evolutorischökonomischen<br />
Kontext Routinen als Bündelung des vorhandenen operationalen Wissens.<br />
Dieses Wissen ist nur im spezifischen sozialen und technologisch-organisatorischen Kontext<br />
einer Institution (z. B. Unternehmen oder Branche) sinnvoll und anwendbar; Routinen machen<br />
es für die regelmäßige Anwendung zugänglich. Mit dem Begriff der Routine lässt sich<br />
auch das unternehmerische Innovationsverhalten analysieren. Routinen bilden die Grundlage<br />
für technologische Entwicklungskorridore oder Pfade, auf denen sich Unternehmen und<br />
Branchen bewegen, indem sie Technologien und Organisationsmuster anwenden und im<br />
Rahmen ihrer spezifischen Restriktionen verbessern. Lernprozesse in der jeweiligen Institution<br />
unterliegen nach Ansicht dieses Ansatzes den (wahrgenommenen) ökonomischen<br />
Chancen, die in Innovationen liegen, den Anreizen im Institutionenumfeld, den Fertigkeiten<br />
der Institutionen und den organisatorischen Arrangements und Mechanismen, die die Übernahme<br />
von Innovationen begünstigen (oder erschweren). Aus evolutorisch-organisationstheoretischer<br />
Sicht ist die Aufrechterhaltung der Funktionsbedingungen für Innovationswettbewerb<br />
notwendige Bedingung für den Fortschritt. In Bezug auf Nachhaltigkeit weist die<br />
evolutorische Theorie der Ökonomie jedoch darauf hin, dass politische Steuerungsimpulse<br />
ausreichend stark sein müssen, um einen Pfadwechsel zugunsten beispielsweise umweltfreundlicher<br />
Technologien einzuleiten, sofern zu erwarten ist, dass die bestehenden nichtnachhaltigen<br />
Technologiepfade auch in Zukunft fortgeführt werden. So ist in der evolutorischen<br />
Beurteilung immer ein Kompromiss zwischen freiheitserhaltender Regulierung und<br />
erforderlicher Impulsstärke zu suchen (Linscheidt, Bodo, 1999; Erdmann & Seifert, 2003).<br />
Gerade deshalb ist es sinnvoll, diese Erkenntnisse im Hinblick auf die Förderung von Innovationen<br />
innerhalb der Wirtschaftssphäre als Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung zu<br />
nutzen.<br />
In neuerer Zeit trugen auch erste sozialwissenschaftliche Beiträge zur Institutionenforschung<br />
zum Verständnis sozial-ökologischer Transformation mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung<br />
bei (Constanza et al., 1999; Minsch et al., 1998; von Prittwitz, 2000; Young et al., 1998).<br />
Diese Ansätze verfolgen das Ziel, die sozialen und institutionellen Rahmenbedingungen<br />
einer erfolgreichen Einbettung von Nachhaltigkeitsstrategien in vorhandene gesellschaftliche<br />
Strukturen zur Entschärfung ökonomischer, ökologischer und sozialer Zielkonflikte heraus zu<br />
arbeiten (Jänicke, 1993 und 1996; Jänicke & Weidner, 1997; Minsch et al., 1998). Damit werden<br />
Einflussmöglichkeiten auf die Veränderung gesellschaftlicher Organisationsformen und<br />
Regelsysteme im Hinblick auf ihren Beitrag zur Förderung von Handlungen, die auf nachhaltige<br />
Entwicklung abzielen, thematisiert (in Kraemer & Metzner, 2002). Die sozialwissenschaftliche<br />
Institutionenforschung beschäftigte sich allerdings nur damit, wie Institutionen mit<br />
anderen Strukturdimensionen in der Regulation gesellschaftlicher Naturverhältnisse (Jahn &<br />
Wehling, 1998) zusammenwirken. Sie blendet damit weitestgehend andere Dimensionen der<br />
Regulation aus, entweder durch Einschluss in den Institutionenbegriff oder durch Ignoranz<br />
ihrer Existenz (z. B. von Werten, Technik und Ökologie, wie sie in der ökonomischen Institutionenforschung<br />
vorkommen) (Edeling et al., 1999).<br />
32