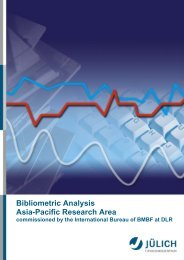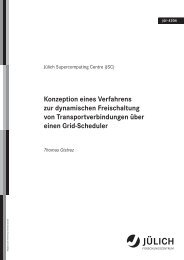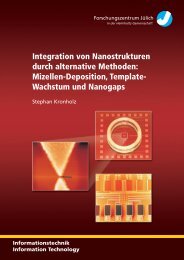netzgebundener Versorgung
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2.2 Akteursunabhängige Verfahren<br />
2.2 Akteursunabhängige Verfahren<br />
Bei akteursunabhängigen Verfahren sind keine gesellschaftlichen Akteure in das Verfahren<br />
eingebunden. Bei den Verfahren werden physische (z. B. bei der Ökobilanz und der Stoffstromanalyse)<br />
und ökonomische Bilanzierungen angewendet. Die ökonomische Bilanzierung<br />
hat den Nachteil, Stoffe ohne wirtschaftlichen Wert nicht zu erfassen; z. B. haben Abfälle und<br />
Abgase keine Wert, sie tauchen nur dann in den Bilanzen auf, wenn dafür Kosten entstehen<br />
(z. B. Entsorgungskosten oder Abgaben). In einer physischen Bilanzierung können sowohl<br />
ökologisch als auch ökonomisch bedeutende Stoff- und Energieflüsse berücksichtigt werden.<br />
Andererseits haben ökonomische Daten den Vorzug, häufig besser verfügbar zu sein.<br />
2.2.1 Kurze Einführung in die Verfahren<br />
Ökobilanz<br />
Die Ökobilanz ist in den DIN / EN ISO 14040, 14041 und 14042 definiert. Sie bilanziert die<br />
bei der Herstellung, Verwendung und Beseitigung eines Produkts oder einer Dienstleistung<br />
anfallenden energetischen und stofflichen Inputs und Outputs (Sachbilanz) und deren Wirkungen<br />
auf die Umwelt (Wirkungsbilanz). Wird nur die Sachbilanz durchgeführt, nennt die<br />
Norm dies eine „Sach-Ökobilanz-Studie". Die Norm verwendet den Begriff „Ökobilanz" als<br />
Übersetzung des englischen Begriffs „Life Cycle Assessment (LCA)" sowie den Begriff „Wirkungsabschätzung"<br />
für das englische „Life Cycle Impact Assessment".<br />
Charakteristisch für die Ökobilanz ist, dass in den obligatorischen Teilen nur naturwissenschaftliche<br />
und technische Zusammenhänge betrachtet und keine Wertungen vorgenommen<br />
werden, sie sind also streng akteursunabhängig. Die Ergebnisse „sind dem Entscheidungsträger<br />
vorzulegen", die Ökobilanz selbst liefert also nicht die Gesamtbewertung. In der Methode<br />
selbst ist nicht festgelegt, welche Wirkungskategorien bilanziert werden sollen und<br />
welche Sachbilanzen zu erfassen sind. Diese sind anhand der Zielsetzung der jeweiligen<br />
Studie festzulegen.<br />
Eine Anwendung des Verfahrens auf Zukunftsoptionen ist möglich, wenn darin die in der<br />
Ökobilanz benötigten Inputs, Outputs und Randbedingungen spezifiziert sind. Bei der Bilanzierung<br />
werden dann aber für alle Schritte des Produktlebenszyklus die gleichen Randbedingungen<br />
zugrunde gelegt, zeitliche Änderungen der Randbedingungen (z. B. Verbesserungen<br />
der Effizienz) im Verlauf des Produktlebenszyklus werden nicht berücksichtigt.<br />
Das Verfahren ist multikriteriell, die Kriterien beschränken sich aber auf die ökologische<br />
Dimension. Es kann auch multi-sektoral angewendet werden, indem entweder der Untersuchungsgegenstand<br />
sektorübergreifend definiert wird oder für jeden Sektor eine separate<br />
Ökobilanz aufgestellt wird.<br />
Die Anforderung an die Datenverfügbarkeit und -validität sind hoch und werden vom Detaillierungsgrad<br />
und Konsistenzgrad der vorliegenden Zukunftsszenarien nicht gedeckt, dennoch<br />
lassen sich einzelne Aspekte mit geringerer aber noch hinreichender Genauigkeit bilanzieren,<br />
bei denen wenige, hinreichend spezifizierte Daten die Bilanz dominieren, wie z. B.<br />
bei den CO 2-Emissionen der Stromerzeugung.<br />
Ein Kriterium für die Gesamtbeurteilung liefert die Ökobilanz nicht, wohl aber Ergebnisse, die<br />
als Basis für eine Gesamtbeurteilung dienen können.<br />
37