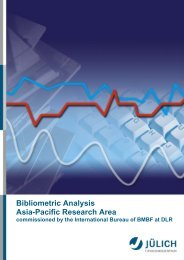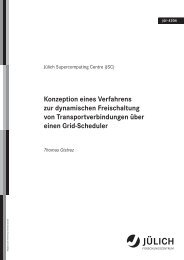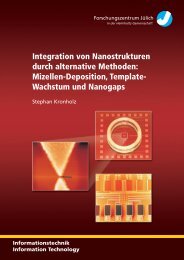netzgebundener Versorgung
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Teil II Empirische Untersuchung<br />
rend. Nur eine vertiefte Analyse in der Form ausgearbeiteter Gutachten gepaart mit der Anwendung<br />
eines standardisierten Beurteilungsformates für die Bewertung kann bei dem komplexen<br />
Gegenstandsbereich gesamtgesellschaftlicher Zukunftsszenarien die Annahmen und<br />
Einflussfaktoren, die die Expertenurteile begründen, explizit machen und diese in vergleichbare<br />
Urteile abbilden.<br />
Deliberative Verfahren hängen auch davon ab, wie erfolgreich der Einbezug relevanter gesellschaftlicher<br />
Akteure gelingt. Die Frage, wer in ein solches Verfahren einzubinden ist und<br />
welcher Modus der Partizipation vorliegt, hängt von der Ziel- und Fragestellung ab. Im Ansatz<br />
des kooperatives Diskurses (Renn, 1999b) werden beispielsweise „citizen panels" zur<br />
Bewertung von Optionen vorgeschlagen. In der vorliegenden Untersuchung galt es, wie z. B.<br />
bei Apostolakis & Pickett (1998), Multiplikatoren für die abschließende Bewertung der Zukunftsszenarien<br />
einzubinden. Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, diejenigen, die<br />
maßgeblich von Entscheidungen über die Zukunft <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong> betroffen<br />
sind, in ein strukturiertes Forum für Lern- und Reflexionsprozesse zu involvieren. Dabei<br />
stand die Frage der Repräsentanz institutionalisierter Interessen im Vordergrund. Die Mitwirkung<br />
der Akteure über den gesamten Bewertungsprozess ist ein Erfolgsfaktor für ein solches<br />
Verfahren.<br />
Die Güte analytisch-deliberativer Bewertungs- und Entscheidungsprozesse ist an verschiedenen<br />
Kriterien zu messen. Janis & Mann (1977) schlagen vor, die Beurteilung der Entscheidungsgüte<br />
auf den Prozess des Entscheidens zu beziehen. Beierle (2002) zog für seine<br />
Analyse der Qualität von „stakeholder-basierten" Entscheidungen beispielsweise die Kriterien<br />
„Kosteneffizienz" und „Beitrag zu innovativen Ideen und Analysen" heran. Multi-kriterielle<br />
Verfahren sind zeit- und ressourcenintensiv. Die vorliegende Konzeption ist ein Vorschlag zu<br />
einem dennoch praktikablen Verfahren. Die Ergebnisse haben – nach Einschätzung der<br />
Teilnehmer des Prozesses – einen hohen Anregungs- und Orientierungswert.<br />
Das Verfahren lieferte im Ergebnis einen differenzierten Zielkatalog, der die Debatte um die<br />
Nachhaltigkeit <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong> voranbringen kann. Aus dem Vergleich des<br />
Zielkatalogs mit aus der Wissenschaft definierten Zielvorstellungen ist ersichtlich, dass die<br />
meisten Studien „Klimaschutz", „Ressourcenschonung", „Risikoarmut und Fehlertoleranz",<br />
„Wirtschaftlichkeit" sowie „<strong>Versorgung</strong>ssicherheit" sowohl in den Energiesektoren als auch im<br />
Wassersektor als Oberziele anführen. Als operationalisierte Zielsetzungen werden in der<br />
ökologischen Dimension am häufigsten der „Schutz der Flächen", „Erhöhung der Produktion<br />
und der Nutzung der umweltfreundlichen Energiequellen", „rationelle Energiewandlung",<br />
„Minimierung des Materialverbrauchs" sowie „Artenvielfalt" und „Schutz der Lebensräume"<br />
für wichtig erachtet. Im Sektor Wasser werden am häufigsten die „Reduktion der Quellenverschmutzung"<br />
und der „Erhalt des quantitativen Zustands" genannt (z. B. UBA, 2002; Enquete-Kommission,<br />
2002; Nitsch & Rösch, 2001). In der Gesamtschau der Zielvorstellungen gesellschaftlicher<br />
Akteure sind diese Ziele ebenfalls relevant. Der Vorteil des Zielkatalogs liegt<br />
darin, dass er sektorübergreifend Gültigkeit besitzt, jedoch konkret genug ist, die spezifischen<br />
Anforderungen jedes Sektors abzubilden.<br />
Die Einschätzung der Ausprägungen der Szenarien auf den Kriterien durch die Experten<br />
erbrachte ein differenziertes Bild.<br />
Keines der Szenarien hat ausschließlich Vor- oder Nachteile.<br />
Szenario A ist dasjenige, das dem hypothetischen Zukunftsbild „Integrierte Mikrosysteme"<br />
am nächsten kommt. Es zeichnet sich durch einen umweltorientierten Energiemix aus: 45 %<br />
208