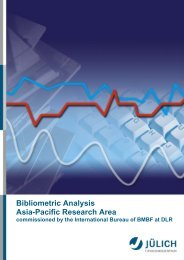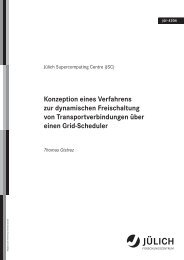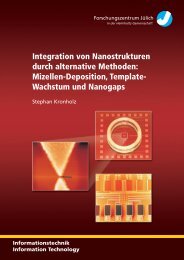netzgebundener Versorgung
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
1.2 Paradigmen und die verschiedenen Konzepte von Nachhaltigkeit<br />
dene Elemente der jeweiligen Sphären betrachtet. Bezüglich der ökologischen Sphäre steht<br />
im Mittelpunkt der Betrachtung das Naturverständnis einschließlich der Frage der Substituierbarkeit<br />
sowie die Betrachtung der Natur als Objekt oder Subjekt. Beim Fokus auf die<br />
ökonomische Sphäre werden Interaktionsbeziehungen herausgestellt, indem aus der Makroperspektive<br />
zunächst das in den einzelnen Disziplinen herrschende Verständnis bzgl. des<br />
gesamten Wirtschaftsprozesses verdeutlicht wird und nicht zuletzt der Entwicklungsbegriff<br />
mit der Frage qualitativen/quantitativen Wachstums sowie die Frage nach der Art des Anstoßes<br />
einer Entwicklung (exogen oder endogen) in das Zentrum der Analyse gestellt werden.<br />
In der Mikroperspektive werden Nachhaltigkeitskonzepte der einzelnen Disziplinen im Hinblick<br />
auf deren Priorisierungsgrad von Allokationsproblemen gegenüber Distributionsgesichtspunkten<br />
erörtert und die institutionellen Randbedingungen beleuchtet, die die Allokation<br />
beeinflussen. Schließlich wird herausgestellt, welcher Natur die Entscheidungen sind, die zu<br />
bestimmten Allokations- und Distributionsergebnissen führen, ob sie individuell oder als<br />
kollektive getroffen werden, und ob diese auf rationalem oder intuitivem Verhalten gründen.<br />
Paradigma: Ableitung von Nachhaltigkeitsprinzipien (Quasi-objektiv vs. explizitnormativ)<br />
Ein konstitutives Element von Nachhaltigkeit ist die inter- und intragenerative Verteilungsgerechtigkeit.<br />
Unter anderem werden Umweltnutzungsansprüche einerseits zwischen Industrieländern<br />
und Entwicklungsländern (intragenerative Gerechtigkeit) und andererseits zwischen<br />
gegenwärtigen und zukünftigen Generationen (intergenerative Gerechtigkeit) eingehender<br />
untersucht. Die Bestimmung solcher Ansprüche fußt entweder auf dem Paradigma einer<br />
quasi-objektiven oder auf einer explizit-normativen Herangehensweise.<br />
Argumentationen der ökologischen Ökonomie in Bezug auf inter- oder intragenerative Verteilungsgerechtigkeit,<br />
die sich als quasi-objektiv bezeichnen lassen, gehen davon aus, dass<br />
sich die gerechte Verteilung von Ressourcen, Gütern, Umweltnutzungsrechten etc. aus der<br />
Tragfähigkeit oder den Belastungsgrenzen natürlicher und gesellschaftlicher Systeme ermitteln<br />
lässt. Nachhaltigkeit wird also im funktionalistischen Ansatz negativ definiert. Beispielsweise<br />
werden Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft als unterschiedliche, strukturierte, eigenständige<br />
aber miteinander gekoppelte Subsysteme betrachtet, deren Funktionsfähigkeit und<br />
Störungsresistenz es im Interesse zukünftiger Generationen zu erhalten gilt. Als Ziel einer<br />
nachhaltigen Entwicklung wird der langfristige Systemerhalt von Umwelt, Gesellschaft und<br />
Wirtschaft formuliert (Brandl et al., 2001).<br />
Eine solche Herangehensweise verfolgt beispielsweise der Ansatz des Umweltbundesamtes,<br />
dessen Aussagen über operationalisierte Ziele zur Minderung von Treibhausgasen und von<br />
Schadstoffemissionen in der Studie über „Langfristszenarien für eine nachhaltige Energienutzung<br />
in Deutschland" des Jahres 2002 sich an wissenschaftlichen Aussagen (z. B. vom<br />
IPCC 1 ) zu Belastungsgrenzen der Ökosysteme orientieren (UBA, 2002). Im Wasserbereich<br />
orientiert sich die Studie des Umweltbundesamtes „Nachhaltige Wasserversorgung in<br />
Deutschland" aus dem Jahre 2001 bei der Formulierung von Zielen an gesetzlichen Vorgaben<br />
in den Bereichen Ressourcenschutz (Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetze),<br />
Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung (Trinkwasserverordnung, DIN 2000) sowie Hausinstallation<br />
(z. B. Grenzwerte der Trinkwasserverordnung, DIN 1988). Die Vorgaben stützen<br />
1 Intergovernmental Panel an Climate Change, http://www.ipcc.ch<br />
21