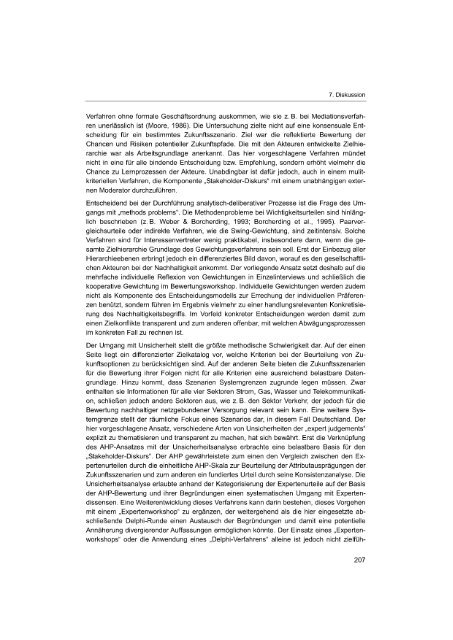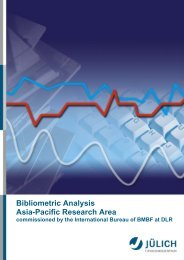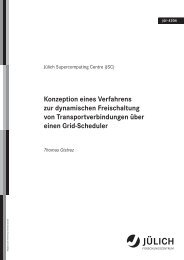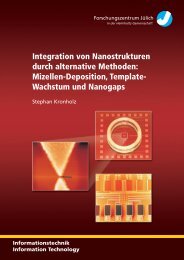netzgebundener Versorgung
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
7. Diskussion<br />
Verfahren ohne formale Geschäftsordnung auskommen, wie sie z. B. bei Mediationsverfahren<br />
unerlässlich ist (Moore, 1986). Die Untersuchung zielte nicht auf eine konsensuale Entscheidung<br />
für ein bestimmtes Zukunftsszenario. Ziel war die reflektierte Bewertung der<br />
Chancen und Risiken potentieller Zukunftspfade. Die mit den Akteuren entwickelte Zielhierarchie<br />
war als Arbeitsgrundlage anerkannt. Das hier vorgeschlagene Verfahren mündet<br />
nicht in eine für alle bindende Entscheidung bzw. Empfehlung, sondern erhöht vielmehr die<br />
Chance zu Lernprozessen der Akteure. Unabdingbar ist dafür jedoch, auch in einem mulitkriteriellen<br />
Verfahren, die Komponente „Stakeholder-Diskurs" mit einem unabhängigen externen<br />
Moderator durchzuführen.<br />
Entscheidend bei der Durchführung analytisch-deliberativer Prozesse ist die Frage des Umgangs<br />
mit „methods problems". Die Methodenprobleme bei Wichtigkeitsurteilen sind hinlänglich<br />
beschrieben (z. B. Weber & Borcherding, 1993; Borcherding et al., 1995). Paarvergleichsurteile<br />
oder indirekte Verfahren, wie die Swing-Gewichtung, sind zeitintensiv. Solche<br />
Verfahren sind für Interessenvertreter wenig praktikabel, insbesondere dann, wenn die gesamte<br />
Zielhierarchie Grundlage des Gewichtungsverfahrens sein soll. Erst der Einbezug aller<br />
Hierarchieebenen erbringt jedoch ein differenziertes Bild davon, worauf es den gesellschaftlichen<br />
Akteuren bei der Nachhaltigkeit ankommt. Der vorliegende Ansatz setzt deshalb auf die<br />
mehrfache individuelle Reflexion von Gewichtungen in Einzelinterviews und schließlich die<br />
kooperative Gewichtung im Bewertungsworkshop. Individuelle Gewichtungen werden zudem<br />
nicht als Komponente des Entscheidungsmodells zur Errechung der individuellen Präferenzen<br />
benützt, sondern führen im Ergebnis vielmehr zu einer handlungsrelevanten Konkretisierung<br />
des Nachhaltigkeitsbegriffs. Im Vorfeld konkreter Entscheidungen werden damit zum<br />
einen Zielkonflikte transparent und zum anderen offenbar, mit welchen Abwägungsprozessen<br />
im konkreten Fall zu rechnen ist.<br />
Der Umgang mit Unsicherheit stellt die größte methodische Schwierigkeit dar. Auf der einen<br />
Seite liegt ein differenzierter Zielkatalog vor, welche Kriterien bei der Beurteilung von Zukunftsoptionen<br />
zu berücksichtigen sind. Auf der anderen Seite bieten die Zukunftsszenarien<br />
für die Bewertung ihrer Folgen nicht für alle Kriterien eine ausreichend belastbare Datengrundlage.<br />
Hinzu kommt, dass Szenarien Systemgrenzen zugrunde legen müssen. Zwar<br />
enthalten sie Informationen für alle vier Sektoren Strom, Gas, Wasser und Telekommunikation,<br />
schließen jedoch andere Sektoren aus, wie z. B. den Sektor Verkehr, der jedoch für die<br />
Bewertung nachhaltiger <strong>netzgebundener</strong> <strong>Versorgung</strong> relevant sein kann. Eine weitere Systemgrenze<br />
stellt der räumliche Fokus eines Szenarios dar, in diesem Fall Deutschland. Der<br />
hier vorgeschlagene Ansatz, verschiedene Arten von Unsicherheiten der „expert judgements"<br />
explizit zu thematisieren und transparent zu machen, hat sich bewährt. Erst die Verknüpfung<br />
des AHP-Ansatzes mit der Unsicherheitsanalyse erbrachte eine belastbare Basis für den<br />
„Stakeholder-Diskurs". Der AHP gewährleistete zum einen den Vergleich zwischen den Expertenurteilen<br />
durch die einheitliche AHP-Skala zur Beurteilung der Attributausprägungen der<br />
Zukunftsszenarien und zum anderen ein fundiertes Urteil durch seine Konsistenzanalyse. Die<br />
Unsicherheitsanalyse erlaubte anhand der Kategorisierung der Expertenurteile auf der Basis<br />
der AHP-Bewertung und ihrer Begründungen einen systematischen Umgang mit Expertendissensen.<br />
Eine Weiterentwicklung dieses Verfahrens kann darin bestehen, dieses Vorgehen<br />
mit einem „Expertenworkshop" zu ergänzen, der weitergehend als die hier eingesetzte abschließende<br />
Delphi-Runde einen Austausch der Begründungen und damit eine potentielle<br />
Annäherung divergierender Auffassungen ermöglichen könnte. Der Einsatz eines „Expertenworkshops"<br />
oder die Anwendung eines „Delphi-Verfahrens" alleine ist jedoch nicht zielfüh-<br />
207