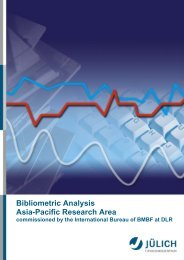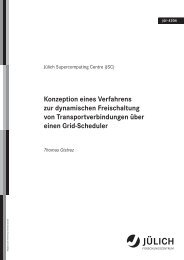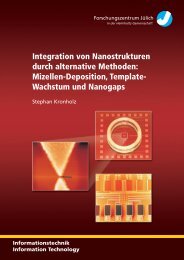netzgebundener Versorgung
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
Chancen und Risiken zukünftiger netzgebundener ... - JuSER
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Teil II Empirische Untersuchung: 3. Wertbaumanalyse<br />
tete eindeutige Entscheidung für ein Zukunftsszenario ist die Zielsetzung des vorliegenden<br />
Verfahrens, sondern vielmehr die sukzessive, über die verschiedenen Schritte des Prozesses<br />
immer konkreter werdende Bewertung von Chancen und Risiken expliziter Zukunftsoptionen.<br />
Um im gesamten Verfahren einen „black box"-Effekt und vor allem frühzeitige Positionskämpfe<br />
gesellschaftlicher Akteure zu vermeiden, werden die individuellen errechenbaren<br />
Präferenzfunktionen nicht in den Diskussionsprozess eingespeist. Vielmehr bilden alle in<br />
Schritt 1 bis 4 erarbeiteten Ergebnisse die Grundlage eines gemeinsamen Workshops. Damit<br />
gilt es, eine möglichst hohe Nachvollziehbarkeit in Bezug auf alle Verfahrensschritte zu erreichen.<br />
Auf der Basis der Experteneinschätzungen zu den Attributausprägungen der Szenarien<br />
werden zu allen Zielbereichen der Zielhierarchie das Für und Wider eines Zukunftspfades<br />
diskutiert. Auch Expertendissense sind Gegenstand der Diskussion. Vor diesem Hintergrund<br />
geht es vor allem um die Fragen: Wie schlagen sich als wichtig angesehene Ziele auf<br />
die Beurteilung der Zukunftsszenarien nieder? Welche Prioritäten werden gesetzt und wie<br />
werden sie begründet? Zu welchen Punkten sind sich die gesellschaftlichen Akteure weitgehend<br />
einig? Welcher der Zukunftspfade könnte eine Orientierung für die Zukunftsgestaltung<br />
bieten?<br />
3. Wertbaumanalyse<br />
Der erste und zweite Schritt des Verfahrens ist die Erstellung der Zielhierarchie. Die Erhebung<br />
der Zielvorstellungen, anhand derer die verschiedenen Zukunftsszenarien zu beurteilen<br />
sind, erfolgt anhand der Wertbaumanalyse. Im Folgenden sind der methodische Ansatz und<br />
die konkrete Umsetzung in der Untersuchung beschrieben. Auf der Basis der Erläuterung der<br />
Auswertung sind die Ergebnisse dargestellt.<br />
3.1 Durchführung<br />
3.1.1 Ansatz<br />
Die Wertbaumanalyse wurde als diskursive Methode zur Generierung und Strukturierung von<br />
Werten, Zielen bzw. Attributen von Keeney und Raiffa im Jahr 1976 in die Debatte eingeführt.<br />
Eine ausführliche Beschreibung findet sich z. B. bei von Winterfeldt & Edwards (1986).<br />
Werthierarchien werden nicht nach der subjektiven Wichtigkeit einzelner Werte, sondern<br />
nach dem Kriterium des Allgemeinheits- bzw. Abstraktionsgrades gebildet (Keeney, 1992b).<br />
Die nach der Strukturierung der Ziele erhaltene Hierarchie ist jedoch nicht dergestalt angelegt,<br />
dass ein Element der Zielhierarchie als Überkriterium für alle Elemente der darunter<br />
liegenden Zielebene fungieren muss, sondern jedes übergeordnete Ziel kann sich auf eine<br />
bestimmte Gruppe von Zielen unterer Ebenen beziehen (Saaty & Vargas, 2000). Die Elemente<br />
der verschiedenen Ebenen stehen jedoch in linearer Beziehung zueinander, d. h. Ziele<br />
der höheren Ebene können nicht von Zielen weiter unten liegender Ebenen dominiert werden<br />
(Saaty, 1990). Hinsichtlich der weiteren Nutzung der Zielhierarchien ist darauf hinzuweisen,<br />
dass diese nur in einem bestimmten Kontext, also bezüglich eines spezifischen Entscheidungs-<br />
bzw. Bewertungsproblems, gültig sind. Es können folglich keine Hierarchien in Bezug<br />
auf die generelle Bedeutung der aufgenommenen Werte gebildet werden (Brüggemann &<br />
Jungermann, 1996).<br />
84