Wir in der Schule von BAG-Selbsthilfe Deutschland
- Text
- Achsedeutschland
- Chronischselteneerkrankungen
- Kinder
- Betroffenen
- Behandlung
- Betroffene
- Symptome
- Eltern
- Erkrankung
- Menschen
- Kindern
- Diagnose
Multiple Sklerose 102
Multiple Sklerose 102 Behandlung Es werden folgende Therapien durchgeführt: Basistherapie: Therapie für milde, moderate Krankheitsverläufe. Das Fortschreiten der Krankheit und weitere akute Schübe sollen möglichst verhindert oder zumindest abgeschwächt werden. · Wirkstoffe wie Interferon beta, Glatirameracetat, Teriflunomid und Dimethylfumarat beeinflussen das Immunsystem und können im Idealfall zu Schubfreiheit führen. Sie werden je nach Präparat einmal oder mehrmals pro Woche oder 14-täglich in die Muskulatur bzw. unter die Haut gespritzt oder in Tablettenform ein- oder zweimal täglich eingenommen. · Mögliche Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Müdigkeit und Fieber. · Begleitmaßnahmen wie Physiotherapie, Beckenbodentraining, Massagen oder Entspannungsmaßnahmen können die Krankheit positiv beeinflussen (z. B. Zittern oder Schwindelgefühl reduzieren). Einzelne Symptome können ebenfalls begleitend medikamentös behandelt werden. Bei einem Versagen dieser Therapien oder einem besonders aggressiven Fortschreiten der Erkrankung können Therapien für (hoch-)aktive Verlaufsformen zum Einsatz kommen. In den meisten Fällen wird dabei in größeren (z. B. monatlichen) Abständen ein Medikament (z. B. Natalizumab oder Alemtuzumab) per Infusion verabreicht. Es gibt aber auch die Möglichkeit einer tablettenbasierten Therapie mit Fingolimod. Schubtherapie: Symptome des Schubs sollen akut bekämpft werden. Hoch dosierte Entzündungshemmer (Glukokortikoide) werden verabreicht. In besonders schlimmen Fällen wird Kortison drei bis fünf Tage lang intravenös verabreicht. Schulungsprogramme Eltern MS-erkrankter Kinder und Jugendlicher können jederzeit die Beratungsangebote der Landesverbände der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) nutzen. Die DMSG bietet darüber hinaus jeweils eine Internetseite für Kinder und Jugendliche an (siehe untenstehende Links). Onlinetools der DMSG bieten gut verständliche Informationen (zu finden unter www.dmsg.de): · MS verstehen, behandeln, erforschen · Die virtuelle MS-Klinik · e-Train MS (Lernprogramm zu MS in verschiedenen Wissensstufen) · Web-App: Mission Serious (ein animiertes Spiel zum Verständnis dessen, was bei MS im Körper passiert) · MS Kognition (Übungen zur Stärkung der kognitiven Fähigkeiten; auch als kostenlose Smartphone-App) · MS.TV-App (Experten- und Patientenvideos sowie Animationen über die kostenlose Smartphone-App ansehen) Materialien für Lehrkräfte Bei Unsicherheit im Umgang mit der Erkrankung können Lehrkräfte auf die Beratungsangebote der Landesverbände der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) zurückgreifen, sich Unterstützung holen und Informationsmaterial anfordern. Hinweise für Lehrkräfte Lehrkräfte sollten über typische Anzeichen von Schüben (s. o.) bzw. die individuelle Problematik eines Kindes mit MS in Hinsicht auf Symptome genau Bescheid wissen. Spezielle Fragen zur Betreuung des Kindes sollten mit den Erziehungsberechtigten abgeklärt sein und es sollte eine entsprechende schriftliche Vereinbarung vorliegen. Der Klassenverband sollte mit Einverständnis der Betroffenen und ihrer Erziehungsberechtigten über die Krankheit informiert werden, um Symptome eines Schubs richtig zuordnen und Hilfe herbeiholen zu können. Die Mitschülerinnen und Mitschüler sollten auch darüber aufgeklärt werden, wie sich die spezifischen Symptome auf das tägliche Leben der Erkrankten auswirken, um sie möglichst effektiv unterstützen zu können. Mit der Erkrankung sollte so offen wie möglich umgegangen werden, ggf. könnte sie auch im Biologieunterricht thematisiert werden. Wichtig ist es, Mitschülerinnen und Mitschüler genau zu informieren und (unbegründete) Ängste (z. B. vor Ansteckungsgefahr) auszuräumen, um ein angstfreies und harmonisches Verhältnis zu ermöglichen. Lehrkräfte sollten sich über ihre Rechte und Pflichten Klarheit verschaffen, um eventuell auftretende Konflikte zu vermeiden. Dies erleichtert den Umgang und gibt Sicherheit für die verantwortungsvolle Aufgabe, ein betroffenes Kind zu beaufsichtigen. Selbsthilfe/Patientenorganisation Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Bundesverband e. V. (DMSG) www.dmsg.de Weitere Internetadressen · www.kinder-und-ms.de · www.dmsg.de/jugend-und-ms · www.kinder-mszentrum-goettingen.de · www.childrenms.de
Muskeldystrophie Muskeldystrophien sind genetisch bedingte Erkrankungen der Skelettmuskulatur. Mutationen in Muskelproteinen führen zu einem fortschreitenden Verfall der Muskulatur. Die Ausprägung der Symptomatik wird durch den jeweiligen Subtyp bestimmt und kann sich entsprechend als milde Muskelschwäche oder als schwere Erkrankung mit tödlichem Verlauf zeigen. Die Häufigkeit des Vorkommens von Muskeldystrophien in der Bevölkerung hängt vom jeweiligen Subtyp ab und ist dementsprechend sehr variabel. Die häufigste Form (Duchenne) kommt bei einem von 3.500 männlichen Neugeborenen vor. Die Becker-Muskeldystrophie betrifft einen von 20.000 männlichen Neugeborenen. Erscheinungsformen Folgende maßgeblichen Muskeldystrophien werden unterschieden: Duchenne: · Häufigste vererbte Muskeldystrophie im Kindesalter · Rezessiv X-chromosomal vererbt (Frauen Trägerinnen, Männer erkranken) · Fortschreitend verlaufende Erkrankung mit einer Lebenserwartung zwischen 15 und in wenigen Fällen 40 Jahren + … · Beginn: Abnahme der Muskulatur ab Geburt, deutliche Einschränkungen im Kindergartenalter, Rollstuhlpflichtigkeit tritt während der Grundschulzeit ein, regelmäßige Überprüfung der Lungen- und Herzfunktionen, · Tod durch Infekte, die sich auf die Atmung (Insuffizienz) auswirken, Herzversagen, Multiorganversagen Becker/Kiener: · Rezessiv X-chromosomal vererbt (Frauen Trägerinnen, Männer erkranken) · Ähnlichkeiten mit dem Typ Duchenne (schreitet deutlich langsamer fort) · Betroffen: gesamte Muskulatur (Gehunfähigkeit im Alter ab ca. 25–50 Jahren) · Erkrankte können bei guter medizinischer Betreuung ein annähernd normales Alter erreichen Zudem gibt es fast 30 verschiedene sog. Gliedergürtel- Formen, bei denen hauptsächlich die Becken- und Schultermuskulatur betroffen ist. Ursache/Diagnose/Prognose Ursache Muskeldystrophie ist eine überwiegend erblich bedingte Erkrankung; diskutiert werden zusätzliche Ursachen wie z. B. Verletzungen im Bereich des Nervensystems oder Infektionen. Diagnose In der Anamnese wird nach dem Verlauf und dem Auftreten bei Familienmitgliedern gefragt. Es schließen sich mehrere Untersuchungen an. Körperliche Untersuchung: · Gelenkveränderungen · Organvergrößerungen · Lungenfunktion · Elektroneurografie (Nervenleitgeschwindigkeit; Nerven werden elektrisch gereizt) · Elektromyografie (Messung der Muskelströme) Laboruntersuchungen: · Kreatinkinase (Muskelenzym in hohem Ausmaß im Blut) · Magnetresonanz-/Kernspintomografie (Muskeln werden in Schichten dargestellt) · Genanalyse (Blutuntersuchung) Die Duchenne-Muskeldystrophie verläuft schnell fortschreitend und führt zu einer deutlichen Einschränkung der Lebensqualität. Bei den anderen Formen ist der Verlauf langsamer. Die Erkrankung geht mit erheblichen sozialen und körperlichen Einschränkungen einher. Muskelschwund ist nicht heilbar. 103
- Seite 1 und 2:
Chronische Erkrankungen und Behinde
- Seite 3 und 4:
Chronische Erkrankungen und Behinde
- Seite 5:
Inhaltsverzeichnis Chronische Erkra
- Seite 8 und 9:
Vorwort Kinder mit einer chronische
- Seite 10 und 11:
Danksagung Unser herzlicher Dank f
- Seite 12 und 13:
Nachteilsausgleiche für Schülerin
- Seite 14 und 15:
14
- Seite 16 und 17:
Achondroplasie Neben den Therapiefo
- Seite 18 und 19:
Adipositas langfristig zu ändern.
- Seite 20 und 21:
ADHS - Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper
- Seite 22 und 23:
Albinismus gestellt wird. Um sie zu
- Seite 24 und 25:
Anaphylaxie (schwere allergische Re
- Seite 26 und 27:
Anaphylaxie (schwere allergische Re
- Seite 28 und 29:
Angeborene Herzfehler Ungefähr ein
- Seite 30 und 31:
Anorexie (Magersucht)/Bulimie (Ess-
- Seite 32 und 33:
Anorexie (Magersucht)/Bulimie (Ess-
- Seite 34 und 35:
Asthma Behandlung Mit der richtigen
- Seite 36 und 37:
Autismus Autismus zählt zu den tie
- Seite 38 und 39:
Autismus Selbsthilfe/Patientenorgan
- Seite 40 und 41:
CHARGE-Syndrom Hinweise für Lehrkr
- Seite 42 und 43:
Clusterkopfschmerz und andere trige
- Seite 44 und 45:
Clusterkopfschmerz Materialien für
- Seite 46 und 47:
Deletionssyndrom 22q11 Materialien
- Seite 48 und 49:
Depressionen Der Schweregrad einer
- Seite 50 und 51:
Depressionen Hinweise für Lehrkrä
- Seite 52 und 53: Diabetes mellitus Typische Symptome
- Seite 54 und 55: Diabetes mellitus Hinweise für Leh
- Seite 56 und 57: Down-Syndrom (Trisomie 21) Hinweise
- Seite 58 und 59: Ehlers-Danlos-Syndrom Menschen bis
- Seite 60 und 61: Endometriose se Ursache/Diagnose/Pr
- Seite 62 und 63: Enterostoma (künstlicher Darmausga
- Seite 64 und 65: Epilepsie Von Epilepsie wird in der
- Seite 66 und 67: Epilepsie Es handelt sich dann um e
- Seite 68 und 69: Glasknochenkrankheit (Osteogenesis
- Seite 70 und 71: Hausstaubmilbenallergie Weise ihren
- Seite 72 und 73: Hämophilie (Bluterkrankheit) Mater
- Seite 74 und 75: Hepatitis C Die geeignete Therapie
- Seite 76 und 77: Hirntumoren Materialien für Lehrkr
- Seite 78 und 79: Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfu
- Seite 80 und 81: Hypothyreose (Schilddrüsenunterfun
- Seite 82 und 83: Ichthyose Hinweise für Lehrkräfte
- Seite 84 und 85: Kleinwuchs Hinweise für Lehrkräft
- Seite 86 und 87: Klinefelter-Syndrom Hinweise für L
- Seite 88 und 89: Laktoseintoleranz (Milchzuckerunver
- Seite 90 und 91: Leukämie Behandlung Da Leukämien
- Seite 92 und 93: Lippen-Kiefer-Gaumenspalte Hinweise
- Seite 94 und 95: Marfan-Syndrom Hinweise für Lehrkr
- Seite 96 und 97: Migräne fühlen sich die Betroffen
- Seite 98 und 99: Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Hinwe
- Seite 100 und 101: Mukoviszidose (Cystische Fibrose) H
- Seite 104 und 105: Muskeldystrophie Behandlung Die Beh
- Seite 106 und 107: Mutismus nehin nicht gibt) oder nac
- Seite 108 und 109: Neurodermitis Die Diagnose Neuroder
- Seite 110 und 111: Nierenerkrankungen, v. a. chronisch
- Seite 112 und 113: Nierenerkrankungen, v. a. chronisch
- Seite 114 und 115: Phenylketonurie Bei einer Phenylket
- Seite 116 und 117: Phenylketonurie Materialien für Le
- Seite 118 und 119: Poland-Syndrom Hinweise für Lehrkr
- Seite 120 und 121: Psoriasis (Schuppenflechte) verteil
- Seite 122 und 123: Psoriasis (Schuppenflechte) Materia
- Seite 124 und 125: Rett-Syndrom mung). Die kommunikati
- Seite 126 und 127: Rheuma/Juvenile idiopathische Arthr
- Seite 128 und 129: Rheuma/Juvenile idiopathische Arthr
- Seite 130 und 131: Schizophrenie schend, aber auch St
- Seite 132 und 133: Schizophrenie Materialien für Lehr
- Seite 134 und 135: Schlaganfall (Hirninfarkt) Die Risi
- Seite 136 und 137: Skoliose Als Skoliose bezeichnet ma
- Seite 138 und 139: Skoliose Materialien für Lehrkräf
- Seite 140 und 141: Spina bifida (offener Rücken)/Hydr
- Seite 142 und 143: Stottern Ursache/Diagnose/Prognose
- Seite 144 und 145: Tinnitus (Tinnitus aurium; lat. „
- Seite 146 und 147: Tourette-Syndrom Das Tourette-Syndr
- Seite 148 und 149: Turner-Syndrom Das Turner-Syndrom (
- Seite 150 und 151: Williams-Beuren-Syndrom Das William
- Seite 152 und 153:
Wiskott-Aldrich-Syndrom Das Wiskott
- Seite 154 und 155:
Zerebralparese Infantile Zerebralpa
- Seite 156 und 157:
Zöliakie (Glutensensitive Enteropa
- Seite 158:
Zöliakie (Glutensensitive Enteropa
Unangemessen
Laden...
Einbetten
Laden...
Gemeinsam für Selten
About us
Doch allein in Österreich leben rund 400.000 Menschen, die direkt oder indirekt von sogenannten "seltenen Erkrankungen" betroffen sind.

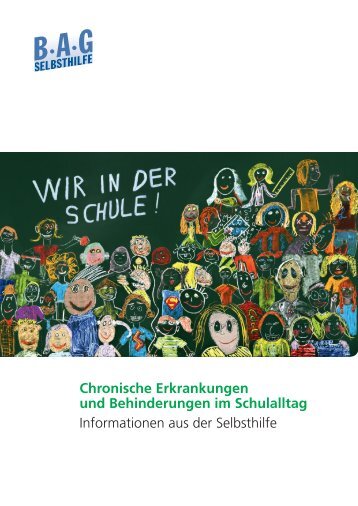
Follow Us
Youtube