Wir in der Schule von BAG-Selbsthilfe Deutschland
- Text
- Achsedeutschland
- Chronischselteneerkrankungen
- Kinder
- Betroffenen
- Behandlung
- Betroffene
- Symptome
- Eltern
- Erkrankung
- Menschen
- Kindern
- Diagnose
Mutismus
Mutismus nehin nicht gibt) oder nach psychischen Konflikten in der Entwicklung der schweigenden Kinder. Sprachtherapeutisches Handeln basiert auf der Annahme, dass Mutismus aus einem dispositionell bedingten übersteigerten Angstempfinden heraus entsteht, das die soziale und vor allem kommunikative Entfaltung der Betroffenen von Beginn ihrer Entwicklung an einschränkt. Der Ist-Zustand der Betroffenen wird damit zum Ausgangspunkt einer in kleinen Schritten vorgenommenen Neukonfiguration von Sprechen, Angstverhalten und der emotionalen Bewältigung sozialer Situationen: Betroffene machen zunächst Geräusche nach oder nennen dem Therapeuten den Anfangsbuchstaben eines Bildsymbols. Es folgen Silben, später Ein-Wort-Antworten, dann kurze bzw. längere Sätze, schließlich das Vorlesen und zum Schluss der Schritt zum zielorientierten und zum freien Sprechen. In der Endphase der Behandlung wird die Bewältigung von realen Alltagssituationen außerhalb der Praxis geübt (In-vivo-Therapie). Mutismus wird als Symptom einer Angststörung begriffen und somit auch wie eine Angststörung behandelt, nämlich durch Habituation (Gewöhnung) an den angstauslösenden Impuls. Die Sprachtherapie ist, in direkter Kombination mit verhaltenstherapeutischen Ansätzen, ein sehr direktiver Therapieansatz und hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Bei der Mutismustherapie können, insbesondere zur Behandlung von Ängsten, auch spezielle Antidepressiva, die auf den Serotoninstoffwechsel einwirken, unterstützend eingesetzt werden, sie können jedoch eine Therapie nur unterstützen oder ergänzen, aber nie ersetzen. Wird das Schweigen z. B. als Folge eines frühkindlichen Traumas interpretiert, was jedoch eher selten ist (unter zehn Prozent Inzidenzrate), empfiehlt sich in der Regel eine analytische Spieltherapie. Sie verfolgt das Ziel, die verdeckte seelische Verletzung spieltherapeutisch aufzuspüren und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Nimmt man beispielsweise einen latenten oder offen ausgetragenen Konflikt innerhalb der Familie als Ursache an, eignet sich die Familientherapie. Sie dient der Aufarbeitung der jeweiligen Beziehungsdynamik sowie der Aufdeckung von Ehekrisen und unbewussten Projektionsmechanismen zwischen den Generationen. Hinweise für Lehrkräfte Lehrkräfte sollten stets mit den Eltern in Kontakt stehen, damit der Mutismus erkannt werden kann. Durch Absprache mit der Therapeutin bzw. dem Therapeuten kann das Behandlungskonzept unterstützt werden. Ggf. könnten die Lehrkräfte Alternativen zur mündlichen Mitarbeit anbieten, damit Betroffene ihre Leistungen auf anderem Weg zeigen können (Nachteilsausgleich). Dies sollte jedoch nie zu 100 Prozent geschehen, da den Betroffenen sonst die Motivation genommen würde, an sich zu arbeiten und ihre eigene Situation durch therapeutische Maßnahmen zu verbessen. Eine 60:40- oder 70:30-Regelung (schriftlich:mündlich) ist empfehlenswerter. Die Kinder sollten nicht gesondert behandelt, sondern in den Klassenverbund integriert werden. Die Klasse sollte über das Thema Mutismus aufgeklärt werden – jedoch nur mit Einwilligung des betroffenen Kindes. Materialien für Lehrkräfte · www.mutismus.de/informationen-und-aufklaerung/ leitlinien-fuer-paedagogen · www.mutismus.de/informationen-und-aufklaerung/ leitlinien-fuer-schulen · www.mutismus.de/informationen-und-aufklaerung/ nachteilsausgleich · Sonderheft 6 der Fachzeitschrift „Mutismus.de“ mit dem Schwerpunkt „Mutismus und Schule“, erhältlich unter: www.mutismus.abmedia-online.de · Hartmann, B. (2004): Mutismus in der Schule – ein unlösbares Problem? In: Amrein, Ch.; Baumgarten, H. H. (Hrsg.): Kommunikation in heilpädagogischen Handlungsfeldern VHN 73/1, S. 29–52. Selbsthilfe/Patientenorganisation Mutismus Selbsthilfe Deutschland e. V. www.mutismus.de Weitere Internetadressen · www.mutismus.de/informationen-undaufklaerung/10-faqs-zum-mutismus · www.mutismus.de/informationen-undaufklaerung/was-ist-mutismus · www.mutismus.de/informationen-undaufklaerung/srmt 106
Neurodermitis Neurodermitis (atopische Dermatitis) ist eine chronisch-entzündliche, nicht ansteckende Hauterkrankung, die zusammen mit Heuschnupfen, allergischem Asthma und Nahrungsmittelallergien zum atopischen Formenkreis gehört. Sobald eine dieser Erkrankungen in der Familie vorliegt (Vater, Mutter, Geschwister), kann die allergische Veranlagung vererbt werden. Daher ist oft eine familiäre Häufung von allergischen Erkrankungen zu beobachten. Neurodermitis tritt meist im Säuglings- oder Kleinkindalter auf und zeigt sich typischerweise in Form von Ekzemen, die mit starkem Juckreiz einhergehen. In Deutschland leiden ca. zehn Prozent der Kinder an Neurodermitis. Damit ist Neurodermitis die häufigste Hauterkrankung im Kindesalter und manifestiert sich in der Regel bis zum ersten Lebensjahr. Die Kinder, die vor dem dritten Lebensmonat erkranken, erleiden meist einen schwereren Krankheitsverlauf und entwickeln häufiger auch andere allergische Erkrankungen wie z. B. eine Nahrungsmittelallergie oder ein allergisches Asthma. Erscheinungsformen Neurodermitiker haben generell eine trockene, zu Juckreiz neigende Haut. Im akuten Entzündungsschub ist die Haut stark gerötet, ggf. treten leichte Hautschwellungen, seltener Bläschenbildung auf. Bei zunehmender Intensität nässen die Ekzeme und es kann zu eitriger Krustenbildung kommen. Bei einem chronischen Ekzem steht die entzündete, aber sehr trockene Haut im Vordergrund. Durch den Entzündungsprozess wird die Haut dicker und gröber. Sowohl beim akuten als auch beim chronischen Ekzem leiden die Betroffenen unter starkem Juckreiz, der auch noch anhält, wenn das Ekzem längst abgeheilt ist. Die Erkrankung verläuft schubweise und ihr Erscheinungsbild variiert je nach Alter und Person. Im Kindesalter treten die Ekzeme bevorzugt an den Extremitätenbeugen, in Körperfalten (z. B. Nacken) und an Handrücken/ -gelenken auf. Symptome im Gesicht/Halsbereich treten typischerweise im Kleinkindalter auf, bei Jugendlichen hingegen eher selten. Ursache/Diagnose/Prognose Die Ursache ist bisher nicht eindeutig geklärt. Er wird diskutiert, dass immunologische Faktoren, genetische Veranlagung, Neigung zu Allergien und eine gestörte Hautbarriere die Erkrankung fördern. Zudem gibt es viele Triggerfaktoren, die den Ausbruch begünstigen können. Neurodermitis gehört zwar zum atopischen Formenkreis, muss aber nicht zwingend mit einer Allergie vergesellschaftet sein. Im Kleinkindalter können aber Reaktionen auf Grundnahrungsmittel (ca. ein Drittel der Kinder, die eine mittlere bis schwere Neurodermitis haben, haben eine Nahrungsmittelallergie), später auch auf Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare den Zustand der Haut verschlechtern. Hinzu kommen zahlreiche Einflussfaktoren, die einen Neurodermitisschub unterhalten oder begünstigen können: · Schweiß, Wärme · mechanische Reize auf der Haut, z. B. durch Wolle, Kratzen · irritierende Stoffe in kosmetischen Produkten · Psyche · Infekte, Impfung · Klima (z. B. Kälte) · Hormone (Pubertät) · Schadstoffe, insbesondere Zigarettenrauch (auch passiv) Da es sich um eine chronische, in Schüben verlaufende Erkrankung handelt, kann man sie zwar abmildern oder die Dauer durch entsprechende Therapien verkürzen, aber man kann die neu aufflammenden Ekzeme nicht gänzlich verhindern. Das ist für die Betroffenen teilweise sehr frustrierend und kann sogar dazu führen, dass die Kinder (insbesondere Teenager) die Auslöser nicht mehr konsequent meiden oder die Hautpflege vernachlässigen, da ihre Bemühungen scheinbar nicht erfolgreich waren. 107
- Seite 1 und 2:
Chronische Erkrankungen und Behinde
- Seite 3 und 4:
Chronische Erkrankungen und Behinde
- Seite 5:
Inhaltsverzeichnis Chronische Erkra
- Seite 8 und 9:
Vorwort Kinder mit einer chronische
- Seite 10 und 11:
Danksagung Unser herzlicher Dank f
- Seite 12 und 13:
Nachteilsausgleiche für Schülerin
- Seite 14 und 15:
14
- Seite 16 und 17:
Achondroplasie Neben den Therapiefo
- Seite 18 und 19:
Adipositas langfristig zu ändern.
- Seite 20 und 21:
ADHS - Aufmerksamkeitsdefizit-Hyper
- Seite 22 und 23:
Albinismus gestellt wird. Um sie zu
- Seite 24 und 25:
Anaphylaxie (schwere allergische Re
- Seite 26 und 27:
Anaphylaxie (schwere allergische Re
- Seite 28 und 29:
Angeborene Herzfehler Ungefähr ein
- Seite 30 und 31:
Anorexie (Magersucht)/Bulimie (Ess-
- Seite 32 und 33:
Anorexie (Magersucht)/Bulimie (Ess-
- Seite 34 und 35:
Asthma Behandlung Mit der richtigen
- Seite 36 und 37:
Autismus Autismus zählt zu den tie
- Seite 38 und 39:
Autismus Selbsthilfe/Patientenorgan
- Seite 40 und 41:
CHARGE-Syndrom Hinweise für Lehrkr
- Seite 42 und 43:
Clusterkopfschmerz und andere trige
- Seite 44 und 45:
Clusterkopfschmerz Materialien für
- Seite 46 und 47:
Deletionssyndrom 22q11 Materialien
- Seite 48 und 49:
Depressionen Der Schweregrad einer
- Seite 50 und 51:
Depressionen Hinweise für Lehrkrä
- Seite 52 und 53:
Diabetes mellitus Typische Symptome
- Seite 54 und 55:
Diabetes mellitus Hinweise für Leh
- Seite 56 und 57: Down-Syndrom (Trisomie 21) Hinweise
- Seite 58 und 59: Ehlers-Danlos-Syndrom Menschen bis
- Seite 60 und 61: Endometriose se Ursache/Diagnose/Pr
- Seite 62 und 63: Enterostoma (künstlicher Darmausga
- Seite 64 und 65: Epilepsie Von Epilepsie wird in der
- Seite 66 und 67: Epilepsie Es handelt sich dann um e
- Seite 68 und 69: Glasknochenkrankheit (Osteogenesis
- Seite 70 und 71: Hausstaubmilbenallergie Weise ihren
- Seite 72 und 73: Hämophilie (Bluterkrankheit) Mater
- Seite 74 und 75: Hepatitis C Die geeignete Therapie
- Seite 76 und 77: Hirntumoren Materialien für Lehrkr
- Seite 78 und 79: Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfu
- Seite 80 und 81: Hypothyreose (Schilddrüsenunterfun
- Seite 82 und 83: Ichthyose Hinweise für Lehrkräfte
- Seite 84 und 85: Kleinwuchs Hinweise für Lehrkräft
- Seite 86 und 87: Klinefelter-Syndrom Hinweise für L
- Seite 88 und 89: Laktoseintoleranz (Milchzuckerunver
- Seite 90 und 91: Leukämie Behandlung Da Leukämien
- Seite 92 und 93: Lippen-Kiefer-Gaumenspalte Hinweise
- Seite 94 und 95: Marfan-Syndrom Hinweise für Lehrkr
- Seite 96 und 97: Migräne fühlen sich die Betroffen
- Seite 98 und 99: Morbus Crohn/Colitis ulcerosa Hinwe
- Seite 100 und 101: Mukoviszidose (Cystische Fibrose) H
- Seite 102 und 103: Multiple Sklerose 102 Behandlung Es
- Seite 104 und 105: Muskeldystrophie Behandlung Die Beh
- Seite 108 und 109: Neurodermitis Die Diagnose Neuroder
- Seite 110 und 111: Nierenerkrankungen, v. a. chronisch
- Seite 112 und 113: Nierenerkrankungen, v. a. chronisch
- Seite 114 und 115: Phenylketonurie Bei einer Phenylket
- Seite 116 und 117: Phenylketonurie Materialien für Le
- Seite 118 und 119: Poland-Syndrom Hinweise für Lehrkr
- Seite 120 und 121: Psoriasis (Schuppenflechte) verteil
- Seite 122 und 123: Psoriasis (Schuppenflechte) Materia
- Seite 124 und 125: Rett-Syndrom mung). Die kommunikati
- Seite 126 und 127: Rheuma/Juvenile idiopathische Arthr
- Seite 128 und 129: Rheuma/Juvenile idiopathische Arthr
- Seite 130 und 131: Schizophrenie schend, aber auch St
- Seite 132 und 133: Schizophrenie Materialien für Lehr
- Seite 134 und 135: Schlaganfall (Hirninfarkt) Die Risi
- Seite 136 und 137: Skoliose Als Skoliose bezeichnet ma
- Seite 138 und 139: Skoliose Materialien für Lehrkräf
- Seite 140 und 141: Spina bifida (offener Rücken)/Hydr
- Seite 142 und 143: Stottern Ursache/Diagnose/Prognose
- Seite 144 und 145: Tinnitus (Tinnitus aurium; lat. „
- Seite 146 und 147: Tourette-Syndrom Das Tourette-Syndr
- Seite 148 und 149: Turner-Syndrom Das Turner-Syndrom (
- Seite 150 und 151: Williams-Beuren-Syndrom Das William
- Seite 152 und 153: Wiskott-Aldrich-Syndrom Das Wiskott
- Seite 154 und 155: Zerebralparese Infantile Zerebralpa
- Seite 156 und 157:
Zöliakie (Glutensensitive Enteropa
- Seite 158:
Zöliakie (Glutensensitive Enteropa
Unangemessen
Laden...
Magazin per E-Mail verschicken
Laden...
Einbetten
Laden...
Gemeinsam für Selten
About us
Doch allein in Österreich leben rund 400.000 Menschen, die direkt oder indirekt von sogenannten "seltenen Erkrankungen" betroffen sind.

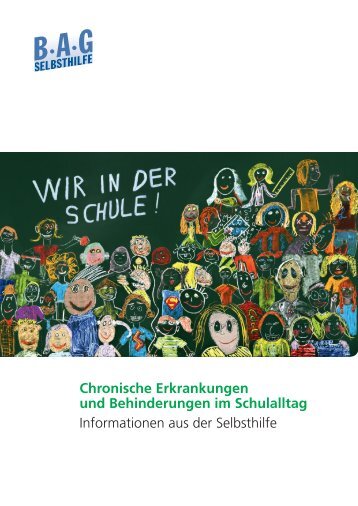
Follow Us
Youtube