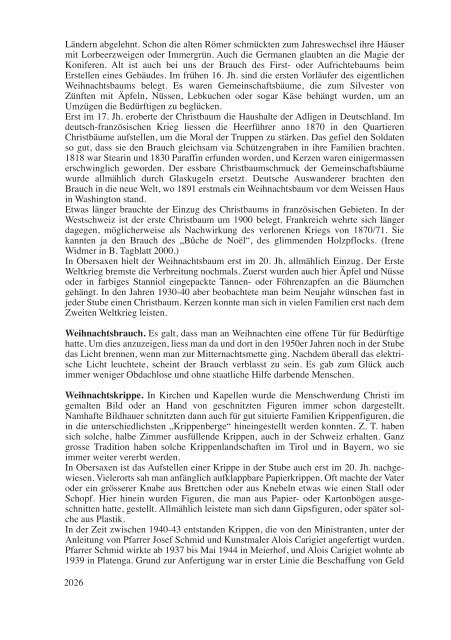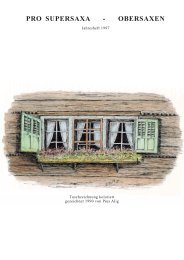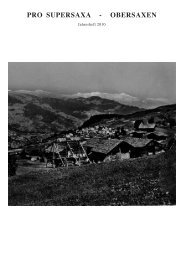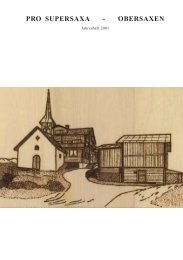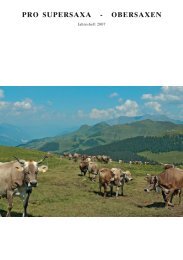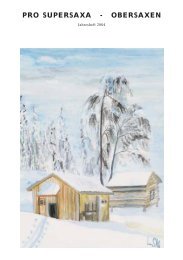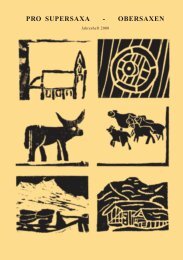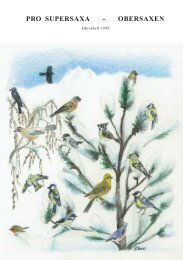Jahresheft 2009 - pro supersaxa
Jahresheft 2009 - pro supersaxa
Jahresheft 2009 - pro supersaxa
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ländern abgelehnt. Schon die alten Römer schmückten zum Jahreswechsel ihre Häuser<br />
mit Lorbeerzweigen oder Immergrün. Auch die Germanen glaubten an die Magie der<br />
Koniferen. Alt ist auch bei uns der Brauch des First- oder Aufrichtebaums beim<br />
Erstellen eines Gebäudes. Im frühen 16. Jh. sind die ersten Vorläufer des eigentlichen<br />
Weihnachtsbaums belegt. Es waren Gemeinschaftsbäume, die zum Silvester von<br />
Zünften mit Äpfeln, Nüssen, Lebkuchen oder sogar Käse behängt wurden, um an<br />
Umzügen die Bedürftigen zu beglücken.<br />
Erst im 17. Jh. eroberte der Christbaum die Haushalte der Adligen in Deutschland. Im<br />
deutsch-französischen Krieg liessen die Heerführer anno 1870 in den Quartieren<br />
Christbäume aufstellen, um die Moral der Truppen zu stärken. Das gefiel den Soldaten<br />
so gut, dass sie den Brauch gleichsam via Schützengraben in ihre Familien brachten.<br />
1818 war Stearin und 1830 Paraffin erfunden worden, und Kerzen waren einigermassen<br />
erschwinglich geworden. Der essbare Christbaumschmuck der Gemeinschaftsbäume<br />
wurde allmählich durch Glaskugeln ersetzt. Deutsche Auswanderer brachten den<br />
Brauch in die neue Welt, wo 1891 erstmals ein Weihnachtsbaum vor dem Weissen Haus<br />
in Washington stand.<br />
Etwas länger brauchte der Einzug des Christbaums in französischen Gebieten. In der<br />
Westschweiz ist der erste Christbaum um 1900 belegt. Frankreich wehrte sich länger<br />
dagegen, möglicherweise als Nachwirkung des verlorenen Kriegs von 1870/71. Sie<br />
kannten ja den Brauch des „Bûche de Noël“, des glimmenden Holzpflocks. (Irene<br />
Widmer in B. Tagblatt 2000.)<br />
In Obersaxen hielt der Weihnachtsbaum erst im 20. Jh. allmählich Einzug. Der Erste<br />
Weltkrieg bremste die Verbreitung nochmals. Zuerst wurden auch hier Äpfel und Nüsse<br />
oder in farbiges Stanniol eingepackte Tannen- oder Föhrenzapfen an die Bäumchen<br />
gehängt. In den Jahren 1930-40 aber beobachtete man beim Neujahr wünschen fast in<br />
jeder Stube einen Christbaum. Kerzen konnte man sich in vielen Familien erst nach dem<br />
Zweiten Weltkrieg leisten.<br />
Weihnachtsbrauch. Es galt, dass man an Weihnachten eine offene Tür für Bedürftige<br />
hatte. Um dies anzuzeigen, liess man da und dort in den 1950er Jahren noch in der Stube<br />
das Licht brennen, wenn man zur Mitternachtsmette ging. Nachdem überall das elektrische<br />
Licht leuchtete, scheint der Brauch verblasst zu sein. Es gab zum Glück auch<br />
immer weniger Obdachlose und ohne staatliche Hilfe darbende Menschen.<br />
Weihnachtskrippe. In Kirchen und Kapellen wurde die Menschwerdung Christi im<br />
gemalten Bild oder an Hand von geschnitzten Figuren immer schon dargestellt.<br />
Namhafte Bildhauer schnitzten dann auch für gut situierte Familien Krippenfiguren, die<br />
in die unterschiedlichsten „Krippenberge“ hineingestellt werden konnten. Z. T. haben<br />
sich solche, halbe Zimmer ausfüllende Krippen, auch in der Schweiz erhalten. Ganz<br />
grosse Tradition haben solche Krippenlandschaften im Tirol und in Bayern, wo sie<br />
immer weiter vererbt werden.<br />
In Obersaxen ist das Aufstellen einer Krippe in der Stube auch erst im 20. Jh. nachgewiesen.<br />
Vielerorts sah man anfänglich aufklappbare Papierkrippen. Oft machte der Vater<br />
oder ein grösserer Knabe aus Brettchen oder aus Knebeln etwas wie einen Stall oder<br />
Schopf. Hier hinein wurden Figuren, die man aus Papier- oder Kartonbögen ausgeschnitten<br />
hatte, gestellt. Allmählich leistete man sich dann Gipsfiguren, oder später solche<br />
aus Plastik.<br />
In der Zeit zwischen 1940-43 entstanden Krippen, die von den Ministranten, unter der<br />
Anleitung von Pfarrer Josef Schmid und Kunstmaler Alois Carigiet angefertigt wurden.<br />
Pfarrer Schmid wirkte ab 1937 bis Mai 1944 in Meierhof, und Alois Carigiet wohnte ab<br />
1939 in Platenga. Grund zur Anfertigung war in erster Linie die Beschaffung von Geld<br />
2026