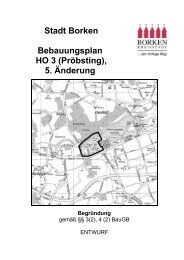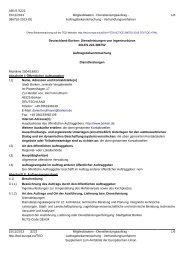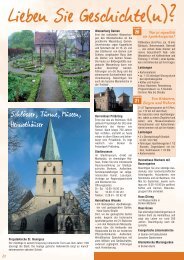SEP Borken_Projektbericht - Stadt Borken
SEP Borken_Projektbericht - Stadt Borken
SEP Borken_Projektbericht - Stadt Borken
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 5<br />
1 Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel<br />
1.1 Problembezug<br />
Das Verhältnis zwischen <strong>Stadt</strong> und Sport ist einem turbulenten Wandel begriffen. Für die<br />
kommunale Sportpolitik ergeben sich damit viele neue Herausforderungen. Lange Zeit eher<br />
verwöhnt durch ein elementares und klar strukturiertes Medium, wird sie mit einem<br />
mittlerweile äußerst dynamischen Komplex von Sport, Alltagskultur, Körperbewusstsein und<br />
Lebensstil konfrontiert, der das Medium grundlegend verändert. Die Städte der Gegenwart,<br />
die ohnehin schon durch den beschleunigten sozialen Wandel und die Informations- und<br />
Zeichenflüsse der Globalisierung um eine neue Identität in Zeit und Raum sowie<br />
verschobenen Standortparametern ringen müssen, sehen sich auch mit einem „Neuen Sport“<br />
konfrontiert. Auch er ist wie vieles im Zeitalter der Globalisierung vielfältiger, dynamischer,<br />
unberechenbarer geworden; er lässt sich nicht mehr mit leichter Hand verwalten oder<br />
dirigieren.<br />
Tatsächlich sind die Städte Schauplatz einer tiefgreifenden Individualisierung des Sportverständnisses.<br />
Die Inlineskater und jugendlichen Skateboardfahrer, die ihren Sport auf<br />
Gehwegen, Plätzen, Straßen, Treppen, Parkdecks, Wirtschaftswegen und Parks ausüben, sind<br />
ein Beispiel dafür, dass viele Sportarten der Gegenwart, speziell die Trendsportarten, völlig<br />
neue Raumansprüche stellen und damit eine eigenwillige, neue städtische "Raumpolitik"<br />
betreiben. Auf die Prozesse eines beschleunigten sozialen Wandels geht weiterhin zurück,<br />
dass die Sportvereine mit ständig neuen Bedürfnissen ihrer Mitglieder konfrontiert werden.<br />
Trotz bemerkenswerter Leistungen vieler Vereine stagnieren die Mitgliederzahlen des<br />
gemeinnützigen Sports. In den Ballungsgebieten hingegen steigt die Zahl der<br />
Mitgliedschaften der kommerziellen Sportanbieter kontinuierlich.<br />
Verloren gegangen ist das Deutungs- und Organisationsmonopol der Vereine und Verbände.<br />
Die kommunale Sportpolitik kann nicht mehr von den klassischen Raumbindungen des<br />
organisierten Sports ausgehen, die die Sportaktivitäten auf die traditionellen Sportstätten,<br />
die Sportplätze und Hallen fixierten. Unverzeihlich wäre es, würde sie an einem klassischen<br />
Verständnis vom Sport festhalten, das die Sportausübung weitgehend auf die Kinder- und<br />
Jugendlichen sowie leistungswilligen jungen Erwachsenen festlegte. Brüchig geworden ist<br />
das traditionelle Einverständnis der kommunalen Sportpolitik, dass die Belange des Sports in<br />
einer <strong>Stadt</strong> ausschließlich oder doch weitgehend durch die Sportvereine und -verbände<br />
festgelegt und geregelt werden. Die Städte müssen in neuen Politikkategorien denken;<br />
Sportentwicklung hat es zunehmend mit der demographischen Entwicklung zu tun; sie muss<br />
mit der <strong>Stadt</strong>planung und -entwicklung, der Sozial- und Gesundheitspolitik wie auch der<br />
Bildungspolitik abgestimmt werden. Die sympathische Idee, dass der Sport nur eine schöne<br />
Nebensache sei, ist obsolet geworden.<br />
Eine aktive kommunale Sportpolitik muss weiterhin davon ausgehen, dass das Medium Sport<br />
bzw. Bewegung und körperliche Aktivität zu einem zentralen Bestandteil allgemeiner<br />
gesellschaftspolitischer Zielsetzungen geworden ist. Die Kommunen sind vor diesem<br />
Hintergrund die Arena, an denen sich die Hoffnungen und Perspektiven entsprechender