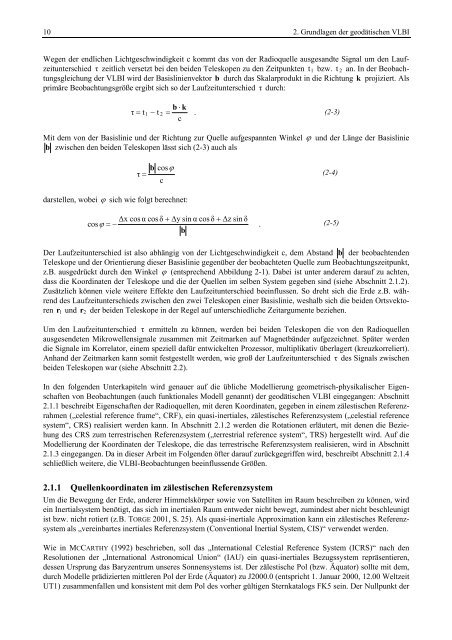Volker Tesmer - Deutsche Geodätische Kommission
Volker Tesmer - Deutsche Geodätische Kommission
Volker Tesmer - Deutsche Geodätische Kommission
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
10<br />
2. Grundlagen der geodätischen VLBI<br />
Wegen der endlichen Lichtgeschwindigkeit c kommt das von der Radioquelle ausgesandte Signal um den Laufzeitunterschied<br />
τ zeitlich versetzt bei den beiden Teleskopen zu den Zeitpunkten t 1 bzw. t 2 an. In der Beobachtungsgleichung<br />
der VLBI wird der Basislinienvektor b durch das Skalarprodukt in die Richtung k projiziert. Als<br />
primäre Beobachtungsgröße ergibt sich so der Laufzeitunterschied τ durch:<br />
b ⋅ k<br />
= t1<br />
− t = .<br />
c<br />
τ 2<br />
Mit dem von der Basislinie und der Richtung zur Quelle aufgespannten Winkel ϕ und der Länge der Basislinie<br />
b zwischen den beiden Teleskopen lässt sich (2-3) auch als<br />
b cosϕ<br />
τ =<br />
c<br />
darstellen, wobei ϕ sich wie folgt berechnet:<br />
∆x cos α cos δ + ∆y sin α cos δ + ∆z sin δ<br />
cosϕ<br />
= −<br />
.<br />
b<br />
Der Laufzeitunterschied ist also abhängig von der Lichtgeschwindigkeit c, dem Abstand b der beobachtenden<br />
Teleskope und der Orientierung dieser Basislinie gegenüber der beobachteten Quelle zum Beobachtungszeitpunkt,<br />
z.B. ausgedrückt durch den Winkel ϕ (entsprechend Abbildung 2-1). Dabei ist unter anderem darauf zu achten,<br />
dass die Koordinaten der Teleskope und die der Quellen im selben System gegeben sind (siehe Abschnitt 2.1.2).<br />
Zusätzlich können viele weitere Effekte den Laufzeitunterschied beeinflussen. So dreht sich die Erde z.B. während<br />
des Laufzeitunterschieds zwischen den zwei Teleskopen einer Basislinie, weshalb sich die beiden Ortsvektoren<br />
r 1 und r 2 der beiden Teleskope in der Regel auf unterschiedliche Zeitargumente beziehen.<br />
Um den Laufzeitunterschied τ ermitteln zu können, werden bei beiden Teleskopen die von den Radioquellen<br />
ausgesendeten Mikrowellensignale zusammen mit Zeitmarken auf Magnetbänder aufgezeichnet. Später werden<br />
die Signale im Korrelator, einem speziell dafür entwickelten Prozessor, multiplikativ überlagert (kreuzkorreliert).<br />
Anhand der Zeitmarken kann somit festgestellt werden, wie groß der Laufzeitunterschied τ des Signals zwischen<br />
beiden Teleskopen war (siehe Abschnitt 2.2).<br />
In den folgenden Unterkapiteln wird genauer auf die übliche Modellierung geometrisch-physikalischer Eigenschaften<br />
von Beobachtungen (auch funktionales Modell genannt) der geodätischen VLBI eingegangen: Abschnitt<br />
2.1.1 beschreibt Eigenschaften der Radioquellen, mit deren Koordinaten, gegeben in einem zälestischen Referenzrahmen<br />
(„celestial reference frame“, CRF), ein quasi-inertiales, zälestisches Referenzsystem („celestial reference<br />
system“, CRS) realisiert werden kann. In Abschnitt 2.1.2 werden die Rotationen erläutert, mit denen die Beziehung<br />
des CRS zum terrestrischen Referenzsystem („terrestrial reference system“, TRS) hergestellt wird. Auf die<br />
Modellierung der Koordinaten der Teleskope, die das terrestrische Referenzsystem realisieren, wird in Abschnitt<br />
2.1.3 eingegangen. Da in dieser Arbeit im Folgenden öfter darauf zurückgegriffen wird, beschreibt Abschnitt 2.1.4<br />
schließlich weitere, die VLBI-Beobachtungen beeinflussende Größen.<br />
2.1.1 Quellenkoordinaten im zälestischen Referenzsystem<br />
Um die Bewegung der Erde, anderer Himmelskörper sowie von Satelliten im Raum beschreiben zu können, wird<br />
ein Inertialsystem benötigt, das sich im inertialen Raum entweder nicht bewegt, zumindest aber nicht beschleunigt<br />
ist bzw. nicht rotiert (z.B. TORGE 2001, S. 25). Als quasi-inertiale Approximation kann ein zälestisches Referenzsystem<br />
als „vereinbartes inertiales Referenzsystem (Conventional Inertial System, CIS)“ verwendet werden.<br />
Wie in MCCARTHY (1992) beschrieben, soll das „International Celestial Reference System (ICRS)“ nach den<br />
Resolutionen der „International Astronomical Union“ (IAU) ein quasi-inertiales Bezugssystem repräsentieren,<br />
dessen Ursprung das Baryzentrum unseres Sonnensystems ist. Der zälestische Pol (bzw. Äquator) sollte mit dem,<br />
durch Modelle prädizierten mittleren Pol der Erde (Äquator) zu J2000.0 (entspricht 1. Januar 2000, 12.00 Weltzeit<br />
UT1) zusammenfallen und konsistent mit dem Pol des vorher gültigen Sternkatalogs FK5 sein. Der Nullpunkt der<br />
(2-3)<br />
(2-4)<br />
(2-5)