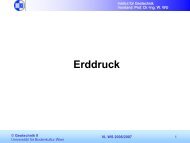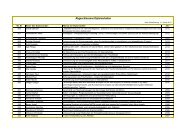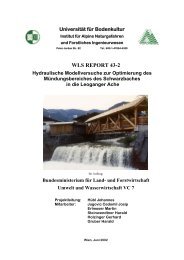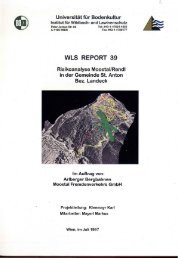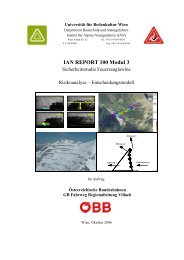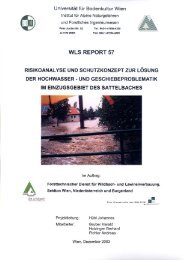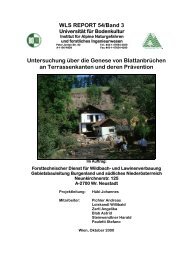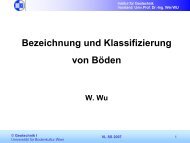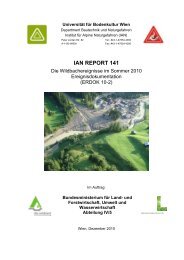Einsatz von Beton für Schutzbauwerke gegen Wildbachgefahren
Einsatz von Beton für Schutzbauwerke gegen Wildbachgefahren
Einsatz von Beton für Schutzbauwerke gegen Wildbachgefahren
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Publiziert in: Zement und <strong>Beton</strong> 3/2008<br />
Kombinationsbauwerke (z.B. Sperre – Straßenbrücke) relevant sein. Zur Sicherstellung eines<br />
ausreichenden Widerstandes des <strong>Beton</strong>s und einer ausreichenden Dauerhaftigkeit der Bewehrung<br />
sind die Anforderungen an die Mindestbetondeckung in ÖNORM B 1992-1-1 und die<br />
<strong>Beton</strong>zusammensetzungen und -eigenschaften nach ÖNORM B 4710-1 einzuhalten.<br />
4.2 Chemischer Angriff<br />
Die Anforderungen an einen chemischen Angriff (Expositionsklassen XA) durch Hang- und<br />
Bachwasser können nicht generalisiert werden. Im Einzelfall sind lösende (L) oder treibende (T)<br />
Angriffsarten oder beides möglich. Die Zusammensetzung des Bachwassers ist <strong>von</strong> den<br />
geologischen und biologischen Charakteristika des Einzugsgebietes abhängig. Gebirgs- und<br />
Quellwasser ist oft chemisch rein, kann jedoch kalkaggressive Kohlensäure enthalten. Moorwasser<br />
enthält oft kalkaggressive Kohlensäure, Schwefelwasserstoff und Sulfate sowie organische Säuren<br />
(z.B. Huminsäuren). Sulfathältige Oberflächenabflüsse treten in Gebieten mit gipsführenden<br />
geologischen Schichten auf. Huminsäuren sind in Gewässern aus bewaldeten Gebieten mit einem<br />
hohen Grundumsatz an Biomasse (Verrottung) enthalten. Weites gilt es zu beachten, dass<br />
chemische Angriffe auf Sperrenbauwerke den Hydroabrasivverschleiß verstärken<br />
(Komplexbeanspruchung).<br />
4.3 Hydroabrasivverschleiß<br />
Wildbachsperren sind ab einem fluviatilen Feststofftransport durch die im Wasser mitgeführten<br />
Feststoffe einem erhöhten Hydroabrasivverschleiß ausgesetzt. Dieser Verschleiß tritt an allen vom<br />
Bachwasser direkt angeströmten Sperrenteilen auf. Die Abtragsrate eines <strong>Beton</strong>s in einem solchen<br />
Bereich ist abhängig <strong>von</strong> der <strong>Beton</strong>druckfestigkeit, der Geschiebefracht, der Intensität der<br />
Geschiebeführung, der Kornzusammensetzung der Feststoffe und der Form des Bauwerkes. In<br />
der Regel ist <strong>für</strong> betroffene Oberflächen die Expositionsklasse XM3 maßgeblich. Da allerdings<br />
diese Beanspruchung auf wenige Flächen der Sperre beschränkt ist (z.B. Abflusssektion) wird die<br />
erforderliche <strong>Beton</strong>zusammensetzung nach 4.1 gewählt und die beanspruchten Flächen speziell<br />
konstruktiv geschützt. Die gebräuchlichsten Konstruktiven Maßnahmen sind Kronsteine und<br />
Panzerbleche. Dabei wird die überströmte Bauwerkskrone durch hochabriebfeste Kronensteine<br />
(Granit, Porphyr, Basalt, harte Kalksteine) oder durch Stahlblech mit Dicken zwischen 8 und<br />
20 mm geschützt (Abb. 4, A,B,C). Die Stahlbleche werden mit aufgeschweißten Kopfbolzen im<br />
<strong>Beton</strong>körper verankert.<br />
4.4 <strong>Beton</strong>deckung<br />
Die <strong>Beton</strong>deckung ist in Abhängigkeit der Expositionsklassen nach ÖNORM B 4710-1, festzulegen<br />
sollte aber in keinem Querschnitt weniger als 3,5 cm betragen. In der Praxis werden <strong>für</strong><br />
Sperrenbauwerke generell <strong>Beton</strong>deckungen über 5,5 cm verwendet. Dies ist nicht zuletzt durch die<br />
Vorgabe bei <strong>Beton</strong>einbau unter Wasser oder <strong>gegen</strong> nur grob maßhaltige Flächen wie z.B. Erdreich<br />
oder Fels <strong>von</strong> 7 cm ± 3 cm bedingt. Da im Fundamentbereich und im unteren aufgehenden<br />
Seite 14