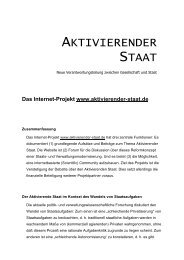Bernhard Blanke: „Erzählungen“ vom Aktivierenden Staat - ISPS eV
Bernhard Blanke: „Erzählungen“ vom Aktivierenden Staat - ISPS eV
Bernhard Blanke: „Erzählungen“ vom Aktivierenden Staat - ISPS eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
werden sollen, fehlt – außer den allgemeinen Fundamenten des Rechtsstaates – die<br />
Voraussetzung für das Erfordernis der öffentlichen Relevanz. Das bedeutet, dass der<br />
Unterschied, der den Unterschied macht, die Trennlinie privat-öffentlich darstellt. Aber<br />
auch diese ist verhandelbar. In der weiteren Entwicklung des zivilgesellschaftlichen Diskurses<br />
bleibt sie aber allzu häufig nebulös.<br />
Die Enquete-Kommission zum Bürgerschaftlichen Engagement verwendete die Begriffe<br />
Bürgergesellschaft und Zivilgesellschaft explizit synonym. Scharfsinnig hatte ein Mitglied der<br />
Kommission bereits eingewandt:<br />
„Während Bürgergesellschaft die Vision einer Gesellschaft beschreibt, in der Bürgerinnen<br />
und Bürger ihre Rechte und Pflichten im Sinne von citoyens voll ausleben können,<br />
kennzeichnet der Begriff der Zivilgesellschaft den Ausschnitt der gesellschaftlichen<br />
Wirklichkeit, der die selbstermächtigten, selbstorganisierten und selbstverantwortlichen<br />
Tätigkeiten und Körperschaften beinhaltet“ (Rupert Graf Strachwitz, Bericht, S. 60).<br />
Der Begriff der Zivilgesellschaft bleibt in seiner Wirkung einer eher ordnungspolitischen,<br />
organisationspolitischen und sektoralen Denkweise verhaftet, die mit spezifischen policy<br />
communities (insbesondere der Freien Wohlfahrt) verbunden ist. Unterscheidet man aber<br />
civic und civil, kommt der erste Begriff dem „<strong>Aktivierenden</strong> <strong>Staat</strong>“ näher, weil er den<br />
„Bürger im <strong>Staat</strong>“ bezeichnet, der seine autonome Rolle keineswegs unterschätzt.<br />
In der Bürgerbefragung in Niedersachsen, auf deren empirischer Grundlage das auch von<br />
mir zu verantwortende Konzept des <strong>Aktivierenden</strong> <strong>Staat</strong>es basiert, wurde diese Trennlinie von<br />
den befragten Bürgern deutlich herausgearbeitet. Aber das weitere wichtige Ergebnis der<br />
Befragung war, dass der Kerngedanke der Kooperation von <strong>Staat</strong> und Bürgern und der<br />
Koproduktion öffentlicher Leistungen (vgl. <strong>Blanke</strong>/Schridde 1999; Braun 2001) keineswegs<br />
eine theoretische Konstruktion darstellt, sondern von den befragten Bürgerinnen und Bürgern<br />
(selbstredend mit den bekannten sozialstrukturellen Unterschieden) geteilt wurde. In der<br />
Interpretation der Daten sind wir noch weitergegangen und haben einen „psychologischen<br />
Vertrag“ zwischen <strong>Staat</strong> und Bürgern entdeckt, der impliziert, dass die Bürger nur dann zu<br />
über die Privatinitiative hinausgehender Eigentätigkeit und Eigenverantwortung zu bewegen<br />
sind, wenn sie das Vertrauen haben, dass der <strong>Staat</strong> dies nicht nur zu seiner eigenen<br />
Entlastung fordert, sondern selbst alle seine Potentiale einer ‚guten Regierung‘ ausschöpft.<br />
Insbesondere wird <strong>vom</strong> <strong>Staat</strong> erwartet, dass er sich selbst bezüglich guter Haushaltswirtschaft<br />
und Politikmanagement aktiviert. Das Konzept der Partizipation bezieht sich dann weniger<br />
auf weitere Aktivierung im direktdemokratischen und repräsentativen Bereich des politischen<br />
Systems, sondern darauf, den Bürger „mit eigenverantwortlichen Leistungen in den<br />
Produktionsprozess öffentlicher Leistungen“ einzubinden. „Die Potentiale des<br />
Bürgerengagements sollen Synergieeffekte für die <strong>Staat</strong>smodernisierung erzeugen“<br />
(<strong>Blanke</strong>/Schridde 1999, S. 5; vgl. hierzu auch Klages 1998; Bogumil 2005 und das<br />
interessante Resümee bei Embacher/Lang 2008, S. 213-237).<br />
In einer Spiegelbefragung der Mitarbeiter des Landes Niedersachsen zur <strong>Staat</strong>modernisierung<br />
und Verwaltungsreform sollte die komplementäre Aufnahmebereitschaft der Verwaltung<br />
abgefragt werden, und wir fanden analoge Vorstellungen (<strong>Blanke</strong>/Schridde/Metje 2000).<br />
Für uns war damit der „Managementzyklus“ (Abb. 1) wieder geschlossen.<br />
Theorien im Hintergrund<br />
Schon als Ergebnis der „Sozialbilanz Niedersachsen“ stand für uns der Slogan fest: statt<br />
„schleichender Privatisierung neue Verantwortungsverteilung“ (<strong>Blanke</strong>/von Bandemer 1995).<br />
Nun ist auch diese Vorstellung als solche nicht originell. In der öffentlichrechtlichen Theorie<br />
des Gewährleistungsstaates, die über die Mitarbeit von Gunnar Folke Schuppert (siehe auch<br />
die Überblicke bei Schuppert 2003) in die Reformdebatte auf Bundesebene eingebracht<br />
9