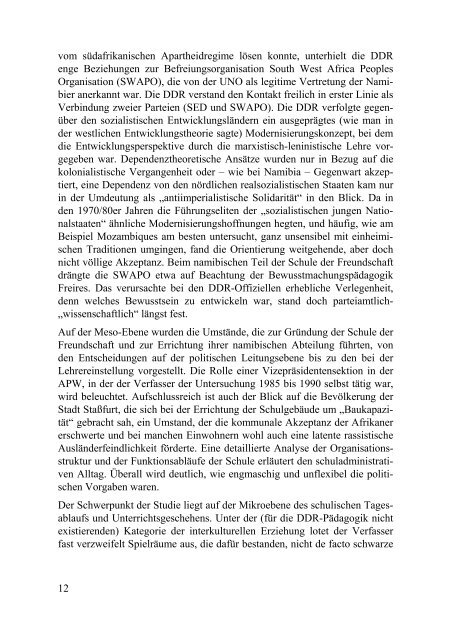- Seite 1 und 2: Schriftenreihe des Interdisziplinä
- Seite 3 und 4: Oldenburg, 2009 Verlag / Druck / Ve
- Seite 5 und 6: 5 Namibische Schulbildung im afrika
- Seite 7 und 8: Anhang A/1 In der Studie zitierte L
- Seite 12: DDR-Deutsche sondern Namibier mit m
- Seite 15 und 16: listischen Einheitspartei Deutschla
- Seite 17 und 18: Insgesamt sechsmal nutzte ich in di
- Seite 20 und 21: 1 Einleitung 1.1 Problemstellung un
- Seite 22 und 23: Das Maß aller Dinge war nun nicht
- Seite 24 und 25: Erst allmählich setzt sich eine re
- Seite 26 und 27: ichtsgeschehen, seiner Planung und
- Seite 28 und 29: untypischer Inhalte und der Konzipi
- Seite 30 und 31: schung auf Afrika und/oder Namibia
- Seite 32 und 33: Entscheidend für die Wahl der Einz
- Seite 34 und 35: ließ sich in gewissen Grenzen halt
- Seite 36 und 37: Im Sinne der Realisierung der Ziels
- Seite 38 und 39: Die Funktion der Verdichtung der du
- Seite 40 und 41: − in Aussagen zur Vorgeschichte d
- Seite 42 und 43: Einrichtung keinerlei Erwähnung.
- Seite 44 und 45: Auch Röhner’s Dissertation (B) 1
- Seite 46 und 47: Kolonialismus, wie z. B. Apartheid
- Seite 48 und 49: 2 Internationale Solidarität und B
- Seite 50 und 51: Antiimperialistische Solidarität w
- Seite 52 und 53: Nichtdiskriminierung, gegenseitigem
- Seite 54 und 55: integrativen Bestandteil außenpoli
- Seite 56 und 57: Jugendliche in 37 Facharbeiterberuf
- Seite 58 und 59: Vor allem im Partei- und Staatsappa
- Seite 60 und 61:
Solidaritätsspende [...] überweis
- Seite 62 und 63:
äußerst diffus seien. Vom Sieg de
- Seite 64 und 65:
Tanzania Berufsausbildungszentrum I
- Seite 66 und 67:
„Als sich das SED-Politbüro am 4
- Seite 68 und 69:
Das Solidaritätskomitee lieferte v
- Seite 70 und 71:
Im Bericht des Solidaritätskomitee
- Seite 72 und 73:
folge von Neuzugängen im gleichen
- Seite 74:
und der MPLA, bzw. den seit 1975 po
- Seite 77 und 78:
dienen hatte. Vorrangiges Ziel war
- Seite 79 und 80:
für die zu erwartenden 900 Schüle
- Seite 81 und 82:
Leitungskader mit Wohnraum zu verso
- Seite 83 und 84:
Im Protokoll zum Abkommen wurde u.
- Seite 85 und 86:
kommenden Herbst (werden) 1.00016 (
- Seite 87 und 88:
Zwei Tage darauf wurde die SdF feie
- Seite 89 und 90:
die Schule der Freundschaft in Sta
- Seite 91 und 92:
ier nur sehr wenig an die Öffentli
- Seite 93 und 94:
einer Gesellschaftsordnung, die nic
- Seite 95 und 96:
‚ungefiltert‘, in der Schulbibl
- Seite 97 und 98:
das eigentlich Pädagogische durcha
- Seite 99 und 100:
hoek) Dass sich die Meinung vieler
- Seite 101 und 102:
wenig herausstellte“. (vgl. Kraus
- Seite 103 und 104:
Scheitern der Schule vorhersehbar g
- Seite 105 und 106:
Scheunpflug in ihrer Fallstudie „
- Seite 107 und 108:
Angola - Kuba25 , das für Anlage,
- Seite 109 und 110:
wachsen und zu verdeutlichen, was d
- Seite 111 und 112:
lich Verfasser, die sich erst nach
- Seite 113 und 114:
lichung (?) von Behnke „Zum Afrik
- Seite 115 und 116:
ehemaligen Erziehern, Schulfunktion
- Seite 117 und 118:
− die Interpretation der Intervie
- Seite 119 und 120:
In einem von mir im September 2000
- Seite 121 und 122:
122 Betrachtung eines Außenstehend
- Seite 124 und 125:
5 Namibisches Bildungswesen im afri
- Seite 126 und 127:
afrikanischen Privilegien ausgestat
- Seite 128 und 129:
der Weltgesundheitsorganisation beh
- Seite 130 und 131:
Folge eine beinahe Verdoppelung der
- Seite 132 und 133:
1988, S. 259) Derart qualifizierte
- Seite 134 und 135:
Modell diente15 , war im Jahre 1977
- Seite 136 und 137:
Mutumbatuli: It was Thursday mornin
- Seite 138 und 139:
There were many people of various a
- Seite 140 und 141:
pien der von der Apartheid-Regierun
- Seite 142 und 143:
a) die Befreiung und die Erlangung
- Seite 144 und 145:
3) Die Schaffung der Voraussetzunge
- Seite 146 und 147:
Das für das zukünftige Namibia
- Seite 148 und 149:
Randländer, den Bantustans bzw. Ho
- Seite 150 und 151:
obwohl dem Department of Bantu Educ
- Seite 152 und 153:
Jugendlichen im außerunterrichtlic
- Seite 154 und 155:
gend. Bemängelt wurde, dass das ak
- Seite 156 und 157:
Für die in den ‚Exile-Camps‘ m
- Seite 158 und 159:
Für die Erziehung der namibischen
- Seite 160 und 161:
die eigentlich, einen sinnvollen Ü
- Seite 162 und 163:
Die Autorin des Artikels (Groß, Ko
- Seite 164 und 165:
120 namibische Schüler (60 % Mädc
- Seite 166 und 167:
Die Zelte, ohne sichtbare Ordnung a
- Seite 168 und 169:
In einem Gespräch, das Engombe, eh
- Seite 170 und 171:
Exile-Camps und den noch weitgehend
- Seite 172 und 173:
In Absprache mit der ‚Rheinische(
- Seite 174 und 175:
dort unterrichtenden Pädagogen ang
- Seite 176 und 177:
the younger children who came from
- Seite 178 und 179:
Die Realität des Lagerlebens war j
- Seite 180 und 181:
Die enorm große Zahl von Schülern
- Seite 182 und 183:
wie sie unmittelbar einen sinnvolle
- Seite 184 und 185:
Eine einheitliche afrikanische Spra
- Seite 186 und 187:
8. Technical (at least one skills d
- Seite 188 und 189:
den Owambos, 79 die allerdings kein
- Seite 190 und 191:
in Staßfurt. Seitens der APW war e
- Seite 192 und 193:
„als eine leicht verständliche E
- Seite 194 und 195:
Swaziland Distance Learning Associa
- Seite 196 und 197:
diesem Wege den Schülern ihre Heim
- Seite 198 und 199:
doch, daß einige der Bücher nicht
- Seite 200 und 201:
Namibia bezogene Erziehungsziele un
- Seite 202 und 203:
The whole breakdown of what is inte
- Seite 204 und 205:
Das Ergebnis für das Fach Mathemat
- Seite 206 und 207:
Verantwortlichen der APW für die w
- Seite 208 und 209:
Das Engagement der Pädagogen endet
- Seite 210 und 211:
falls vom ANC, ohne Jahr) trägt de
- Seite 212 und 213:
den - oft in halbzerstörten Häuse
- Seite 214 und 215:
teten oder (nur) übernommenen Mate
- Seite 216 und 217:
Doch darüber schweigt er sich in s
- Seite 218 und 219:
obwohl namibische Kinder als Ausdru
- Seite 220 und 221:
Victor Candy, einem zu damaliger Ze
- Seite 222 und 223:
Jedoch versuchte auch die SWAPO-Fü
- Seite 224 und 225:
Tab. 7 Geburtsorte und Regionen, de
- Seite 226 und 227:
„2. Die DDR sichert die Beschulun
- Seite 228 und 229:
takte zu einer Reihe von Fach- und
- Seite 230 und 231:
S. 1) in der Kreisleitung der SED S
- Seite 232 und 233:
Der Informant, in seiner Sorge um d
- Seite 234 und 235:
„Die ‚Schule der Freundschaft
- Seite 236 und 237:
6 Zur Beschulung namibischer Kinder
- Seite 238 und 239:
mus und proletarischen Internationa
- Seite 240 und 241:
ürgerlichen Schule und Pädagogik
- Seite 242 und 243:
kritischen Reflexion und Weiterentw
- Seite 244 und 245:
ik, VDR Jemen, Äthiopien, Cuba, Ni
- Seite 246 und 247:
„So besteht mit sozialistischen L
- Seite 248 und 249:
Einen Monat vor der Ausreise der na
- Seite 250 und 251:
liche Tätigkeit. In der Oberschule
- Seite 252 und 253:
Löderburg“ (vgl. Krause 1988, A/
- Seite 254 und 255:
Tab. 8 Ministerium für Volksbildun
- Seite 256 und 257:
Tab. 9 Stundentafel der ‚10-klass
- Seite 258 und 259:
wie viele andere didaktischen Mater
- Seite 260 und 261:
− „Die APW ist bereit, bei notw
- Seite 262 und 263:
Schullehrpläne und die daraus abge
- Seite 264 und 265:
gesetzten Ziele (siehe Bildungsgese
- Seite 266 und 267:
Im Grunde handelte es sich dabei um
- Seite 268 und 269:
Belletristik, populärwissenschaftl
- Seite 270 und 271:
Namibia, sind in einigen Fächern
- Seite 272 und 273:
nehmen war. Was wohl auch der globa
- Seite 274 und 275:
zur Hinzufügung (‚Aufpfropfung
- Seite 276 und 277:
nen Tendenzen schwarzen Rassismus
- Seite 278 und 279:
ücher der POS, Basis des Geschicht
- Seite 280 und 281:
Ein Positivum der RLP bestand vor a
- Seite 282 und 283:
diametral entgegengesetzt stand die
- Seite 284 und 285:
UdSSR aufkeimenden ‚Öffnung und
- Seite 286 und 287:
Die meisten Akzentuierungen finden
- Seite 288 und 289:
gen Befreiungskampf der SWAPO vom v
- Seite 290 und 291:
forschend in die weitestgehenden je
- Seite 292 und 293:
Einige Passagen aus dieser Tagung:
- Seite 294 und 295:
Entsprechend der Arbeitsstandpunkte
- Seite 296 und 297:
dem Leben im Exil, von Natur und Um
- Seite 298 und 299:
Befreiung Namibias, in den Kinder w
- Seite 300 und 301:
Dazu gehörten die Fächer: − Mat
- Seite 302 und 303:
elletristischer Literatur für den
- Seite 304 und 305:
Den Aufgaben der Handreichung sind
- Seite 306 und 307:
schen Armee durch Geld korrumpiert
- Seite 308 und 309:
gehend selbst dazu beitragen zu kö
- Seite 310 und 311:
den Siegen des Menschen - von dem T
- Seite 312 und 313:
Ein wesentliches Ziel des Deutschun
- Seite 314 und 315:
gen dazu aufgefordert, von dem Ange
- Seite 316 und 317:
Verantwortlichen der APW, die es f
- Seite 318 und 319:
nen Anlass, im Rahmen von Veränder
- Seite 320 und 321:
Hier nun einige konkrete Beispiele
- Seite 322 und 323:
schaften u.a.m. Bei allem bestand d
- Seite 324 und 325:
Einer Notiz von Plötz (wissenschaf
- Seite 326 und 327:
und ein erstes schriftliches Dokume
- Seite 328 und 329:
mir geglückt, dass noch wenigstens
- Seite 330 und 331:
anzuerziehen. Rein auf den schulisc
- Seite 332 und 333:
erarbeitet wurden, kann sie (die Le
- Seite 334 und 335:
schen Schüler konzeptionell und pr
- Seite 336 und 337:
8. wurde weiterhin festgelegt, dass
- Seite 338 und 339:
Konzeption für die 10. Klasse war
- Seite 340 und 341:
etische Kenntnisse in Einheit mit K
- Seite 342 und 343:
plan (Entwurf) Politische Erziehung
- Seite 344 und 345:
Die Genossen hier an der Schule hel
- Seite 346 und 347:
sich dabei - siehe oben - um ‚ana
- Seite 348 und 349:
fahren (Ormig-Abzüge) seine Fortse
- Seite 350 und 351:
Dass der Musikunterricht an der SdF
- Seite 352 und 353:
in der siebenten Klassenstufe mit j
- Seite 354 und 355:
[...] es ist nicht möglich, ab Kla
- Seite 356 und 357:
− Statistiken, − Karten, − au
- Seite 358 und 359:
weisen konnten. An ein mögliches K
- Seite 360 und 361:
leben. / Durch diese Stoffeinheit w
- Seite 362 und 363:
vivi’s106 Voranstellungen zu ‚E
- Seite 364 und 365:
Ideologien, vor allem im Sinne des
- Seite 366 und 367:
Besonders wichtig scheint mir jedoc
- Seite 368 und 369:
Group halt / stopp! Gruppe halt! At
- Seite 370 und 371:
let as praise lasst uns preisen Nuj
- Seite 372 und 373:
Juli 18. Geburtstag von Nelson Mand
- Seite 374 und 375:
Erziehungsprozesses besprochen, so
- Seite 376 und 377:
7 Epilog Eigentlich hatte ich mir s
- Seite 378 und 379:
Daran hat sich auch in der Folge ni
- Seite 380 und 381:
− zur Charakterisierung der SdF u
- Seite 382 und 383:
sucht zu werden. Doch hätte das de
- Seite 384 und 385:
Anhang A/1 In der Studie zitierte L
- Seite 386 und 387:
3 Unterrichtshilfen 466 3.1 Mathema
- Seite 388 und 389:
Auszüge aus den Grundsätzen der K
- Seite 390 und 391:
Döring, H.-J./Rüchel, U. (Hrsg.);
- Seite 392 und 393:
Grohs, G.; Zur Aufnahme afrikanisch
- Seite 394 und 395:
Kenna, C.; Ausstellung; Was ist aus
- Seite 396 und 397:
Krause, J.; Zum kolonialen Erbe und
- Seite 398 und 399:
Melber, H. (Hrsg.); Our Namibia. A
- Seite 400 und 401:
Radtke, F.-O./Gstettner, P./Streiff
- Seite 402 und 403:
Sielski, G.; Bundesrepublik Deutsch
- Seite 404 und 405:
Zinke, H.; Gespräch in der APW; 17
- Seite 406 und 407:
Heron, G./Ransford, E.; Mathematics
- Seite 408 und 409:
The English Group; Namibia Primary
- Seite 410 und 411:
Litzba, D./Merkelbach, H.; 100 Jahr
- Seite 412 und 413:
Zinke, S.; Lieder in englischer Spr
- Seite 414 und 415:
3.3 Afrikanische Geschichte (Beispi
- Seite 416 und 417:
4.9 Werkunterricht Werkunterricht;
- Seite 418 und 419:
A/4 Archivalien (Bundesarchiv Berli
- Seite 420 und 421:
Krause, J.; Die Lehrplankonzeption
- Seite 422 und 423:
A/5 Publizistik 1 Bücher, wiss. Ar
- Seite 424 und 425:
2 Presse (Zeitungen/Zeitschriften/P
- Seite 426 und 427:
14. Pressefoto (ADN-ZB/Schulz/22.5.
- Seite 428 und 429:
13. Rohbeck, B., Namibische Kinder
- Seite 430 und 431:
2001 1. Voigt, K.-P.; Staßfurterin
- Seite 432 und 433:
2006 1. Postler, E.; „Diese Jahre
- Seite 434 und 435:
A 6 Zeugnisse/Urkunden 1. Zeugnis
- Seite 436 und 437:
Klasse Fach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 De
- Seite 438 und 439:
Stundentafel für die Sonderklasse
- Seite 440 und 441:
2.3 Überarbeitete Stundentafel Ber
- Seite 442 und 443:
3.2 Präzisierte Stundentafel Berei
- Seite 444 und 445:
(1. und 2. Ausbildungsjahr). Der Un
- Seite 446 und 447:
A/9 Abkürzungsverzeichnis AAB Anti
- Seite 448 und 449:
ND Neues Deutschland (Presseorgan)
- Seite 450 und 451:
A/10 Vortragsmanuskript, Pädagogis
- Seite 452 und 453:
− „Er sprach englisch ... was s
- Seite 454 und 455:
(Seite 8) MINISTERIUM FÜR VOLKSBIL
- Seite 456 und 457:
2. Fächer, in denen Hinweise/Direk
- Seite 458 und 459:
− „Die heimatbezogene Erziehung
- Seite 460 und 461:
− Biologie − Kunsterz − Musik
- Seite 462 und 463:
− Inhalte und Werte: die für jed
- Seite 464 und 465:
1.4 English Language English Langua
- Seite 466 und 467:
6. TESTS − Preparatory test − F
- Seite 468 und 469:
Als Grundlage für diese von Wissen
- Seite 470 und 471:
ßende Berufsausbildung zu verschaf
- Seite 472 und 473:
− In der Ausbildung praktischer u
- Seite 474 und 475:
− die Fachzirkelleiter durch die
- Seite 476 und 477:
Die Winterferien verbringen die jun
- Seite 478 und 479:
(Seite 15) Die Klassensprecher alle
- Seite 480 und 481:
Donnerstag 1-2 Std. Hausaufgaben, F
- Seite 482 und 483:
(Seite 20) Politische Gedenktage, d
- Seite 484 und 485:
A/13 ‚Schule der Freundschaft‘
- Seite 486 und 487:
− Technik und Produktion in Über
- Seite 488 und 489:
3 Klassenstufe 7 3.1 Deutsche Sprac
- Seite 490 und 491:
4.3 Mathematik Lehrbuch für Klasse
- Seite 492 und 493:
− Mathematik, Klasse 8 (F) (00 08
- Seite 494 und 495:
der SLB beteiligt. Nur ein deutsche
- Seite 496 und 497:
Die Durchsetzung des Kapitalismus a
- Seite 498 und 499:
3.5 1. Lehrjahr Komplexe Übungen z
- Seite 500 und 501:
Einzellige Lebewesen Tierische Einz
- Seite 502 und 503:
10.2 Klassenstufe 8 Produktionsaufg
- Seite 504 und 505:
− Geographisch liegen Mosambik un
- Seite 506 und 507:
organisierte Jagd auf diese Tiere w
- Seite 508 und 509:
Thema: „Die Welt 1871“ Beispiel
- Seite 510 und 511:
3 Mathematik 3.1 Klassenstufe 5 (ke
- Seite 512 und 513:
in den Entwicklungsländern 175 geg
- Seite 514 und 515:
Thema: „Kohle“ Text: „In der
- Seite 516 und 517:
− „Vergleiche die Größe der K
- Seite 518 und 519:
− „Gepanzerte Fahrzeuge der Ras
- Seite 520 und 521:
4. Umschlagseite zum Lehrbuch „Ge
- Seite 522 und 523:
2. Geschichte − Klassenstufe 7
- Seite 524 und 525:
− Klassenstufe 8 „Der Wortschat
- Seite 526 und 527:
A/15 Analyse der Zusammenarbeit der
- Seite 528 und 529:
Positionen zu einigen inhaltlichen
- Seite 530 und 531:
ealität in den Einsatzländern, da
- Seite 532 und 533:
− In weitem Maße ausgelöst durc
- Seite 534 und 535:
Zusammenfassung Die vorliegende Arb
- Seite 536 und 537:
Abstract The present work was passe
- Seite 538 und 539:
Schriftenreihe des Interdisziplinä
- Seite 540 und 541:
29 Inga Scheumann: Die Weiterbildun