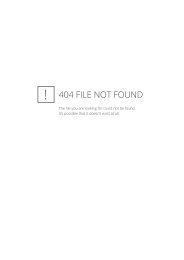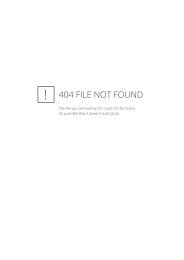- Seite 1 und 2: Deutscher Bundestag 8. Wahlperiode
- Seite 3 und 4: Der Rat von Sachverständigen für
- Seite 5 und 6: SITUATION DER UMWELT UND DEREN ENTW
- Seite 7 und 8: Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 9 und 10: Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 11 und 12: Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 13 und 14: 0 EINFÜHRUNG 1. Schutz und Sicheru
- Seite 15 und 16: 10. Im Umweltgutachten 1974 hat der
- Seite 17: Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 21 und 22: pen stellt das urban-industrielle S
- Seite 23 und 24: Abb. 2a — 2c Symbolerklärung: De
- Seite 25 und 26: Abb. 2h — 2j h - j: Agrarökosyst
- Seite 27 und 28: Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 29 und 30: anreichern können, so daß eine We
- Seite 31 und 32: Arten bei Stoffumsatz und Aufrechte
- Seite 33 und 34: 1.1.3.4 Schadstoffanreicherung in O
- Seite 35 und 36: Tabelle 3 Bruterfolge des Braunen P
- Seite 37 und 38: Marienkäfer und Florfliegen (z. Z.
- Seite 39 und 40: Tabelle 4 Belastungsgruppe Toxische
- Seite 41 und 42: der Gewässerüberwachung kann der
- Seite 43 und 44: 140. Demgegenüber ist die behandel
- Seite 45 und 46: Abb. 7 Deutscher Bundestag — 8. W
- Seite 47 und 48: kommen übertragen wird. Daneben gi
- Seite 49 und 50: Tabelle 5 Kombinationswirkungen bei
- Seite 51 und 52: unter Umweltbedingungen leicht übe
- Seite 53 und 54: Abb. 8 Deutscher Bundestag — 8. W
- Seite 55 und 56: Tabelle 9 Deutscher Bundestag — 8
- Seite 57 und 58: Verbindungen haben eine stärkere a
- Seite 59 und 60: Tabelle 11 Deutscher Bundestag —
- Seite 61 und 62: Folge, wodurch den Pflanzen weniger
- Seite 63 und 64: 1.1.7.6.3 Wirkungen auf Organismen
- Seite 65 und 66: (0,1 ppm), angegeben in Ozonäquiva
- Seite 67 und 68: wurden relativ hohe Nitrosaminmenge
- Seite 69 und 70:
Abb. 10 ner hat nicht das hohe Mage
- Seite 71 und 72:
256. Überpointiert wurde behauptet
- Seite 73 und 74:
an Wald- und Wegrändern ein reichh
- Seite 75 und 76:
Schäden. Es bleibt allerdings zu p
- Seite 77 und 78:
1.2 Grundbereiche der Umweltpolitik
- Seite 79 und 80:
schwere Schäden für die Ottomotor
- Seite 81 und 82:
Auf der Zieleb en e müssen die Hau
- Seite 83 und 84:
Maßnahmen von ihm allein zu vertre
- Seite 85 und 86:
serbedarfs rechnet die Versorgungsw
- Seite 87 und 88:
Für den unterschiedlichen Einsatz
- Seite 89 und 90:
342. Während die WHO schon 1958
- Seite 91 und 92:
Vergleich zu Gewässergütedaten de
- Seite 93 und 94:
Dies gilt auch innerhalb der als Be
- Seite 95 und 96:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 97 und 98:
Abb. 3 rungshilf en der Länder, so
- Seite 99 und 100:
Abb. 4 359. Die bisherigen Planunge
- Seite 101 und 102:
Phosphat-Frachten im Rhein. Die in
- Seite 103 und 104:
in Abhängigkeit von der jeweiligen
- Seite 105 und 106:
Der Rat empfiehlt dringend eine Üb
- Seite 107 und 108:
Abb. 7 Tabelle 6 Sedimenttiefe (cm)
- Seite 109 und 110:
aus auf die abwassertechnischen Ent
- Seite 111 und 112:
Lebhaftes Interesse der Bevölkerun
- Seite 113 und 114:
linie der EG wird erwartet (BMI-Umw
- Seite 115 und 116:
ein Rahmengesetz des Bundes mit der
- Seite 117 und 118:
mittelbar erhebliche Bedeutung zu.
- Seite 119 und 120:
3. Güteziele für Stoffe der Liste
- Seite 121 und 122:
437. 1. Die zu den Mindestanforderu
- Seite 123 und 124:
stehen" eine generelle Umschreibung
- Seite 125 und 126:
Gefahr: Beeinträchtigung der Trink
- Seite 127 und 128:
erkennbar, zu dem in der Bundesrepu
- Seite 129 und 130:
stiger Lösungen der weiterhin umfa
- Seite 131 und 132:
eeinflussenden Faktoren, insbesonde
- Seite 133 und 134:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 135 und 136:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 137 und 138:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 139 und 140:
Tabelle 2 Deutscher Bundestag — 8
- Seite 141 und 142:
Tabelle 3 Deutscher Bundestag — 8
- Seite 143 und 144:
Tabelle 4 Deutscher Bundestag — 8
- Seite 145 und 146:
anteil am Gesamtschwebestaub in Ver
- Seite 147 und 148:
Der Spitzenwert IW2 = 4 g/m3 wurde
- Seite 149 und 150:
516. Eine wesentliche Ursache für
- Seite 151 und 152:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 153 und 154:
pen (Feuerungen, Kraftstoff- und St
- Seite 155 und 156:
Stickstoff oxide 524. 1975 in Nordr
- Seite 157 und 158:
esonders zu beachten. Einmal werrde
- Seite 159 und 160:
534. Eine durchgreifende Senkung de
- Seite 161 und 162:
keiten steigen die Emissionen aller
- Seite 163 und 164:
für das weitere Vorgehen an. Der R
- Seite 165 und 166:
) Nach Immissionsmessungen und Simu
- Seite 167 und 168:
d) Für die Vorläufer von Oxidanti
- Seite 169 und 170:
Auf Grund ihrer thermodynamischen E
- Seite 171 und 172:
Tabelle 16 Herkunft/Anwendung Deuts
- Seite 173 und 174:
Tabelle 18 Deutscher Bundestag —
- Seite 175 und 176:
in Höhen über 30 km mit an Sicher
- Seite 177 und 178:
1) Die Verringerung des spezifische
- Seite 179 und 180:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 181 und 182:
noch Tabelle 1 Deutscher Bundestag
- Seite 183 und 184:
Tabelle 2 Deutscher Bundestag - 8.
- Seite 185 und 186:
Deutscher Bundestag - 8. Wahlperiod
- Seite 187 und 188:
nach Abfallgruppen und Wirtschaftsb
- Seite 189 und 190:
Tabelle 5 Deutscher Bundestag — 8
- Seite 191 und 192:
angefallen. Eine entsprechende Hoch
- Seite 193 und 194:
und Komplikationen der Zulassungsve
- Seite 195 und 196:
Bei den Sammel- und Transportsystem
- Seite 197 und 198:
Abfallbeseitigungsanlagen Nordrhein
- Seite 199 und 200:
schließlich Klärschlamm, Altreife
- Seite 201 und 202:
auf wenige Anlagen muß deshalb ein
- Seite 203 und 204:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 205 und 206:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 207 und 208:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 209 und 210:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 211 und 212:
In den betriebseigenen Anlagen wurd
- Seite 213 und 214:
Tabelle 12 Regierungsbezirk Land De
- Seite 215 und 216:
Einige Landesgesetze verpflichten K
- Seite 217 und 218:
alle Bundesländer anschlossen, ist
- Seite 219 und 220:
— bei allen Lücken im einzelnen
- Seite 221 und 222:
noch Tabelle 14 Ziele des Abfall wi
- Seite 223 und 224:
noch Tabelle 14 Ziele des Abfall wi
- Seite 225 und 226:
no ch Tabelle 14 Ziele des Abfall A
- Seite 227 und 228:
gramm genannten allgemeinen Maßnah
- Seite 229 und 230:
Haushaltungen, bei denen für 1972
- Seite 231 und 232:
lagen zurückgehen. Aktivitäten de
- Seite 233 und 234:
1.2.5 Lärmbekämpfung 1.2.5.1 Einf
- Seite 235 und 236:
(lautstarke Hobbies, Schießsport,
- Seite 237 und 238:
verlaufen und von baldigem Wiederei
- Seite 239 und 240:
tor-Variable im Hinblick auf Beläs
- Seite 241 und 242:
vermeidbar sind und naturgemäß mi
- Seite 243 und 244:
geworden (HASSEL, H. u. OELKERS H.
- Seite 245 und 246:
ausgesetzt sein als ländliche Wohn
- Seite 247 und 248:
ei verschiedenen Maschinen und Fahr
- Seite 249 und 250:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 251 und 252:
Tabelle 3 Deutscher Bundestag — 8
- Seite 253 und 254:
über den zulässigen Geräuschpege
- Seite 255 und 256:
Abb. 7 Deutscher Bundestag — 8. W
- Seite 257 und 258:
gen nicht vor. Man kann jedoch als
- Seite 259 und 260:
Abb. 10 Deutscher Bundestag — 8.
- Seite 261 und 262:
Abb. 12 Deutscher Bundestag — 8.
- Seite 263 und 264:
Abb. 13 Deutscher Bundestag — 8.
- Seite 265 und 266:
773. Die im letzten Jahrzehnt erheb
- Seite 267 und 268:
Tabelle 10 Betriebsart Deutscher Bu
- Seite 269 und 270:
— 145 auf die Beschränkung der B
- Seite 271 und 272:
783. Starke Geräusche, die von Mas
- Seite 273 und 274:
zielle Belastung der Träger der ge
- Seite 275 und 276:
zeuge unter Berücksichtigung von K
- Seite 277 und 278:
Spielstraßen). Für Bonn wurde ein
- Seite 279 und 280:
Tabelle 14 Beispiele für die Durch
- Seite 281 und 282:
gebung von Verkehrswegen und Indust
- Seite 283 und 284:
kehrsordnung ist bisher nicht erfü
- Seite 285 und 286:
825. Sobald die Eckdaten für den S
- Seite 287 und 288:
Gebäuden in der Schutzzone 2, für
- Seite 289 und 290:
1.2.6 Fremdstoffe in Lebensmitteln
- Seite 291 und 292:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 293 und 294:
schutzmittel angewandt, kaum Rücks
- Seite 295 und 296:
werden. Daher sind die zur Zeit gel
- Seite 297 und 298:
Weizen wurde durch Waschen und Troc
- Seite 299 und 300:
Tabelle 2 FLEISCH Deutscher Bundest
- Seite 301 und 302:
des Gleichgewichts wird durch den i
- Seite 303 und 304:
art 6 bis 12 % der untersuchten Pro
- Seite 305 und 306:
H.-A., 1975, WEINREICH, O., 1974, C
- Seite 307 und 308:
1.2.6.2.3 Polycyclische aromatische
- Seite 309 und 310:
1.2.6.3.1 Vorkommen in Lebensmittel
- Seite 311 und 312:
noch weiterer intensiver Grundlagen
- Seite 313 und 314:
Regelungen zu einem den Pestizidein
- Seite 315 und 316:
A b b. 1 a u. 1b Deutscher Bundesta
- Seite 317 und 318:
Abb. 1 e u. 1 f Deutscher Bundestag
- Seite 319 und 320:
Tabelle 2 Deutscher Bundestag — 8
- Seite 321 und 322:
Tabelle 4 Handelsdüngerverbrauch d
- Seite 323 und 324:
Tabelle 7 Auszugsweise Zusammenstel
- Seite 325 und 326:
sagt werden. Wegen des großen Ante
- Seite 327 und 328:
(vgl. Tz. 66 ff.), kann durch Kupfe
- Seite 329 und 330:
ten von stark mit Stickstoffdünger
- Seite 331 und 332:
wendet. (Obst- und Gemüseanbau üb
- Seite 333 und 334:
zu verwirklichen, sehr ernst genomm
- Seite 335 und 336:
scheint. Da auch hier Kenntnislück
- Seite 337 und 338:
durch Licht und folgendes Abtöten;
- Seite 339 und 340:
1.3 Komplexe Bereiche der Umweltpol
- Seite 341 und 342:
Positive Ergebnisse wurden bisher a
- Seite 343 und 344:
untereinander gerecht abzuwägen si
- Seite 345 und 346:
Die direkte Ableitung des Regenwass
- Seite 347 und 348:
1,3,1 13 Räumlich-funktionale Glie
- Seite 349 und 350:
planung lassen sich anhand des Plan
- Seite 351 und 352:
sichtigung auch dieser Verkehrsante
- Seite 353 und 354:
gung, -verteilung, -aufteilung und
- Seite 355 und 356:
genes Verhältnis zwischen öffentl
- Seite 357 und 358:
hat aber keine unmittelbare Rechtsw
- Seite 359 und 360:
1132. Als weiteres Beispiel für ei
- Seite 361 und 362:
wohl im Kostenmodell die explizite
- Seite 363 und 364:
1142. Hinsichtlich der zukünftigen
- Seite 365 und 366:
möglichst gering sein sollte, sind
- Seite 367 und 368:
Tabelle 3 Die Entwicklung des Perso
- Seite 369 und 370:
Beitrag des ÖPNV zur Umweltentlast
- Seite 371 und 372:
des gegenwärtigen Netzes 1) werden
- Seite 373 und 374:
— die Anpassungsfähigkeit an sic
- Seite 375 und 376:
Abb. 10 Deutscher Bundestag — 8.
- Seite 377 und 378:
Hochgeschwindigkeitszügen angefahr
- Seite 379 und 380:
gegenüber konventionellen Verkehrs
- Seite 381 und 382:
(Tab. 6). Insbesondere bei den Magn
- Seite 383 und 384:
Abb. 11 Deutscher Bundestag — 8.
- Seite 385 und 386:
für Hochgeschwindigkeitszüge durc
- Seite 387 und 388:
1.3.3 Landschaftspflege und Natursc
- Seite 389 und 390:
1.3.3.2 Beurteilung des Flächennut
- Seite 391 und 392:
Instrument der „Flurbilanz" 1) um
- Seite 393 und 394:
1.3.3.2.4 Industrie- und Dienstleis
- Seite 395 und 396:
nach dem Bau der Autobahn etwa beim
- Seite 397 und 398:
wiegend auf land- und forstwirtscha
- Seite 399 und 400:
tieren, die bestimmte, noch nicht a
- Seite 401 und 402:
Abb. 3 Deutscher Bundestag — 8. W
- Seite 403 und 404:
gen Interessen des Naturschutzes (v
- Seite 405 und 406:
ökologisch tragbarer Zustand ist e
- Seite 407 und 408:
unterschiedlich. Vor allem liegt da
- Seite 409 und 410:
Geschützte Landschaftsbestandteile
- Seite 411 und 412:
Tabelle 11 Deutscher Bundestag —
- Seite 413 und 414:
Tabelle 12 Bisherige Annahmen der W
- Seite 415 und 416:
Abb. 5 Deutscher Bundestag — 8. W
- Seite 417 und 418:
6. der Schaffung von Grundlagen fü
- Seite 419 und 420:
zustandes ist eine Bewertung der he
- Seite 421 und 422:
1.3.3.3.5 Internationale Vereinbaru
- Seite 423 und 424:
Tabelle 15 Planungsträger Planungs
- Seite 425 und 426:
ausreichendem Maße zur Verfügung
- Seite 427 und 428:
1.4 Aufwendungen für Umweltschutzm
- Seite 429 und 430:
Tabelle 2 Nr. der Grund systematik
- Seite 431 und 432:
Tabelle 5 Betriebskosten für Umwel
- Seite 433 und 434:
Tabelle 9 Gebühren, Beiträge und
- Seite 435 und 436:
nicht eine scheinrationale Objektiv
- Seite 437 und 438:
Auch hier zeigt sich, daß nach ers
- Seite 439 und 440:
1381. Während in der Gruppe der tr
- Seite 441 und 442:
) Die Zeit der Erfolge, gekennzeich
- Seite 443 und 444:
tikel. Im Umfang hat sich die Umwel
- Seite 445 und 446:
seins liegt nicht vor. Die wichtigs
- Seite 447 und 448:
eingeführt und nach außen propagi
- Seite 449 und 450:
Ziweck Deutscher Bundestag — 8. W
- Seite 451 und 452:
Geld für den Straßenbau bzw. den
- Seite 453 und 454:
Verursacherprinzip bejahen würden)
- Seite 455 und 456:
(INFAS 1972). „Damit die Seen und
- Seite 457 und 458:
1450. Umweltfragen spielen in den B
- Seite 459 und 460:
gestellt werden können, während z
- Seite 461 und 462:
2.1.4 Bürgerinitiativen (BI) in de
- Seite 463 und 464:
gitim, den örtlichen Administratio
- Seite 465 und 466:
1488. Bei der Frage, ob BI eine Kor
- Seite 467 und 468:
die sich neuerdings nicht mehr nur
- Seite 469 und 470:
2.1.5 Überlegungen zur Verbandsbet
- Seite 471 und 472:
gender Billigung des Verbandes eins
- Seite 473 und 474:
ung dieses Gesetzes hat der Bund ei
- Seite 475 und 476:
tungsvorschriften als besonders gee
- Seite 477 und 478:
Industrieunternehmen, Kommunalpolit
- Seite 479 und 480:
und in Tageszeitungen aus dem Berei
- Seite 481 und 482:
trifft zu: Ge werbe auf sichts amt
- Seite 483 und 484:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 485 und 486:
Behörde Deutscher Bundestag — 8.
- Seite 487 und 488:
Abfallwirtschaft. Diese haben vor a
- Seite 489 und 490:
Zahl der Ant worten 1580. Auch Schw
- Seite 491 und 492:
Regel eine starke Beanspruchung des
- Seite 493 und 494:
Verhalten bei der Neugenehmigung vo
- Seite 495 und 496:
zeitlichen Verzögerung oder inhalt
- Seite 497 und 498:
1600. Gewässerschutzbehörden mach
- Seite 499 und 500:
tungsaufwand verbunden ist. Das all
- Seite 501 und 502:
zip sollte vermieden werden. Solche
- Seite 503 und 504:
sieht des Rates einer eingehenden P
- Seite 505 und 506:
Qualifikation der Probennehmer 1629
- Seite 507 und 508:
2.2.3.5 Empfehlungen 1634. Der Rat
- Seite 509 und 510:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 511 und 512:
Deutscher Bundestag — 8. Wahlperi
- Seite 513 und 514:
Tabelle 1 Deutscher Bundestag — 8
- Seite 515 und 516:
der EG-Ratstagung vom 16. Oktober 1
- Seite 517 und 518:
dings bereits heute für den amerik
- Seite 519 und 520:
Überführung in die Gesetzgebung d
- Seite 521 und 522:
einem möglichst frühen Entstehung
- Seite 523 und 524:
1697. Heute zeichnet sich der Über
- Seite 525 und 526:
sten) und die zugehörigen Planungs
- Seite 527 und 528:
gleichzeitigen Betrieb der Umweltsc
- Seite 529 und 530:
1730. In makroökonomischer Sicht f
- Seite 531 und 532:
ner Daten über die Anteile von Zin
- Seite 533 und 534:
1751. Die Bauwirtschaft partipizier
- Seite 535 und 536:
Durchsetzungsmöglichkeiten des Ver
- Seite 537 und 538:
eeinträchtigt die Nutzung der Aufn
- Seite 539 und 540:
mittelbar durch Ausgleichszahlungen
- Seite 541 und 542:
densbeseitigung und Schadensvermeid
- Seite 543 und 544:
1783. Unbeachtet blieben bisher die
- Seite 545 und 546:
schaffung und Kontrolle, nicht nur
- Seite 547 und 548:
Ersteres kann, wie die Erfahrung le
- Seite 549 und 550:
im internen Entscheidungsprozeß di
- Seite 551 und 552:
ohne Auswirkungen auf die Realeinko
- Seite 553 und 554:
Instrumente einmal in der Landwirts
- Seite 555 und 556:
- Private Umweltschutzinvestitionen
- Seite 557 und 558:
lieger verbleiben und diese auf Pla
- Seite 559 und 560:
Tabelle 5 Deutscher- Bundestag —
- Seite 561 und 562:
die die Erfüllung der Vorrangfunkt
- Seite 563 und 564:
ihre Durchführungsbestimmungen. Be
- Seite 565 und 566:
len toleriert; die Allokationseffiz
- Seite 567 und 568:
4.1.2 Umweltchemikalien 4.1.2.1 Umw
- Seite 569 und 570:
wirkt sich die zunehmende wirtschaf
- Seite 571 und 572:
Aussage erlaubt sein, daß die Bede
- Seite 573 und 574:
fenzuhalten und die energiewirtscha
- Seite 575 und 576:
der Bedürfnisse muß weit stärker
- Seite 577 und 578:
4.3.3 Zum Vorsorgeprinzip 1935. Ein
- Seite 579:
ersetzen, er hat jedoch in den letz
- Seite 582 und 583:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 584 und 585:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 586 und 587:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 588 und 589:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 590 und 591:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 592 und 593:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 594 und 595:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 596 und 597:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 598 und 599:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 600 und 601:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 602 und 603:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 604 und 605:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 606 und 607:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 608 und 609:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 610 und 611:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 612 und 613:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 614 und 615:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 616 und 617:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 618 und 619:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 620 und 621:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 622 und 623:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 624 und 625:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 626 und 627:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 628 und 629:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 630 und 631:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 632 und 633:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 634 und 635:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 636 und 637:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest
- Seite 638:
Drucksache 8/1938 Deutscher Bundest