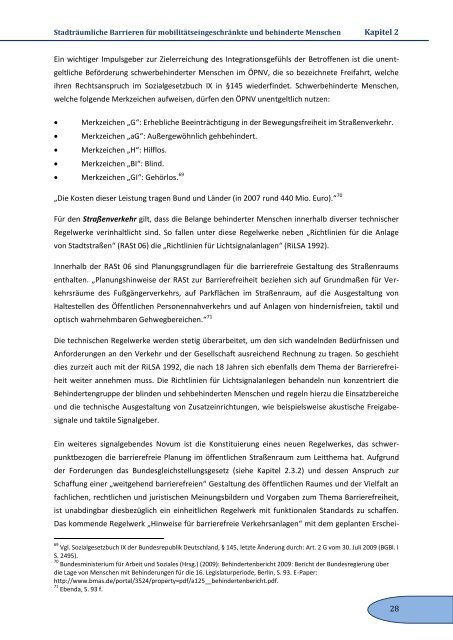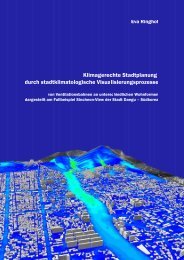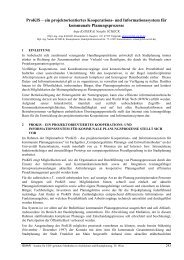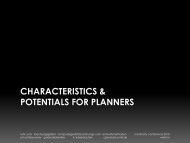Diplomarbeit zum Downloaden - cpe - Universität Kaiserslautern
Diplomarbeit zum Downloaden - cpe - Universität Kaiserslautern
Diplomarbeit zum Downloaden - cpe - Universität Kaiserslautern
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Stadträumliche Barrieren für mobilitätseingeschränkte und behinderte Menschen Kapitel 2<br />
Ein wichtiger Impulsgeber zur Zielerreichung des Integrationsgefühls der Betroffenen ist die unent-<br />
geltliche Beförderung schwerbehinderter Menschen im ÖPNV, die so bezeichnete Freifahrt, welche<br />
ihren Rechtsanspruch im Sozialgesetzbuch IX in §145 wiederfindet. Schwerbehinderte Menschen,<br />
welche folgende Merkzeichen aufweisen, dürfen den ÖPNV unentgeltlich nutzen:<br />
Merkzeichen „G“: Erhebliche Beeinträchtigung in der Bewegungsfreiheit im Straßenverkehr.<br />
Merkzeichen „aG“: Außergewöhnlich gehbehindert.<br />
Merkzeichen „H“: Hilflos.<br />
Merkzeichen „BI“: Blind.<br />
Merkzeichen „GI“: Gehörlos. 69<br />
„Die Kosten dieser Leistung tragen Bund und Länder (in 2007 rund 440 Mio. Euro).“ 70<br />
Für den Straßenverkehr gilt, dass die Belange behinderter Menschen innerhalb diverser technischer<br />
Regelwerke verinhaltlicht sind. So fallen unter diese Regelwerke neben „Richtlinien für die Anlage<br />
von Stadtstraßen“ (RASt 06) die „Richtlinien für Lichtsignalanlagen“ (RiLSA 1992).<br />
Innerhalb der RASt 06 sind Planungsgrundlagen für die barrierefreie Gestaltung des Straßenraums<br />
enthalten. „Planungshinweise der RASt zur Barrierefreiheit beziehen sich auf Grundmaßen für Ver-<br />
kehrsräume des Fußgängerverkehrs, auf Parkflächen im Straßenraum, auf die Ausgestaltung von<br />
Haltestellen des Öffentlichen Personennahverkehrs und auf Anlagen von hindernisfreien, taktil und<br />
optisch wahrnehmbaren Gehwegbereichen.“ 71<br />
Die technischen Regelwerke werden stetig überarbeitet, um den sich wandelnden Bedürfnissen und<br />
Anforderungen an den Verkehr und der Gesellschaft ausreichend Rechnung zu tragen. So geschieht<br />
dies zurzeit auch mit der RiLSA 1992, die nach 18 Jahren sich ebenfalls dem Thema der Barrierefrei-<br />
heit weiter annehmen muss. Die Richtlinien für Lichtsignalanlegen behandeln nun konzentriert die<br />
Behindertengruppe der blinden und sehbehinderten Menschen und regeln hierzu die Einsatzbereiche<br />
und die technische Ausgestaltung von Zusatzeinrichtungen, wie beispielsweise akustische Freigabe-<br />
signale und taktile Signalgeber.<br />
Ein weiteres signalgebendes Novum ist die Konstituierung eines neuen Regelwerkes, das schwer-<br />
punktbezogen die barrierefreie Planung im öffentlichen Straßenraum <strong>zum</strong> Leitthema hat. Aufgrund<br />
der Forderungen das Bundesgleichstellungsgesetz (siehe Kapitel 2.3.2) und dessen Anspruch zur<br />
Schaffung einer „weitgehend barrierefreien“ Gestaltung des öffentlichen Raumes und der Vielfalt an<br />
fachlichen, rechtlichen und juristischen Meinungsbildern und Vorgaben <strong>zum</strong> Thema Barrierefreiheit,<br />
ist unabdingbar diesbezüglich ein einheitlichen Regelwerk mit funktionalen Standards zu schaffen.<br />
Das kommende Regelwerk „Hinweise für barrierefreie Verkehrsanlagen“ mit dem geplanten Erschei-<br />
69<br />
Vgl. Sozialgesetzbuch IX der Bundesrepublik Deutschland, § 145, letzte Änderung durch: Art. 2 G vom 30. Juli 2009 (BGBl. I<br />
S. 2495).<br />
70<br />
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Hrsg.) (2009): Behindertenbericht 2009: Bericht der Bundesregierung über<br />
die Lage von Menschen mit Behinderungen für die 16. Legislaturperiode, Berlin, S. 93. E-Paper:<br />
http://www.bmas.de/portal/3524/property=pdf/a125__behindertenbericht.pdf.<br />
71<br />
Ebenda, S. 93 f.<br />
28