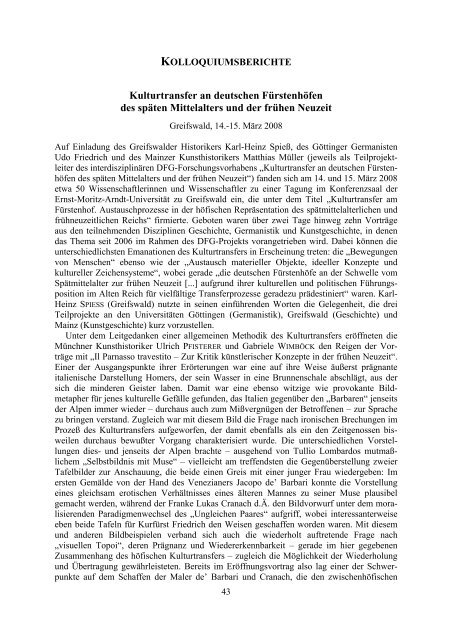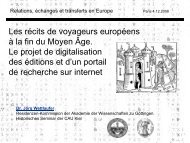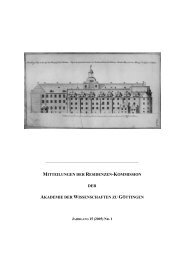PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KOLLOQUIUMSBERICHTE<br />
Kulturtransfer an deutschen Fürstenhöfen<br />
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit<br />
Greifswald, 14.-15. März 2008<br />
Auf Einladung des Greifswalder Historikers Karl-Heinz Spieß, des Göttinger Germanisten<br />
Udo Friedrich und des Mainzer Kunsthistorikers Matthias Müller (jeweils als Teilprojektleiter<br />
des interdisziplinären DFG-Forschungsvorhabens „Kulturtransfer an deutschen Fürstenhöfen<br />
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit“) fanden sich am 14. und 15. März 2008<br />
etwa 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu einer Tagung im Konferenzsaal der<br />
Ernst-Moritz-Arndt-Universität zu Greifswald ein, die unter dem Titel „Kulturtransfer am<br />
Fürstenhof. Austauschprozesse in der höfischen Repräsentation des spätmittelalterlichen und<br />
frühneuzeitlichen Reichs“ firmierte. Geboten waren über zwei Tage hinweg zehn Vorträge<br />
aus den teilnehmenden Disziplinen Geschichte, Germanistik und Kunstgeschichte, in denen<br />
das Thema seit 2006 im Rahmen des DFG-Projekts vorangetrieben wird. Dabei können die<br />
unterschiedlichsten Emanationen des Kulturtransfers in Erscheinung treten: die „Bewegungen<br />
von Menschen“ ebenso wie der „Austausch materieller Objekte, ideeller Konzepte und<br />
kultureller Zeichensysteme“, wobei gerade „die deutschen Fürstenhöfe an der Schwelle vom<br />
Spätmittelalter zur frühen Neuzeit [...] aufgrund ihrer kulturellen und politischen Führungsposition<br />
im Alten Reich für vielfältige Transferprozesse geradezu prädestiniert“ waren. Karl-<br />
Heinz SPIESS (Greifswald) nutzte in seinen einführenden Worten die Gelegenheit, die drei<br />
Teilprojekte an den Universitäten Göttingen (Germanistik), Greifswald (Geschichte) und<br />
Mainz (Kunstgeschichte) kurz vorzustellen.<br />
Unter dem Leitgedanken einer allgemeinen Methodik des Kulturtransfers eröffneten die<br />
Münchner Kunsthistoriker Ulrich PFISTERER und Gabriele WIMBÖCK den Reigen der Vorträge<br />
mit „Il Parnasso travestito – Zur Kritik künstlerischer Konzepte in der frühen Neuzeit“.<br />
Einer der Ausgangspunkte ihrer Erörterungen war eine auf ihre Weise äußerst prägnante<br />
italienische Darstellung Homers, der sein Wasser in eine Brunnenschale abschlägt, aus der<br />
sich die minderen Geister laben. Damit war eine ebenso witzige wie provokante Bildmetapher<br />
für jenes kulturelle Gefälle gefunden, das Italien gegenüber den „Barbaren“ jenseits<br />
der Alpen immer wieder – durchaus auch zum Mißvergnügen der Betroffenen – zur Sprache<br />
zu bringen verstand. Zugleich war mit diesem Bild die Frage nach ironischen Brechungen im<br />
Prozeß des Kulturtransfers aufgeworfen, der damit ebenfalls als ein den Zeitgenossen bisweilen<br />
durchaus bewußter Vorgang charakterisiert wurde. Die unterschiedlichen Vorstellungen<br />
dies- und jenseits der Alpen brachte – ausgehend von Tullio Lombardos mutmaßlichem<br />
„Selbstbildnis mit Muse“ – vielleicht am treffendsten die Gegenüberstellung zweier<br />
Tafelbilder zur Anschauung, die beide einen Greis mit einer junger Frau wiedergeben: Im<br />
ersten Gemälde von der Hand des Venezianers Jacopo de’ Barbari konnte die Vorstellung<br />
eines gleichsam erotischen Verhältnisses eines älteren Mannes zu seiner Muse plausibel<br />
gemacht werden, während der Franke Lukas Cranach d.Ä. den Bildvorwurf unter dem moralisierenden<br />
Paradigmenwechsel des „Ungleichen Paares“ aufgriff, wobei interessanterweise<br />
eben beide Tafeln für Kurfürst Friedrich den Weisen geschaffen worden waren. Mit diesem<br />
und anderen Bildbeispielen verband sich auch die wiederholt auftretende Frage nach<br />
„visuellen Topoi“, deren Prägnanz und Wiedererkennbarkeit – gerade im hier gegebenen<br />
Zusammenhang des höfischen Kulturtransfers – zugleich die Möglichkeit der Wiederholung<br />
und Übertragung gewährleisteten. Bereits im Eröffnungsvortrag also lag einer der Schwerpunkte<br />
auf dem Schaffen der Maler de’ Barbari und Cranach, die den zwischenhöfischen<br />
43