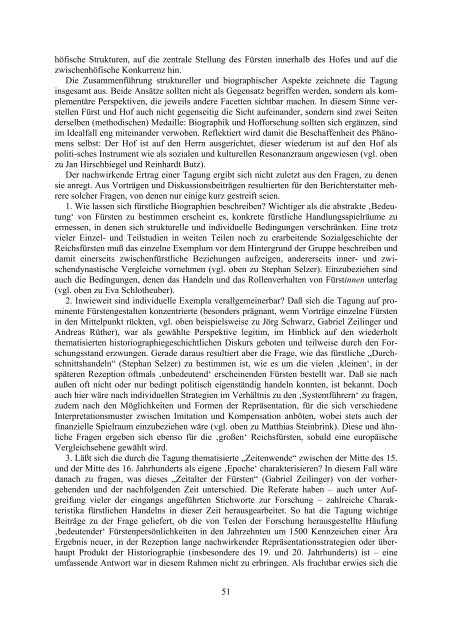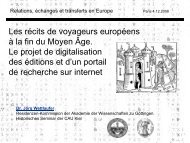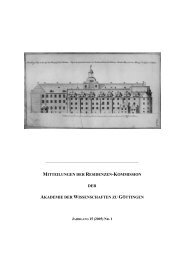PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
höfische Strukturen, auf die zentrale Stellung des Fürsten innerhalb des Hofes und auf die<br />
zwischenhöfische Konkurrenz hin.<br />
Die Zusammenführung struktureller und biographischer Aspekte zeichnete die Tagung<br />
insgesamt aus. Beide Ansätze sollten nicht als Gegensatz begriffen werden, sondern als komplementäre<br />
Perspektiven, die jeweils andere Facetten sichtbar machen. In diesem Sinne verstellen<br />
Fürst und Hof auch nicht gegenseitig die Sicht aufeinander, sondern sind zwei Seiten<br />
derselben (methodischen) Medaille: Biographik und Hofforschung sollten sich ergänzen, sind<br />
im Idealfall eng miteinander verwoben. Reflektiert wird damit die Beschaffenheit des Phänomens<br />
selbst: Der Hof ist auf den Herrn ausgerichtet, dieser wiederum ist auf den Hof als<br />
politi-sches Instrument wie als sozialen und kulturellen Resonanzraum angewiesen (vgl. oben<br />
zu Jan Hirschbiegel und Reinhardt Butz).<br />
Der nachwirkende Ertrag einer Tagung ergibt sich nicht zuletzt aus den Fragen, zu denen<br />
sie anregt. Aus Vorträgen und Diskussionsbeiträgen resultierten für den Berichterstatter mehrere<br />
solcher Fragen, von denen nur einige kurz gestreift seien.<br />
1. Wie lassen sich fürstliche Biographien beschreiben? Wichtiger als die abstrakte ‚Bedeutung‘<br />
von Fürsten zu bestimmen erscheint es, konkrete fürstliche Handlungsspielräume zu<br />
ermessen, in denen sich strukturelle und individuelle Bedingungen verschränken. Eine trotz<br />
vieler Einzel- und Teilstudien in weiten Teilen noch zu erarbeitende Sozialgeschichte der<br />
Reichsfürsten muß das einzelne Exemplum vor dem Hintergrund der Gruppe beschreiben und<br />
damit einerseits zwischenfürstliche Beziehungen aufzeigen, andererseits inner- und zwischendynastische<br />
Vergleiche vornehmen (vgl. oben zu Stephan Selzer). Einzubeziehen sind<br />
auch die Bedingungen, denen das Handeln und das Rollenverhalten von Fürstinnen unterlag<br />
(vgl. oben zu Eva Schlotheuber).<br />
2. Inwieweit sind individuelle Exempla verallgemeinerbar? Daß sich die Tagung auf prominente<br />
Fürstengestalten konzentrierte (besonders prägnant, wenn Vorträge einzelne Fürsten<br />
in den Mittelpunkt rückten, vgl. oben beispielsweise zu Jörg Schwarz, Gabriel Zeilinger und<br />
Andreas Rüther), war als gewählte Perspektive legitim, im Hinblick auf den wiederholt<br />
thematisierten historiographiegeschichtlichen Diskurs geboten und teilweise durch den Forschungsstand<br />
erzwungen. Gerade daraus resultiert aber die Frage, wie das fürstliche „Durchschnittshandeln“<br />
(Stephan Selzer) zu bestimmen ist, wie es um die vielen ‚kleinen‘, in der<br />
späteren Rezeption oftmals ‚unbedeutend‘ erscheinenden Fürsten bestellt war. Daß sie nach<br />
außen oft nicht oder nur bedingt politisch eigenständig handeln konnten, ist bekannt. Doch<br />
auch hier wäre nach individuellen Strategien im Verhältnis zu den ‚Systemführern‘ zu fragen,<br />
zudem nach den Möglichkeiten und Formen der Repräsentation, für die sich verschiedene<br />
Interpretationsmuster zwischen Imitation und Kompensation anböten, wobei stets auch der<br />
finanzielle Spielraum einzubeziehen wäre (vgl. oben zu Matthias Steinbrink). Diese und ähnliche<br />
Fragen ergeben sich ebenso für die ‚großen‘ Reichsfürsten, sobald eine europäische<br />
Vergleichsebene gewählt wird.<br />
3. Läßt sich die durch die Tagung thematisierte „Zeitenwende“ zwischen der Mitte des 15.<br />
und der Mitte des 16. Jahrhunderts als eigene ‚Epoche‘ charakterisieren? In diesem Fall wäre<br />
danach zu fragen, was dieses „Zeitalter der Fürsten“ (Gabriel Zeilinger) von der vorhergehenden<br />
und der nachfolgenden Zeit unterschied. Die Referate haben – auch unter Aufgreifung<br />
vieler der eingangs angeführten Stichworte zur Forschung – zahlreiche Charakteristika<br />
fürstlichen Handelns in dieser Zeit herausgearbeitet. So hat die Tagung wichtige<br />
Beiträge zu der Frage geliefert, ob die von Teilen der Forschung herausgestellte Häufung<br />
‚bedeutender‘ Fürstenpersönlichkeiten in den Jahrzehnten um 1500 Kennzeichen einer Ära<br />
Ergebnis neuer, in der Rezeption lange nachwirkender Repräsentationsstrategien oder überhaupt<br />
Produkt der Historiographie (insbesondere des 19. und 20. Jahrhunderts) ist – eine<br />
umfassende Antwort war in diesem Rahmen nicht zu erbringen. Als fruchtbar erwies sich die<br />
51