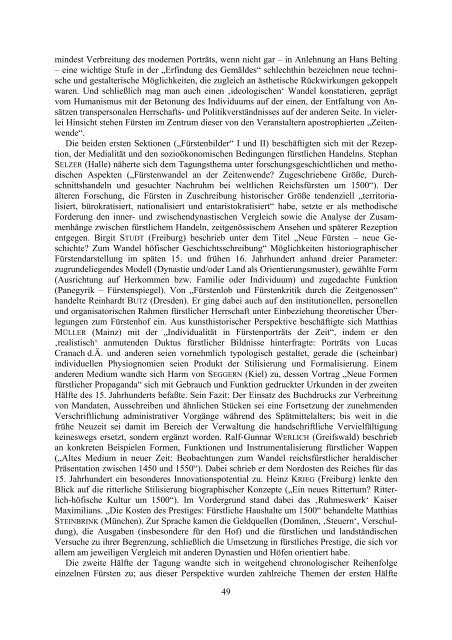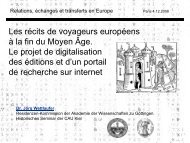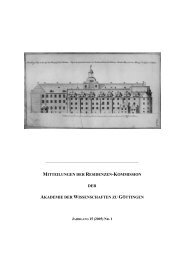PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
mindest Verbreitung des modernen Porträts, wenn nicht gar – in Anlehnung an Hans Belting<br />
– eine wichtige Stufe in der „Erfindung des Gemäldes“ schlechthin bezeichnen neue technische<br />
und gestalterische Möglichkeiten, die zugleich an ästhetische Rückwirkungen gekoppelt<br />
waren. Und schließlich mag man auch einen ‚ideologischen‘ Wandel konstatieren, geprägt<br />
vom Humanismus mit der Betonung des Individuums auf der einen, der Entfaltung von Ansätzen<br />
transpersonalen Herrschafts- und Politikverständnisses auf der anderen Seite. In vielerlei<br />
Hinsicht stehen Fürsten im Zentrum dieser von den Veranstaltern apostrophierten „Zeitenwende“.<br />
Die beiden ersten Sektionen („Fürstenbilder“ I und II) beschäftigten sich mit der Rezeption,<br />
der Medialität und den sozioökonomischen Bedingungen fürstlichen Handelns. Stephan<br />
SELZER (Halle) näherte sich dem Tagungsthema unter forschungsgeschichtlichen und methodischen<br />
Aspekten („Fürstenwandel an der Zeitenwende? Zugeschriebene Größe, Durchschnittshandeln<br />
und gesuchter Nachruhm bei weltlichen Reichsfürsten um 1500“). Der<br />
älteren Forschung, die Fürsten in Zuschreibung historischer Größe tendenziell „territorialisiert,<br />
bürokratisiert, nationalisiert und entaristokratisiert“ habe, setzte er als methodische<br />
Forderung den inner- und zwischendynastischen Vergleich sowie die Analyse der Zusammenhänge<br />
zwischen fürstlichem Handeln, zeitgenössischem Ansehen und späterer Rezeption<br />
entgegen. Birgit STUDT (Freiburg) beschrieb unter dem Titel „Neue Fürsten – neue Geschichte?<br />
Zum Wandel höfischer Geschichtsschreibung“ Möglichkeiten historiographischer<br />
Fürstendarstellung im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert anhand dreier Parameter:<br />
zugrundeliegendes Modell (Dynastie und/oder Land als Orientierungsmuster), gewählte Form<br />
(Ausrichtung auf Herkommen bzw. Familie oder Individuum) und zugedachte Funktion<br />
(Panegyrik – Fürstenspiegel). Von „Fürstenlob und Fürstenkritik durch die Zeitgenossen“<br />
handelte Reinhardt BUTZ (Dresden). Er ging dabei auch auf den institutionellen, personellen<br />
und organisatorischen Rahmen fürstlicher Herrschaft unter Einbeziehung theoretischer Überlegungen<br />
zum Fürstenhof ein. Aus kunsthistorischer Perspektive beschäftigte sich Matthias<br />
MÜLLER (Mainz) mit der „Individualität in Fürstenporträts der Zeit“, indem er den<br />
‚realistisch‘ anmutenden Duktus fürstlicher Bildnisse hinterfragte: Porträts von Lucas<br />
Cranach d.Ä. und anderen seien vornehmlich typologisch gestaltet, gerade die (scheinbar)<br />
individuellen Physiognomien seien Produkt der Stilisierung und Formalisierung. Einem<br />
anderen Medium wandte sich Harm von SEGGERN (Kiel) zu, dessen Vortrag „Neue Formen<br />
fürstlicher Propaganda“ sich mit Gebrauch und Funktion gedruckter Urkunden in der zweiten<br />
Hälfte des 15. Jahrhunderts befaßte. Sein Fazit: Der Einsatz des Buchdrucks zur Verbreitung<br />
von Mandaten, Ausschreiben und ähnlichen Stücken sei eine Fortsetzung der zunehmenden<br />
Verschriftlichung administrativer Vorgänge während des Spätmittelalters; bis weit in die<br />
frühe Neuzeit sei damit im Bereich der Verwaltung die handschriftliche Vervielfältigung<br />
keineswegs ersetzt, sondern ergänzt worden. Ralf-Gunnar WERLICH (Greifswald) beschrieb<br />
an konkreten Beispielen Formen, Funktionen und Instrumentalisierung fürstlicher Wappen<br />
(„Altes Medium in neuer Zeit: Beobachtungen zum Wandel reichsfürstlicher heraldischer<br />
Präsentation zwischen 1450 und 1550“). Dabei schrieb er dem Nordosten des Reiches für das<br />
15. Jahrhundert ein besonderes Innovationspotential zu. Heinz KRIEG (Freiburg) lenkte den<br />
Blick auf die ritterliche Stilisierung biographischer Konzepte („Ein neues Rittertum? Ritterlich-höfische<br />
Kultur um 1500“). Im Vordergrund stand dabei das ‚Ruhmeswerk‘ Kaiser<br />
Maximilians. „Die Kosten des Prestiges: Fürstliche Haushalte um 1500“ behandelte Matthias<br />
STEINBRINK (München). Zur Sprache kamen die Geldquellen (Domänen, ‚Steuern‘, Verschuldung),<br />
die Ausgaben (insbesondere für den Hof) und die fürstlichen und landständischen<br />
Versuche zu ihrer Begrenzung, schließlich die Umsetzung in fürstliches Prestige, die sich vor<br />
allem am jeweiligen Vergleich mit anderen Dynastien und Höfen orientiert habe.<br />
Die zweite Hälfte der Tagung wandte sich in weitgehend chronologischer Reihenfolge<br />
einzelnen Fürsten zu; aus dieser Perspektive wurden zahlreiche Themen der ersten Hälfte<br />
49