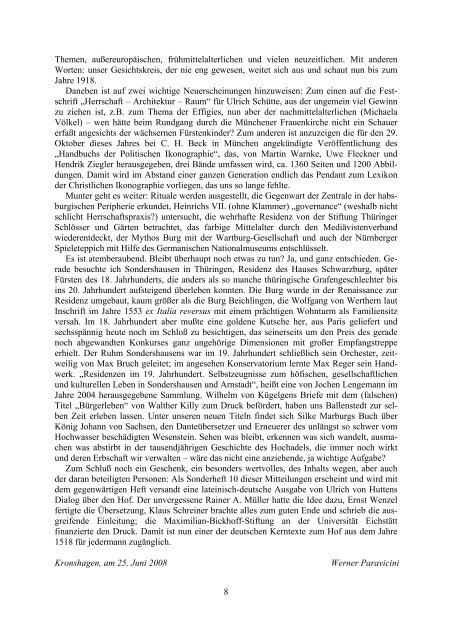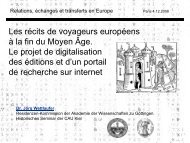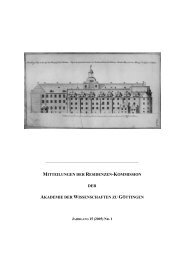PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Themen, außereuropäischen, frühmittelalterlichen und vielen neuzeitlichen. Mit anderen<br />
Worten: unser Gesichtskreis, der nie eng gewesen, weitet sich aus und schaut nun bis zum<br />
Jahre 1918.<br />
Daneben ist auf zwei wichtige Neuerscheinungen hinzuweisen: Zum einen auf die Festschrift<br />
„Herrschaft – Architektur – Raum“ für Ulrich Schütte, aus der ungemein viel Gewinn<br />
zu ziehen ist, z.B. zum Thema der Effigies, nun aber der nachmittelalterlichen (Michaela<br />
Völkel) – wen hätte beim Rundgang durch die Münchener Frauenkirche nicht ein Schauer<br />
erfaßt angesichts der wächsernen Fürstenkinder? Zum anderen ist anzuzeigen die für den 29.<br />
Oktober dieses Jahres bei C. H. Beck in München angekündigte Veröffentlichung des<br />
„Handbuchs der Politischen Ikonographie“, das, von Martin Warnke, Uwe Fleckner und<br />
Hendrik Ziegler herausgegeben, drei Bände umfassen wird, ca. 1360 Seiten und 1200 Abbildungen.<br />
Damit wird im Abstand einer ganzen Generation endlich das Pendant zum Lexikon<br />
der Christlichen Ikonographie vorliegen, das uns so lange fehlte.<br />
Munter geht es weiter: Rituale werden ausgestellt, die Gegenwart der Zentrale in der habsburgischen<br />
Peripherie erkundet, Heinrichs VII. (ohne Klammer) „governance“ (weshalb nicht<br />
schlicht Herrschaftspraxis?) untersucht, die wehrhafte Residenz von der Stiftung Thüringer<br />
Schlösser und Gärten betrachtet, das farbige Mittelalter durch den Mediävistenverband<br />
wiederentdeckt, der Mythos Burg mit der Wartburg-Gesellschaft und auch der Nürnberger<br />
Spieleteppich mit Hilfe des Germanischen Nationalmuseums entschlüsselt.<br />
Es ist atemberaubend. Bleibt überhaupt noch etwas zu tun? Ja, und ganz entschieden. Gerade<br />
besuchte ich Sondershausen in Thüringen, Residenz des Hauses Schwarzburg, später<br />
Fürsten des 18. Jahrhunderts, die anders als so manche thüringische Grafengeschlechter bis<br />
ins 20. Jahrhundert aufsteigend überleben konnten. Die Burg wurde in der Renaissance zur<br />
Residenz umgebaut, kaum größer als die Burg Beichlingen, die Wolfgang von Werthern laut<br />
Inschrift im Jahre 1553 ex Italia reversus mit einem prächtigen Wohnturm als Familiensitz<br />
versah. Im 18. Jahrhundert aber mußte eine goldene Kutsche her, aus Paris geliefert und<br />
sechsspännig heute noch im Schloß zu besichtigen, das seinerseits um den Preis des gerade<br />
noch abgewandten Konkurses ganz ungehörige Dimensionen mit großer Empfangstreppe<br />
erhielt. Der Ruhm Sondershausens war im 19. Jahrhundert schließlich sein Orchester, zeitweilig<br />
von Max Bruch geleitet; im angesehen Konservatorium lernte Max Reger sein Handwerk.<br />
„<strong>Residenzen</strong> im 19. Jahrhundert. Selbstzeugnisse zum höfischen, gesellschaftlichen<br />
und kulturellen Leben in Sondershausen und Arnstadt“, heißt eine von Jochen Lengemann im<br />
Jahre 2004 herausgegebene Sammlung. Wilhelm von Kügelgens Briefe mit dem (falschen)<br />
Titel „Bürgerleben“ von Walther Killy zum Druck befördert, haben uns Ballenstedt zur selben<br />
Zeit erleben lassen. Unter unseren neuen Titeln findet sich Silke Marburgs Buch über<br />
König Johann von Sachsen, den Danteübersetzer und Erneuerer des unlängst so schwer vom<br />
Hochwasser beschädigten Wesenstein. Sehen was bleibt, erkennen was sich wandelt, ausmachen<br />
was abstirbt in der tausendjährigen Geschichte des Hochadels, die immer noch wirkt<br />
und deren Erbschaft wir verwalten – wäre das nicht eine anziehende, ja wichtige Aufgabe?<br />
Zum Schluß noch ein Geschenk, ein besonders wertvolles, des Inhalts wegen, aber auch<br />
der daran beteiligten Personen: Als Sonderheft 10 dieser Mitteilungen erscheint und wird mit<br />
dem gegenwärtigen Heft versandt eine lateinisch-deutsche Ausgabe von Ulrich von Huttens<br />
Dialog über den Hof. Der unvergessene Rainer A. Müller hatte die Idee dazu, Ernst Wenzel<br />
fertigte die Übersetzung, Klaus Schreiner brachte alles zum guten Ende und schrieb die ausgreifende<br />
Einleitung; die Maximilian-Bickhoff-Stiftung an der Universität Eichstätt<br />
finanzierte den Druck. Damit ist nun einer der deutschen Kerntexte zum Hof aus dem Jahre<br />
1518 für jedermann zugänglich.<br />
Kronshagen, am 25. Juni 2008 Werner Paravicini<br />
8