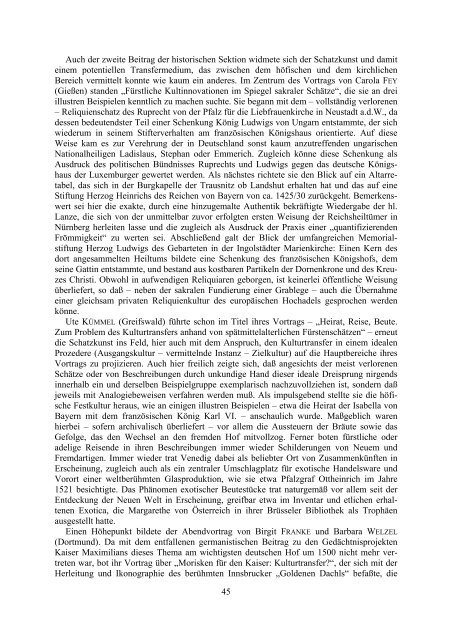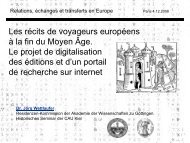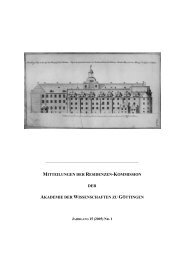PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Auch der zweite Beitrag der historischen Sektion widmete sich der Schatzkunst und damit<br />
einem potentiellen Transfermedium, das zwischen dem höfischen und dem kirchlichen<br />
Bereich vermittelt konnte wie kaum ein anderes. Im Zentrum des Vortrags von Carola FEY<br />
(Gießen) standen „Fürstliche Kultinnovationen im Spiegel sakraler Schätze“, die sie an drei<br />
illustren Beispielen kenntlich zu machen suchte. Sie begann mit dem – vollständig verlorenen<br />
– Reliquienschatz des Ruprecht von der Pfalz für die Liebfrauenkirche in Neustadt a.d.W., da<br />
dessen bedeutendster Teil einer Schenkung König Ludwigs von Ungarn entstammte, der sich<br />
wiederum in seinem Stifterverhalten am französischen Königshaus orientierte. Auf diese<br />
Weise kam es zur Verehrung der in Deutschland sonst kaum anzutreffenden ungarischen<br />
Nationalheiligen Ladislaus, Stephan oder Emmerich. Zugleich könne diese Schenkung als<br />
Ausdruck des politischen Bündnisses Ruprechts und Ludwigs gegen das deutsche Königshaus<br />
der Luxemburger gewertet werden. Als nächstes richtete sie den Blick auf ein Altarretabel,<br />
das sich in der Burgkapelle der Trausnitz ob Landshut erhalten hat und das auf eine<br />
Stiftung Herzog Heinrichs des Reichen von Bayern von ca. 1425/30 zurückgeht. Bemerkenswert<br />
sei hier die exakte, durch eine hinzugemalte Authentik bekräftigte Wiedergabe der hl.<br />
Lanze, die sich von der unmittelbar zuvor erfolgten ersten Weisung der Reichsheiltümer in<br />
Nürnberg herleiten lasse und die zugleich als Ausdruck der Praxis einer „quantifizierenden<br />
Frömmigkeit“ zu werten sei. Abschließend galt der Blick der umfangreichen Memorialstiftung<br />
Herzog Ludwigs des Gebarteten in der Ingolstädter Marienkirche: Einen Kern des<br />
dort angesammelten Heiltums bildete eine Schenkung des französischen Königshofs, dem<br />
seine Gattin entstammte, und bestand aus kostbaren Partikeln der Dornenkrone und des Kreuzes<br />
Christi. Obwohl in aufwendigen Reliquiaren geborgen, ist keinerlei öffentliche Weisung<br />
überliefert, so daß – neben der sakralen Fundierung einer Grablege – auch die Übernahme<br />
einer gleichsam privaten Reliquienkultur des europäischen Hochadels gesprochen werden<br />
könne.<br />
Ute KÜMMEL (Greifswald) führte schon im Titel ihres Vortrags – „Heirat, Reise, Beute.<br />
Zum Problem des Kulturtransfers anhand von spätmittelalterlichen Fürstenschätzen“ – erneut<br />
die Schatzkunst ins Feld, hier auch mit dem Anspruch, den Kulturtransfer in einem idealen<br />
Prozedere (Ausgangskultur – vermittelnde Instanz – Zielkultur) auf die Hauptbereiche ihres<br />
Vortrags zu projizieren. Auch hier freilich zeigte sich, daß angesichts der meist verlorenen<br />
Schätze oder von Beschreibungen durch unkundige Hand dieser ideale Dreisprung nirgends<br />
innerhalb ein und derselben Beispielgruppe exemplarisch nachzuvollziehen ist, sondern daß<br />
jeweils mit Analogiebeweisen verfahren werden muß. Als impulsgebend stellte sie die höfische<br />
Festkultur heraus, wie an einigen illustren Beispielen – etwa die Heirat der Isabella von<br />
Bayern mit dem französischen König Karl VI. – anschaulich wurde. Maßgeblich waren<br />
hierbei – sofern archivalisch überliefert – vor allem die Aussteuern der Bräute sowie das<br />
Gefolge, das den Wechsel an den fremden Hof mitvollzog. Ferner boten fürstliche oder<br />
adelige Reisende in ihren Beschreibungen immer wieder Schilderungen von Neuem und<br />
Fremdartigen. Immer wieder trat Venedig dabei als beliebter Ort von Zusammenkünften in<br />
Erscheinung, zugleich auch als ein zentraler Umschlagplatz für exotische Handelsware und<br />
Vorort einer weltberühmten Glasproduktion, wie sie etwa Pfalzgraf Ottheinrich im Jahre<br />
1521 besichtigte. Das Phänomen exotischer Beutestücke trat naturgemäß vor allem seit der<br />
Entdeckung der Neuen Welt in Erscheinung, greifbar etwa im Inventar und etlichen erhaltenen<br />
Exotica, die Margarethe von Österreich in ihrer Brüsseler Bibliothek als Trophäen<br />
ausgestellt hatte.<br />
Einen Höhepunkt bildete der Abendvortrag von Birgit FRANKE und Barbara WELZEL<br />
(Dortmund). Da mit dem entfallenen germanistischen Beitrag zu den Gedächtnisprojekten<br />
Kaiser Maximilians dieses Thema am wichtigsten deutschen Hof um 1500 nicht mehr vertreten<br />
war, bot ihr Vortrag über „Morisken für den Kaiser: Kulturtransfer?“, der sich mit der<br />
Herleitung und Ikonographie des berühmten Innsbrucker „Goldenen Dachls“ befaßte, die<br />
45