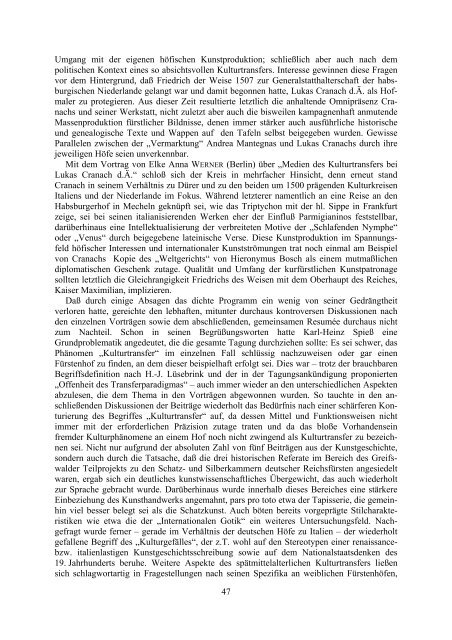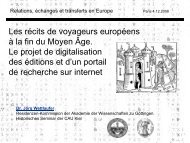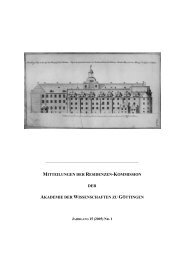PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
PDF-Format - Residenzen-Kommission - GWDG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Umgang mit der eigenen höfischen Kunstproduktion; schließlich aber auch nach dem<br />
politischen Kontext eines so absichtsvollen Kulturtransfers. Interesse gewinnen diese Fragen<br />
vor dem Hintergrund, daß Friedrich der Weise 1507 zur Generalstatthalterschaft der habsburgischen<br />
Niederlande gelangt war und damit begonnen hatte, Lukas Cranach d.Ä. als Hofmaler<br />
zu protegieren. Aus dieser Zeit resultierte letztlich die anhaltende Omnipräsenz Cranachs<br />
und seiner Werkstatt, nicht zuletzt aber auch die bisweilen kampagnenhaft anmutende<br />
Massenproduktion fürstlicher Bildnisse, denen immer stärker auch ausführliche historische<br />
und genealogische Texte und Wappen auf den Tafeln selbst beigegeben wurden. Gewisse<br />
Parallelen zwischen der „Vermarktung“ Andrea Mantegnas und Lukas Cranachs durch ihre<br />
jeweiligen Höfe seien unverkennbar.<br />
Mit dem Vortrag von Elke Anna WERNER (Berlin) über „Medien des Kulturtransfers bei<br />
Lukas Cranach d.Ä.“ schloß sich der Kreis in mehrfacher Hinsicht, denn erneut stand<br />
Cranach in seinem Verhältnis zu Dürer und zu den beiden um 1500 prägenden Kulturkreisen<br />
Italiens und der Niederlande im Fokus. Während letzterer namentlich an eine Reise an den<br />
Habsburgerhof in Mecheln geknüpft sei, wie das Triptychon mit der hl. Sippe in Frankfurt<br />
zeige, sei bei seinen italianisierenden Werken eher der Einfluß Parmigianinos feststellbar,<br />
darüberhinaus eine Intellektualisierung der verbreiteten Motive der „Schlafenden Nymphe“<br />
oder „Venus“ durch beigegebene lateinische Verse. Diese Kunstproduktion im Spannungsfeld<br />
höfischer Interessen und internationaler Kunstströmungen trat noch einmal am Beispiel<br />
von Cranachs Kopie des „Weltgerichts“ von Hieronymus Bosch als einem mutmaßlichen<br />
diplomatischen Geschenk zutage. Qualität und Umfang der kurfürstlichen Kunstpatronage<br />
sollten letztlich die Gleichrangigkeit Friedrichs des Weisen mit dem Oberhaupt des Reiches,<br />
Kaiser Maximilian, implizieren.<br />
Daß durch einige Absagen das dichte Programm ein wenig von seiner Gedrängtheit<br />
verloren hatte, gereichte den lebhaften, mitunter durchaus kontroversen Diskussionen nach<br />
den einzelnen Vorträgen sowie dem abschließenden, gemeinsamen Resumée durchaus nicht<br />
zum Nachteil. Schon in seinen Begrüßungsworten hatte Karl-Heinz Spieß eine<br />
Grundproblematik angedeutet, die die gesamte Tagung durchziehen sollte: Es sei schwer, das<br />
Phänomen „Kulturtransfer“ im einzelnen Fall schlüssig nachzuweisen oder gar einen<br />
Fürstenhof zu finden, an dem dieser beispielhaft erfolgt sei. Dies war – trotz der brauchbaren<br />
Begriffsdefinition nach H.-J. Lüsebrink und der in der Tagungsankündigung proponierten<br />
„Offenheit des Transferparadigmas“ – auch immer wieder an den unterschiedlichen Aspekten<br />
abzulesen, die dem Thema in den Vorträgen abgewonnen wurden. So tauchte in den anschließenden<br />
Diskussionen der Beiträge wiederholt das Bedürfnis nach einer schärferen Konturierung<br />
des Begriffes „Kulturtransfer“ auf, da dessen Mittel und Funktionsweisen nicht<br />
immer mit der erforderlichen Präzision zutage traten und da das bloße Vorhandensein<br />
fremder Kulturphänomene an einem Hof noch nicht zwingend als Kulturtransfer zu bezeichnen<br />
sei. Nicht nur aufgrund der absoluten Zahl von fünf Beiträgen aus der Kunstgeschichte,<br />
sondern auch durch die Tatsache, daß die drei historischen Referate im Bereich des Greifswalder<br />
Teilprojekts zu den Schatz- und Silberkammern deutscher Reichsfürsten angesiedelt<br />
waren, ergab sich ein deutliches kunstwissenschaftliches Übergewicht, das auch wiederholt<br />
zur Sprache gebracht wurde. Darüberhinaus wurde innerhalb dieses Bereiches eine stärkere<br />
Einbeziehung des Kunsthandwerks angemahnt, pars pro toto etwa der Tapisserie, die gemeinhin<br />
viel besser belegt sei als die Schatzkunst. Auch böten bereits vorgeprägte Stilcharakteristiken<br />
wie etwa die der „Internationalen Gotik“ ein weiteres Untersuchungsfeld. Nachgefragt<br />
wurde ferner – gerade im Verhältnis der deutschen Höfe zu Italien – der wiederholt<br />
gefallene Begriff des „Kulturgefälles“, der z.T. wohl auf den Stereotypen einer renaissance-<br />
bzw. italienlastigen Kunstgeschichtsschreibung sowie auf dem Nationalstaatsdenken des<br />
19. Jahrhunderts beruhe. Weitere Aspekte des spätmittelalterlichen Kulturtransfers ließen<br />
sich schlagwortartig in Fragestellungen nach seinen Spezifika an weiblichen Fürstenhöfen,<br />
47