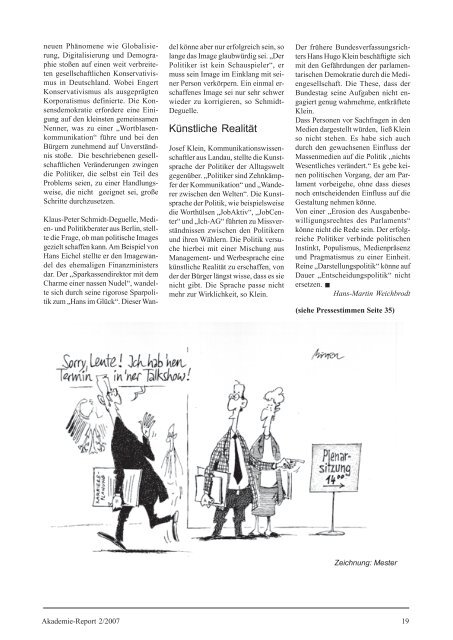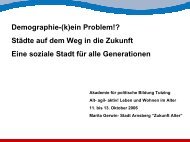AKADEMIE -REPORT - Akademie für Politische Bildung Tutzing
AKADEMIE -REPORT - Akademie für Politische Bildung Tutzing
AKADEMIE -REPORT - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
neuen Phänomene wie Globalisierung,<br />
Digitalisierung und Demographie<br />
stoßen auf einen weit verbreiteten<br />
gesellschaftlichen Konservativismus<br />
in Deutschland. Wobei Engert<br />
Konservativismus als ausgeprägten<br />
Korporatismus definierte. Die Konsensdemokratie<br />
erfordere eine Einigung<br />
auf den kleinsten gemeinsamen<br />
Nenner, was zu einer „Wortblasenkommunikation“<br />
führe und bei den<br />
Bürgern zunehmend auf Unverständnis<br />
stoße. Die beschriebenen gesellschaftlichen<br />
Veränderungen zwingen<br />
die Politiker, die selbst ein Teil des<br />
Problems seien, zu einer Handlungsweise,<br />
die nicht geeignet sei, große<br />
Schritte durchzusetzen.<br />
Klaus-Peter Schmidt-Deguelle, Medien-<br />
und Politikberater aus Berlin, stellte<br />
die Frage, ob man politische Images<br />
gezielt schaffen kann. Am Beispiel von<br />
Hans Eichel stellte er den Imagewandel<br />
des ehemaligen Finanzministers<br />
dar. Der „Sparkassendirektor mit dem<br />
Charme einer nassen Nudel“, wandelte<br />
sich durch seine rigorose Sparpolitik<br />
zum „Hans im Glück“. Dieser Wan-<br />
<strong>Akademie</strong>-Report 2/2007<br />
del könne aber nur erfolgreich sein, so<br />
lange das Image glaubwürdig sei. „Der<br />
Politiker ist kein Schauspieler“, er<br />
muss sein Image im Einklang mit seiner<br />
Person verkörpern. Ein einmal erschaffenes<br />
Image sei nur sehr schwer<br />
wieder zu korrigieren, so Schmidt-<br />
Deguelle.<br />
Künstliche Realität<br />
Josef Klein, Kommunikationswissenschaftler<br />
aus Landau, stellte die Kunstsprache<br />
der Politiker der Alltagswelt<br />
gegenüber. „Politiker sind Zehnkämpfer<br />
der Kommunikation“ und „Wanderer<br />
zwischen den Welten“. Die Kunstsprache<br />
der Politik, wie beispielsweise<br />
die Worthülsen „JobAktiv“, „JobCenter“<br />
und „Ich-AG“ führten zu Missverständnissen<br />
zwischen den Politikern<br />
und ihren Wählern. Die Politik versuche<br />
hierbei mit einer Mischung aus<br />
Management- und Werbesprache eine<br />
künstliche Realität zu erschaffen, von<br />
der der Bürger längst wisse, dass es sie<br />
nicht gibt. Die Sprache passe nicht<br />
mehr zur Wirklichkeit, so Klein.<br />
Der frühere Bundesverfassungsrichters<br />
Hans Hugo Klein beschäftigte sich<br />
mit den Gefährdungen der parlamentarischen<br />
Demokratie durch die Mediengesellschaft.<br />
Die These, dass der<br />
Bundestag seine Aufgaben nicht engagiert<br />
genug wahrnehme, entkräftete<br />
Klein.<br />
Dass Personen vor Sachfragen in den<br />
Medien dargestellt würden, ließ Klein<br />
so nicht stehen. Es habe sich auch<br />
durch den gewachsenen Einfluss der<br />
Massenmedien auf die Politik „nichts<br />
Wesentliches verändert.“ Es gebe keinen<br />
politischen Vorgang, der am Parlament<br />
vorbeigehe, ohne dass dieses<br />
noch entscheidenden Einfluss auf die<br />
Gestaltung nehmen könne.<br />
Von einer „Erosion des Ausgabenbewilligungsrechtes<br />
des Parlaments“<br />
könne nicht die Rede sein. Der erfolgreiche<br />
Politiker verbinde politischen<br />
Instinkt, Populismus, Medienpräsenz<br />
und Pragmatismus zu einer Einheit.<br />
Reine „Darstellungspolitik“ könne auf<br />
Dauer „Entscheidungspolitik“ nicht<br />
ersetzen. �<br />
Hans-Martin Weichbrodt<br />
(siehe Pressestimmen Seite 35)<br />
Zeichnung: Mester<br />
19