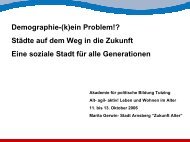AKADEMIE -REPORT - Akademie für Politische Bildung Tutzing
AKADEMIE -REPORT - Akademie für Politische Bildung Tutzing
AKADEMIE -REPORT - Akademie für Politische Bildung Tutzing
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sicherheit – ein deutsches Grundbedürfnis?<br />
Krieg, Wirtschaftskrisen,<br />
Ausgrenzung bedrohen<br />
den Menschen. Er kann<br />
sein Leben verlieren, sein Hab<br />
und Gut, die Achtung anderer.<br />
Er trifft Vorkehrungen, damit all<br />
dies nicht eintritt. Auch das Handeln<br />
von Staaten lässt sich in<br />
diesen Kategorien beschreiben.<br />
Suche nach Sicherheit – eine anthropologische<br />
Konstante. Von<br />
einem „deutschen Grundbedürfnis“<br />
spricht man, weil durch die<br />
historischen Erfahrungen des<br />
vergangenen Jahrhunderts –<br />
Wolfgang Krieger (Universität Marburg)<br />
ging der Frage nach, ob das Sicherheitsbedürfnis<br />
der Deutschen in<br />
besonderem Maße ausgeprägt ist. Er<br />
erinnerte an das „Trauma der extremen<br />
Schutzlosigkeit“, das in der Zeit nach<br />
dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland<br />
herrschte. Das Vertrauen der Menschen<br />
in einen sicheren Staat ohne Diktatur<br />
sei in dieser Zeit zerstört gewesen.<br />
Dieses allgemeine Gefühl der Unsicherheit<br />
habe schließlich mit zu der<br />
umfangreichen Sozialgesetzgebung in<br />
der Adenauerzeit beigetragen. Der Referent<br />
rief den Tagungsteilnehmern<br />
weitere Katastrophen der Nachkriegszeit<br />
ins Gedächtnis, wie zum Beispiel<br />
die Hamburger Flutkatastrophe 1962,<br />
den Contergan-Skandal, die Bedrohung<br />
durch die Berlin-Blockade und<br />
schließlich die Rote Armee Fraktion.<br />
Diese Ereignisse verunsicherten die<br />
Deutschen tief und bestärkten sie in ihrem<br />
Sicherheitsstreben.<br />
„Pionierstaat der<br />
Sozialgesetzgebung“<br />
Die Sozialstaatlichkeit der Nachkriegszeit<br />
habe auf einer langen deutschen<br />
Tradition aufgebaut, wie Manfred G.<br />
Schmidt referierte. Eine jahrhundertealte,<br />
tief in der Gesellschaft verwurzelte<br />
Herrschaftstradition, der die Verantwortung<br />
des Herren gegenüber seinem<br />
Knecht zugrunde lag, habe<br />
<strong>Akademie</strong>-Report 2/2007<br />
zwei Weltkriege, moralische<br />
Verunsicherung, Hyperinflation,<br />
Weltwirtschaftskrise, Teilung<br />
und spätere Wiedervereinigung –<br />
das Streben nach Sicherheit in<br />
besonderer Weise das Denken der<br />
Deutschen prägte und noch immer<br />
prägt. Wie genau, das wurde<br />
bei der Tagung unter Leitung<br />
von Jürgen Weber und Karl-<br />
Heinz Willenborg beleuchtet, auf<br />
der Ebene der Individuen mit den<br />
Ergebnissen der demoskopischen<br />
Forschung, beim staatlichen<br />
Handeln mit Analysen zu wichti-<br />
Wolfgang Krieger: Allgemeines<br />
Gefühl der Unsicherheit.<br />
Foto: Willenborg<br />
Deutschland bereits im 19. Jahrhundert<br />
zum „Pionierstaat der Sozialgesetzgebung“<br />
werden lassen. Die Bismarcksche<br />
Sozialpolitik sollte negativen Folgen<br />
der zunehmenden Industrialisierung<br />
und Verstädterung entgegenwirken<br />
und die Arbeiterschaft an den monarchischen<br />
Staat binden. Neben dieser<br />
Tradition – so machte Schmidt deutlich<br />
– stellte später das demokratische<br />
System einen idealen Nährboden <strong>für</strong><br />
den Ausbau der Sozialstaatlichkeit dar.<br />
Durch das allgemeine Wahlrecht sei es<br />
nun auch der großen Masse der finanziell<br />
schlechter Gestellten, die im besonderen<br />
Maße vom Sozialstaat profi-<br />
gen Politikbereichen, von denen<br />
in der gegenwärtigen Diskussion<br />
die Entwicklung des Sozialstaats<br />
eine herausragende Rolle<br />
spielt. Die kardinalen Herausforderungen<br />
des Sicherheitsstrebens<br />
heute lauten darüber hinaus<br />
Globalisierung und internationaler<br />
Terrorismus. Die Frage,<br />
wie die innere Spannung von<br />
Sicherheit und Freiheit angesichts<br />
dieser Gefährdungen im<br />
Rechtsstaat ausbalanciert werden<br />
kann, wurde ebenfalls thematisiert.<br />
tieren, möglich, Einfluss auf die Gesetzgebung<br />
zu nehmen. Dies zeige sich<br />
deutlich daran, dass die zwei großen<br />
deutschen Sozialstaatsparteien – die<br />
CDU/CSU und die SPD – bei ihren<br />
Wahlkämpfen besonders mit sozialen<br />
Themen versuchten, Wählerstimmen<br />
<strong>für</strong> sich zu gewinnen.<br />
Manfred G. Schmidt: Sanierung des<br />
Sozialsystems schwer umzusetzen.<br />
Foto: Schwarzer<br />
Jedoch sei der <strong>für</strong> den deutschen Bundesstaat<br />
typische Dauerwahlkampf <strong>für</strong><br />
den Staat auch ein Problem, weil so<br />
eine „Sanierung“ des Sozialsystems<br />
nur schwer umzusetzen sei. Daneben<br />
hänge der Sozialstaat von sozioökonomischen<br />
Wirkkräften ab. „Wirtschaftlich<br />
begünstigt durch die enor-<br />
�<br />
9