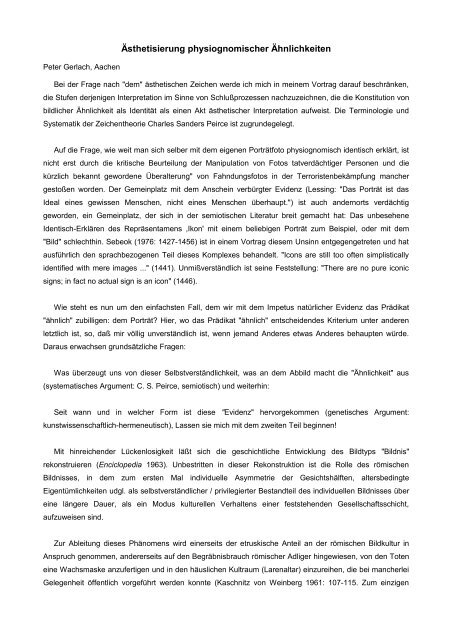Ästhetisierung physiognomischer Ähnlichkeiten
Ästhetisierung physiognomischer Ähnlichkeiten
Ästhetisierung physiognomischer Ähnlichkeiten
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Peter Gerlach, Aachen<br />
<strong>Ästhetisierung</strong> <strong>physiognomischer</strong> <strong>Ähnlichkeiten</strong><br />
Bei der Frage nach "dem" ästhetischen Zeichen werde ich mich in meinem Vortrag darauf beschränken,<br />
die Stufen derjenigen Interpretation im Sinne von Schlußprozessen nachzuzeichnen, die die Konstitution von<br />
bildlicher Ähnlichkeit als Identität als einen Akt ästhetischer Interpretation aufweist. Die Terminologie und<br />
Systematik der Zeichentheorie Charles Sanders Peirce ist zugrundegelegt.<br />
Auf die Frage, wie weit man sich selber mit dem eigenen Porträtfoto physiognomisch identisch erklärt, ist<br />
nicht erst durch die kritische Beurteilung der Manipulation von Fotos tatverdächtiger Personen und die<br />
kürzlich bekannt gewordene Überalterung" von Fahndungsfotos in der Terroristenbekämpfung mancher<br />
gestoßen worden. Der Gemeinplatz mit dem Anschein verbürgter Evidenz (Lessing: "Das Porträt ist das<br />
Ideal eines gewissen Menschen, nicht eines Menschen überhaupt.") ist auch andernorts verdächtig<br />
geworden, ein Gemeinplatz, der sich in der semiotischen Literatur breit gemacht hat: Das unbesehene<br />
Identisch-Erklären des Repräsentamens ,Ikon' mit einem beliebigen Porträt zum Beispiel, oder mit dem<br />
"Bild" schlechthin. Sebeok (1976: 1427-1456) ist in einem Vortrag diesem Unsinn entgegengetreten und hat<br />
ausführlich den sprachbezogenen Teil dieses Komplexes behandelt. "Icons are still too often simplistically<br />
identified with mere images ..." (1441). Unmißverständlich ist seine Feststellung: "There are no pure iconic<br />
signs; in fact no actual sign is an icon" (1446).<br />
Wie steht es nun um den einfachsten Fall, dem wir mit dem Impetus natürlicher Evidenz das Prädikat<br />
"ähnlich" zubilligen: dem Porträt? Hier, wo das Prädikat "ähnlich" entscheidendes Kriterium unter anderen<br />
letztlich ist, so, daß mir völlig unverständlich ist, wenn jemand Anderes etwas Anderes behaupten würde.<br />
Daraus erwachsen grundsätzliche Fragen:<br />
Was überzeugt uns von dieser Selbstverständlichkeit, was an dem Abbild macht die "Ähnlichkeit" aus<br />
(systematisches Argument: C. S. Peirce, semiotisch) und weiterhin:<br />
Seit wann und in welcher Form ist diese "Evidenz" hervorgekommen (genetisches Argument:<br />
kunstwissenschaftlich-hermeneutisch), Lassen sie mich mit dem zweiten Teil beginnen!<br />
Mit hinreichender Lückenlosigkeit läßt sich die geschichtliche Entwicklung des Bildtyps "Bildnis"<br />
rekonstruieren (Enciclopedia 1963). Unbestritten in dieser Rekonstruktion ist die Rolle des römischen<br />
Bildnisses, in dem zum ersten Mal individuelle Asymmetrie der Gesichtshälften, altersbedingte<br />
Eigentümlichkeiten udgl. als selbstverständlicher / privilegierter Bestandteil des individuellen Bildnisses über<br />
eine längere Dauer, als ein Modus kulturellen Verhaltens einer feststehenden Gesellschaftsschicht,<br />
aufzuweisen sind.<br />
Zur Ableitung dieses Phänomens wird einerseits der etruskische Anteil an der römischen Bildkultur in<br />
Anspruch genommen, andererseits auf den Begräbnisbrauch römischer Adliger hingewiesen, von den Toten<br />
eine Wachsmaske anzufertigen und in den häuslichen Kultraum (Larenaltar) einzureihen, die bei mancherlei<br />
Gelegenheit öffentlich vorgeführt werden konnte (Kaschnitz von Weinberg 1961: 107-115. Zum einzigen
erhaltenen Beispiel, Neapel Nat. Mus., um 300 v.Chr.: Bull 1977: 437). Hieran erscheint zweierlei von<br />
Bedeutung:<br />
1. Bildnisse stehen in einem aktuellen, bzw. jederzeit aktualisierbaren Handlungszusammenhang, der<br />
öffentlich motiviert ist und auf einen engen Kreis der herrschenden Oberschicht begrenzt blieb: ius imaginum<br />
des Geburtsadels, Ämternobilität, mindestens Aedilen, Frauen ausgeschlossen).<br />
2. Die physiognomische Ähnlichkeit, die sich auf die vordere Gesichtspartie bezieht, unterliegt einem<br />
Element von Zufälligkeit, denn auf dem Totenbett sieht der Leichnam nicht unbedingt so aus, wie man das<br />
Bildnis des Verstorbenen öffentlich vorstellen will.<br />
So sehen dann auch die Büsten, die eine Statue eines Römers als Bildnisse seiner Ahnen trägt,<br />
keineswegs nach Totenmasken aus. Jedenfalls haben wir einige Veränderungen ganz spezifischer Art ins<br />
Kalkül zu ziehen. Diese öffentliche Zurschaustellung änderte sich mit dem Erstarken des christlichen<br />
Einflusses auf die römische Kultur. Die Formen des Bildnisses werden noch in römischer Zeit radikal auf<br />
"expressive" Bildnistypen hin ausgeprägt. Schließlich haben die Bildnisse untereinander mehr an<br />
Gemeinsamkeiten, als das Völkergemisch in der Spätphase des römischen Imperiums je hat bei den<br />
lebenden Individuen aufweisen können. Bildnisse bekommen offensichtlich eine andere Funktion. So lautet<br />
der übereinstimmende Schluß und dies ändert sich für die nächsten Jahrhunderte in verschiedener<br />
Richtung, gleichwohl der Individualisierung <strong>physiognomischer</strong> Ähnlichkeit gänzlich konträr (Enciclopedia<br />
1963: 577 - 583; Keller 1970).<br />
In der Argumentation christlicher Autoren um das Verständnis der Ebenbildlichkeit des Menschen mit<br />
Gott (Gen. 1, 26) und die Funktion der Inkarnation Christi wird die Frage nach einer Legitimation von<br />
christlicher Kunst überhaupt aufgeworfen gegenüber dem alttestamentarischen Bildverbot (Ladner 1965).<br />
Auf der einen Seite wird die ausschließlich spirituelle Relation der Ebenbildlichkeit herausgestellt, wenn etwa<br />
Clemenz von Alexandria formuliert: Das Bild Gottes ist der göttliche Logos, aber das Abbild des Bildes ist<br />
die Seele des Menschen (Stromata 5,14), auf der anderen Seite besteht ein aufweisbarer Zusammenhang<br />
mittelalterlicher Bildnisse mit denen der Antike (Klauser 1958).<br />
Indes tritt mit dem 12. Jh. Individualisierung in der Ikonographie menschlicher Gestalt unterschiedlich<br />
hervor, ohne daß es einen nachweislichen Verwendungsrahmen des Bildnisses gäbe, dessen einziger oder<br />
hauptsächlicher Grund physiognomische Ähnlichkeit wäre (Brückner 1966; Kocks 1971; Heller 1976, anders<br />
z. B. Pope - Hennessy 1966 "The Cult of Personality", S. 4: Kommemorative Funktion.). Terminologie und<br />
Argumentation der Bilderstürmereien und des Bilderverbots geben deutliche Anhaltspunkte für diese<br />
Argumente (Warnke 1973).<br />
Im ersten illustrierten Druck der "Celeste Fisonomia" des Giovanni Battista della Porta (1541-1615), der<br />
1586 in Neapel erschien, wird mit jenem Begriff von "Ähnlichkeit' argumentiert, die durch Zeichen zwischen<br />
Makro- und Mikrokosmos vermittelt ist, <strong>Ähnlichkeiten</strong>, die allenthalben herrschen: Bezeichnende Form und<br />
bezeichnete Form sind <strong>Ähnlichkeiten</strong>, die nebeneinanderstehen. Wahrscheinlich ist darin die Ähnlichkeit im<br />
Denken des sechzehnten Jahrhunderts das, was es an Universellstem gibt; gleichzeitig das Sichtbarste, was
man jedoch zu entdecken versuchen muß, denn es ist das am meisten Verborgene; das was die<br />
Erkenntnisform determiniert (denn man erkennt nur, indem man den Wegen der Ähnlichkeit folgt) und was<br />
ihr den Reichtum ihres Inhalts garantiert (denn wenn man die Zeichen aufhebt und betrachtet, was sie<br />
bezeichnen, läßt man die Ähnlichkeit selbst in ihrem Licht an den Tag kommen und aufleuchten)". (Foucault<br />
1966:60.) Von Innerlichkeit keine Rede. Im Prinzip gilt hier der Syllogismus:<br />
Jedes Lebewesen erhält seine Gestalt von den Sternen und den Zeichen, die dominieren<br />
(Planetenkonstellationen).<br />
Der Mensch, der zu einem solchen Zeitpunkt geboren wird, erhält von daher seine Gestalt.<br />
Der Mensch, der auf diese Weise seine Gestalt erhalten hat, erhält konsequenterweise einen der<br />
Planetenkonstellation ähnlichen Charakter, die seine physiognomische Besonderheit ausweist. "I luochi del<br />
cielo, nei quali sono forme simili alle forme de gli huomini, & alle forme, che sono ne i segni, ò fuor de i<br />
segni, fanno i corpi ben fatti, e ben proportionati, ma le altre forme che sono di conditioni, diversivicano i<br />
corpi, & li fanno ineguali ..." (della Porta 1586:77).Bezeichnenderweise wird unter dem Stichwort<br />
"Physiognomie" keineswegs die Gestalt des Kopfes oder des Gesichts verstanden, sondern sowohl die<br />
Proportion des ganzen Körpers, als auch Wohl- und Mißgestalt einzelner Körperteile. In den Illustrationen<br />
wird eigentümlicherweise mehrheitlich nur ein Mensch-Tier Vergleich der Kopf- und Gesichtspartien<br />
vorgeführt! Bildliche Innovation erscheint hier begrifflich noch nicht eingeholt. Ähnlichkeit heißt noch immer<br />
Analogie, Zeichen für kosmische Sympathie, die zwischen "ähnlichen" Elementen vorherrscht und entdeckt<br />
werden kann. (Enciclopedia 1963 III: 114-118). Die Zeichen bleiben dem Bewußtsein äußerlich, es sind die<br />
von Gott den Dingen gegebenen Signaturen, die der Mensch entdecken kann, um Erkenntnisse über diese<br />
Welt zu gewinnen.<br />
Wenig wissen wir dagegen über die Ziele derjenigen Maler und Graphiker, die bereits über einhundert<br />
Jahre zuvor sich auf die äußerliche, jeglicher auf Taten verweisender Attribute abholden Ähnlichkeit<br />
<strong>physiognomischer</strong> Eigentümlichkeiten des "nach dem Leben gemalten" Individuums spezialisiert hatten.<br />
Absichtlich tritt Attribut und Symbol völlig zurück hinter die physiognomische "Zufälligkeit" des abgebildeten<br />
individuellen Antlitzes. Durch das Insistieren auf dem Recht des Einzelnen und Besonderen in der Reflexion<br />
auf die eigenen Züge, diese anschaulich werden zu lassen, werden physiognomische Qualitäten selbst<br />
attributives Mittel, dem Zweck zugeordnet Individualität ohne Beziehung zu szenischer Einbindung - die<br />
immer Garanten feudaler Legitimation und deren Derivate bezeichnen - aufzuweisen. (Hinz 1975: 104;<br />
Geisberg 1923). Dem Kundigen bleibt selbst noch die ausgeprägteste Physiognomie etwa in Veith Stoß'<br />
Altarbildern spätgotischer Typus, der seiner thematischen Einbindung im Ausschnitt entkleidet nicht an<br />
Individualität gewinnt, sondern durch Haltung und Wendung einer Ergänzung durch Andere fordert.<br />
In der graphischen Darstellung eines Ehepaares wird bis heute unangefochten ein Selbstbildnis eines<br />
Meisters mit seiner Frau vermutet, wie die beigegebene Unterschrift besagt: Individualbildnis, also Porträt im<br />
engeren, neuzeitlichen Sinn (um 1480 / 90) (Thieme / Becker 24 1930: 325 - 326). Die Einzelheiten dieser<br />
Bestimmung können hier nicht diskutiert werden. Wesentlich wird das Fehlen von Wappen, Hausmarken und<br />
dgl. vermerkt, die Reduktion auf das Gesicht (ohne Hände!) und die stille Repräsentation, die sich (als
gedachter oder fiktiver Ausschnitt) in kein für diese Zeit bekanntes (Bild-)Handlungsschema einfügen ließe<br />
(Warburg 1930; Hinz 1974: 157). Privatheit wird Ausweis einer bürgerlichen Ikonographie, deren zentrales<br />
Kriterium dasjenige ist, was Waetzold 1908 für die kunstwissenschaftliche Forschung hypothetisch<br />
formulierte: "Die Ähnlichkeit, jedoch als außerästhetischer Wert, der nur für eine kleine Betrachtergruppe<br />
existiert. Ob deshalb der Ähnlichkeitsgehalt eines Porträts überhaupt bedeutungslos für den ästhetischen<br />
Genuß ist, wird der Gang der Untersuchung zu beantworten haben". (Waetzold 1908: 73). Beifügungen von<br />
Altersangaben und Entstehungsjahr in der Dürerzeit weisen einen verfestigten Platz dem Porträt innerhalb<br />
der Hierarchie der Bildgattungen bereits um 1500 aus. Zweifel an der Ausdrucksfähigkeit nur der<br />
physiognomischen Ähnlichkeit allein tauchen bei Dürer 1526 auf (Hinz 1975: 105): Damit bezweifelt er aber<br />
eher die Ohnmacht des Malers, als die Ohnmacht dieser neuen Identitätsvorstellung. Wenn nun noch in der<br />
Physiognomik des 16. Jh. Ähnlichkeit als eine durch Sympathie vermittelte Analogie begrifflich gefaßt wird,<br />
wie ist dann die Ähnlichkeit als bildwürdiges Thema im Rahmen des Bildnisses zu verstehen? Was heißt hier<br />
Abbildung der eigenen Physiognomie?<br />
Diese unterliegt, wie jede andere Abbildung als Zeichen interpretiert, den gleichen Bedingungen, wie wir<br />
diese für die Ornamentgraphik des gleichen Zeitraumes aufgewiesen haben (Gerlach 1977: 278). Nur daß<br />
das Repräsentanten nicht nur Ikon ist, kraft einer Eigenschaft, die es für sich genommen besitzt, nämlich zu<br />
figurieren. Dies kann aber nichts anderes heißen, als daß das Bildnis stilistische Merkmale aufweist, es ist<br />
aber zuerst ein Repräsentamen, "das seine Funktion erfüllt, die es nicht haben könnte, wenn sein Objekt<br />
nicht existierte". Das Objekt aber existiert als Porträtierter, Peirce hat diesen Fall als Index klassifiziert. In der<br />
"relativ echten Form des Index" (5.75) ist aber ein Ikon eingeschlossen. Der duale Charakter am<br />
graphischen Bildnis wird sogleich klar, wenn wir bestimmen können, was das erste Element ist, "kraft dessen<br />
der Index wirkt und das als Vertreter des partikulären Objekts dient, während das andere-das implizierte<br />
Ikon-das Repräsentanten selbst repräsentiert, welches eine Qualität des Objektes ... ist". (5.75). Jenes<br />
Wahmehmungsmodell nämlich, das wir beim Erkennen und Erinnern eines Gegenstandes konstruieren,<br />
weist diejenige Ähnlichkeit mit dem Ikon auf - und eben nicht mit dem Objekt - die die aktuelle Veränderung<br />
ist, die durch das Objekt bewirkt wird, wie es Peirce für das implizierte Ikon fordert. Wie aber wird das<br />
partikuläre Objekt vertreten, damit das Zeichen zur Klasse der "relativ echten Form des Index" gehören<br />
kann? Dies kann nur die je geordnete Konfiguration sein, die isomorphe Verteilung, aus der die Umrißlinie<br />
zusammengesetzt ist. Denn nur darin ist die Forderung erfüllt, daß, wenn ein Index durch das Objekt bewirkt<br />
wird, er notwendigerweise mit dem Objekt Qualitäten gemeinsam hat und nur unter Hinsicht auf diese sich<br />
auf das Objekt bezieht. Damit sind wir bei einer allgemeinen Bestimmung einer Abbildung oder graphischen<br />
Notation angelangt. Die Frage nach der Evidenz der "physiognomischen Ähnlichkeit" ist uns aber weder<br />
zweifelhaft noch plausibler geworden.<br />
Nun werden wir dem Urheber dieses Bildnisses keine Intentionen unterstellen wollen, die außerhalb des<br />
Denkens seiner Zeit lägen. Es gab für die Abbildung der Individualität mittels <strong>physiognomischer</strong> Ähnlichkeit<br />
keinen theoretischen Begriff, und es gab keinen praktischen Zweck, der eine der unseren vergleichbare<br />
Verwendungsweise für einen derartigen Bildtyp einschlösse.<br />
Vor aller begrifflichen Füllung ist die Herstellung dieser Bildnisse Produkt eines experimentierenden<br />
Handwerks, deren einzelne Vertreter sich in einer bestimmten historischen Situation in der
Auseinandersetzung mit einer feudalen Bildtradition äußerlich und in dem Insistieren auf die eigene<br />
Privatheit in allerersten Schlußformen auf die eigene Innerlichkeit beziehen und sie im Bild artikulieren.<br />
(Geisberg 1923: 15 - 17).<br />
Welche Sensationen sinnlicher oder geistiger Art den Graphiker des 15. Jh. bewegt haben mögen,<br />
entzieht sich unserer Nachprüfung. Dadurch aber, daß er uns ein graphisches Bildnis hinterlassen hat, steht<br />
doch einiges fest: Daß es ein sinnlich und geistig begabter Mensch gewesen sein muß, der dieses Bildnis<br />
hergestellt hat, als Folge einer Motivation in seinem speziellen Medium zu handeln. In dem Maße wie<br />
individuelle Sinnlichkeit zunehmend nur noch als private legitim zur Geltung gebracht werden kann und in<br />
der Öffentlichkeit negativ sanktioniert ist, stellt sich im Bildnis als Abbild <strong>physiognomischer</strong> Merkmale eine<br />
neue Artikulationsform vergegenständlichter bzw. objektivierter und damit rudimentärer Sinnlichkeit in<br />
legitimer Form der Öffentlichkeit. Ein Gefühl, das durch das Bildnis hervorgerufen wird, ist die erste<br />
eigentliche bedeutungstragende Wirkung des Zeichens. Der "emotionale Interpretant" (Peirce) kann aber<br />
nicht diejenige Instanz sein, in der die eigentümliche Überzeugung ihren Ort hat, daß ein Porträt dem<br />
Porträtierten, physiognomisch ähnlich sei. Der "emotionale Interpretant" ist aber dasjenige, was alle anderen<br />
Interpretanten zur Grundlage haben: Es ist eine Suggestion, die Suggestion allgemeinster Art, die uns<br />
überhaupt ein Bild mit dem Abgebildeten in Verbindung zu bringen erlaubt, dies aber mit einer<br />
unbezweifelbaren Gewißheit. (Dewey 1958: 90 ff).<br />
In der Einfühlungstheorie Theodor Lipps wurde dieses Phänomen rein introspektiv beschrieben, wenn er<br />
feststellt: "Wir versetzen uns also gleichsam mit unserem eigenen Körper in (eine) Linie und tun so, als hätte<br />
sie ebenfalls einen Körper" bis hin zu der "Einfühlung in die sinnliche Erscheinung lebender Wesen" (Lipps<br />
1907: 355-359). Was uns aber genauer dazu befähigt, derartige "Einfühlung" zu leisten, wie denn das<br />
unmittelbare Objekt als geistiger Repräsentant auch materiell mit dem Bewußtsein überhaupt in Verbindung<br />
kommen kann, ist in der "Theorie der complexen Localzeichen" Wilhelm Wundts von 1898 erläutert: Bei den<br />
an die Stellung und Bewegung des Auges gebundenen Empfindungen handelt es sich (wahrscheinlich)<br />
"aber in allen diesen Fällen um Complexe von Empfindungen, an denen neben den Gelenken die Muskeln<br />
selbst, die Haut und die sonst mit sensiblen Nerven versehenen umgebenden Gewebe teilnehmen", die als<br />
"innere Tastempfindungen" angemessen benannt sind: "Indem die Spannungsempfindungen des Auges, ein<br />
Continuum von einer Dimension bildend, mit dem zweidimensionalen, aber ungleichartigen Continuum der<br />
Netzhautlocalzeichen assoziativ verschmelzen, erzeugen sie ein gleichartiges Continuum von zwei<br />
Dimensionen, das heißt eine Raumoberfläche ..." (Wundt 1898: 112). Auf dem 1. Semiotischen Kolloquium<br />
in Berlin 1975 hat der Vortrag von Grüsser (1977: 29) deutlich gemacht, daß die von Wundt in der Netzhaut<br />
hypothetisch lokalisierten "Zeichen" mit den durch Winkel- und Kontrastunterbrechung erregbaren<br />
Nervenzellenklassen (Detektoren) in der Sehrinde des Gehirns identifiziert werden müssen.<br />
In dem suggestiven Miteinander von innerem Tastsinn und jenen Sehrindenlokalzeichen konstituiert sich<br />
dasjenige Zeichen, dessen emotionaler Interpretant diejenige Reihe von Schlußprozessen einleitet, die uns<br />
Ähnlichkeit zwischen uns und unserem Porträt evident erscheinen läßt.<br />
Springen wir an dieser Stelle in das 19. Jh. über. Sozusagen rückwärts von demjenigen Ende, das wir<br />
willkürlich bei Darwins Ergebnissen der Untersuchung zur physiognomischen Expression des Kindes
(Ekman 1973: 223 ff), die er als entwicklungsgeschichtlich erworben charakterisiert-und die sich im Prinzip<br />
nicht oder kaum von denen Morris' (1978) unterscheiden. Auch hier ist nach der Genese und der Funktion<br />
dieser Arbeiten und der Wende, die sich innerhalb der Diskussion dartut, zu fragen, um diejenigen<br />
Schlußprozesse zu rekonstruieren, die in ihnen wirksam sind. Literarisch manifest ist das Feld zwischen<br />
Psychologie und Soziologie durch die sogen. französischen Physiologen (Barberis 1970: 699) geworden, die<br />
zwischen Brillat-Savarins "Physiologie du gout" (1826) und Balzacs "Physiologie du mariage" (1829) mit<br />
ihren Arbeiten begannen (Huon 1957). In der Zeitschrift "La Silhouette" z. B. erschienen diese Artikel mit<br />
Illustrationen der bekanntesten Karikaturisten wie Gavarni, Daumier, Cham u. a. Es sind Arbeiten, die eine<br />
wissenschaftliche Analyse der sozialen Gruppen und deren spezifische Verhaltensformen zum Gegenstand<br />
haben, ebenso wie die sie begleitenden Zeichnungen. (Van Biesbrock 1978: 22 ff).<br />
Die Karikatur, speziell die Bildniskarikatur stellt die kunstwissenschaftlich wichtige Frage heraus, was sich<br />
zeichentheoretisch aussagen läßt über den Status der "Ähnlichkeit" bei der Konstitution von<br />
Bedeutungsfeldern, die mit diesen Karikaturen von Typen, Berufen, Institutionen hergestellt wurden und sich<br />
offensichtlich einer breiten, einverständigen Rezeption erfreuten (Daumier 1974: 28 ff). Doch zuvor noch<br />
eins: Die Bildniskarikatur entstand im 17. Jh. (Boeck 1968). Die Annahme einer einfühlenden Sympathie, die<br />
sich auf das Erleben und Kennen des eigenen Körpers bezieht (Kemp 1975), muß für das frühe 19. Jh. in<br />
verstärkter Weise angesetzt werden, als für das frühe 15. / 16. Jh. Allerdings hat sie ihre Wirkung nicht mehr<br />
bloß in einer ersten Schicht emotionalen Schließens, sondern die Karikatur setzt bereits eine rationale<br />
Thematisierung voraus, die zwischen dem 17. und 19. Jh. schrittweise angewachsen ist. Diesen Zuwachs<br />
müssen wir für die Karikatur näher als einen Komplex von sozialen Urteilen bestimmen. Diese aber sind ein<br />
Interpretanten-Problem. Emotionaler und energetischer Interpretant sind Wirkungen, die das Bildnis "als<br />
Abbild <strong>physiognomischer</strong> Ähnlichkeit" hat: Es ist jenes Gefühl des reinen Wiedererkennens, die übergeht in<br />
die eigentlich bedeutungstragende Wirkung, die immer eine Anstrengung, eine Einwirkung auf die Innenwelt<br />
darstellt, nämlich das sich als identisch wiedererkennen, das jeweils einen einzelnen Akt darstellt. Dieser Akt<br />
ist jederzeit wiederholbar, mit den gleichen Mitteln und den gleichen Wirkungen.<br />
Die Karikatur aber, die ja das Prinzip der "physiognomischen Ähnlichkeit" voraussetzt und historisch in<br />
der Tat voraussetzte, basiert auf der Norm dessen, was als hinreichende Bedingungen für die<br />
"physiognomische Ähnlichkeit" allgemein akzeptiert wurde.<br />
Die Karikatur ist aber nicht nur dasjenige, wo "das Häßliche durch Selbstübertreibung lächerlich" wird,<br />
wie es in dem systematischen Versuch von Karl Rosenkranz in seiner Ästhetik des Häßlichen (1853) an der<br />
Umschlagstelle von dem Widrigen zum Komischen lokalisiert wurde, sondern auch diejenige Stelle, wo das<br />
Allgemeine, die gesellschaftliche Institution, mit den Mitteln - figuralen und physiognomischen - der<br />
Individualisierung attackiert wurde. Leonardo hatte die bildliche Reflexion über die physiognomische<br />
Ähnlichkeit entdeckt - seine Zeichnungen blieben folgenlos, bis sie von einem Niederländer gestochen und<br />
verbreitet wurden. In England des ausgehenden 18. Jh. entstand unter dem Eindruck italienischer Vorlagen<br />
jener Typus von Karikatur, der in Frankreich zwischen Napoleon I. und Napoleon III. zum politischen<br />
Kampfinstrument wurde und auf der Basis der "Evidenz <strong>physiognomischer</strong> Ähnlichkeit' scheinbar einzelne<br />
Akte individuellen Erkennens betraf, unter dem Gewand der bildlichen Norm des Individualporträts aber<br />
politische Argumente hervorbrachte. Dies meint eine Modifikation der Tendenz einer Person, in bestimmter<br />
Weise zu handeln, die das Ergebnis vorhergegangener Erfahrungen oder vorhergegangener
Willensanstrengungen bzw. Handlungen oder eines Komplexes beider Arten von Ursachen ist: Habit-<br />
Change.<br />
Literatur<br />
Barberis, Pierre, 1970: Balzac et le mal du siècle. Contribution á une Physiologie du monde moderne. Paris<br />
Boeck, Wilhelm, 1968: Inkunabeln der Bildniskarikatur bei Bologneser Zeichnern des 17. Jahrhunderts. Von<br />
Freunden und Schülern zum 60. Geburtstag. Stuttgart<br />
Brückner, Wolfgang, 1966: Bildnis und Brauch. Studien zur Bildfunktion der Effigies, Berlin.<br />
Bull, Reinhard, 1977: Das große Buch vom Wachs. Geschichte, Kultur, Technik. München.<br />
Darwin, Charles, 1874: Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei dem Menschen und den Thieren. Aus d.<br />
Engl. übers. v. J. Victor Carus, 2. sorgf. durchges. Aufl. Stuttgart.<br />
Daumier, Honore und die ungelösten Probleme der bürgerlichen Gesellschaft. Ausst. Kat. Neue Gesellschaft<br />
für Bildende Kunst, Berlin Mai / Juni 1974.<br />
Della Porta, 1586: Giambattista d. J., De Humana Physiognomia libri III, Neapel.<br />
Dewey, John, 1934 / 1958*: Art as Expcrience. New York.<br />
Enciclopedia 1963: E. Universale dell'Arte, Istituto per la Collaborazione Culturale. Venezia - Roma, Bd. III,<br />
s. v. Carattere; Bd. XI, s. v. Ritratto.<br />
Foucault, Michel, 1966: Les mots et les choses. Paris, zit. n.: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der<br />
Humanwissenschaften. Frankfurt 1974.<br />
Geisberg, Max, 1923: Die Anfange des Kupferstichs. = Meister der Graphik hrsg. v. H. Voss. B. 2, 2. Aufl.,<br />
Leipzig.<br />
Gerlach, Peter, 1977: Probleme einer semiotischen Kunstwissenschaft, in: Posner / Reinecke, 1977, S. 262 -<br />
292.<br />
Grüsser, Otto - Joachim, 1977: Neurobiologische Grundlagen der Zeichenerkennung, in: Posner / Reinecke<br />
1977, S. 13 - 45.<br />
Heller, Elisabeth, 1976: Das altniederländische Stifterbild. = Tuduv-Studien: Reihe Kulturwiss., Bd. 6.<br />
München.<br />
Hinz, Berthold, 1974: Studien zur Geschichte des Ehepaarbildnisses, in: Marburger Jhb. f.<br />
Kunstwissenschaft, Bd. 19, S. 139 - 218.<br />
Hinz, Berthold, 1975: Innerlichkeit und ihre äußerlichen Bedingungen. Das humanistische Bildnis des<br />
Justinian und der Anna von Holzhausen, in: Städel-Jahrbuch hrsg. v. K. Gallwitz u. H. Beck. NF Bd. 5, S. 97<br />
- 110.<br />
Huon, Antoinette, 1957: Charles Philipon et le maison Aubert, in: Andree Lheritier, Les Physiologics.<br />
Repertoire des Physiologics. Études de Presse, 4e trimestre 1957.<br />
Kaschnitz von Weinberg, Guido, 1961: Römische Kunst, Bd. 2. Zwischen Republik und Kaiserzeit, hrsg. v.<br />
Helga von Heintze. = rowohlts deutsche encyclopedie. Hamburg.<br />
Keller, Harald, 1970: Das Nachleben des antiken Bildnisses von der Karolingerzeit bis zur Gegenwart.<br />
Freiburg / Basel / Wien.<br />
Kemp, Wolfgang, 1975: Die Beredsamkeit des Leibes. Körpersprache als künstlerisches und<br />
gesellschaftliches Problem der bürgerlichen Emanzipation, in: Städel-Jhb. NF Bd. 5, S. 111 - 134.
Klauser, Theodor, 1958: Studien zur Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst, in: Jhb. für Antike und<br />
Christentum l, 1958, S. 20 ff, 2, 1959, S. 115 ff, 3, 1960, S. 112 ff.<br />
Kocks, Dirk, 1971: Die Stifterdarstellungen in der italienischen Malerei des 13. - 15. Jahrhunderts. Phil.Diss.<br />
Köln 1971.<br />
Lipps, Theodor, 1907: Ästhetik, in: Die Kultur der Gegenwart, Bd. 1, 6, S. 355 - 359 und Ästhetik, Bd. 1 - 2,<br />
Hamburg - Leipzig 1903 - 1906.<br />
Morris, Demond, 1978: Der Mensch, mit dem wir leben. München.<br />
Posner, Roland / Reinecke, Hans - Peter, Hsg., 1977: Zeichenprozesse. Semiotische Forschungen in den<br />
Einzelwissenschaften, Wiesbaden.<br />
Peirce, Charles Sanders, 1933: Collected Papers of Ch. S. P. ed. by Ch. Hartshorne and P. Weiss,<br />
Cambridge, Mass. zit. n. Karl - Otto Apel (Hrsg.) Charles S. Peirce Schriften zum Pragmatismus und<br />
Pragmatizismus. =Theorie Suhrkamp, 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1976.<br />
Pope - Hennessy, John, 1966: The Portrait in the Renaissance. London.<br />
Riedl, Fritz, 1931: Das Selbstbildnis. Berlin.<br />
Rosenkranz, Karl, 1853: Ästhetik des Häßlichen, zit. n. der Ausg. Wiss. Buchges. Darmstadt 1973.<br />
Schweitzer, Bernhard, 1948: Die Bildniskunst der römischen Republik. Leipzig.<br />
Sebeok, Thomas A., 1976: Iconicity, in: Modern Languages Notes Bd. 91, S. 1427 - 1456.<br />
Thieme, Ulrich / Becker, Felix, 1930: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur<br />
Gegenwart, Bd. 24, Leipzig, S. 325-326 s. v. Meckenem.<br />
van Biesbrock, Hans - Rüdiger, 1978: Die literarische Mode der Physiologien in Frankreich (1840-1842).<br />
Phil. Diss. Aachen. Frankfurt a.M. / Bern / Las Vegas.<br />
Waetzold, Wilhelm, 1908: Die Kunst des Porträts. Leipzig.<br />
Warburg, Anni, 1930: Israhel van Meckenem. Bonn.<br />
Warnke, Martin, 1973: Bildersturm. Die Zerstörung des Kunstwerks, München.<br />
Wundt, Wilhelm, 1898: Zur Theorie der räumlichen Gesichtswahrnehmung, in: Philosophische Stud. hrsg. v.<br />
W. Wundt, Bd. 14, Leipzig S. 1 - 118.