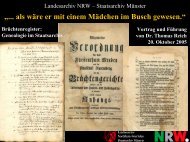ARCHIVAR 209 - Archive in Nordrhein-Westfalen
ARCHIVAR 209 - Archive in Nordrhein-Westfalen
ARCHIVAR 209 - Archive in Nordrhein-Westfalen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
154<br />
<strong>ARCHIVAR</strong> 62. Jahrgang Heft 02 Mai 2009<br />
ARCHIVTHEORIE<br />
UND PRAXIS<br />
In zweifacher H<strong>in</strong>sicht – die <strong>in</strong> Pacht genommene Würde des<br />
Sammelns und Speicherns an sich vorausgesetzt – ist dieser These<br />
zunächst etwas Beruhigendes, ja Versöhnliches zuzusprechen.<br />
Zum e<strong>in</strong>en dar<strong>in</strong>, dass vor dem ultimativen Speichergedächtnis<br />
nicht alle<strong>in</strong> die von Siegern (nicht nur im militärischen S<strong>in</strong>ne)<br />
geschriebene Geschichte Gültigkeit beanspruchen kann. Zum<br />
anderen mag es dem Archivar tröstlich ersche<strong>in</strong>en, dass angesichts<br />
e<strong>in</strong>er Aushebungsstatistik, welche die e<strong>in</strong>malige Benutzung<br />
e<strong>in</strong>er Akte <strong>in</strong>nerhalb von 35 Jahren konstatiert, soviel Wert auf<br />
die (freilich unhörbare) Vielstimmigkeit des Zusammengetragenen<br />
und Bewahrten gelegt wird. So könnte es ersche<strong>in</strong>en, wenn<br />
nicht e<strong>in</strong>er zu uns – dem Archivar, dem Archivbenutzer, dem<br />
Historiker – sprechenden „Stimme“ der Dokumente kaum noch<br />
Beachtung zukäme.<br />
Nicht e<strong>in</strong>e Geschichte der Medien, sondern die technische<br />
Materialität der Medien der Geschichte steht im Vordergrund.<br />
Diskursivität ist Ernst per se verdächtig; <strong>in</strong> den großen historischen<br />
Narrationen (Nation, Fortschritt etc.) sei stets Ge schich te(tes)<br />
<strong>in</strong> Macht übersetzt – und vice versa: Macht auf Historie umgepolt<br />
–, stets fragmentarische <strong>in</strong> erfüllte Existenz umgedeutet<br />
worden. Zu sehr habe heutiges geschichtswissenschaftliches<br />
Selbstverständnis Droysens auf Akten über Staats- und Verwaltungstätigkeiten<br />
bezogenes „Aus Geschäften wird Geschichte,<br />
aber sie s<strong>in</strong>d nicht Geschichte“ als Imag<strong>in</strong>ations- und Narrationsparadigma<br />
<strong>in</strong>ternalisiert. Die Herrscher über das Gedächtnis, so<br />
heißt es tendenziös, bedienten die Adressaten nach Belieben.<br />
Ernsts Wunschbild ist aber e<strong>in</strong> Gedächtnis, welches se<strong>in</strong> eigener<br />
Adressat ist; er möchte, dass beide <strong>in</strong> e<strong>in</strong>s fallen, um perspektivisch<br />
motivierter Verfügbarkeit über Gespeichertes zu entgehen.<br />
Ernsts These lässt sich durchaus kulturkritisch im S<strong>in</strong>ne Adornos<br />
verstehen: der Waren- und Ausstellungscharakter des Gesammelten<br />
und Gespeicherten erst gibt den Anlass zur Verführung,<br />
Verdrehung, Unterschlagung, kurz zum (konstruktiv-konstruierten)<br />
Missbrauch. Auf Daten übertragen sche<strong>in</strong>t diese Auffassung,<br />
um bei Adorno zu bleiben, e<strong>in</strong>e Art anti-kapitalistischen Zug<br />
aufzuweisen: Zwar handelt es sich um e<strong>in</strong> Sammeln um des<br />
Anhäufens willen, jedoch soll offenbar das Gesammelte nicht<br />
wieder <strong>in</strong> Umlauf gebracht werden. Die Fürsprache für das<br />
Monument anstatt des Dokuments, für das Datum anstatt der<br />
Information, für Übertragung anstatt von Kommunikation, für<br />
Deskription anstatt von Hermeneutik, für Gedächtnis anstatt<br />
Er<strong>in</strong>nerung bedeutet zugleich e<strong>in</strong>e Absage gegenüber der diskursiven<br />
Distribution, der fortlaufenden Abfassung und Verbreitung<br />
von Texten über und dem Dialog mit <strong>in</strong> <strong>Archive</strong>n Gespeichertem.<br />
Dieses vermehrt sich bereits durch das vielfältige Leben (von der<br />
Verwaltungsakte bis zum Nachlass), dessen pluralistisches Auf -<br />
kommen <strong>in</strong> allen Eigenheiten und Unarten völlig gleich bedeutend<br />
aufzunehmen ist. Das Gespeicherte, so lässt sich im S<strong>in</strong>ne<br />
der medientheoretischen Herangehensweise sagen, spricht mit<br />
sich selbst, ohne sich zu zerstückeln und narrativ zu rekonfigurieren.<br />
Ernst sche<strong>in</strong>t versessen auf das Historische als e<strong>in</strong>es (unzugänglichen)<br />
Eigenwerts, e<strong>in</strong>e Geschichte, die gar nicht vorliegt, sondern<br />
sich erst im Medium des Archivs autopoetisch erzeugt. Dieses<br />
Synonym-Denken (Archiv = Geschichte, aber e<strong>in</strong>e solche, die sich<br />
nicht schreiben, nicht erzählen lässt) ersche<strong>in</strong>t nach zwei Seiten<br />
h<strong>in</strong> paranoid: zum e<strong>in</strong>en <strong>in</strong> dem Wunsch, den Autor als Schöpfer<br />
und Gestalter loszuwerden (siehe Foucaults „Tod des Autors“),<br />
zum anderen <strong>in</strong> der Sorge um die so oft wiederlegte Unantastbarkeit<br />
von Geschichte als gesichertes Datum. Geschichte möchte<br />
Ernst nur noch als systemtheoretisch geschlossenes Universum<br />
denken. Als Signum dafür gilt ihm Goethes Durchnummerieren<br />
und anschließendes Versiegeln des „Faust“-Manuskripts.<br />
Insbesondere für die tägliche Praxis des Archivarsberufs hat das<br />
etwas Ungewöhnliches, ja Revoltierendes. Denn an welcher Stelle<br />
f<strong>in</strong>det <strong>in</strong> Ernsts Auffassungsweise etwa noch e<strong>in</strong>e – zweifelsohne<br />
immer sich an narrativ vermittelten Geschichtsdeutungen orientierende<br />
– Bewertung statt? Wie sollen die Probleme der Aufbewahrung<br />
und Magaz<strong>in</strong>ierung gelöst werden? Ernst denkt hier an<br />
die vielfältigen Möglichkeiten der elektronischen Datensicherung.<br />
Aber auch <strong>in</strong> H<strong>in</strong>sicht auf die Biographie jedes E<strong>in</strong>zelnen wirkt<br />
die Dialogferne se<strong>in</strong>er Auffassung abweisend: Schauplätze der<br />
Geschichte werden als – oftmals verlorener oder vernichteter –<br />
Lebensraum nicht länger berücksichtigt noch gewürdigt. In e<strong>in</strong>er<br />
gleichsam hermetisch geschützten Geschichte gibt es ke<strong>in</strong>e<br />
Vergessenheit und ke<strong>in</strong>e Er<strong>in</strong>nerung.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der Arbeit und des Selbstverständnisses der <strong>Archive</strong><br />
gelangt Ernst zu provokativen Schlussfolgerungen. Das Kassationsverfahren,<br />
die bewertende Auswahl von archivwürdigem<br />
Material (Ernst spricht diesbezüglich von e<strong>in</strong>er Archiv und Ver -<br />
waltung übergestülpten Taxonomie) ist ihm äußerst verdächtig.<br />
Denn ebenso wie die Forschung als Akt narrativer Übersetzung<br />
sei sie Umpolung von Macht auf Geschichte. Archivographie, so<br />
se<strong>in</strong> Begriff, bedeutet ihm e<strong>in</strong>e Verknappung der Historie.<br />
In diesem Zusammenhang bezieht Ernst sich auf He<strong>in</strong>rich<br />
August Erhards Aufsatz „Ideen zur wissenschaftlichen Begründung<br />
und Gestaltung des Archivwesen“ (1834), der von ihm<br />
widersprüchlich gedeutet wird. Wenn Erhard davon spricht,<br />
<strong>Archive</strong> hätten „bibliotheksnah“ zu se<strong>in</strong>, so verweist er damit auf<br />
ihre Bedeutung sowohl für die Forschung als auch für die noch<br />
nicht abgeschlossene Registratur. Dies wird von Ernst auch<br />
anerkannt. Wenig später wird jedoch behauptet, Erhards Vorhaben<br />
habe dar<strong>in</strong> bestanden, <strong>Archive</strong> aus der Verwaltung herauszulösen,<br />
um sie ganz zu historischen Instituten zu machen. Dies<br />
nutzt Ernst dann für e<strong>in</strong> Plädoyer für die Registratur als Aufzeichnungssystem,<br />
worunter die Theorie elektronischer Medien<br />
den Zwischen- im Unterschied zum Arbeitsspeicher verstehe, e<strong>in</strong><br />
Aufschreibsystem das grundlegend von der „narratio rerum<br />
gestrum“ differiere.<br />
Das Pert<strong>in</strong>enzpr<strong>in</strong>zip ist ihm unlieb und Napoleon gilt ihm als<br />
die große archiv- und mediengeschichtliche Katastrophe, <strong>in</strong>dem<br />
das französische Pr<strong>in</strong>zip der „fonds“ eben jenes Pr<strong>in</strong>zip e<strong>in</strong>führte,<br />
welches zu sehr der historischen Forschung <strong>in</strong> die Hände<br />
gearbeitet habe.<br />
Damit wird auch deutlich, woh<strong>in</strong> die Systemtheorie – ob nun<br />
unfreiwillig oder nichts weniger als das – tendiert: zu e<strong>in</strong>er quasi<br />
metaphysischen Setzung ungebrochener Vollständigkeit und<br />
gesicherter Ewigkeit. Dem entspricht die unbändige Furcht vor<br />
dem Vergessenwerden, dem Verlust, vor Verfall und Tod – und das<br />
mechanistische Vorgehen gegen diesen. Vergessen und Tod s<strong>in</strong>d<br />
nicht mehr zu fürchten, sie werden (verme<strong>in</strong>tlich) abgeschafft,<br />
denn alles ist ja da, vollständig, friedfertig und selbstgenügsam<br />
gespeichert. Das sche<strong>in</strong>t nicht sowohl technizistisch als auch<br />
harmonistisch gedacht. Verdrängt wird mit dieser Theorie des<br />
kulturellen Gedächtnisses die traumatische Erfahrung, <strong>in</strong> der die<br />
kulturellen Aneignungen der Welt stets ihren Ursprung haben.<br />
Und ist Verwaltung, wie es e<strong>in</strong>mal bei Ernst heißt, wirklich<br />
resistent gegenüber kulturemphatischem Deutungswillen? E<strong>in</strong><br />
mathematisch-abstrakt verstandenes Aufzeichnungssystem, das<br />
Ernst <strong>in</strong> der Registratur gegenüber dem Archiv zu sehen angibt,