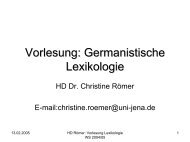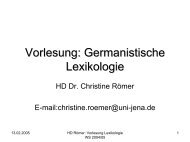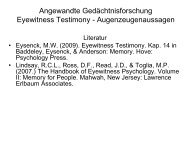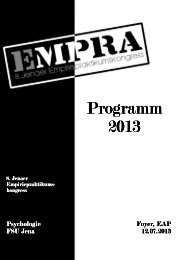Hegel und die analytische Philosophie - Friedrich-Schiller ...
Hegel und die analytische Philosophie - Friedrich-Schiller ...
Hegel und die analytische Philosophie - Friedrich-Schiller ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
44<br />
ich es für angebracht halte, sie als "<strong>die</strong> linguistische Position" zu bezeichnen; sie ist jedenfalls in<br />
meinen Augen <strong>die</strong> allein haltbare <strong>und</strong> richtige Version. (Wenn ich auch sie nachher einer Kritik<br />
unterziehen werde, so nicht einer linguistischen Kritik.)<br />
aa. Die begriffliche Konturiertheit <strong>und</strong> Bestimmtheit der Gegenstände<br />
Für <strong>die</strong>se Position gibt es ein unzureichendes <strong>und</strong> ein zureichendes Argument. Das<br />
unzureichende besteht in der Feststellung, daß wir über alles, worüber wir sprechen, nur mittels<br />
der Sprache sprechen können. So richtig das ist, ist es doch nur eine Trivialität, <strong>die</strong> keine<br />
weitergehenden Schlüsse verstattet, beispielsweise nicht den, daß <strong>die</strong> Gegenstände, über <strong>die</strong> wir<br />
sprechen, selbst wesentlich sprachlich bestimmt seien. Dieses erste Argument bewegt sich noch<br />
ganz auf der Ebene der commonsensualistischen Sprachauffassung, wonach wir über<br />
Gegenstände sprechen, <strong>die</strong> an sich unabhängig von dem, was wir über sie sagen, so sind, wie sie<br />
sind. Seine linguistische Akzentuierung, <strong>die</strong> es von anderen Formen des common sense<br />
unterscheidet, besteht nur darin, darauf hinzuweisen, daß unsere Aussagen über <strong>die</strong>se<br />
Gegenstände sprachlichen Sinnbedingungen unterliegen <strong>und</strong> also an <strong>die</strong>sen zu prüfen sind <strong>und</strong><br />
nur dann, wenn sie <strong>die</strong>sen genügen, korrekt sein können.<br />
Das andere, das zureichende Argument hingegen erklärt, daß Gegenstände jeglicher Art<br />
sprachlich konturiert sein müssen. Wir können uns auf Gegenstände nur sprachlich beziehen.<br />
Und das tun wir mittels Begriffen. Daher unterliegt der Zuschnitt von Gegenständen (welcher Art<br />
auch immer) begrifflichen Konturierungsbedingungen. Dies ergibt sich, genauer gefaßt, unter<br />
zwei Aspekten: dem unserer Gegenstandsbegriffe <strong>und</strong> dem unserer Auffassung einzelner<br />
Gegenstände. Zum ersten: Welche Arten von Gegenständen wir auch immer konzipieren mögen<br />
(natürliche, fiktive, lebensweltliche, unbekannte usw. Gegenstandsarten), <strong>die</strong> Begriffe davon sind<br />
jeweils durch das begriffliche Netz konturiert, mittels dessen wir <strong>die</strong>se Arten konzipieren.<br />
Zweitens hat der Umstand, daß wir einzelne Gegenstände jeweils im Licht unserer allgemeinen<br />
Begriffe von Gegenständen bestimmen, zur Folge, daß <strong>die</strong>se Gegenstände eben <strong>die</strong> begrifflichen<br />
Bestimmungen besitzen müssen, <strong>die</strong> durch den jeweiligen Gegenstandsbegriff bezeichnet sind.<br />
Anders als im Licht solcher Begriffe können Gegenstände gar nicht auftauchen oder zum Thema<br />
werden. Infolgedessen sind <strong>die</strong> Gegenstände, auf <strong>die</strong> wir uns beziehen, notwendig sprachlich<br />
bzw. begrifflich konturiert. Diese Konturiertheit (von Gegenständen welchen Typs auch immer)<br />
ist völlig unumgänglich - wollte man von Gegenständen irgendeines anderen Typs sprechen,<br />
könnte man <strong>die</strong>s erneut nur im Duktus einer bestimmten sprachlich-begrifflichen Konturierung<br />
tun.<br />
Ich habe zuletzt von sprachlicher bzw. begrifflicher Konturierung gesprochen. Es ist<br />
bemerkenswert, daß <strong>die</strong> Rede von `begrifflicher' Konturierung plausibler ist als <strong>die</strong> von<br />
`sprachlicher' Konturierung. Während wir uns gegenüber der These, Gegenstände seien<br />
sprachlicher Natur, unbehaglich fühlen - <strong>die</strong> Gegenstände sprechen doch nicht! -, leuchtet <strong>die</strong><br />
These, daß <strong>die</strong> Gegenstände begrifflicher Natur sind, ungleich mehr ein. Denn wir verstehen<br />
Gegenstände unweigerlich als irgendwie bestimmte. Bestimmtheit aber ist nur ein anderer Name<br />
für begriffliche Struktur. Wir müssen zwar nicht meinen, daß wir in jedem Fall schon <strong>die</strong> den<br />
Gegenständen adäquaten Begriffe besäßen, aber wir meinen unweigerlich, daß <strong>die</strong> Gegenstände<br />
nicht einfach `irgendwie', sondern von bestimmter Art sind, daß sie von sich her eine<br />
Bestimmtheit <strong>die</strong>ser oder jener Art aufweisen. Und <strong>die</strong>se Bestimmtheit betrachten wir als