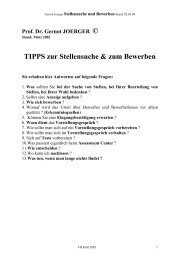2. Klassische Kommunikationsmodelle und ... - Hochschule Kehl
2. Klassische Kommunikationsmodelle und ... - Hochschule Kehl
2. Klassische Kommunikationsmodelle und ... - Hochschule Kehl
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Hochschule</strong> <strong>Kehl</strong> - Vorlesung Psychologie Gr<strong>und</strong>studium<br />
Beim Empfänger wird im nächsten Schritt die übermittelte Zeichensequenz (Botschaft/Nachricht)<br />
aufgr<strong>und</strong> des eigenen Zeichenvorrates „dekodiert“ <strong>und</strong> in<br />
Bedeutungssequenzen übersetzt, die vom Empfänger wiederum als Botschaften des Senders<br />
verstanden / interpretiert werden können. Indem der Empfänger nun auf diese so<br />
verstandene Bedeutung reagiert, wird er selbst zum Sender, der Andere zum Empfänger<br />
Für die weite Verbreitung dieses Modells können verschiedene Gründe vermutet werden:<br />
Die Zerlegung zwischenmenschlicher Kommunikation in Sender-Empfänger - Einheiten <strong>und</strong><br />
die Darstellung zwischenmenschlicher Kommunikation als wechselseitiger Nachrichtenübermittlung<br />
auf der Sachebene kommt wohl der subjektiven Alltagstheorie<br />
zwischenmenschlicher Kommunikation im deutschen Sprachraum recht nahe. Auch der begriffliche<br />
Notstand im Deutschen, dass es für die umfassende Rolle von Personen in der<br />
Kommunikation kein treffendes deutsches Wort zu geben scheint, lässt auch Fachleute zu<br />
den Begriffen „Sender“ <strong>und</strong> „Empfänger“ greifen, wobei oft unklar bleibt, inwieweit im<br />
Gebrauch der Begriffe das ganze Modell impliziert sein soll – wenn beispielsweise die Rede<br />
ist von der „Beziehung“ zwischen Sender <strong>und</strong> Empfänger.....<br />
Die Übersetzung von Sender <strong>und</strong> Empfänger in die vermenschlichten Begriffspaare Sprecher<br />
<strong>und</strong> Hörer ist insofern unbefriedigend, als hier nur auf die akustische Ebene der<br />
Kommunikation Bezug genommen wird – ein deutscher Begriff, der alle Ebenen zwischenmenschlicher<br />
Kommunikation umgreift, ist offensichtlich nicht vorhanden. Das gilt ebenso für<br />
die „Doppelfunktion“ einer Person im Kommunikationsgeschehen als „Sender/Empfänger“<br />
oder „Sprecher/Hörer“ gleichzeitig (Hermann, 1985, 8ff)<br />
Schließlich sei noch vermerkt, dass der Gebrauch analytischer Einheiten von Sender-<br />
Empfänger-Abfolgen die Reduktion komplexer Prozesse zwischenmenschlicher Kommunikation<br />
auf untersuchbare <strong>und</strong> beschreibbare Untersuchungsgegenstände ermöglicht. Damit<br />
gehen aber wichtige Aspekte <strong>und</strong> Fragestellungen zwischenmenschlicher Kommunikation<br />
verloren, die auf Gleichzeitigkeit <strong>und</strong> Wechselseitigkeit der Kommunikationsprozesse beruhen.<br />
Einige Darstellungen hinterlegen wohl deshalb auch das kybernetische Modell der<br />
Rückkoppelung zur Kennzeichnung der Austauschbeziehung zwischen Sender <strong>und</strong> Empfänger,<br />
um damit die Wechselseitigkeit der Beeinflussung hervorzuheben (so beispielsweise<br />
Thomas, 1991, 60)<br />
<strong>2.</strong>1.3 Die Anwendung des Modells auf Interkulturelle Kommunikation<br />
Was hilft dieses Modell nun bei der Analyse <strong>und</strong> Verbesserung zwischenmenschlicher<br />
Kommunikation? Diese Frage soll am Beispiel interkultureller Kommunikation erörtert werden<br />
– genauer also: Was kann das Sender-Empfänger-Modell dazu beitragen, bekannte Probleme<br />
interkultureller Kommunikation zu begreifen oder überhaupt erst zu identifizieren?<br />
<strong>2.</strong>1.3.1 Enkodieren <strong>und</strong> Dekodieren zwischen den Kulturen<br />
Greifen wir zunächst die Prozesse von Enkodierung <strong>und</strong> Dekodierung heraus:<br />
Was enkodieren wir eigentlich, wenn wir beispielsweise „etwas zur Sprache bringen“?<br />
Die Frage nach diesem Etwas, das wir als kommunizierende Menschen ständig in Symbole<br />
oder Signale „enkodieren“, ist ein großes Thema in Philosophie, Psychologie, Sprachwissenschaft<br />
– letztlich in allen Disziplinen, die sich mit menschlichem Erleben, Bewusstsein,<br />
Denken, Sprache usw. beschäftigen. Auf dieses Vorbegriffliche, Vorsprachliche im menschlichen<br />
Lebensprozess stoßen wir im Alltag ganz praktisch, wenn wir Worte oder Ausdruck<br />
suchen <strong>und</strong> nicht (gleich) finden. Wenn wir beispielsweise einen Brief oder ein Gedicht<br />
schreiben wollen – <strong>und</strong> Blatt für Blatt wieder zerreißen, weil wir nicht „die richtigen Worte“<br />
finden. Woran messen wir aber, was „richtig“ ist, wenn wir noch gar nicht „wissen, was wir<br />
schreiben wollen“? Im Alltag umschreiben wir diesen inneren Bezugspunkt oft mit „Ahnung“,<br />
© 2003, 2006 HJ Feuerstein – Kommunikation <strong>und</strong> Verwaltungshandeln (Auszug)<br />
10