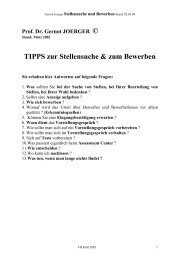2. Klassische Kommunikationsmodelle und ... - Hochschule Kehl
2. Klassische Kommunikationsmodelle und ... - Hochschule Kehl
2. Klassische Kommunikationsmodelle und ... - Hochschule Kehl
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Hochschule</strong> <strong>Kehl</strong> - Vorlesung Psychologie Gr<strong>und</strong>studium<br />
<strong>2.</strong>5 Weitere Modelle zwischenmenschlicher Kommunikation<br />
Ich schließe an dieser Stelle die Erörterung bekannter <strong>Kommunikationsmodelle</strong> unter dem<br />
Gesichtpunkt Interkulturelle Kommunikation ab. Erwähnt sei noch das populäre Kommunikationsmodell<br />
der „Vier Ohren / Vier Schnäbel“ auf Sender <strong>und</strong> Empfängerseite, das von<br />
Friedemann Schulz von Thun entwickelt wurde (1981, 1998, auf dem Hintergr<strong>und</strong> des Organonmodells<br />
von Karl Bühler 1978, 1999). Zu den bekannteren Theorien<br />
zwischenmenschlicher Kommunikation gehören die Transaktionsanalyse (TA) von Eric Berne<br />
<strong>und</strong> die Themenzentrierte Interaktion (TZI) von Ruth Cohn. Diese Modelle stellen<br />
unterschiedliche Aspekte zwischenmenschlicher Kommunikation heraus, um damit Regeln,<br />
Interventionen <strong>und</strong> Zielbereiche bei gestörter oder erschwerter Kommunikation zu begründen.<br />
Sie können in gleicher Weise wie oben beschrieben auf interkulturelle Situationen<br />
angewandt werden.<br />
<strong>2.</strong>6 Interkulturelle Kommunikation als Stress- Situation<br />
Stresserleben der Beteiligten spielt häufig eine zentrale Rolle für die Entwicklung gestörter<br />
Kommunikation Deshalb seien noch kurz einige Ergänzungen zum Zusammenhang von<br />
Stress <strong>und</strong> Interkulturelle Kommunikation eingefügt:<br />
Die meisten Ansätze sind sich darin einig, dass Stress auf der körperlichen Ebene mit erhöhter<br />
Spannung einhergeht – aber auch Lähmung, Apathie können als Stressreaktion<br />
verstanden werden. Bei länger anhaltendem Stress sind psychosomatische Erkrankungen<br />
die Folge. Auf der Gefühls- <strong>und</strong> Verhaltensebene werden drei Reaktionsarten unterschieden:<br />
Angriffsverhalten mit Wut als typischer Emotion, Fluchtverhalten mit Furcht als<br />
Kennzeichen, oder, wenn keine äußere Reaktion möglich erscheint, der Versuch der inneren<br />
Bewältigung mit Angst als Begleitgefühl.<br />
Hans Selye, Begründer der Stressforschung, betont zunächst die lebenserhaltende Funktion<br />
von Stress als organismische Reaktion auf Anforderungen. Die damit zusammenhängende<br />
generelle Notwendigkeit zur Anpassung <strong>und</strong> Veränderung von Lebensgewohnheiten ist ein<br />
Aspekt, der sicherlich auf die Situation „im Ausland“ anwendbar ist. Auch die Unterscheidung<br />
von Eustress als positiv erlebter Stresswirkung im Sinne „reizvoller Situation“ <strong>und</strong> Distress<br />
als negativ wirkender Überbeanspruchung zeigt auf die Doppelgesichtigkeit Interkultureller<br />
Begegnung „zwischen Reiz <strong>und</strong> Überforderung“. Als auslösende Stressoren wirken subjektiv<br />
wahrgenommene Unbekanntheit, Unsicherheit, Komplexität, Über- <strong>und</strong> Unterforderung einer<br />
Situation. Interkulturelle Situationen enthalten solche Stressoren regelmäßig. Unklarheit <strong>und</strong><br />
Komplexität kennzeichnen Situationen, in denen nicht klar ist „was gespielt wird“. Durch die<br />
vielfältigen Unterschiede zwischen der eigenen <strong>und</strong> der Kultur des Gesprächspartners entstehen<br />
Gefühle von Überforderung, die sich häufig in genervtem Angriff, Rückzug oder<br />
resignativer Lähmung zeigen.<br />
Da es in der Situation der interkulturellen Begegnung für Beteiligte häufig nicht möglich ist,<br />
die Situation zu klären, besteht eine wichtige Fähigkeit darin, Unklarheit <strong>und</strong> Komplexität<br />
aushalten zu können, in der Situation zu bleiben <strong>und</strong> mit nicht restlos aufklärbaren Unsicherheiten<br />
kompetent umzugehen. So sehen auch Brislin <strong>und</strong> Mitarbeiter in Interkulturellem<br />
Stress <strong>und</strong> geeigneten Stressbewältigungsmethoden ein wesentliches Thema interkultureller<br />
Trainings (Brislin & Yoshida, 1994, 10f. <strong>und</strong> 72ff.).<br />
© 2003, 2006 HJ Feuerstein – Kommunikation <strong>und</strong> Verwaltungshandeln (Auszug)<br />
24