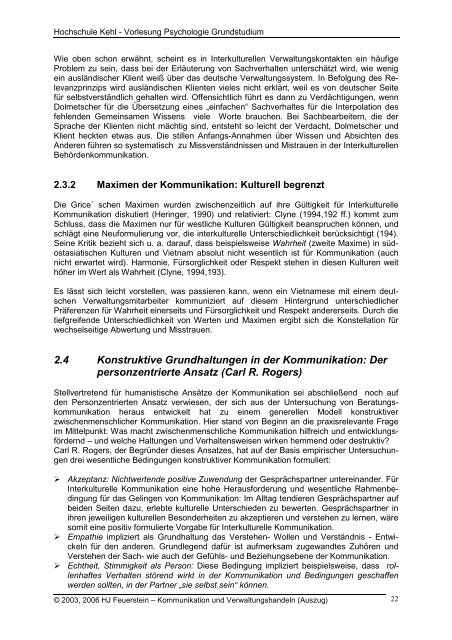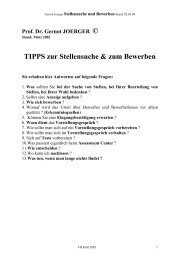2. Klassische Kommunikationsmodelle und ... - Hochschule Kehl
2. Klassische Kommunikationsmodelle und ... - Hochschule Kehl
2. Klassische Kommunikationsmodelle und ... - Hochschule Kehl
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Hochschule</strong> <strong>Kehl</strong> - Vorlesung Psychologie Gr<strong>und</strong>studium<br />
Wie oben schon erwähnt, scheint es in Interkulturellen Verwaltungskontakten ein häufige<br />
Problem zu sein, dass bei der Erläuterung von Sachverhalten unterschätzt wird, wie wenig<br />
ein ausländischer Klient weiß über das deutsche Verwaltungssystem. In Befolgung des Relevanzprinzips<br />
wird ausländischen Klienten vieles nicht erklärt, weil es von deutscher Seite<br />
für selbstverständlich gehalten wird. Offensichtlich führt es dann zu Verdächtigungen, wenn<br />
Dolmetscher für die Übersetzung eines „einfachen“ Sachverhaltes für die Interpolation des<br />
fehlenden Gemeinsamen Wissens viele Worte brauchen. Bei Sachbearbeitern, die der<br />
Sprache der Klienten nicht mächtig sind, entsteht so leicht der Verdacht, Dolmetscher <strong>und</strong><br />
Klient heckten etwas aus. Die stillen Anfangs-Annahmen über Wissen <strong>und</strong> Absichten des<br />
Anderen führen so systematisch zu Missverständnissen <strong>und</strong> Mistrauen in der Interkulturellen<br />
Behördenkommunikation.<br />
<strong>2.</strong>3.2 Maximen der Kommunikation: Kulturell begrenzt<br />
Die Grice´ schen Maximen wurden zwischenzeitlich auf ihre Gültigkeit für Interkulturelle<br />
Kommunikation diskutiert (Heringer, 1990) <strong>und</strong> relativiert: Clyne (1994,192 ff.) kommt zum<br />
Schluss, dass die Maximen nur für westliche Kulturen Gültigkeit beanspruchen können, <strong>und</strong><br />
schlägt eine Neuformulierung vor, die interkulturelle Unterschiedlichkeit berücksichtigt (194).<br />
Seine Kritik bezieht sich u. a. darauf, dass beispielsweise Wahrheit (zweite Maxime) in südostasiatischen<br />
Kulturen <strong>und</strong> Vietnam absolut nicht wesentlich ist für Kommunikation (auch<br />
nicht erwartet wird). Harmonie, Fürsorglichkeit oder Respekt stehen in diesen Kulturen weit<br />
höher im Wert als Wahrheit (Clyne, 1994,193).<br />
Es lässt sich leicht vorstellen, was passieren kann, wenn ein Vietnamese mit einem deutschen<br />
Verwaltungsmitarbeiter kommuniziert auf diesem Hintergr<strong>und</strong> unterschiedlicher<br />
Präferenzen für Wahrheit einerseits <strong>und</strong> Fürsorglichkeit <strong>und</strong> Respekt andererseits. Durch die<br />
tiefgreifende Unterschiedlichkeit von Werten <strong>und</strong> Maximen ergibt sich die Konstellation für<br />
wechselseitige Abwertung <strong>und</strong> Misstrauen.<br />
<strong>2.</strong>4 Konstruktive Gr<strong>und</strong>haltungen in der Kommunikation: Der<br />
personzentrierte Ansatz (Carl R. Rogers)<br />
Stellvertretend für humanistische Ansätze der Kommunikation sei abschließend noch auf<br />
den Personzentrierten Ansatz verwiesen, der sich aus der Untersuchung von Beratungskommunikation<br />
heraus entwickelt hat zu einem generellen Modell konstruktiver<br />
zwischenmenschlicher Kommunikation. Hier stand von Beginn an die praxisrelevante Frage<br />
im Mittelpunkt: Was macht zwischenmenschliche Kommunikation hilfreich <strong>und</strong> entwicklungsfördernd<br />
– <strong>und</strong> welche Haltungen <strong>und</strong> Verhaltensweisen wirken hemmend oder destruktiv?<br />
Carl R. Rogers, der Begründer dieses Ansatzes, hat auf der Basis empirischer Untersuchungen<br />
drei wesentliche Bedingungen konstruktiver Kommunikation formuliert:<br />
� Akzeptanz: Nichtwertende positive Zuwendung der Gesprächspartner untereinander. Für<br />
Interkulturelle Kommunikation eine hohe Herausforderung <strong>und</strong> wesentliche Rahmenbedingung<br />
für das Gelingen von Kommunikation: Im Alltag tendieren Gesprächspartner auf<br />
beiden Seiten dazu, erlebte kulturelle Unterschieden zu bewerten. Gesprächspartner in<br />
ihren jeweiligen kulturellen Besonderheiten zu akzeptieren <strong>und</strong> verstehen zu lernen, wäre<br />
somit eine positiv formulierte Vorgabe für Interkulturelle Kommunikation.<br />
� Empathie impliziert als Gr<strong>und</strong>haltung das Verstehen- Wollen <strong>und</strong> Verständnis - Entwickeln<br />
für den anderen. Gr<strong>und</strong>legend dafür ist aufmerksam zugewandtes Zuhören <strong>und</strong><br />
Verstehen der Sach- wie auch der Gefühls- <strong>und</strong> Beziehungsebene der Kommunikation.<br />
� Echtheit, Stimmigkeit als Person: Diese Bedingung impliziert beispielsweise, dass rollenhaftes<br />
Verhalten störend wirkt in der Kommunikation <strong>und</strong> Bedingungen geschaffen<br />
werden sollten, in der Partner „sie selbst sein“ können.<br />
© 2003, 2006 HJ Feuerstein – Kommunikation <strong>und</strong> Verwaltungshandeln (Auszug)<br />
22