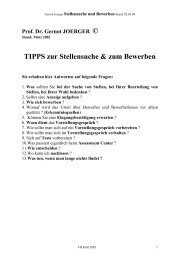2. Klassische Kommunikationsmodelle und ... - Hochschule Kehl
2. Klassische Kommunikationsmodelle und ... - Hochschule Kehl
2. Klassische Kommunikationsmodelle und ... - Hochschule Kehl
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Hochschule</strong> <strong>Kehl</strong> - Vorlesung Psychologie Gr<strong>und</strong>studium<br />
sensibel zu sein. Wenn nun eine britische Frau dem Drängen zum Küssen nachgab, bedeutete<br />
dies für sie nach ihren kulturellen Normen, dass sie dann auch zum nächsten Schritt<br />
bereit sein würde – diese „schnelle Bereitwilligkeit“ zum Sex wiederum verstörte die amerikanischen<br />
Männer, die britische Frauen aufgr<strong>und</strong> dieser Erfahrung als „leicht zu haben“<br />
bewerteten. Das Beispiel weist darauf hin, dass unsere Handlungen nicht nur für sich stehen,<br />
sondern im jeweiligen Kontext der kulturell normierten Abfolge einer Handlung unterschiedliche<br />
Bedeutung zugeschrieben wird – wenn diese zwischen den Kommunikationspartnern<br />
nicht übereinstimmen, sind Missverständnisse programmiert.<br />
Eine andere Erscheinung lässt sich ebenfalls unter dieser Rubrik einführen: Nicht selten<br />
kommt es vor, dass ausländische Besucher von Behörden recht gut Deutsch sprechen, aber<br />
deutsche Gesprächspartner verstehen sie dennoch nicht - sie wissen nicht, „worauf diese<br />
Person hinauswill“. Dieses Problem wird oft durch kulturell unterschiedliche Diskursstile bedingt:<br />
Westliche Kulturen stellen beispielweise das Wichtige an den Anfang, asiatische<br />
Kulturen bauen ihre Rede so auf, dass das Wichtige später kommt (Scollon & Wong Scollon,<br />
1995, 2). Obwohl die Partner also beide eine gemeinsame Sprache sprechen, kommen sie<br />
an manchen Stellen nicht zum Punkt. Für unser Verstehen spielt es offensichtlich eine zentrale<br />
Rolle, an welcher Stelle in der Rede etwas gesagt wird.<br />
<strong>2.</strong><strong>2.</strong><strong>2.</strong>4 Kulturelle Unterschiede in der verbalen <strong>und</strong> nonverbalen Kommunikation<br />
Das vierte Axiom zum Verhältnis von digitalen <strong>und</strong> analogen Modalitäten der Kommunikation<br />
berührt die Bedeutung <strong>und</strong> das Zusammenspiel von verbaler <strong>und</strong> nonverbaler Kommunikation,<br />
auf das ich schon kurz im Zusammenhang des Sender – Empfänger – Modells<br />
eingegangen bin. Mit dem Axiom wird die Bedeutsamkeit, gleichzeitig die Vieldeutigkeit der<br />
nonverbalen Ebene für die Kommunikation betont - insbesondere für die Beziehungsebene.<br />
Nehmen wir wieder das Beispiel Lächeln – wenn jemand lächelt in unserer Gegenwart kann<br />
das als fre<strong>und</strong>lich, falsch, verlegen, verlogen, triumphierend, wissend, amüsiert, ironisch,.......zählen<br />
- je nach Beziehung <strong>und</strong> unseren Annahmen über den Partner. Betrachtet<br />
man interkulturelle Situationen unter diesem Gesichtspunkt, so lässt sich die Bedeutsamkeit<br />
dieses Aspektes für die Entstehung interkultureller Missverständnisse wiederum deutlich<br />
herausstellen: Gestik, Mimik, Bewegungen, der Ausdruck von Gefühlen sind in vielen Gesellschaften<br />
spezifisch ausgeprägt <strong>und</strong> in traditionellen Kulturen stark normiert, wenn es um<br />
den Ausdruck von Gefühlen geht: Auf die Bedeutung des Lächelns in asiatischen Kulturen<br />
habe ich schon hingewiesen. Andersartige Beispiele finden sich in mediterranen Gesellschaften:<br />
Bei bestimmten Ereignissen wie Tod eines Verwandten besteht die starke<br />
Erwartung, dass Trauer öffentlich ausgedrückt wird. Wir kennen in der deutschen Kultur z.B.<br />
auch die starke Erwartung sichtbarer Zeichen von Freude bei der Entgegennahme eines Geschenkes;<br />
wenn ein Geschenk nicht mit dem Ausdruck von freudiger Dankbarkeit „quittiert“<br />
wird, kann das zu stillschweigender Enttäuschung beim Schenkenden führen <strong>und</strong> die Beziehung<br />
nachhaltig belasten. Die Koordination von verbalen <strong>und</strong> nichtverbalen Ebenen kann<br />
also ebenfalls als stark kulturell geregelt beschrieben werden.<br />
Die Frage der Übersetzbarkeit von der analogen in die digitale Modalität erweist sich als kritische<br />
Stelle in der Kommunikation. (Watzlawick, 1969, 96). Was darf in einer Kultur verbal<br />
expliziert werden, was muss nonverbal bleiben? Es liegt nahe für Deutsche, wenn man sich<br />
nicht sicher ist, was die andere nonverbal eigentlich „sagen“ will, einfach zu fragen: „Wie<br />
meinen Sie das jetzt?“ „Ist Ihnen das nicht recht?“ Dies kann aber interkulturell als schwerer<br />
Normverstoß erlebt werden: Kulturen lassen sich einordnen auf einer bipolaren Dimension<br />
„implizit“ – „explizit“. Deutsche werden deutlich auf der Seite „explizit“ eingestuft, was ihnen<br />
wiederum in manchen Kulturen den Ruf einträgt, indezent, derb oder unhöflich zu sein. Bemerkenswert<br />
erscheint, dass der in deutschen Kommunikationstrainings so beliebte Weg<br />
„Metakommunikation“ als Lösung für Kommunikationsprobleme im interkulturellen Kontext<br />
besonders riskant erscheint: Wird schon für intrakulturelle Kommunikation übersehen, dass<br />
„Reden über die Kommunikation“ denselben Kommunikationsproblemen unterliegt <strong>und</strong> „Metakommunikation“<br />
genau so scheitern kann wie „Kommunikation“, so ist bei Interkultureller<br />
© 2003, 2006 HJ Feuerstein – Kommunikation <strong>und</strong> Verwaltungshandeln (Auszug)<br />
18