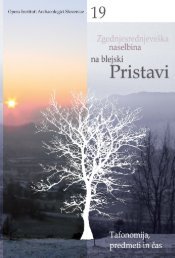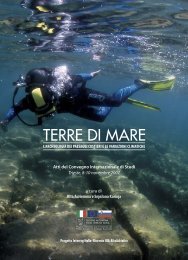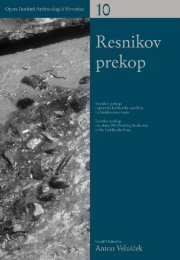Andrej Pleterski
Andrej Pleterski
Andrej Pleterski
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
zwischen glanegg vnd dem spital ze vnser frowen kirchen (Grafenauer 1952, 173). Andere Steine<br />
werden in der Quelle nicht erwähnt.<br />
Man führt ihn von dem Platz, wo man ihn auserkoren und umgekleidet habt, dorthin, wo der Stein<br />
liegt. Das beweist, daß es sich um zwei verschiedene Schauplätze handelte. Der erste befand sich<br />
höchstwahrscheinlich auf der Karnburg - Krnski Grad. Über den anderen wurde in der Fachwelt noch<br />
nicht ernsthaft diskutiert; alle sehen ihn, ausgenommen von Jakscha, ebenfalls in der Karnburg -<br />
Krnski Grad. Bislang war es nämlich selbstverständlich, daß es sich um Glanegg der Quelle handelte,<br />
um Glanegg im oberen Glantal, daß von Maria Saal - Gospa Sveta gute 11 km Luftlinie entfernt ist.<br />
Von Jakschas Ansicht, die sich nur auf die Interpretation der Zeremonie stützt, daß der Stein den<br />
Herzogstuhl darstellt (Jaksch 1927, 15), wurde von Grafenauer überzeugend widerlegt. Die<br />
Diskussion drehte sich damals nämlich im wesentlichen um die Frage, ob mit stain der Fürstenstein<br />
oder der Herzogstuhl gemeint war. Grafenauer gab aber auch eine topographische Begründung.<br />
Seines Ermessens ist eine Lokalisierung des Herzogstuhls zwischen Glanegg und Maria Saal - Gospa<br />
Sveta unmöglich. Dieser Weg führt nämlich durch die Ortschaften Maria Feicht, St. Peter am Bichl -<br />
Št. Peter na Gori und die Karnburg - Krnski Grad, also am Fürstenstein und nicht am Herzogstuhl<br />
vorbei, der mehr als einen Kilometer nördlich von diesem Weg liegt. Ginge es um den Herzogstuhl,<br />
würde man eine ebenso eindeutige Lokalisierung dieser Art ansetzen, und zwar die Straße, die von<br />
St. Veit - Št. Vid nach Süden führt, an der er unmittelbar liegt (Grafenauer 1952, 242 f). Im Lichte<br />
der Artefakt- und topographischen Analyse, die wir oben durchgeführt haben, büßt Grafenauers<br />
topographische Analyse einige Anhaltspunkte ein. Wenn der Fürstenstein auch dort gestanden hat<br />
wie der Herzogstuhl, dann hat ihn der Weg (heutiges) Glanegg - Maria Saal - Gospa Sveta ebenfalls<br />
um einen guten Kilometer verfehlt. Und wenn es die Straße nach St. Veit - Št. Vid damals neben den<br />
Steinen noch nicht gegeben hat, weil sie gute 250 m weiter östlich verlief, muß man die Quelle<br />
offensichtlich anders verstehen. Die Ausgangsfrage lautet nicht, welchen Stein der stain darstellt,<br />
sondern wo Glanegg liegt.<br />
Der unbekannte Autor hätte, wenn der stain wirklich auf der Karnburg - Krnski Grad gestanden<br />
hätte, es auch ausdrücklich sagen können, denn es handelte sich um einen gutbekannten Ort. Aber<br />
nein. Den Ort des Steines bestimmte er so, daß er ihn auf die Linie zwischen zwei Punkte setzte. Das<br />
spricht schon an und für sich für den Umstand, daß es in der Nähe des Steins keinen ausgeprägten<br />
Anhaltspunkt (Gebäude, Berg, Brücke) gegeben hat. Einen Anhaltspunkt bietet nur das Hospiz bei<br />
Maria Saal - Gospa Sveta, das nur in dieser Quelle erwähnt wird. Gewiß war er von der Kirche nicht<br />
weit entfernt. Der Autor war hier so genau, daß er sich nicht für die sicherlich bekanntere Kirche<br />
selbst entschieden hat, sondern für einen möglichst präzisen Punkt. Konnte er demnach als zweiten<br />
Punkt das durchaus unbestimmte, 11 km entfernte Glanegg gewählt haben, das man von dem ersten<br />
Punkt überhaupt nicht sehen kann? Das erscheint mir unwahrscheinlich. Keine andere Quelle aus dem<br />
11. Jh. erwähnt dieses Glanegg. Zum erstenmal erwähnt wird es erst 1134 (Kranzmayer 1958, 82). -<br />
Glan-egg bedeutet eine Anhöhe an der Glan - Glana. Und diese hat der Autor auch gemeint, aber<br />
diejenige, die vom ersten Punkt sichtbar war, am anderen Glanufer. Von Maria Saal - Gospa Sveta<br />
aus gesehen, liegen dort nur zwei ausgeprägte Anhöhen: Ulrichsberg - Šenturška gora und<br />
Tanzenberg - Plešivec. Die erste kommt als Glanegg nicht in Frage, denn sie hieß noch 983 mons<br />
Carentanus, 1331 Chernperch, bis man dort 1485 eine kleine, dem hl. Ulrich geweihte Kirche<br />
errichtete (Kranzmayer 1958, 115, 232; Kos 1906, Št. 475). Plešivec bedeutet natürlich "plešast vrh"<br />
- kahler Gipfel - (Bezlaj 1961, 97) und nicht "plesišče" - Tanzplatz, daher ist der Name Tanzenberg<br />
ein übersetzerisches Mißverständnis. Nicht nur heute, sondern auch in der josephinischen<br />
Militärlandkarte ist der Gipfel mit Wald bewachsen, kahl ist dagegen der Kamm, wo eine<br />
gleichnamige Burg steht. Da in der zweiten Hälfte des 18. Jhs. der Waldumfang am kleinsten war,<br />
war der Gipfel sicherlich auch im 11. Jh. bewaldet. Sein ursprünglicher Name konnte demnach nicht<br />
Plešivec gewesen sein, er hätte aber durchaus Glanegg sein können. Der Name Tanzenberg tritt<br />
schon 1247 auf (Kranzmayer 1958, 219). Der Name der Burg, die tatsächlich auf einer Kahlfläche<br />
steht, wie man auf Merians Karte gut sehen kann, wurde später auch noch auf den benachbarten<br />
Gipfel übertragen, vielleicht auch deshalb, um eine Verwechslung mit der Burg Glanegg im oberen<br />
18