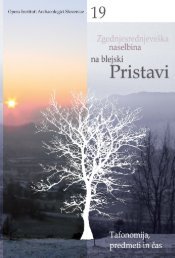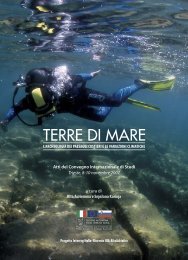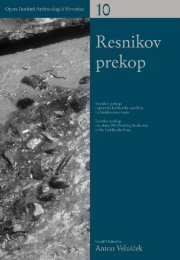Andrej Pleterski
Andrej Pleterski
Andrej Pleterski
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
König Arturs, erinnern. Sie hat einen Wagen, der von einem einbeinigen Pferd gezogen wird.<br />
Nachdem sie dreimal um den Brunnen gegangen war, brachen daraus drei Wellen hervor und<br />
verunstalteten sie, die erste ihr Bein, die zweite das Auge, die dritte eine Hand. Die Helden der<br />
Geschichten haben häufig eine Rindergestalt und es fehlt nicht an weißen Kühen mit roten Ohren.<br />
Die Schwester Boand ist Medb, die sich auch Aife nennt. Sie ist eine Kämpferin und wird von Cú<br />
Chulainn geschwängert, nachdem dieser sie besiegt hat. Alle Kämpfe verlaufen innerhalb der engsten<br />
Mitglieder der Familie, die in "Blutschande" lebt. Der Zweikampf zwischen Fraech und seinem Vater<br />
Cú Chulainn findet am Feiertag Imbolc (1. II.), dem ersten Frühlingstag, statt. Der Kampfplatz ist ein<br />
Gewässer, in das sich Fraech begibt, nachdem er sich ausgezogen hat.<br />
Wir verstehen nicht nur die Details der Temair-Zeremonie besser, sondern wir erhalten auch eine<br />
Parallele zum dreifachen Rundgang um den Stein, den der zukünftige Kärntner Herzog unternimmt.<br />
Dabei erscheint der Stein als Symbol des Brunnens, der Stein, der Wasser gibt. Dem Gang zwischen<br />
den Steinen Blocc und Bluigne entspricht der Gang zwischen den beiden römischen Meilensteinen.<br />
Der Schlag, den der Einsetzer dem zukünftigen Kärntner Herzog verleiht, ist der letzte Rest des<br />
ehemaligen Zweikampfs.<br />
Die Tasche mit der Nahrung (Käse, Brot, Imbiß) fehlt bei den irischen Beispielen. Schon<br />
Puntschart wies auf die tschechische Legende von Libuša und Premisl hin, wo Premisl auf dem Pflug<br />
sitzt und Käse hat (Puntschart 1899, 72). Banaszkiewicz (1986, 42; 40 ff) fügte sehr überzeugend<br />
die Tasche mit der Nahrung in die indoeuropäische (und noch weitere) Tradition über den Herrscher-<br />
Ernährer ein. Der Herrscher ist nämlich verantwortlich für die Nahrung und das Überleben seiner<br />
Gemeinschaft. Dabei ist hervorzuheben, daß der Bauer als Einsetzer erst sekundär in die Kärntner<br />
Zeremonie Eingang fand und deshalb in keinerlei Verbindung steht zu der Figur des Herrschers und<br />
Ackerbauers, wie es fälschlicherweise Banaszkiewicz (1986, 47) verstanden hat.<br />
Ebenso sind wir in der angeführten irischen Tradition auf keinen Hut gestoßen. Daß es sich um<br />
einen Kultgegenstand handelt, davon zeugen u. a. zahlreiche Skulpturen altslawischer Götter, wo er<br />
ihnen fest auf dem Haupt sitzt. Erwähnenswert ist vor allem das sog. Idol von Zbruč aus der<br />
südwestlichen Ukraine, wo eine Gottheit mit vier Gesichtern einen Hut trägt, in zwei Körpern<br />
hingegen noch ein Schwert, ein Pferd und ein Horn (Słupecki 1994, 216 ff, Fig. 104). Hier liegen<br />
demnach vier Elemente vor, denen wir auch in der Kärntner Zeremonie begegnen.<br />
Bedeutung der Farben und der Umkleidung. - Die Aufmerksamkeit der bisherigen Forscher war<br />
häufig sehr auf die Umkleidung in bäuerliches Gewand gelenkt, was es in der ursprünglichen<br />
Zeremonie überhaupt nicht gegeben hat. In der Zeremonie ist nicht die Kleidung wichtig, sondern das<br />
Umkleiden als Symbol des Übergangs von einer Existenzform in die andere und vor allem die Farben.<br />
In der Kärntner Zeremonie begegnen wir der weißen, schwarzen, roten und grauen Farbe, in der<br />
irischen dagegen der weißen, schwarzen, roten, grauen und grünen. Dabei ist es nicht unbedeutend,<br />
daß die Pferdebeschreibungen in den Texten des Zyklus von Ulster dafür vier Farben kennen: weiß,<br />
schwarz, grau und rot (Sayers 1994, 244 ff). Wie man schon lange weiß, bedeuten die Farben die<br />
verschiedenen Seiten der Welt. Anhand einer großen Materialfülle aus Europa, Asien und sogar<br />
Amerika hat dies Herbert Ludat (1982) bewiesen. Banaszkiewicz (1994) hat vor kurzem gezeigt, daß<br />
sich die Symbolik der Farben später auf die vier Jahreszeiten, Teile des Universums und deren<br />
Eigenschaften und schließlich auf einzelne Götter und Gesellschaftsschichten erweitert. In der<br />
Tradition Irlands und Kärntens handelt es sich offensichtlich noch um die Verwendung der Farben als<br />
Symbole der Natur und keinesfalls schon der gesellschaftlichen Funktionen im Sinne von Dumézils<br />
Erklärungen. Bezeichnenderweise gibt es in der allgemeinen Überlieferung keine einheitliche<br />
Verwendung für eine Himmelsrichtung. Daher ist eine Erklärung des Ursprungs der<br />
Farbbezeichnungen nicht überflüssig.<br />
Bel (weiß) ist abgeleitet von dem ide.*bhel- “weiß, hell” (Gluhak 1993, 130). Črn (schwarz)<br />
stammt von Wurzeln, die “schwarz, dunkel” bedeuten (Gluhak 1993, 166 f). Rdeč (rot) gehört zur<br />
selben Gruppe wie rja (Rost) und ruda (Erz), die Wurzel ist das ide. *reudh - “rot”, in verschiedenen<br />
ide. Sprachen kann es noch “Blut” und “gelb” bedeuten (Gluhak 1993, 521, 532 f; Furlan 1995a;<br />
Furlan 1995b). Siv (grau) stammt von der ide. Wurzel * (s)kei- “leuchten, scheinen, Schatten”, in<br />
42